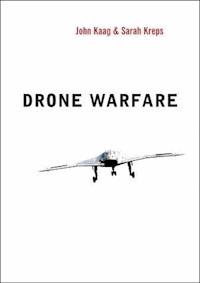11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Kaag verwebt seine philosophischen Anliegen geschickt mit den kleinen und großen Krisen des täglichen Lebens... seine Ehrlichkeit macht Mut.« – The Wall Street Journal
»Wandern mit Nietzsche« ist die Geschichte zweier philosophischer Reisen, die John Kaag unternommen hat. Die eine als junger Mann von neunzehn Jahren, die andere siebzehn Jahre später – unter gänzlich verschiedenen Umständen. Nun ist er Ehemann und Vater, seine Frau und sein Kind sind mit dabei. Kaag begibt sich in die schroffen Berge rund um Sils-Maria, wo Friedrich Nietzsche sein Monumentalwerk ›Also sprach Zarathustra‹ verfasste. Beiden Reisen ist gemein, dass sie auf der Suche nach der Weisheit im Kern von Nietzsches Philosophie unternommen wurden, und doch vollkommen verschiedene Interpretationen bereithalten. Genauer gesagt: Radikal unterschiedliche Einsichten in das Wesen des Menschen.
In »Wandern mit Nietzsche« geht es John Kaag darum, die eigene Selbstgefälligkeit zu überwinden, die Grenze zwischen Vernunft und Wahnsinn zu erkunden und das Unerreichbare in Angriff zu nehmen. Wenn John alleine oder mit seiner Familie – aber eben immer mit Nietzsche – wandert, erkennt er, dass auch das Ausrutschen lehrreich sein kann: Beim Aufstieg auf den Berg, und durch die dabei unvermeidlichen Fehltritte hat man die Chance, um mit Nietzsches Worten, »zu werden, wer man ist«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Buch
»Wandern mit Nietzsche« ist die Geschichte zweier philosophischer Reisen, die John Kaag unternommen hat. Die eine als junger Mann von neunzehn Jahren, die andere siebzehn Jahre danach – unter gänzlich verschiedenen Umständen. Nun ist er Ehemann und Vater, seine zweite Ehefrau Carol und seine Tochter Becca sind mit dabei. Kaag begibt sich in die schroffen Berge rund um Sils-Maria, wo Friedrich Nietzsche sein Monumentalwerk »Also sprach Zarathustra« verfasst hatte. Beiden Reisen ist gemein, dass sie auf der Suche nach der Weisheit im Kern von Nietzsches Philosophie unternommen wurden und doch vollkommen verschiedene Interpretationen bereithalten. Genauer gesagt: radikal unterschiedliche Einsichten in das Wesen des Menschen.
In »Wandern mit Nietzsche«, dem Nachfolgewerk zu »Das Bücherhaus« (btb 71889), geht es Kaag darum, die eigene Selbstgefälligkeit zu überwinden, die Grenze zwischen Vernunft und Wahnsinn zu erkunden und das Unerreichbare in Angriff zu nehmen. Wenn er allein oder mit seiner Familie – aber eben immer mit Nietzsche – wandert, erkennt er, dass auch das Ausrutschen lehrreich sein kann: Beim Aufstieg auf den Berg und durch die dabei unvermeidlichen Fehltritte hat man die Chance, um mit Nietzsches Worten zu sprechen, »zu werden, wer man ist«.
Autor
JOHN KAAG, Jahrgang 1981, ist Professor für Philosophie an der University of Massachusetts, Lowell. Er gilt als einer der spannendsten jungen Philosophen der USA und schreibt regelmäßig Artikel für Fachzeitschriften, aber auch für die »New York Times«, »Harper’s Magazine« und viele weitere Magazine und Zeitungen. Sein erstes populäres Sachbuch »American Philosophy. A Love Story« (dt.: »Das Bücherhaus«, btb 2018) wurde 2016 u. a. vom »National Public Radio« zum besten Buch des Jahres gekürt. Er lebt in der Nähe von Boston.
John Kaag
Wandern mit Nietzsche
Wie man wird, wer man ist
Aus dem Amerikanischen von Martin Ruben Becker
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel »Hiking With Nietzsche. On Becoming Who You Are« im Verlag Farrar, Straus and Giroux, New York.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe September 2022
Copyright der Originalausgabe © 2018 by John Kaag
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2022 by btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Published by arrangement with Farrar, Straus and Giroux, LLC, New York
Umschlaggestaltung: semper smile, München, nach einem Entwurf von Dan Mogford
Umschlagmotiv: © Dan Mogford
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
JT ∙ Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-21041-0V001www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Für Carol und Becca
Die meisten Menschen, alle jene von der Herde, haben nie die Einsamkeit geschmeckt. Sie trennten sich einmal von Vater und Mutter, aber nur, um zu einem Weibe zu kriechen und schnell in einer neuen Wärme und Zusammengehörigkeit unterzugehen. Niemals sind sie allein, niemals reden sie mit sich selbst.
Hermann Hesse, »Zarathustras Wiederkehr«, 1919
INHALT
Prolog: Bezugsberge
TEIL I
Wie die Reise begann
Dauerhafte Begleiter
Der letzte Mensch
Die ewige Wiederkehr
TEILII
Der verliebte Zarathustra
Auf dem Berg
Über Genealogie
Dekadenz und Ekel
Grand hotel Abgrund
TEILIII
Das Pferd
Siehe, der Mensch
Steppenwolf
Werde, der du bist
Epilog: Morgestraich
Zeitleiste zu Nietzsches Leben und Werk
Ausgewählte Bibliografie und Lektüreempfehlungen
Dank
Sach- und Personenregister
PROLOG: BEZUGSBERGE
So stecke Dir selber Ziele, hohe und edle Ziele und gehe an ihnen zu Grunde ! Ich weiß keinen besseren Lebenszweck als am Großen und Unmöglichen zu Grunde zu gehen: animae magnae prodigus.
Friedrich Nietzsche, Notizbuch, 1873
Ich brauchte sechs Stunden bis zum Gipfel des Piz Corvatsch. Dies war Friedrich Nietzsches Berg. Der Sommernebel, der sich am Morgen bis über die Niederungen legt, hatte sich ganz verzogen und gab den Blick frei auf die Ausläufer eineinhalb Kilometer unterhalb der Bergspitze. Ich legte auf einer abgewetzten Granitplatte eine Pause ein und betrachtete zufrieden, wie weit ich schon gekommen war. Einen Moment lang blickte ich auf den Silsersee hinunter: dort, am schimmernden Fuß des Corvatsch, ein aquamarinblauer Spiegel, der sich übers Tal erstreckte und die Landschaft verdoppelte, die ohnehin schon, wie ich dachte, unglaublich prächtig war. Dann löste sich in der Sonne auch noch die letzte Wolke auf, und im Südwesten zeigte sich nun der Piz Bernina. So weit war ich allerdings noch gar nicht gekommen. Bernina, die zweithöchste Erhebung in den Ostalpen, ist der »Bezugsberg« des Corvatsch, der Kulminationspunkt in einem Höhenzug, der von Nord nach Süd verläuft und zwei riesige Gletschertäler halbiert. Nachdem der achtundzwanzigjährige Johann Coaz 1850 als Erster seinen Gipfel erklommen hatte, schrieb er: »Ernste Gefühle ergriffen uns. Das gierige Auge schweifte über die Erde bis an den weiten Horizont und tausend und abertausend Bergspitzen lagerten sich um uns, felsig aus glänzenden Gletschermeeren emportauchend. Erstaunt und beklommen sahen wir über diese großartige Gebirgswelt hin.«
Ich war neunzehn. Bezugsberge hatten eine gewisse Macht über mich. Der Bezugsberg, ob in der Nähe aufragend oder in der Ferne winkend, ist der höchste Gipfel in einer Gebirgskette, der Punkt, von dem aus sich alle anderen geologischen Ableger herleiten. Es hatte mich in die Alpen und ins Dorf Sils-Maria gezogen, in jenes Schweizer Dorf, das Nietzsche für einen Großteil seines geistigen Lebens zu seiner Heimat erkoren hatte. Tagelang wanderte ich über die Berge, die er Ende des neunzehnten Jahrhunderts durchquert hatte, und dann, immer noch auf der Spur Nietzsches, begab ich mich auf die Suche nach einem Bezugsberg. Piz Corvatsch, mit 3451 Metern Höhe, wirft seinen Schatten über seine Ableger, die Berge, die Sils-Maria umgeben. Auf der anderen Seite des Tals: Bernina. Fünfhundert Kilometer westlich, an der französischen Grenze dieser »herrlichen Bergwelt«, steht Berninas weit entfernter Vorfahre, der Mont Blanc. Danach – in absurder Ferne, fremd geworden und allgegenwärtig – erhebt sich der Everest, beinahe doppelt so groß wie sein französischer Verwandter. Corvatsch, Bernina, Mont Blanc, Everest – der Weg zum Bezugsberg ist für die meisten Reisenden unerträglich lang.
Nietzsche war die meiste Zeit seines Lebens auf der Suche nach dem Höchsten und Tag für Tag entschlossen, sich dafür die physische und geistige Landschaft zu erschließen. »Seht«, sagt er, »ich lehre euch den Übermenschen.«
Dieser »Übermensch«, ein den gewöhnlichen Menschen übersteigendes Ideal, etwas außerordentlich Hohes, das der Einzelne erstreben kann, ist für unzählige Leser eine Inspiration geblieben. Viele Jahre lang dachte ich, die Botschaft des »Übermenschen«sei ganz klar: Du musst besser werden, dich steigern über das hinaus, was du gerade bist. Freigeist, Selbstüberwinder, Nonkonformist – Nietzsches existenzialistischer Held erschreckt und inspiriert gleichermaßen. Der »Übermensch«steht als Herausforderung da, uns anders zu entwerfen, jenseits gesellschaftlicher Konventionen und selbst verordneter Fesseln, die das moderne Leben stillschweigend regieren. Jenseits des gleichförmigen und unaufhaltsamen Marschtritts des Alltäglichen. Jenseits der Angst und Depression, die unsere täglichen Beschäftigungen begleiten. Jenseits der Furcht und der Selbstzweifel, die uns unsere Freiheit nehmen.
Nietzsches Philosophie wird manchmal als pubertär verunglimpft – als Produkt eines Größenwahnsinnigen, das vielleicht besonders gut zur Ichbezogenheit und Naivität der Jugendzeit passt, das man aber am besten überwunden haben sollte, wenn man erwachsen geworden ist. Und es ist etwas Wahres dran, viele Leser an der Schwelle zum Erwachsensein fühlten sich von diesem »guten Europäer« ermutigt. Aber bestimmte nietzscheanische Lektionen sind bei den Jüngeren noch Perlen vor die Säue. Im Laufe der Jahre bin ich sogar zu dem Schluss gelangt, dass seine Schriften im Gegenteil besonders für jene von uns geeignet sind, die allmählich die mittleren Jahre erreicht haben. Mit neunzehn, auf dem Gipfel des Corvatsch, hatte ich keine Vorstellung davon, wie öde die Welt manchmal sein konnte. Wie leicht es einem gemacht würde, in den Tälern zu bleiben, sich mit Mittelmäßigkeit zufriedenzugeben. Oder wie schwierig es sein würde, dem Leben gegenüber aufmerksam und wach zu bleiben. Mit sechsunddreißig beginne ich es überhaupt erst zu verstehen.
Ein verantwortungsbewusster Erwachsener zu sein, bedeutet oft, neben vielem anderem, sich mit einem Leben abzufinden, das sehr weit unter den Erwartungen und Möglichkeiten geblieben ist, die man einmal gehabt hatte oder in Wirklichkeit immer noch hat. Es heißt zu werden, was man immer zu vermeiden gehofft hatte. Auch in den mittleren Jahren ist der »Übermensch« noch ein bleibendes Versprechen, eine Hoffnung, dass ein Wandel immer noch möglich ist. Nietzsches »Übermensch«– ja seine Philosophie insgesamt – ist keine bloße Abstraktion. Man sollte sie nicht in einem Sessel sitzend oder auf dem Sofa in seinem gemütlichen Zuhause begreifen wollen. Man muss buchstäblich aufstehen, sich recken und strecken und losgehen. Der Wandel tritt ein, Nietzsche zufolge, in einem »plötzlichen Gefühl und Vorgefühl von Zukunft, von nahen Abenteuern, von wieder offenen Meeren, von wieder erlaubten, wieder geglaubten Zielen«.
Dieses Buch handelt von »wieder erlaubten Zielen«, die man sich immer noch erträumt, es handelt davon, wie man mit Nietzsche hinüber ins Erwachsenenleben wandert. Als ich das erste Mal den Corvatsch bestieg, dachte ich, das einzige Ziel des Bergsteigens sei, über die Wolken und ins Freie zu kommen, aber im Laufe der Jahre, in denen mein Haar allmählich ins Graue changiert, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass dies wirklich nicht das einzige Ziel des Wanderns oder auch des Lebens sein kann. Es stimmt schon, je höher man steigt, desto weiter kann man sehen, aber es stimmt auch, dass, ganz gleich wie hoch man auch klettert, der Horizont sich doch immer wieder aus dem Blick stiehlt.
Je älter ich werde, desto bedrängender ist die Botschaft von Nietzsches »Übermensch«geworden, aber auch desto verwirrender. Wie hoch ist hoch genug ? Worauf soll ich genau schauen oder, ehrlicher gefragt, wonach soll ich suchen ? Was ist der Sinn dieser Blase an meinem Fuß, des Schmerzes der Selbstüberwindung ? Wie genau bin ich auf diesen besonderen Gipfel gelangt ? Soll ich mich mit diesem Gipfel zufriedengeben ? Auf der Schwelle zu seinem dreißigsten Lebensjahr schlug Nietzsche vor: »Die junge Seele sehe auf das Leben zurück mit der Frage: Was hast du bis jetzt wahrhaft geliebt, was hat deine Seele hinangezogen ?« Am Ende sind genau dies die richtigen Fragen, die man sich stellen sollte. Das Projekt des »Übermenschen« – wie das Altern selbst – ist nicht, an irgendeinem bestimmten Ziel anzukommen oder für alle Zeiten einen Raum mit Aussicht zu finden.
Wenn man wandert, neigt man sich dem Berg zu. Manchmal rutscht man aus und stolpert nach vorn. Manchmal verliert man das Gleichgewicht und kippt hintenüber. Dies ist eine Geschichte über den Versuch, sich genau richtig zu halten, sein gegenwärtiges Selbst etwas Unerreichtem, aber Erreichbarem, das allerdings noch außer Sicht ist, zuzueignen. Selbst das Ausrutschen kann lehrreich sein. Etwas geschieht mit einem, nicht auf dem Gipfel, sondern auf dem Weg dahin. Man hat die Chance, in Nietzsches Worten, der »zu werden, der man ist«.
TEIL I
WIE DIE REISE BEGANN
Wer nur einigermaßen zur Freiheit der Vernunft gekommen ist, kann sich auf Erden nicht anders fühlen denn als Wanderer – wenn auch nicht als Reisender nach einem letzten Ziele: denn dieses gibt es nicht.
Friedrich Nietzsche, »Menschliches, Allzumenschliches«, 1878
Ich erzähle meinen Studenten oft, dass die Philosophie mir das Leben gerettet hat. Und das stimmt auch. Auf meiner ersten Reise nach Sils-Maria – auf dem Weg zum Piz Corvatsch – hat sie mich allerdings beinahe umgebracht. Es war im Jahr 1999 und ich arbeitete an einem Essay über Genie, Wahnsinn und die ästhetische Erfahrung in den Schriften von Nietzsche und seinem amerikanischen Zeitgenossen Ralph Waldo Emerson. Behütet, wie ich mit knapp zwanzig Jahren war, kam ich damals allerdings kaum über die unsichtbaren Grenzen in der Mitte des Bundesstaats Pennsylvania hinaus, und so zog mein Betreuer an ein paar administrativen Strippen und sorgte dafür, dass ich mal herauskam. Am Ende meines ersten akademischen Jahres überreichte er mir einen unbeschrifteten Umschlag – darin lag ein Scheck über dreitausend Dollar. »Sie sollten nach Basel fahren«, schlug er vor, wobei ihm wahrscheinlich völlig klar war, dass ich dort nicht bleiben würde.
Basel war ein Wendepunkt, ein Dreh- und Angelpunkt zwischen Nietzsches zunächst konventionellem Leben als Gelehrter und seiner zunehmend erratischen Existenz als Europas Dichterphilosoph. Er war 1869 als jüngstes verbeamtetes Fakultätsmitglied an der Universität von Basel in die Stadt gekommen. In den folgenden Jahren sollte er sein erstes Buch, »Die Geburt der Tragödie«, schreiben, in dem er ausführte, dass die Anziehungskraft der Tragödie in ihrer Fähigkeit liege, die beiden widerstreitenden Bedürfnisse des Menschseins miteinander zu versöhnen: die Sehnsucht nach Ordnung und das seltsame, aber unleugbare Verlangen nach Chaos. Als ich in Basel eintraf, noch immer ein Teenager, konnte ich nicht umhin, zu denken, dass der eine dieser beiden Triebe – ein besessenes Bedürfnis nach Stabilität und Vernunft, das Nietzsche als das »Apollinische« bezeichnet – in der modernen Gesellschaft den Sieg davongetragen hatte.
Der Bahnhof in Basel ist ein Inbegriff Schweizer Präzision – schöne Menschen in schöner Kleidung schweben durch eine prächtige Vorhalle, um zu Zügen zu gelangen, die sich niemals verspäten. Gegenüber auf der anderen Straßenseite erhebt sich ein mächtiger zylindrischer Wolkenkratzer, der die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) beherbergt, die mächtigste Finanzinstitution der Welt. Ich verließ den Bahnhof und nahm vor der Bank mein Frühstück ein, während ein Pulk gut gekleideter Apollos auf dem Weg zu seiner Arbeit im Gebäude verschwand. »Die gebildeten Stände und Staaten«, erklärt Nietzsche, »werden von einer großartig verächtlichen Geldwirtschaft fortgerissen.« Die Lebensaussichten in der modernen kapitalistischen Gesellschaft waren lukrativ, aber nichtsdestoweniger trostlos: »Niemals war die Welt mehr Welt, nie ärmer an Liebe und Güte.«
Nietzsche zufolge ließen sich Liebe und Güte nicht im Gleichschritt verwirklichen, sondern verkörperten geradezu das Gegenteil: dionysische Raserei. Sein Leben in Basel sollte eigentlich glücklich und wohlgeordnet sein, ein Leben des Geistes und in der besten Gesellschaft, aber als er dort eintraf, schloss er bald Freundschaft mit dem romantischen Komponisten Richard Wagner, und jenes Leben kam schnell an sein Ende. Er war nach Basel gekommen, um klassische Philologie zu unterrichten, das Studium der alten Sprachen und ihrer ursprünglichen Bedeutungen, was harmlos genug erschien, aber Nietzsche verstand, anders als seine konservativeren Kollegen, wie radikal diese Art theoretischer Archäologie und Freilegung sein konnte. In der »Geburt der Tragödie«stellt er die These auf, dass die westliche Kultur mit all ihrer grandiosen Verfeinerung auf einer verborgenen, unterschwelligen Struktur errichtet worden ist, die vor vielen Zeitaltern von Dionysos selbst geschaffen worden ist. Und in den Anfangsjahren ihrer Freundschaft zielten Nietzsche und Wagner darauf, diese Struktur wieder sichtbar zu machen.
Dionysos schien nicht in Basel zu wohnen. Homer zufolge war er weit entfernt von den Mauern der westlichen Zivilisation, »in der Nähe des ägyptischen Stroms«, geboren. Er war das wilde Kind der griechischen Mythologie, die Gestalt, die Apollo erfolglos unter Kontrolle zu behalten versuchte. Auch als Eleutherios bekannt – der »Freie« –, wird dieser rüpelhafte Gott des Weins und der Fröhlichkeit gewöhnlich so dargestellt, dass er mit einem trunkenen Weisen, seinem Ziehvater, dem Satyr Silenus, über die Hügel wandert. Das Wort »wandern« lässt es ein wenig seriöser erscheinen, als es war; es war wohl eher ein Herumtoben – man bahnte sich tanzend und vögelnd den Weg zwischen den Bäumen draußen vor den Stadtgrenzen hindurch.
Wagner war dreißig Jahre älter als Nietzsche, im selben Jahr geboren wie der Vater des Philosophen, ein strenggläubiger Lutheraner, der an einer »Gehirnerweichung« gestorben war, als sein Sohn fünf Jahre alt war. An dem Komponisten Wagner war nichts weich oder tot. Wagners Werke der mittleren Periode waren Ausdruck von Sturm und Drang, und Nietzsche verehrte sie. Wagner und Nietzsche teilten eine tiefe Verachtung für den Aufstieg der bürgerlichen, das heißt bourgeoisen Kultur, für die Vorstellung, dass das Leben am besten leicht gelebt werden sollte, angenehm, pünktlich und korrekt. »Ein Leben führen« war – und ist immer noch – einfach in Basel: Man geht zur Schule, wählt einen Beruf, verdient Geld, kauft sich etwas, fährt in Urlaub, heiratet, bekommt Kinder, und dann stirbt man wieder. Nietzsche und Wagner wussten, dass an dieser Art zu leben etwas Sinnloses haftete.
Zu Anfang der »Geburt der Tragödie« erzählt Nietzsche die Geschichte von König Midas und Silenus. Midas, der berühmte König mit dem goldenen Händchen, bittet Dionysos’ Gefährten, ihm den Sinn des Lebens zu erklären. Silenus wirft dem König einen Blick zu und sagt dann ohne Umschweife zu ihm: »Elendes Eintagsgeschlecht, des Zufalls Kinder und der Mühsal, was zwingst du mich, dir zu sagen, was nicht zu hören für dich das Ersprießlichste ist ? Das Allerbeste ist für dich gänzlich unerreichbar: nicht geboren zu sein, nicht zu sein, nichts zu sein. Das Zweitbeste aber ist für dich – bald zu sterben.« Als ich auf den Stufen der BIZ saß und dabei zusah, wie Männer und Frauen zur Arbeit eilten, dachte ich, dass Silenus vermutlich recht gehabt hatte: Manche Arten von Leben werden am besten so schnell wie möglich gelebt. Nietzsche und Wagner glaubten dennoch, dass das Menschsein ausgekostet und aus dem Vollen gelebt werden sollte.
»Denn nur als ästhetisches Phänomen«,so insistiert Nietzsche in der »Geburt der Tragödie«, »ist das Dasein und die Welt ewig gerechtfertigt.« Dies war Nietzsches Antwort auf die Weisheit Silenus’, der einzige Weg, den modernen Nihilismus zu überwinden. Ästhetisch: aus dem griechischen aisthanesthai, »wahrnehmen, empfinden, fühlen«. Nur indem er die Welt anders wahrnahm, nur indem er tief empfand, konnte Silenus Zufriedenheit erlangen. Wenn man dem Leiden und dem Tod schon nicht entgehen konnte, war es stattdessen vielleicht möglich, sie bereitwillig anzunehmen, sie sogar heiter und fröhlich anzunehmen. Das Tragische besaß nach Nietzsche auch seine Vorzüge: Es bewies, dass Leiden mehr als bloßes Leiden sein konnte; der Schmerz in all seiner bitteren Rohheit konnte dennoch gesteuert, zugeordnet werden, er konnte sogar etwas Schönes und Erhabenes annehmen. Indem sie das Tragische akzeptierten, statt es zu fliehen, hatten die alten Griechen sich einen Weg gebahnt, den Pessimismus zu überwinden, der die Moderne allzu schnell ergriffen hatte.
Ich sollte eigentlich mehrere Wochen in Basel bleiben, sollte die meiste Zeit in der Bibliothek verbringen, aber während ich mich langsam auf den Weg durch die Stadt machte, wurde mir klar, dass dieser Plan vollkommen unmöglich war. Die Straßen waren zu gerade, zu still, zu profan. Ich musste etwas fühlen können, ich musste meine Betäubung lösen, mir beweisen, dass ich nicht bloß schlief. Ich war, vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben, frei, etwas anderes zu tun als das, was mir aufgetragen worden war. Als ich schließlich die Universität erreichte, an der Nietzsche einmal gelehrt hatte, wusste ich, dass ich Basel so schnell wie möglich verlassen musste.
Im Jahr 1878 war das Hoffnungsvolle, das in »Die Geburt der Tragödie« angeklungen war, bereits verweht. Nietzsches Gesundheit verschlechterte sich, während sich die ersten Anzeichen psychischer Instabilität zu erkennen gaben. Er rannte buchstäblich auf die Berge, machte sich auf eine zehnjährige philosophische Wanderung durch alpines Terrain – zunächst nach Splügen, dann nach Grindelwald am Fuß des Eiger, weiter zum San-Bernardino-Pass, dann nach Sils-Maria und schließlich zu den Städten Norditaliens. Diesen Weg einzuschlagen, hieß, Nietzsche durch seine produktivste Phase zu folgen – ein Jahrzehnt fieberhaften Schreibens, das viele der wegweisenden Werke des modernen Existenzialismus, der Ethik und der Postmoderne hervorbrachte: »Also sprach Zarathustra«, »Jenseits von Gut und Böse«, »Zur Genealogie der Moral«, »Götzen-Dämmerung«, »Der Antichrist« und »Ecce homo«. An meinem ersten und einzigen Abend in Basel beschloss ich, dass dies der Pfad sein sollte, den ich einschlagen würde – ein Weg, von dem viele Gelehrte glauben, dass er Nietzsches Aufstieg zum Genie und seinen Abstieg in den Wahnsinn nachzeichnet.
Am nächsten Morgen erwachte ich vor Tagesanbruch, machte einen langen Lauf, um meine Vermutung zu bekräftigen, dass Basel absolut seelenlos war, genau der falsche Ort für mich, und begab mich zum Bahnhof. Erster Halt: Splügen, hoch in den Alpen. Ich dachte, ich würde schließlich nach Turin kommen, wo Nietzsche 1888 den »Antichrist«schrieb, kurz bevor er seinen Verstand verlor. Dort hatte er etwas gefunden, am Rande des Wahnsinns: eine Philosophie, die eher dazu gedacht war, uns zu erschrecken als zu belehren. Wenn wir vorhaben, den »Antichrist«zu lesen, dann nur, fordert Nietzsche, indem wir »eine Vorliebe der Stärke für Fragen, zu denen niemand heute den Mut hat,« kultivieren, für den »Mut zum Verbotenen«. Der Schrecken hat seine Verdienste. Die Fragen, die uns am meisten Angst bereiten, sind genau jene, die unsere volle und augenblickliche Aufmerksamkeit verlangen. Ich machte mich, so gut ich konnte, mit diesem Gedanken vertraut. Schließlich ließ mein Zug das Tal hinter sich – und mit ihm, ganz langsam, auch meine Angst vor dem Verbotenen.
Mein Vater wurde, genau wie der Nietzsches, verrückt, als ich vier Jahre alt war. Nietzsches Vater starb. Meiner verließ seine Familie. Mein Vater und Namensvetter Jan hatte in den 1980er-Jahren im internationalen Bankgeschäft gearbeitet und sich auf trianguläre Arbitrage spezialisiert, eine Form des Handels, die die Preisunterschiede zwischen unterschiedlichen Währungen am Devisenmarkt nutzt, zwischen dem Dollar, dem Yen und dem Pfund. Heutzutage machen Computer diesen Job, aber in den Anfängen der Währungsarbitrage machten das Männer wie mein Vater. Eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen ist, wie mein Großvater mir zu erklären versucht, was sein Schwiegersohn eigentlich genau beruflich tut. Er holte eine Schachtel Murmeln heraus und zeigte mir drei unterschiedliche Sorten: blaue, grüne und violette. Stell dir vor, begann er, du kannst bei mir zehn blaue Murmeln gegen sieben grüne eintauschen. Und dann findest du jemanden, der dir für deine sieben grünen Murmeln zwölf violette gibt. Jetzt nimmst du deine violetten und tauschst sie für elf blaue ein. Er gab mir die ursprünglich zehn blauen Murmeln wieder und fischte noch eine weitere aus der Schachtel und rollte sie mir zu: »Die kriegst du.« Das ist Arbitrage – etwas für nichts, zu gut, um wahr zu sein.
»Was man ehedem um Gottes willen tat«, schreibt Nietzsche, »tut man jetzt um des Geldes willen.« In Wahrheit tat Jan das, was »ehedem um Gottes willen« getan worden war, um des Geldes und des Erlebnisses willen. Er war ein Erlebnis-Junkie: fliegenfischen, segeln, Auto fahren, reiten, Ski fahren, Partys feiern, wandern – wenn man etwas dabei fühlen konnte, dann tat er es. Von außen gesehen war er ein obszön reicher, gut aussehender Mann mit einer schönen Frau und zwei strahlenden Söhnen. Aber oft trügt der Schein. Als Nietzsche sich dem Ende seiner Zeit in Basel näherte, gestand er: »Ich bin mir der tiefen Melancholie bewußt, die meiner … Heiterkeit zugrunde liegt.« Meinem Vater war ein ähnliches Geheimnis bewusst, eines, das er mit einer schönen Fassade zu maskieren suchte – aber es trieb ihn schließlich in die Depression, in den Alkoholismus und in ein zu frühes Grab. Am Ende war Arbitrage tatsächlich zu gut, um wahr zu sein.
Als Kind hatte ich nur eine Ahnung davon gehabt, was das Verhalten meines Vaters anbelangte, aber mit neunzehn Jahren begann ich, es mit der Klarheit nun eigener Erfahrung zu verstehen. Jan spürte die Verlockung dessen, was Nietzsche das »Große und Unmögliche« nannte – die Sehnsucht nach einer Kompensation für das Gefühl, etwas von unschätzbarem Wert geliebt und verloren zu haben. Sein eigener Vater, der ebenfalls weitgehend abwesend gewesen war, hatte sein Leben zum Großteil in einer Strumpffabrik am Rande von Reading, Pennsylvania, vergeudet, für eine Frau, die sich sehr für Geld erwärmte, sich aber für ihren Mann schämte, der als Arbeiter tatsächlich hart schuften musste, um es anzuschaffen. Mein Großvater kam abends nach Hause geschlichen, aß sein Abendbrot, ließ sich dann in seinen Lehnstuhl in der Zimmerecke nieder und trank die Art von Drink, die einen Mann ausknockt. Liebe war immer etwas schwer Verfügbares, etwas, das man sich verdienen musste. Und es war nie genug. Dieses Gefühl des Mangels entstammte nicht tatsächlicher Armut, sondern einer Vorstellung von Liebe und Zuneigung, die nicht nur für meine Familie gilt. Sie wird dabei als eine Art Handel begriffen. Natürlich ist der Austausch von Gefühlen genauso befriedigend wie der von Gütern und Dienstleistungen – also überhaupt nicht –, aber das hält einen nicht davon ab, dauernd diesen Handel zu versuchen. Der absolute Bankrott dieser Liebeskonditionen hält alles in frenetischer Bewegung.
Nachdem mein Großvater an Leberzirrhose gestorben war, entdeckte Jan die Art von Drinks, die sein Vater getrunken hatte, und kaufte ein rotes Zweiersofa aus Leder für die Wohnzimmerecke. Aber meistens war er unterwegs, nahezu andauernd, immer weg, auf der Suche nach dem nächsten Deal. Von einer dieser Geschäftsreisen kam er einfach nicht mehr zurück. Zunächst landete er in Philadelphia und dann in New York. An einem bestimmten Punkt verlor ich ihn aus den Augen.
Der Zug fuhr durch Bad Ragaz, das an der Grenze zu Liechtenstein, am Fuß des Pizol in den Glarner Alpen, liegt. Ich musterte die Berge oberhalb von Ragaz, wo Schafe träge auf den niedrigeren Höhenlagen grasten. Irgendwo zwischen den Felsen lag die Taminaschlucht, eine schmale Grotte mit den heilenden Quellwassern, die die Mineralbrunnen von Bad Pfäfers speisen. Seit siebenhundert Jahren bahnen sich Pilger ihren Weg den Berg hinauf, um sich wiederherzustellen und sich den Schmutz des täglichen Lebens abzuwaschen. In den 1840er-Jahren wurde das Wasser den Berg hinuntergeleitet, um die inzwischen berühmten Bäder von Bad Ragaz zu füllen. Nietzsche zog sich, erschöpft von den Jahren in Basel, mit dreiunddreißig Jahren in dieses Kurbad in der Hoffnung zurück, den Migräneattacken zu entgehen, die ihn, seit er ein Jugendlicher gewesen war, gequält hatten. Hier war es auch, wo er den Entschluss fasste, sich seiner Verpflichtungen als ordentlicher Professor zu entledigen. »Könntest Du wissen«, schrieb er an seinen Freund Carl von Gersdorff im April 1874, »wie verzagt und melancholisch ich im Grunde von mir selbst, als produzierendem Wesen, denke ! Ich suche weiter nichts als etwas Freiheit, etwas wirkliche Luft des Lebens und wehre mich, empöre mich gegen das viele, unsäglich viele Unfreie, was mir anhaftet.« Er würde Basel verlassen und sich in höher gelegene Regionen begeben. Als Ragaz aus meinem Blick verschwand, konnte ich die Anziehungskraft solch eines Rückzugsortes verstehen, aber auch die Kräfte, die die Flucht so leidig machten.
Als Nietzsches Vater, der Pastor, starb, tat der kleine Junge – der in seiner Kindheit meist nur »Fritz« genannt worden war –, was für fast alle frommen Lutheraner nur natürlich ist: Er wurde noch gehorsamer. In seiner Jugend hatte er vor, Geistlicher zu werden; er wurde von seinen Mitschülern der »kleine Pastor« genannt – das war nicht freundlich gemeint. Nietzsche war intelligenter und introvertierter, als gut für ihn war, und seine Klassenkameraden hänselten ihn gnadenlos. Wenn er von den Gleichaltrigen nicht akzeptiert werden konnte, dann suchte Fritz eben die Bestätigung von Gott: »Alles was er gibt, will ich freudig hinnehmen, Glück und Unglück, Armut und Reichtum und kühn selbst dem Tod ins Auge schauen, der uns alle einstmals vereinen wird zu ewiger Freude und Seligkeit.« Das Bestreben, diametrale Gegensätze heiter anzuerkennen, selbst die härtesten – die von Leben und Tod –, war eines, das Nietzsche weder jemals aufgeben noch ganz verwirklichen sollte.
Gesellschaft fand der junge Mann nicht leicht, aber nicht, weil er unhöflich oder egoistisch gewesen wäre. Ganz im Gegenteil. Der junge Fritz war schüchtern, höflich, allzu ehrerbietig. Lange Zeit waren Bücher seine besten Freunde. Mit fünfzehn Jahren – als andere Jugendliche sich ihre ersten Hörner abstießen –, gründete der junge Fritz einen exklusiven Buchclub namens »Germania«. Es gab eine Handvoll Mitglieder: Nietzsche und ein paar weitere Jungen, die Bücherwürmer genug waren, um ihn zu überzeugen. Bei ihrem Gründungstreffen kauften sie eine Flasche Bordeaux, wanderten zu den alten Ruinen von Schönburg vor den Toren von Pforta, schworen den Büchern und der Literatur ihre Treue und warfen die Flasche über die Zinnen, um ihren Pakt zu besiegeln. Die nächsten drei Jahre trafen sich die Mitglieder von »Germania« regelmäßig, um Gedichte, Essays und Traktate auszutauschen (hier präsentierte der junge Nietzsche auch seine erste philosophische Abhandlung »Fatum und Geschichte«) und Wagners neueste Kompositionen aufzuführen, darunter auch »Tristan und Isolde«. Das war Nietzsches Version von Spaß und Freizeitvergnügen.
Während der Zug mich weiter in die Höhen trug, dachte ich über die Absurdität einer solchen Kindheit nach – allerdings nur ein wenig absurder als eine, zu der auch neunwöchige Pilgerreisen auf den Spuren längst verstorbener Philosophen gehörten – und darüber, wie schwierig es für ihn gewesen war, sich wirklich integrieren zu können.
Fritz versuchte normal zu sein, aber die Dinge entwickelten sich nicht sonderlich gut für ihn. Was den Alltag anbelangte, die Dinge des täglichen Lebens, übertrieb er es entweder oder, häufiger noch, entwickelte schnell einen Überdruss angesichts ihrer Banalität. Als er Pforta, das beste Internat in Deutschland, verließ, schrieb er sich an der Universität Bonn ein und tat sich damit hervor, genau wie alle anderen zu sein – mit Saufkumpanen, Ausflugstouren und sogar einer kurzen Romanze. Er versuchte es wie die anderen mit der Trinkerei, aber als er an einem Abend wirklich über die Stränge schlug, betrank er sich dermaßen, dass man ihn beinahe von der Universität verwiesen hätte. Als er seiner Mutter von dem unglückseligen Besäufnis berichtete, beklagte er sich, dass er »einfach nicht gewußt habe, wie viel [Alkohol] er tatsächlich vertragen könne«. Als er der Burschenschaft Frankonia beitrat – was in den USA in etwa einer »Fraternity« entspricht –, kam er an die Grenzen seiner Bereitschaft zur Konformität. Er mochte Bier überhaupt nicht. Er mochte Gebäck. Und er lernte und studierte gern – sehr gern. Als er nach nur zehn Monaten Bonn verließ, um nach Leipzig zu gehen, war ihm völlig klar geworden, dass es nur Zeitverschwendung für ihn wäre, wenn er sich weiterhin bemühte, normal zu sein.
Am Ende seiner Teenagerjahre gab es zwei Tröstungen für Fritz: seine Mutter Franziska und die Schriften von Ralph Waldo Emerson. Er hatte Anfang der 1860er-Jahre, gegen Ende seiner Schulzeit in Pforta, begonnen, Emerson zu lesen, und der amerikanische Transzendentalist wurde ihm schnell zu einem Vertrauten; Nietzsche schrieb: »Emerson, mit seinen Essays, ist mir ein guter Freund und Erheiterer auch in schwarzen Zeiten gewesen: Er hat so viele Skepsis, so viele ›Möglichkeiten‹ in sich, daß bei ihm sogar die Tugend geistreich wird.« Philosophie lernte man am besten auswendig – nicht im Sinne von gedankenlosem Gedächtnistraining, sondern indem man sich etwas wirklich zu Herzen nahm und es in der Erfahrung erprobte. Diese persönlichste Art des Lernens sollte den Einzelnen den Mut geben, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, ohne die Anleitung von Lehrern oder Priestern. Und dann war da noch Emersons Skepsis, der Zweifel der Kritik, der sich zwischen Nietzsche und das Priesteramt geschoben hatte. »Es gibt in der Welt einen einzigen Weg, auf welchem niemand gehen kann, außer dir: Wohin er führt ? Frage nicht«, lehrt uns Nietzsche, »gehe ihn.« Dieser Weg der Selbstständigkeit sollte zur Hauptstraße werden, die ihn schließlich in die Alpen führen würde.
Nietzsche fühlte sich von Emersons prometheischem Individualismus angezogen, von seiner Idee, dass Einsamkeit nicht etwas war, das man um jeden Preis meiden müsse, sondern vielmehr ein Moment der Unabhängigkeit, den man gedanklich erkunden und sogar genießen könne. Tatsächlich ist Isolation, bis zu dem Grad, dass sie einen von jeglichen gesellschaftlichen Fesseln befreit, die angemessenste Lage für einen Philosophen. Dieser romantische Impuls war bei beiden Denkern tief verwurzelt; ästhetische Erfahrung war etwas Lebensbejahendes, nicht in einer abstrakten, sondern in der emotionalen und intellektuellen Einstellung des Einzelnen verankert. Mit zweiundzwanzig Jahren schrieb Nietzsche in einem Brief an Carl von Gersdorff über seine große Bewunderung für den Amerikaner: »Gelegentlich kommen Stunden jener ruhigen Betrachtung, wo man in Freude und Trauer gemischt über seinem Leben steht … wie Emerson sie so trefflich beschreibt.«
Beim Übergang ins Erwachsenenalter begann Nietzsche bestimmte Formen der Erfahrung – unter anderem jene Stunden ruhiger Betrachtung – als eine Möglichkeit zu sehen, dem Kummer und den Sorgen des Lebens zu entfliehen, und er wurde umso mehr von ebendem Denker angezogen, der, in den 1840er-Jahren, die Wende zur Erfahrung in der Philosophie eingeläutet hatte.
Es ist zugegeben ein merkwürdiger Gedanke: dass man Transzendenz erreicht, indem man sich ganz in die lebendige, alltägliche Erfahrung versenkt, dass man Transzendenz nicht »dort draußen« findet, sondern nur in einer tieferen Erkundung des Lebens. Aber genau diese Idee ist es, die den jungen Nietzsche zu Emerson hinzog.
Traditionelle religiöse Wege zur Erlösung waren in den ersten Jahrzehnten des neunzehnten Jahrhunderts gekappt worden: Die »höhere Kritik« in Deutschland, eine Form der Bibelkritik, die die Evangelien eher als historische Dokumente denn als Wort Gottes las, untergrub die spirituelle und existenzielle Autorität der Kirche; der zeitgenössische Kapitalismus kam in Fahrt und ersetzte das Kreuz durch das allmächtige Dollarzeichen; und die moderne Wissenschaft – verkörpert durch Darwins Entdeckungen Mitte des Jahrhunderts – unterminierte den religiösen Glauben nur noch mehr. Man konnte Glauben erlangen – und Momente tiefen, beinahe göttlichen Sinns erleben –, aber nur in dem sinnlichen, erkennbaren Strom der Existenz.
In seinem Essay »Erfahrung« von 1844, der im Jahr von Nietzsches Geburt erschien, schreibt Emerson: »Kein Mensch gelangte jemals zu einer Erfahrung, die sättigend war, aber ihr Gutes birgt Nachrichten von etwas Besserem. Weiter und weiter ! In Augenblicken der Befreiung wissen wir, daß ein neues Bild vom Leben … bereits möglich ist.« Dies ist Emerson, wo er am meisten Hoffnung verbreitet, aber Nietzsche verstand ebenso, dass Schwung im Sinne Emersons auch von einem verlangte zu lernen, wie man auf richtige Weise Erfahrung erlebt und erleidet. Für Emerson verwirklichte man seine Selbstüberwindung in gleichsam sommerlichen Momenten von Freude und Trauer, den Augenblicken am Mittag, wenn man begreift, dass der Tag am Abklingen und schon halbwegs vorüber ist. Diesem Amerikaner, einem Mann Ende dreißig, der seine erste Frau an die Tuberkulose verloren hatte, war persönliche Tragik nicht fremd, und er half Fritz dabei, die eigene zu überstehen und zu ertragen. Emersons Essay »Kompensation«, das Gegenstück zu seinem berühmteren »Selbstständigkeit«, versprach, dass »jedes Laster, dem wir nicht erliegen, eine Wohltat ist«. Nietzsche verbrachte den größten Teil seines Lebens damit, diese Botschaft zu verinnerlichen, nahm sie wiederholt in eigenen Worten wieder auf, am berühmtesten in »Götzen-Dämmerung«: »Was mich nicht umbringt«, bekräftigte er, »macht mich stärker.«
Ich wusste, dass er diese Worte – und den Rest des Buches – in einer irrsinnigen Arbeitswoche in Sils-Maria geschrieben hatte. Nachdem ich Splügen erkundet hatte, wollte ich mich dorthin begeben. Vielleicht konnte ich sogar zu Fuß laufen. Ich hatte meine Turnschuhe und Flipflops mitgebracht. Mehr als vierzig Kilometer konnten es nicht sein.
Straßen und Eisenbahntrassen sollen zwei Punkte auf die kürzest mögliche Weise miteinander verbinden, aber in den Bergen winden sich die Straßen um Gebirgsausläufer und Felsvorsprünge – sie verlaufen tatsächlich nur dann gerade, wenn sie durch Tunnel führen, wo diese die Bergwand durchbohren. Ich spähte aus dem Zugfenster hinunter. Wir näherten uns Splügen und hielten für einen Moment in Chur, der Hauptstadt des Kantons Graubünden. Dort war der Weg, den Nietzsche, wie ich mir vorstellte, gegangen war, nur eine schmale Schotterstraße, die in den Granit gehauen war und um den nächsten Bergrücken verschwand. Sie war herrlich. Und trügerisch. Der Weg hatte einen Randstreifen von einem halben Meter und ein Geländer und fiel dann vollkommen ab, um, wie es schien, Hunderte von Metern. Das Geländer war erst kürzlich angebracht worden. Nietzsche kam in die Berge, um am Rande des Abgrunds zu wandern.
Wir fuhren in ein Hochtal, höher gelegen als die meisten Berge New Englands, und ich genoss zum ersten Mal die majestätische Schönheit der Alpen. Wenn die Schönheit der nietzscheanischen Tragödie als Landschaft ihren Ausdruck finden könnte, dann hier: Malerische, wohlgeordnete Schweizer Dörfer lagen verstreut in einem weiten, grasbewachsenen Talkessel, der allmählich und dann plötzlich Platz machte für Felswände aus Stein und Eis, die in die Wolken ragten. Extreme, die sich in perfekter Harmonie vereinten.
»Ich steige ganz bequem die Landstraße empor«, berichtet Nietzsche während seines kurzen Aufenthaltes in Chur, »alles liegt vor mir … herrliche Rückblicke, fortwährend wechselnde und sich erweiternde Rundblicke.« Als ich mich umsah, bevor ich wieder in den Zug nach Splügen stieg, dachte ich, dass der Anstieg in die Berge für ihn nicht so leicht gewesen sein kann. So zu wandern erscheint nicht besonders schlau – besonders in einer Kultur, die sich damit brüstet, auf immer noch bequemere Weise von hier nach dort zu gelangen. Nietzsche hatte ein Wort für diese Art von Kultur: dekadent. Das Wort kommt vom Lateinischen decadere – »hinunterfallen« oder »herausfallen« im Sinne von »entgleisen«.
Nietzsche und Emerson zufolge hatte die Moderne den Bezug zum Rhythmus des Lebens verloren. Sie war nicht mehr im Einklang mit den Grundimpulsen, die einmal die menschliche Existenz beseelt hatten. Tiere lieben es normalerweise, zu spielen, zu rennen, zu klettern – Energie zu verbrauchen und ihre Kraft zu genießen. Aber in unserem Bemühen, zivilisiert und fromm zu werden, meinte Nietzsche, hatten wir Modernen es geschafft, das Tier in uns zu töten oder zumindest einzukerkern. Mit Hilfe des Christentums und des Kapitalismus hatte man den Menschentieren gestattet zu verweichlichen. Wenn man »zur Arbeit ging«, dann nicht, um seinen freien Willen auszuüben, sondern um der nächsten Lohntüte willen. Das Leben wurde nicht länger enthusiastisch gelebt – es wurde nur noch aufgeschoben.
Nietzsche floh aus vielen Gründen in die Berge. Er war krank – er litt unter Übelkeit, Kopfschmerzen und hatte ein Augenleiden, das sein späteres Leben überschattete –, und er brauchte mehr Zeit für sein Schreiben. Er war auf der Suche nach neuen Erfahrungen, tieferen und höheren. Allerdings war er in Basel auch nicht länger restlos willkommen. In der Gesellschaft der Philologen hatte die Veröffentlichung von »Die Geburt der Tragödie«1872 eine Kluft zwischen den Literalisten und den Existenzialisten aufgerissen. Die Literalisten fanden, dass das Ziel des Studiums des Ursprungs der Sprache darin bestand, es »richtig zu verstehen« – die Grenzen bloßer Interpretationen zu überwinden, um die Bedeutung der Wörter so zu begreifen, wie die Alten sie einst verstanden hatten. Nietzsche und eine kleine Gruppe existenzialistischer Philologen waren der Ansicht, dass diese Art von intellektueller Zeitreise sowohl anachronistisch als auch unmöglich war – dass es die »Aufgabe des Philologen sei, sein eigenes Zeitalter mit Hilfe der klassischen Welt besser zu verstehen«. Der Sinn des Studiums der Historie war, den gegenwärtigen Moment der Erfahrung zu bereichern. Diese These wurde in einem Fragment gebliebenen Essay aufgestellt, den Nietzsche »Wir Philologen« nannte und der unveröffentlicht blieb, zumindest teilweise wegen der Kontroverse, die bereits um »Die Geburt der Tragödie« herum tobte. Als das Buch erschien, wandte sich Friedrich Ritschl, lange Zeit Nietzsches Mentor und der Anführer der literalistischen Tradition, gegen seinen vielversprechendsten Studenten.
Ritschl zufolge hatte Nietzsche zwei Seiten: die des brillanten und strengen Gelehrten, der noch die dichtesten und verwirrendsten Passagen im Altgriechischen zu entschlüsseln vermochte, und die des »fantastisch-extravaganten, überschlauen« Verrückten, »der ins Unverständliche verfiel«. Nietzsches dionysischer Geist verschaffte ihm nur wenig Freunde in den biederen Zirkeln von Basels intellektueller Elite. Die Besprechungen von »Die Geburt der Tragödie« – eine davon von einem seiner besten Freunde – waren wüst. Der zu so vielen Hoffnungen Anlass gebende junge Gelehrte, der in den Worten eines seiner berühmten Mentoren »buchstäblich tun konnte, was immer er wollte«, war plötzlich ein akademischer Outcast. So fuhr er im September 1872 nach Splügen; es war ein Experiment in Sachen Leben in den Bergen, wie er es dann einige Jahre später ernsthaft in Angriff nahm. »Als wir in die Nähe des Splügen kamen«, schrieb Nietzsche im Oktober an seine Mutter, »überkam mich der Wunsch hier zu bleiben … Dieses hochalpine Tal … ist ganz meine Lust. Da sind reine starke Lüfte, Hügel und Felsblöcke von allen Formen, rings herum gestellt mächtige Schneeberge: aber am meisten gefallen mir die herrlichen Chausseen, in denen ich stundenweit gehe.« Als Nietzsche in Splügen ankam, nahm er in einem kleinen Gasthaus am Rande der Stadt Quartier. Während er in Basel zu gleichen Teilen Prominenter und Paria war, war er hier bloß ein Fremder und genauso behandelten ihn die Dorfbewohner auch. Nietzsche schrieb seiner Mutter, dass er die Freiheit der Anonymität genoss. »Jetzt weiß ich doch einen Winkel«, schrieb er, »wo ich, mich kräftigend und in frischer Tätigkeit, aber ohne jede Gesellschaft leben kann. Die Menschen sind einem hier wie Schattenbilder.«
Als ich nach der fünfstündigen Fahrt ausstieg, musste ich ihm recht geben: Die flüchtigen Erscheinungen menschlichen Lebens bildeten einen starken Kontrast zu der Festigkeit dieses Terrains. Menschen schlüpften aus dem Zug und machten sich auf den Weg zu ihren kleinen Häuschen, die sich an die Bergwände schmiegten. Ich blieb im Bahnhof allein zurück, atmete keuchend die dünne Luft ein und fragte mich, wo ich wohl die Nacht verbringen sollte. Aber es war erst drei Uhr nachmittags und die Berge lockten. Mit Flipflops an den Füßen und einem Fünfzehn-Kilo-Rucksack auf dem Rücken machte ich mich auf meine erste alpine Wanderung.
Ich folgte einem alten Maultierpfad, der von der Dorfmitte Splügens in die Berge führte. Kleine, unscheinbare Schilder wiesen den Weg nach Isola, einem Dorf an der Grenze zu Italien, knapp fünfzig Kilometer entfernt. Ich wollte bloß eine kurze Wanderung machen und vor Einbruch der Dämmerung wieder zurückkehren. Das Gehen ist eine der lebensbejahendsten menschlichen Aktivitäten. Es ist die Form, wie wir den Raum organisieren und ermessen und uns zur Welt als ganzer verhalten. Es ist der lebende Beweis, dass Wiederholung – einen Fuß vor den anderen setzen – einer Person tatsächlich ermöglichen kann, entscheidende Fortschritte zu machen. Es ist kein Zufall, dass Eltern die ersten Schritte ihrer Kinder feiern – das erste und vielleicht bedeutendste Zeichen von Unabhängigkeit.
Der Weg war relativ flach und sogar gelegentlich gepflastert, und ich kam schnell voran. Gehen ist praktisch und körperlich nutzbringend, aber für Künstler und Denker wie Nietzsche ist es außerdem aufs Innigste mit dem Schöpferischen und mit philosophischem Denken verbunden. Seine Gedanken schweifen lassen, auf den eigenen Füßen stehend zu denken, zu einem Schluss zu kommen – das sind nicht einfach nur Redewendungen, sondern zeugen von einer Form der geistigen Offenheit, die man nur in der Bewegung erreichen kann. In den Worten von Jean-Jacques Rousseau, dem Philosophen aus dem achtzehnten Jahrhundert: »Ich tue nie etwas anderes als zu Fuß zu gehen; die Landschaft ist mein Arbeitszimmer.« Die Geschichte der Philosophie ist in hohem Maße die Geschichte des Denkens in Bewegung, im Übergang. Natürlich haben sich viele Philosophen niedergelassen, um zu schreiben, aber das war höchstens eine Art Hocken, ein Weg, um den Boden zu markieren, den man überquert hatte. Buddha, Sokrates, Aristoteles, die Stoiker, Jesus, Kant, Rousseau, Thoreau – diese Denker saßen nie sehr lange still. Und manche von ihnen, die wahrhaft obsessiven Spaziergänger, begriffen, dass das Wandern schließlich ganz woandershin führen kann: zur echten Wanderschaft. Das ist die Entdeckung, die Nietzsche in den Alpen machte.
Mit dreißig Jahren war er immer noch kräftig genug, um vom Aufstieg zu träumen: »So hoch zu steigen, wie je ein Denker stieg, in die reine Alpen- und Eisluft hinein, dorthin, wo es kein Vernebeln und Verschleiern mehr gibt, und wo die Grundbeschaffenheit der Dinge sich rauh und starr, aber mit unvermeidlicher Verständlichkeit ausdrückt !« Wandern, anders als die meisten Berufungen, ist Arbeit, die ihren eigenen unmittelbaren Lohn in sich trägt, und seine unangenehmen Aspekte sind oft die gewinnbringendsten. Der dumpfe Schmerz von Milchsäure, der sich in den Quadrizepsen und Waden bildet, erinnert einen allmählich daran, dass das Fleisch – das eigene