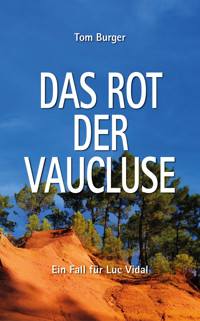9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Als Kommissar Luc Vidal den Tod der vierundachtzigjährigen Claire untersucht, ahnt er nicht, dass dies eine Welle von Gewalttaten auslösen wird. Dabei rücken eine Gruppe von Claires Jugendfreunden und ein Buch mit Briefen von Francesco Petrarca in den Mittelpunkt. Der Dichter hatte im 14. Jahrhundert dort am Fuß des Mont Ventoux gelebt, wo sich die Ereignisse für Luc Vidal und die zweiundzwanzigjährige Amandine Moreau überschlagen. Die junge Frau wird das Bücherhaus erben – und daraus ist nicht nur das Buch mit Petrarcas Briefen verschwunden. Amandines Ausstrahlung und die erotische Wirkung einer Bronzeskulptur führen den Kommissar bei den Ermittlungen an seine Grenze. In einem Wettlauf gegen die Zeit muss er herausfinden, welches Geheimnis Petrarcas Briefe und dessen Gedichtsammlung an Laura birgt. Denn eines ist gewiss: Irgendwo zwischen den Kalkfelsen der Dentelles de Montmirail, den Weinbergen von Gigondas und der trügerischen Idylle von L’Isle-sur-la-Sorgue wartet auf das nächste Opfer der Tod.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Table of Contents
INNENTITEL
ÜBER DAS BUCH
FRANCESCO PETRARCA, SONETT 68 (AN LAURA).
ERSTER TEIL. DAS PETRARCA-KOMPLOTT
ZWEITER TEIL. DER LAURA-KOMPLEX
DRITTER TEIL. DER KALTE GLANZ VON GOLD
ANHANG
IMPRESSUM
DAS BÜCHERHAUS
LUC VIDALS ZWEITER FALL
TOM BURGER
ÜBER DAS BUCH
Als Kommissar Luc Vidal den Tod der vierundachtzigjährigen Claire untersucht, ahnt er nicht, dass dies eine Welle von Gewalttaten auslösen wird.
Dabei rücken eine Gruppe von Claires Jugendfreunden und ein Buch mit Briefen von Francesco Petrarca in den Mittelpunkt. Der Dichter hatte im 14. Jahrhundert dort am Fuß des Mont Ventoux gelebt, wo sich die Ereignisse für Luc Vidal und die zweiundzwanzigjährige Amandine Moreau überschlagen. Die junge Frau wird das Bücherhaus erben – und daraus ist nicht nur das Buch mit Petrarcas Briefen verschwunden.
Amandines Ausstrahlung und die erotische Wirkung einer Bronzeskulptur führen den Kommissar bei den Ermittlungen an seine Grenze. In einem Wettlauf gegen die Zeit muss er herausfinden, welches Geheimnis Petrarcas Briefe und dessen Gedichtsammlung an Laura birgt.
Denn eines ist gewiss: Irgendwo zwischen den Kalkfelsen der Dentelles de Montmirail, den Weinbergen von Gigondas und der trügerischen Idylle von L’Isle-sur-la-Sorgue wartet auf das nächste Opfer der Tod.
ANMERKUNG
Diese Geschichte und alle handelnden Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten und Namensgleichheiten mit toten oder lebenden Personen oder realen Ereignissen wären rein zufällig.
FRANCESCO PETRARCA, SONETT 68 (AN LAURA).
»Es flatterten die goldnen Haare in der Luft, welche sie in tausend anmuthige Locken wand: und das liebliche Licht strahlte flammender als gewöhnlich aus den schönen Augen, dessen sie jetzt fast beraubet sind … Ihr Gang, war nicht der Gang einer Sterblichen, sondern einer Engelsgestalt und ihre Worte tönten anders, als eine menschliche Stimme!«
(Übersetzung von Friedrich Schiller, erschienen in Neue Thalia, 4. Band, 1793)
ERSTER TEIL
DAS PETRARCA-KOMPLOTT
EINS – FREITAGMORGEN
An den Wänden hingen Schwarz-Weiß-Fotos. Porträts, Akte, exotische Reiseländer, Friedhöfe. Szenen einer längst vergangenen Zeit. Einige der Porträtierten erkannte er. Camus war darunter, und auch Picasso. Es gab auch Fotos amerikanisch aussehender Frauen und Männer vor orientalischer Kulisse. Es waren schmale, lässige Typen mit wachen Gesichtern.
Ein antiker Kleiderschrank und einzelne kleine Möbelstücke waren scheinbar wahllos in dem Raum aufgestellt. Dazwischen reihten sich verspielte Leuchter und Spiegel, die bunte Lichtreflexe abstrahlten und dieses Zimmer um immer neue Perspektiven erweiterten. Das Ganze glich einem Museum. Reiseerinnerungen. Jugenderinnerungen. Begegnungen. Die Momentaufnahmen eines Lebens. Im Zentrum dieser Zusammenstellung stand ein Bett. Schwarzes, gedrechseltes Holz wuchs vom gefliesten Fußboden zu einem Baldachin empor, unter dem sich eine Kathedrale des Schlafes ausbreitete. Darauf lag die tote Frau. Sie war zierlich. Ihre blasse, faltige Haut verriet das Alter. Sie war vierundachtzig gewesen.
Kommissar Luc Vidal beugte sich zu dem kleinen Tisch neben dem Bett hinunter, neigte den Kopf zur Seite und las das Etikett einer Weinflasche. »Gigondas«, murmelte er, »ein Signature von zweitausendvier.«
Der Wein hatte Spuren auf das Gesicht der Toten gemalt. Ein intensives Dunkelrot, fast ins Violett gehend, durch das schwach die Haut hindurchschien. An den eingetrockneten Rändern der Verlaufsspuren war die Flüssigkeit zu einer fast schwarzen, krustigen Konsistenz eingetrocknet. Um den Kopf herum war das Laken vom Wein durchfärbt und auf dem Boden lag ein zersplittertes Glas über angetrockneten Weinflecken.
Er drehte sich zu der Frau um, die ihn in das Zimmer begleitet hatte. Amandine Moreau war jung. Eigentlich noch ein Mädchen. Ihr Gesicht war schmal und blass und von langem, goldbraunem Haar gerahmt. Helle Sprenkel von Sommersprossen zeichneten ein lebhaftes Bild auf die schmalen Flügel ihrer Nase. Sie hatte sich bei den wenigen Schritten mit ungewöhnlicher Geschmeidigkeit und Grazie bewegt und stand jetzt an einen schlaksigen Jungen gelehnt. Max, hatte sie ihn Luc Vidal vorgestellt. Ein Deutscher. Ihr Freund. Er spräche gut Französisch.
»Hat Ihre Tante immer nachts im Bett Rotwein getrunken?«
Amandine Moreau nickte. »Und dazu meist noch Zigarillos geraucht«, sagte sie und bewegte ihr Kinn leicht in Richtung des Tisches, auf dem ein Aschenbecher neben der Flasche mit dem Gigondas stand. Ihre Stimme löste eine Gänsehaut bei Luc Vidal aus.
Über dem abgestandenen Rauch lag noch der Duft eines schweren, sinnlichen Parfums. »Ist das Patschuli?«, fragte der Kommissar und die Frau nickte. Dann schnupperte er an den eingetrockneten Resten der Flüssigkeit, streifte einen Handschuh über und schob den Mund der Toten vorsichtig etwas auseinander. Ein roter Tropfen lief aus dem Mundwinkel. »Was macht Sie glauben, dass dies ein Mord war?« Er sah Amandine Moreau aus seiner gebückten Haltung von unten an.
»Intuition!«
»Ahh …! Und deshalb wollten Sie auch, dass jemand von der Kripo kommt.«
Sie nickte wieder. »Und was meinen Sie, Monsieur le Commissaire, habe ich recht?«
Vidal wog den Kopf »Mhh …, es wäre doch möglich, dass ihre Tante sich an dem Wein verschluckt hat und daran erstickt ist. Kommt als Todesursache recht häufig vor. Vor allem bei hohem Alkoholkonsum.«
Er sah Amandine fragend an, die einen Moment lang unentschlossen auf ihrer Unterlippe kaute. »Es passt aber einiges nicht zusammen!«
»Zum Beispiel …?«
»Sie hat im Bett immer Magazine gelesen, aber es liegt keines in ihrem Bett oder am Boden, das hinuntergefallen sein könnte, als sie starb. Alle liegen hier fein säuberlich auf dem Stapel. Und mit dem letzten Schluck im Bett hätte sie sich aufgerichtet, den Zigarillo ausgedrückt und das Glas auf den Tisch gestellt. Wenn sie in diesem Augenblick gestorben wäre, wäre sie wohl aus dem Bett gefallen. Oder der Wein wäre über ihre Brust gelaufen und der Fleck auf dem Laken mehr am Rand des Bettes. Tatsächlich sieht es ja ganz anders aus. Der Fleck befindet sich mehr oder weniger in der Mitte am Kopfende, so als hätte sie im Liegen getrunken.«
»Das scheint allerdings so! Ihre Tante hätte natürlich auch Wein trinken können, ohne dabei zu rauchen oder in einem Magazin zu lesen.«
»Wäre ungewöhnlich gewesen. Sie blätterte immer in den Magazinen, bis sie müde war.«
»Ohne Brille?«
»Sie hat sich die Bilder angesehen. Das ging noch ohne Brille. Gelesen hat sie selten.«
»Dann fehlt uns ja eigentlich nur noch das Motiv für einen Mord! Fällt Ihnen spontan eines ein?«
»Streitereien!«
»Mit wem?«
»Ich glaube mit den meisten.«
»Auch mit Ihnen?«
»Gelegentlich.«
»Kennen Sie Namen?«
»Ein paar … Nachbarn, alte Freunde.«
»Bücher«, mischte sich ihr Freund in das Gespräch ein.
»Bücher?«
»Das Motiv meine ich! … Sie besaß alte Bücher! Antiquarische Werke. Jede Menge. Schätze mal, dass die ein Vermögen wert sind.«
Der Kommissar ließ sich die Bibliothek zeigen. Es war ein Raum voller Magie, mit uralten Bücherregalen aus poliertem Holz, die über zwei Ebenen die hohen Wände bedeckten und deren obere Ebene von einer umlaufenden Galerie erschlossen war. Eine schmale Treppe aus dem gleichen, rötlich glänzenden Holz führte hinauf. Das weite Geviert war mit großen quadratischen Fliesen aus grob behauenem Stein bedeckt und die Luft war erfüllt von dem Duft alter Bücher. Abertausende davon standen in schier endlosen Regalreihen.
Max zeigte Vidal einige Werke aus den Anfängen des Buchdrucks. Dort gab es vereinzelt Lücken, die durch eine luftigere Anordnung der Bücher kaschiert worden waren. Vidal zog eines der Bücher heraus und schlug den ledernen Deckel auf. Dante Alighieri, Commedia, stand auf dem Innentitel. Die Datumsangabe lautete MDII, was, wie er rekonstruierte, 1502 bedeutete. »Vermutlich ist das hier tatsächlich einiges wert.« Er zog sein Handy aus der Tasche und rief im Kommissariat an. »Ich brauche den Erkennungsdienst in Saint-Martin.«
Während sie auf das Team warteten, brachte Amandine Kaffee.
»Sie leben hier allein mit Ihrer Tante!?«
»Nur noch in den Semesterferien. Ich studiere in Paris.«
»Und zuvor haben Sie mit Ihrer Familie hier gewohnt?«
»Bis mein Vater starb. Dann bin ich mit meiner Mutter nach Paris gezogen …«
»… und hat Ihre Tante dieses riesige Haus ganz allein weiter bewohnt?«
»Es hat sie nicht gestört.«
»Keine anderen Verwandten?«
»Ich war ihre letzte.«
»Damit wären Sie Erbin?«
»Vermutlich.«
Vidal machte eine Pause, trank Kaffee und blickte noch einmal fasziniert auf die unglaubliche Bücherflut. »Wann haben Sie die Tote gefunden?«, fragte er schließlich.
»Vorhin. So gegen sieben vielleicht. Wir wollten frühstücken. Ich wollte sie wecken.«
»Und da lag sie tot im Bett?«
»So, wie sie jetzt dort liegt.«
»Wann hatten sie zuletzt mit ihr gesprochen?«
»Gestern Abend. Bevor wir losgefahren sind.«
»Wohin?«
»Zu Freunden nach Avignon.«
»Wann sind Sie zurückgekommen?«
»Das war gegen zwölf«, sagte Max, »ich habe die Turmuhr gehört.«
»Und ist Ihnen da etwas aufgefallen? Unbekannte Fahrzeuge im Ort? Personen, die Sie nicht zuordnen konnten?«
Amandine schüttelte den Kopf. Max strich sich das Kinn. »Ein alter Renault stand ein Stück weit vor dem Stadttor und da wird kein Weinbauer nach seinen Reben geguckt haben.«
»Haben Sie die Nummer behalten?«
»Nein.«
»Und als Sie ins Haus gekommen sind, haben Sie da etwas bemerkt?«
»Nichts. Wir sind davon ausgegangen, dass Claire schläft.«
Während er wieder an seinem Kaffee nippte, betrachtete Kommissar Vidal die Hände von Amandine Moreau. Sie waren feingliedrig mit schmalen, langen Fingern. Er ließ sich Namen von Nachbarn und Bekannten geben – eine kurze Liste alter Menschen – und sie erwähnte einen Mönch. »Der ist mir hier zweimal kurz begegnet.«
»Und die Bekannten ihrer Tante? Was hielt die zusammen? Kartenspiele … gegenseitige Hilfe? …«, fragte Vidal.
Sie schüttelte den Kopf. »Nein. Erinnerungen. Früher war das eine feste Gruppe. Manchmal sind die nachts auf den Mont Ventoux gestiegen und haben Gedichte von Petrarca gelesen.«
»Petrarca? …«
»Der war hier so was wie der Hausheilige.«
»Und der hat nochmal wann gelebt …?«
»Dreizehnhundertirgendwas.«
Vidal zog die Augenbrauen hoch.
Als er das Haus verließ, hatte der Mistral die Wolken des frühen Morgens bereits auseinandergepflügt. Weiße, ausgefranste Schleier zogen rasend südwärts, darüber breitete sich ein immer tiefer werdendes Blau aus. Saint-Martin leuchtete unter dem Ansturm des Lichts in allen Facetten von Ocker. Der Wind schlug Fensterläden in zarten Minztönen, Lavendelblau und Chromoxidgrün klappernd gegen Hauswände und zerrte an blühenden Bougainvilleen und Rosenstöcken, die an Bruchsteinfassaden emporrankten. Dieser verschlafene Ort war die Inkarnation dessen, was die Provence ausmachte. Ein Mord passte eigentlich nicht hierher.
ZWEI
»Kommst du mit zum Essen?«, fragte Nicolas Gauthier.
Luc Vidal sah kurz zu seinem Partner auf und schüttelte den Kopf. »Ich muss mal Diät halten. Die Hemden spannen.«
Gauthier verharrte einen Moment lang und betrachtete Vidal mit einem schiefgezogenen Mundwinkel. »Ich hab heute Morgen beobachtet, wie du im Beisein von Amandine Moreau angestrengt den Bauch eingezogen hast. Hoffst du auf anerkennende Blicke einer Zweiundzwanzigjährigen?«
Gauthier drehte sich mit einem breiten Grinsen um und ging.
Der Mistral hatte an Kraft zugenommen und jetzt fast Sturmstärke erreicht. Er zerrte an allem, was auf dem Weg zum Mittelmeer Widerstand bot, bog Bäume, wirbelte den Staub der Straße auf und komponierte eine beständige Kulisse von klappernden, schlagenden und pfeifenden Tönen. Er würde drei, sechs oder neun Tage andauern. So war es die Regel. Dies rief einen Zustand von Gereiztheit hervor, machte die Nächte sternenklar und die Weitsicht vom Mont Ventoux grandios – und Luc Vidal musste mindestens einen weiteren Tag lang damit rechnen, witterungsbedingt von einer Migräneattacke befallen zu werden. Vidal wollte dem entfliehen. Montag wäre es wieder besser auszuhalten in der Stadt.
Kurz nach vier Uhr verließ er das Kommissariat und meldete sich vom Handy aus bei Amandine Moreau an. Er hielt in Carpentras am Supermarkt und kaufte eine fertige Salatmischung mit mageren Schinkenstreifen und dazu ein kalorienarmes Dressing. Seine Abendmahlzeit, die er in der Remise einnehmen würde, seinem Zufluchtsort seit mehr als einem Jahr. Colombier hieß der Weiler, in dem sich die beiden dringend renovierungsbedürftigen Räume befanden. Luc Vidal empfand das Leben dort als eine wohltuende Abwechslung zu seiner Wohnung in Avignon. Von Saint-Martin aus waren es nur wenige Kilometer dorthin. Arbeit und Bedürfnis nach Abgeschiedenheit erfuhren zumindest in diesem Fall eine räumliche Nähe.
Amandine Moreau schien gefasster zu sein, als er sie wiedersah. Sie war immer noch etwas blass und ihre grünen Augen wirkten müde, sie zeigte aber mehr Körperspannung als am Morgen. Sie war schmal, mit langen Gliedmaßen und stand durchgestreckt, mit leicht angewinkelten Armen vor ihm. Sprungbereit, dachte er, wie eine Katze, die zum Angriff übergeht.
»Legen Sie los«, sagte sie, »was ist in der Nacht passiert? Wurde Claire erstickt?«
»Möglich. Die genaue Todesursache wird die Gerichtsmedizin noch herausfinden. Es braucht Zeit … nächste Woche werden wir mehr wissen.« Er hob die Schultern.
»Wissen Sie wenigstens schon den genauen Todeszeitpunkt? Ich meine, irgendwann ist hier gestern Nacht ein Mörder im Haus gewesen. Und wir wären dem fast in die Arme gelaufen. Der muss sich ja auch durch den Ort bewegt haben. Vielleicht hat ihn jemand beobachtet?«
»Vermutlich starb Ihre Tante zwischen elf und zwölf Uhr.« Er machte eine Pause und ging weiter in die Halle hinein, von der aus Dielen hinter Türen mit Doppelflügeln in weitere Bereiche des Hauses und eine imposante Treppe in die oberen Geschosse führte. »Riesig … hat was von einem Schloss. Wer hier etwas sucht, muss sich verdammt gut auskennen, meinen Sie nicht?« Er lächelte Amandine Moreau an.
»Möglich …«
»Wenn wir einmal davon ausgehen, dass Ihre Tante ermordet wurde, dann scheint der Täter doch sehr gezielt in ihr Schlafzimmer gegangen zu sein, sonst hätte er sich doch vielleicht verlaufen … hätte Lärm erzeugt … irgendwie ihre Aufmerksamkeit geweckt. Aber das schien ja nicht der Fall gewesen zu sein.«
»Irgendwie nicht.« Sie zog eine Grimasse. »Nein, nicht so richtig. Er wird sie überrascht haben.«
»Aber nicht so, dass sie in Panik geraten ist. Sie hat weiter ihren Wein getrunken …«
»Ja. Ist merkwürdig! Wahrscheinlich kannten sie sich. Ich meine, so, dass es nicht ungewöhnlich für sie war, dass er plötzlich in ihrem Schlafzimmer stand.«
»Wir reden immer von einem Er. Könnte doch auch eine Sie gewesen sein.«
»Könnte.«
»Er oder Sie hätte einen Schlüssel haben müssen. Kennen Sie jemanden, der dafür in Frage käme? Der ganz selbstverständlich nachts bei Ihrer Tante im Schlafzimmer auftauchen konnte?«
»Ich weiß nicht. Vielleicht jemand von den alten Freunden. Aber sie war da wohl auch etwas nachlässig. Ich meine, was Schlüssel angeht. Die Schlösser sind alle alt und wer weiß, wer im Laufe der Jahre hier Zutritt hatte …«
»… also, Sie haben keine spezielle Idee, um wen es sich handeln könnte?«
»Nee …« Amandine schüttelte den Kopf. Dann fragte sie beiläufig: »Haben Sie Spuren entdeckt?«
»Haben wir«, sagte er knapp.
Tatsächlich gab es eine Fülle von Spuren, die auf ein reges Kommen und Gehen über den rückwärtigen Eingang des Hauses schließen ließen. Es war hohes Gras niedergetreten worden, es gab Schleifspuren des Gartentors in der Erde und an einem Dornenstrauch war ein Kunststofffetzen hängengeblieben, der von einer Supermarkt-Einkaufstüte stammte. Zudem hatten sie so viele Fingerabdrücke sichern können, dass dies zumindest den Schluss zuließ, in dem Haus würde selten geputzt werden.
»Ich würde mir gerne noch einmal ihre Bibliothek ansehen.« Vidal ging zwei Schritte und blieb dann stehen. »Ihr Freund Max wäre hilfreich. Würden Sie ihn holen?«
Amandine ging an den Fuß der Treppe und rief nach oben: »Max, der Kommissar braucht dich. Komm mal!«
Vidal beobachtete sie von hinten. Sie trug hautenge Jeans. Für einen Moment schweiften seine Gedanken ab, bis Max sich oben über die Brüstung beugte.
»Worum geht’s?«
»Die Bibliothek! Sie scheinen sich dort gut auszukennen.«
»Ist spannend. Ich meine, wo hat man schon mal die Gelegenheit, in so was rumzustöbern. Ungestört und ohne Aufpasser. Uralte Werke, die es sonst kaum mehr gibt und die man woanders nie in die Hand nehmen darf.«
»Zeigen Sie mir, was daran so spannend ist?«
Die Bibliothek der Familie de Roquesteron war imposant. Seit Jahrhunderten hatte man Handschriften und Bücher zusammengetragen. Es gab eine Sammlung von Inkunabeln, Frühdrucke, die bis etwa um das Jahr 1500 gefertigt wurden und denen die typischen Merkmale eines Buchs, wie Titelseite, Kapitelüberschriften oder Seitenzahlen noch fehlten. Aus der Renaissance stammte eine umfangreiche und vermutlich einmal vollständige Sammlung von Werken aus dem Verlag des Venezianers Manutius. In dieser Sammlung hatte Max die deutlichsten Lücken entdeckt und im Internet recherchiert. Nach seinen Erkenntnissen fehlte zum Beispiel das 1513 erschienene Werk von Cicero, Epistolae ad Atticum und das 1505 veröffentlichte Gli Asolani von Pietro Bembo.
»Die haben hier alles in ihre Sammlung aufgenommen, was gedruckt worden ist. So richtig viele Titel waren das in den ersten Jahrhunderten allerdings nicht. Ich meine, nicht so wie heute. Und kaufen kann man die nirgendwo mehr. Höchstens mal bei seltenen Auktionen. Aber so ist im achtzehnten Jahrhundert auch der Name für dieses Haus entstanden – Mille Livre, tausend Bücher. Tatsächlich sind es aber inzwischen vermutlich mehr als hunderttausend. Wenn die Menschen hier im Dorf über das Haus sprechen, nennen sie es das Bücherhaus.«
Nach einer Stunde verließ Luc Vidal die beiden und erreichte nach einer knappen Viertelstunde die Remise in Colombier. Es war eine etwas verwahrloste Idylle im Anbau eines charmanten Landguts, das einer britischen Malerin und Bildhauerin gehörte. Sue Addington kam regelmäßig im April in die Provence, blieb bis September und malte in dieser Zeit abstrakte Landschaften in dunklen, körperreichen Strichen. Luc hatte ihr dabei zugesehen, wie sie eine künstlerische Naturgewalt entfesseln konnte. Es bescherte ihr ein beträchtliches Vermögen.
Sie hatten sich kennengelernt, als am Morgen nach einer Vernissage eines ihrer Gemälde fehlte. Ein ungewöhnlicher Fall, der ihn mehrfach nach Colombier führte. Wenige Wochen nachdem der Fall geklärt gewesen war, hatte die Künstlerin ihn angerufen und ihm die Remise für gelegentliche Landausflüge angeboten. Für einen Spottpreis. Der eigentliche Zweck dieses Angebots war klar: Er würde Bewacher des Anwesens werden. Vidal hatte angenommen.
Die Südflanke des Mont Ventoux lag schon im Abenddunkel, als er Colombier erreichte. Der kahle Kegel wurde vom mattroten Licht einer in der Ferne untergehenden Sonne umspielt, während der Ort von altertümlichen Straßenlaternen bereits goldfarben getüncht war. Er hielt vor dem Bar-Tabac und gönnte sich eine Gitanes Maïs mit einem kleinen Weißen zum Feierabend. Jean-Michel, der seine Vorlieben inzwischen ebenso gut kannte, wie die aller anderen Einwohner, hatte beides schon für Vidal parat, als der zum Tresen kam. Als dann noch der Duft eines Hasenragouts in die Nase des Kommissars drang, das Jean-Michels Frau für den Tag auf die Karte gesetzt hatte, ließ er den gekauften Salat im Auto und verschob seine guten Vorsätze.
DREI
Der Tag hatte die Illusion eines frühen Sommers geweckt. Tupfer frischen Grüns bedeckten in unzähligen Nuancen die Westflanke des Mont Ventoux. Anselm Bernhard saß auf der windgeschützten Steinbank vor dem alten Bauernhaus, das er im Herbst gekauft hatte, und betrachtete den Berg. Der Grat, den er von seinem Platz aus sehen konnte, verlief in einem mäßigen Neigungswinkel beständig in die Höhe. Ein mächtiger, kilometerlanger grüner Keil, der von einem intensiven Blau gesäumt war, das der Mistral an den provenzalischen Himmel malte. Die kahle Kuppe des Bergs blieb hinter dem Anstieg verborgen. Es war kühl. Der eisige Wind fegte das Rhônetal hinab zum Mittelmeer, drückte durch alle Ritzen der altersschwachen Fenster und zerrte lärmend an den wackeligen Fensterläden.
Anselm nahm es gelassen. Zwei arbeitsreiche Wochen und ein lange überfälliger Hausputz lagen hinter ihm. Er belohnte sich dafür mit dem epochalen Blick und einem Gigondas Signature, den er bereits am Mittag dekantiert hatte und der in einer Glaskaraffe temperieren und Sauerstoff ziehen durfte. Eigentlich war es nur eine einfache Cuvée aus Grenache und Syrah, die er in der Caveau, der Weinkellerei am Ortseingang von Gigondas entdeckt hatte. Aber es war ein perfekter Alltagswein, mit einer Struktur, die ihm zunehmend gefiel.
Später am Nachmittag kam Christine aus Paris. Sie war blendend gelaunt. »Ich habe riesige Lust, an diesem Wochenende die Provence zu erobern.« Sie schüttelte die Kaskade brauner Locken und grinste breit. »Bist du mein Mann?«
Anselm trank einen weiteren Schluck von dem Gigondas. »Da kannst du sicher sein!«
Sie drängte den Arm mit dem Weinglas zur Seite, setzte sich auf seinen Schoß und wuschelte in dem ungekämmten verdorrten Steppengras, das Anselms Kopf bedeckte. »Wir machen einen Ausflug nach L’Isle-sur-la-Sorgue, dort suche ich für meinen Vater zum Geburtstag ein hübsches altes Buch und dann machen wir irgendwo Picknick. Ganz idyllisch. An einem einsamen Bach, auf einer Decke, mit Rotwein und Käse. Und wenn es warm genug ist, können wir ein klitzekleines bisschen rumfummeln und unsere nackten Bäuche in die Sonne recken.« Sie küsste ihn auf die Nase. Später kochte er dann.
Sie saßen gemeinsam in der Küche. Ein altertümlicher Gasherd, eine Spüle, ein lärmender Kühlschrank und ein eichener Tisch, der seit Generationen zu diesem Haus zu gehören schien, waren das einzige Mobiliar. Das Holz war vom Gebrauch poliert, nahezu schwarz, mit Furchen und Einkerbungen. An der Kopfseite dominierte ein Kamin, der früher Kochstelle gewesen war und dessen Funktion sich jetzt darauf beschränkte, Büchern ein Platz zu geben. Christine las und Anselm kümmerte sich um Spargel und Erdbeeren aus Carpentras.
»Er muss bissfest sein«, dozierte er.
Christine nickte. »Und das geht wie?«
»Koch einfach die Schalen und holzigen Enden fünfzehn Minuten lang aus und koch dann einmal kurz den Spargel in diesem Sud auf. Danach lässt du ihn mehrere Minuten ohne weitere Wärmezufuhr garen und brätst ihn kurz in etwas Butter in der Pfanne an.«
»Und weiter?«
»Du legst ihn auf vorgewärmte Teller mit der Erdbeer-Vinaigrette, so wie ich es jetzt tue. Und voilà, Madame, Asperge tricolore. Violette Köpfe, weißer Stiel und rote Vinaigrette. Das müsste eine Französin eigentlich von einem Buch ablenken.«
»Tut es!«, sagte sie..
VIER – SONNABEND
Anselm döste auf dem Beifahrersitz und öffnete nur hin und wieder kurz die Augen, wenn Christine ihn auf eine Besonderheit entlang der Strecke hinwies. Der Mistral hatte nachgelassen. Ein hellgrauer Schleier bedeckte den Himmel. Anselm hatte die Wetterveränderung morgens vom Bett aus beobachtet und wäre am liebsten liegen geblieben. Geweckt hatte ihn die Zungenspitze von Christine, die sanft in seiner Ohrmuschel kreiste. Dann hatte er ihre Finger gespürt, die an seinem Bauch hinabglitten. »Ein Teil von dir scheint schon wach zu sein, der Rest sollte jetzt folgen«, hatte sie geflüstert und sein Kinn mit ihren Zähnen umfasst.
Ganz langsam hatten der Duft ihrer Haut, das Kribbeln an seinen Fingerspitzen beim Ertasten ihres Körpers und seine zunehmende Erregung sein Bewusstsein erreicht und die Schläfrigkeit vertrieben. »Du zuerst«, hatte sie dann gegurrt und sich auf den Rücken gerollt. Seine Lippen waren an ihr herabgeglitten, bis er sich lange Zeit ganz auf die akrobatischen Bewegungen seiner Zunge konzentriert hatte. Danach hatte sie ihn opulent belohnt.
Eine Stunde später hielten sie in L’Isle-sur-la-Sorgue und Christine betätigte sich als Fremdenführerin. Die Sorgue, erklärte sie Anselm, umschließe die Insel des Zentrums und entspränge nur wenige Kilometer östlich der größten Quelle Europas, deren Wasser über smaragdgrüne Algen durch die Stadt ströme. Donnerstags sei Wochenmarkt und sonntags der große Provenzalische Markt, der sich praktisch über die ganze Innenstadt und entlang der Flussufer ausbreite. Ein Muss für jeden Touristen und eine Qual für jeden, der Menschenmassen scheue. Der heutige Samstag wäre hingegen ideal und böte die besten Voraussetzungen, um in einigen der vielen Brocantes, den Trödel-Läden, und in Antiquitätengeschäften nach Büchern zu suchen.
Hortense Clement betrieb eines der gediegensten Geschäfte dieser Art, mit ausgesucht hochwertigen Möbeln, stilvollen Accessoire, einigen wenigen, aber reizvollen Gemälden und Grafiken, Büchern und Manufakturwaren aus Glas und Porzellan. Anselm war von der erotischen Ausstrahlung der Frau beeindruckt, die ihn, ganz entgegen seiner Vorlieben, trotz ihrer Üppigkeit erreichte. Hortense Clement war mit routiniertem Lächeln, perfektem Make-up und textiler Extravaganz das eigentliche Juwel in dieser Galaxie polierter Kostbarkeiten. Christines Suche gestaltete sich dagegen langwieriger, als er bereit war, sich mit Antiquitäten und Hortense zu beschäftigen. Er suchte sich vor dem Geschäft einen windstillen Platz in einem weitläufigem, begrüntem Atrium, das von einem Vorderhaus und zahlreichen pavillonartigen Gebäuden begrenzt war. Dort boten gut dreißig Händler Brocantes und Antiquités an. Nach einer halben Stunde kam Christine mit zufriedenem Lächeln zu ihm heraus. Madame Clement verabschiedete sie an der Tür.
»Ich hab ein Buch von Francesco Petrarca gefunden. Bislang unverkäuflich. Sie hat noch keinen Preis. Aber sie ruft mich an und hält es für mich zurück. Ich hab Fotos gemacht. Es ist spannend.«
»Und wie ist die Frau an das Buch gekommen?«
»Ein Kommissionsgeschäft. Es kommt aus einer privaten Bibliothek.«
FÜNF
Luc Vidal sah aus dem Fenster der Remise. Der klare Himmel war einem Grau gewichen. Sein Ausblick auf den Südhang des Ventoux, auf die Weinfelder, Obst- und Olivenplantagen, die bis an den Ortsrand von Colombier reichten, war aber dennoch grandios. Unterhalb des Col de la Madeleine leuchteten rote Ockerfelsen aus dem Grün der Pinien. Er genoss den Blick. Dies war vermutlich der Höhepunkt des Tages. Der Rest würde ermüden.
In Saint-Martin verbrachte er einige Stunden damit, Nachbarn der Toten zu befragen, ohne nennenswerte Erkenntnisse zu gewinnen, und fuhr dann zu einer der Adressen, die Amandine Moreau ihm genannt hatte. Das Haus lag unterhalb gigantischer, senkrecht aufragender scharfkantiger Kalksteinspitzen. Wie hölzerne Gerippe umstanden Rebstöcke das Gebäude und reichten in Reihen bis an den Höhenzug heran, der unvermittelt aus der Hügellandschaft aufstieg.
Vincent Monnier öffnete ihm und ging schleppend an einem Stock gehend voran in die Küche zu seiner Frau, die deutlich agiler wirkte. Hélène Monnier hatte ihr weißes Haar zu einem strengen Knoten gebunden. Sie war größer als ihr Mann, der sich einen Moment lang von seinem Stock getrennt und neben ihr aufgerichtet hatte. »Hier will jemand das Rollenverhältnis klarstellen«, überlegte Vidal. Er fragte die beiden nach der gemeinsamen Jugendzeit, nach den Treffen des Petrarca-Clubs, wie er es nannte, nach den Wanderungen zum Mont Ventoux und den anderen Mitgliedern dieser Gruppe.
»Es gibt nicht mehr viele«, sagte die Frau.
»Wie sind sie eigentlich zusammengekommen?«
»In der Schulzeit.« Vincent hatte einen schmalen Zigarillo aus einer Schachtel genommen. Der Kommissar erkannte, dass es die gleiche Marke war, die auch Claire de Roquesteron geraucht hatte. »Wir alle besuchten das gleiche Lycée. So fand sich diese Truppe zusammen. Claire machte uns mit Petrarca vertraut. Ein romantischer Fokus. Wir hatten eine Symbolfigur, lasen seine Werke, entdeckten für uns die Orte in der Provence, an denen er sich aufgehalten und über die er geschrieben hatte. Malaucène lag nahebei und wir suchten von dort verschiedene Pfade, auf denen Francesco Petrarca zum Gipfel gestiegen sein mochte.«
»In welcher Sprache wurde gelesen?«, unterbrach Vidal.
»Latein. Meist hat Claire übersetzt. Es gab aber auch Bücher auf Italienisch, das konnten einige von uns.«
»Bücher aus der Bibliothek der de Roquesterons?«
»Natürlich. Wir haben immer dort zusammengesessen.«
»Waren Sie ein Jahrgang auf dem Lycée?«
»Mehr oder weniger. Hélène war die jüngste von uns, sie kam auch erst später hinzu.«
»Das heißt, im Wesentlichen waren Sie alle so um die siebzehn, als die Deutschen auch die Provence besetzten.«
»Bis auf Hélène ja.«
»Wie lange hielt diese Gruppe zusammen?«
»Mit Beginn des Krieges veränderten sich einzelne Lebensentwürfe. Politische Ideale wichen stärker voneinander ab als zuvor. Krieg polarisiert eben. Nach der Befreiung haben wir nie wieder vollständig zusammengefunden. Viele haben die Region hier verlassen, um eine Arbeit zu finden oder um zu studieren.«
»Was haben Sie beide gemacht?«
»Ich habe zunächst auch studiert. Maschinenbau. In Paris. Hélène kam später dorthin. Es gab eine Wohnung, in der einige von uns zusammenwohnten. Wo man sich traf. Also ich meine die, die damals in Paris waren.«
»Und dann? Was haben Sie gemacht, als sie nicht mehr studierten?«
Vincent starrte auf die Glutspitze des Zigarillos und schlug zögerlich die Asche ab, die sich an der Spitze gebildet hatte. »Ich bin hierher zurückgekommen«, sagte er und fixierte dabei den Aschenbecher. »Meine Familie brauchte Unterstützung im Olivenbau«, fügte er hinzu.
»Wann war das?«
»Anfang 1950. Damals gab es hier noch Oliven. Die sind erst alle im Februar 1956 beim großen Frost abgestorben ...« Vincent schwieg abrupt und Vidal ließ ihm Zeit, seiner Gefühle wieder Herr zu werden. Er wusste nur zu gut, dass der Frost 1956 für die Menschen in dieser Region die Apokalypse gewesen war. Millionen Olivenbäume waren in einer einzigen Nacht vom Frost gesprengt und die Existenz der Bauern vernichtet worden. »Ich habe dann von Anfang an daran mitgearbeitet, hier in der Region wieder Wein anzubauen, wie das schon in früheren Jahrhunderten getan wurde«, ergänzte der Alte schließlich.
»Und Sie?«, wandte Vidal sich an seine Frau.
»Ich bin Mitte der Fünfziger zurückgekommen.« Den Gefühlsausbruch ihres Mannes hatte sie ungerührt mit einem kurzen seitlichen Blick zur Kenntnis genommen und dann wieder Vidal angesehen.
»Was hatten Sie studiert?«
»Nichts. Meiner Familie fehlte das Geld. Ich habe mich so durchgeschlagen.«
»Und dann doch Paris den Rücken gekehrt?«
»Was blieb mir übrig?«
Vidal war aufgestanden und sah aus dem Fenster auf die Weinberge hinaus. »Sieht schön aus. Da wird in mir wieder mein Jugendtraum wach, einen Weinberg zu bewirtschaften«, sagte er.
Vincent lachte kurz und verächtlich. »Seien Sie froh, dass Sie bei der Polizei ein geregeltes Einkommen haben. Weinbau ist nur interessant, wenn man genügend Fläche hat und die Parzellen groß genug für eine wirtschaftliche Bearbeitung sind. Wir haben nur winzige Flecken über einen weiten Umkreis verstreut. Um überhaupt vernünftig produzieren zu können, mussten wir immer hinzupachten. Da bleibt kaum etwas über. Knochenarbeit für kargen Lohn.«
»Die verstorbene Claire de Roquesteron besaß Weinberge, die sie verpachtet hatte. Konnte sie davon leben?«
Die beiden Alten sahen sich kurz an und schwiegen.
»Konnte sie?«, insistierte Vidal.
Hélène trat zu Vidal ans Fenster und sah ebenfalls hinaus. »Besser als wir!«, sagte sie schließlich.
»Was hat sie mit ihrem Geld gemacht? Bislang haben wir kaum Barvermögen entdeckt?«
»Vielleicht hat Sie’s ja dem Mönch gegeben.«
»Dem Mönch?«
SECHS
An der Tür der Remise hing ein Leinenbeutel mit einer Aufschrift auf Englisch. Es war ein Zeichen dafür, dass Sue Addington angereist war. Seine Vermieterin genoss die französische Küche mit uneingeschränkter Begeisterung, versuchte aber gelegentlich, Luc Vidal davon zu überzeugen, dass Großbritannien keine kulinarische Diaspora ist.
Er ahnte den Inhalt des Beutels. Meist bestand das Mitbringsel aus Cheddar und Blue Stilton, zwei Käsesorten, von denen er nur dem Blauschimmel etwas abgewinnen konnte; klassischer Mint Sauce, die er mit einem leichten Schauer in einer Schublade verstaute; Thin Cut Orange Marmalade, die er tatsächlich gern zum Frühstück aß; Dark Chocolate Ginger Royals Shortbread, das meist als Gebäck bei Besprechungen im Kommissariat Verwendung fand; Earl Grey Tea, den er verschenkte und verdammt guten Malt Whisky, den er ganz für sich allein genoss. Die Künstlerin hatte ihn nie gefragt, was er von ihrer Delikatessenauswahl hielt.
Im Haupthaus brannte kein Licht und so vermutete Luc Vidal sie bei Jean-Michel und Maud, die an Samstagabenden in dem kleinen Saal hinter dem Bar-Tabac das Dorf bewirteten. Es gab stets zwei Vorspeisen zur Auswahl, eine Terrine de sanglier, eine Wildschweinpastete mit grünem Salat oder einen Salade de chèvre chaud, dem folgte ein Hauptgericht, das traditionell Lamm oder Wildschwein auf Dinkel aus Sault war und von Maud in tönernen Auflaufformen mit sehr viel Thymian, Rosmarin, Knoblauch und Oliven für den gleichzeitigen Ansturm von gut hundert hungrigen Gästen vorbereitet und gebacken worden war und so ohne zeitliche Verzögerungen serviert werden konnte. Dazu gab es Wein aus der lokalen Winzergenossenschaft, der in großen Glaskaraffen auf die Tische gestellt und in beachtlichen Mengen konsumiert wurde, bis schließlich riesige Käseplatten die Runde von Tisch zu Tisch machten, gefolgt von vereinzelten Wünschen nach einer hausgemachten Crème Caramel, Kaffee und Digestifs.
Als Luc Vidal im Chez Maud, wie er den Bar-Tabac getauft hatte, ankam, waren Raumtemperatur und Stimmung schon deutlich erhöht. Maud balancierte zwei große Tabletts mit Auflaufformen durch die eng gestellten Tischreihen, wobei sie es noch fertig brachte, ihm im Vorbeigehen mit einem breiten Lächeln einen Ellenbogen kokett in die Seite zu stoßen. Vidal bekam am Tresen seinen kleinen Weißen und Maud raunte ihm auf ihrem Rückweg in die Küche zu, sie werde ihm einen Platz neben Sue decken, die sich mit dem Bürgermeister und seiner Frau gerade ziemlich langweile.
Im Saal hatten alle sein Kommen beobachtet. Der Mord war, wie in Saint-Martin, auch hier das Hauptthema der dörflichen Gespräche. Und so sammelte Luc Vidal ungewollt Ratschläge, Ermunterungen und geflüsterte Hinweise, bevor er sich auf den Stuhl neben Sue Addington zwängen konnte.
Sie legte kurz ihre Hand auf seine. Dann setzte sie eine Diskussion mit dem Bürgermeister fort, bei der es um eine ständige Ausstellung ihrer Gemälde in Colombier ging. Das Museum war seine Lieblingsidee, für die er ebenso hartnäckig wie erfolglos bei der Künstlerin warb.
»Ich arbeite zurzeit viel an Skulpturen«, sagte sie, »vielleicht stelle ich einige vor dem Haus auf.« Sie lächelte besänftigend.
SIEBEN – SONNTAG
Sie ließen sich von der Menschenmasse treiben, die sich aus dem Ort in Richtung der Sorguequelle bewegte. Es war später Vormittag, kühl und trotzdem voll. Anselm hatte zwar gelesen, dass Fontaine-de-Vaucluse ein Touristenmagnet sei, aber nicht mit dieser Fülle gerechnet. Zehn Minuten lang trotteten sie im Schwarm der Besucher mit, der sich immer tiefer in das enger werdende Tal hineinbewegte. Schließlich standen sie in einer Traube von Menschen vor dem riesigen Kessel, der sich am Fuß einer lotrecht aufragenden Felswand von beeindruckender Höhe aus der Tiefe öffnete. Eine unfassbare Menge Wasser drückte aus dem dreihundert Meter tiefen Schlund empor, um brodelnd als weiße Gischt über Felsklippen ins Tal zu stürzen. Es war Faszination pur und Anselm konnte jetzt verstehen, dass sich alljährlich Hundertausende auf den Weg machten, um dieses Naturschauspiel zu erleben. Vallis Clausa, das geschlossene Tal, hatten die Römer diesen Fleck Erde benannt und Petrarca war davon begeistert gewesen.
»Er ist 1337 von Avignon hierher gezogen«, erläuterte Christine. »Die Papststadt hat ihn ziemlich angeekelt. Zuviel Kommerz. Hier hat der Mann mehrheitlich seine Werke verfasst. Ohne die Touristen muss es ein Paradies gewesen sein.« Das kristallklare Wasser der Sorgue floss wenige hundert Meter unterhalb der Quelle bereits als Fluss mit rasender Geschwindigkeit durch eine fantastische Landschaft, die von einer über dem Tal gelegenen Burgruine gekrönt wurde. Unterhalb der Burg lag das Petrarca-Museum in einem kleinen Haus, das vollkommen an die geneigte Felswand geschmiegt war. Hier hatte der Dichter gelebt und in makelloser Schönschrift Abertausende von Seiten gefüllt. Christine war euphorisiert von der Vorstellung, möglicherweise bald eines der ersten Druckwerke seiner Texte zu besitzen.
Von diesem Tal aus hatte der Dichter sich jahrelang bewegt, meist zu Fuß. Der Radius war begrenzt gewesen, die Kontakte waren es nicht. Es hatten Fürsten, mächtige Geistliche, Philosophen und Dichter dazu gezählt. Christine erzählte Anselm über König Robert von Anjou, einen bedeutenden Förderer von Petrarcas Dichtung, zu dessen provenzalischem Besitz die Papststadt Avignon gehörte hatte und dessen neapolitanisches Königreich wiederum ein Lehen des in Avignon residierenden Papstes gewesen war. Und sie erzählte, dass Petrarca eine enge Freundschaft zu Philippe de Cabassole gepflegt hatte, dem Bischof von Cavaillon, zu dessen Diözese die Burg oberhalb Petrarcas Hauses gehörte.
»Seit wann begeistert dich der Mann eigentlich?«
»Weiß nicht. Irgendwann. Mein Vater hat mir viel von ihm erzählt. Er ist geradezu ein Fan. So weit geht das bei mir nicht, aber er interessiert mich als Person total. Muss ein außergewöhnlicher Mensch gewesen sein. Dichter, Gelehrter, Emissär für weltliche Fürsten und Kleriker, der in ganz Europa unterwegs war und die Geschicke der damaligen Staaten maßgeblich mitgestaltet hat. Er wollte Italien zur Weltmacht führen, wie es Rom einst gewesen war. Er hat die italienische Sprache maßgeblich entwickelt, hat daran gearbeitet, dass Rom wieder zum Papstsitz würde, hat es geschafft, nach Jahrhunderten als erster wieder auf dem Kapitol in Rom zum Dichterfürsten gekrönt zu werden.«
»Woher weiß man das alles?«, fragte Anselm skeptisch.
»Er hat unentwegt über sich selbst geschrieben. In rund sechshundert Briefen an seine Freunde, die in Europa verteilt lebten.«
»Und die haben seine Briefe dann als Buch herausgegeben?«
»Nein. Verlegt worden ist das erst rund hundert Jahre später. Als der Buchdruck das einigermaßen wirtschaftlich ermöglichte. Also, seit Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts etwa. Bis dahin gab es nur handschriftliche Kopien in Kleinstauflagen. Auch seine Dichtungen sind Zeit seines Lebens nicht für die Allgemeinheit veröffentlicht worden. Er war zwar als größter Dichter seiner Zeit anerkannt, aber eben nur von den wenigen, die in den Genuss der handschriftlichen Kopien seiner Werke kamen. Und das waren seine persönlichen Freunde und Gönner.«
Sie setzten sich unter tief hängende Äste alter Bäume, die einen Seitenarm der Sorgue überschatteten. Ein Angler ließ von der Uferbefestigung aus mit fließenden Bewegungen seine Rute vor und zurück schnellen, an deren Ende die Schnur mit der Fliege über das Wasser schoss; zwei Kinder inspizierten die alten Wassersysteme, die an dieser Stelle einmal eine Mühle angetrieben hatten und eine kleine Gruppe stand abwartend vor dem Eingang des Museums.
»Und was hat Petrarca dann schlussendlich so berühmt gemacht, dass man ihm hier sogar ein Museum gewidmet hat?«
»Vieles an seiner Dichtung war richtungsweisend. Und das über Jahrhunderte. Auch euer Goethe ist entscheidend durch ihn geprägt worden. Ich glaube am Nachhaltigsten haben aber seine dreihundertsechsundsechzig Liebesgedichte an eine Laura seinen Ruhm begründet. Die Frau ist der Nachwelt ein Rätsel geblieben, ein Mythos. Die Gedichtsammlung ist als Canzoniere bekannt geworden.«
»Und Laura, was war an der so sagenhaft?«
»Sie taucht namentlich nur einmal in den Versen auf und niemand hat eine wirkliche Ahnung, wer das Mädchen gewesen sein soll. Bei Petrarca steht sie für Schönheit, Sehnsucht, Leidenschaft und Liebesschmerz. Es haben sich dann später unzählige Legenden darum gerankt. Und so sind Laura und Petrarca zu dem großen Liebespaar der Provence aufgestiegen. Eine tragische, unerfüllte und traurige Liebe. Ganz wie bei Romeo und Julia. Bei Petrarca stirbt nicht er, der Romeo, sondern ausschließlich Laura. Er beklagt ihren Tod in seinen Versen.«
»Wie herzzerreißend! Wir brauchen an tragischen Liebesgeschichten, was wir nur bekommen können.«
»Zyniker!«
Er stand auf und warf einen flachen Kiesel auf die Wasseroberfläche. Zweimal hüpfte der Stein gegen den rasenden Flusslauf, dann verschwand er und mit ihm stob eine Gruppe Forellen auseinander, was den missbilligenden Blick des Anglers zur Folge hatte. »Und wann ruft Hortense Clemente dich wegen deines Petrarca-Buches an?«
»Irgendwann nächste Woche, hat sie gesagt. Und noch ist es ja auch nicht meins.«
»Bis zu welchem Preis kaufst du?«
Christine schwieg einen Moment. »Ich hoffe auf unter fünfhundert. Für mehr fehlt mir im Moment die Kohle. Aber es wäre ein wirklich tolles Geschenk für Papa.«
ACHT
Hortense Clement sah noch einmal auf den Scheck von Le Crédit Lyonnais. Mit wuchtigen Ziffern war die Summe von eintausendvierhundert Euro darauf geschrieben. Die einzige Einnahme an diesem Sonntagvormittag. Der Verkauf einer Sammlung von zwölf Likörgläsern und vier dazugehörigen Karaffen aus der Époque Napoléon III. Ein Kommissionsgeschäft mit sehr magerem Gewinn. Sie steckte den Scheck zusammen mit einem Einreichungsformular in einen Briefumschlag, den sie auf dem Heimweg bei ihrer Bank einwerfen würde, strich den Klebestreifen des Umschlags über ihre feuchte Zunge und verschloss ihn. Sie musste in naher Zeit noch einmal gründlich darüber nachdenken, ob es wirklich lohnend war, den Laden sonntags geöffnet zu halten. Gewiss, an keinem anderen Tag waren dermaßen viele Menschen im Ort, um den Provenzalischen Markt zu besuchen. Zehntausende drängten sich den gesamten Vormittag über durch die engen Gassen im Zentrum von L’Isle-sur-la-Sorgue und entlang der Flussufer, und viele davon schauten auch in die Antiquitätengeschäfte. Ernsthafte Kaufinteressenten waren aber nur wenige darunter. Meist waren es Touristen. Ständig musste sie aufpassen, dass diese Besucher nichts umwarfen, zerstörten oder klauten.
Sie hatte um halb zwei das Geschäft abgeschlossen und die Beleuchtung ausgestellt. Von dem kleinen Sekretär aus, der in unmittelbarer Nähe des Eingangs stand und der ihr gleichermaßen Empfang wie Büro war, beobachtete sie das langsame Abebben der Besucherströme in dem weitläufigen Atrium. Das Plätschern des Springbrunnens, der diesen Hof in zwei Bereiche gliederte, wurde nicht länger von dem Lärm der Menschenmassen übertönt und drang nun deutlich in die Stille des Ladens hinein.
Vereinzelt blieben Paare vor dem dunklen Schaufenster stehen und zeigten sich gegenseitig Entdeckungen unter den ausgestellten Stücken. Meist drängte sich dann einer, mit der Hand das Sonnenlicht abschirmend, gegen das Glas, um einen Preis erkennen zu können. Hortense wusste stets im Voraus, welche Reaktion sich anschließen würde. Sie kannte ihre Klientel und sie konnte potenzielle Interessenten sehr gut von reinen Sehleuten unterscheiden. Interessenten neigten dazu, mit dem Kopf zu wiegen, wenn sie einen Preis erkannt hatten, und eine kurze, meist lebhafte Diskussion miteinander zu führen, bevor sie weitergingen. Sehleute gestikulierten wild und lachten übertrieben.
Einer nach dem anderen hatten auch ihre Kollegen aus den umliegenden Läden das Atrium verlassen, um noch einen Aperitif vor dem Mittagessen einzunehmen. Sie versagte sich beides. Zunehmend fiel es ihr schwer, die ohnehin schon stattliche Körperfülle nicht noch weiter anwachsen zu lassen. Mit Anfang fünfzig war sie zwar immer noch eine attraktive Frau, aber eben für ihren Geschmack deutlich zu füllig.
Sie beneidete diese Christine Dubois, die am Samstag bei ihr gewesen war und sich so intensiv für das Petrarca-Buch interessiert hatte. Diese Frau war groß, schlank und doch außerordentlich weiblich. Jede Rundung saß an der richtigen Stelle, üppig und prachtvoll. Ihre eigenen Rundungen drängten hingegen mehr aus der Körpermitte heraus und jeder noch so kleine Aperitif und jede verzichtbare Nahrung verstärkten diesen Zustand bleibend und scheinbar unmittelbar. Madame Dubois kannte diese Probleme vermutlich nicht. Ihre Liebhaber mussten glückliche Männer sein.
Diese junge Frau hatte unbedingt das Buch kaufen wollen, das sie aber selber erst vor wenigen Tagen hereinbekommen hatte. Sie hatte noch nicht einmal Zeit gehabt, den Band zu prüfen oder eine Expertise einzuholen. Christine Dubois musste warten. Das Buch konnte wenige hundert Euro wert sein, aber auch mehrere zehntausend. Da war eine gründliche Recherche nötig, die sie mit aller gebührender Sorgfalt und Zeit durchführen würde.
Hortense seufzte. Sie hielt einen Moment lang unschlüssig den Umschlag in der Hand und genoss die Stille, die sie umgab. Sie würde vielleicht doch etwas zu Mittag essen. Einen Salat, nur mit wenigen Tropfen Olivenöl und etwas Balsamico angemacht. Blattsalat, mit einigen Streifen roter Paprika und hauchdünnen Zwiebelringen, die etwas Schärfe brächten. Sie würde auf Baguette verzichten und lediglich Mineralwasser dazu trinken. Das wäre ein guter Kompromiss. Der Sonntag ganz ohne Mittagessen würde zu freudlos sein.
Die leisen Kratzgeräusche, die aus der Tiefe des Ladens nach vorne drangen, waren ihr über den Gedanken an den Salat nicht gleich bewusst geworden. Jetzt lauschte sie angespannt auf diese unwirklichen Laute.
Es konnte eine Maus sein. Ein lästiger kleiner Nager mit hohem Schädigungspotenzial. Ihre Kunden wären wenig erheitert, Mäusekot in den Schubladen einer exklusiven Louis XIV-Kommode zu finden oder gar Nagespuren an bibliophilen Schätzen. Sie würde noch am Nachmittag Fallen aufstellen und Montag vor Geschäftsbeginn kontrollieren müssen.
Tatsächlich war das Geräusch jetzt lauter geworden, es klang schwerer, schleifender. Für eine Maus unpassend. Eine streunende Katze könnte hier ein Versteck gesucht haben, vielleicht, um in einem unzugänglichen Winkel Junge zu gebären. Andererseits bot die Stadt für Katzen Unmengen geeigneterer Plätze für eine Geburt als gerade ein Ladenlokal, in dem sich an diesem Vormittag Dutzende von Menschen in jeden Winkel gezwängt hatten.
Es wäre dabei natürlich auch für einen Menschen möglich gewesen, sich zwischen den eng beieinanderstehenden Möbeln zu verstecken. Jemand, der von ihr unbemerkt in den Laden getreten war, als sie sich um andere kümmern musste, und der sich dann zwischen den Großmöbeln einen sichtgeschützten Platz gesucht hatte. Aber warum sollte das jemand machen? Um sie zu berauben? In so gut wie keinem Antiquitätengeschäft wäre Bargeld zu finden. Die Kunden zahlten mit EC- oder Kreditkarten und Franzosen gern auch mit Schecks. Aber selbst die wären für einen Gelegenheitsdieb kaum einlösbar. Sie sah auf den Umschlag, den sie noch immer in der Hand hielt. Natürlich konnte es Menschen geben, denen dies nicht bewusst war. Drogenabhängige etwa, die mit starkem Suchtdruck versuchten, an Geld zu gelangen, um sich wieder das Gehirn vernebeln zu können. Manchen sah man die Sucht nicht an. Und inmitten der bunten Lässigkeit, mit der die Touristen auftraten, fiele vermutlich nicht einmal eine gewisse Verwahrlosung auf. In Hortense kam Wut auf. Nein, ein Junkie sollte hier in ihrem Reich nichts in die Hände bekommen, was er für Heroin oder was immer er auch brauchte, verwenden könnte.
Sie stand auf und ging einen Schritt auf den rückwärtigen Ladenteil zu, besann sich aber und kam noch einmal zu dem Sekretär zurück. Seit Monaten benutzte sie einen schlanken Brieföffner, dessen verzierter Elfenbeingriff gut in der Hand lag. Ein wunderschönes Stück, mit einer Klinge aus Damaszener Stahl, für das sich schon viele Kunden interessiert hatten, von dem sie sich aber bislang nicht hatte trennen können. Jetzt würde dieser Brieföffner, dessen Länge und Klingenbeschaffenheit ihn eigentlich mehr zu einer handlichen Waffe machten, einem Eindringling den notwendigen Respekt abverlangen.
Entschieden trat sie den Weg in die engen Winkel ihres Ladens an, aus denen zwischen wuchtigen Eichentischen, mächtigen Bauernschränken, verspielten Salonmöbeln und ausladenden Skulpturen die Geräusche erklungen waren.
Das Halbdunkel in diesem Bereich erwies sich als hinderlich. Sie stieß mehrfach gegen Möbelstücke, die sich geräuschvoll verschoben. Ein heimliches Vordringen war damit unmöglich geworden und sie entschied sich, den Angriff direkt lautstark zu verkünden, ohne Zurückhaltung oder sorgsame Wortwahl. »Du Scheißpenner wirst mir hier nichts klauen!«, brüllte sie, sich mit dem Brieföffner voran den Weg durch das Möbellabyrinth bahnend, bis sie unvermittelt vor dem Eindringling stand. Was sie sah, entsprach nicht ihrer Erwartung. Die Überraschung war so nachdrücklich, dass sie die Hand mit dem Brieföffner sinken ließ. Sie starrte in das Gesicht ihres Gegenübers, dann auf den Gegenstand, der über ihr schwebte.
Es war eines ihrer Lieblingsstücke. Pure koloniale Dekadenz und die Zierde eines jeden Boudoirs. Ein Lampenneger, wie sie es ausdrückte, wobei sie sich bewusst war, dass dies kaum als gesellschaftlich korrekte Bezeichnung gelten würde. Aber Lampensklave afrikanischer Herkunft klang einfach zu dämlich. Sie hatte die Plastik, die in ihrer Entstehungszeit vermutlich eine Öllampe in den hochgereckten Händen gehalten hatte, die aber ohne Lampe bei ihr angekommen war, eigenhändig mit einer elektrischen Beleuchtung im Jugendstil ausgestattet, die ihr aus ihrem Bestand als passend erschienen war. Eine sehr gelungene Kombination, die überdies genug Licht nach unten abstrahlte, um den Körper des Knaben hinreichend zu erleuchten. Er war schwarz wie Ebenholz und ein wahres Prachtstück von einem nackten Jüngling. Jeden einzelnen Muskel und Knochen hatte der Schöpfer dieses Werkes herausgearbeitet und in eine aufreizende Position gebracht. Allein die knackigen Arschbacken hatten Hortense immer wieder in Begeisterung versetzt ebenso, wie die sorgfältige Gestaltung eines prächtigen Penis, den sie sich etwas erigierter gewünscht hätte. Der Knabe trug als einziges Kleidungsstück und Zeichen seines Sklavenstandes einen bunten Turban, unter dem der krause Haarschopf gänzlich verschwand. Darunter zeigte sich ein Gesicht mit schmalen Lippen und einer auffallend schmalen, graden Nase, die davon zeugte, dass hier ein Künstler ohne größere ethnologische Interessen nach einem eher europäischen Modell gearbeitet hatte.
Jetzt sah sie aus dem Augenwinkel, dass sich diese schmale Nase mit großer Geschwindigkeit auf sie zubewegte. Sie behielt dabei den Penis fest im Blick, bis sich die Nase in ihre Kopfhaut bohrte und sich ein aberwitziger Schmerz vom Schädelknochen über den gesamten Kopf ausbreitete. Die wunderbar glänzende schwarze Gestalt erhob sich erneut vor ihr, während sie wankend Halt an einem Möbel suchte. Wieder traf die Nase ihre Schädeldecke, die gleichzeitig mit der Skulptur zerbarst und Hortense in die Bruchstücke der Lampenkonstruktion schleuderte.
NEUN
Zacharias Murray malte schnell. Das beeindruckte seine Studenten. Von denen wollte später zwar keiner Kunstmaler, sondern meist Web- oder Modedesigner werden, aber Professor Murray war ein Idol. Noch bevor die Kids aus den USA einflogen, um in der mittelalterlichen Idylle von Lacoste Design zu studieren, war ihnen Zac Murray ein Begriff und sie hatten von der traumwandlerischen Sicherheit gehört, mit der er Landschaften, ein beliebiges Sujet oder Porträt mit atemberaubender Geschwindigkeit auf ein Papier bannte.
Noch größere Bewunderung erntete Murray, wenn er in L’Isle-sur-la-Sorgue sonntags seine Staffeleien aufbaute und in Serie malte. Er kam stets früh, um die beste Stelle im Park am Flussufer zu besetzen. Die kleine Plattform dort wurde gern auch von Sängern, Artisten oder Kunsthandwerkern genutzt. Sie lag etwas oberhalb des Flussufers unmittelbar neben der Brücke zur Altstadtinsel, auf der sich viele Hundert Marktstände dicht an dicht aneinanderreihten. Hier kam jeder der sonntäglichen Besucher des großen Provenzalischen Marktes vorbei. Abertausende drängten den schmalen Gang entlang, der den beeindruckenden Namen Allée du 18 Juin trug. Vom Trödelmarkt, der sich zwischen Hauptstraße und dem Kanal erstreckte, führte die Allee vorbei an Ständen mit afrikanischem Schmuck und Modeaccessoires. Unweigerlich blickten die Touristen dann zu Murray und seinen Staffeleien. Spätestens, wenn sie sich auf der Brücke über der Sorgue von anderen Touristen fotografieren ließen oder einfach nur fasziniert auf das kristallklare Wasser schauten, fragten sie sich, was jemand mit acht Staffeleien gleichzeitig anstellte.
Zac malte parallel das gleiche Motiv: Die Sorgue, mit Blick auf die alten provenzalischen Häuser im Hintergrund und die üppig beladenen Marktstände am jenseitigen Ufer, vor denen sich die Besucher drängten. Es war ein prachtvolles Motiv, mehr Provence und Farbigkeit war kaum irgendwo vorhanden. Der smaragdgrün leuchtende Fluss verlief diagonal in der Bildmitte. Rechts wurde dieses Hauptelement seiner Bilder durch unzählige Schattierungen von Ocker an den Hausfassaden, dem Spektrum der provenzalischen Rundpfannen von Indischgelb bis Krapprot auf den Dächern und von dem Feuerwerk kleiner Farbtupfer entlang der Marktstände begleitet. Links bildeten das tiefe Zinnobergrün der Parkbäume und das pittoreske Gebäude der Caisse d’Epargne mit dem beeindruckenden Mühlrad den notwendigen Kontrast. Über allem gipfelte der Himmel, meist in einer Bläue, die seit van Gogh immer wieder Maler versucht hatten, auch nur ansatzweise darstellen zu können.
Zac wanderte von einer Staffelei zur anderen, konturierte mit Buntstiften unter Einhaltung einer fotografisch exakten Perspektive, legte flächige Grundtöne an und begann von jeweils verschiedenen Ecken der kleinen Kunstwerke aus, die kräftigen Farben aufzutragen. Er ließ den genauen Malablauf in den unterschiedlichen Fortschritten der Bilder für die Besucher erkennbar, die sich in Trauben um ihn scharten. Murray war in seinem Element. Das Bad in der Menge war ihm deutlich wichtiger als der Verkauf der Gemälde, die ihm angenehmerweise noch ein charmantes Zusatzeinkommen zu seinem Professorengehalt verschafften.
Er entsprach dabei vollständig dem Klischeebild eines Landschaftsmalers, mit weiter, chamoisfarbener Leinenhose; einem bunt getupften Hemd, das von der Größe eines Zeltes über seinen wuchtigen Körper hing und einem beachtlichen Haarwuchs auf seinen Armen und der Brust freien Raum bot; mit wallendem Bart und einem breitkrempigen, an den Rändern ausgefransten Basthut über dem Gesamtkunstwerk Künstler. Während er malte, sprach er fast ununterbrochen meist mit mehreren der Zuschauer gleichzeitig und teilweise dozierend auch mit allen. In breitem Amerikanisch, durchsetzt mit fließendem Französisch, welches er mit einem so deutlichen Akzent aussprach, dass niemand auf die Idee hätte kommen können, er wäre woanders beheimatet als in den USA. Zac liebte diese Inszenierung.
Dieser Sonntag hatte in der langen Folge der Sorgue-Motive eine Variante mit blassblauem Himmel erfordert, den Murray allerdings mit einigen Inseln jenes Van-Gogh-Blaus ausgestattet hatte, das die Kunden nun einmal von einem Provence-Gemälde erwarteten.
Kurz vor Ende des Marktvormittags begann sich der Besucherstrom zu lichten. Kleine Gruppen saßen unterhalb von seinem Standort an der Uferpromenade und picknickten. Ein junges Paar vergnügte sich knutschend neben dem Mühlrad. Die Chansonnette, die am Brunnen den Vormittag über BrelLieder vorgetragen und sich dabei mit dem Akkordeon selbst begleitet hatte, packte ihr Instrument ein und ließ nur noch den kleinen Tisch mit CDs ihrer Darbietungen für letzte Käufer stehen. Sie war hochtalentiert, wie Zac anerkennend trotz seines Redeflusses herausgehört hatte, eigentlich gebührte ihr das Pariser Olympia und nicht der Standort am Rande des Sonntagsmarktes von L’Isle-sur-la-Sorgue. Er selbst hatte fast alle Aquarelle verkauft und plauderte danach angeregt mit einer Niederländerin über Malerei, seinem Lieblingsthema, wie auch ihrem, was ihr zudem ein Anliegen von nationaler Bedeutung war, schließlich waren der Niederländer Vincent van Gogh und die Provence nahezu synonym.
Durch das noch lichte Laub blickte er über den Brunnen hinweg auf die Avenue des Quatres Otages. Es war zu einem Hobby von ihm geworden, dabei die Touristen von den Einheimischen zu unterscheiden und einzelne von ihnen wiederzuerkennen. Er konnte zahlreiche Besitzer der Antiquitätengeschäfte identifizieren, die ihre Läden bereits geschlossen hatten und auf dem Weg nach Hause, in eine Bar oder ein Restaurant waren.
Er hatte damit gerechnet, dass, pünktlich wie immer, auch Hortense Clement das Atrium des Magasin d’antiquités in Richtung Post verlassen und bei der Banque Populaire einen Umschlag einwerfen würde, der, wie er vermutete, ihre Tageseinnahmen enthielt. Die Frau faszinierte ihn, seit er sie das erste Mal bewusst wahrgenommen hatte: ihre weibliche Üppigkeit, ihre Extravaganz, ihr Stil. Er war ihretwegen bereits mehrfach früher aufgebrochen, um sie durch das Schaufenster in ihrem Laden bewundern zu können. Irgendwann würde er sie ansprechen. Was hatte er zu verlieren? Und schließlich war er nicht irgendwer. Kein einfacher Markthändler, kein brotloser Künstler, der versuchte, auf Märkten sein Überleben zu sichern. Er war Dozent einer renommierten Universität, einer Design-Institution an allen ihren Standorten weltweit. Er war ein bedeutender Mann.
Als um zwei Uhr die letzten Markthändler ihre Lieferwagen bepackten und aus dem Labyrinth der Gassen zur Hauptstraße manövrierten, war Hortense noch immer nicht auszumachen. Es würde ihn ärgern, sie an diesem Sonntag zu verpassen. Tatsächlich hätte dies das Vergnügen deutlich geschmälert, dass ihn der Tag an diesem Ort sonst stets bereitete. Er betrachtete es schließlich als ein Omen. Vielleicht sollte er ihr an diesem Tag als allerletzter Kunde in ihrem Laden begegnen und sie in ein geistreiches und charmantes Gespräch verwickeln. Er würde Esprit zeigen, Verve, Scharfsinn und ein hohes Maß an Fachwissen in der Kunst. Er würde sie beeindrucken und für sich einnehmen können und möglicherweise ließe sich sogar eine Einladung zum Abendessen aussprechen, verbunden mit dem Angebot, ihr den Zauber von Lacoste und die wunderbaren alten Gebäude der Universität zu zeigen. Man würde in das Café de la Gare in Bonnieux gehen. Das Essen dort war exzellent und bot immer einen guten Anlass über den britischen Autor Peter Mayle zu sprechen, der das Restaurant mit seinem ersten Buch weltberühmt gemacht hatte. Ein äußerst unterhaltsames Thema. Lieber noch würde er das Café de la Poste in Goult angesteuern, in dem man auch die Chance hatte, John Malkovich zu treffen, der unterhalb des Ortes wohnte, oder gar Johny Depp und Vanessa Paradis mit ihren Kindern, die ebenfalls nahebei wohnten. Leider hatte das Restaurant aber nur mittags geöffnet.
Zac Murray verstaute seine Malutensilien auf einer mitgebrachten Handkarre und schob diesen quer durch den Park zum Atrium des Magasin d’antiquités, dem Königreich der Antiquitäten, das Hortense mit dreißig ihrer Kollegen teilte.
Seine Enttäuschung war groß, als er das Atrium verlassen vorfand. Die Exponate in den prächtigen Verkaufsräumen der alten Gebäude lagen im Dunkeln. Jalousien waren herabgelassen und über allem lag die schläfrige Stille des Mittags. Auch in dem Geschäft von Hortense Clement war kein Licht mehr auszumachen. Er beschattete seine Augen und drückte die Nase gegen das Glas, um besser in den Laden hineinschauen zu können, entdeckte dort aber keine Hortense. Als er sich gerade umdrehte, um das Atrium zu verlassen, hörte er hinter sich Schritte. Eilige Schritte, die beschleunigt wurden und in ein schleppendes Laufen übergingen. Er sah sich nach dem Geräusch um, das in dem menschenleeren Atrium unwirklich und deplatziert klang und machte eine schmale hohe Gestalt in einem dunklen, wehenden Umhang aus, die zum rückwärtigen Ausgang des Atriums lief. Der eigentümliche Klang der Schritte setzte sich in seiner Erinnerung fest.
ZEHN – MONTAG
Das Atrium war weiträumig abgesperrt und der Verkehr entlang der Sorgue umgeleitet worden. Selbst die Brücke, die von der Altstadt herüberführte, war von der Polizei besetzt. Auf der anderen Uferseite drängten sich die Neugierigen.
Luc Vidal verharrte einen Moment, als er die Passage durch das Vorderhaus durchquert hatte. Die Kollegen von Hortense Clement warteten neben dem Brunnen auf den weiteren Verlauf der Ereignisse. Allen war das Entsetzen anzusehen. Die Idylle der Antiquitätenhändler war nachhaltig zerstört. Einer von ihnen hatte Hortense am Vormittag gefunden. Ein schmaler Mann von undefinierbarem Alter mit gepflegter Langhaarfrisur, scharfer Adlernase und abschätzendem Blick aus dunkelbraunen Augen. Er beobachtete den Kommissar, unaufgeregt und abwartend.
»Ich bin Kommissar Vidal von der Police nationale aus Avignon. Sie haben die tote Madame Clement entdeckt?«
Der Mann nickte stumm.
»Wann war das?«
»So zehn Uhr fünfzig etwa. Wir öffnen beide immer gegen halb elf. Man sieht sich. Spricht miteinander. Da sie kurz vor elf noch nicht aufgetaucht war, habe ich nachgesehen.«
»Die Tür war unverschlossen?«
»Zugemacht, aber nicht abgeschlossen. Mir war sofort klar, dass da was nicht stimmte.«
»Gab es Auffälligkeiten? Etwas, das irgendwie anders als sonst war? Ein verschobenes Möbel, ein Utensil, das nicht an seinem gewohnten Platz war? Ein Duft vielleicht, von einem Parfum, von Schweiß, Alkohol oder so etwas?«
Wieder bewegte der Mann stumm den Kopf, mit kaum wahrnehmbarer Geste. »Nichts! Es wirkte so augenfällig normal, dass es nicht normal sein konnte. Ich wusste instinktiv, dass ich Hortense tot finden würde.«
»Haben Sie direkt angefangen, nach ihr zu suchen?«
»Ich habe Lionel angerufen und ihn gebeten rüberzukommen.« Er bewegte sein Kinn in Richtung eines jüngeren Mannes, der einen Moment lang zu Luc Vidal aufsah.
»Und dann haben Sie gemeinsam gesucht?«
»Nein. Als Lionel kam, hatte ich sie schon gefunden. Wir haben dann gemeinsam noch jeden Winkel abgesucht und dann die Polizei gerufen.«
Luc Vidal sog mit einem leichten Pfeifen die Luft zwischen den geschlossenen Lippen ein und wippte mit dem Kopf. Wertvolle Spuren konnten durch die beiden Amateurdetektive schon zerstört worden sein, aber ihr Vorgehen war nur zu verständlich. »Wir müssen uns gleich weiterunterhalten«, sagte er unbestimmt zur ganzen Gruppe von Männern und Frauen, die eigentlich bereits ihren Geschäften nachgehen und vielleicht wichtige Kontakte vom Wochenende pflegen wollten. An diesem Tag würde aber nichts daraus werden.