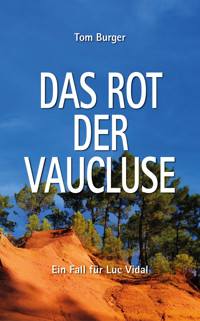9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein faszinierender Berg. Und ein furchtbarer Verdacht Im Juli 2015 stirbt am provenzalischen Mont Ventoux ein ehemaliger Radprofi bei einer Trainingsfahrt. Er war gedopt. Die Police nationale wird mit dem Fall beauftragt, da im Jahr 2016 die Königsetappe der Tour de France wieder einmal über den Berg führt – und das am französischen Nationalfeiertag und im Beisein des Staatspräsidenten. Dabei darf das heitere Bild eines sauberen Sportereignisses nicht durch einen Dopingtoten getrübt sein. Parallel zu Kommissar Luc Vidal interessiert sich auch die Kölner Sportjournalistin und Dopingfachfrau Hannah Jacobi für den Fall. Sie kommt in die Provence und beginnt ihre Recherche mit Rennrad und hoher Bereitschaft zum Risiko. Schnell vermutet sie, dass wesentlich mehr hinter dem Todesfall steckt als ein individuelles Gesundheitsproblem. In den Fokus der Ermittlungen gerät ein Verdächtiger, von dem die Police nationale nur eines weiß: Er ist ein schöner Mann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Table of Contents
DER SCHÖNE MANN
ÜBER DAS BUCH
ZITAT
ERSTER TEIL. DAS GOLDMAN-DILEMMA
ZWEITER TEIL. DIE KUNST ZU TÖTEN
DRITTER TEIL. DER FALSCHE GEORGE
VIERTER TEIL. DER WINDIGE BERG - 14. JULI 2016
ANHANG
ÜBER DEN AUTOR
IMPRESSUM
DER SCHÖNE MANN
Luc Vidals dritter Fall
TOM BURGER
ÜBER DAS BUCH
EIN FASZINIERENDER BERG. UND EIN FURCHTBARER VERDACHT
Im Juli 2015 stirbt am provenzalischen Mont Ventoux ein ehemaliger Radprofi bei einer Trainingsfahrt. Er war gedopt. Die Police nationale wird mit dem Fall beauftragt, da im Jahr 2016 die Königsetappe der Tour de France wieder einmal über den Berg führt – und das am französischen Nationalfeiertag und im Beisein des Staatspräsidenten. Dabei darf das heitere Bild eines sauberen Sportereignisses nicht durch einen Dopingtoten getrübt sein.
Parallel zu Kommissar Luc Vidal interessiert sich auch die Kölner Sportjournalistin und Dopingfachfrau Hannah Jacobi für den Fall. Sie kommt in die Provence und beginnt ihre Recherche mit Rennrad und hoher Bereitschaft zum Risiko. Schnell vermutet sie, dass wesentlich mehr hinter dem Todesfall steckt als ein individuelles Gesundheitsproblem. In den Fokus der Ermittlungen gerät ein Verdächtiger, von dem die Police nationale nur eines weiß: Er ist ein schöner Mann.
ANMERKUNG
Diese Geschichte und alle handelnden Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten und Namensgleichheiten mit toten oder lebenden Personen oder realen Ereignissen wären rein zufällig.
ZITAT
„Den perfekten Mord, den gibt es nicht“, sagte Tom zu Reeves.
„Man kann sich einen ausdenken, aber das ist nur ein Gesellschaftsspiel …“
Patricia Highsmith: Ripley’s Game
Diese Geschichte ist Fiktion. Teilweise.
ERSTER TEIL
DAS GOLDMAN-DILEMMA
1 _ ENDE JULI 2015
Wassertropfen rannen über ihren Rücken und zeichneten feuchte Streifen auf die Haut. Sie beugte den Oberkörper nach vorn, trocknete ihr Haar mit einem Frotteehandtuch und sah gelegentlich in den Spiegel, der gegenüber dem Bett hing. Höffner konnte sie im Halbdunkel darin erkennen.
Von draußen drangen die Geräusche der Stadt durch die angelehnten Fensterflügel. Die Vorhänge bewegten sich in der einströmenden Luft. Es duftete nach Sommer.
Sie waren sich zufällig begegnet. Irgendwann am Morgen. Als Avignon erwachte und Touristen die Place de l’Horloge vor den großen Kaffeehäusern und die Place du Palais vor dem Papstpalast fluteten. Sie waren dann gemeinsam durch die Altstadt gegangen, hatten geredet, gelacht, Menschen beobachtet. Am Nachmittag hatten sie ein Hotelzimmer genommen. Er war sicher, es zu schaffen. Dieses Mal. Es war ein Desaster geworden.
Höffner rollte sich leise stöhnend auf die Seite.
„Bist du wirklich in Ordnung?“, fragte sie und sah über ihre Schulter hinweg zu ihm hinab.
„Scheiße!“ Höffner vergrub sein Gesicht im Laken. Er ahnte, dass sie ihn anstarrte. Sie würde sich jetzt anziehen und gehen.
Es war ein Moment, vor dem ihm graute. Und er kannte die Ursache. Manchmal, wenn er den Mut aufbrachte, sah er genau hin. Die angespannten Muskeln zeichneten ein falsches Bild. Seine Brust wuchs. Seine Kraft forderte einen Tribut.
Aber es gab das Ziel. Dann wäre er wieder an der Spitze, könnte erneut fahren, sich einem Team anbieten, Siege erringen. Der überhastete Ausstieg vor einem Jahr war ein Fehler gewesen. Nach dem Training würde er sich zurückmelden. Noch war er nicht zu alt.
„Ich gehe jetzt“, flüsterte sie. „Mach dir nichts draus. Das passiert anderen auch.“ Sie lächelte.
Er sah aus den Augenwinkeln zu ihr auf. Sie würden sich nicht mehr wiedersehen. Dabei hatte es vielversprechend begonnen.
Zwei Tage später saß Höffner wieder auf dem Sattel. Der Ausflug nach Avignon lag für ihn weit zurück. Er war gut versorgt. Und exzellent trainiert. In Bestform. Zumindest auf dem Rad. Alle anderen Gedanken waren verdrängt. In weniger als einer Stunde wäre er am Gipfel des Mont Ventoux. Und im nächsten Jahr vielleicht sogar an der Spitze der Tour de France.
„Ich krieg dich“, murmelte Höffner und blickte zum Berg hinauf. Auf ihn wirkte der Kegel pompös, atemberaubend, überheblich, provokant und obszön. Aber es war sein Berg. Seine Herausforderung. Sein Ziel. Und heute würde er den Streckenrekord brechen. Bislang war der Baske Mayo der Schnellste gewesen.
Bis zum Weiler Sainte-Colombe war die Kette der Fahrer noch lückenhaft. Eine Perlenschnur grellfarbener Trikots, die sich zwischen Obstplantagen und Weinfeldern durch das Hügelland am Fuß des Kolosses bewegte.
Am Steilanstieg schlossen sich die Lücken. Die Perlen in Phosphorgrün, Magenta, Kupferoxydblau und anderen Tönen einer schrillen Palette verdichteten sich zu einer wogenden Masse kämpfender Leiber. Einige im Wiegetritt. Nicht alle würden die knapp zweiundzwanzig Kilometer bis zum Gipfel in tausendneunhundertelf Meter Höhe schaffen.
Beim Chalet Reynard endete der Wald. Danach reflektierte Kalkschotter am Gipfel gleißend das Licht. Höffner lag seiner Planung voraus. Bislang zweiundzwanzigkommaneun Stundenkilometer Durchschnitt. Mayo hatte dreiundzwanzig erreicht. Die Wetterwarte kam in Sicht. Ein monumentaler weißer Finger, der in den dunkelblauen Himmel ragte. Ein Betonmonolith. Synonym mit dem Mont Ventoux.
Höffner spurtete. Es war ein grandioser Sprint. Mit pfeifender Atmung und Schaum vor dem Mund, den der Wind wie Gischt von den Lippen riss.
Er war eine Maschine. Stark und ermüdungsfrei. Konstant. Den Druck in der Brust ignorierte er. Ebenso die Schmerzen im Arm. Dann änderte sich sein Rhythmus. Er schlingerte, stürzte und lag schließlich mit weit geöffneten Pupillen und bläulicher Haut auf dem Asphalt. Es hielten Fahrer an und trugen ihn an den Straßenrand. Einer von ihnen diagnostizierte seinen Tod.
2 _
„Er war gedopt“, sagte Maria Falcone. „Wir haben Erythropoietin, also Epo isoliert, das nicht von seinem Körper stammt. Das Hormon ist im Körper für die Bildung roter Blutkörperchen von Bedeutung.“ Die Rechtsmedizinerin stand neben Bernd Höffners Leiche und sah abwartend auf Kommissar Luc Vidal. Ihr glattes, graues Haar war zu einem Pferdeschwanz gebunden, das hagere Gesicht von einer dunklen Hornbrille geprägt. Sie war fast so groß wie Vidal. Er mochte ihre Strenge. Sie war zielgerichtet. Unmissverständlich. Professionell. „Eigentlich sind dopende Fahrer zu Mikrodosierungen übergegangen, die kaum nachweisbar sind. Der hier war eindeutig weniger vorsichtig. Manche setzen auch wieder auf Eigenblutdoping mit körpereigenem Epo.“
„Wo liegt da der Vorteil?“
„Bei einem Training in extremen Höhenlagen bildet der Körper vermehrt Erythrozyten, also rote Blutkörperchen, um in der dünneren Luft mehr Sauerstoff binden zu können. Den Fahrern wird beim Höhentraining Blut entnommen, die roten Blutkörperchen werden extrahiert und stehen dann, kurz vor dem Start eines Wettkampfes, zur Infusion zur Verfügung. So gibt es keine nachweisbaren Fremdsubstanzen, nur den hohen Wert an roten Blutkörperchen. Um diese Manipulation nachweisen zu können, müsste der Fahrer über einen sehr langen Zeitraum hinweg sehr systematisch kontrolliert werden. Schwierig, auch für gut organisierte Antidoping-Agenturen.“
„Je mehr Sauerstoff aufgenommen werden kann, desto höher ist die Leistungsfähigkeit, richtig? …“
„Ohne Sauerstoff keine Energiegewinnung. Ohne Energie keine Leistung. Relativ simpel. Mit einem größeren Potenzial ist man eben im Vorteil.“
„Kann es für seinen Tod außer Epo-Doping noch andere Gründe geben …?“ Luc Vidal hatte die Decke von dem Toten zurückgezogen und betrachtete aufmerksam dessen Körper.
„Gut möglich. In jedem Fall ist es Tod durch Herzversagen. Passiert Radfahrern auch ohne Doping.“
„Selbstüberschätzung?“
„Meist. Kardiologische Probleme werden gern ignoriert. Oder nicht in Betracht gezogen.“
„Der hier sieht durchtrainiert aus.“
„In jeder Faser. Mehr wäre wohl nicht gegangen. Trotzdem ist er gestorben. Wir müssen weitere Laboruntersuchungen durchführen und ihn aufschneiden … das ganze Programm. Das kann dauern. Manche Tests können wir nicht selbst machen.“
„Machen Sie! Wir brauchen jedes Detail.“ Vidal zog einen Latexhandschuh über und drückte prüfend in das Gewebe des Toten. Mehrmals tippte er dabei gegen die Wölbung der Brust.
„Gynäkomastie!“ Maria Falcone verschränkte die Arme und suchte den Augenkontakt zu Vidal. „So nennt man das Wachstum des Brustdrüsengewebes. Verweiblichung. Das kann eine Folge von übermäßigem Gebrauch anaboler androgener Steroide sein. Überschüssiges Testosteron wird dabei in das weibliche Sexualhormon Östrogen umgewandelt. Tatsächlich wird bei dem Mann wohl ein bunter Cocktail von Doping-Stoffen zum Tode geführt haben.“
„Finden Sie es! Ich muss belastbare Ergebnisse liefern. Und das schnell. Höffner war bis vor einem Jahr noch Profifahrer. Oft bei der Tour de France dabei. Das Thema ist jetzt politisch besetzt. Der Präsident will sich im nächsten Jahr die Königsetappe der Tour am Ventoux ansehen. Am Nationalfeiertag. Er wird vermutlich direkt nach der Parade von der Place de la Concorde aus mit seinen Staatsgästen herfliegen. Bis dahin muss Höffners Tod vergessen sein. Keine negative Presse zum Ventoux. Nur noch Sonnenschein und ein großes Sportereignis!“ Vidal tippt noch einmal in das Brustgewebe. „Was ist mit seinem Schwanz? Konnte er den noch benutzen?“
Falcone zog die Augenbrauen hoch und sah Vidal tadelnd an. „Das lässt sich nicht genau sagen. Bei manchen Mitteln bleiben Erektionsstörungen unter Umständen nicht aus. Irgendwann zeigt sich die Wirkung auch an den Hoden.“
„Kleine Eier?“, fragte Vidal. Er ignorierte die Missbilligung. In einem Jahr würde Maria Falcone in den Ruhestand gehen und er sie vermissen. Bis dahin blieb ihr Spiel, rauer Cop und spröde Medizinerin zu sein.
„Schwund!“, sagte sie. „Ganz allgemein. Auch die Spermienbildung geht zurück. In diesem Fall würde ich von einer bereits leichten, aber noch nicht signifikanten Verkleinerung der Genitalien sprechen.“
„Scheiße! … Warum macht man das?“
„Überzogener Ehrgeiz … falsche Einschätzung von Wirkstoffen …“ Sie zog das Laken über die Leiche, löste die Arretierung der Räder und schob den Wagen einige Schritte in Richtung des Kühlraumes. Dann hielt sie an und drehte sich noch einmal zu Vidal um. „Die Frage nach dem Warum müssen Sie klären. Es ist aber klar, dass niemand solche Substanzen ohne Grund konsumiert. Der Mann hatte ein hohes Ziel.“ Dann fügte sie im Gehen noch hinzu: „Sie wirken in ihrem dunkelblauen Anzug fast wie ein Banker. Es wäre schön, wenn auch Ihre Ausdrucksweise passen würde!“
Vidal nickte, ohne etwas zu erwidern. Dann folgte er Falcone und zog noch einmal das Laken in die Höhe. „Kriegt man das ganze Zeug auf Rezept?“
„Zu therapeutischen Zwecken ja. Aber das muss aufgrund medizinischer Befunde erfolgen. Zumindest bei uns.“
„Und sonst?“
„Manches lässt sich in der Garage nachbauen. Etwas labortechnisches Wissen reicht aus.“
„Garagen-Doping?“ Vidal zog die Handschuhe aus, warf sie in einen Abfalleimer. „Dann werde ich mich jetzt wohl mal auf die Suche nach der Garage machen, verehrte Frau Doktor. Und Sie geben mir bitte bei jeder noch so kleinen Erkenntnis Bescheid.“ Er grinste.
3 _
„Wollt ihr noch rauf?“, fragte Vidal eine Gruppe von Radfahrern vor dem Bar-Tabac von Colombier und zeigte mit dem Kopf in Richtung des Mont Ventoux. Er war gegen achtzehn Uhr in dem verschlafenen Dorf angekommen.
„Nur eine kleine Feierabendrunde“, erwiderte einer der Fahrer, „kurz einmal hoch und dann über Malaucène zurück.“
„Wie lange seid ihr dabei unterwegs?“ Vidal setzte sich neben die Gruppe. Unaufgefordert bekam er von Jean-Michel einen kleinen Weißen und die obligate Gitanes Maïs an den Tisch gebracht, die sich der Kommissar sonst an der Bar gönnte, wenn er gelegentlich in seiner Remise des alten Gutshofes einen Tag Auszeit vom Stadtleben nahm.
„Knapp zwei Stunden“, erklärte ein anderer aus der Gruppe. „Und dann noch von Malaucène zurück nach Haus. Um neun haben unsere Frauen uns wieder.“
„Ob sie wollen oder nicht!“, warf ein dritter Mann ein und alle lachten.
Vidal hob sein Glas und prostete den Fahrern zu.
„Hat schon mal einer aus eurer Truppe am Ventoux schlapp gemacht?“, fragte er erneut in Richtung der Radfahrer.
„Das ist aber eine Frage …“, wieder lachten alle. „Man hält mal oben am Chalet Reynard, wenn man besonders großen Durst hat … aber sonst? Nein … das heißt, der alte Laurent ist einmal auf halbem Weg nach oben umgekehrt, da war der aber bereits sechsundsiebzig und hatte am Tag zuvor die Hochzeit seiner Enkelin gefeiert.“
Die Gruppe erhob sich einer nach dem anderen. Sie setzten die Helme auf und arretierten ihre Schuhe in den Halterungen der Pedale. Sie verabschiedeten sich winkend von Vidal und fuhren in Richtung Bédoin über die Landstraße davon.
Der Kommissar lehnte sich gähnend zurück und hob winkend die Hand. Jean-Michel brachte einen weiteren Weißen. „Stimmt meine Information, dass Sue den Gutshof aufgeben will?“ Der Wirt sammelte Gläser und Flaschen ein und wischte den Nachbartisch sauber.
„Das hat sie gesagt.“
„Dann ist das dein letzter Sommer hier?“
Vidal nickte stumm. Es war kein schöner Gedanke, irgendwann keinen Feierabend mehr an der Bar des Chez Maude beginnen zu können. Er wurde für einen Moment melancholisch.
„Man könnte ein Hotel aus dem Gut machen …“, Jean-Michel war an den Rand der kleinen Straße getreten, die zwischen den wenigen Häusern von Colombier hindurch zum Mont Ventoux führte. „Du solltest Sue fragen, ob sie dir das Objekt überlässt. Das Geld dafür braucht sie ja sicher nicht.“
„Kannst du dir mich als Gastgeber vorstellen?“
„Nicht wirklich.“
„Ich auch nicht.“ Luc Vidal schwieg einen Moment. „Bulle bleibt Bulle“, sagte er dann schließlich und zuckte mit den Schultern. „Was soll’s. Ich mach’s ja für mich und nicht für die andern.“
„Auch nicht für mich?“
„Für dich schon. Und für deine Frau … vielleicht diesen Ort … den Wein … ein gutes Hasenragout … und, naja, für die Provence und meine Ruhe, wenn ich hier sitze.“
„Ich weiß ja“, sagte Jean-Michel und klopfte dem Kommissar freundschaftlich auf die Schulter. „Und deshalb bekommst du auch immer abends eine Gitanes gratis von mir. Alles andere wäre ja auch schon Korruption.“
4 _
Im Internet war das Maison Chambres d’hôtes, das Gästehaus von Catherine Sabatier, auf Satellitenkarten gut zu erkennen gewesen. Sie vermietete Zimmer in dem alten Gehöft, das einsam am Fuß des Mont Ventoux lag und eine scheinbar starke Anziehungskraft auf Radprofis ausübte. Jedenfalls hatte Vidal das in einem Internetforum für Biker so gelesen. Höffner hatte dort gewohnt.
Es führte lediglich eine einspurige Asphaltpiste in schlechtem Zustand von der Landstraße dorthin. Vidal musste langsam fahren. Anfänglich säumten gepflegte Obstplantagen den Weg, dann änderte sich das Bild und die Landschaft wurde zusehends karger. Struppige Eichen und vereinzelte Oliven- und Obstbäume ragten in verschrobenem Wuchs aus graubraunem Steppengras hervor. Dahinter erhob sich dunkel der Ventoux, der jäh aus dem sanft welligen Vorland aufstieg.
Niedriger Baumbewuchs überzog den Berg, Schwarzgrün gegen den lichtgrauen Kalkschotter des Bodens kontrastierend und immer wieder von scharfkantigen Felsenpartien durchbrochen. Der kahle Gipfel, der gut tausend Meter oberhalb begann, war hier nicht mehr zu sehen. Dunklere Passagen im Grün zeichneten die Einschnitte zahlreicher Combes nach, enge Schluchten, die diesen Hangabschnitt des Mont Ventoux prägten. Durch einige davon führten markierte Wanderwege bergan, andere waren tief in den Felsen gefräst, durch die sich nur sehr enge Pfade in die Bergwelt schlängelten.
Catherine Sabatiers Reich lag am Ende der Piste unmittelbar am Hang. Es bestand aus einer Ansammlung von Gebäuden, die zwei oder drei Geschosse hoch aufragten. Neben den aneinandergrenzenden Hauptgebäuden gab es noch kleinere abseitsstehende Bauten. Alles war aus dem gleichen ockerfarbenen Naturstein aufgeschichtet, mit zahlreichen Winkeln, Vorsprüngen und Fenstern von sehr unterschiedlicher Größe mit dunkelbraun gestrichenen Holzläden.
Die Freiflächen zwischen den Gebäuden, Geländeebenen, Terrassen und angrenzenden Wegen waren aus hellem feinkörnigem Kies angeschüttet. Vidal entdeckte auch einen Swimmingpool, dessen minzfarbene Wasserfläche einen starken Kontrast zu den Farben der Umgebung bildete.
Einige Gäste standen mit Trikots bekleidet abfahrbereit neben ihren Rädern. Madame sei im Haus, wurde ihm gesagt. Vermutlich noch im Frühstücksraum. Ihm begegnete eine beeindruckende Frau. Catherine Sabatier mochte Anfang siebzig sein, mit voller, sorgsam frisierter goldbrauner Frisur, die ihr leicht aufgeschwemmtes Gesicht in ausladenden Wellen umfloss.
Sie musterte Vidal ebenso intensiv wie er sie. Ihr Blick glitt von seinen welligen, mittlerweile deutlich vom Schwarz ins Grau übergehenden Haaren über den Ausdruck in seinen schwarzen Augen, seine Rasur, die Passform, das Material und den Zustand seiner Kleidung, bis zu seinen Schuhen hinab. Er konnte das Urteil an ihren Augen ablesen. „Flic!“, stand da abschätzig geschrieben. Sie zeigte andeutungsweise auf einen Stuhl, blieb aber selbst stehen. „Was kann ich für Sie tun, Monsieur le Commissaire?“
„Höffner“, sagte Vidal. Er bemühte ein schüchternes Konfirmandenlächeln. „Der war Ihr Gast. Wir untersuchen den Unglücksfall. Es ist für die deutschen Behörden. Seit wann war er hier?“
„Seit zwei Wochen.“
„Hatte er reserviert?“
„Nein. Er kam spontan.“
„Und Sie hatten noch ein Zimmer für ihn, obwohl jetzt Hochsaison ist?“
„Kein Zimmer. Den Gîte, den alten Taubenschlag, die Pigeonnier. Die meisten Gäste kommen in Gruppen und wohnen zusammen in den Hauptgebäuden. Der Gîte war frei. Wir vermieten es selten.“
„Er kam allein?“
„Ja.“
„… und blieb es auch?“
„Ja.“
„Haben Sie an ihm in den letzten Tagen eine Veränderung bemerkt. Wirkte er auf Sie anders als sonst?“
Sie schüttelte fast unmerklich den Kopf und hielt dabei Augenkontakt mit Vidal. „Nein. Es gab keine Veränderung. Es wäre mir aufgefallen.“
„Wie verlief sein Tag? Hatte er bestimmte Gewohnheiten, Zeiten, zu denen er aß, mit dem Rad unterwegs war oder Ausflüge unternahm?“
„Er frühstückte früh. Wie alle meine Gäste. So gegen acht.“
Luc Vidal ging einige Schritte um Catherine Sabatier herum und blickte in den Speiseraum. „Hier? Frühstücken Ihre Gäste hier in diesem Raum? An diesem einen Riesentisch?“
Sie nickte.
„Und nach dem Frühstück – haben Sie ihn dann noch öfter mal gesehen?“
„Meist nicht.“
„Und wenn Sie ihn gesehen haben?“
„War er mit dem Auto unterwegs.“
„Passierte das oft?“
„Selten.“
„Hatten andere Gäste zu ihm Kontakt?“
„Das kann ich Ihnen nicht sagen. Sie treffen sich beim Frühstück. Es ist ein Kommen und Gehen.“
„Haben Sie da Unterhaltungen von ihm mit anderen Gästen mitbekommen?“
„Sie tauschen sich über Streckenverläufe und Wetterprognosen aus.“
„Kommen alle Ihre Gäste zum Radfahren hierher?“
„Manche wandern.“
„Und wo kommen Ihre Gäste her?“
„Frankreich und Belgien, Holland, Deutschland. Auch einige Italiener und Engländer.“
„Alleinreisend oder in Gruppen?“
„Bis auf Herrn Höffner, Gruppen.“
„Auch ganze Radsportteams?“
„Meistens.“
Vidal begann, sich über Catherine Sabatiers Einsilbigkeit zu ärgern. Aber noch gab es nicht einmal einen konkreten Fall, in dem er ermittelte. Bislang war Höffners Tod ein Unglück, kein Verbrechen. Derzeit war alles noch ungewiss. Für einen Moment kam er sich albern in der Rolle vor, die man ihm zugedacht hatte.
Er ließ sich von ihr den Gîte zeigen. Es war ein kleines, komplett eingerichtetes Appartement mit Doppelbett und Miniküche. Der Eingang lag an der von den Haupthäusern abgewandten Seite. Was immer Höffner unternommen und mit wem er sich hier getroffen hatte, es wäre weder von den anderen Bewohnern des alten Bauernhofs noch von Catherine Sabatier zu beobachten gewesen. „War nach seinem Tod jemand hier drin?“, fragte er.
Catherine Sabatier verschränkte die Arme und sah Vidal geringschätzig an. „Ich, Monsieur le Commissaire. Ich habe mich vergewissert, dass hier alles in Ordnung ist. Dann habe ich die Tür verschlossen und bei Ihren Kollegen von der Police municipale nachgefragt, was ich machen soll. Abwarten und nichts berühren, hatte man mir geantwortet. Das habe ich befolgt.“
„Das ist gut. Dann werde ich mich jetzt mal etwas umsehen.“ Der Kommissar zog sich Latexhandschuhe über und begann Schubladen und Höffners persönliche Sachen durchzusehen.
„Haben Sie einen Durchsuchungsbefehl dafür?“, fragte sie, was Vidal so lange ignorierte, bis sie sich ihm in den Weg stellte. „Jetzt ist Schluss damit. Ich muss Sie bitten, zu gehen.“
5 _
„Es gibt kein harmloses Doping“, dozierte Hannah Jacobi vor ihren Studenten in Köln. „Tatsächlich stellen sich immer Nebenwirkungen ein, mit teils irreversiblen Gesundheitsschäden. Die Erkenntnis ist nicht einmal neu. Es wird trotzdem gedopt und besonders im Spitzensport ist eine niedrige Hemmschwelle zu verzeichnen.“ Sie machte eine rhetorische Pause und blickte auf die Teilnehmer ihrer Lehrveranstaltung. Für einen kurzen Moment hoffte sie Nachdenklichkeit, vielleicht sogar Betroffenheit erzeugen zu können. Es waren überwiegend männliche Studenten, die in ihrer Veranstaltung über Doping als Thema der Sportberichterstattung saßen. Alles in allem ein kleines Grüppchen durchtrainierter Sportler. Die wenigen Mädchen schienen etwas gelangweilt ihren Ausführungen zu folgen. Und bei den Jungs war sie sich nicht sicher, ob die sich wirklich für etwas anderes als ihre eigenen Körper interessierten. Dabei waren sie alle freiwillig und mit der Intention hier, später einmal Sportjournalisten zu werden.
„Der US-amerikanische Publizist Bob Goldman führte dazu zwischen neunzehnhundertzweiundachtzig und Mitte der Neunzehnhundertneunziger-Jahre Befragungen unter Hochleistungssportlern durch“, fuhr sie fort. „Er wollte dabei wissen, wer von den Befragten bereit wäre, innerhalb von fünf Jahren zu sterben, wenn er durch die Einnahme von Doping den Gewinn einer Goldmedaille sichern könnte. Die Ergebnisse waren stets annähernd gleich. Und nun die Frage an Sie: Wie hoch schätzen Sie den Prozentsatz derer, die dazu bereit waren?“ Hannah sah erneut in die Runde, fokussierte Einzelne, deren Muskelmasse sie vermuten ließ, dass sie anabole Steroide einnahmen.
Tatsächlich hob aber eines der Mädchen den Arm aus einer eher liegenden Position an einem der hinteren Tische. „Die Hälfte!“, sagte sie und ließ den Arm so sinken, als habe diese Antwort sie alle Kraft gekostet.
„Richtig! Und bekannt ist diese erschütternde Erkenntnis unter dem Begriff ‚Goldman-Dilemma‘. Eine Kontrollgruppe von Nichtsportlern, die der Australier Connor zweitausendneun in Bezug auf herausragende berufliche Erfolge befragte, kam lediglich auf eine Zustimmungsquote von einem Prozent. Der Unterschied ist also signifikant. Für die journalistische Arbeit leitet sich daraus eine hohe Verantwortung ab. Wir müssen uns fragen, ob wir mit unserer Arbeit nicht überhaupt erst die Voraussetzung für die selbstzerstörerische Sehnsucht nach dem Erfolg schaffen. Ob wir nicht willentlich in Kauf nehmen, dass Sportler dopen und uns damit überhaupt erst die Storys über immer neue sportliche Sensationen liefern. Ohne neuen Rekord keine Story. Ohne Doping kein neuer Rekord. Ein Teufelskreis. Was könnte die Lösung für dieses Dilemma sein? Was könnte der Sportjournalismus zur Lösung beitragen? Über diese Fragen möchte ich mit Ihnen zum Beginn des kommenden Semesters diskutieren. Ich hoffe dann auf viele interessante Impulse und eine lebhafte Diskussion.“
Hannah klappte die Mappe vor sich zu und schaltete ihr Notebook mit der PowerPoint-Präsentation ab. Einen Moment lang beobachtete sie die Studenten, die einzeln und in kleinen Gruppen den Raum verließen. Sie waren überwiegend gertenschlank. Perfekte Körper, durch viele Stunden harter Trainingsarbeit gestylt. Es war sicher kein unerwünschtes Nebenprodukt des Studiums.
Diesem Idealbild konnte sie selbst nicht mehr entsprechen. Zeitmangel und die Lust an gutem Essen trugen dazu bei, langsam fülliger zu werden. In absehbarer Zeit würde sie die engen Jeans und Pullis zugunsten eines anderen Kleidungsstils aussortieren müssen. Die blonde Mähne aus ihrer Mädchenzeit war bereits einem Kurzhaarschnitt gewichen.
Zurück in ihrem Büro erwartete sie eine Nachricht in der Mail. „Bernd Höffner ist tot“, schrieb Max. „Die Meldung kam grade von dpa herein. Ist letzte Woche am Ventoux kurz unterhalb des Gipfels vom Rad gefallen. Soll Herzinfarkt gewesen sein. Falls du ihn nicht mehr auf dem Schirm hast: Der war bis zweitausendvierzehn als Radprofi unterwegs. Konnte Gegner ziemlich mürbe machen. Irgendwann kamen Gerüchte wg. Doping auf. Als sich das verstetigte, ist er ausgestiegen und hat in einem Fahrradmarkt angefangen. Wenn der jetzt so einfach tot vom Rad kippt, ist was faul. Könnte eine gute Story für dich werden. LG, Max“.
Hannah goss sich ein Glas Mineralwasser ein, trank bedächtig und las die Mail ein zweites Mal. Natürlich wusste sie, wer Höffner war. Sie hatte selbst zu diesen Dopinggerüchten recherchiert. „Hast du schon eine Idee für die Story?“, schrieb sie zurück.
Die Antwortmail kam prompt: „Der war garantiert nicht allein dort unten. Und wenn der gedopt war, wird es jemanden geben, von dem er das Zeug hatte. Vielleicht ist die französische Polizei schon an dem Fall dran.“
„Wie könnte man vorgehen?“
„Am Ventoux in die Szene eintauchen. Besitzt du ein Rennrad …?“
Die Idee war interessant. Sie könnte auf Höffners Spuren am Mont Ventoux recherchieren. Am Puls des Geschehens. Im engen Kontakt mit der Szene. Live dabei. Dem Tod auf der Fährte …
6 _
Sie war ewig nicht Rad gefahren und die Idee vermutlich absurd. Aber die Suche nach der Top-Story brauchte den Mut zum Ungewissen. Wo sonst könnte sie an Menschen herankommen, die für eine Fahrt auf den Mont Ventoux nicht einmal den Tod scheuten? Ein Mensch wie Höffner. Ein Fahrer, der eigentlich Risiken hätte abwägen können, der seinen Körper bei vielen Rennen bis an die Grenze der Leistungsfähigkeit getrieben hatte und deshalb auch tatsächlich diese Grenzen kannte. Und der trotzdem gestorben war. Jenseits dieser Grenzen. Die Frage war, warum. Und ihr Instinkt sagte ihr, dass Höffner nicht der Einzige war.
Sie musste da hoch. Und das unverzüglich. Die Medienmeute würde zunächst über Höffners Familie herfallen, über seine Freunde, über seine Feinde, über seine ehemaligen Teamkollegen und den Coach. Sie wollte an die herankommen, die als Nächste sterben könnten, und ihnen die Frage stellen: Warum machst du das? Das Goldman-Dilemma live und nicht als hypothetische Option. Die Frage nach der Freude am Tod.
Jetzt stand sie mit ihrem alten Rennrad aus Studienzeiten am Fuß des Mont Ventoux. Die Entscheidung für die Provence war unmittelbar gefallen. Max hatte ihr ein Quartier bei einem alten Freund besorgt. Anselm Bernhard. Ein Kochbuchautor mit einem Haus direkt am Berg. Und auf den wollte sie jetzt hinauf. Sie würde die Fahrt überleben. Es war eine Frage der Disziplin. Alle Nährstoffe, die ihr Körper dafür brauchte, hatte sie ihm zugefügt. Sie hatte genug Flüssigkeit dabei, sie hatte sich sorgsam aufgewärmt und ihre Muskeln gedehnt, sie hatte sich mental vorbereitet. Sie musste ihr Tempo finden, die richtige Atmung, die Haltung auf dem Rad. Sie musste andere Fahrer ignorieren und sich nicht dazu hinreißen lassen, ihren Fahrstil zu ändern. Sie musste die Frustration ertragen, wenn andere schneller waren und der Anstieg zum Gipfel auch nach Stunden noch unendlich erschien. Ihr Feind saß im Kopf, nicht im Körper.
Sie hatte auf den ersten Kilometern Assoziationen von Ausverkauf in Boutiquen und von kaltem Büfett. Alles drängte sich ohne Not, griff nach etwas, was nicht gebraucht wurde, füllte den Teller mit Speisen, die man nicht mehr essen könnte. Warum alle diese Menschen mit dem Rad auf den Berg hinauffuhren, war für sie nicht nachvollziehbar. Drahtige Körper mit opulenten Muskeln bewegten filigrane Maschinen wie besessen an ihr vorbei; Alte, Dicke, Unbewegliche und Narren peinigten sich ohne erkennbaren Sinn; Radreisende mit Fahrradtaschen und Gepäckkörben suchten im Weg ihr Ziel; E-Bike-Fahrer versuchten, mit gespeicherter Energie vermeintlich das Gesetz der Gravitation zu widerlegen. Dazwischen fuhr sie, den Blick auf das monotone Band des Asphalts geheftet. Noch waren kein Gipfel und damit kein Ende der Strapaze in Sicht und außer der Erkenntnis, dass es weiter immer nur bergan ginge, keine weitere zu gewinnen. Der Schmerz in ihren Beinen war konstant, aber erträglich geworden. Sie hatte aus anfänglichen Fahrfehlern gelernt.
Um der Monotonie zu entfliehen, addierte sie während der Fahrt die Zahlen der Fibonacci-Folge – eins, eins, zwei, drei, fünf, acht, dreizehn …; multiplizierte eine fiktive Höhe einer fiktiven Anzahl von Bäumen entlang ihrer Fahrstrecke mit einer fiktiven Häufigkeit um den Berg herum, errechnete eine fiktive Anzahl daraus zu gewinnender Bretter und wiederum daraus zu bauender Schiffe und stellte sich dann die Armada der Flotte vor, die in Toulon des Mittelalters aus dem Holz des Ventoux gebaut worden war.
Nach fünfzehneinhalb Kilometern hatte sie den Parkplatz am Chalet Reynard erreicht. Hinter dem kleinen Restaurant führte ein Skilift zum oberhalb gelegenen Grat. Es erschien ihr in dem Moment nichts schöner, als dort sitzen, ein kaltes Bier trinken, die Sommersonne und die Aussicht auf die Provence genießen zu können. Aber sie würde danach nicht einen Meter weiter bergan fahren wollen.
Die restlichen sechs Kilometer zum Gipfel erhöhten dann noch einmal die Qual, während sie nun bei der Konjugation von ihr willkürlich einfallenden Verben angekommen war, was sie bis zum Gedenkstein für Tom Simpson beschäftigte, der dort neunzehnhundertsiebenundsechzig bei der Tour de France an Doping, Alkohol und der gnadenlosen Sonne gestorben war. Danach blieb ihr Denken beharrlich auf Bernd Höffners Tod und Doping ausgerichtet, was lediglich auf den allerletzten Metern in einer abscheulich steilen Kurve von purem Schmerzempfinden überlagert wurde. Als sie oben anhielt, hatte sie Applaus erwartet. Um sie herum waren aber alle mit Selfies beschäftigt und keiner nahm Notiz von ihr.
Als das Gefühl in ihre tauben Finger zurückkehrte und die Schmerzen im Rücken, den Beinen und am Po nachließen, entdeckte sie einen zierlichen Asiaten, der einige Meter entfernt von ihr erschöpft auf sein Mountainbike gelehnt ins Leere starrte. Die fingerdicken Reifen ihres Rennrades hatten nur einen geringen Reibungsverlust erzeugt. Um wie viel anstrengender muss es für ihn gewesen sein, ein Rad mit dicken Profilreifen auf dem Weg hier hochzufahren? Sie beobachtete den Mann eine Weile. In seinem Gesicht konnte sie nicht die Euphorie ausmachen, die sich bei den anderen Fahrern einstellte, sobald sie am Gipfel angekommen waren.
Sie manövrierte mit ihrem Rad an den anderen vorbei, die entlang der Mauer abgestellt worden waren, während ihre Besitzer den monumentalen Turm der Wetterwarte mit sich selbst davor fotografierten. Andere knipsten sich gegenseitig mit ihren Rädern in der Hand und in Siegerpose. Dazwischen wuselten unzählige Touristen, die unterhalb der Kuppe ihre Fahrzeuge geparkt hatten und von hier oben aus die Weitsicht genossen oder Süßigkeiten an den zahlreichen Ständen kauften, die den Radlern zur Wiederauffüllung ihres Zuckerspiegels dienten.
„Nice place to be after such a ride“, sprach sie auf gut Glück den Asiaten an.
Der nickte zunächst stumm und erwiderte dann: „Hard ride, very hard.“
Wo er herkäme, fragte Hannah. Japan, sagte er. Ob er dort auch führe? Oft, sagte er, Räder seien sein Beruf. Er hob das massig aussehende Mountainbike mit einem Finger an. Carbon, sagte er, dann spielte er mit den Griffen der Schaltkomponenten und ergänzte: „Neu. So wird Fahren viel einfacher. Man braucht weniger Kraft. Alles meine Entwicklung!“ Er lächelte schwach. „Toll!“, sagte Hannah. Der Japaner verbeugte sich höflich, setzte seinen Helm auf und verabschiedete sich von ihr.
Hannah schien es, als hätte sie ihn bei etwas gestört. Als habe er nach etwas Ausschau gehalten, was sie oder andere nicht mitbekommen sollten. Sie beobachtete ihn, wie er sich über die von Süden kommende Passstraße entfernte, die sie kurz zuvor hochgefahren war, dann nach der ersten Kehre wieder unterhalb ihres Standortes vorbeifuhr und schließlich nach rechts von der Straße auf einen Pfad in das Geröllfeld wechselte. „Sieh da, es gibt also noch andere Wege zurück in die Ebene“, überlegte sie, „und für die braucht man dann zwingend ein Mountainbike.“
7
Hayato Takahashi trank keinen Wein. Der Mann, der sich mit ihm im Restaurant verabredet hatte, bedauerte dies höflich. Gerade dieses Restaurant, sagte der lächelnd, böte von allem aus der Region das Beste und das gelte uneingeschränkt auch für den Wein.
Der Japaner kannte den Mann unter dem Namen Miller, wobei dieser das i und das e lang zog, sodass es Französisch wie Miileeer klang, und Takahashi davon ausging, dass es nicht sein richtiger Name war. Auf ihn wirkte er nicht wie ein Nordeuropäer, von denen er aber nur wusste, dass diese meist einen blassen Teint hatten und oft blond waren, Iren sogar rothaarig. Das waren Klischees, aber er versuchte damit, eine Orientierung zu gewinnen. Amerikaner konnte er an ihrem Habitus erkennen, Europäer blieben für ihn ein Rätsel. Dieser hatte leicht gebräunte Haut. Er war smart. Lächelte stets breit, mit graden, geschlossenen Lippen
Der Mann hatte gute Kontakte. War in der Szene vernetzt. Miller kannte die Entwicklungen des Japaners für die Radindustrie und er wusste von Gerüchten über einen unsichtbaren Felgenantrieb. Sie hatten Kontakt über Handys mit Prepaid-Karten.
Am Morgen hatte Hayato Takahashi ihn angerufen. Er bräuchte einen Fahrer für einen Test. Das Restaurant war Millers Idee und dem Japaner war keine bessere Lösung eingefallen. Der Ort war ein Bergnest, nur durch ein schmales Stadttor zu erreichen. Er war an der monumentalen Skulptur eines gewappneten Samurai vorbeigefahren – nannte man sie hier Samurai? – und hatte dann hinter einer Kirche einen Parkplatz für seinen Wagen gefunden. Das Restaurant gehörte zu einem Hotel in den Mauern einer restaurierten Schlossanlage mit verschachtelten alten Gebäuden. Takahashi nahm an, dass dies dem Herrn des Samurais gehört haben musste, den man mit dem Denkmal als tapferen Krieger geehrt hatte. Der Blick von dort auf den Mont Ventoux war unvergleichlich.
Sie hatten sich im Gewölbe des Restaurants verabredet und saßen ungestört vor dem großen Kamin. Alle anderen Gäste bevorzugten die Terrasse.
„Ich brauche einen Spitzenfahrer“, erläuterte Takahashi.
Miller lächelte wie gewöhnlich, griff nach der Speisekarte und machte eine ausladende Geste. „Das wird kein Problem. Wir sollten wählen.“
Takahashi nahm ebenfalls die Speisekarte und neigte höflich den Kopf. „Ich brauche einen Fahrer, der austrainiert ist. Es geht nur um die Spitze. Spitzenfahrer erreichen eine Dauerleistung von ungefähr fünfhundert Watt. Ich biete mit meiner Entwicklung etwa fünfzig Watt dazu an. Das reicht, um unter den Besten den Sieger zu stellen. Ich muss den Energiegewinn genau ermitteln und dokumentieren. Das wird mein Verkaufsargument. Es wird keine Testfahrten vor einem Kauf geben. Und da zählen für mich auch nur potenzielle Sieger.“
Danach studierte er nur kurz die Speisekarte und entschied sich schnell für Meeresgetier – das Wolfsbarsch-Carpaccio mit Espelette-Pfeffer als Vorspeise und die Jakobsmuscheln mit Zitronen-Confit zum Hauptgang. Dazu gab es noch fünf weitere Gänge, die Takahashi aber nicht interessierten. Miller nahm die Foie gras mit schwarzem Trüffel und das Lamm unter der Olivenkruste.
„Was kostet so ein Felgenantrieb?“ Miller kaute ausgiebig einen Schluck Ventoux-Wein, der von einem nur wenige Kilometer entfernten Gut stammte. „Ausgezeichnet. Sie verpassen da etwas“, ergänzte er und nahm einen weiteren Schluck.
„Zweihunderttausend in Serie“, erwiderte Takahashi. „Und wenn jemand den Antrieb exklusiv möchte, zehn Millionen.“
Miller öffnete bei der genannten Summe leicht den Mund, aus dem so ein dünnes Rinnsal tiefroten Weins an seinem Kinn herablief.
„Die Pharmaleute werden E-Doping nicht gerne sehen. Ich muss Vorsorge schaffen“, sagte Takahashi, der den Fluss des Weines beobachtete und Miller seine Serviette reichte.
Die Kellner brachten nach und nach die jeweils sieben Gänge an den Tisch und Miller aß alles restlos auf, lächelte zwischendurch und verzichtete auf Konversation, während der Japaner etwas ratlos auf Soßen, Beilagen und die kunstvolle Dekoration aus erlesenen Zutaten schaute. Letztendlich begrenzte er sich auf das Muschelfleisch und den Fisch. Nach dem Dessert bestellte Miller noch einen Kaffee für sich. Er sah sein Gegenüber fragend an, der mit dem Kopf schüttelte und stattdessen einen weiteren Tee orderte.
„Und die WADA kann von Ihrem Felgenantrieb nichts entdecken?“, fragte Miller schließlich.
„Praktisch unmöglich. Sie müssten das Rad mit einem hochleistungsfähigen Röntgengerät scannen. Äußerlich ist nichts erkennbar. Das ist Hightech, ein Felgenantrieb, der ähnlich wie der einer Magnetschwebebahn funktioniert. Ein Transversalflussmotor. Die Energie liefern organische Solarzellen, die als Folie wie Lack auf den Rahmen aufgetragen werden, eine schwere Speicherzelle ist unnötig. Das Ganze wiegt kaum etwas und als Motor ist diese Technologie nicht zu identifizieren.“
„Klingt spannend. Leider verstehe ich von Technik rein nichts.“ Miller begann, seine Serviette pedantisch zu falten und nach jeder Faltung glatt zu streichen. „Mir geht da immer nur ein Gedanke im Kopf herum. Wenn alle diesen Motor verwenden würden und der nicht zu entdecken wäre, was würde da einen Sieger ausmachen?“
Takahashi hatte die Faltung der Serviette schweigend beobachtet und zunächst erwartet, Miller würde dabei eine besondere Form oder Figur erzeugen, war aber dann von dem banalen Ergebnis ebenso gelangweilt wie von der Fragestellung. „Es wird der bessere Ingenieur gewinnen. So wie derzeit häufig der bessere Pharmazeut“, antwortete er höflich.
8
Die Fachleute der französischen Antidopingagentur AFLD hatten eine erste kurze Stellungnahme zu den vorläufigen Laborergebnissen geliefert. Eine genaue Analyse könne mehrere Monate dauern, schrieb man, und dazu müssten dann auch sämtliche Laborergebnisse vorliegen. Noch wüsste ja keiner so ganz genau, was Höffner sich alles einverleibt hätte. Tatsache sei auf der Basis der derzeitigen Erkenntnisse nur, dass Höffner zwar gentechnisch hergestelltes EPO im Blut hatte und insofern die Forensik richtig lag. Die Erythrozytenzahl sei aber nicht bedeutend hoch gewesen. Normalerweise erreichten Sportler diesen Wert auch durch ein exzessives Höhentraining. Als Todesursache könne es gleichwohl infrage kommen – der Grenzwert des Weltradsportverbandes UCI für Hämatokrit, also des Anteils der Erythrozyten am Volumen des Blutes, sei mit zweiundfünfzig leicht überschritten gewesen – selbst, wenn es nicht sehr wahrscheinlich sei. „Das“, fluchte Luc Vidal, „sagt nun Scheiße nochmals gar nichts aus.“
„Werden Sie kreativ, Vidal“, würde der Polizeichef sagen, und Luc entschied sich für den Besuch der einschlägigen Radgeschäfte rund um den Ventoux. Er verließ Avignon auf der Schnellstraße in Richtung Carpentras, immer den unvermittelt monumental aus dem flacheren Vorland aufragenden Mont Ventoux vor Augen, und steuerte zunächst Malaucène an, wo es allein drei Läden für Biker gab. Der Verkauf von Radsportartikeln schien sich zu lohnen. Vidal hielt auf dem Parkstreifen entlang der Hauptstraße. Unter ausladenden Platanen reihten sich dort Restaurants und Bars aneinander, in denen sich jetzt zur Mittagszeit Touristen drängten. Es war die Flaniermeile des kleinen Ortes, von der aus die Nordroute hinauf zum Gipfelpass abzweigte. Unzählige Radfahrer machten dort Halt.
Er betrat einen der Fahrradläden, sah sich zunächst einige der ausgestellten Rennräder an und widmete sich dann den Trikots. Seine aktuelle Konfektionsgröße kannte er nicht. Während er auf einen Verkäufer wartete, lauschte er auf die Gespräche anderer Kunden und schnappte Wortfetzen auf. Zweimal wurde ein toter deutscher Fahrer erwähnt. Das Unglück hatte sich herumgesprochen.
„Wer ist gestorben?“, fragte Vidal, ohne exakt jemand mit dieser Frage anzusprechen. Einer berichtete mit Bestimmtheit über Höffners Tod. „Doping“, sagte der Mann, „von den Berufsfahrern machen das doch viele. Aber der soll auch Drogen genommen haben. Koks, habe ich gehört.“
„Genaues weiß man nicht?“
„Das wird man vielleicht nie erfahren. Ist ja häufig so. Denk mal an Marco Pantani, da ist auch nach zwölf Jahren die Todesursache nicht klar.“
Als Vidal schließlich das Geschäft wieder verließ, ohne etwas gekauft zu haben, fiel ihm eine Frau mit blondem Kurzhaarschnitt auf. Sie hielt einen Satz Bremsgummis in der Hand, wirkte erschöpft und sah ihn aufmerksam an.
9
Der andere war zuerst eingetroffen. Er war hager. Ein scharf geschnittenes Gesicht mit kantigen Knochen, tief liegenden Augen und schmalen, fast fleischlosen Lippen. Ausgezehrt vom Training mit andauernder Maximalgeschwindigkeit. Er nannte sich Sergeij. Miller hatte ihn tatsächlich kurzfristig vermittelt. Er sei ein Talent, ein zukünftiger Spitzenfahrer. Er schaffe vierhundertachtzig Watt. Als Dauerleistung. Und er wäre zuverlässig. Verschwiegen. Ein Mann aus dem Osten. Er würde zehntausend nehmen. Das sei ein guter Preis. Takahashi müsse sich entscheiden. Er, Miller, habe in der Zwischenzeit in Erfahrung gebracht, dass auch andere an einem Felgenantrieb bauten. Takahashi liefe die Zeit davon. Der wusste das.
Sie hatten sich an einem Feldweg südlich von Saint Estève verabredet. Von dort fiel die Ebene unterhalb des Ventoux sanft in Richtung des Ortes Flassan ab. Erst am Horizont konnte man im Dunst des Morgens als nächsten Höhenzug die dunkle Kontur des Plateau de Vaucluse erkennen. Dazwischen lag dünn besiedeltes Agrarland.
Sie sprachen englisch miteinander und die Kommunikation erwies sich als schwierig. „Wir dokumentieren den Zugewinn an Leistung durch den Felgenmotor. Es ist für den Verkauf. Niemand sieht ein fertiges Rad, bevor er diese Antriebstechnik für sich kauft. Ich dokumentiere deshalb deine Fahrleistung. Das wird mein Verkaufsargument. Erst fährst du mit dem Rad, in das der Motor eingebaut ist, dann ohne.“ Der Mann nickte, Takahashi war sich aber nicht sicher, ob er wirklich verstanden hatte. Er dachte einen Moment lang nach und wiederholte dann seinen Satz mit anderen Worten und in anderem Satzbau.
Der Mann nickte wieder. „Ich fahre einmal mit einem Motor und einmal ohne“, bestätigte er. „Aber wo ist der Motor?“
Es würde noch schwieriger werden, als befürchtet. Zudem begann Sergeij, von einem Bein auf das andere zu hüpfen und mit den Armen gegen seinen Oberkörper zu schlagen. Obwohl bereits die Sonne schien und Takahashi fand, dass es eine recht angenehme Temperatur sei, fror der andere, dessen ausgemergelter Körper keinen Kälteschutz bot.
„Hier“, erklärte Takahashi, „und hier und hier.“ Er zeigte mit dem Finger auf die Felge, den Rahmen unterhalb der Sattelstütze und den Lack, und er wusste, dass dies keine wirkliche gute Erklärung war. Natürlich war dort nichts zu sehen. Eine sichtbare Konstruktion würde ja auch kaum den Zweck des Motor-Dopings erfüllen.
Er versuchte dann doch noch, den technischen Hintergrund darzulegen. „Hier sind kleine Magnete eingelassen.“ Er kreiste mit dem Finger um die Carbonfelge und nahm dann eine Büroklammer, die er aus seiner Tasche gezogen hatte, bog sie auseinander und hielt sie an das glatte mattschwarze Material. Die Klammer hielt dort einen kurzen Moment, begann dann abwärts zu gleiten und fiel unvermittelt zu Boden. „Die Magnete sind ganz schwach“, erklärte Takahashi, „es soll nicht auffallen, dass die Felge magnetisch ist. Und hier im Rahmen“, er strich mit dem Finger über die dicht an der Felge vorbeiführende Konstruktion, „sind Kupferspulen untergebracht, die ein elektromagnetisches Feld erzeugen. Nach dem Prinzip sich gegenseitig abstoßender Magnete wird das Rad so angetrieben.“
Sergeij sah ihn zweifelnd an. Er schien nicht wirklich verstanden zu haben, was der Japaner grade erläutert hatte. „Und woher kommt die Energie?“, fragte er dann aber doch sehr konkret nach.
Wieder strich Takahashi mit dem Finger über den Rahmen, der ungewöhnlich klobig wirkte, durch die ausschließliche Verwendung von Carbon als Werkstoff aber viel leichter als filigrane Konstruktionen aus Aluminium war. „Das ist keine Lackierung hier drauf, das ist farbige Solarfolie. Mit enorm hohem Wirkungsgrad. Mehr als dreizehn Prozent. Die Fläche des Rahmens reicht aus, bis zu fünfzig Watt Peak zu erreichen, also die Leistung, die ich unter standardisierten Laborbedingungen erreicht habe. Damit hast du beim Sprint am Pass einen riesigen Vorteil. Oberhalb der Baumgrenze reicht die Energieausbeute allemal, um dir die Spitze zu sichern. Dann, wenn alle anderen ihre Kraftreserven schon fast verbraucht haben.“
Das erste Mal lächelte Sergeij. „Gutes Prinzip!“, sagte er. „Und wie ermitteln wir die Leistung?“
„Du benutzt deinen gewohnten Herzfrequenzsensor und dazu ist im Tretkurbelsatz ein Messgerät eingebaut, das alle Fahrdaten erfasst, wie Trittfrequenz, Geschwindigkeit, Distanz, Energieumsatz, Zeit. Ich fahre hinterher und bekomme alle Daten mobil auf mein Notebook übertragen. Zudem mache ich Videoaufnahmen von der Fahrt. So bekommen wir ein lückenloses Bild.“
Sergeij nickte wieder, während Takahashi ihn kritisch ansah. Tatsächlich war der Japaner nicht davon überzeugt, dass sein neuer Testfahrer wirklich verstanden hatte, worum es ging, aber für den Moment gab es keine Alternative. „Dann los!“, sagte er. „Noch sind keine anderen Fahrer am Berg unterwegs. Ich lege auf zu viele Augenzeugen auch keinen Wert. Wir starten mit der Messung knapp zwei Kilometer unterhalb vom Chalet Reynard. Ab da, bis zum Gipfel, fährst du dann Höchstleistung. Ich bleibe von da an dicht hinter dir.“
Sie passierten ein Restaurant unterhalb von Sainte Colombe, bogen in der Spitzkehre der Landstraße nach Nordosten ab und tauchten wenige Meter danach in den Wald ein. Sergeij fuhr in mäßigem Tempo voran und sah immer wieder hinunter auf das ungewöhnlich gestaltete Rad, auf dem er saß, bis er offensichtlich zu der Konstruktion Vertrauen gewonnen hatte und sein Körper warm genug für eine größere Geschwindigkeit war.
Takahashi folgte ihm in deutlichem Abstand und begann nun ebenfalls zu beschleunigen. Entfernt verschwand Sergeij bereits in einer Rechtskurve aus seinem Blickfeld. Es war an der Zeit, die Distanz zu verringern. Der Leihwagen war allerdings ungewöhnlich leistungsschwach. Mehrmals trat er das Gaspedal bis an den Anschlag, was aber weitestgehend wirkungslos blieb. Schließlich schaltete er in den zweiten Gang herunter, der den Motor laut aufheulen ließ, ohne dass er dabei eine deutlich höhere Geschwindigkeit erreichte. Als er die Rechtskurve durchfahren hatte, verschwand Sergeij bereits in der folgenden scharfen Linkskurve. Noch fuhr der Mann nicht seine Spitzengeschwindigkeit. Takahashi fluchte über seinen SUV, der sich am Berg als ungeeignet erwies, erinnerte sich dann aber, dass er bereits andere Steigungen hier in der Provence damit gefahren war, ohne diese Leistungsschwäche bemerkt zu haben.
Die Straße führte nun durch ein enger werdendes Tal aufwärts. Der niedrige Eichenwald, der zu beiden Seiten der Straße die ersten Kilometer begleitet hatte, ging in Kiefernbestand über. Es wurde schattiger und Sergeij würde hier ohne Unterstützung des kleinen Motors fahren müssen. Trotzdem nahm die Distanz zwischen ihnen kontinuierlich zu. Wieder trat Takahashi mehrmals das Gaspedal vollständig durch, wobei er zunehmend das Gefühl hatte, irgendetwas würde den Druck bremsen.
Links von ihm tauchte eine Parkfläche im Wald auf und er fuhr von der Straße ab, um das Gaspedal untersuchen zu können. Es blieben noch genug Kilometer, auf denen er Sergeij einholen könnte, wenn sich das Fahrzeug wieder richtig beschleunigen ließe.
Es war fünfzehn Minuten nach acht und noch niemand war ihnen begegnet oder hatte sie überholt. Takahashi ließ den Motor laufen, kniete sich neben der geöffneten Fahrertür auf den Kies und beugte den Oberkörper in den Fußraum. Mehrmals betätigte er das Pedal mit der Hand und ertastete schließlich den Gelenkbereich auf der Rückseite. Es fühlte einen harten, leicht gewölbten Widerstand, der zwischen den Metallteilen klemmte, konnte aber nicht erkennen, was es war. Er würde einen Schraubenzieher als Hebel brauchen, um den Widerstand bewegen zu können. Vielleicht ließe sich das Hindernis beseitigen.
Takahashi schob sich nach hinten aus dem Fahrzeug heraus, griff mit der rechten Hand nach dem Holm und stützte sich, um aufzustehen, mit der Linken in der Türfüllung ab. In die unscharfe Spiegelung dunkler Kiefern, die er aus dem Augenwinkel auf dem Fahrzeuglack erkannte, schob sich schemenhaft eine weitere dunkle Fläche. Sie bewegte sich schneller als die wiegenden Bäume. Sie bildete einen schärferen Kontrast. Sie war näher.
Ihm wurde in diesem Moment bewusst, dass um ihn herum Tausende von Vögeln in der Stille zwischen den Bäumen zwitscherten und ein intensiver Duft von Kiefernharz in der Luft lag. Er fühlte sich für einen kurzen Augenblick in diesem Land heimisch. Es ist, dachte er, ein ganz und gar japanischer Morgen … und gleich bin ich tot.
10 _
„Setz dich“, sagte die blonde Frau. Sie saß mit angewinkelten Beinen in einem der großen Gartensessel auf der Terrasse hinter Anselm Bernhards altem Bauernhaus und sah Luc Vidal lächelnd an. Ihre nackten Füße lugten unter dem Stoffpolster der Seitenlehne hervor. Vidal registrierte, dass ihre Nägel an Händen und Füßen in einem tiefen Rot lackiert waren.
Das Haus war ein perfekter Rückzugsort. Ein traditionelles provenzalisches Mas, abseits touristischer Wege, umgeben nur von Oliven- und Obstplantagen, Weingärten und Wiesen auf einem Hügel am Fuß des Ventoux gelegen. Anselm hatte es behutsam renoviert und die kleinen Räume in versetzten Ebenen, die in vergangenen Jahrhunderten den Bedürfnissen der Bauern entsprochen hatten, um den Anbau eines großen Raumes im traditionellen Stil der Region erweitert. Ein wuchtiger eichener Bauerntisch bot dort zwölf Personen Platz. In den Wintermonaten war dieser Raum der Treffpunkt für Freunde bei langen Gesprächen und immer wieder überraschenden Köstlichkeiten der provenzalischen Küche. Er hatte den Tisch mit den passenden Stühlen bei einem Antiquitätenhändler in L’Isle-sur-la-Sorgue entdeckt.
An die Südseite des alten Mas grenzte ein verwilderter Garten, der zu zwei Seiten mit einer hohen Mauer aus Bruchsteinen gegen den Mistral geschützt war. Nach Osten ließ eine niedrigere Mauer den Blick zum Ventoux frei. Lorbeer- und Buchssträucher, einzelne Rosenstöcke und ein üppiger Oleander ragten aus dem verwitterten Kies, der den Garten bedeckte. Eine einzelne Zypresse war nahe der im Westen gelegenen Mauer zu beachtlicher Höhe gewachsen. Eine alte Gartenbank mit verschlungenem schmiedeeisernem Gestell und zerbrochenen Holzplanken, deren verwaschenes Türkis sich als farblicher Kontrast von den changierenden Ockertönen der Bruchsteine abhob, war vor der südlich gelegenen Mauer ein stummes Zeugnis längst vergangener Sommer; ihre einzige Funktion war nun die einer langsam verfallenden Skulptur.
Die Terrasse war aus großen, grob behauenen Steinplatten gefügt und erstreckte sich, in unregelmäßiger Tiefe in den Garten ragend, entlang der Südseite des Mas.
Anselm hatte Vidal in der Küche bei der Begrüßung gesagt, er solle schon einmal hinausgehen. „Ihr könnt euch ja selbst vorstellen! Ich bin noch mit den Aperitifs beschäftigt.“
„Ich bin Luc“, sagte der Kommissar. „Wir sind uns schon einmal begegnet. Im Fahrradladen in Malaucène.“
„Ist mir aufgefallen! Ich bin Hannah.“
„Eine Freundin von Max, hat Anselm gesagt.“
„Du erinnerst dich an ihn?“
„Aber klar. Er war mir sehr sympathisch. Und der Tod seiner Freundin hier ist mir ziemlich nahe gegangen.“
„War tragisch, ich weiß. Er hat mir davon erzählt. Ich bin jetzt seine Kollegin. Er versucht sich nach dem Sportstudium als freier Journalist. Ich bin auch eine. Wir haben eine Bürogemeinschaft.“
Vidal schob einen der anderen Gartensessel in Blickrichtung zu Hannah und setzte sich. „Und worüber schreibst du?“
Sie verzog den Mund schräg. „Über alles, was nach Schweiß riecht und mit guter oder lädierter Gesundheit zusammenhängt. Ich kann’s mir nicht aussuchen. Die Katze braucht Futter – und ich ein Dach über dem Kopf. Ich hab ein Faible für Ethik in der Sportberichterstattung. Aber damit kann ich nicht wirklich Geld verdienen.“ Sie sprach leise, in einem melodischen Ton und sah Vidal mit einem leicht ironischen Blick unentwegt an.
Anselm brachte eisgekühlten Blanc Limé, Schüsseln mit Oliven, gekochten Artischocken, Aioli und Sardellencreme.
Die Farben der Landschaft wurden langsam von dem Orangeton des Sonnenuntergangs übermalt und letzte weiße Wolkenflocken spielten am blasser werdenden Himmel mit dem Ventoux. Irgendwo an einem fernen Wasserlauf begannen Millionen von Fröschen und Zikaden fast zeitgleich ihr Konzert. Die Stimmung war perfekt für ein Essen an einem Sommerabend im Kreis von Freunden.
„Wir sind uns bereits in einem Fahrradgeschäft begegnet.“ Hannah zeigte mit dem Finger auf Luc und lächelte vielsagend. Die wasserblauen Augen funkelten in ihrem sommersprossigen Gesicht. „Er hat sich für Trikots interessiert, und als er dabei hörte, dass ein Fahrer vor Kurzem tot vom Rad gefallen ist, bekam er es mit der Angst zu tun und ist, ohne etwas zu kaufen, wieder gegangen.“
„Du hast mich erwischt“, sagte Vidal. „Aber du sahst auch so aus, als würdest du nie wieder ein Rad besteigen wollen.“
„Will ich auch eigentlich nicht. Es war furchtbar. Mir tut immer noch der Po weh. Aber ich muss etwas abnehmen und Anselm kocht so gut, dass ich mindestens einmal täglich auf den Berg muss.“
Anselm tauchte ein Artischockenblatt in die Anchoiade und kaute genüsslich das weiche Fleisch daran ab. „Du musst hier nichts essen. Wenn du fasten würdest, könntest du den ganzen Tag in der Sonne liegen. Es liegt nur an dir.“
„Kommt nicht infrage. Wann bin ich schon mal bei einem Spitzenkoch zu Gast … aber es ist tatsächlich auch ein Stück weit beruflich, dass ich zum Ventoux hochgefahren bin“, sagte sie zu Luc gewandt.
Sie lächelte und Vidal überlegte, ob man diese Art zu lächeln spitzbübisch nennen konnte. „Das musst du mir erklären“, sagte er dann, während er ebenfalls eine Artischocke nahm und diese mit so außerordentlichem Interesse betrachtete, als würde er die Frucht das erste Mal in seinem Leben sehen.