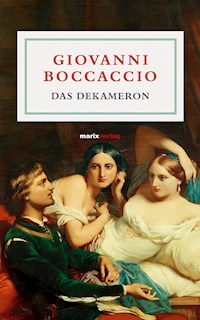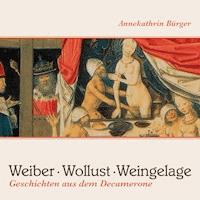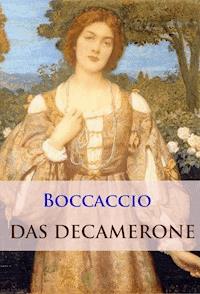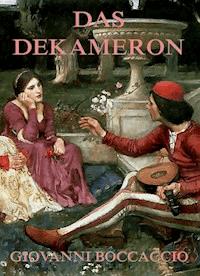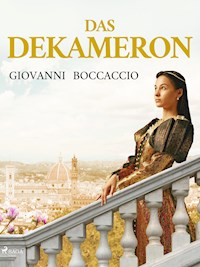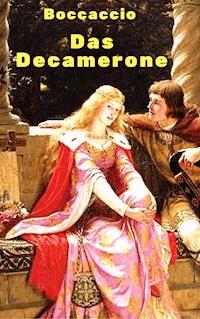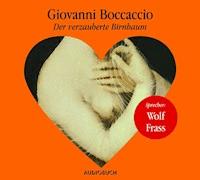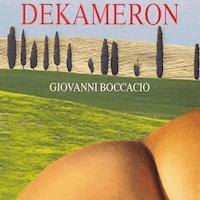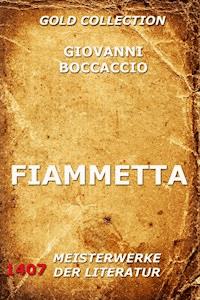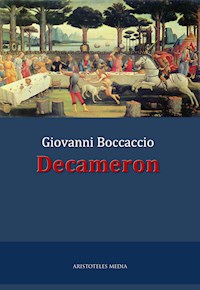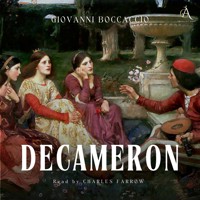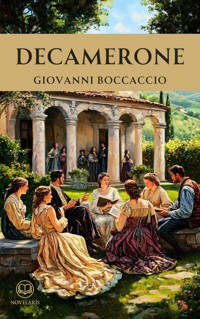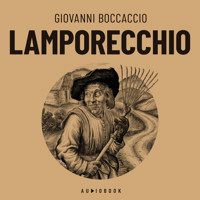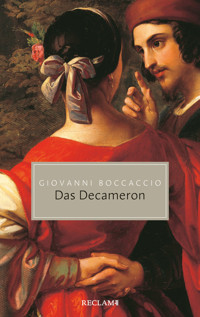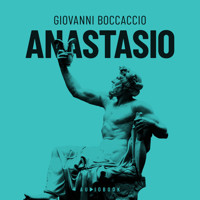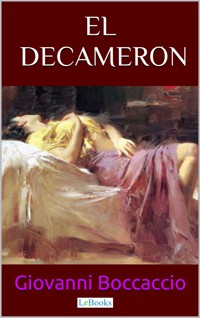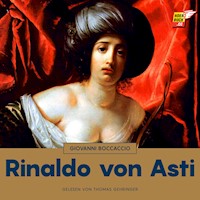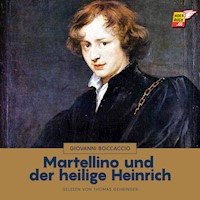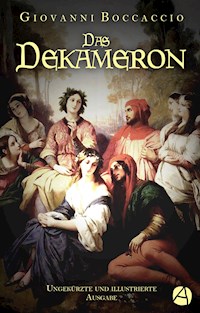
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: apebook Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das “Dekameron” ist eine Sammlung von 100 Geschichten, die von einer Gruppe von sieben jungen Frauen und drei jungen Männern erzählt werden, die sich in einer selbst auferlegten Quarantäne verschanzt haben, um die Pandemie abzuwarten, die damals im 14. Jahrhundert in Florenz wütete. Boccaccios Dekameron stammt aus dem Griechischen und bedeutet “zehntägiges Ereignis”. Seine Figuren amüsieren sich, indem sie während der zehn Tage ihrer Gefangenschaft jeden Tag eine Geschichte erzählen – hundert Geschichten über Liebe und Abenteuer, Leben und Tod und überraschende Wendungen des Schicksals. Dabei geht es weniger um abstrakte Begriffe wie Moral oder Religion als vielmehr um irdische Werte. Die Geschichten reichen von der unzüchtigen Peronella, die ihren Liebhaber in einer Wanne versteckt, bis hin zu Ser Cepperallo, der trotz seines unheiligen Leichtsinns zum Heiligen wird. Das Ergebnis ist ein überragendes Monument der europäischen Literatur und ein Meisterwerk der phantasievollen Erzählkunst, das Schriftsteller von Chaucer bis Shakespeare inspiriert hat. Das Buch umfasst ca. 1200 gedruckte Seiten und ist mit einer Vielzahl von Illustrationen dekoriert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1479
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
GIOVANNI BOCCACCIO
DAS DEKAMERON
100 NOVELLEN
DAS DEKAMERON wurde im italienischen Original von Boccaccio ca. 1349-1353 verfasst.
Diese Ausgabe wurde aufbereitet und herausgegeben von
© apebook Verlag, Essen (Germany)
www.apebook.de
1. Auflage 2021
V 1.0
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-96130-423-3
Buchgestaltung: SKRIPTART, www.skriptart.de
Books made in Germany with
Bleibe auf dem Laufenden über Angebote und Neuheiten aus dem Verlag mit dem lesenden Affen und
abonniere den kostenlosen apebook Newsletter!
Erhalte zwei eBook-Klassiker gratis als Willkommensgeschenk!
Du kannst auch unsere eBook Flatrate abonnieren.
Dann erhältst Du alle neuen eBooks aus unserem Verlag (Klassiker und Gegenwartsliteratur)
für einen sehr kleinen monatlichen Beitrag (Zahlung per Paypal oder Bankeinzug).
Hier erhältst Du mehr Informationen dazu.
Follow apebook!
*
* *
ROMANE von JANE AUSTEN
bei apebook
Verstand und Gefühl
Stolz und Vorurteil
Mansfield Park
Northanger Abbey
Emma
*
* *
HISTORISCHE ROMANREIHEN
bei apebook
Der erste Band jeder Reihe ist kostenlos!
Die Geheimnisse von Paris. Band 1
Mit Feuer und Schwert. Band 1: Der Aufstand
Quo Vadis? Band 1
Bleak House. Band 1
Am Ende des Buches findest du weitere Buchtipps und kostenlose eBooks.
Und falls unsere Bücher mal nicht bei dem Online-Händler deiner Wahl verfügbar sein sollten: Auf unserer Website sind natürlich alle eBooks aus unserem Verlag (auch die kostenlosen) in den gängigen Formaten EPUB (Tolino etc.) und MOBI (Kindle) erhältlich!
Inhaltsverzeichnis
Das Dekameron
Frontispiz
Impressum
Giovanni Boccaccio
Über das Dekameron
Erster Tag
Erste Geschichte
Herr Chapelet täuscht einen frommen Pater durch eine falsche Beichte und stirbt. Trotz des schlechten Lebenswandels, den er geführt, kommt er nach seinem Tode in den Ruf der Heiligkeit und wird Sankt Chapelet genannt.
Zweite Geschichte
Der Jude Abraham geht auf Antrieb des Jeannot von Sevigné nach Rom und kehrt, als er die Schlechtigkeit der Geistlichen dort kennengelernt hat, nach Paris zurück, um Christ zu werden.
Dritte Geschichte
Der Jude Melchisedech entgeht durch eine Geschichte von drei Ringen einer großen Gefahr, die ihm Saladin bereitet hat.
Vierte Geschichte
Ein Mönch befreit sich von einer schweren Strafe, die er verwirkt hat, indem er seinem Abte dasselbe Vergehen auf geschickte Weise vorhält.
Fünfte Geschichte
Die Markgräfin von Montferrat weist die törichte Liebe des Königs von Frankreich durch ein Hühnergericht und ein paar hübsche Worte zurück.
Sechste Geschichte
Ein wackerer Mann beschämt durch einen guten Einfall die Heuchelei der Mönche.
Siebente Geschichte
Bergamino beschämt auf feine Weise Herrn Cane della Scala wegen einer plötzlichen Anwandlung von Geiz, indem er ihm eine Geschichte von Primasseau und dem Abt von Clugny erzählt.
Achte Geschichte
Guiglielmo Borsiere straft mit feiner Rede den Geiz des Herrn Ermino de' Grimaldi.
Neunte Geschichte
Aus dem schwachen König von Zypern wird durch den Spott einer Edeldame aus der Gaskogne ein entschlossener Herrscher.
Zehnte Geschichte
Meister Alberto von Bologna beschämt auf feine Weise eine Dame, die ihn wegen seiner Liebe zu ihr beschämen wollte.
Zweiter Tag
Erste Geschichte
Martellino stellt sich lahm und gibt vor, durch den Leichnam des heiligen Heinrich geheilt zu werden. Sein Betrug wird entdeckt, er wird geprügelt und eingekerkert und schwebt in Gefahr, gehenkt zu werden, kommt aber endlich los.
Zweite Geschichte
Rinaldo von Asti kommt, von Räubern ausgeplündert, nach Castel Guiglielmo, wo er von einer Witwe beherbergt und für seinen Unfall schadlos gehalten wird und dann unversehrt nach Hause zurückkehrt.
Dritte Geschichte
Drei Jünglinge bringen ihr Hab und Gut durch und verarmen. Ein Neffe von ihnen kehrt, an allem verzagend, nach Hause zurück und trifft unterwegs mit einem Abte zusammen, der sich als Tochter des Königs von England entpuppt. Sie heiratet ihn und macht seine Oheime durch Ersatz des Verlorenen wieder wohlhabend.
Vierte Geschichte
Landolfo Ruffolo verarmt, wird Korsar, gerät in genuesische Gefangenschaft und erleidet Schiffbruch. Er rettet sich auf einer Kiste voll köstlicher Edelsteine, wird in Korfu von einem armen Weibe beherbergt und kehrt reich in die Heimat zurück.
Fünfte Geschichte
Andreuccio von Perugia kommt nach Neapel, um Pferde zu kaufen, und gerät in einer Nacht dreimal in Lebensgefahr, entrinnt ihr jedoch jedesmal und kehrt mit einem Rubin in seine Heimat zurück.
Sechste Geschichte
Madonna Beritola verliert ihre zwei Söhne, wird dann mit zwei kleinen Rehen auf einer Insel gefunden und geht nach Lunigiana. Hier tritt einer ihrer Söhne bei dem Landesherrn in Dienst, schläft mit dessen Tochter und wird gefangengesetzt. Inzwischen empört sich Sizilien gegen König Karl, der Sohn wird von seiner Mutter erkannt und heiratet die Tochter seines Herrn. Der Bruder findet sich ebenfalls, und beide werden wieder vornehme Leute.
Siebente Geschichte
Der Sultan von Babylon schickt seine Tochter dem König von Algarbien zur Frau, sie aber gerät durch eine Reihe von Ereignissen in einem Zeitraum von vier Jahren und an verschiedenen Orten neun Männern in die Hände. Endlich wird sie ihrem Vater zurückgebracht und reist als vorgebliche Jungfrau zum König von Algarbien, um dessen Gattin zu werden.
Achte Geschichte
Der Graf von Antwerpen geht einer falschen Anschuldigung wegen in die Verbannung und läßt seine zwei Kinder an verschiedenen Orten in England. Als er später unerkannt zurückkehrt, findet er beide in glücklicher Lage. Er zieht als Stallknecht mit dem Heere des Königs von Frankreich, seine Unschuld wird entdeckt, und er gewinnt seine frühere Stellung wieder.
Neunte Geschichte
Bernabo von Genua verliert durch Ambrogiuolos Betrug sein Vermögen und befiehlt, daß seine unschuldige Frau getötet werde. Sie entkommt und dient in Männerkleidern dem Sultan. Dann entdeckt sie den Betrüger und veranlaßt Bernabo, nach Alexandrien zu kommen. Der Betrüger wird bestraft, und sie kehrt, wieder im Frauengewand, mit ihrem Manne reich nach Genua zurück.
Zehnte Geschichte
Paganino von Monaco raubt dem Herrn Ricciardo von Chinzica seine Gattin. Dieser erfährt, wo sie ist, begibt sich dorthin, befreundet sich mit Paganino und fordert sie von ihm zurück. Paganino verspricht sie ihm, wenn sie wieder zu ihm wolle. Sie hat aber keine Lust, zu ihm zurückzukehren, und wird nach Herrn Ricciardos Tode Paganinos Frau.
Dritter Tag
Erste Geschichte
Masetto von Lamporecchio stellt sich stumm und wird Gärtner in einem Nonnenkloster, dessen Bewohnerinnen um die Wette bei ihm schlafen.
Zweite Geschichte
Ein Stallknecht schläft bei der Gemahlin des Königs Agilulf. Der König bemerkt es im stillen, findet ihn und schneidet ihm die Haare ab. Der Geschorene tut seinen Kameraden ein Gleiches und entgeht dadurch seinem Unstern.
Dritte Geschichte
Eine Dame, die in einen jungen Mann verliebt ist, bringt unter dem Vorwand der Beichte und großer Gewissenhaftigkeit einen sittenstrengen Mönch dahin, daß er, ohne zu wissen, was er tut, sie an das Ziel ihrer Wünsche führt.
Vierte Geschichte
Don Felice lehrt den Bruder Puccio, wie er durch eine Bußübung selig werden kann. Bruder Puccio nimmt sie auf sich, und Don Felice vertreibt sich inzwischen mit dessen Frau die Zeit.
Fünfte Geschichte
Zima schenkt Herrn Francesco Vergellesi ein schönes Pferd und erhält dafür die Erlaubnis, mit dessen Frau reden zu dürfen. Als sie schweigt, antwortet er selbst in ihrem Namen, und dann erfolgt alles seinen Antworten gemäß.
Sechste Geschichte
Ricciardo Minutolo liebt die Gattin des Filippello Fighinolfi. Er erfährt, daß sie eifersüchtig auf ihren Mann ist, spiegelt ihr vor, Filippello werde am nächsten Tag mit seiner, Ricciardos, Frau in einem Bade zusammentreffen, und erreicht, daß sie hingeht. Während sie glaubt, mit ihrem Manne zusammen gewesen zu sein, findet sich, daß sie bei Ricciardo gelegen hat.
Siebente Geschichte
Tedaldo verläßt Florenz im Unfrieden mit seiner Geliebten. Nach einiger Zeit kehrt er, als Pilger verkleidet, zurück, spricht mit ihr, bringt sie zur Erkenntnis ihres Unrechts, rettet ihren Mann, der des Mordes an ihm überführt ist, vor dem Tode, versöhnt ihn dann mit seinen Brüdern und erfreut sich mit der Geliebten in aller Vorsicht des Glücks der Liebe.
Achte Geschichte
Ferondo wird, nachdem er ein gewisses Pulver geschluckt hat, für tot begraben. Der Abt aber, der sich inzwischen mit seiner Frau ergötzt, holt ihn aus dem Grabe, setzt ihn gefangen und macht ihm weis, er sei im Fegefeuer. Dann wird er auferweckt und erzieht einen Sohn, den der Abt mit seiner Frau erzeugt hat, als den seinigen.
Neunte Geschichte
Gillette von Narbonne heilt den König von Frankreich von einer Fistel und verlangt dafür Bertrand von Roussillon zum Manne. Dieser heiratet sie wider Willen und geht aus Verdruß nach Florenz. Hier verliebt er sich in ein junges Mädchen, das er zu umarmen glaubt, während er Gillette beschläft. Diese gebiert ihm zwei Söhne, um derentwillen er sie liebgewinnt und als Gemahlin behandelt.
Zehnte Geschichte
Alibech wird Einsiedlerin, und der Mönch Rusticus lehrt sie den Teufel in die Hölle heimschicken. Dann kehrt sie zurück und wird die Frau des Neerbal.
Vierter Tag
Erste Geschichte
Tancredi, Fürst von Salerno, tötet den Geliebten seiner Tochter und schickt ihr sein Herz in einer goldenen Schale; sie aber gießt vergiftetes Wasser darüber, trinkt es und stirbt.
Zweite Geschichte
Bruder Alberto redet einer Frau ein, der Engel Gabriel sei in sie verliebt, und beschläft sie mehrmals in dessen Namen. Endlich springt er aus Furcht vor ihren Verwandten aus dem Fenster und flüchtet in das Haus eines armen Mannes, der ihn, als wilden Mann verkleidet, am nächsten Tag auf den Marktplatz bringt, wo er erkannt, von seinen Klosterbrüdern festgehalten und ins Gefängnis gesetzt wird.
Dritte Geschichte
Drei Jünglinge lieben drei Schwestern und fliehen mit diesen nach Kreta. Die älteste von ihnen ermordet aus Eifersucht ihren Geliebten. Die zweite rettet jene dadurch vom Tode, daß sie sich dem Herzog von Kreta ergibt. Dafür ermordet aber ihr Geliebter sie und flieht mit der ältesten. Die dritte Schwester und ihr Freund werden dieses Mordes beschuldigt und bekennen sich im Gefängnis dazu. Aus Furcht vor dem Tode bestechen sie die Wächter und fliehen arm nach Rhodos, wo sie im Elend sterben.
Vierte Geschichte
Gerbino greift gegen das Versprechen König Wilhelms, seines Großvaters, ein Schiff des Königs von Tunis an, um dessen Tochter zu rauben. Die Schiffsleute töten die Dame, wofür Gerbino sie alle umbringt, ihm aber nachher der Kopf abgeschlagen wird.
Fünfte Geschichte
Lisabettas Geliebter wird von ihren Brüdern ermordet. Er erscheint ihr im Traum und zeigt ihr, wo er verscharrt ist. Darauf gräbt sie seinen Kopf heimlich aus, tut ihn in einen Basilikumtopf und benetzt ihn täglich stundenlang mit ihren Tränen. Endlich nehmen ihn die Brüder ihr fort, und sie stirbt bald darauf vor Gram.
Sechste Geschichte
Andreola liebt den Gabriotto. Sie erzählt ihm einen Traum, den sie gehabt hat, und er ihr einen anderen. Darauf stirbt er plötzlich in ihren Armen. Als sie ihn mit ihrer Dienerin nach Hause trägt, werden sie von der Wache gefangen, und sie gesteht, wie sich alles zugetragen hat. Der Stadtrichter will ihrer Ehre Gewalt antun, sie wehrt sich aber. Ihr Vater erfährt indes, wo sie ist, und befreit sie, da er sie unschuldig findet. Sie aber weigert sich, länger in der Welt zu leben, und wird Nonne.
Siebente Geschichte
Simona liebt den Pasquino. Als sie miteinander in einem Garten sind, reibt Pasquino sich mit einem Salbeiblatt die Zähne und stirbt. Simona wird festgenommen und stirbt gleichfalls, als sie ein anderes jener Salbeiblätter an den Zähnen zerreibt, um dem Richter zu zeigen, wie Pasquino gestorben ist.
Achte Geschichte
Girolamo liebt Salvestra. Die Bitten seiner Mutter nötigen ihn, nach Paris zu gehen, und als er zurückkommt, findet er seine Geliebte verheiratet. Er schleicht sich verstohlen in ihr Haus und stirbt an ihrer Seite. Die Leiche wird in eine Kirche getragen, und Salvestra sinkt tot neben ihr nieder.
Neunte Geschichte
Herr Guillem von Roussillon gibt seiner Frau das Herz des Herrn Guillem von Cabestaing zu essen, den sie geliebt und den er getötet bat. Als sie es erfährt, stürzt sie sich aus einem hohen Fenster herab und wird mit ihrem Geliebten begraben.
Zehnte Geschichte
Die Frau eines Arztes legt ihren Geliebten, der einen Schlaftrunk genommen hat, den sie aber für tot hält, in einen Kasten, den zwei Wucherer mit dem Scheintoten in ihr Haus tragen. Letzterer erholt sich und wird als Dieb gefangen. Die Magd der Frau redet dem Richter vor, sie habe jenen in den Kasten gelegt, den die Wucherer gestohlen. So wird er vom Galgen gerettet, die Wucherer aber werden wegen des Kastendiebstahls zu einer Geldstrafe verurteilt.
Fünfter Tag
Erste Geschichte
Kimon wird durch die Liebe vernünftig und raubt Iphigenie, seine Geliebte, zur See. In Rhodos verhaftet, wird er durch Lysimachos befreit, und beide entführen gemeinschaftlich Iphigenie und Kassandra von ihrem Hochzeitsfest. Sie fliehen nach Kreta und heiraten dort ihre Geliebten, mit denen sie endlich in die Heimat zurückberufen werden.
Zweite Geschichte
Costanza liebt Martuccio Gomito. Auf die Nachricht von seinem Tode bin überläßt sie sich verzweifelt und allein einem Kahne, den der Wind nach Susa treibt. In Tunis findet sie den Geliebten lebendig wieder und gibt sich ihm, der inzwischen durch klugen Ratschlag die Gunst des Königs erworben hat, zu erkennen. Er heiratet sie und kehrt mit ihr als reicher Mann nach Lipari zurück.
Dritte Geschichte
Pietro Boccamazza flieht mit Agnolella und stößt auf Räuber. Das Mädchen flüchtet sich in einen Wald und wird von dort zu einer Burg geführt. Pietro fällt gefangen in die Hände der Räuber, entgeht ihnen aber wieder und gelangt endlich, nachdem er noch andere Gefahren überstanden hat, in dieselbe Burg, wo Agnolella sich befindet. Dort vermählt er sich mit ihr, und beide kehren nach Rom zurück.
Vierte Geschichte
Ricciardo Manardi wird von Messer Lizio da Valbona bei dessen Tochter angetroffen. Er heiratet das Mädchen und söhnt sich mit ihrem Vater wieder aus.
Fünfte Geschichte
Guidotto von Cremona vertraut sterbend dem Giacomino von Pavia seine Pflegetochter an. Giannole di Severino und Minghino di Mingole verlieben sich zu Faenza beide in sie und werden darüber miteinander handgemein. Endlich wird entdeckt, daß das Mädchen eine Schwester des Giannole ist, und Minghino erhält sie zur Frau.
Sechste Geschichte
Gian von Procida wird bei seiner Geliebten, die inzwischen dem König Friedrich geschenkt worden war, überrascht und mit ihr an einen Pfahl gebunden, um verbrannt zu werden. Ruggieri dell' Oria erkennt und rettet ihn, und er wird ihr Gemahl.
Siebente Geschichte
Theodor verliebt sich in Violante, die Tochter des Messer Amerigo, seines Herrn, schwängert sie und wird deshalb zum Strange verurteilt. Während er mit Geißelhieben zur Hinrichtung geführt wird, erkennt und befreit ihn sein Vater, und er vermählt sich mit Violante.
Achte Geschichte
Nastagio degli Onesti bewirbt sich um die Liebe einer Dame aus dem Hause Traversari und bringt, ohne Gegenliebe zu finden, dabei sein ganzes Vermögen durch. Auf die Bitten der Seinigen geht er eines Tages nach Chiassi und sieht dort, wie ein junges Mädchen von einem Ritter gejagt, getötet und dann von zwei Hunden gefressen wird. Darauf lädt er seine Familie, die Dame und ihre Angehörigen zu einem Mittagessen dorthin, und der Anblick des zerfleischten Mädchens und die Furcht vor einem ähnlichen Schicksal erschrecken die Spröde so sehr, daß sie Nastagio zum Manne nimmt.
Neunte Geschichte
Federigo degli Alberighi liebt, ohne Gegenliebe zu finden, und verzehrt in ritterlichem Aufwand sein ganzes Vermögen, so daß ihm nur ein einziger Falke bleibt. Den setzt er, da er nichts anderes hat, seiner Dame, die ihn zu besuchen kommt, zum Essen vor. Sie aber ändert, als sie dies vernommen, ihre Gesinnung, nimmt ihn zum Manne und macht ihn reich.
Zehnte Geschichte
Pietro di Vinciolo geht aus, um anderwärts zu Nacht zu essen. Seine Frau läßt ihren Buhlen kommen; Pietro kehrt aber heim, und die Frau versteckt den Liebhaber unter einem Hühnerkorbe. Pietro erzählt, daß im Hause Ercolanos, bei dem er gespeist, ein Jüngling, den die Frau verborgen, gefunden worden sei, worüber Pietros Frau die des Ercolano heftig tadelt. Zum Unglück tritt ein Esel dem Burschen unter dem Korbe auf die Finger, so daß er schreien muß. Pietro läuft hinzu, sieht ihn und erkennt die Falschheit seiner Frau, ist aber niederträchtig genug, sich am Ende doch wieder mit ihr auszusöhnen.
Sechster Tag
Erste Geschichte
Ein Edelmann sagt zu Madonna Oretta, er wolle ihr den Weg durch eine Geschichte so sehr verkürzen, daß sie glauben werde, sie sitze zu Pferde. Als er sie darauf ungeschickt erzählt, bittet sie ihn, daß er sie wieder absteigen lasse.
Zweite Geschichte
Cisti, der Bäcker, bringt durch eine beißende Antwort Messer Geri Spina wegen eines unbescheidenen Begehrens zur Einsicht.
Dritte Geschichte
Monna Nonna de' Pulci gebietet durch eine treffende Antwort den unschicklichen Reden des Bischofs von Florenz Schweigen.
Vierte Geschichte
Chichibio, der Koch des Currado Gianfigliazzi, verwandelt durch einen schnellen Einfall den Zorn des Currado in Gelächter und rettet sich vor dem Unheil, mit dem dieser ihn schon bedroht hatte.
Fünfte Geschichte
Messer Forese da Rabatta und Meister Giotto, der Maler, die beide von Mugello zurückkommen, machen sich gegenseitig über ihr unscheinbares Aussehen lustig.
Sechste Geschichte
Michele Scalza beweist einigen jungen Leuten, daß die Baronci das adeligste Geschlecht in der Welt und in der Maremma sind, und gewinnt damit eine Mahlzeit.
Siebente Geschichte
Madonna Filippa wird vor Gericht gefordert, weil ihr Gatte sie mit ihrem Geliebten erwischt hat. Durch ihre geschickte und lustige Antwort kommt sie aber frei und veranlaßt eine Abänderung des Stadtrechts.
Achte Geschichte
Fresco rät seiner Nichte, niemals in den Spiegel zu sehen, wenn ihr der Anblick unausstehlicher Leute so widerwärtig sei, wie sie behaupte.
Neunte Geschichte
Guido Cavalcanti sagt einigen Florentiner Edelleuten, die ihn überrascht haben, in versteckter Weise die Wahrheit.
Zehnte Geschichte
Bruder Cipolla verspricht den Bewohnern eines Landstädtchens, ihnen eine Feder des Engels Gabriel zu zeigen. Da er aber an deren Stelle Kohlen findet, sagt er, sie seien von denen, mit welchen der heilige Laurentius geröstet ward.
Siebenter Tag
Erste Geschichte
Gianni Lotteringhi hört des Nachts an seiner Tür klopfen, weckt seine Frau und läßt sich von dieser weismachen, es sei ein Gespenst. Beide machen sich daran, dies mit einem Gebet zu beschwören, und das Klopfen hört auf.
Zweite Geschichte
Peronella versteckt, als ihr Gatte plötzlich nach Hause kommt, ihren Geliebten in einem Weinfaß. Der Mann sagt ihr, er habe das Faß verkauft, sie antwortet aber, daß sie den Handel schon mit einem andern abgeschlossen habe, der eben hineingekrochen sei, um seine Festigkeit zu prüfen. Nun kommt dieser heraus, läßt das Faß noch vom Gatten ausschaben und dann in sein Haus tragen.
Dritte Geschichte
Bruder Rinaldo schläft bei seiner Gevatterin. Der Mann überrascht sie in der Kammer, und man macht ihm weis, daß jener seinem Patenkind die Würmer besprochen habe.
Vierte Geschichte
Tofano sperrt eines Nachts seine Frau aus dem Hause aus. Da sie auf ihre Bitten hin keinen Einlaß erhält, tut sie, als stürze sie sich in einen Brunnen, indem sie einen großen Stein hineinwirft. Tofano kommt hierauf aus dem Hause, die Frau schleicht sich hinein und sperrt nun ihn aus, wobei sie ihn zugleich ausschilt und verhöhnt.
Fünfte Geschichte
Ein Eifersüchtiger hört, als Priester verkleidet, seiner Frau die Beichte. Sie macht ihm weis, sie liebe einen Geistlichen, der jede Nacht zu ihr komme. Während der Eifersüchtige diesem an der Tür auflauert, läßt die Frau ihren Liebhaber über das Dach zu sich kommen und vergnügt sich mit ihm.
Sechste Geschichte
Während Madonna Isabella den Lionetto bei sich hat, wird sie von Lambertuccio, der sie ebenfalls liebt, besucht. Da ihr Gatte zurückkehrt, schickt sie den Lambertuccio mit einem Dolch in der Hand aus dem Hause, worauf ihr Mann den Lionetto heimbegleitet.
Siebente Geschichte
Lodovico offenbart Madonna Beatrice seine Liebe. Sie schickt Egano, ihren Gatten, in ihren Kleidern in den Garten, während Lodovico sie beschläft. Dann steht dieser auf und verprügelt im Garten den Egano.
Achte Geschichte
Ein Ehemann wird eifersüchtig auf seine Frau. Sie wickelt sich einen Bindfaden um die Zehe, um gewahr zu werden, wann ihr Geliebter kommt. Der Mann merkt es. Während er aber den Liebhaber verfolgt, legt die Dame an ihrer Statt eine andere ins Bett, die vom Manne geprügelt wird und die Haare abgeschnitten bekommt. Dann eilt er zu ihren Brüdern, die ihn ausschelten, als sie finden, daß alles unwahr sei.
Neunte Geschichte
Lydia, die Gattin des Nikostratus, liebt den Pyrrhus. Um an ihre Liebe glauben zu können, fordert er drei Dinge von ihr, die sie alle vollbringt. Überdies ergötzt sie sich in Anwesenheit des Nikostratus mit ihm und macht diesem weis, es sei nicht wahr, was er mit eigenen Augen gesehen.
Zehnte Geschichte
Zwei Sieneser lieben eine Frau, die des einen Gevatterin ist. Der Gevatter stirbt, erscheint, seinem Versprechen gemäß, dem Gefährten und berichtet ihm, wie es dort im Jenseits zugeht.
Achter Tag
Erste Geschichte
Wolfhart leiht von Gasparruolo Geld und wird mit dessen Frau einig, für die gleiche Summe bei ihr zu schlafen. Er gibt es ihr und sagt in ihrer Gegenwart zu Gasparruolo, daß er ihr's gegeben hat, und sie muß einräumen, daß es wahr ist.
Zweite Geschichte
Der Pfarrer von Varlungo schläft bei Frau Belcolore und läßt ihr zum Pfand seinen Mantel zurück. Dann borgt er einen Mörser von ihr, schickt diesen zurück und fordert seinen verpfändeten Mantel wieder, den die gute Frau mit spitzigen Worten zurückgibt.
Dritte Geschichte
Calandrino, Bruno und Buffalmacco suchen im Flußbett des Mugnone nach dem Wunderstein Heliotrop, und Calandrino glaubt ihn gefunden zu haben. Mit Steinen beladen kehrt er nach Hause zurück. Die Frau schilt ihn aus. Erzürnt prügelt er sie und erzählt seinen Gefährten, was diese besser wissen als er.
Vierte Geschichte
Der Propst von Fiesole liebt eine Witwe, von der er nicht wiedergeliebt wird. Während er bei ihr zu schlafen glaubt, beschläft er ihre Magd, mit der ihn die Brüder der Frau von seinem Bischof ertappen lassen.
Fünfte Geschichte
Drei junge Leute ziehen einem Richter aus der Mark die Hosen herunter, während er in Florenz auf der Gerichtsbank sitzt und Recht spricht.
Sechste Geschichte
Bruno und Buffalmacco entwenden Calandrino ein Schwein und lassen ihn daraufhin den Versuch machen, es durch Ingwerkuchen und Vernacciawein wiederzuentdecken. Ihm aber geben sie hintereinander zwei mit Aloe angemachte Hundekuchen, die er des bitteren Geschmacks wegen ausspuckt, so daß es scheint, als habe er selbst das Schwein gestohlen. Danach lassen sie ihn sich auch noch loskaufen, da er nicht will, daß seine Frau von der Geschichte erfährt.
Siebente Geschichte
Ein Gelehrter liebt eine Witwe, die in einen andern verliebt ist und ihn eine Winternacht hindurch im Schnee stehen und ihrer warten läßt. Dafür gibt er ihr einen Rat, der zur Folge hat, daß sie mitten im Juli einen ganzen Tag nackt auf einem Turme zubringen muß, den Fliegen, den Wespen und der Sonnenglut ausgesetzt.
Achte Geschichte
Zwei Freunde verkehren miteinander. Der eine schläft bei der Frau des anderen; dieser merkt es und nötigt seine Frau, ersteren in eine große Truhe zu sperren, auf der er nun, während jener darin ist, mit dessen Frau sein Spiel treibt.
Neunte Geschichte
Meister Simon, der Arzt, wird von Bruno und Buffalmacco, welche ihn in eine Gesellschaft, die kursieren geht, aufzunehmen versprochen, nachts an einen Ort geschickt, von Buffalmacco in eine Dunggrube gestoßen und darin gelassen.
Zehnte Geschichte
Eine Sizilianerin nimmt einem Kaufmann alles, was er nach Palermo gebracht hat, mit meisterhafter Geschicklichkeit ab; dieser stellt sich darauf, als sei er noch mit viel größeren Warenvorräten als zuvor nach Palermo zurückgekehrt, nimmt ihr das Geld durch Borg wieder ab und läßt ihr nichts als Wasser und Werg.
Neunter Tag
Erste Geschichte
Madonna Francesca wird von Rinuccio und von Alessandro geliebt. Da sie keinen von beiden wiederliebt, schafft sie sich beide klüglich vom Halse, indem sie dem einen aufträgt, als Toter in ein Grab zu steigen, dem andern aber, jenen als einen Toten daraus hervorzuholen, was beide nicht zustande bringen.
Zweite Geschichte
Eine Äbtissin steht eilig im Finstern auf, um eine ihrer Nonnen, die bei ihr verklagt worden ist, mit ihrem Liebhaber im Bett zu überraschen. Da sie aber selbst einen Priester bei sich hat, nimmt sie statt des Schleiers dessen Hosen um. Als die Angeklagte diese erblickt und die Äbtissin darauf aufmerksam macht, wird sie freigelassen und darf ungestört mit ihrem Geliebten verweilen.
Dritte Geschichte
Auf Anstiften Brunos, Buffalmaccos und Nellos macht Meister Simon dem Calandrino weis, er sei schwanger. Dieser gibt den Genannten zu seiner Heilung Kapaune und Geld, worauf er ohne Entbindung wieder genest.
Vierte Geschichte
Cecco di Messer Fortarrigo verspielt zu Buonconvento alles, was er hat, und das Geld des Cecco di Messer Angiulieri dazu. Dann läuft er diesem im Hemde nach, läßt ihn unter dem Vorwand, daß jener ihn beraubt habe, von Bauern ergreifen, zieht dessen Kleider an, besteigt sein Pferd und eilt davon, während Angiulieri im Hemd zurückbleibt.
Fünfte Geschichte
Calandrino verliebt sich in ein junges Mädchen, und Bruno macht ihm ein Amulett, mit dem er sie berührt, worauf sie mit ihm abseits geht. Hier aber von seiner Frau überrascht, kommt er in schlimme Händel.
Sechste Geschichte
Zwei junge Männer herbergen bei einem Wirt. Der eine schleicht sich zu dessen Tochter, während die Wirtsfrau sich aus Versehen zu dem anderen legt. Darauf steigt der, welcher bei der Tochter war, zum Vater ins Bett und erzählt ihm alles, in dem Glauben, er erzähle es dem Freunde. Darüber entsteht Lärm, die Frau merkt ihren Irrtum, schleicht zur Tochter ins Bett und beschwichtigt hier alles mit geschickter Rede.
Siebente Geschichte
Talano di Molese träumt, daß ein Wolf die Kehle und das Gesicht seiner Frau zerfleische, und rät ihr, sich in acht zu nehmen. Sie tut es nicht, und das Geträumte widerfährt ihr.
Achte Geschichte
Biondello führt den Ciacco mit einer Mahlzeit an, wofür sich Ciacco listig rächt, indem er ihn tüchtig durchbleuen läßt.
Neunte Geschichte
Zwei junge Männer fragen Salomo um Rat, der eine, wie er geliebt werden, der andere, wie er seine widerspenstige Frau bessern könne. Dem ersten antwortet er, er solle lieben, dem zweiten, er solle zur Gänsebrücke gehen.
Zehnte Geschichte
Don Gianni stellt auf Gevatter Pietros Bitten eine Beschwörung an, um dessen Frau in eine Stute zu verwandeln. Als er aber daran geht, ihr den Schwanz anzusetzen, verdirbt Pietro den ganzen Zauber, indem er erklärt, er wolle keinen Schwanz haben.
Zehnter Tag
Erste Geschichte
Ein Ritter hat dem König von Spanien gedient und glaubt, dafür schlecht belohnt worden zu sein, weshalb der König ihm durch eine sichere Probe beweist, daß dies nicht seine, sondern seines widrigen Geschickes Schuld ist, und ihn hierauf reichlich beschenkt.
Zweite Geschichte
Ghino di Tacco nimmt den Abt von Clugny gefangen, heilt ihn von seinem Magenübel und läßt ihn dann frei. Dieser kehrt an den römischen Hof zurück, versöhnt jenen mit Papst Bonifaz und macht ihn zum Hospitaliterritter.
Dritte Geschichte
Mithridanes, neidisch auf die Freigebigkeit des Nathan, bricht auf, um ihn zu töten, und begegnet ihm, ohne ihn zu kennen. Von ihm selbst über die Mittel unterrichtet, findet er ihn, wie ihm gesagt war, in einem Haine. Er erkennt ihn tief beschämt und wird sein Freund.
Vierte Geschichte
Herr Gentile da Carisendi rettet, von Modena kommend, eine Dame, die er liebte und die man als tot beigesetzt hatte, aus der Gruft. Ins Leben zurückgerufen, genest sie eines Sohnes, und Herr Gentile gibt sie und ihr Kind dem Niccoluccio Caccianimico, ihrem Gemahl, wieder zurück.
Fünfte Geschichte
Madonna Dianora fordert von Herrn Ansaldo im Januar einen Garten so schön wie im Mai. Herr Ansaldo verpflichtet sich einen Schwarzkünstler und verschafft ihn ihr. Ihr Gatte erlaubt ihr, Herrn Ansaldo zu Willen zu sein. Dieser entbindet sie ihres Versprechens, als er die Großmut ihres Mannes erfährt, und der Schwarzkünstler verläßt Herrn Ansaldo, ohne etwas von ihm annehmen zu wollen.
Sechste Geschichte
Der siegreiche König Karl der Ältere verliebt sich in eine Jungfrau, schämt sich aber dann seines törichten Gedankens und vermählt sie und ihre Schwester auf ehrenvolle Art.
Siebente Geschichte
König Peter von Aragonien hört von der glühenden Liebe, welche die kranke Lisa für ihn hegt. Er spricht ihr freundlich zu, vermählt sie dann mit einem edlen Jüngling, küßt sie auf die Stirn und nennt sich fortan ihren Ritter.
Achte Geschichte
Sophronia, welche die Frau des Gisippus zu sein glaubt, ist die Gattin des Titus Quinctius Fulvus und geht mit ihm nach Rom. Hier trifft Gisippus in ärmlichem Zustande ein, und da er sich von Titus verachtet glaubt, klagt er, um zu sterben, sich selbst an, einen Menschen getötet zu haben. Titus erkennt ihn wieder und gibt nun, um ihn zu retten, vor, er sei es, der jenen getötet, worauf der wirkliche Mörder sich selbst angibt. Danach werden alle von Octavian in Freiheit gesetzt. Titus gibt dem Gisippus seine Schwester zur Gattin und teilt sein gesamtes Besitztum mit ihm.
Neunte Geschichte
Saladin wird, als Kaufmann verkleidet, von Herrn Torello geehrt und bewirtet. Der Kreuzzug erfolgt. Herr Torello, der seiner Gattin eine Frist gesetzt hat, nach der sie sich wieder vermählen möge, wird gefangen und dadurch, daß er Falken abrichtet, dem Sultan bekannt. Dieser erkennt ihn wieder, gibt sich ihm zu erkennen und ehrt ihn hoch. Herr Torello wird hierauf krank und durch magische Kunst in einer Nacht nach Pavia versetzt. Hier wird er bei der Hochzeit, die seine Gattin eben feiert, von ihr erkannt und kehrt mit ihr in sein Haus zurück.
Zehnte Geschichte
Der Markgraf von Saluzzo wird durch die Bitten seiner Leute genötigt, eine Frau zu nehmen. Um sie aber nach seinem Sinne zu haben, wählt er die Tochter eines Bauern und zeugt mit ihr zwei Kinder. Er macht sie glauben, daß er diese getötet habe, und sagt ihr dann, er sei ihrer überdrüssig und habe eine andere geheiratet. Zum Schein läßt er seine eigene Tochter nach Hause zurückkehren, als wäre diese seine Gemahlin, und verjagt jene im bloßen Hemde. Da er sie bei dem allem geduldig findet, nimmt er sie zärtlicher denn je wieder in sein Haus, zeigt ihr ihre erwachsenen Kinder, ehrt sie und läßt sie als Markgräfin ehren.
Eine kleine Bitte
Buchtipps für dich
Kostenlose eBooks
A p e B o o k C l a s s i c s
N e w s l e t t e r
F l a t r a t e
F o l l o w
A p e C l u b
Links
Zu guter Letzt
Giovanni Boccaccio
* 1313 in Florenz oder Certaldo
† 21. Dezember 1375 in Certaldo bei Florenz
Boccaccio (spr. -kattscho), Giovanni, einer der größten ital. Dichter und hochverdienter Humanist, geb. 1313 in Paris, gest. 21. Dez. 1375 in Certaldo bei Florenz, war der natürliche Sohn des Florentiner Kaufmanns Boccaccio di Chellino, der aus Certaldo stammte, weshalb B. seinem Namen stets da Certaldo hinzufügte, und einer jungen, vornehmen Pariser Witwe mit Vornamen Gianna (Jeanne). Zum Kaufmann bestimmt, widmete er sich 6 Jahre lang mit Widerwillen diesem Beruf, während ihn seine Neigung zu den Wissenschaften und der Dichtkunst zog. Etwa Ende 1330 siedelte er nach Neapel über. Sein Widerwille gegen den Kaufmannsstand wuchs in der prächtigen Umgebung noch mehr, und endlich gestattete ihm sein Vater, einen andern, freilich nicht den ersehnten, Beruf zu ergreifen. Er sollte kanonisches Recht studieren, »um dadurch später reich zu werden« (1332). Sechsjähriges Studium blieb erfolglos. Mit aller Macht zog es B. zur Dichtkunst und zum Studium der klassischen Literatur. Dichter und Gelehrte am Hofe, dessen Gesellschaftskreise ihm durch seinen Landsmann Niccolò Acciajuoli zugänglich gemacht wurden, waren sein liebster Umgang. Zu seinen ersten Werken, die italienisch geschrieben sind, begeisterte ihn die Liebe zu der natürlichen Tochter König Roberts von Neapel, Maria (»Fiammetta«). B. hat ihr viele lyrische Gedichte gewidmet, und in einer Reihe von Romanen und Erzählungen in Prosa und Versen hat er die Geschichte seines Werbens, seines Glückes und seiner Verschmähung in die Darstellung eingefügt. 1340 oder 1341 rief ihn der Vater nach Florenz zurück, 1346 war er in Ravenna, 1348 in Forlì. Als sein Vater 1348 oder 1349 an der Pest gestorben war, kehrte B. nach Florenz zurück. Er war nun freier Herr und konnte sich mit seinen bescheidenen Mitteln das Leben nach Wunsch gestalten. Als Dichter besaß er schon großen Ruf, und seine Mitbürger übertrugen ihm nun auch manche wichtige politische Ämter. Die 1350 mit Petrarca geschlossene Freundschaft bewirkte, daß er sich fast ausschließlich humanistischen Studien zuwandte und weckte in ihm wahre Gläubigkeit. B. besuchte Petrarca wiederholt auf längere Zeit (1359, 1363, 1368). 1359 gelang es B., den Griechen Leontius Pilatus als Professor nach Florenz zu ziehen. So war er der erste, der für eine Neubelebung der Kenntnis des Griechischen sorgte. Er selbst brachte es freilich nicht mehr weit in dieser Sprache. 1362 siedelte B. auf dringen des Bitten des Großseneschalls Niccolò Acciajuoli nach Neapel über, kehrte aber schon 1363 nach Florenz zurück, weil der Empfang den Erwartungen Boccaccios nicht entsprochen hatte. In Florenz blieb er nun mit kurzen Unterbrechungen bis an sein Lebensende, oft auf seinem Gütchen in Certaldo weilend, oft auch noch mit politischen Missionen betraut, so 1365 an Urban V. nach Avignon und 1367 an denselben nach Rom. 1370 bis 1371 war B. noch einmal in Neapel. Mit dem zunehmenden Alter befielen ihn allerlei Krankheiten. Dennoch übernahm er noch 1373 den ebrenvollen Auftrag der Florentiner Regierung, öffentliche Vorlesungen über Dantes »Divina Commedia« zu halten, die[105] er im Oktober d. J. begann. Schon im Januar 1374 zwang ihn jedoch sein Gesundheitszustand, das Lehramt aufzugeben, und im Herbst zog er sich ganz nach Certaldo zurück. Im Juni 1879 wurde ihm hier auf der Piazza Solferino ein Denkmal errichtet.
Boccaccios überaus zahlreiche Werke sind teils in italienischer, teils in lateinischer Sprache geschrieben. Leidenschaftliche Liebe brachte sein Dichtertalent zur Entfaltung. Im Auftrag Marias schrieb B. sein erstes Werk, den dicken Roman »Filocolo« (1338–1340, zuerst gedruckt Vened. 1472), eine weitschweifige und schwülstige Bearbeitung der Sage von Flor und Blancheflor. Wahrscheinlich noch 1338 vollendete er den »Filostrato« in Ottaven (Vened. 1480), die B. zuerst in der Kunstdichtung verwendete. Das prächtige Gedicht hat Chaucer in »Troylus and Cryseyde« oft wörtlich übersetzt, und darauf beruht Shakespeares »Troilus and Cressida«. Nicht so schön ist die ebenfalls in Ottaven gedichtete »Teseide« (1341, gedruckt Ferrara 1475), welche die Liebe des Palemone und Arena zu des Theseus Schwägerin Emilia behandelt und von Chaucer für seine »Knightes Tale« verwertet wurde. B. vollendetstes Gedicht in Ottaven ist das idyllische »Ninfale Fiesolano« (Vened. 1477), wohl der Abschluß seiner Jugendwerke. Wohl schon früher ist das »Ninfale d'Ameto« (1341–42), in Prosa und Terzinen verfaßt (Rom 1478), eine Hirtendichtung in Verbindung mit Allegorie. Ebenfalls verherrlicht noch die Maria die allegorische »Amorosa Visione« (etwa 1342, gedruckt Mail. 1521) in 50 Gesängen in Terzinen. Dem Trennungsschmerz gibt die »Fiammetta« (1342, gedruckt Padua 1472) Ausdruck, ein Liebesroman von feinster psychologischer Durchführung und hinreißendem Zauber der Sprache. Alle Phasen der Liebe zu Maria spiegeln endlich auch noch die lyrischen Gedichte wider (Livorno 1802). Eine kulturhistorisch wertvolle, aber oft unflätige Satire in Prosa auf eine Florentiner Witwe, die sich B. versagte, ist der »Corbaccio« oder »Labirinto d'amore« (zuerst Flor. 1487). Boccaccios Dantebegeisterung entsprang die Lobschrift (zwischen 1357 u. 1362) »Vita di Dante« (hrsg. von Macri-Leone, Flor. 1888; der erste Entwurf von Rostagno, Bologna 1899) und seinen Vorlesungen der wertvolle »Commento sopra la Commedia« (beste Ausg. von Milanesi, Flor. 1863, 2 Bde.), der leider nur bis zum 17. Gesang der Hölle reicht. Das Werk jedoch, dem der Dichter B. seinen Nachruhm zumeist verdankt, ist das »Decamerone«, das man treffend die »Menschliche Komödie« genannt hat und das durch die Schönheit der Sprache und den Stil der Erzählung ein fast unerreichtes Muster seiner Gattung geworden ist. Das »Decamerone« ist eine Sammlung von 100 durch eine Rahmenerzählung miteinander verbundenen Novellen, die der Dichter von zehn während der Pest 1348 aus Florenz entflohenen Personen, sieben Damen und drei Jünglingen aus der seinen Gesellschaft, zu ihrer Unterhaltung an zehn Tagen (daher der nach dem Griechischen gebildete Name) vortragen läßt. Die Erzählungen sind von der mannigfachsten Art; sie behandeln tragische und komische, wunderbare und rührende, witzige und schlüpfrige Stoffe und sind den mannigfachsten Quellen entnommen. Die Verschiedenheit der dem Leser vorgeführten Menschenklassen und Persönlichkeiten, ihre vortreffliche Charakteristik, die Mannigfaltigkeit der Vorgänge, der reizvolle Wechsel von Ernst und Scherz, die Anmut der Erzählungsweise, verbunden mit der Fülle und Gewandtheit der Sprache, haben das »Decamerone« zu einem der hervorragendsten Werke der italienischen Literatur gemacht. Die Unsittlichkeiten des Buches, die nie um ihrer selbst willen dargestellt werden, sondern um ihre Komik hervorzuheben, fallen der Sittenlosigkeit der Zeit des Dichters zur Last.
Das »Decamerone« ist unendlich oft gedruckt und wiederholt in alle gebildeten Sprachen übersetzt worden. Der vielleicht älteste sogen. Deo gratias-Druck erschien ohne Angabe des Jahres und des Ortes, der zweite Venedig 1471; außerdem brachte das 15. Jahrh. noch elf Ausgaben. Über die Ausgaben vgl. Bacchi della Lega, Serie delle edizioni delle opere di Giovanni B. (Bologna 1875), und Passano, I novellieri italiani in prosa (2. Ausg., Turin 1878). Bereits um 1460 wurde das »Decamerone« ins Deutsche von Arigo (s.d.) übertragen (hrsg. von Keller, Stuttg., Literarischer Verein, 1860); neuere deutsche Übersetzungen lieferten Soltau (Berl. 1803, 3 Bde.; neue Ausg., das. 1884) u. a., die besten K. Witte (3. Aufl., Leipz. 1859, 3 Bde.). Zu den Übersetzungen vgl. Bacchi della Lega a. a. O.; über die Quellen grundlegend Landau, Quellen des Dekameron (2. Aufl., Stuttg. 1884), und Bartoli, I precursori del B. e alcune delle sue fonti (Flor. 1876). Boccaccios »Opere volgari« gab Moutier heraus (Flor. 1827–34, 17 Bde.), eine Auswahl in deutscher Übersetzung W. Röder (»Boccaccios Romane und Novellen«, Stuttg. 1844, 4 Bde.). – In lateinischer Sprache schrieb B. verschiedene mythologische u. historische Werke, die »Genealogia deorum gentilium«, 15 Bücher; »De montibus, sylvis, fontibus, lacubus, fluminibus, stagnis etc.« (in alphabetischer Ordnung); »De casibus virorum illustrium«; »De claris mulieribus« (deutsche Übersetzung von Steinhöwel [s.d.], hrsg. von Drescher für den Literarischen Verein, Stuttg. 1896); außerdem 17 Eklogen, Briefe u. a. Vgl. Hortis, Studj sulle opere latine del B. (Triest 1879); Hecker, Boccaccio-Funde (Braunschw. 1901).
Biographische Literatur etc.: Landau, B., sein Leben und seine Werke (Stuttg. 1877; erweiterte ital. Übersetzung von Antona-Traversi, Neapel 1881); Körting, Boccaccios Leben und Werke (Leipz. 1880); Crescini, Contributo agli studj sul B. (Turin 1887); Wesselofsky, Boccaccio (Petersb. 1893–1894); Rossi, Dalla mente e dal cuore di Giovanni B. (Bologna 1900).
Aus : Meyers Großes Konversations-Lexikon, Band 3. Leipzig 1905, S. 104-105.
Il Decamerone (vom griechischen deka=zehn und hemera=Tag, also Zehntagebuch) erzählt bekanntlich, dass im Jahre 1348, als die Pest in Florenz schrecklich wütete, eines Dienstags sich in der Kirche di Santa Maria Novelli sieben junge, edelgeborene und befreundete Damen zwischen 18 und 28 Jahren durch einen Zufall trafen. Die älteste, Pampinea, macht den Vorschlag, gemeinsam die Stadt des Todes zu fliehen und sich auf ein Landgut zu begeben. Während sie noch beraten, finden sich drei junge Männer in der Kirche ein, von denen jeder in eins der Mädchen verliebt ist, und alle zehn begeben sich nun mit ihrer Dienerschaft nach einem zwei Meilen von Florenz gelegenen Schlösschen, wo sie fröhlich und geschwisterlich einige Zeit verbringen. An jedem Tag wird ein anderer der Gesellschaft zum König gewählt und hat für das Wohlbehagen und die Unterhaltung der übrigen zu sorgen. Pampinea als Königin des ersten Tages bestimmt, dass nachmittags Geschichten erzählt würden, und zwar sollte jeder der Zehn über den Stoff sprechen, der ihm am meisten zusagte. Am zweiten Tag, unter Philomenens Regierung, wird das Thema aufgegeben, von Leuten zu berichten, die nach verschiedenem Unheil am Ende doch an ein glückliches Ziel kommen. Am dritten Tag verlangt die Königin Neiphile Erzählungen des Inhalts, wie einer durch Scharfsinn ein ersehntes Ziel erreichte oder etwas verlorenes zurückgewann. Am vierten Tage wird unter Philostratus' Regierung von Liebe gesprochen, die unglücklich, am fünften unter der Königin Fiammetta von Liebe, die nach mancherlei Widerwärtigkeiten doch glücklich endete. Am sechsten Tage stellt Elise die Aufgabe, Beispiele beizubringen, wie leichtfertig Geneckte durch schnelle und witzige Antwort der Gefahr und dem Spott entgingen. Am siebenten Tage, unter König Dioneus, werden Streiche erzählt, welche Frauen ihren Männern, am achten, unter Laurettas Zepter, Streiche, die sich Eheleute oder anderen Personen gegenseitig spielten. Am neunten Tage erlaubt Königin Emilia jedem zu berichten, was ihm eben behagt, und am zehnten, unter Pamphilus' Regierung, muss jeder Beispiele von Edelmut und Hochsinnigkeit beibringen. Damit schließt dann das Buch "Il Decamerone, beigennant der Erz-Kuppler", so dass es also genau 100 Geschichten enthält.
Von diesen 100 Geschichten hat Boccaccio nur die allerwenigsten erfunden; die Stoffe der meisten stammen aus arabischen, indischen, persischen, altfranzösischen und sonstigen Quellen. Aber Boccaccio gab ihnen erst literarische Form, lokalisierte sie und erzählte sie mit einer Lebendigkeit, Anschaulichkeit und in einer Sprache, die das berühmte Muster italienischer Prosa ward. In Bau und Bildung der Perioden folgte er dabei dem bewunderten Vorbild der Alten, insbesondere Ciceros. Vielleicht hielt er sich zu sehr an dies große Muster:
Seine Perioden sind etwas weitläufig, aber in aller Fülle doch von schöner Klarheit, während bei seinen Nachahmern mehr und mehr das Künstliche dieses Stiles zum Vorschein kommt. Es wird bei Boccaccio selbst minder auffällig durch die große Frische des Wortes, das der Mund dese Volkes, die Gassen von Florenz ihm gaben. Am bekanntesten von den Geschichten des Decamerone ward durch Lessings Nathan den Weisen wohl jene von den drei Ringen, die als dritte Novelle des ersten Tages von Philomena erzählt wird. Weit berühmt ist auch jene von dem armen Adeligen, der seinen einzigen Falken opfert, um der Geliebten eine Mahlzeit vorsetzen zu können. Eine andere, die letzte Erzählung des ganzen Werkes, behandelt den Griselda-Stoff, der seitdem von Dichtern aller Länder und Zeiten, zuletzt (1909) von Gerhart Hauptmann, aufgenommen ward. Und wer hat noch nicht über den Bruder Zippolla gelacht, der den Gläubigen eine Feder des Engels Gabriel vorzeigen will und der sich so wundervoll herausredet, als er in seinem Kästchen statt der Feder ein paar Kohlen findet? Witziger noch ist der Koch, der seiner Geliebten eine Keule von dem gebratenen Kranich abschneidet, seinem Herrn erzählt, dass Kraniche nur eine Keule und ein Bein besitzen und zum Beweise dessen bei einem Spazierritt auf die Vögel, die nach ihrer Art auf einem Fuße stehen, hinweist. Der Herr aber schreit Ho! Ho!, dass die Kraniche erschreckt auch das andere Bein herunterlassen und entfliehen. «Nun, Spitzbube?» fragt er dann zornig. «Ja,» sagt der Koch, «hättet Ihr den von gestern abend auch so angeschrieen, hätte auch er die andere Keule noch herausgestreck!» Am witzigsten und gelungensten sind jedoch jene Schwänke, die ins sexuelle Gebiet abschweifen. Die derbe Komik, die darin regiert, ja, die nun einmal nicht wegzuleugnende Obszönität der Stoffe wird durch die Form etwas geadelt; Boccaccio ist niemals wählerisch in der Situation, im Thema, aber stets im Worte. Er selbst hat sich am Schlusse seines Werkes auf gute Art gegen den Vorwurf der Unsittlichkeit verteidigt, und wenn der saftigen Stücklein, wie sie besonders Dioneus erzählt, auch reichlich viel sind, so ist nicht nur das Schlimmste davon auf das Konto der Zeit zu setzen, sondern es bleibt auch bestehen, dass Boccaccios ganz auf das Konkrete gerichtete Natur, sein Mutwille, seine Grazie nirgends mehr triumphieren, als in diesen etas lasziven Novellen, so dass, wenn man sie entfernen wollte, ein großer Teil des Besten, was er geschrieben hat, verschwinden würde. Stärker noch als gegen die Obszönität einiger Stücke hat sich der Unwille vieler gegen den Hohn und Spott gerichtet, mit dem der Decamerone die Mönche und Nonnen, die hohe und niedere Geistlichkeit, das ganze versumpfte Priestertum des 14. Jahrhunderts überschüttet.
Dante donnert gegen das Papsttum; Boccaccio macht die Kleriker lächerlich. Alle pikanten Histörchen sind fast Geistlichen in die Schuhe geschoben. Kein Wunder, dass das Zehntagewerk auf den Index kam, dass Savonarola alle Exemplare, die er erlangen konnte, verbrannte. Es hat nichts genützt; der Decamerone hat die Jahrhunderte überlebt, und wie sich Millionen an ihm ergötzten, so haben Maler und Dichter - voran Shakespeare - immer wieder aus seinem Reichtum an mannigfaltigen Stoffen geschöpf.
Aus: "Geschichte der Weltiteratur" von Carl Busse
Der zyklische Aufbau des Werkes bezieht sich auf die Bedeutung der alten heiligen Zahl Zehn, die Bonaventura als numerus perfectissimus bezeichnet hatte, wobei vor allem Dantes Göttliche Komödie, die in hundert Gesänge gegliedert ist, als Vorbild diente.
Die Schilderung der Pest in Florenz ist beklemmend realistisch und detailreich dargestellt. Sie dient auch bis heute als historische Quelle über diese Epidemie. Man kann die Einleitung zweifellos als memento mori auffassen, das am Beginn der unbeschwert und daseinsfroh erzählten Novellen steht. Sie werden von den jungen Menschen in einer kultivierten Atmosphäre des Landhauses erzählt, das von üppigen Gärten umgeben ist, bei Spiel und Tanz. Da die Themen der Erzählungen variabel und zudem allgemein gehalten sind, entsteht eine große Vielfalt von fein oder derb, tragisch oder komisch erzählten Geschichten. In ihnen wird ein ganzes Welttheater ausgespannt, dessen handelnde Personen sowohl Sultane und Könige als auch Bauern, Handwerker oder Spitzbuben sind. Auch die Schauplätze umfassen nahezu die gesamte damals bekannte Welt. Das Besondere an Boccaccios Novellen ist ihr neuer Geist, der mit seinen aus Daseinsfreude und eigener Entscheidung handelnden Personen das Mittelalter überwindet. Kirchenleute und besonders Mönche kommen dabei meist besonders schlecht weg. Vor allem die Schilderung der Kleriker und zunächst weniger die Erotik mancher Novellen hat später zur Ablehnung Boccaccios durch die Kirche geführt.
Da Boccaccio selbst angibt, die Geschichten seien nicht von ihm erfunden, wurde intensiv nach den Quellen der einzelnen Erzählungen geforscht. Sie lassen sich auf die unterschiedlichsten Ursprünge und Überlieferungen zurückführen, wie auf antike Quellen, mittelalterliche, besonders französische Legenden- und Schwankliteratur oder ältere italienische Erzähltradition. Boccaccio erzählt aber nicht einfach nach, sondern er gestaltet seine Vorbilder vielfach um.
Das Landhaus, in dem Boccaccios Handlung angesiedelt ist, ist noch erhalten und befindet sich auf halbem Weg zwischen Florenz und Fiesole an der Via Boccaccio. Heute befindet sich dort ein Department des European University Institute.
Wirkungsgeschichte
Bereits die Grammatiker und Rhetoriker der Renaissance waren der Ansicht, dass Boccaccios Dekameron ein Meisterwerk sei. Der Autor wurde zusammen mit Dante und Francesco Petrarca zum Wegbereiter und Vorbild für die eigenen Bestrebungen. Heute gilt das Dekameron unbestritten als Ursprung der italienischen Prosa überhaupt und als ein Werk, das die Weltliteratur nachhaltig beeinflusst hat. So wurde die Novellensammlung unter anderen von Geoffrey Chaucer (Canterbury Tales), Margarete von Navarra (Heptaméron), Miguel de Cervantes (Novelas ejemplares), François Rabelais und zahlreichen, heute nicht mehr so bekannten Autoren nachgeahmt. Johann Wolfgang von Goethe schätzte das Werk sehr und deutschte den Namen Boccaccios in Boccaz ein. Die Romantiker würdigten ebenfalls die Novellensammlung besonders und wurden zu eigenen Werken angeregt, so zum Beispiel Honoré de Balzac mit seinen im späten Mittelalter spielenden Tolldreisten Geschichten. Stoffe einzelner Erzählungen benützten William Shakespeare (Cymbeline und Ende gut, alles gut), Hans Sachs und Jonathan Swift. Die Figur des Melchisedech liegt der Ringparabel in Gotthold Ephraim Lessings Drama Nathan der Weise zugrunde.
«Das Decamerone bleibt das einsame Meisterwerk, das als "comedia umana" neben der Divina Comedia steht, das erste große Prosawerk der italienischen Sprache, das treffend gezeichnete, noch heute gültige Bild der vielfältigen Lebensäußerungen und Verhaltensweisen des Menschen, ein historisch-literarischer Mahnstein seiner geistigen Entwicklungsgeschichte.»
Aus: Kindlers Literatur Lexikon
Erster Tag
Es beginnt der erste Tag des Dekameron, an dem nach einer Darlegung des Autors, warum die zusammenkamen, um einander Geschichten zu erzählen, unter Pampineas Herrschaft von dem gesprochen wird, was ein jeder am Liebsten hat.
ooft ich, holde Damen, in meinen Gedanken erwäge, wie mitleidig ihr alle von Natur aus seid, erkenne ich auch, daß eurer Meinung nach dies Werk einen betrübten und bitteren Anfang haben wird, da es an seiner Stirn die schmerzliche Erwähnung jener verderblichen Pestseuche trägt, die vor kurzem jeden, der sie sah oder sonst kennenlernte, in Trauer versetzte.
Doch wünsche ich, daß ihr euch nicht vom Weiterlesen in dem Glauben abschrecken lasset, ihr müßtet immer zwischen Seufzern und Tränen lesend weiterwandeln. Dieser schreckensreiche Anfang soll euch nicht anders sein wie den Wanderern ein steiler und rauher Berg, jenseits dessen eine schöne und anmutige Ebene liegt, die ihnen um so wohlgefälliger scheint, je größer die Anstrengung des Hinauf- und Hinabsteigens war. Und wie der Schmerz sich an das Übermaß der Lust anreiht, so wird auch das Elend von der hinzutretenden Freude beschlossen. Dieser kurzen Trauer – kurz nenne ich sie, weil sie in wenigen Zeilen enthalten ist – folgen alsbald die Lust und die Süßigkeit, die ich euch oben versprochen habe und die man nach einem solchen Anfang ohne ausdrückliche Versicherung vielleicht nicht erwartete. In der Tat, hätte ich füglich vermocht, euch auf einem anderen und minder rauhen Pfade als diesem dahin zu führen, wohin ich es wünsche, so hätte ich es gern getan. Weil aber ohne diese Erwähnung nicht berichtet werden konnte, warum das geschah, was weiterhin zu lesen ist, entschließe ich mich gewissermaßen notgedrungen zu dieser Beschreibung.
Ich sage also, daß seit der heilbringenden Menschwerdung des Gottessohnes eintausenddreihundertachtundvierzig Jahre vergangen waren, als in die herrliche Stadt Florenz, die vor allen andern in Italien schön ist, das tödliche Pestübel gelangte, welches – entweder durch Einwirkung der Himmelskörper entstanden oder im gerechten Zorn über unseren sündlichen Wandel von Gott als Strafe über den Menschen verhängt – einige Jahre früher in den Morgenlanden begonnen, dort eine unzählbare Menge von Menschen getötet hatte und dann, ohne anzuhalten, von Ort zu Ort sich verbreitend, jammerbringend nach dem Abendlande vorgedrungen war.
Gegen dieses Übel half keine Klugheit oder Vorkehrung, obgleich man es daran nicht fehlen und die Stadt durch eigens dazu ernannte Beamte von allem Unrat reinigen ließ, auch jedem Kranken den Eintritt verwehrte und manchen Ratschlag über die Bewahrung der Gesundheit erteilte. Ebensowenig nützten die demütigen Gebete, die von den Frommen nicht ein, sondern viele Male in feierlichen Bittgängen und auf andere Weise Gott vorgetragen wurden.
Etwa zu Frühlingsanfang des genannten Jahres begann die Krankheit schrecklich und erstaunlich ihre verheerenden Wirkungen zu zeigen. Dabei war aber nicht, wie im Orient, das Nasenbluten ein offenbares Zeichen unvermeidlichen Todes, sondern es kamen zu Anfang der Krankheit gleichermaßen bei Mann und Weib an den Leisten oder in den Achselhöhlen gewisse Geschwulste zum Vorschein, die manchmal so groß wie ein gewöhnlicher Apfel, manchmal wie ein Ei wurden, bei den einen sich in größerer, bei den andern in geringerer Anzahl zeigten und schlechtweg Pestbeulen genannt wurden. Später aber gewann die Krankheit eine neue Gestalt, und viele bekamen auf den Armen, den Lenden und allen übrigen Teilen des Körpers schwarze und bräunliche Flecke, die bei einigen groß und gering an Zahl, bei andern aber klein und dicht waren. Und so wie früher die Pestbeule ein sicheres Zeichen unvermeidlichen Todes gewesen und bei manchen noch war, so waren es nun diese Flecke für alle, bei denen sie sich zeigten.
Dabei schien es, als ob zur Heilung dieses Übels kein ärztlicher Rat und die Kraft keiner Arznei wirksam oder förderlich wäre. Sei es, daß die Art dieser Seuche es nicht zuließ oder daß die Unwissenheit der Ärzte (deren Zahl in dieser Zeit, außer den wissenschaftlich gebildeten, an Männern und Frauen, die nie die geringste ärztliche Unterweisung genossen hatten, übermäßig groß geworden war) den rechten Grund der Krankheit nicht zu erkennen und daher ihr auch kein wirksames Heilmittel entgegenzusetzen vermochte, genug, die wenigsten genasen, und fast alle starben innerhalb dreier Tage nach dem Erscheinen der beschriebenen Zeichen; der eine ein wenig früher, der andere etwas später, die meisten aber ohne alles Fieber oder sonstige Zufälle.
Die Seuche gewann um so größere Kraft, da sie durch den Verkehr von den Kranken auf die Gesunden überging, wie das Feuer trockene oder brennbare Stoffe ergreift, wenn sie ihm nahe gebracht werden. Ja, so weit erstreckte sich dies Übel, daß nicht allein der Umgang die Gesunden ansteckte und den Keim des gemeinsamen Todes in sie legte; schon die Berührung der Kleider oder anderer Dinge, die ein Kranker gebraucht oder angefaßt hatte, schien die Krankheit dem Berührenden mitzuteilen.
Unglaublich scheint, was ich jetzt zu sagen habe, und wenn es nicht die Augen vieler sowie die meinigen gesehen hätten, so würde ich mich nicht getrauen, es zu glauben, hätte ich es auch von glaubwürdigen Leuten gehört. Ich sage nämlich, daß die ansteckende Kraft dieser Seuche mit solcher Gewalt von einem auf den anderen übersprang, daß sie nicht allein vom Menschen dem Menschen mitgeteilt ward, sondern daß auch, was viel mehr sagen will, häufig und unverkennbar andere Geschöpfe außer dem Menschengeschlecht, wenn sie Dinge berührten, die einem an der Pest Leidenden oder an ihr Gestorbenen gehört hatten, von der Krankheit befallen wurden und an diesem Übel starben. Davon habe ich unter anderm eines Tages mit eigenen Augen, wie ich vorhin gesagt habe, folgendes Beispiel gesehen: man hatte die Lumpen eines armen Mannes, der an dieser Seuche gestorben war, auf die offene Straße geworfen, und dort fanden sie zwei Schweine, welche sie nach der Art dieser Tiere anfangs lange mit dem Rüssel durchwühlten, dann aber mit den Zähnen ergriffen und hin und her schüttelten; nach kurzer Zeit aber fielen sie beide, als hätten sie Gift gefressen, unter einigen Zuckungen tot auf die Lumpen hin, die sie zu ihrem Unheil erwischt hatten.
Aus diesen und vielen anderen ähnlichen und schlimmeren Ereignissen entstand ein allgemeiner Schrecken, und mancherlei Vorkehrungen wurden von denen getroffen, die noch am Leben waren. Fast alle strebten zu ein und demselben grausamen Ziele hin, die Kranken nämlich und was zu ihnen gehörte, zu vermeiden und zu fliehen, in der Hoffnung, sich auf solche Weise selbst zu retten. Einige waren der Meinung, ein mäßiges Leben, frei von jeder Üppigkeit, vermöge die Widerstandskraft besonders zu stärken. Diese taten sich in kleineren Kreisen zusammen und lebten, getrennt von den übrigen, abgesondert in ihren Häusern, wo sich kein Kranker befand, beieinander. Hier genossen sie die feinsten Speisen und die ausgewähltesten Weine mit großer Mäßigkeit und ergötzten sich, jede Ausschweifung vermeidend, mit Musik und anderen Vergnügungen, die ihnen zu Gebote standen, ohne sich dabei von jemand sprechen zu lassen oder sich um etwas, das außerhalb ihrer Wohnung vorging, um Krankheit oder Tod zu kümmern.
Andere aber waren der entgegengesetzten Meinung zugetan und versicherten, viel zu trinken, gut zu leben, mit Gesang und Scherz umherzugehen, in allen Dingen, soweit es sich tun ließe, seine Lust zu befriedigen und über jedes Ereignis zu lachen und zu spaßen, sei das sicherste Heilmittel für ein solches Übel. Diese verwirklichten denn auch ihre Reden nach Kräften. Bei Nacht wie bei Tag zogen sie bald in diese, bald in jene Schenke, tranken ohne Maß und Ziel und taten dies alles in fremden Häusern noch weit ärger, ohne dabei nach etwas anderem zu fragen als, ob dort zu finden sei, was ihnen zu Lust und Genuß dienen konnte. Dies wurde ihnen auch leicht gemacht, denn als wäre sein Tod gewiß, so hatte jeder sich und alles, was ihm gehörte, aufgegeben. Dadurch waren die meisten Häuser herrenlos geworden, und der Fremde bediente sich ihrer, wenn er sie zufällig betrat, ganz wie es der Eigentümer selbst getan hätte.
Wie sehr aber auch die, welche so dachten, ihrem viehischen Vorhaben nachgingen, so vermieden sie doch auf das sorgfältigste, den Kranken zu begegnen. In solchem Jammer und in solcher Betrübnis der Stadt war auch das ehrwürdige Ansehen der göttlichen und menschlichen Gesetze fast ganz gesunken und zerstört; denn ihre Diener und Vollstrecker waren gleich den übrigen Einwohnern alle krank oder tot oder hatten so wenig Gehilfen behalten, daß sie keine Amtshandlungen mehr vornehmen konnten. Darum konnte sich jeder erlauben, was er immer wollte.
Viele andere indes schlugen einen Mittelweg zwischen den beiden obengenannten ein und beschränkten sich weder im Gebrauch der Speisen so sehr wie die ersten, noch hielten sie im Trinken und in anderen Ausschweifungen so wenig Maß wie die zweiten. Vielmehr bedienten sie sich der Speise und des Tranks nach Lust und schlossen sich auch nicht ein, sondern gingen umher und hielten Blumen, duftende Kräuter oder sonstige Spezereien in den Händen und rochen häufig daran, überzeugt, es sei besonders heilsam, durch solchen Duft das Gehirn zu erquicken; denn die ganze Luft schien von den Ausdünstungen der toten Körper, von den Krankheiten und Arzneien stinkend und beklemmend.
Andere aber waren grausameren Sinnes – obgleich sie vermutlich sicherer gingen – und erklärten, kein Mittel gegen die Seuche sei so wirksam und zuverlässig wie die Flucht. In dieser Überzeugung verließen viele, Männer wie Frauen, ohne sich durch irgendeine Rücksicht halten zu lassen, allein auf die eigene Rettung bedacht, ihre Vaterstadt, ihre Wohnungen, ihre Verwandten und ihr Vermögen und flüchteten auf ihren eigenen oder gar einen fremden Landsitz; als ob der Zorn Gottes, der durch diese Seuche die Ruchlosigkeit der Menschen bestrafen wollte, sie nicht überall gleichmäßig erreichte, sondern nur diejenigen vernichtete, die sich innerhalb der Stadtmauern antreffen ließen, oder als ob niemand mehr in der Stadt verweilen solle und deren letzte Stunde gekommen sei.
Obgleich diese Leute mit den also verschiedenen Meinungen nicht alle starben, so kamen sie doch auch nicht alle davon, sondern viele von den Anhängern jeder Meinung erkrankten, wo immer sie sich befanden, und verschmachteten fast ganz verlassen, wie sie das Beispiel dazu, solange sie gesund gewesen waren, denen gegeben hatten, die gesund blieben. Wir wollen davon schweigen, daß ein Mitbürger den andern mied, daß der Nachbar fast nie den Nachbarn pflegte und die Verwandten einander selten oder nie besuchten; aber mit solchem Schrecken hatte dieses Elend die Brust der Männer wie der Frauen erfüllt, daß ein Bruder den andern im Stich ließ, der Oheim seinen Neffen, die Schwester den Bruder und oft die Frau den Mann, ja, was das schrecklichste ist und kaum glaublich scheint: Vater und Mutter weigerten sich, ihre Kinder zu besuchen und zu pflegen, als wären es nicht die ihrigen.
In dieser allgemeinen Entfremdung blieb den Männern und Frauen, die erkrankten – und ihre Zahl war unermeßlich –, keine Hilfe außer dem Mitleid der wenigen Freunde, die sie nicht verließen, oder dem Geiz der Wärter, die sich durch einen unverhältnismäßig hohen Lohn zu Dienstleistungen bewegen ließen. Aber auch der letzteren waren nicht viele zu finden, und die sich dazu hergaben, waren Männer oder Weiber von geringer Einsicht, die meist auch zu solchen Dienstleistungen gar kein Geschick hatten und kaum etwas anderes taten, als daß sie den Kranken dies oder jenes reichten, was sie gerade verlangten, oder zusahen, wenn sie starben. Dennoch gereichte ihnen oft ihr Gewinn bei solchem Dienste zum Verderben.
Weil die Kranken von ihren Nachbarn, Verwandten und Freunden verlassen wurden und nicht leicht Diener finden konnten, bürgerte sich ein Brauch ein, von dem man nie zuvor gehört hatte: daß nämlich Damen, wie vornehm, sittsam und schön sie auch waren, sich, wenn sie erkrankten, durchaus nicht scheuten, von Männern, mochten diese jung oder alt sein, bedient zu werden und vor ihnen, ganz als ob es Frauenzimmer wären, ohne alle Scham jeden Teil ihres Körpers zu entblößen, sobald die Bedürfnisse der Krankheit es erforderten. Vielleicht hat dieser Brauch bei manchen, die wieder genasen, in späterer Zeit einigen Mangel an Keuschheit veranlaßt. Überdies starben aber auch viele, die vermutlich am Leben geblieben wären, hätte man ihnen Hilfe gebracht.