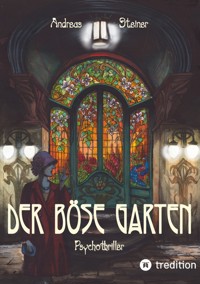Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Als der 13jährige Konrad sein älterer Bruder Ronald und deren kleine Schwester Ida im Jahre 1938 angesichts der Naziherrschaft und des drohenden Krieges nach England zu ihrem Großvater geschickt werden, finden sie sich wieder an einem geheimnisvollen Ort: Ein altes Herrenhaus mit einer langen Geschichte, das ein eigenes Gedächtnis zu haben scheint, und Wissen von Jahrhunderten beherbergt. Unter diesem Einfluss träumt sich Konrad in verschiedene Zeitalter, vom Mittelalter bis zur Jahrhundertwende. Zu allen Zeiten taucht Valnir auf, ein böses Wesen aus grauer Vorzeit, der mit einer Gefolgschaft aus Dämonen versucht, in Menschen Bösartigkeit, Hass und Missgunst zu erwecken, um dadurch seine unheilvolle Macht zu mehren. Doch es gibt zu auch immer jemanden in Konrads Alter, der in der Lage ist, Valnir zu bekämpfen, und zwar mit Hilfe einer alten, magischen Figur, die Lebensfreude und Leichtigkeit verkörpert, und die Krankheiten und Irrsinn heilen kann. In einem mystischen Steinkreis begegnet er der feenhaften Ceridwen, aber auch dem Mönch Martinus aus seinem Traum, und schließlich allen anderen, die die Fähigkeit haben, die magische Figur zu benutzen. Ob man Valnir endgültig vernichten kann, wenn es gelänge, sich leibhaftig in einer Zeit zu treffen? Unerwartete Hilfe kommt von Konrads Großvater, aber auch von dem angeblich verrückten Ivor, der mehr zu wissen scheint, als man ihm zutraut. Eine fesselnde, atmosphärische Reise in die Geschichte Englands, finsterer Horror, spannungsgeladene Geschehnisse und zugleich eine hintergründige psychologische Metapher über die Heilung von Angst und Verzweiflung, über Unbeugsamkeit und Eigenständigkeit, und die Kraft der Freundschaft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt:
Nach England
Steinerne Wächter
Martinus, der Novize
Enaids Tanz
Valnirs Fluch
Die Sachsen greifen an
Die Verwandlung
Klosterleben
Valnirs Rückkehr
Blackwell Manor
Engel und Teufel
Anne, die Apothekerin
Ratten im Hospital
Grays Kopf
Der Kurpfuscher
Der edle Ritter
Das Dunkel aus der Zeit
Ein Schatten, bleicher als weiß
James, der Totengräber
Ruß und Feuer
Das Ding in der Nische
Glück und Herrlichkeit
Das schwarze Tier
Das geheime Zimmer
Der Besucher
Novembernebel
Ceridwen, die Fee
Das Vermächtnis
Rascheln im Gemäuer
Gewitterstimmung
Tumult
Die Zusammenkunft
Valnirs Ende
Der Funke des Lichtes
In grauen Tagen, vor unendlich langer Zeit,
ist er gekommen, der Fürst der Nacht
und bracht’ den Schatten über das Land.
Niemand weiß, woher er kam, wohin er will und wen er sucht
und wessen Schicksal er bedroht.
Die Weisen sprechen, dass auch er
dereinst ein Kind war, voller Träume
singend, springend und voll Lachen.
Doch Schmerz, durch Knüppel, Fäuste, Peitsch und Schläge
von seines eignen Vaters Hand
ließen das Lied verklingen, das er einst sang.
So rammt’ er schließlich, hassgequält,
dem Peiniger das Schwert in den Leib,
zu beenden seine Qual
und zu beginnen seine Macht,
um Freude fortan zu empfinden,
das Dunkel in die Welt zu tragen.
Verflucht und ruhelos nun seitdem
zieht er in der Welt umher.
Seine Gefährten sind die Geschöpfe der Finsternis,
die Dämonen der Nacht, die Raben und die Wölfe.
Seine Kunde sind Pestilenz und Furcht.
Verderben bringt sein ferner Gruß,
Angst und Irrsinn sein Geruch,
und wen er anhaucht, ist geweiht dem Tod.
Altnordische Ballade, 9. Jh.Nachdichtung von Ivor Cox
1. Nach England
enn ich mich an das Haus meines Großvaters erinnere, denke ich vor allem an die vielen großen, schwarzen Vögel, die ständig um den Westturm kreisten. Ich war damals gerade 13 Jahre alt und habe immer versucht, diesen Anblick möglichst lässig und gleichgültig abzutun, als sei ich ein harter alter Krieger, dem so etwas nicht das Geringste ausmacht. Ich tat daher beim Betreten des Anwesens so uninteressiert wie möglich, um möglichst überlegen und erwachsen zu wirken. Aber in Wahrheit habe ich mich gefürchtet. Die Raben und Krähen machten mir Angst, denn sie erschienen mir wie Boten des Todes, und ich redete mir ein, dass Großvaters großes altes Haus sie anzog, als wohne etwas Böses, Verderbenbringendes darin.
Seit langem weiß ich, dass es nicht das Haus war. Es war vielmehr der schmerzvolle Abschied von meiner Mutter, die uns im Sommer 1938 von Deutschland in ihre englische Heimat schickte.
Wir, das waren außer mir mein älterer Bruder Ronald, damals sechzehnjährig und nebenbei der unerträglichste Klugscheißer, den man sich vorstellen kann, und meine kleine Schwester Ida, die mit ihren sechs Jahren noch gar nicht verstand, wie krank Mama damals war. Für Ida war die Reise zu unserem bislang unbekannten Großvater ein einziger großer Abenteuerurlaub. Ronald gab sich dagegen, als langweile ihn das Ganze, und hatte sich zu der Reise nach England lediglich herabgelassen, damit er auf uns aufpassen konnte. Er pflegte mich spöttisch »Kleiner« zu nennen, was mich jedes Mal zur Weißglut brachte und ich ihm am liebsten eine geklebt hätte. Das einzig Gute an meinem Ärger über ihn war, dass dies meine beständige Traurigkeit unterbrach, denn es schien mir so, als sei ich der Einzige von uns Dreien, der die Trennung von unserer Mutter überhaupt begriff und der deshalb regelmäßig mit den Tränen kämpfte.
Nachdem die Fähre von Calais abgelegt hatte, war es mir, als schnitte mir ein Messer ins Herz, und der salzige Geruch des Meeres machte mir schmerzvoll klar, wie weit weg von ihr wir bereits waren.
Ida hatte noch nie das Meer gesehen und kam aus dem Staunen nicht heraus. Ständig deutete ihr kleiner Zeigefinger auf zahlreiche Dinge, die sie spannend fand, von Luftschächten und Rettungsbooten auf der Fähre, den bunten Flaggen, die im Wind flatterten, bis zu Schiffstauen, Bojen und umhersegelnden, schreienden Möwen. Sie fragte mich dann mit ihren weit ihren aufgerissenen blauen Augen tausend Dinge, und ich hatte verdammt viel zu tun, mir Antworten dazu auszudenken, denn von den meisten Sachen hatte ich überhaupt keine Ahnung. Ida war die Temperamentvollste von uns, unserer Mutter sehr ähnlich. Gleichzeitig hatte sie grenzenloses Vertrauen in die Welt, denn bislang hatte sie nur gute Erfahrungen gemacht. Alle fanden sie entzückend, und da sie praktisch jeden anzustrahlen pflegte, erntete sie Wohlwollen, wo immer sie war. Wahrscheinlich schloss sie daraus, dass sie äußerst liebenswert sei, und damit hatte sie sogar Recht. Nur ich war immer derjenige, der sich Sorgen machte und an allem zweifelte – eine Regung, die meinem älteren Bruder völlig fremd war.
Ronald lehnte lässig an der Reling und rauchte mit betont blasiertem Blick eine Zigarette, die er zweifellos aus Vaters Schreibtisch gestohlen hatte. Mit seinem grauen Hut und dem zweireihigen Tweed-Jackett wirkte er tatsächlich so wie ein junger Geschäftsmann, zu dessen ganz normalen Alltag es gehört, den Ärmelkanal zu überqueren. Ich glaube, er war damals verliebt (was er nie zugegeben hätte) und es passte ihm vor allem deswegen nicht, fortzugehen. Ich meine sogar, mich vage zu erinnern, an wen: ein dunkelhaariges, schlankes Mädchen aus der Nachbarschaft, mit tiefen, braunen Augen, das einen ziemlich großen Busen hatte. Ich hielt es damals allerdings nicht für möglich, dass Ronald zu solch zarten romantischen Gefühlen wie der Liebe fähig wäre. Er tat nämlich immer so, als sei er der Casanova vom Dienst und habe bereits reihenweise erotische Erfahrungen, aber ich wette, in Wahrheit hatte er zu diesem Zeitpunkt noch nie ein Mädchen geküsst.
»Na, Kleiner«, sagte er zwischen zwei Zügen, »die englischen Ladies sollen ja nicht gerade das Gelbe vom Ei sein. Da stehen uns wohl traurige Zeiten bevor.«
Ich muss zugeben, auch ich stellte mir die Engländerinnen damals blass, blond, dürr und pickelig vor, dazu meistens mit Leichenbittermiene Tee trinkend und zum Frühstück fade Haferpampe zubereitend. Unsere Mutter sah ich damals wohl gar nicht als Engländerin. Sie war wunderschön: schlank, dunkle Locken, strahlende blaue Augen, genau wie Ida. Und kochen konnte meine Mutter … es war wie im Paradies! Sie schien immer von einer unbeugsamen Kraft. Sie jetzt so schwach und bleich in Erinnerung zu haben, war wie ein böser Traum.
In diesem Moment auf der Reling bemerkte ich erst, wie wenig wir von ihrer Heimat eigentlich wussten, obwohl wir mit ihr Englisch sprachen. Das einzige englische Buch, was ich je gelesen hatte, war Alice in Wonderland, und dies hatte mich dermaßen verstört, dass ich die Engländer seitdem für ein verschrobenes Völkchen hielt, das womöglich sogar ein bisschen verrückt war.
Ich wunderte mich sogar über das sonnige Wetter an diesem Tag, denn ich wähnte England stets von undurchsichtigen Nebelschwaden durchzogen. Daher erschien mir die Aussicht unerträglich, bei schlechtem Wetter in einem verstaubten alten Haus, in einem winzigen Dorf fern jeder Stadt eine unbestimmt lange Zeit verbringen zu müssen. Dass dort unser Großvater wohnte, tröstete mich wenig, denn der war bislang nur durch das regelmäßige Schicken von gelehrten alten Büchern zu unseren Geburtstagen in Erscheinung getreten.
Die Weißen Klippen von Dover tauchten auf, und ich hob Ida hoch, um sie ihr zu zeigen. Fast unwirklich wirkte das Weiß, und im goldenen Licht der Morgensonne erschienen sie uns wie ein verwunschenes Land. Als ich Idas strahlendes kleines Gesicht sah, spürte auch ich einen Schimmer von Spannung, was uns wohl erwarten würde.
Ich gestand es mir nur ungern ein, aber ich war verdammt froh, Ronald in meiner Nähe zu haben. Die Menschenmassen auf der Fähre, die Ankunft in Dover, die Zollkontrollen, das Warten auf den richtigen Zug – mit ihm fühlte ich mich erheblich sicherer, als dass ich mir all dies allein zugetraut hätte.
Dann erreichten wir London. Als wir den Bahnhof betraten, war ich schier überwältigt. Er war groß, erschreckend groß, voller Lärm, Gestank, Prunk und Gedränge – ein wirrer Traum aus Stein und Gold. Menschen allen Alters und Standes schoben sich durch die Gänge und Hallen: vornehme Damen, würdige Herren, zerlumpte Gestalten, dienstfertige Gepäckträger. Wir tauchten ein in ein Meer von Gesichtern und Stimmen, in den Geruch von Parfüm, Schweiß, Zigarren, Puder, verbrannter Kohle und dem Dampf der Lokomotiven, die wie riesenhafte stählerne Echsen die Schienen entlangkrochen. Unter den ehrwürdigen, von mächtigen Säulen getragenen Balustraden mischte sich die Musik einer Blaskapelle unter das Stöhnen und Fauchen der gewaltigen Maschinen, und während wir uns durch die Menge quetschten, drangen Fetzen einer Drehorgel an mein Ohr, die »It’s a long way to Tipperary« spielte. Zwischendurch tönten die Trillerpfeife eines Zugschaffners oder ein lauter Ruf, die Fahrgäste mögen nun einsteigen. Überall war der Glanz der königlichen Stadt zu spüren. Laternen tauchten die prachtvollen Gewölbe und Stahlkonstruktionen in gleißendes Licht. Es gab Läden, Zeitungskioske, Bars und Cafés, Restaurants und Erfrischungsstände. Rolltreppen fuhren in unterirdische Gänge von unergründlicher Tiefe, die U-Bahn-Schächte verschlangen Menschen und spuckten sie an anderer Stelle wieder aus. Auf den Bänken saßen zahllose Reisende, die auf ihre Züge warteten, und es bildeten sich lange Schlangen vor den Fahrkartenschaltern. Mit einem leisen Triumph bemerkte ich, dass auch Ronald hinter seiner überlegenen Miene nervös und angespannt war, aber allein um dies nicht zugeben zu müssen, gab er sich betont forsch und zielgerichtet. Es gelang ihm auch tatsächlich, die richtigen Fahrkarten für uns zu kaufen, und er tat nach diesem grandiosen Coup natürlich so, als habe er nie in seinem Leben etwas anderes gemacht. Bis wir uns endlich in unser Zugabteil hineingedrängt hatten, hatte ich bereits tausend Ängste durchgestanden. Vor allem befürchtete ich, Idas kleine Hand könnte sich der meinen entwinden und ich würde sie verlieren.
Im Zugabteil hatte Ronald schnell seine übliche Blasiertheit wiedergefunden. Er lümmelte sich auf die Sitzbank und kramte in seiner Jackentasche.
»Na, mein Kleiner«, sagte er, während er sich mit affektiert abgespreiztem kleinem Finger eine Zigarette anzündete, »das hätten wir fürs Erste. Jetzt brauchen wir uns nur noch in Opas Kaff kutschieren zu lassen, und dann ist unser Glück perfekt.« Dabei rollte er die Augen, als ginge es direkt ins Gefängnis.
»Es ist Kindern untersagt, zu rauchen«, ertönte plötzlich eine Stimme. Der Schaffner, dem sie gehörte, wirkte keineswegs unfreundlich, aber sehr bestimmt. Ich jedenfalls hätte ihn umarmen können dafür. Selten hatte ich gesehen, wie Ronald einen derart roten Kopf bekam und sich eilte, die Zigarette auszudrücken. Ich fürchtete nur sogleich, dies würde üble Folgen haben. Ronalds giftiger Blick in mein grinsendes Gesicht verhieß nichts Gutes.
Wir sprachen alle drei recht gut Englisch – unsere Eltern hatten uns zweisprachig aufgezogen. Und dennoch war hier alles so anders, denn zu Hause redeten wir nur mit unserer Mutter so. Hier aber unterhielten sich alle um uns herum völlig selbstverständlich in Mamas Muttersprache – wie unwirklich! Ja, wir waren nun tatsächlich in einem anderen Land. Ida schien es am wenigsten zu beschäftigen, denn sie war bald eingeschlafen. Ronald sah die ganze Zeit verbissen aus dem Fenster, während ich in einer komischen Mischung aus Anspannung und Müdigkeit vor mich hindöste.
Nachdem wir erst in Swindon, dann in Gloucester nochmals umgestiegen waren und in einem kleinen Bummelzug Platz gefunden hatten, nickte auch ich kurz ein.
Ich hatte einen üblen Albtraum. Eine riesenhafte Armee von schwarzuniformierten SS-Leuten marschierte unter schauerlichen Gesängen durch eine Stadt voll riesenhafter grauer, düsterer Gebäude. Noch im Traum erinnerte ich mich, wie sie in unserer Heimatstadt nun tatsächlich auf den Straßen zu sehen waren, erst vereinzelt, dann immer mehr und überall, wie Parasiten, die sich ausbreiteten. Ich hatte schon beim ersten Anblick damals Angst vor ihnen, da die Männer alle zu einer bedrohlichen Masse verschmolzen, als hätten sie sich aufgelöst und ihre Seele sei irgendwo anders hingegangen. Ich weiß noch, wie der Sohn unseres Nachbarn vor erst einem Jahr in schwarzer SS-Uniform nach Hause kam, eigenartig fremd; der lustige Kerl von früher war plötzlich so wahnsinnig ernst, starr, wie versteinert; selbst seine Stimme wirkte mit einem Mal kalt und mechanisch. Damals dachte ich, er sei irgendwie krank und es hätte etwas mit dieser Uniform zu tun.
Im Traum kauerte ich zusammen mit Ida angstvoll auf einer uralten zinnenbewehrten Steinbrücke und beobachtete, voller Angst, entdeckt zu werden, die schwarze Armee von dem erhöhten Punkt aus, während sie darunter hermarschierte. Der Anführer auf seinem Pferd sah plötzlich direkt zu mir und heftete seine tiefliegenden Augen auf mich. Sie stachen aus seinem totenblassen Gesicht wie glühende Kohlen hervor – ein eigenartiges Gesicht mit hoher Stirn, dichten schwarzen Augenbrauen, einem mächtigen Kinn und einem auffallend kleinen Mund mit dünnen, bläulichen Lippen. Sein Blick bohrte sich geradezu in mich hinein. Dann lächelte er höhnisch. In diesem Augenblick wusste ich, dass wir verloren waren. Ich packte Ida und rannte mit ihr von der Brücke auf ein großes Tor zu, das in ein finsteres Treppenhaus führte, und vermeinte bereits, das Trappeln der Schritte unserer Verfolger zu hören.
Ein äußerst schmerzhafter Stoß von Ronalds Faust gegen meinen Arm machte mich schlagartig wach. Ob Ronald mein schweres, angstvolles Atmen bemerkt hatte? Jedenfalls erlöste sein Hieb mich schlagartig. Vermutlich ahnte er nicht, dass er mir damit ausnahmsweise etwas Gutes tat.
Wir näherten uns offenbar unserem Ziel, immer nach Westen, dem Sonnenuntergang entgegen. Die Sonne war bereits hinter dem Horizont versunken; noch strahlte der Himmel dort golden, aber überall verbreitete sich bereits das Zwielicht. Die Bäume, die an den Zugfenstern vorbeirauschten, erschienen bereits als schwarze Silhouetten, und die Hügelketten hatten schon jenes dunstige Blau der Abenddämmerung. Ich bemühte mich, Ida sanft zu wecken. Wir griffen nach unseren Jacken und Koffern, drängelten uns auf den Gang und spürten, wie der Zug sein Tempo drosselte und schließlich quietschend in dem kleinen Bahnhof zu stehen kam.
Obwohl es beginnender Sommer war, war es kalt und feucht auf dem abendlichen Bahnsteig. Ronald machte ein Gesicht wie pures Sauerkraut, denn er hatte sich für den Sommer vermutlich romantische Techtelmechtel mit der vollbusigen Dunkelhaarigen vorgestellt. Hier dagegen begann sogar Nebel aufzusteigen. Der Bahnhof wirkte wie seit Jahrhunderten nur noch von Geistern bewohnt, menschenleer und im Inneren lediglich von einer trüben Gaslaterne beleuchtet. Ich packte Ida bei der Hand und wir schoben uns durch die Flügeltüren in den Innenraum des Bahnhofsgebäudes.
Dort stand ein riesenhafter Kerl. Er war bestimmt fast zwei Meter groß und einen Meter breit, trug Stiefel groß wie Regentonnen, eine Strickjacke, mit der man ein ganzes Bett hätte bedecken können, und einen breiten Gürtel, der wie für einen Ochsen gemacht schien. Sein Kopf war von einer Schiebermütze bedeckt und das runde Gesicht mit der überdimensionalen Nase darunter schaute wie von kindlicher Neugier erfüllt auf uns. In der einen Hand hielt er ein Windlicht, in der anderen ein Schild, auf dem mit Kreide der Name »ADLER« geschrieben stand – unser Name.
Sofort ging er auf uns zu und lächelte. »Now then!«, sagte er mit einer unerwartet hohen, brüchigen Stimme. »Ihr seid bestimmt die strangers! Ich bin Walter, ich arbeite für Herrn Neville Brooks!« Ich hatte große Schwierigkeiten, ihn zu verstehen, denn er sprach einen starken Dialekt - Yorkshire, wie ich später erfuhr. Nur der Name unseres Großvaters war eindeutig. Er griff sofort nach unseren Koffern, die in seinen Pranken wirkten wie ein paar leere Pappschachteln, und durchschritt die Ausgangstür. Dort stand ein Fuhrwerk mit zwei Pferden, eine Art Kutsche mit Ladefläche, auf die er mit leichter Hand unser Gepäck legte und es gleich mit einer Plane bedeckte.
»Wie … sie haben kein Auto?«, fragte Ronald entgeistert und deutete ungläubig auf das Gefährt.
»Aye«, antwortete Walter, »Mr Brooks ist sehr traditionell veranlagt und öffnet sich neuen Dingen nur sehr zögerlich.« Er packte Ida wie eine Feder und hob sie auf den Ledersitz. Sie schien nicht die geringste Furcht vor ihm zu empfinden und lachte vor Vergnügen. Nachdem wir alle Platz genommen hatten, pflanzte er sich auf den Kutschbock, wobei der ganze Wagen schwankte und ächzte, als werde er von einem Elefanten betreten, schnalzte mit der Zunge und wir fuhren los.
Ida strahlte. Sie liebte Pferde, und die unerwartete Fahrt mit der Kutsche war für sie ähnlich abenteuerlich, wie es für mich eine Achterbahnfahrt gewesen wäre. Ronald starrte erst mit verkniffenem Mund geradeaus. Nach einer Weile sank er resigniert auf die Rückenlehne. »Kleiner«, sagte er kopfschüttelnd, schwer atmend, mit betont vorgewölbter Unterlippe, »wir sind hier nicht nur am Arsch der Welt, sondern auch am Arsch der Zeit.«
Es war noch nicht einmal sieben Uhr abends, aber hierzulande wurde es weit früher dunkel als in Deutschland. Gottlob verfügte Walters Fuhrwerk über ein paar einigermaßen kräftige Lampen, denn die schmale Landstraße war weitgehend unbeleuchtet. Außerdem wimmelte es von Rissen und Schlaglöchern, so dass das Gefährt rumpelte und holperte, als führen wir über einen Acker. Ronald rollte regelmäßig mit den Augen. Doch endlich tauchten ein paar Straßenlaternen auf. »St. John-on-the-Hills« stand auf dem Ortsschild.
»Sind wir bald da?«, traute ich mich zu fragen. »Aye!«, sagte Walter. »Etwa zehn Minuten noch! Das Haus von Mr Brooks ist ein wenig außerhalb des Dorfes!«
»Auch das noch!«, stöhnte Ronald.
Endlich verlangsamte Walter das Tempo. Vor uns tauchte ein gewaltiges Herrenhaus mit zahlreichen verschachtelten Giebeln und einer Armee von Schornsteinen auf den Dächern auf. Wie ein riesenhaftes Tier kauerte es vor dem am Horizont noch immer rotviolett glimmendem Himmel, umgeben von zahlreichen alten Eichen und im Westen gekrönt durch einen wuchtigen, hohen Turm.
Walter lenkte das Fuhrwerk durch eine Toreinfahrt in einen kopfsteingepflasterten Hof, brachte die Pferde zum Stillstand und sprang scheppernd vom Bock. Ida ließ sich wieder von ihm mit hohem Schwung herunterheben, während Ronald und ich uns schwerfällig herausschälten und matt nach unten kletterten.
Obwohl die erleuchteten Fenster einladend aussahen, wirkten die uralten Mauern auf mich wie die Burg eines Trollkönigs, ein Spukhaus oder eine gigantische Grabstätte, und sämtliche schaurigen Momente aus allen Gruselgeschichten, die ich in meinem Leben verschlungen hatte, meldeten sich in diesem Augenblick wieder.
»Die Verwandtschaft aus Deutschland! Willkommen!«
Die Stimme gehörte einer kleinen, etwas fülligen Frau, die die Eingangstür weit geöffnet hatte und gleich auf uns zueilte. Im Laternenlicht erwies sie sich als noch relativ jung, höchstens dreißig Jahre alt, das Gesicht voller Sommersprossen, und ihr Englisch war zu meiner Erleichterung ohne Probleme zu verstehen. »Ich bin Elizabeth! Ich kümmere mich hier um alles hier drinnen. Walter ist für alles draußen zuständig!«, sagte sie. »Kommt herein! Das Abendessen steht schon bereit!«
Während Walter sämtliche Koffer auf einmal in seinen großen Handschaufeln ins Haus trug, geleitete Elizabeth uns drei durch einen holzgetäfelten Eingangsbereich in eine prächtige Halle, in der ein riesenhafter eiserner Kronleuchter hing. Sie umfasste zwei Stockwerke, und in der Mitte befand sich eine große Holztreppe, die auf die erste Galerie führte. Ida schaute furchtsam auf die Statuen und Rüstungen, die in allen möglichen Ecken und Winkeln standen, und auf die Gemälde, die an so ziemlich allen freien Stellen der Wände hingen. Auf der Treppe stand ein elegant gekleideter älterer Herr: unser Großvater.
Ich erkannte ihn sofort, obwohl ich erst ein einziges Bild von ihm gesehen hatte, ein Foto aus der Kindheit meiner Mutter, wo er sie auf dem Arm hatte. Damals war alles an ihm schwarz: Sein Haar, sein Bart, sogar seine Augen. Jetzt aber hatte er schneeweißes Haupthaar und einen ebensolchen Vollbart, wobei seine Augenbrauen und sein Schnurrbart noch die ursprüngliche tiefschwarze Farbe hatten. Seine auffallend dunklen Augen waren stechend und schienen uns aufmerksam zu prüfen.
»Guten Abend, Sir«, sagte ich, und Ronald ließ sich ebenso dazu herab, eine höfliche Begrüßung zu murmeln.
Neville Brooks schwebte würdevoll die Stufen herab. An seiner schlanken Hand, die das geschnitzte Geländer entlangglitt, erblickte ich zahlreiche Ringe, und über seinem Anzug trug er eine golden schimmernde Kette mit einem Amulett, das an eine Distel erinnerte. Er trat schweigend zu uns und musterte einen nach dem anderen.
»Ich heiße euch willkommen, meine Enkelkinder. So lernen wir uns also doch einmal kennen.«
Seine Stimme war tief und voluminös, obwohl er nicht laut sprach. Sein Akzent war vornehm, als spräche ein Graf oder ein anderer hoher Adeliger.
»Elizabeth wird euch eure Zimmer zeigen«, fuhr er fort. »Danach bekommt ihr etwas zu essen. Ich selbst werde euch heute Abend keine Gesellschaft leisten, da ich noch zu arbeiten habe.«
Er deutet auf eine große Eichentür am hinteren Ende. »Dort ist die Bibliothek und dort ist auch mein Arbeitszimmer. Wenn ich dort bin, wünsche ich keinerlei Störung. Ansonsten gewähre ich euch, die Bücher zu eurer Bildung zu nutzen, wenn ihr sorgsam damit umgeht.«
Er wandte sich ab. »Bist du mein Opa?«, ließ sich Ida vernehmen.
Neville Brooks drehte sich nochmals um. »Ja«, sagte er nach kurzem Zögern, »der bin ich wohl.«
Hochaufgerichtet, als habe er einen Stock verschluckt, stieg er die Stufen hinauf.
»Gibt es eigentlich keine Oma?«, fragte mich Ida flüsternd.
»Nicht mehr«, flüsterte ich zurück. »Unsere Oma ist schon lange tot. Ich habe sie auch nicht kennengelernt.«
Elizabeth beugte sich zu uns. »Am besten, ihr sprecht nicht von eurer Großmutter. Mr Brooks möchte an ihren Tod nicht erinnert werden.«
2. Steinerne Wächter
onald als dem Ältesten von uns wurde das Vorrecht zuteil, Mama anzurufen. Er sprach kurz und beherrscht mit ihr, hängte den Sprachtrichter dann ein und teilte uns sein »Alles in Ordnung« mit. Dann trotteten wir zu Tisch.
Das Essen war entgegen unseren Befürchtungen äußerst schmackhaft. Es gab einen Dicke-Bohnen-Eintopf mit Speck und Räucherwurst, danach noch kalten aufgeschnittenen Braten, frisches braunes Brot und eingelegte Zwiebeln, dazu Salat und zum Schluss Karamellpudding mit Walnüssen. Ronald schaufelte sich das Essen rein, als habe er einen Monat gehungert, schnallte danach seinen Gürtel drei Löcher weiter und wirkte ungewohnt zufrieden. Ida schlief fast auf der Tischplatte ein, was Elizabeth zum Anlass nahm, uns unsere Zimmer zu zeigen, in denen unsere Koffer schon bereitstanden. Sie trug die schlafende Ida direkt in ihr Bett in einem kleinen Zimmer, direkt neben ihrem eigenen Raum. Ronald bezog ein großes Zimmer mit Blick auf die Straße, das er sogar für einigermaßen angemessen hielt. Ich wurde in einem der Turmzimmer untergebracht, wozu wir einige Stufen einer engen Wendeltreppe emporsteigen mussten, und mein anfängliches Unbehagen wuchs noch mehr, als Elizabeth mir erzählte, dass es sich hier um den ältesten Teil des Gebäudes handelte, der bis ins 9. Jahrhundert zurückgehe. Das Zimmer selbst sah aber sehr gemütlich aus: ein großer, wuchtiger Holzschrank, ein Bett mit Nachttisch, mehrere relativ kleine, schmale Fenster, aber gottlob elektrisches Licht. Der Waschtisch bestand aus einer Schüssel und einer großen Wasserkanne. Für Notfälle stand ein Nachttopf unter dem Bett, denn die Klos und Bäder befanden sich im Hauptgebäude in den unteren Stockwerken.
Als ich allein im Zimmer war, fühlte ich mich einsam. Ich versuchte, mich abzulenken, indem ich meinen Koffer auspackte. Dann entzündete ich die Nachtkerze auf dem Nachttisch und ging nochmals durch das kalte, dunkle Treppenhaus nach unten, um nach Ida zu sehen. Sie schlief tief und fest. Ich gab ihr einen Kuss und klopfte nochmal an Ronalds Zimmer. Er schien ungehalten, denn er lag schon im Bett und las ein Buch.
»Alles in Ordnung?«, fragte ich betont arglos.
»Nichts ist in Ordnung, das weißt du doch!«, raunzte er, und suchte das Buch an seiner Seite zu verbergen.
»Was liest du da?« Ich zeigte auf das dunkelblaue Buch. Wortlos und betont gelangweilt hielt er mir den Titel unter die Nase.
»›Tausendundeine Nacht‹? Du liest Märchen?«
»Ach, Kleiner«, sagte er mitleidig, »da stehen noch ganz andere Sachen drin. Aber das ist noch nichts für dich.«
»Nenn mich nicht immer ›Kleiner’‹ Ich habe auch einen Namen!«
»Mister Konrad Adler! Ich erbitte demütigst eure Gunst!«, flötete er mit Falsettstimme.
»Bei uns zu Hause nennt man mich Conny. Das weißt du doch! Kannst du nicht einmal normal reden?«
»Solange du dich wie ein Hosenscheißer benimmst, nenne ich dich ›Kleiner‹«, belehrte er mich. »Das passt zu dir.«
Mit einer Handbewegung bedeutete er mir, mich zu verziehen.
Was Ronald betraf, war alles beim Alten geblieben. Irgendwie war das auch ein Trost.
Wahrscheinlich hatte ich das kälteste Zimmer von allen. Die alten Mauern schienen den Frost des längst vergangenes Winters außerordentlich gut gespeichert zu haben. Ich wachte nachts bibbernd auf und hüllte mich in alles, was Elizabeth mir an Decken gebracht hatte. Dann aber fiel ich in einen so tiefen Schlaf wie schon lange nicht mehr.
Am nächsten Morgen weckte mich das Zwitschern der Vögel, so laut und zahlreich, wie ich es nur ein einziges Mal erlebt hatte: bei einem Urlaub in der Provence … den einzigen, den wir je mit der ganzen Familie gemacht hatten, denn unser Vater war ständig unterwegs, um Brücken in aller Welt, vorzugsweise in Asien, zu bauen. Wir haben in unserer Kindheit nicht viel von ihm gehabt. Allerdings verdiente er dort eine Menge Geld.
Ich schälte mich unwillig aus den warmen Decken, und sofort überzog sich mein ganzer Körper mit Gänsehaut. Ich war sehr dünn damals, geradezu mager, obwohl ich ganz gut futtern konnte – es sei denn, ich hatte Sorgen. An diesem Morgen hatte ich erstaunlicherweise Hunger, und ich beeilte mich, nach unten zu kommen.
Elizabeth hatte bereits den Frühstückstisch vorbereitet; es roch nach Tee, gebratenem Speck und geröstetem Toast. »Ich bin gleich soweit!«, rief sie aus der Küche und winkte mich ins Esszimmer, das wir schon vom gestrigen Abend kannten. Von Ronald war noch nichts zu sehen, aber ich entdeckte Ida, die in der Küche fleißig dabei war, Elizabeth Eier anzureichen.
Dann erschien unser Großvater und begab sich mit uns wortlos an das Kopfende des Tisches, wo Elizabeth ihm sogleich Tee einschenkte und ihm Milchkännchen und Zucker in greifbare Nähe stellte.
»Wo ist euer Bruder?« Er sprach eher leise, aber seine Stimme füllte den ganzen Raum.
»Wahrscheinlich schläft er noch«, sagte ich, während ich es mir auf dem schweren Holzstuhl bequem zu machen versuchte.
»Es ist bereits nach acht!«
»Ronald ist ein Faultier!«, erklärte Ida.
»Ist er das?« Unser Großvater rührte mit elegantem Schwung in seiner Tasse. »Mit sechzehn?« Er langte nach seiner Gabel, während Elizabeth Rührei und gebratenen Speck, Würstchen und Bohnen auftrug. »Ich bin bereits weit über sechzig und stehe jeden Morgen um sieben Uhr auf.« Sein Gesicht zeigte eindeutige Anzeichen größter Missbilligung. Mir machte das gute Laune. Der blöde Schnösel von Ronald würde sicher von ihm bald ein paar Worte dazu hören. Ich fühlte, dass ich Neville Brooks mögen würde.
Ronald erschien schließlich doch - mit zerknautschtem Gesicht und verstrubbeltem Haar, zeitgleich mit dem ominösen Porridge, das durch Elizabeths Spezialbehandlung mit Sahne, Honig und Zimt nicht die fade Schlabberpampe war, die wir alle erwartet hatten, und erstaunlich gut schmeckte. Opa Neville schenkte Ronalds Anblick und dessen verschlafenem Morgengruß keine besondere Beachtung. Allerdings wies er ihn auch nicht zurecht, sondern widmete sich unbeirrt dem Toast und der Orangenmarmelade, die Elizabeth nach dem üppigen Hauptgang auch noch hereinbrachte. Ich hatte überraschend großen Hunger, was ich von mir sonst nicht kannte. Normalerweise brachte ich morgens nicht mehr als eine Tasse Kakao herunter.
Opa Neville schien nach der morgendlichen Begrüßung ohnehin bereits geistig woanders zu sein. Mama hatte ihn uns als unnahbar und versponnen geschildert, und ich ahnte nun, was sie damit gemeint hatte. Er tupfte sich schließlich Mund und Bart mit seiner Serviette ab und tauchte kurz aus seiner Gedankenwelt auf.
»Ich werde nun ein paar Stunden arbeiten«, erklärte er, und sah in die Runde. »Ich sehe, dass es euch schmeckt. Das ist gut. Es geht nichts über ein gutes englisches Frühstück.« Er erhob sich von seinem rustikalen Holzstuhl. »Ich hoffe, ihr seid euch bewusst, an was für einem geschichtsträchtigen Ort ihr euch befindet«, sagte er. »Dieses Hauses ist mehr als tausend Jahre alt. Wer kann sowas schon von seinem Wohnhaus behaupten? Es ist Teil eines ehemaligen Klosters, das im Jahre 843 von schottischen Mönchen gegründet wurde. Die Überreste davon sind überall noch zu sehen. Also erkundet mal die Umgebung, es wird euch nicht schaden.«
Zu einer weiteren Unterhaltung war er offenbar nicht aufgelegt. Er wandte sich ab, marschierte schnurstracks durch die Tür und nahm Kurs auf sein Arbeitszimmer. Kurz darauf hörten wir eine Tür ins Schloss fallen.
Ronalds desinteressiertes Gesicht war für mich keine Überraschung, und als Ida eifrig zu Elizabeth in die Küche lief und ich beide kurz darauf lachen und schwatzen hörte, stieg ich zu meinem Turmzimmer hinauf, schlüpfte dort in meine Sportjacke, schnürte meine festen Schuhe und lief durch den Hinterausgang ins Freie.
Der dunstige Himmel des Morgens hatte sich bereits gelichtet und sommerliches Sonnenlicht tauchte alles um mich herum in leuchtende Farben. Jetzt erst, bei Tag, konnte ich die ganze Umgebung erkennen. Großvaters Haus stand inmitten von uralten, mächtigen Bäumen und bestand selbst aus wuchtigen Steinmauern, die aussahen, als stammten sie aus der Zeit von König Artus persönlich. Das Anwesen war von einer verwitterten Steinmauer umgeben, die in unregelmäßigen Abständen mehrere eingebrochene Quermauern aufwies, die früher zu irgendwelchen Gebäuden gehört haben mochten. Noch deutlicher wurde dies hinter dem Haus, wo sich ein völlig verwilderter Garten anschloss. Überall wuchsen dort dichte Büsche von Brennnesseln, weiß blühende Holunderbäume, Schwarzdorn und Massen von Brombeersträuchern. Walter hatte es trotzdem geschafft, in einigen Bereichen große Gemüsebeete anzulegen. Mittendrin gab es aber auch Flächen von Wiesen, die teilweise sorgfältig gemäht waren und ein paar Holzbänke beherbergten. Auch hier war der größere Teil der Natur sich selbst überlassen und es wuchsen zahllose Blumen und Gräser, in denen Insekten aller Art herumwimmelten. Dazwischen duckten sich immer wieder quaderförmige Steine in kurzen Abständen, die vielleicht in alter Zeit Grundmauern gewesen waren, und in einiger Entfernung stand der Rest einer an eine Kirche erinnernden Fassade mit romanischen Säulen und Bögen, die über und über von Efeu und wildem Wein bewachsen waren. Bei einem Teil war sogar noch das Gewölbe erhalten, und in den Mauerresten darüber, in denen Vögel nisteten, waren noch die Mulden zu sehen, in denen früher die Holzbalken des nächsten Stockwerks gesteckt hatten. Dahinter befanden sich offenbar noch die Überreste eines Kreuzganges - die ursprüngliche quadratische Anlage war zwischen dem Gras und den üppigen Büschen noch deutlich zu erkennen. Durch eine Gruppe von Säulen, die den Jahrhunderten noch immer trotzten, erkannte ich einige Grabsteine, die die Erdbewegungen stark verschoben hatten und die in alle möglichen Richtungen zeigten, wenn sie nicht längst umgesunken waren.
In der sommerlichen Wärme der aufsteigenden Sonne zirpten bereits überall die Grillen, sprangen die Heuschrecken umher und die Schmetterlinge flatterten.
Ich schlenderte zwischen den Grabsteinen umher und entdeckte noch weitere ausgetretene Treppenstufen, eingestürzte Durchgänge und überwachsene Steinplatten, wo früher eine große Anlage von Gebäuden gewesen sein musste. Zwischen einigen Himbeersträuchern fand ich eine völlig verwitterte Engelsstatue mit abgebrochenem, früher vermutlich erhobenem Arm, die mit Flechten nur so übersäht war. Dahinter erblickte ich, dicht an einem Weidenzaun, eine stattliche Anzahl Bienenkörbe, die in mehreren Lagen auf rohen, vom Wetter gegerbten Holzbohlen standen, die für mich wie die Planken von einem alten Piratenschoner aussahen. Ein beständiges Summen erfüllte die ganze Atmosphäre und der süße Duft zahlloser Blüten stieg in meine Nase.
»He da! Was treibst du hier, Bengel?«
Ein alter Mann mit breitkrempigem Strohhut und graublauer Latzhose stand plötzlich mitten im hohen Gras und war offenbar übelster Laune. Mit seiner schwarzumrandeten runden Brille und dem langen weißen Bart sah er aus wie ein als Mensch verkleideter Ziegenbock. Leider schwang er etwas in der Hand, das mich an einen großen Schürhaken erinnerte, und er stapfte sehr wütend auf mich zu.
»Entschuldigen sie, Sir«, stotterte ich, »ich wollte niemanden stören!«
»Mach, dass du hier fortkommst!«, geiferte er mit überschlagender Stimme und ließ in seinem Maul eine Reihe fauliger Zahnstümpfe erkennen, »oder ich zerstampf dich zu Mus!« Er stapfte auf mich zu und fuchtelte mit dem Gerät in seiner Hand so wild um sich, dass ich ihm das sofort glaubte. Ich schlug alle Ambitionen, ihn beschwichtigen zu wollen, in den Wind und suchte schleunigst das Weite. Erst als ich wieder den Bereich von Walters Gemüsebeeten erreichte, kam ich außer Atem zum Stehen.
Zuerst wollte ich in Großvaters Haus Schutz suchen, so wie ich als kleiner Junge immer nach Hause gelaufen war, wenn mich etwas bedrückte. Aber dann erinnerte ich mich daran, dass ich höchstens Elizabeth oder Walter antreffen würde – oder vielleicht Ronald. Den konnte ich jetzt gerade gebrauchen!
Ich beschloss, mich von dem Bereich der Bienenstöcke fernzuhalten, und orientierte mich in die entgegengesetzte Richtung. Ich lief noch über eine große alte Steinplatte, in der noch schemenhaft ein Relief zu erkennen war, das an ein keltisches Kreuz erinnerte, dann hörten die alten Monumente auf. Eine mächtige alte Eibe schien eine Art Grenze zu markieren, denn unterhalb davon breitete sich das Moor aus, von dem ich schon gelesen hatte.
Ich hielt ein wenig ehrfürchtig inne. Noch stand ich auf der Anhöhe, auf der das Kloster erbaut war, aber vor meinen Füßen fiel der Hügel rasch ab. Rundherum kündigten zwar zahlreiche Bäume den dichten Wald an, doch direkt vor mir bot sich meinem Blick eine mystisch anmutende, weite Landschaft voller violettem Heidekraut, sumpfigen Stellen voller Torfmoos mit weißen Tupfen vom Wollgras, unterbrochen von niedrigen Ginsterbüschen, und in einiger Entfernung einige grüne Hügel mit seltsamen verhutzelten Bäumen – eine Versammlung von gnomenhaften Wächtern, die mich abschätzig beobachteten. Einige Findlinge, große, runde Felsen, die aussahen, als habe sie jemand wahllos in der Landschaft verstreut, zeigten mir, dass das Moor nur teilweise versumpft und wohl gefahrlos begehbar war. Auffällig waren drei mannshohe, verwitterte Steine, die am Eingang des Moores standen und den Eindruck machten, als seien sie vor langer Zeit dort aufgestellt worden.
Kein Haus war hier zu sehen. Mir war, als beträte ich ein Jenseits, einen menschenleeren Raum. Nach allem, was ich aus der Schule noch wusste, hatte das ganz vernünftige Gründe: Unter anderem war der Boden zu morastig, um darauf bauen zu können. Legenden und Sagen dagegen erzählten von Geistern, die das Moor bewohnten. Und wirklich war mir bei jedem Schritt, den ich nun tat, als bewegte ich mich im Bereich einer Anderswelt, einer Region der Leprachaune1 und Feen. Ich sah mich um. Großvaters Haus war bereits weit entfernt, und es wirkte, als winke es mir wie zum Abschied zu.
Die Beklemmung, die ich spürte, war aber weniger stark als meine Neugier. Was sollte hier schon sein? Geister gab es nicht, Feen und Elfen waren etwas für Kinder, und ich war darauf und dran, keines mehr zu sein. Schlimm genug, dass mein älterer Bruder so ein Knallkopf war.
Ich folgte einer Art Pfad – zumindest schien ich nicht der erste zu sein, der diesen Weg nahm. Dass meine Annahme richtig war, merkte ich daran, dass ab und zu Holzstege und dicke Bohlen moorige Stellen überbrückten. An einem riesenhaften Findling hielt ich inne. Ich schwitzte und keuchte ganz ordentlich – als Stadtkind war ich es gar nicht gewohnt, solch lange Fußmärsche hinzulegen. Aber jetzt war ich zu weit gelaufen, um einfach wieder umzukehren. Gut, dass das kräftige Frühstück noch so gut vorhielt.
Bald war ich an den Hügeln angekommen. Ich schritt durch das grüne Gras hinauf und erreichte die Gruppe der knorrigen Bäume, die von Nahem ganz normal, ja sogar freundlich aussahen. Ich ging einfach hindurch, genoss den kühlenden Schatten und blickte bald von dort aus auf eine fast runde Ebene, die von ähnlichen Hügeln umsäumt war wie der, auf dem ich stand … einige kleiner, andere langgestreckt wie ein Wall. Vor allem aber standen dort steinerne Monolithen unterschiedlicher Größe, die einen weitläufigen Kreis bildeten, so als habe ein sagenhafter Riese mächtige steinerne Nadeln in die Landschaft gespießt, um einen magischen Platz zu markieren. Auffällig war, dass innerhalb des Kreises kaum Gras wuchs – Moos war dort in Hülle und Fülle und in der Nähe der Steine mehrere Pilze, aber sonst nichts. Angelehnt an den größten dieser Steine saß jemand.
Ich stolperte den Hügel hinunter. Es war ein Mädchen. Ihre dunklen Haare wehten ein wenig im Wind, ansonsten saß sie entspannt in der Sonne und hatte die Augen geschlossen. Ich stampfte absichtlich möglichst kräftig auf, um mich bemerkbar zu machen, und hustete ein paar Mal, als sie sich nicht rührte. Etwas hilflos stand ich schließlich vor ihr und betrachtete sie.
Sie mochte etwa so alt sein wie ich, obwohl sie schon aussah wie eine junge Dame. Ihr grauer Rock und ihr rostroter Pullover passten eigenartig verwunschen zu ihrer hellen Haut, den vollen roten Lippen und ihrem Haar, das im Sonnenlicht kupfern schimmerte.
»Starrst du immer so auf andere Leute?«, sagte sie plötzlich mit geschlossenen Augen. Sie hatte eine volle, fast tiefe Stimme, und ich zuckte zusammen, denn ich hatte gedacht, sie schliefe.
»N-nein, normalerweise nicht«, stotterte ich.
»Und warum tust du es hier mit mir?«
»Mir fiel nichts Besseres ein.«
Sie öffnete träge ein Augenlid, um es gleich wieder zu schließen. »Wer bist du? Ich habe dich noch nie hier gesehen.«
»Ich heiße Conny«, sagte ich. »Konrad Adler. Ich wohne dort hinten in dem alten Herrenhaus am Kloster, bei St.-John-on-the-Hills. Neville Brooks ist mein Großvater.«
»Du wohnst in dem alten Herrenhaus?« Sie klang jetzt erstaunt und öffnete zwei dunkelgrüne Augen.
»Ja, aber erst seit gestern. Ich komme aus Deutschland«, erklärte ich.
»Ah, daher der komische Akzent.« Sie bedeutete mir, mich neben sie zu setzen und rückte dafür zur Seite.
»Ich bin eigentlich auch nicht von hier«, erzählte sie. »Ich heiße Ceridwen. Meine Familie stammt aus Wales. Mein Großvater kam einst hierher, um in den Kohleminen zu arbeiten.«
Sie griff in den Korb an ihrer Seite und holte eine Handvoll dunkelblauer Beeren hervor. »Magst du? Moosbeeren. Die wachsen hier überall und werden gerade reif.«
Ich probierte die Beeren, die süß und saftig waren. Sie schmeckten wie Heidelbeeren.
»Und was verschlägt einen Deutschen in diese abgelegene Gegend?«
»Meine Mutter ist aus England«, sagte ich. »Sie ist krank, und mein Vater ist beruflich viel unterwegs. Und sie macht sich Sorgen um das, was in Deutschland gerade passiert. Daher hat sie uns zu unserem Großvater geschickt. Wir sind erst gestern angekommen.«
Eigenartig. Sie wirkte so vertraut auf mich. Ich glaube, ich hätte ihr sofort alles erzählt, was ich auf dem Herzen hatte.
»Wer sind ›wir‹?«, fragte sie.
»Mein großer Bruder Ronald, meine kleine Schwester Ida und ich.«
»Und das Erste, was du tust, ist hierher zu kommen?«
»Ich war neugierig und wollte die Gegend erkunden. Und das Moor wirkte aufregend auf mich.«
Sie blickte erst etwas verständnislos, sah dann aber in den Himmel. »Ich komme oft hierher«, murmelte sie. »Hier habe ich Ruhe. Keiner stört mich. Und die Zeit ist hier wie stehengeblieben. Wahrscheinlich sah es hier vor ein paar tausend Jahren schon so aus.«
Ich glaubte ihr jedes Wort. Jetzt merkte ich plötzlich, dass ich eine ganze Weile gar nicht an Sorgen und Nöte gedacht hatte. Bis zu ihrer Frage. Einen kurzen Augenblick fühlte ich mich schuldig, dass es mir so gut ging, während Mama zuhause in Deutschland kaum aus ihrem Bett aufstehen konnte.
»Hast du gerade an deine Mutter gedacht?«
Konnte Ceridwen Gedanken lesen? Ich starrte sie an, als wäre mir der Geist von Canterville erschienen.
»So schwer war das nicht zu erraten.« Sie lächelte spitzbübisch. Dann wurde sie unruhig. »Ich fürchte, ich werde meiner geliebten Stiefmutter nun die Beeren bringen müssen, damit sie ihre Törtchen backen kann.« Sie sprang auf und griff nach ihrem Korb.
»Du hast eine Stiefmutter?«, frage ich. »Was ist mit deiner Mutter?«
Ceridwen war schon auf dem Weg und wandte sich noch einmal um. »Sie ist weggegangen«, rief sie. »Ist schon viele Jahre her.« Sie winkte mir noch zu und war bald zwischen einem Wäldchen von Schwarzdornbüschen verschwunden.
Das Pferdefuhrwerk war gottlob doch nicht das einzige Fortbewegungsmittel, das wir zur Verfügung hatten. Walter besaß ein Motorrad mit Beiwagen, mit dem er mit Elizabeth oder wem auch immer ins Dorf fuhr, um dort Besorgungen zu machen. Es knatterte immer wie kurz vor der Explosion, und stieß stinkende Wolken aus, als hätte Walter nicht Benzin, sondern ein teuflisches Elixier eingefüllt.
»Das war der alte Graham!«, lachte er, als ich ihm von meiner vormittäglichen Begegnung erzählte. »Er nutzt einen Teil des Klostergeländes für seine Bienen. Er behauptet, nur die Blumen des Klosterhügels hätten die richtige Zauberkraft für sein magisches Zeug. Mag er glauben, was er will.«
Ich hatte das Glück, Walter begleiten zu dürfen. Ich war noch nie in einem Beiwagen gefahren, und hatte mächtig Respekt vor dem Tempo, das Walter auf der holperigen Straße vorlegte. In meiner blühenden Fantasie gab es gleich einen lauten Kracks und ich sauste mit dem abgeplatzten Beiwagen führerlos durch die bewaldeten Hügel, um an einem Baum oder im Bach zu enden. Aber die Realität war harmloser. Der Beiwagen hielt.
»Graham spinnt«, fuhr Walter fort, »Überall sieht er jemanden, der ihm ans Leder will oder ihm etwas wegnehmen möchte. Denkt, das Leben ist grauenhaft, die Welt ist schlecht, und nur bewohnt von Bösewichtern und Idioten. Aber sein Honig ist wunderbar.«
»Dass er glaubt, dass hier Zauberkräfte herrschen, kann ich sogar verstehen«, meinte ich. »Mir war auch etwas unheimlich, als ich durch das Moor spaziert bin.«
»Du hast schon das Moor erkundet? Du legst ja ordentlich los!«
»Ja, gleich am Anfang stehen diese eigenartigen Steine …«
Walter lachte. »Ja, die finden auch andere unheimlich! Sie werden die ›Three Bad Sisters‹ genannt!«
»Wieso das?«
»Ach, das ist so eine Geistergeschichte aus dem letzten Jahrhundert. Hier lebten tatsächlich drei Schwestern, die bekannt waren für ihre Bösartigkeit. Niemand mochte sie leiden, und sie taten wohl auch Einiges, um sich unbeliebt zu machen. Angeblich hat sie der Teufel persönlich in Steine verwandelt und seitdem stehen sie dort.«
Einen Augenblick lang wünschte ich, Walter hätte mir das nicht erzählt. Verwandelte böse Schwestern hatten mir zu meiner unruhigen Stimmung gerade noch gefehlt.
Er lenkte das Motorrad in Richtung Dorf, und schon bald tauchten die ersten Häuser auf. Kurz darauf waren wir auf der belebten Dorfstraße mit dem Gemischtwarenladen, der Bäckerei, dem Schneider, der Metzgerei und der Apotheke. Die Dorfkneipe hatte trug den klangvollen Namen »The Cunning Little Monk2«, und auf dem großen Holzschild war dazu eine Szene mit einem offenbar bestens gelaunten kleinen Mönch abgebildet, der in einer Art Irrgarten stand und eine große Wurst in der Hand hielt. Es war einer der Momente, wo ich mir dachte, auf einem anderen Planeten zu sein. So etwas würde es in Deutschland nie geben!
Elizabeth hatte Walter eine lange Einkaufsliste mitgegeben. In Walters Transportkiste sammelten sich nach und nach Speck, Würste, Käse, Eier, Äpfel, Zwiebeln, Lauch, Mehl, Zucker, Gewürze, Bier und frisches Brot. Walter schien jeden im Dorf zu kennen und erkundigte sich bei allen nach Neuigkeiten. Die hagere Metzgersfrau, Mrs Nesbitt, hatte eine kranke Schwester, die gottseidank wieder genesen war und nun Urlaub in Blackpool machte und der noch junge, pausbackige Bäcker Jason Ives war werdender Vater und entsprechend unruhig (»Jede Minute könnte es soweit sein!«). Der Herr Pfarrer, Mr Chandler, hatte leider noch immer seine Nierenkoliken und der Sohn des Gemischtwarenhändlers Bateson hatte das Trimester nicht geschafft – was seinen Vater zutiefst bekümmerte und er sich nächtelang fragte, was er wohl falsch gemacht hatte. Der Sohn des Apothekers Gibbons (der bereits die gleiche Stirnglatze hatte wie sein Vater) würde demnächst zur Universität gehen, um dort Medizin zu studieren und Jack »The Bottle« Brodie, der Dorftrunkenbold, war, wie wohl jeden Tag um diese Uhrzeit, bereits völlig betrunken; er hielt sich schwankend an einem Laternenpfahl fest und wünschte jedem, der vorbeiging, lallend einen wundervollen Abend. Mrs Florence Ormerod, die Schneiderin, bei der Walter einen abgeänderten karierten Freizeitanzug abholte, erzählte milde lächelnd von den Fortschritten, die Herbert, ihr geistig behinderter Sohn, trotz aller Einschränkungen machte, und er sich nun für das Backen begeisterte. Sie bot uns Butterkringel an, die Herb selbst gebacken hatte (und die grauenhaft schmeckten, weil er offenbar den Zucker mit dem Salz verwechselt hatte).
Zu guter Letzt setzte sich Walter ins Cunning Little Monk und gönnte sich eine Pint Stout, die ihm der gut gelaunte Wirt Harry (der seine spindeldürre Tochter Gladys ziemlich barsch herumscheuchte) frisch zapfte. Ich kannte das Getränk nicht, es sah pechschwarz aus und hatte eine Sahnehaube darauf, aber tatsächlich war es ein besonders würziges Bier mit festem Schaum. Er ließ mich einen Schluck probieren, und ich schwöre, es war das Ekligste, was ich je in meinem Leben getrunken habe, schwer und bitter. Wie Erwachsene so etwas gerne trinken konnten, war mir völlig unbegreiflich. Da hielt ich mich lieber an mein Ginger-Ale.
An diesem Abend war ich trunken von neuen Eindrücken. Ich dachte an das Kloster, an Ceridwen, das Moor, den Steinkreis… und an die Moosbeeren, die Ceridwen mir gegeben hatte. Ihre verschwundene Mutter. Und an die Achterbahnfahrt in Walters Beiwagen. Ida war vergnügt, weil sie mit Elizabeth einen Kirschkuchen gebacken hatte. Und Ronald…, ach, der sollte selbst klarkommen. Sollte er doch seine schweinischen Märchen lesen.
Ich hatte diese Nacht einen seltsamen Traum. Ungewöhnlich intensiv, auf unheimliche Art real und lebendig.
1 Keltischer Kobold
2 »Das listige Mönchlein«
3. Martinus, der Novize
n diesem Morgen war es noch einmal richtig kalt … »so kalt, dass selbst dem Teufel die Hörner abfrieren würden« wie Pater Adelmus in einem seiner unbedachten Momente vermutlich gesagt hätte. Die Morgenröte verkündete einen klaren Frühlingstag, und doch verließ der Atem den Mund in einem dichten Nebel. Der Reim lag auf dem Bach, und Raureif bedeckte alle Halme und Blätter. Martinus war es daher nur wenig frühlingshaft zumute; er fror, und die Tasse Kräutertee, die er nach der Morgenvesper bekommen hatte, hatte ihre wärmende Wirkung bereits nach Verlassen der Klosterpforte verloren. Zitternd hüllte er sich in seine Kutte, zog seine Kapuze tief ins Gesicht und rieb sich die schmerzenden Fingerkuppen in den Handschuhen, die Bruder Bláán ihm geliehen hatte und die einem dreizehnjährigen Novizen wie Martinus, der ohnehin eher klein und schmächtig war und entsprechend schmale Hände hatte, viel zu groß waren. Kurz dachte er noch an das winzige Bündel, das gestern Morgen vor der Klosterpforte gelegen hatte: Ein halb erfrorenes Baby, mager und schwach, das Pater Adelmus sofort in einen ganzen Berg von Schaffellen gewickelt hatte, ohne große Hoffnung, dass es überleben würde. Diese Nacht hatte es geschafft – ein Wunder. Da würde ein starker junger Kerl wie er erst recht nicht zimperlich sein.
Doch schon bald durchflutete goldenes Morgenlicht den Wald. Ein paar Fasanen flatterten aus dem Unterholz auf, als sich Martinus nach den ersten Blättern bückte, die zu sammeln ihm aufgetragen war. Die Sonne begann nun allmählich zu wärmen, und Martinus frohlockte, als er nun einen wahren Teppich von Bärlauch im lichten Wald ausmachte. Er würde seinen Weidenkorb im Nu gefüllt haben und bald bei einem frischgebackenen Stück Brot mit Speck und Käse in der Frühstücksrunde sitzen und mit einem Humpen heißer Milch seinen Magen wärmen. Jedes gepflückte Blatt brachte ihn diesem himmlischen Moment näher.
Der würgende Schrei in seiner nächsten Nähe erfüllte ihn dagegen mit einem Entsetzen, als wäre er kurz vor die Hölle. Erst war er starr vor Schreck. Dann duckte er sich in die Wurzeln einer alten Eiche und verhielt sich mucksmäuschenstill, obgleich sein Herz wie eine Trommel schlug. Martinus war nicht wirklich furchtsam, aber er hatte eine mächtige Fantasie. Tausend grässliche Bilder stiegen in ihm auf. Im Kloster erzählte man sich abscheuliche Dinge über die keltischen Heiden. Gewiss, offiziell waren die Einwohner in der Umgebung alle getauft, aber in Wahrheit waren sie immer noch ihrem alten Aberglauben verhaftet und verehrten heimlich ihre grausigen Götter. Bruder Benno von Coventry beliebte lebhaft deren blutige Menschenopfer und schaurige Rituale zu schildern und ihre Bündnisse mit den Mächten des Bösen, und das, obwohl man nun bereits das Jahr des Herrn 1103 schrieb und das gesamte Abendland bis hin zur heiligen Stadt Jerusalem durch die tapferen Kreuzritter vom verderblichen Einfluss allen Unglaubens gesäubert worden war. Und doch, die alten keltischen Albe schienen oft in jedem Baum zu lauern, in jeder Mauerritze zu verstecken, aus jedem Erdloch hervorzulugen. Bei dem Gedanken begann Martinus schwer zu atmen und erneut zu zittern, nunmehr aber nicht mehr vor Kälte. Nichts von dem, was er gerade vernommen hatte, erschien ihm menschlich.
Angstvoll lauschte Martinus. Da! Schon wieder! Das Schreien hatte sich jetzt in ein qualvolles Gurgeln verwandelt, dann wieder kam Keuchen und Stöhnen. Martinus kam jetzt der Gedanke, ob es sich womöglich nicht um einen höllischen Unhold, sondern um einen verletzten Menschen handeln könnte. Dies machte ihn schaudern, denn dann stand die Pflicht der Nächstenliebe zu Gebote, dabei wollte er sich doch viel lieber verkriechen. Er murmelte ein Stoßgebet. Bebend hob er den Kopf in die Höhe und spähte umher, auch wenn ihm alle Haare zu Berge standen. Die Erde begann schon zu tauen und feucht zu werden, aber er zog es dennoch vor, sich dicht an den Boden zu drücken und sich langsam weiter zu schlängeln.
Hinter der nächsten Hügelkuppe lag ein schwer verwundeter Ritter. Er lag wie in einem Bett in einer tiefen Mulde, inmitten von Erde, Glockenblumen, Moos und Schneeglöckchen. Offenkundig war er im Todeskampf, sein Bart wie auch das Gewand über seiner Rüstung waren blutgetränkt, seine Gliedmaßen waren wie im Krampf angewinkelt. Er atmete in kurzen Stößen und hatte bereits den starren Blick des Sterbenden. In kurzen Abständen würgte er Blut hervor.
Martinus vergaß augenblicklich seine Angst. Er stürzte zu dem Schwerverletzten.
»Haltet aus! Ich hole Hilfe!«
Die stieren Augen des Ritters hefteten sich auf ihn. Als er erkannte, dass Martinus davoneilen wollte, entrang sich seiner Kehle ein qualvoller Laut.
»Ich bin beizeiten zurück!« beteuerte Martinus. Doch der Ritter fuhr fort zu stöhnen. Er versuchte, etwas zu sagen.
Martinus kniete sich hin und näherte sein Ohr dem Mund des Ritters. Er roch bereits nach Tod.
»Öffne meinen… Brustpanzer!« flüsterte dieser mit fiebernden Lippen.
Martinus griff in das Blut und den Eiter und riss erfolglos an den verkrusteten Riemen. Geistesgegenwärtig hielt er sich nicht lange auf. Er holte sein Messer hervor und durchtrennte alle Halterungen mit ein paar kräftigen Schnitten. Der Ritter schrie, als Martinus den geborstenen Brustpanzer abhob.
Eine Wolke von Krankheit und Verwesung entströmte dem freigewordenen Körper. Der Anblick war entsetzlich. Überall verklebte schwärzliches Blut die Unterkleidung mit der Haut. Die zahlreichen klaffenden Wunden waren nass und geschwollen.
»Nimm den Beutel dort«, brachte der Ritter mühsam hervor. Martinus entdeckte tatsächlich einen kleinen pechschwarzen Lederbeutel, der an einem geflochtenen Band um den Hals des Ritters hing. Er durchschnitt das Band und nahm den Beutel an sich. Er war eigenartig warm und weich – wie lebendige Haut.
»Bewahre das, was darinnen ist, gut auf«, flüsterte der Ritter. »Und zeige es nur solchen, denen du vertraust.« Ein Husten und Würgen unterbrachen sein Flüstern, gefolgt von starkem Hecheln nach Luft.
»Ihr Mönche haltet es für Teufelszeug, doch ich schwöre bei Christus, dem Sohn Gottes, dass es das nicht ist! Die alten Götter sind nicht schlecht… nur anders.« Er starrte Martinus in die Augen. »Bitte, achte darauf!« flehte er, »Versprich es mir! Es bewirkt… Gutes!«
»Ich verspreche es!«, hörte Martinus sich sagen, denn er hatte im Grunde gar keine Ahnung, ober er dieses Versprechen halten konnte oder wollte. Der Ritter schloss erschöpft die Augen. Sein Atem ging hechelnd und schnell. Ob er nun gerade starb?
Martinus ließ sich keine weitere Zeit, dies abzuwarten. Er griff sich seinen Bärlauch beladenen Korb und stürzte hastig in Richtung Kloster, so schnell ihn seine Beine trugen und bis seine Lungen schmerzten.
»Nein, er lebt. Noch.« Pater Adelmus wusch sich die blutbefleckten Hände. »Jetzt können wir nur noch für ihn beten.«
»Wird er wieder gesund?« Martinus fühlte sich so erschöpft, als habe er den ganzen Tag Holz gehackt, den Klosterhof gekehrt und noch dazu die Latrinen gereinigt. Emsig schrubbte er sich die Hände, um jede Spur von Blut und Tod von seinem Körper zu entfernen.
»Das weiß Gott allein. Er braucht jetzt vor allem Ruhe.«
Pater Adelmus war hager und drahtig, und sein langer, wallender Bart begann sich bereits grau zu verfärben. Er pflegte niemals zu zögern, wenn es etwas zu tun gab, sei es eine Kleinigkeit oder eine gewaltige Aufgabe. Ähnliches erwartete er auch von anderen. Sein sehniger Zeigefinger wies auf den Leinensack mit blutigen Lumpen.
»Bring ihn in den Hof. Wir müssen alles verbrennen.«
Martinus hatte gelernt, Pater Adelmus nicht zu widersprechen. Kurz schaute er noch auf das schwach atmende Baby, das in der anderen Ecke des Krankenzimmers untergebracht war und in einer Kiste lag, die Pater Adelmus in ein Bettchen umfunktioniert hatte. Entschlossen schulterte er dann das schwere Bündel, das einen einzigen nassen Klumpen aus Stoff, Leder, Blut und Metall enthielt, und tat wie ihm geheißen. Jetzt, wo die Sonne hoch am Himmel stand, musste er fast schwitzen, und die Bienen summten um die bereits geöffneten Heckenrosenblüten. Bruder Merwyn, der zusammen mit ihm die schwere Bahre mit dem Verletzten getragen hatte, hatte bereits ein kräftiges Feuer entfacht, dessen Flammen sie den Kleidersack jetzt übergaben.
»Auf dass alle dunklen Mächte in die Hölle zurückkehren!« murmelte Merwyn und strich durch seine blonden Locken.
»Was mag ihm zugestoßen sein?« Martinus konnte den Anblick des geschundenen Körpers, den sie noch eben gewaschen und verbunden hatten, nicht loswerden.
»Keine Ahnung. Er sah jedenfalls aus, als habe ihn ein Dämon zerfleischt.«
»Vielleicht war es ein Wildschwein?«
»Seit wann verüben Wildschweine Stichwunden durch eherne Rüstungen? Nein, hier hatte der Teufel seine Hand im Spiel.« Merwyn bekreuzigte sich dreimal hintereinander.
»Wir wollen hoffen, dass unser edler Ritter nicht in schwarzmagische Machenschaften verwickelt ist! Und dass sich das Böse scheut, unsere heiligen Mauern zu überwinden. Wer weiß, welche Kreaturen der Hölle er anzieht!«
Martinus fand diesen Abend keinen Schlaf, obwohl er todmüde war. Adelmus hatte jeden Kontakt mit dem Kranken verboten, und hatte ihn lediglich nach Eisenkraut, Schafgarbe und Eichenrinde ausgeschickt. Einmal war er kurz eingenickt, doch ein Albtraum von einem schwarzbehaarten, gedrungenen Wesen mit menschenähnlichen Zügen und wolfsähnlichen Zähnen und Krallen schreckte ihn rüde auf. Er atmete tief, aber das Grauen des Albdrucks wollte nicht weichen. Er sprach ein paar Gebete, doch anstatt, dass die ersehnte Ruhe einkehrte, peinigten ihn umso mehr beängstigende Gedanken.
»Wer weiß, welche Dämonen er anzieht!«
Martinus saß jetzt kerzengerade auf seiner Pritsche. Der Beutel! Der kleine Lederbeutel, den er an sich genommen hatte! Aufgrund der Aufregungen und Sorgen hatte er ihn völlig vergessen. Sicher war dessen teuflischer Inhalt bereits der Grund für seine quälende Angst!
Unruhig nestelte er an seiner Kutte, die er wegen der Nachtkälte anbehalten hatte. Seine Hand ergriff etwas Warmes und Weiches.
Wie konnte der kleine schwarze Beutel so warm sein? Es war, als glühe etwas in seinem Inneren. Das konnte doch nur mit schwarzer Magie zu tun haben! Seine Finger ertasteten etwas Hartes, aber Filigranes im Inneren.
Ebenso furchtsam wie neugierig sah er sich um. Hier in seiner Zelle war es so dunkel, dass er lediglich ein paar Sterne im Nachthimmel durch das schmale Fenster sah. Entschlossen stand er nun auf und öffnete seine Zellentür. Er huschte auf den Gang in Richtung Westturm und gelangte über die Wendeltreppe in den Kräutergarten.
Der Mond schien hell und tausende Sterne blinkten vom Firmament. Man konnte ihn bereits riechen, den Frühling. Überall duftete es nach Kräutern und Blüten und in der noch kühlen Luft ließ sich eine tröstliche Wärme erahnen. Vorsichtig öffnete er den Beutel.
Das, was er hervorholte, hatte er nicht erwartet. Er hielt eine kleine, metallene Figur von silbrigem Glanz in den Händen. Es handelte sich offenkundig um eine schlanke, tanzende Frau, auf einem Bein stehend, das andere angewinkelt, die Arme leicht und grazil, aber doch voller Kraft erhoben. Auf ihrem Gesicht lag ein Lächeln … nicht höhnisch, sondern fröhlich, fast lachend, voll unbeschwerter Lebensfreude. Ihr Haar war zu einer kunstvollen Frisur geflochten, in die Blumen eingewoben waren, und ihr Gewand wogte um sie herum, als habe sie gerade eine Drehung vollführt. Alles wirkte so anmutig und sinnlich, dass jede Furcht von Martinus wich. Er war ganz bezaubert, so schön fand er sie. Ein warmes Gefühl breitete sich in ihm aus, das ihm bislang unbekannt war.
Andächtig verstaute er die kleine Figur wieder in dem Beutel und verbarg ihn sicher unter seiner Kutte, indem er ihn sich um den Hals hing wie ein Amulett – so, wie ihn auch der Ritter getragen hatte.
Pater Cyprianus hatte in der sonntäglichen Frühmesse wie üblich vom jüngsten Gericht gesprochen und alle der Hölle anempfohlen, die vom rechten Glauben abwichen, den Sünden der Hoffart, Wollust oder Ruhmsucht frönten und den Pfad der Demut und Frömmigkeit verließen. Sein kugelrunder Körper hatte vor Gottesfurcht nur so gebebt und sein dicker Kopf mit den schwabbelnden Backen vor hingebungsvoller Glut rot geleuchtet. Der weitere Morgen war dann wie gewohnt von Arbeit und Lehre beherrscht, obgleich am Tag des Herrn nur das Nötigste getan wurde – was aber schon viel genug war. Martinus war gerade dabei, die Holzscheite aufzustapeln, die Bruder George von Litchfield schwitzend und dampfend mit lautem Gekeuche und verbissener Inbrunst dabei war, mit einer gewaltigen Axt zu spalten, als ein Pochen an der Klosterpforte hörbar wurde. Es musste ein Fremder sein, denn es unterschied sich von dem kurzen Klopfen der Mitbrüder, die aus dem Wald oder von den Feldern kamen, erheblich: länger, kräftiger, ungeduldiger. Neugierig trat Martinus aus der Scheune. Bruder William, der Torwache hatte, unterhielt sich mit dem Ankömmling erst eine Weile durch die Torluke, wandte sich dann ratsuchend um und bedeutete Martinus, den er als ersten erspähte, Pater Adelmus zu holen.
»Ich bedaure aufrichtig, Euch keine bessere Kunde geben zu können.«
Martinus war wie versteinert. Der fremde Ritter war tot; Pater Adelmus hatte dies dem Fremden gerade mitgeteilt. Am Morgen noch schien es ihm besser zu gehen, auch wenn er das Bewusstsein noch nicht wiedererlangt hatte und das Fieber noch immer hoch war. Aber der ruhige, friedliche Atem des Kranken hatte Grund zur Hoffnung gegeben. Martinus spürte jetzt einen bleiernen Schmerz in sich aufsteigen, der seinen Magen ausfüllte wie zäher Kleister, sein Herz umkrampfte und ihm die Kehle zuschnürte. Seine Augen füllten sich mit Tränen. Er nahm kaum noch wahr, wie Pater Adelmus jetzt dem Fremden sehr bestimmt und energisch Einhalt gebot.
»Seine Krankheit erfordert die Verbrennung seines Leichnams«, sagte er nun, »bis dahin gilt unbedingte Quarantäne, um eine Epidemie zu verhindern. Wir können Euch nicht zu ihm lassen.«
Martinus’ Blick fiel jetzt zum ersten Mal durch die Luke auf den Besucher, und er erschrak. Das Antlitz des Fremden war bleich, lang und hager; seine eisfarbenen, schimmernden Augen lagen tief im Schatten starker, schwarzer Brauen, die an das gesträubte Fell von Wölfen erinnerten, und einer breiten, hohen Stirn, über der das wallende, pechschwarze Haar bis weit über die Schultern hinabfiel und das gespenstische Gesicht so umrahmte wie die Finsternis der Nacht den Mond. Zwischen der kräftigen, hervorragenden Nase und dem mächtigen Kinn befand sich ein merkwürdig kleiner Mund mit schmalen Lippen von blassem Violett, und wenn er sprach, wirkten seine langen Zähne wie das Gebiss eines Raubtieres aus grauer Vorzeit.
Der Fremde lächelte jetzt. »Ich bedaure, dass die Umstände Euch keine andere Wahl lassen« sagte er jetzt. »Dennoch muss ich darauf bestehen, zu einem späteren Zeitpunkt seinen Nachlass zu sichten.«
Martinus merkte erst jetzt, dass seine Stimme wie ein Krächzen klang – wie eine rostige Knarre.
»Er verfügt über keinen Nachlass. Alles, was er bei sich trug, wurde bereits dem Feuer übergeben; die Asche düngt bereits unseren Kräutergarten.«
»Aber vielleicht habt ihr etwas übersehen! Er besaß etwas, das mir gehört!«
»Alles, was er bei sich hatte, ist entweder verbrannt oder er hat es schon zuvor verloren«, gab Pater Adelmus zur Antwort.
»Es ist ein Talisman, der mir persönlich sehr am Herzen liegt! Er befindet sich in einem kleinen, schwarzen Lederbeutel, den der Ritter um den Hals trug!«
Martinus griff sich unmittelbar an seine Brust und spürte den filigranen Schatz unter seiner Kutte.
»Mir ist nichts dergleichen bekannt. Und seid gewiss, dass wir Diener unseres Herrn Jesus Christus sind und uns nichts aneignen, was uns nicht gehört.«
»Verzeiht, das wollte ich nicht sagen.«
»Sollten wir dennoch etwas finden, werden wir es aufbewahren. Möget ihr mich nun entschuldigen.«
»Habt Dank«, stieß der Fremde unzufrieden hervor.
Einen kurzen Augenblick begegneten sich Martinus Blick und der des Fremden. Es fühlte sich wie ein Eiszapfen, der das Herz durchdringt. Dann schloss Bruder William die Klappe.
Martinus eilte Pater Adelmus hinterher, der bereits wieder auf dem Weg ins Hospital war.
»Wann ist er denn gestorben?« fragte er flüsternd.
»Überhaupt nicht«, antwortete der Pater, nachdem er die Tür hinter sich geschlossen hatte.
Martinus war wie vom Donner gerührt.
»Er ist gar nicht tot?«
Seine Erleichterung war wie die Sommersonne nach einem Unwetter.
»Nein.«
»Ihr... ihr habt gelogen?« Martinus konnte es kaum fassen, dass Pater Adelmus vor seinen Augen gesündigt hatte.
»Genauso, wie du gestohlen hast.«
Martinus schnappte nach Luft.
»Ich habe nicht gestohlen!«
»Wo ist dann jener Talisman, den der Fremde begehrte? Du warst doch der erste, der dem Ritter begegnete. Einen Beutel, den man um den Hals trägt, verliert man schließlich nicht einfach, nicht wahr?«
Er schenkte sich genüsslich einen kleinen Becher Kräuterwein ein.