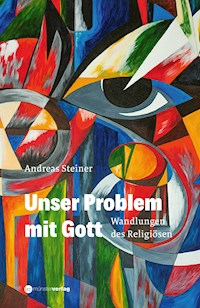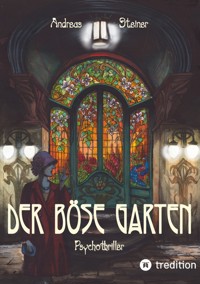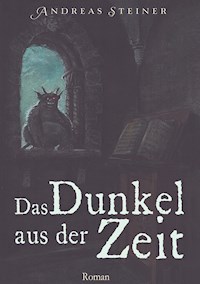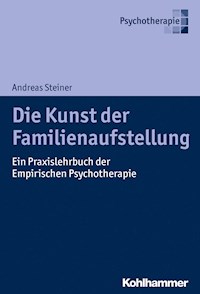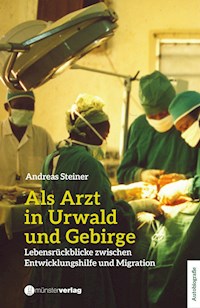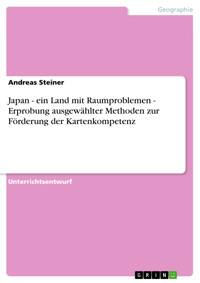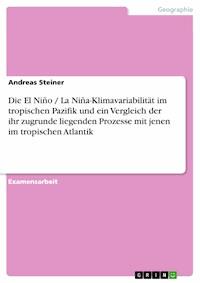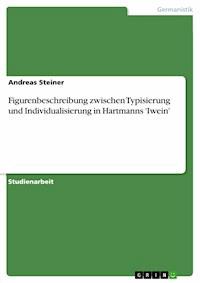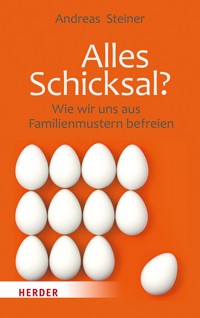
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Was haben Ernest Hemingway, John F. Kennedy oder Marylin Monroe gemeinsam? Sie alle waren gefangen in tragischen familiären Mustern, aus denen sie keinen Ausweg fanden. Ohne dass sich Menschen dessen bewusst sind, prägen solche Muster das Leben jedes einzelnen. Doch sind sie wirklich Schicksal? Pointiert und verständlich zeigt der Psychologe Andreas Steiner, wie man die eigenen Familienmuster erkennt und überwindet. Der Familientherapeut macht deutlich, dass die Ursachen keineswegs so mysteriös sind, wie sie scheinen und zeigt den Weg aus solchen Verstrickungen: die ehrliche, oft schmerzhafte, aber gleichzeitig spannende Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit und der eigenen Familiengeschichte. Dadurch wird nicht nur der einzelne Mensch von drückenden Problemen entlastet, sondern das ganze System kann gesund und künftige Generationen aus den zerstörerischen Mustern befreit werden. Diese wiederkehrenden Verhaltensweisen und Ähnlichkeiten sind oft völlig unvernünftig und führen ins Unglück. Und das, obwohl die Beteiligten wissen müssten, was geschieht und motiviert sein sollten, es anders zu machen: Die Ehe von einem Paar ist katastrophal. Der Mann schlägt die Frau, geht ständig fremd. Sie erträgt dies lange Jahre, schließlich verlässt er sie wegen einer anderen. Die gemeinsame Tochter, die selbst unter ihrem brutalen Vater gelitten hat, verliebt sich später in einen Mann, der sie ebenfalls schlägt und betrügt. Sollte nicht gerade sie es besser wissen? Das "Nicht-Bemerken" solcher Muster und Lebensmotive hat seinen Ursprung darin, dass Menschen den immensen unbewussten Anteil an allem, was sie tun und denken, nicht wahrhaben – und dies auch nicht wollen. Das evolutionär wichtige Bedürfnis nach Zugehörigkeit zur Familie hindert daran, kritisch hinter die Kulissen zu blicken. Doch durch die prägende Lebenszeit in der Familie ist jeder einzelne von Anfang an "vorprogrammiert". Der Mensch jedoch denkt, er sei frei und losgelöst von alten Bindungen. Das Buch ist eine spannende Reise zu den Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten des Lebens, es benennt die Ursachen vermeintlicher Familienschicksale, zeigt Wege aus den alten Familienmustern und macht deutlich: niemand ist seinem Schicksal ausgeliefert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreas Steiner
Alles Schicksal?
Wie wir uns aus Familienmustern befreien
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2020
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Verlag Herder
Umschlagmotiv: © ONiONAstudio/iStock/GettyImages
E-Book-Konvertierung: Carsten Klein, Torgau
ISBN E-Book 978-3-451-81951-3
ISBN Print 978-3-451-60090-6
Inhalt
Einleitung
Wie ein roter Faden
Die Wiederkehr von Früherem
Der Fluch der Kennedys
»Schicksalshafte« Muster
Der Mensch und sein Umfeld
Frei formbar oder genetisch festgelegt?
Das Lernen
Die Anziehungskraft des Vertrauten
Das Festhalten an vertrauten Mustern
Die bedrohte Männlichkeit: Ernest Hemingway
Das menschliche (Un-)Bewusstsein
Die Macht des Unbewussten
Menschlichkeit anstatt Göttlichkeit
Rationale Einsichten
Das innere Drehbuch
Gefühle
Primärgefühle
Angst
Ekel
Wut
Trauer
Freude
Begierde
Liebe und Bindung
Sekundärgefühle
Kindliche Gefühle
Fremdgefühle
Spirituelle Gefühle
Die Bedeutung von sozialen Systemen
Familie, Sippe, Clan, Gemeinschaft
Geborgenheit, Zugehörigkeit und Identität
Gruppendynamik
Ein Teil des größeren Ganzen
Unbewusste Lebensentwürfe
Das Fortführen von Themen
Tradierte Lebensformen
Schatten des Krieges
Hitlers Geist in heutiger Erziehung
Verarbeitung, Verdrängung, Verstrickung
Konstruktivismus
Falsche und echte Erinnerungen
Umdeuten unbequemer Wirklichkeit
Lüge und Bullshit
Familiengeheimnisse
Radikales Abspalten
Zweifel an berichteten Fakten
Krankheit und Gesundheit
Die psychiatrische Wirklichkeit
Alltag in psychiatrischen Einrichtungen
Das Streben nach Sühne
Gut und Böse
Radikalität
Das Gefühl von Schuld, ohne schuldig zu sein
Verdrängtes taucht wieder auf
Der Schaden durch vorgegebene Moral
System und Biografie
Schicksalhafte Ereignisse
Individuelle Motive und günstiges Umfeld: Jeanne d’Arc
Das Lebensthema steckt bereits in der Familiengeschichte
Das kindliche Weltbild
Gutes und schlechtes Gewissen
Kindliche Deutungen
Märchenhafte Wirklichkeiten
Das Scheitern an der Realität
Formen des Ausgleichs
Kindliche Illusionen
Die Tudors: Blut, Angst, Tragödie und Theater
Der Vater: Heinrich VIII.
Das Skriptmotiv als Fluch
Die Mutter: Anne Boleyn
Der Kampf um den Thron
Die Frau, die anders ist als alle anderen
Kompensation, Überkompensation und Zerrissenheit
Ruhm, Macht und Reichtum als Ersatz
Tragik als Antrieb: Ray Charles
Der tote Zwillingsbruder: Elvis Presley
Rächen
Rache als romantische Vorstellung
Bestrafung der Eltern
Übertragene Rache: Sadismus
Angst vor Erkenntnis
Rache als pathologische Ideologie: Adolf Hitler
Fortführen
Nachfolgen
Verkehren
Austilgen
Sühnen
Vertreten
Das Aufspüren seelischer Wirklichkeiten
Die Sherlock-Holmes-Methode
Skriptfiguren und Skriptgeschichten
Wie Lösungen funktionieren
Das Ordnen
Aussöhnung
Angemessenheit
Hindernisse
Heilende Reisen
Das Wesen von Lösungen
Verändern von Mustern
Über den Autor
Index
Einleitung
Erfahrung heißt gar nichts.
Man kann seine Sache
auch 35 Jahre schlecht machen.
Kurt Tucholsky
Wie ein roter Faden
Als ich ins Gymnasium kam, hatte ich einen Schulkameraden, der bald zum engen Freund wurde. Er hieß Kurt, war strohblond und sommersprossig, und wir teilten viele Interessen, lachten über ähnliche Witze, waren ähnlich emotional und hatten ähnliche Probleme. Wir lasen sogar die gleichen Comics. Man kann wirklich sagen: Wir waren richtig dicke Freunde.
Kurt wohnte damals mit seinen Eltern in einem kleinen Häuschen, das Teil einer Siedlung war, die die SPD einst hatte bauen lassen. Sein Vater war Busfahrer, der in seiner Freizeit Akkordeon spielte, seine Mutter Putzfrau, nette, einfache Leute, die sehr stolz darauf waren, dass ihr einziges Kind es bis aufs Gymnasium geschafft hatte. Erst viel später kam ich darauf, dass sie es womöglich auch gerne sahen, dass Kurt mich zum Freund hatte, weil ich aus einem Akademikerhaushalt stammte, denn solche Unterschiede spielten für mich nie eine Rolle. Ein einziges Mal nur sprach mich seine Mutter darauf an, dass sie erstaunt sei, mit welcher Ausdauer ich mich in Bücher vertiefen konnte.
Kurts Eltern erlaubten ihm sogar etwas, was meine Eltern niemals gemacht hätten: Die ganze Klasse durfte in ihrem Keller eine Klassenfete feiern. Der vermeintliche Höhepunkt war, dass sein Vater mit seinem Akkordeon hereinspazierte und uns den »Schneewalzer« und ähnliche Hits vorspielte. Dies war das erste Mal, dass einige sich anschließend über Kurt und seine Familie lustig machten.
Als wir etwa dreizehn Jahre alt waren und die siebte Stufe besuchten, begann sich Kurt eigenartig zu verändern. Ich merkte zunächst nichts davon, für mich blieb alles gleich. Bis zu einem normalen Schultag, der unsere Freundschaft abrupt beendete.
In dieser Zeit war es unter uns sehr beliebt, in der Pause Karten zu spielen. Einige Spezialisten spielten Skat; Vito, ein italienischer Mitschüler, hatte »Briscola« mitgebracht, dass mit einem Deck aus den klassischen Bildern Schwert, Stab, Münze und Kelch gespielt wurde und viel Spaß machte. Der große Renner aber wurde schließlich »Herzblättchen«, eine Art vereinfachter Skat, bei dem die Trumpffarbe Herz vorgegeben war, und mit dem wir viele Stunden zubrachten. Der Vorteil zum Skat war außerdem, dass man es nicht nur zu dritt, sondern auch zu viert oder fünft spielen konnte.
Kurt und ich waren so eine Art fester Bestandteil jeder Herzblättchen-Runde, und der dritte oder gar vierte Mann wechselte. An einem Tag trafen wir uns wie üblich zu dritt, nur dass Kurt diesmal zu dem freistehenden Tisch nur zwei Stühle stellte und offenbar größten Wert darauf legte, dass sie für ihn und den anderen Mitspieler seien. Ohne mich anzusehen, verkündete er ihm: »Andreas macht nicht mit. Wir spielen Sechsundsechzig.« – Ein Kartenspiel, das man nur zu zweit spielen kann.
Für mich wirkte das wie eine Ohrfeige, und ich vermute, so war es auch gemeint. Ich stand jedenfalls zunächst wie angewurzelt da. Der andere warf einen verschämten Blick zu mir und nahm folgsam die Karten entgegen, die Kurt verteilte. Ohne mich eines Blickes zu würdigen, begann er die Partie. Kurt wandte sich nach kurzer Zeit zu mir und fragte genervt, ob ich hier weiter herumstehen und glotzen wolle. Ich trottete wortlos fort. Später stellte ich ihn zur Rede. Er entgegnete betont blasiert: »Was hast du denn für Probleme?« Es wurde eine sehr unerfreuliche Unterhaltung, an deren Ende er mich als »geistigen Tiefflieger« bezeichnete.
Seitdem kamen von ihm fast nur noch abfällige oder stichelnde Bemerkungen, und ich muss zugeben, ich hielt ihn bald für den größten Vollidioten aller Zeiten und versäumte es nicht, ihm das mitzuteilen. Er schien Ähnliches von mir zu denken. Ein paarmal prügelten wir uns sogar. Er freute sich unmissverständlich, wenn mir etwas im Unterricht misslang, und amüsierte sich köstlich, wenn Karl, der Schlägertyp der Klasse, mir mal wieder meine Saftflasche ausgesoffen hatte, was nach dem schweißtreibenden Sportunterricht geradezu qualvoll war. Gottlob hatte ich noch ein paar andere Freunde in der Klasse.
Dann bekamen wir einen neuen Mitschüler, Heiko, mit dem ich mich gut verstand. Die meiste Freizeit verbrachte ich künftig mit ihm, sodass ich den Verlust von Kurts Freundschaft bald einigermaßen verschmerzt hatte. Ich erinnere mich noch gut an einen Moment, wo wir auf dem Schulhof etwa zu sechst zusammenstanden, und die Sprache irgendwie auf Kurt kam.
Heiko, mit seinen vierzehn Jahren schon sehr dem Zynismus zugetan, schürzte spöttisch seine Lippen. »Der Jo-Kurt!« – er nannte ihn so wegen seiner weißlichen Gesichtsfarbe – »Tja ... der ist ja nicht sehr beliebt.« In diesem Augenblick wurde mir etwas bewusst, was sich später noch deutlicher abzeichnete: Kurt hatte sich in der ganzen Klasse völlig isoliert. Niemand wollte mit ihm etwas zu tun haben. Er hatte alle vor den Kopf gestoßen, beleidigt, oder sich durch flapsige Bemerkungen lächerlich gemacht. Heutige Schüler würden ihn »extrem uncool« nennen. In den Pausen schlich er alleine über den Schulhof oder war überhaupt nicht mehr zu sehen. Im Unterricht wirkte er ernst und unnahbar und würdigte niemanden eines Blickes, was die meisten als arrogant deuteten. Karl trat ihm mehrmals bei Gelegenheit in den Schritt und machte sich über den »kleinen Schniedel« lustig, den er beim Umkleiden nach dem Sport an ihm gesehen haben wollte. Heiko stellte angeekelt fest, Jo-Kurt stinke nach Klopapier. Das war noch nicht einmal ganz falsch – Kurt begann tatsächlich, ungepflegt und verlottert auszusehen.
Besonders zum Gespött machte Kurt sich, als er sich ein Outfit zulegte, das später mit Manta-Fahrern assoziiert wurde: Fuchsschwanz, Cowboystiefel, Goldkettchen, Vokuhila-Frisur, wogegen diejenigen, die sich für »vornehmer« hielten, zunehmend dem damaligen Popper-Outfit anhingen: Lacoste-Pullunder, Karottenhose, Stulpen, weiße Turnschuhe, schmaler Schlips, lange Haartolle, ausrasierter Nacken. Die Lieblingsspottobjekte der pubertierenden Angeberelite waren damals die »Prolos«, also genau das, was Kurt repräsentierte.
Kurt wurde schlecht im Unterricht, was ihm den Ruf einbrachte »nicht der Hellste« oder der »Klassendepp« zu sein. Irgendwann blieb er sitzen und musste die Stufe wiederholen. Er hatte schon sehr früh eine Freundin, viel früher als alle anderen von uns, und man konnte die beiden beobachten, wie sie in den Pausen Seite an Seite die Runde machten. Für uns alle stand fest, dass es sich um das hässlichste Mädchen handelte, das wir je gesehen hatten. In Wirklichkeit war sie überhaupt nicht hässlich; wir wollten sie nur unbedingt hässlich finden. Ich kann mich nur schütteln, wenn ich daran denke, was wir damals für einen destruktiven Schwachsinn geredet haben. Ich habe mitgequatscht. Die rücksichtslose Arroganz der Fünfzehnjährigen ist oft unerträglich.
Irgendwann – womöglich nach Abschluss der mittleren Reife, keiner wusste es – verließ Kurt die Schule; er war jedenfalls eines Tages weg. Wir merkten es erst nach längerer Zeit, denn er spielte in unserer Wahrnehmung kaum noch eine Rolle. Jahre später erfuhr ich, dass er sich umgebracht hat. Er sprang von einem Hochhaus, kurz vor seinem zwanzigsten Geburtstag. Ich fand seine Todesanzeige später im Internet. »Der harte Kampf ist nun zu Ende, du bist erlöst von deinem Schmerz« stand darauf.
Verdammt, Kurt. War das nötig? Ich habe dich mal so gerngehabt! Was war nur in dich gefahren? Warum nur hast du es allen so schwer gemacht, dich zu mögen? Warum hast du alle, die dich liebten, so weggestoßen? Wieso warst du so ein Idiot?
Kurts Werdegang erschien mir wie der praktizierte Leitfaden »Wie vergraule ich mir meine Mitmenschen – nachhaltig, endgültig, schnell – wie Sie garantiert von jedem für ein Arschloch gehalten werden.« Ein Psychiater würde bei ihm wahrscheinlich eine Depression diagnostizieren, die sich chronifiziert habe.
Aber das trifft den Kern der Sache nicht wirklich. Viel später, als ich Psychotherapeut wurde, begegnete mir das Thema der seelischen Skripten, ein Konzept von Eric Berne.1 Der bedeutende Begründer der Transaktionsanalyse hatte erkannt, dass Menschen einen unbewussten Vorentwurf für sich und ihr Leben haben, also ein inneres Bild davon, wie sie selbst sind und wie das Leben verlaufen wird. Berne nannte das »Script«, was auf Amerikanisch so viel wie Drehbuch bedeutet. Dies bezieht sich nicht nur auf eine Symptomatik in Form einer Stimmung wie etwa eine Depression oder eine permanente Unruhe, sondern auch auf konkrete Inhalte wie Partnerwahl, beruflicher Werdegang, persönliche Freiheiten oder das Verfolgen von Zielen – oder das Scheitern. In Kurts Fall war es wohl das Leben eines verachteten Außenseiters.
Es gibt auch positive Skripte: der erstgeborene Wunschsohn, der völlig selbstverständlich später Bankdirektor wird, weil er in seiner ganzen Kindheit größtenteils nur von seinen Eltern vermittelt bekam, wie toll er ist, oder die Prinzessin, die schon immer Papas Liebling war und auch später noch mit Leichtigkeit Männer findet, die alles für sie tun. Das Leben wird größtenteils unbewusst so gestaltet, wie es dem eigenen inneren Bild entspricht. Wer »weiß«, dass er ganz toll ist, zu dem passt beruflicher Erfolg bzw. für eine Prinzessin ist es absolut stimmig, dass andere ihr den Hintern nachtragen.
Für Psychotherapeuten wird dies natürlich dann relevant, wenn Menschen offenkundig systematisch Pläne verfolgen, die sie ins Unglück führen, die ihre Ressourcen nicht nutzen oder abseits ihrer eigenen Bedürfnisse agieren. Es gibt Menschen, denen scheint das Unglück regelrecht an der Schuhsohle zu kleben. Andere verfallen bei der Partnerwahl mit tödlicher Sicherheit immer auf den gleichen problematischen Typus. Andere sind – ohne ersichtlichen optischen Grund – felsenfest von ihrer Hässlichkeit überzeugt und wehren sich mit Händen und Füßen gegen jedes Kompliment. Andere wiederum verhindern trotz hoher Intelligenz systematisch jeden Erfolg, der zu passieren droht. Viele dieser Menschen fragen sich irgendwann: »Warum passiert immer mir das?« oder »Warum passiert mir immer das Gleiche?« und wundern sich, dass sie es doch besser hätten wissen müssen. Viele verurteilen sich sogar dafür, dass sie wieder einmal »zu blöd« dafür waren, den immer gleichen Fehler rechtzeitig zu erkennen und entsprechend etwas zu verändern.
Menschen, die zur Psychotherapie kommen, haben daher oft eine deutlich tiefere Einsicht als solche, die es dringend nötig hätten, die Möglichkeit einer Psychotherapie aber weit von sich weisen. Letztere leiden oft auch, können das aber nicht zugeben, weil sie sich nicht trauen, die Hintergründe ihrer Probleme anzuschauen bzw. etwas in ihrem Leben zu verändern. Oft wird die Ansicht kundgetan, dass Psychotherapie sowieso totaler Quatsch ist, dass man doch nicht verrückt sei oder schlicht, dass doch alles in schönster Ordnung ist. Es gibt Leute, die sich lieber umbringen, als sich helfen zu lassen, oder die lieber an einem Magengeschwür sterben. Oder aber es steht nicht in ihrem Drehbuch, sich helfen zu lassen.
In den Psychotherapien wird folglich versucht, diese zerstörerischen oder belastenden Pläne bewusst zu machen und natürlich entsprechend zu verändern. Die »Heilung« erfolgt, wenn der Mensch sich endlich traut, gegen sein problematisches Skript zu verstoßen, also etwas bewusst und absichtlich zu tun, was er bislang noch nie getan hat – und damit einen neuen Weg einschlägt.
Bernes Beschreibungen erinnerten mich an Kurt, meinen toten, ehemaligen Freund, der es sich so dermaßen systematisch mit allen seinen Mitmenschen verscherzt hatte, dass er zum Schluss keinen Ausweg mehr wusste. Wahrscheinlich gehörte es zu Kurts Skript auch dazu, sich keine Hilfe zu suchen und eben nicht zu erkennen, dass er etwas für sich tun müsste.
Entscheidend ist nun, dass solche Prozesse nicht nur unbewusst ablaufen, sondern eine Art Vorbereitung erfahren, die oft mehrere Generationen zurückreicht.
Die Wiederkehr von Früherem
Stellen Sie sich einmal vor, Sie sind weiblich, 39 Jahre alt, glücklich verheiratet und haben drei Kinder. Sie arbeiten in einem einträglichen Job, sagen wir mal: als Rechtsanwältin. Und ganz und gar unerwartet geraten sie in eine Lebenskrise: Plötzlich scheint alles »falsch« zu sein: Ihr Job, Ihr Mann, Ihre Familie. Alles macht plötzlich irgendwie Angst, ist zu viel, nimmt Ihnen die Luft, obwohl es keinerlei Grund dafür gibt; Ihre Partnerschaft ist harmonisch und liebevoll, die Kinder mögen zwar manchmal nerven, aber sie sind trotzdem süß und ihr ganzer Stolz. Der Job ist gut und interessant, und das Geld stimmt auch. Und trotzdem schreit eine immer lauter werdende innere Stimme: »Ich muss raus hier!«
Sie suchen sich Rat – erst bei Freunden, die alle nach Gründen für Ihren Zustand suchen. Ist Ihr Beruf wirklich der Richtige für Sie? Sind Sie überfordert, haben Sie einen Burn-out oder sind Sie unzufrieden? Ist wirklich mit Ihrer Partnerschaft alles in Ordnung? Leben Sie Ihr Leben so, wie Sie es wollen, oder sind Sie insgeheim unglücklich?
Da nichts davon zuzutreffen scheint, gehen Sie zu einem Psychiater. Der diagnostiziert eine Depression und verschreibt Ihnen ein Antidepressivum. Aber das behagt Ihnen gar nicht, zumal man davon dick wird und die Libido in den Keller geht, von den Konzentrationsstörungen ganz zu schweigen. Das können Sie wirklich nicht gebrauchen.
Sie überlegen, ob Sie Ihr Leben ändern sollten. Vielleicht nochmal studieren? Vielleicht Astronomie! Das hat Ihnen doch als kleines Mädchen schon so gut gefallen. Oder Sie machen eine Schreinerausbildung. Das Arbeiten mit Holz ist doch etwas Handfestes, nicht so unkonkret wie die verdammte Juristerei. Oder sollten Sie nach Spanien auswandern? Eine alleinstehende Freundin gibt Ihnen zu bedenken, ob es nicht besser wäre, sich von Ihrem Mann zu trennen. Und schließlich gibt Ihnen ein etwas verrückter Freund einen Tipp: Sie sollten doch einmal Ahnenforschung betreiben. Manchmal gebe es so eine unheimliche Wiederkehr von Lebensmustern. So als ob eine Art Macht des Schicksals uns alle steuern würde, und die dafür sorgt, dass sich bestimmte Lebensmuster immer wieder wiederholen, quer durch die Generationen.
Ein Verstandesmensch wie Sie ordnet das natürlich sofort als Spinnerei ein. Eine Art Karma? So ein Blödsinn! Allerdings hat ein Teil von Ihnen ein wenig Feuer gefangen. Familienforschung ist ja schließlich spannend, so oder so. Dabei fällt Ihnen auf, dass Sie über Ihre Familiengeschichte eigentlich gar nicht so viel Informationen haben. Ein Anlass, Ihre Eltern mal wieder zu besuchen.
Dort wird es ein einerseits netter, andererseits kontroverser Abend. Während Ihre sonst so verschlossene Mutter auftaut und viel und gerne von ihren Eltern und Großeltern erzählt, hält sich Ihr Vater eher bedeckt. Plötzlich hat er etwas in der Garage zu tun oder klinkt sich aus einem anderen Grund aus der Unterhaltung aus. Dabei fällt Ihnen auf, dass Sie ganz besonders von diesem Familienzweig kaum etwas wissen. Die Mutter Ihres Vaters haben Sie als einzigen der Großeltern nie kennengelernt. Und gerade über die will Ihr Vater partout nichts erzählen. Das macht Sie irgendwie stutzig.
Wie fast in jeder Familie gibt es auch in Ihrer eine schwatzhafte Großtante, die über so ziemlich alles Bescheid weiß. Sie freut sich, dass sie von Ihnen, ihrer Großnichte, Besuch bekommt. Und sie weiß zu erzählen, dass Ihre Großmutter (eben jene Mutter Ihres Vaters) sich umgebracht hat – mit 39 Jahren. Ein Ereignis, dass in der Familie stets ängstlich verschwiegen wurde. Natürlich ist das nur Zufall, ganz klar. Auch, dass diese Großmutter in ihrer Freizeit Gedichte geschrieben hat, genau wie Sie. Aber das machen ja alle. Also nichts Besonderes.
Und dann hatte sie noch diese Eigenart … (ungewöhnlich für eine Frau, besonders damals), abends auf dem Balkon eine Zigarre zu rauchen, einmal im Monat. Genau wie Sie.
Zufall?
Der Fluch der Kennedys
Die unheimliche Wiederkehr solch dramatischer Lebensmuster lässt sich fast in jedem Familiensystem beobachten. Nicht immer machen sie sich so präzise an einer Jahreszahl oder einem Lebensalter fest. Oft sind es vor allem wiederkehrende Lebensmotive, die bestimmte Entwicklungen vorgeben (wie z. B. den Impuls, in einem bestimmten Lebensalter plötzlich sein Leben verändern zu müssen) oder verbieten (wie z. B. Erfolg, der nicht stattfinden will). Dazu gibt es viele berühmte Beispiele, wie etwa den sogenannten Fluch der Kennedys. In dieser Familie passieren ständig spektakuläre Unglücke wie spektakuläre Erfolge – vorwiegend bei den Männern, die sich durch extremen Ehrgeiz und exzessiven Lebensstil auszeichnen, verbunden mit dem Verbot, Schwäche zu zeigen. Viele von ihnen starben durch Leichtsinn oder brachten sich und andere übermäßig in Gefahr.
Die Norm der eisernen Stärke begann durch die strenge Erziehung von Joseph »Joe« Kennedy sen. Aus einer armen irischen Einwandererfamilie stammend, brachte er es bis zum Diplomaten – und für ihn stand fest, dass einer seiner Söhne Präsident zu werden habe. Die Tragödien nahmen ihren Anfang, als Rosemary Kennedy, John F. Kennedys Schwester, auf Initiative des Vaters Joe lobotomiert wurde. Dies ist ein hirnchirurgischer, irreversibler Eingriff, bei dem der Hypophysenvorderlappen des Gehirns durchtrennt wird – danach sind die Patienten quasi schwerbehindert und sitzen nur noch apathisch im Sessel.
Was hatte Rosemary getan? Sie war »retardiert« – nach Eindruck des Vaters geistig zu langsam. Prompt wurde sie entsorgt – für immer. So ging man mit Menschen in dieser Familie um, die eine Form von Schwäche zeigten. Ab da ging es tragisch weiter, immer extrem. Der älteste Sohn, Joe jr., starb als Flieger im Zweiten Weltkrieg – er hatte sich »freiwillig« für eine gefährliche Mission gemeldet. Der nächste Sohn war dann an der Reihe. John Fitzgerald Kennedy war schwer krank. Er litt an einer Autoimmunkrankheit, an einer chronischen Darmentzündung, Knochenerweichung, war nierenkrank und hatte ständig Schmerzen, ging aber dennoch zum Militär – bloß keine Schwäche! Permanent musste er starke Tabletten nehmen. Wie sein Vater war er ein pathologischer Schürzenjäger; viele seiner Liebschaften teilte er sich sogar mit seinem Bruder Robert (u. a. Marilyn Monroe). Beide Brüder wurden später erschossen. Edward, der jüngste der Kennedy-Brüder, verursachte – vermutlich betrunken – einen schweren Autounfall, bei dem seine Beifahrerin jämmerlich ertrank. John F. Kennedys Frau Jaqueline erlitt zahlreiche Fehlgeburten, darunter zwei Totgeburten – verursacht vermutlich durch Chlamydien, mit der ihr Mann sie durch seine ständigen Sexaffären angesteckt hatte.
Diese unselige Tradition wurde in der nächsten Generation fortgeführt – und zwar ausschließlich bei den Männern. Die Frauen der Kennedys sind einigermaßen unauffällig, vermutlich weil die extremen Erwartungen vornehmlich bei den Männern liegen. John-John, John F. Kennedys einziger Sohn, musste unbedingt bei einem Tornado Flugzeug fliegen und riss bei seinem Absturz seine Frau und seine Schwägerin mit in den Tod. Joe, Robert Kennedys ältester Sohn, verursachte einen schweren Autounfall, bei dem seine Beifahrerin querschnittgelähmt wurde. David, ein weiterer Sohn Robert Kennedys, setzte sich den goldenen Schuss. Michael, wiederum ein Sohn Roberts, hatte ein sexuelles Verhältnis mit einer Dreizehnjährigen; später starb er, weil er in einem Schneesturm Skifahren war und verunglückte. William Smith, ein Sohn Jean Kennedy Smiths, wurde der Vergewaltigung angeklagt. Edward jun., der ältere Sohn Edward »Ted« Kennedys, erkrankte an Krebs, ihm musste ein Bein amputiert werden. Sein jüngerer Bruder Patrick verursachte einen schweren Verkehrsunfall, im gleichen Alter wie sein Vater damals – und auch betrunken. Ständig waren Drogen und Alkohol im Spiel. All diese Männer sorgten so dafür, dass sich tragische Ereignisse in jeder Generation wiederholten.
»Schicksalshafte« Muster
Die wiederkehrenden Motive sind nicht zwangsläufig negativ; auch Erfolge, positive Umbrüche, plötzliche Entlastungen (so, als würde ein »Fluch« aufhören zu wirken) gibt es – oder auch eine besondere Kraft, die ein Mensch in sich trägt. Für Psychotherapeuten ist es natürlich die dramatische Variante, die sie auf den Plan ruft; schließlich leiden Betroffene darunter, fühlen sich eingeengt oder bleiben völlig unter ihren Möglichkeiten. Daher stellt sich dann die Frage: Wie stellen wir diese Muster fest? Wie lassen sie sich verstehen? Und natürlich: Wie kann man sie verändern oder sogar auflösen?
In diesem Buch werden daher Bedingungen und Gründe für die Entstehung solch »schicksalhafter« Muster genau beschrieben, wie sie zur Entfaltung kommen und warum sie aufrechterhalten werden. Und da es natürlich um Lösungen gehen soll, enthält es auch Anleitungen und Beschreibungen von Techniken, sie bei sich selbst zu erkennen, und was Sie tun können, um sie aufzulösen. Das kann natürlich keine professionelle Psychotherapie ersetzen. Aber selbst dann gilt: Ein unbewusster Teil Ihrer Persönlichkeit wird sich von diesen Lebensmotiven nicht trennen wollen und wird sie mit Zähnen und Klauen verteidigen.
1 Berne, Eric: Was sagen Sie, nachdem Sie »Guten Tag« gesagt haben? Psychologie menschlichen Verhaltens. München 1975
Der Mensch und sein Umfeld
Schicksal, das wusste er jetzt,
kam nicht von irgendwo her,
es wuchs im eigenen Innern.
Hermann Hesse
Die Fragen, die sich Psychologen schon immer gestellt haben, sind die: Wie erhalten und speichern Menschen Informationen? Warum reagieren verschiedene Menschen auf die gleichen Reize unterschiedlich? Und natürlich: Warum tun Menschen, die ja zu intelligentem, einsichtsfähigem, vorausschauendem Handeln fähig sind, lauter Dinge, die unvernünftig, schädlich, ja manchmal geradezu hirnrissig sind? Dies ist eine Frage, die vor allem Psychotherapeuten beschäftigt.
Frei formbar oder genetisch festgelegt?
Zunächst können wir feststellen, dass Menschen schon bei der Geburt individuell und einzigartig sind. Diese Erkenntnis ist nicht unbedingt selbstverständlich. Noch in den dreißiger Jahren waren viele Experten wie der Amerikaner John B. Watson davon überzeugt, dass Menschen bei der Geburt ein vollkommen unbeschriebenes Blatt sind, aus denen so ziemlich alles werden könnte. Man glaubte sozusagen, dass biologische Grundgegebenheiten, Veranlagungen etc. für seelische und intelligente Abläufe keine Bedeutung haben.1 Das war keine naturwissenschaftliche Erkenntnis, sondern hatte eher das Niveau eines religiösen Glaubens, auch wenn Watson dies durch ein ebenso fragwürdiges wie unethisches Experiment zu belegen versucht hat.
Später ging die Auffassung in genau die entgegengesetzte Richtung. Vor allem die Studien an eineiigen Zwillingen von Cyril Burt, der sich vornehmlich mit der Erforschung von Intelligenz befasste, legten nahe, dass etwa 85 Prozent der menschlichen Eigenschaften ererbt seien (beim Thema Intelligenz glaubte Burt an nahezu 100 Prozent Vererbung).2 Mehrere seiner Schüler wie Hans-Jürgen Eysenck übernahmen seine Lehren und bauten ihre Forschungen darauf auf. Nach Burts Tod kam heraus, dass Burts besagte Studien ziemlich plumpe Fälschungen waren.3 Er hatte wahrscheinlich den größten Teil dieser »Forschungen« komplett erfunden. Das hat alles wieder relativiert; so manches »wissenschaftlich fundierte« Gedankengebäude krachte dadurch zusammen. Heutzutage ist man vorsichtiger und geht von einer Vererbung von etwa 50 Prozent oder etwas mehr aus, ohne dass man sich auf genaue Zahlen festlegen könnte.
Gut nachgewiesen ist dagegen, dass Individuen zu Lernprozessen fähig sind, die sie befähigen, sich auf die Gegebenheiten, Gefahren und Notwendigkeiten des Lebens einzustellen und das Leben somit besser bewältigen können. Diese grundlegende Fähigkeit ist mit Sicherheit ererbt und gilt für Tiere wie für Menschen. Es ist sogar nachgewiesen, dass bereits Embryos im Mutterleib lernen. Da es dort dunkel ist, sind diese ersten Lernprozesse vor allem akustischer Natur; Embryos reagieren auf Musik und Sprache, und man vermutet, dass dies bereits wichtige Grundlagen für die spätere intellektuelle Entwicklung schafft. Auch der Tastsinn, Geruchs- und Geschmackssinn ist vorgeburtlich bereits aktiv. Vor allem aber reagieren Embryos auch auf Stress, was nahelegt, dass bereits ungeborene Kinder an Problemen teilhaben, negative Stimmungen und ängstliche Erregung spüren und daher schon bei der Geburt in gewisser Weise vorprogrammiert sind.4
Das Lernen
Das Wahrnehmen von Reizen setzt sich nach der Geburt naturgemäß fort, zumal sich Sinnesorgane und die dazugehörigen Bereiche des Gehirns entsprechend entwickeln. Jede Art von Lernen erzeugt Spuren im Gedächtnis, alles wird differenzierter, nuancenreicher, vielschichtiger. Je mehr man weiß, desto mehr nimmt man auch wahr. Es ist sogar so, dass ein bestimmtes Level an Stress (der durchaus positiv, weil anregend sein kann) Aufmerksamkeit, Neugierde und Informationsverarbeitung steigert.
Das erste bedeutende Experiment zum Lernen war von dem russischen Arzt Ivan Pavlov, der 1905 nachwies, dass sich verschiedene, zur selben Zeit auftretende Reize miteinander verbinden. In seinem Experiment präsentierte er einem Hund gleichzeitig mit einem Knochen einen Glockenklang, der an sich für einen Hund uninteressant ist. Mit der Zeit lernte der Hund, dass der Glockenschlag das begehrte Fressen ankündigte. Schließlich genügte das Anschlagen der Glocke, um den bei ihm typischen Speichelfluss bei bevorstehendem Fressen auszulösen. Die beiden Reize waren miteinander verschmolzen. Diese Art des Lernens wird als »klassische Konditionierung« bezeichnet.
Pavlov hat seine Experimente weiter fortgesetzt und machte 1927 eine weitere bemerkenswerte Entdeckung: Er injizierte einem Hund Morphium, wodurch sich der Hund übergeben musste. Als er dem Hund jedoch nur Kochsalz, also eine völlig harmlose, körpereigene Substanz spritzte, übergab sich der Hund ebenfalls. Er hatte gelernt, dass auf die Spritze Übelkeit mit Übergeben folgte, und »dachte« folglich, dass auch diese (in Wirklichkeit harmlose) Spritze das Gleiche bewirken müsse. Dies war das erste Mal, dass nachgewiesen wurde, dass eine bloße Vorstellung ausreicht, um starke (körperliche) Reaktionen zu zeigen.5
Ein weiterer bedeutender Pionier der Lernpsychologie war der Amerikaner B. Frederic Skinner, der das operante Lernen nachgewiesen hat.6 Demnach zeigen Individuen ein ursprünglich zufälliges Verhalten umso häufiger, je mehr, direkter, zeitlich unmittelbarer und kontinuierlicher es belohnt wird. Ratten, die in eine Kiste gesetzt wurden (die berühmte »Skinner-Box«), bekamen immer dann eine Portion Futter, wenn sie zufällig an einen Hebel stießen, der dort angebracht war. Nun interessieren sich Ratten nicht für Hebel, für Futter aber umso mehr. Als die Tiere aber begriffen, dass der Hebel etwas mit Futter zu tun hat, wurde er extrem interessant. Sie begannen, wie wild den Hebel zu drücken, den sie kurz zuvor noch völlig ignoriert hatten.
Skinner stellte, nachdem die Ratten das Hebeldrücken gelernt hatten, die Belohnung ein. Die Ratten bekamen nichts mehr, und stellten also fest, dass der Hebel seine Bedeutung eingebüßt hatte. Entsprechend änderten sie ihr Verhalten wieder, hörten auf, den Hebel zu drücken und liefen schließlich wieder genauso in der Box umher wie am Anfang. Das Verhalten war durch »Nicht-Verstärkung« wieder gelöscht worden.
Skinner hat sein Experiment insofern variiert, als dass er die Belohnung bei verschiedenen Ratten in Form von Quoten verabreichte. Einige bekamen ihr Futter erst, wenn sie den Hebel zweimal gedrückt hatten, einige erst nach dem vierten Mal, einige gar erst nach dem zehnten Mal. Das Ergebnis: Die Tiere brauchten jeweils länger, um den Zusammenhang zu begreifen. Das Interessante war nun, dass sich die Ratten in der Phase der Löschung, also, als sie nichts mehr bekamen, auch unterschiedlich verhielten. Die Ratten, die immer, also nach jedem Drücken, ihr Futter bekommen hatten, gaben als erste auf. Bei den anderen dauerte es deutlich länger, und am löschungsresistentesten erwiesen sich diejenigen, die nur jedes zehnte Mal belohnt worden waren. Sie versuchten es auch nach etlichen fruchtlosen Anstrengungen immer wieder – weil sie ja mitgelernt hatten, dass es sich lohnt, hartnäckig zu sein!
In der Lernforschung sind die Arbeiten Skinners auf vielfältige Weise fortgeführt und weiter differenziert worden. Neben der Verstärkung durch Belohnung zeigte sich auch, dass das Abstellen eines (erwarteten) negativen Effektes als Belohnung (bzw. Erleichterung) empfunden wird und daher einen ähnlichen Effekt hat, etwa wenn die Versuchstiere lernten, einen unangenehmen Ton oder schmerzhaften Elektroschock durch spezifisches Verhalten abzustellen. Dieses Vermeiden hat sich gerade bei menschlichem Verhalten als ein äußerst tückisches Prinzip erwiesen. Es gibt Menschen, die Vermeidung als zentrales Lebensprinzip entwickeln und überhaupt nichts mehr tun oder ihr Zimmer nicht mehr verlassen.
Auch dies kann noch zusätzlich gelernt worden sein. Der amerikanische Psychologe Martin Seligman hat in einem ziemlich grausamen Experiment nachgewiesen, dass »Hilflosigkeit« ebenfalls erlernt werden kann. Er hielt Hunde in einem Käfig, dessen metallener Boden unter elektrische Spannung gesetzt werden konnte. Dies ist für die Tiere äußerst schmerzhaft. Sie hatten aber die Möglichkeit, in einen anderen Käfig zu entkommen, der ungefährlich war, und lernten so, sich in Sicherheit zu bringen. Einige Hunde wurden daraufhin in ein Gestell eingespannt, das ihnen die Flucht unmöglich machte. Sie mussten die Elektroschocks hilflos ertragen. Als sie dann wieder freigelassen wurden, zeigten sie ein völlig apathisches Verhalten und blieben in dem Käfig liegen, als die elektrische Spannung wieder angestellt wurde. Sie hatten aufgegeben, resigniert und taten nichts mehr – weil sie gelernt hatten, dass ihr Tun nichts nützt. Daher nimmt man an, dass eine wichtige Lerngrundlage für Depressionen solche Prozesse sind, also andauernde Situationen, wo der Betroffene gelernt hat, dass er nichts tun kann.
Es ist immer wieder kritisiert worden, Prinzipien, die man an Tieren erforscht hat, auf den Menschen zu übertragen. In der Tat ist die menschliche (Lern-)Wirklichkeit oft komplexer als bei Ratten oder Hunden. Auch die von den Lernforschern angenommene Löschung existiert wahrscheinlich nicht, weil jede Art von Lernen gespeichert wird. Dennoch gilt als unbestritten, dass Lerneffekte entscheidenden Einfluss auf die menschliche Psyche haben. Kinder, die viel Aufmerksamkeit bekommen, sind motivierter als Kinder, die alles Mögliche machen, ohne dass sich einer der Eltern dafür interessiert. Kinder, die Angst vor Bestrafung haben, weil sie strenge oder cholerische, unbeherrschte Eltern haben, lernen womöglich, durch Lügen (zum Beispiel Fälschen von Zeugnisnoten) Schlägen zu entgehen. Aber selbst Bestrafungen können einen positiven Effekt haben, weil sie für Kinder weniger schlimm sind, als überhaupt keine Reaktion der Bezugspersonen zu bekommen, insbesondere dann, wenn sie sich zu vernachlässigt fühlen und Symptome produzieren, die die Eltern dann zwingen, sich mit ihnen zu beschäftigen, wie Einnässen, Herumschreien, Demolieren von Gegenständen – kurz: allem, was sich eignet, um Effekte zu erzielen. Lerneffekte dieser Art können sich bis weit ins Erwachsenenalter hineinziehen und ein Teil des Lebensstiles werden.
Besonders wichtig, gerade für das Verstehen von Psychodynamiken in Familiensystemen, ist die Entdeckung des Bobachtungslernens7 durch Albert Bandura. Es besagt, dass Menschen dadurch, dass sie Verhalten und Effekte bei anderen modellhaft beobachten, ebenfalls lernen, ohne dieses Verhalten selbst durchgeführt haben zu müssen. Man weiß also etwas, ohne es erlebt zu haben. Dadurch wurde erstmalig begreifbar, dass Wissen und Erfahrung nicht unbedingt auf persönliche Lebenserfahrungen zurückgeführt werden können, sondern regelrecht abgeschaut werden. Diese Effekte werden uns im weiteren Verlauf dieses Buches noch oft begegnen.
Insgesamt können wir festhalten, dass alles, was Menschen wissen und können auf Lernprozesse zurückgeht. Aber leider sind damit auch viele Probleme, wiederkehrende Muster und problematische Selbstbilder ebenfalls gelernt. Die persönliche, subjektive Wirklichkeit ist immer selektiv, d. h., jeder Mensch nimmt in erster Linie das wahr, was er kennt. Unbekanntes wird tendenziell ausgeblendet. Innere Bilder und Vorstellungen vom eigenen Selbst, dem eigenen Leben, der Menschheit und der Welt wirken gewissermaßen wie ein Filter, der nur das Bekannte hindurchlässt. Dadurch werden einmal gelernte Muster immer wiederholt, gefestigt und aufrechterhalten. Zu diesen Phänomenen gehört auch, dass der Mensch selbst von seinen problematischen, einschränkenden, ja manchmal quälenden, destruktiven Mustern nichts mitbekommt, obwohl er an sich intelligent genug wäre, sie zu erkennen und zu verändern.
1 Watson, John B. (1930): Behaviorism. Revised ed. Chicago: University of Chicago Press
2 Burt, Cyril L. (1966): The Genetic Determination of Differences in Intelligence: A Study of Monozygotic Twins Reared Together and Apart. British Journal of Psychology. 57 (1–2): S. 137–153
3 Kamin, Leon (1974): The Science and Politics of IQ. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates
4 Huttunen, Matti O. (1989): Maternal Stress during Pregnancy and the Behavior of the Offspring. In: Doxiadis, Spyros et. al.: Early Influences Shaping The Individual. New York: Plenum Press, S. 175–182
5 Vgl. Shapiro, Arthur K. (1997): Powerful Placebo: From Ancient Priest to Modern Physician. Baltimore, MD: Johns Hopkins UP
6 Skinner, Frederic B. (1938): The Behavior of Organisms: An Experimental Analysis. New York: D. Appleton & Co.
7 Bandura, Albert (1976): Lernen am Modell. Ansätze zu einer sozial-kognitiven Lerntheorie. Stuttgart: Klett
Die Anziehungskraft des Vertrauten
Die Fesseln der Gewohnheit sind zu leicht,
als dass man sie spürte,
bevor sie zu fest sind,
um sie noch abzuschütteln.
Samuel Johnson
Theresas Vater war gewalttätig. Der Krieg, den er als Jugendlicher noch hatte mitmachen müssen, hatte seine Spuren hinterlassen, und ihn nicht nur hart, sondern auch nervlich labil gemacht. Aus nichtigsten Anlässen bekam er extremste Wutanfälle, brüllte und schlug alle in der Familie, von seiner Frau bis zu seinen drei Kindern. Die Mutter ertrug dies schweigend, ohne zu klagen, und war weder in der Lage, sich noch die Kinder zu schützen. Nach außen tat sie, als sei alles in Ordnung. Als Theresa zwanzig war, lernte sie ihren Mann kennen. Er war deutlich älter als sie – fünfzehn Jahre –, erfolgreicher Unternehmer und zum Entsetzen ihres strenggläubigen katholischen Vaters: Türke. Mit ihm an der Seite wurde sie mutiger, und sagte ihrem Vater schließlich ebenso keck wie verächtlich. »Du hast mir gar nichts mehr zu sagen! Morgen bin ich Frau Zaimoğlu!«
Ihr Partner aber erwies sich, wie sich schon bald herausstellte, als eine exakte Kopie, ja womöglich eine Steigerung ihres Vaters: Ihr Mann verprügelte sie mehrfach in der Woche, teilweise sogar so schwer, dass sie in die Klinik gefahren werden musste. Ihrem Vater erzählte sie nichts davon, aus Angst, er könnte ihren Mann umbringen. Ansonsten fand sie ihr Leben »schön« und schien die Gewalt, die ihr ständig wiederfuhr, völlig zu verdrängen. Als ihr ältester Sohn vierzehn Jahre alt war, begann er, seinen Vater nachzuahmen. Bei einer Meinungsverschiedenheit schlug er seiner Mutter ins Gesicht und trat ihr mehrfach in den Bauch. Sie berichtete mir in der Therapiestunde den Vorfall unter Tränen. Eine Woche später hatte sie das Ereignis völlig »vergessen« – sie wusste nichts mehr davon und war geradezu empört, als ich sie auf die Gewalttätigkeit der Männer in ihrer Familie hinweisen wollte.
Theresa hatte sich – ohne dass es ihr bewusst war – einen Mann nach dem Vorbild ihres Vaters ausgesucht, obwohl dieser Mann vordergründig ganz anders zu sein schien als ihr Vater. Oberflächlich gesehen schien sie sogar in Opposition zu ihrem Vater zu stehen, stellte seine Werte quasi auf den Kopf. Aber in Wirklichkeit war ihr Mann genauso strenggläubig wie ihr Vater, war genauso brutal wie ihr Vater, war genauso unbelehrbar wie ihr Vater. Sie selbst ging mit der alltäglichen Gewalt dann auch noch genauso um wie ihre Mutter – obwohl sie ihre Mutter seit ihrer Kindheit für ihre Untätigkeit gehasst hatte und immer anders sein wollte. Ja, sie suchte sogar sich selbst gegenüber die Illusion aufrechtzuerhalten, alles sei ganz anders und sogar besser.
Das Festhalten an vertrauten Mustern
Lassen wir uns das einmal auf der Zunge zergehen: Da ist eine Frau, die unter ihrem brutalen Vater leidet und ihre Mutter dafür ablehnt, sie nicht geschützt zu haben – und sucht sich später »freiwillig« genau das Gleiche aus und verhält sich auch noch genauso, wie sie es selber verurteilt hat. Gerade sie müsste es also besser wissen – sie machte es aber nicht besser. Womöglich macht sie es sogar noch schlechter als ihre Eltern.
Kommen Sie mir jetzt nicht mit »Das weiß man doch vorher nicht«- oder »Menschen können sich doch spontan verändern«-Argumenten in Bezug auf die Partnerwahl. Selbst wenn dem so wäre: Man muss solche Dinge wie Gewalt in der Ehe nicht klaglos ertragen. Man kann sich trennen, Hilfe holen, die Polizei rufen, Psychotherapie machen. Könnte man. Wenn man eine Veränderung wirklich wollte. Stattdessen neigen aber Menschen dazu, das einmal Etablierte, Vertraute beizubehalten.
Aber darüber hinaus ist es nachweislich so, dass die unbewusste Wahrnehmung in Bezug auf andere Menschen sehr differenziert und sehr zielgerichtet ist, auch in Bezug auf schädliche und gefährliche Partner. Der »Griff ins Klo« ist keinesfalls zufällig, sondern erfolgt ganz systematisch und exklusiv. Und dass ein gewalttätiger Mann vor der Hochzeit noch völlig friedfertig und achtungsvoll war und urplötzlich aus heiterem Himmel zum Schläger mutiert, ist hochgradig unwahrscheinlich. Er war es schon immer, konnte es vielleicht gut verbergen. Und die von ihm »faszinierte« Frau hat dies höchstwahrscheinlich unbewusst wahrgenommen.
Nicht nur in einer problematischen Partnerwahl wiederholen sich Lebensmotive. Sie können auch politische oder religiöse Positionen betreffen, auffällige Charaktereigenschaften, persönlichen Erfolg, Freundschaften und Einsamkeit, Kinderreichtum oder Kinderlosigkeit, Berufswahl; selbst Lebensdaten wie Alter (etwa wenn in mehreren Generationen immer in einem bestimmten Lebensjahr etwas Entscheidendes passiert) oder der Eintritt in eine bestimmte Lebensphase (z. B. in den Beruf) können Auslöser dafür sein, dass sie plötzlich greifen und der Mensch etwas Problematisches tut.
Ein Klient von mir – ich will ihn Matthias nennen – erzählte mir von seiner Familiengeschichte: Auffällig war, dass sein Großvater (der Vater seiner Mutter) ein »Herr-auf-und-davon« war; er hatte die Großmutter mit der kleinen Tochter im Alter von 32 Jahren sitzenlassen und man hat nie wieder etwas von ihm gehört. Allerdings war das auch nicht so einfach, bzw. es war unerwünscht: Das Thema »Opa« war tabu; von dem Mann durfte nicht gesprochen werden, und wenn Matthias seine Großmutter nach ihrem verschwundenen Mann fragen wollte, verwandelte sich ihr Mund in einen dünnen, verkrampften Strich, der bedeutete: »Von diesem Menschen hat man nicht zu reden.«