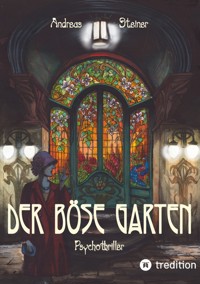
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Deutschland 1927. Als Clara Wegener ihr Medizinstudium beginnt, betritt sie nicht nur den Tempel des Wissens. Besonders in der Irrenheilkunde findet sie vor allem Menschenverachtung, Sadismus und Unwissenschaftlichkeit. Und in der großen Stadt scheint es ähnlich zuzugehen – Korruption, Drogenhandel, sexuelle Exzesse, Dekadenz und Vergnügungssucht. Einzig die selbstbewusste, emanzipierte Eva Gutmann scheint über alle Verdorbenheit erhaben zu sein. Eva hat das Talent, Menschen auf subtile Weise wie Marionetten zu benutzen und für ihre Zwecke zu manipulieren. Clara findet in ihr nicht nur eine Verbündete, sondern glaubt auch, Geborgenheit und Halt durch sie zu finden. Gleichzeitig treibt ein Serienmörder sein Unwesen. Seine Opfer sind oft einflussreiche Männer, die er regelrecht hinzurichten pflegt. Clara offenbart sich eine verrückte Logik darin, die sie selbst zunächst nicht wahrhaben will, denn Eva scheint auf merkwürdige Weise darin verstrickt zu sein. Was hat die all dies mit einer lange zurückliegenden Hinrichtung eines Doppelmörders zu tun? Was spielt Evas schizophrener Bruder Klaus für eine Rolle? Ein Psychothriller über menschliche Abgründe vor dem Hintergrund der goldenen 20er Jahre und dem Vorabend der Dritten Reiches.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 632
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Andreas Steiner
Der böse GARTEN
Andreas Steiner
Der böse GARTEN
Psychothriller
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über dnb.dnb.de abrufbar.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß §44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
© 2024 Andreas Steiner
Website: www.andreassteiner.art
Lektorat: Werner Lange
Coverdesign: Andreas Steiner
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig.
Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: Andreas Steiner, Gertrudenstr. 7, 50667 Köln, Germany.
Dieses Buch ist auch als E-Book erhältlich.
Music, when soft voices die
Vibrates in the memory;
Odours, when sweet violets sicken,
Live within the Music, when soft voices die, Vibrates
sense they quicken.
Rose leaves, when the rose is dead,
Are heap’d for the belovèd’s bed;
And so thy thoughts, when thou art gone,
Love itself shall slumber on.
Percy Bysshe Shelley
Inhalt
Cover
Halbe Titelseite
Titelblatt
Urheberrechte
Prolog.
Kapitel I.
Kapitel II.
Kapitel III.
Kapitel IV.
Kapitel V.
Kapitel VI.
Kapitel VII.
Kapitel VIII.
Kapitel IX.
Kapitel X.
Kapitel XI.
Kapitel XII.
Kapitel XIII.
Kapitel XIV.
Kapitel XV.
Kapitel XVI.
Kapitel XVII.
Kapitel XVIII.
Kapitel XIX.
Kapitel XX.
Kapitel XXI.
Kapitel XXII.
Kapitel XXIII.
Kapitel XXIV.
Kapitel XXV.
Kapitel XXVI.
Kapitel XXVII.
Kapitel XXVIII.
Kapitel XXIX.
Kapitel XXX.
Kapitel XXXI.
Kapitel XXXII.
Kapitel XXXIII.
Kapitel XXXIV.
Kapitel XXXV.
Kapitel XXXVI.
Kapitel XXXVII.
Kapitel XXXVIII.
Kapitel XXXIX.
Kapitel XL.
Kapitel XLI.
Kapitel XLII.
Kapitel XLIII.
Kapitel XLIV.
Kapitel XLV.
Kapitel XLVI.
Kapitel XLVII.
Kapitel XLVIII.
Kapitel IL.
Kapitel L.
Kapitel LI.
Kapitel LII.
Epilog
Der böse Garten
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Prolog.
Epilog
Der böse Garten
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
Prolog.
13. Mai 1910. Justizvollzugsanstalt, Gefängnishof.
DIE SONNE DES FRÜHEN FREITAGMORGENS spiegelte sich merkwürdig lieblich in Karl Högers schwerem Handbeil, das er jetzt aus dem langen, schwarzen Holzkasten nahm. Es waren aprikosenfarbene bis zartrosa Strahlen, die im feuchten Morgennebel wie lichtgewordenes Parfüm wirkten, das sich mit dem schweren Duft des Flieders verband. Einige Singvögel waren schwach jenseits der hohen Ziegelmauer zu hören, und die schwarzbefrackten Gestalten in Gefängnishof № 2 wirkten dagegen wie eine Versammlung riesenhafter, dünner Raben inmitten eines steingewordenen Traumes.
Es war fast sechs Uhr, und der Richtblock befand sich bereits an seinem Platz. Nur wenige Meter entfernt stand der mit schwarzem Tuch umhüllte Richtertisch, an dem der Staatsanwalt und sein Sekretär nebst zwei Gerichtsvertretern platzgenommen hatten. Etwas abseits harrte eine Gruppe von Polizeibeamten der bevorstehenden Prozedur. Daneben standen der Gefängnisdirektor, ein paar Journalisten, eine kleine Schar ausgewählter Gemeindemitglieder und einige Justizangestellte.
Högers erster Henkersknecht füllte einige Sägespäne in den Korb und verstreute den Rest großzügig um den Richtblock herum, dann rückte er die rote Bank an ihre Stelle. Der jüngste Knecht nahm das Beil in Empfang. Er war kalkweiß, und unter seinem schwarzen Zylinder sah er aus wie Blauschimmelkäse. Es war seine erste Hinrichtung heute, bisher hatten sie nur an Puppen und Strohwischen geübt. Höger dagegen hatte bereits über hundert Menschen enthauptet. Der Junge würde diesen Morgen viel über das Leben lernen – und über das Sterben noch mehr. Es ging immer ganz leicht, es war stets kurz, und niemandem wurde wehgetan.
Der Staatsanwalt studierte eine Weile seine Taschenuhr und erhob dann seine belegte Stimme: »Der Delinquent möge jetzt vorgeführt werden!«
Das Sterbeglöckchen begann zu läuten. Die von zwei Polizisten bewachte Tür des Hauptgebäudes öffnete sich und aus dem Dunkel des Ausganges schälten sich zwei Justizwachtmeister heraus, zwischen ihnen der Verurteilte, aschfahl, und jetzt endlich stumm. Die ganze Nacht hatte er ohne Unterlass gebrüllt, jetzt brachte er nicht einmal mehr ein leises Krächzen zustande.
Höger hatte ihn bereits gestern in Augenschein genommen: Er hatte einen dünnen, mageren Hals, der keinen großen Kraftaufwand verursachen würde.
Der Sekretär erhob sich, trat zu dem Verurteilten und leierte teilnahmslos den Urteilstext herunter: »Kurt Ottokar Helm, Ihnen wird vorgeworfen, Ihre Frau, Gwendolin Helena Helm, geborene Gutmann, sowie Herrn Sigmund Granach heimtückisch ermordet zu haben. Sie wurden dafür am 21. April 1910 für schuldig befunden und zum Tode durch Enthaupten verurteilt. Ihr Gnadengesuch wurde am 12. Mai 1910 abgelehnt.«
Er wandte sich zu Höger und zeigte ihm das Schreiben. Der Staatsanwalt erhob sich und trat zu dem Verurteilten. »Möchten Sie noch etwas verlauten lassen?«
Kurt Helm wollte noch etwas sagen, brachte aber nur ein abwehrendes Röcheln hervor. Dann schüttelte er den Kopf.
»Herr Scharfrichter, hiermit übergebe ich Ihnen den Delinquenten.« Höger nahm seinen Zylinder ab. Er ergriff die ehrwürdige Axt. Die Henkersknechte packten den Verurteilten. Sie legten ihn bäuchlings auf die rote Bank und pressten den zitternden Körper auf das Holz. Der jüngste schob den Hals des Mannes auf den Block, rückte das Kinn in die Mulde und machte den Nacken frei.
Der Henker trat heran, hob das Beil kaum einen Meter und ließ es niedersausen. Er durchtrennte Helms Nacken mit einem Hieb. Der Leib bäumte sich kurz auf, das Blut spritzte in einigen dünnen Strahlen aus dem Hals hervor und sickerte dann schwallweise in den Blutkasten.
Der Kopf fiel vornüber in den Korb. Sein Gesicht versank in den Sägespänen.
Seit der Verlesung des Urteils waren keine fünfzehn Sekunden vergangen. Das Sterbeglöckchen war im Augenblick des Todes verstummt.
»Herr Staatsanwalt, das Urteil ist vollstreckt«, sagte Höger pflichtgemäß.
Der Vorgang war lächerlich leicht im Vergleich zu den gewaltigen Hieben, die bei den zahllosen schweren Knochen nötig gewesen waren, die Karl Höger früher in seinem Beruf als Pferdemetzger zerhackt hatte. Während er seinen Zylinder wieder aufsetzte, wurde der Sarg herbeigetragen, der Körper von Kurt Helm samt Kopf hineingelegt und verschlossen.
Der Sekretär wandte sich zu Höger: »Auf Wunsch des Staatsanwaltes teile ich Ihnen mit, dass Sie ihre Aufgabe zu seiner vollsten Zufriedenheit erledigt haben. Sie haben den Delinquenten mit größtem Geschick enthauptet, die Vorbereitungen mit aller Umsicht getroffen, und sich während des gesamten Prozesses tadelfrei aufgeführt.«
Während die Schwärze des Todes nach Kurt Ottokar Helms Seele griff, war es merkwürdigerweise nicht das Knirschen seines Halswirbels, das er als Letztes wahrnahm. Es war das Lachen eines jungen Mädchens – fröhlich und unbeschwert. Wie im Augenblick eines besonderen Glücks.
Kapitel I.
Montag, 09. Mai 1927. Hörsaal der medizinischen Fakultät.
»BETRACHTEN WIR DIESE WIRBEL: Sie umgeben den Übergang des Rückenmarks zum Stammhirn. Im Aufschnitt hier erkennen wir medulla oblongata, pons und formatio reticularis. Es handelt sich dabei um den entwicklungsgeschichtlich ältesten Teil des menschlichen Gehirnes. Hier findet die Steuerung überlebenswichtiger Funktionen statt: Atmung, Reflexe, Blutdruck.« Die Stimme von Professor Walter Krauß war voll und tief. Von Gestalt war er aber keine imposante Erscheinung, obgleich er sich alle Mühe gab, eine zu sein. In seinem breiten Gesicht stachen unter seinen buschigen schwarzen Brauen zwei dunkle, stechende Augen hervor, die Falten seines Gesichtes erinnerten an eine zerklüftete Steinwüste; sein weißes Haar war zurückgekämmt und gab eine hohe Stirn frei. Sein grauer Schnurrbart war gezwirbelt wie bei Kaiser Wilhelm und seine von zahlreichen geplatzten Äderchen gezeichnete Nase zeugte von unzähligen Flaschen Rotweines, die er im Laufe seines Lebens geleert haben mochte, wie auch sein Unterbauch, der dick hervorragte und zu den dünnen Beinen nicht zu passen schien. Seine Hände waren auffallend klein, und schienen noch nie in seinem Leben körperliche Arbeit verrichtet zu haben.
Krauß’ Zeigestock irrlichterte über die großformatige Farbtafel des menschlichen Nervensystems. Befriedigt registrierte er das andächtige Schweigen der schreibenden Studenten. Etwas verächtlich fokussierte er die junge Dame, die inmitten der schwarzgekleideten Studentenschar emsig und offenbar äußerst konzentriert ihre Heftseiten beschriftete.
Ein weiteres Weibsbild. In seiner Vorlesung! Was, bei allen guten Geistern, suchte wieder eine Vertreterin der instinktdominierten, tierähnlichen Spezies in einer Veranstaltung, die doch der Intelligenz vorbehalten war? Die akademischen Tugenden begannen, immer mehr zu verwässern. Ihm reichte schon die kleine Gruppe von Studentinnen auf der anderen Seite des Hörsaals, allesamt höhere Töchter ehrgeiziger Eltern, die nach Beendigung des Studiums ohnehin Kinder bekämen und dann die Windeln wechseln und kochen würden, in der Küche, wo sie auch hingehörten.
Clara Wegener war eine auffallend hübsche Frau; sie war schlank, aber nicht mager, sondern hatte eine Figur wie eine antike Statue der Aphrodite. Ihre blonde, kaum zu bändigende Haarmähne trug sie lang, ohne sich für modische Kurzhaarschnitte zu interessieren, die sie als zu unweiblich empfand. Stattdessen hatte sie ihr Haar elegant zusammengesteckt, so dass es geordnet auf ihren Rücken entlang wallte, ohne seine Wildheit zu verleugnen. Ihre Haut war hell, und wirkte fast filigran in ihrer Zartheit. Auffällig waren im Kontrast dazu ihre tief dunkelbraunen Augen und die dichten, fast schwarz anmutenden Brauen. Mit ihrer weißen Bluse und dem schwarzen Rock war sie eher dezent gekleidet; am auffälligsten war die schwere Bernsteinkette ihrer Mutter, die sie seit ihrem Tod im letzten Jahr kaum noch ablegte. Diese Kette war für Clara wie ein Talisman, der sie gegen alle Bedrohlichkeiten des Lebens schützte. Auch während des Schreibens umklammerte ihre Hand oft einige der Steine, und sie fühlte ihr mächtiges Volumen in ihrer Handfläche.
Claras zierliche Hand glitt über das Papier und füllte die Seiten ihres Heftes eng mit Wissen. Kein Wort, keine Bedeutung würde ihr entgehen.
Eine bereits wohlbekannte Stimme raunte an ihr Ohr: »Was man nicht in den Kopf kriegen kann, sollte man wenigstens auf dem Papier haben.«
Verhaltenes Gekicher folgte von allen Seiten.
»Das sind doch die Kochrezepte für heute Abend«, wisperte ein anderer Scherzbold.
»Heute Abend gibt es dann wohl gebackenes Stammhirn!«, gluckste es von hinten.
Friedrich Lohmann, der hochgewachsene Offizierssohn mit dem tiefen Schmiss in der Wange war wieder in seinem Element. Er pflegte stets gelangweilt im Auditorium zu sitzen, wenn er eine Vorlesung mit seiner Anwesenheit beehrte. Alle Professoren und andere Dozenten schienen davon auszugehen, dass er ohnehin bereits alles wusste und er tat nichts, um Zweifel daran aufkommen zu lassen. Er leistete sich als Einziger die anarchistische Freiheit eines hellen Sommeranzuges. Sein längliches, hocharistokratisches Gesicht hatte eine solch naturgegebene Blasiertheit, dass jegliche Art der Bescheidenheit hochgradig unpassend gewirkt hätte. Auch die Vorstellung, man könne Verehrung für eine Frau empfinden, war viel zu demütig für ihn, als dass er diese Haltung auch nur andeutungsweise in Betracht gezogen hätte.
Clara hatte sich mit spöttischen Bemerkungen aller Art bereits arrangiert. Sie hatte sich entschieden, nicht darauf zu reagieren. Es sei denn, sie konnte einige ihrer schlagfertigen Antworten platzieren, die sie begonnen hatte, zu sammeln und auswendig zu lernen. Leider gab es von den drei anderen Studentinnen keine Unterstützung; die Gruppe um die vornehm entrückte Hedda Seipold glänzte vielmehr durch Abschottung und Schweigsamkeit. Hedda wirkte wie das weibliche Pendant zu Friedrich Lohmann; betont nobel, damenhaft gelangweilt und von den beiden anderen flankiert wie von einem Hofstaat. Ansonsten thronte sie einer Prinzessin gleich in den Veranstaltungen, sagte nie ein Wort, schien noch nicht einmal zuzuhören. Das einzige Mal, dass Clara sie hatte sprechen hören, war ihre süffisante Behauptung, ohne Vorbereitung jede Prüfung bestehen zu können.
Clara verspürte wenig Lust auf diese Gesellschaft. Ihre Isolation brachte sie erst recht dazu, sich ganz auf das Lernen zu konzentrieren. Während der Vorlesungen hatte sie somit Wichtigeres zu tun, als sich mit den Befindlichkeiten und Albernheiten der anderen Studenten zu beschäftigen. Und schon gar nicht mit aufgeblasenen Fatzken wie Friedrich Lohmann, der noch nie in seinem Leben irgendwelche Selbstzweifel, Geldsorgen oder sonstigen Nöte gehabt hatte. Betont sinnlich strich sie sich eine goldene Haarsträhne aus dem Gesicht. Ihre Zungenspitze befeuchtete sacht ihre geöffneten Lippen, die der selbstgefällige Schnösel niemals würde küssen dürfen. Allerdings gab es derzeit auch sonst niemanden, den Clara so weit in ihre Nähe gelassen hätte, obwohl sie sich nach der Zeit der Trauer allmählich wieder danach sehnte, sich zu verlieben. Aber der Blick in die Runde der Kommilitonen war eher entmutigend.
Clara stammte aus einem Dorf, das zu Beginn der zwanziger Jahre ein elektrisches Stromnetz erhalten hatte. Ihr Vater Albrecht betrieb dort eine kleine mechanische Werkstatt und war ein unermüdlicher Bastler. Bereits einige Jahre zuvor hatte er sein kleines Haus elektrifiziert, indem er eine eigene Turbine installiert hatte, die er mit dem Gebirgsbach neben ihrem Haus betrieb. Damit hatte er lange vor allen anderen im Dorf eine Ahnung vom Licht der großen Städte nach Hause geholt und gleichzeitig eine Begeisterung in Clara entfacht für all das, was möglich war, wenn man sich nur unermüdlich in Dinge vertiefte. Noch Jahre später fühlte Clara eine besondere Andacht, wenn sie die schwarzen Drehschalter betätigte und der ganze Raum sich mit hellem Licht füllte.
Der Krieg schien ihrem Vater fast nichts angehabt zu haben. Wohl war er bei seiner Rückkehr etwas magerer gewesen, die Haare ein wenig weißer und schütterer, als Clara in Erinnerung hatte, und von einer eigenartigen Schwermut erfüllt, die sich aber immer verflüchtigte, sobald er in seiner Werkstatt war und dort hämmerte, klopfte, feilte und schraubte. So lernte sie ihn kennen, emsig, fleißig und still, denn als er ins Feld hatte ziehen müssen, war sie knapp fünf Jahre alt gewesen, und sie hatte nur noch ihre Mutter gehabt, die sie ab diesem Zeitpunkt so zu unterstützen versuchte, wie ihre kleinen Hände es ausrichten konnten. Dass es noch jemanden gab, der dazugehörte, erschien ihr zunächst fremd und unwirklich.
Mit Vaters Rückkehr kehrte auch eine wilde Sinnlichkeit zurück, die Clara von ihrer Mutter nicht kannte. Albrecht Wegener liebte die Musik und gab zum Kummer und Unverständnis seiner Ehefrau immer wieder Geld dafür aus, erst für einen Phonographen und unzählige Walzen mit Opernarien, dann für ein Grammophon nebst einer unglaublichen Anzahl von Schallplatten und schließlich für ein Klavier. Clara erschauerte bei den verzauberten Klängen der Akkorde, die etwas unendlich Vertrautes und gleichzeitig Unbegreifliches in ihr wachriefen. Niemand zuvor hatte in der Familie jemals ein Instrument gespielt, geschweige denn eines besessen, aber ihr Vater ließ von nun an einen Musiklehrer kommen, der Clara unterrichtete. Seine Tochter sollte die Freude am Schönen genießen und vertiefen, was ihm in seiner Kindheit nie vergönnt gewesen war. Ihre erste Mozart-Sonate trieb ihm die Tränen des Glücks in die Augen, obgleich er nie darüber sprach. Er saß nur dabei und hörte zu.
Doch je mehr Claras und ihr Vater in Begeisterung aufblühten, desto unerbittlicher schien ihre Mutter zu verwelken. Sie wurde langsamer, schweigsamer, war immer öfter in sich gekehrt. Sie versah ohne Klage ihre Arbeit, wurde aber immer verdorrter und schwächer. Ihre dicken, wallenden, kaum zu bändigenden Haare dünnten aus, wurden stumpf und verfärbten sich zu einem kranken Gelb. Erst als die Krämpfe einsetzten, riefen sie den Doktor. Auf seine Frage, ob sie Blut im Stuhl habe, nickte sie. »Seit sechs Jahren«, sagte sie. Das sorgenvolle Gesicht des Arztes brachte Claras Herz zum Klopfen. Etwas Schlimmes ging hier vor, das war mit einem Mal allgegenwärtig. Ihr Vater war seitdem noch unruhiger als sonst, trank des Abends mehrere Schnäpse und wies seine Frau an, sich zu schonen. Seine Schwester zog für ein paar Monate bei ihnen ein, um die Hausarbeit zu übernehmen.
Als ihre Mutter starb, quälte Clara jenes gnadenlose Gefühl, einfach zusehen zu müssen, wie ihre Mutter ging, ohne etwas dagegen tun zu können. Wut auf die hilflosen Ärzte wechselte sich ab mit einer bedrückenden Leere, die bislang von ihrem Glauben an Gott angefüllt war, und nun der angstvollen Ahnung von endlosen Räumen voller Schweigen wich, wo sie zuvor schützende Geborgenheit vermutet hatte. Nein, dort war nichts. Kein Gott, keine Hilfe, nur schreiende Einsamkeit und der unerbittliche Lauf der Dinge.
An diesem Tag verwarf sie ihren Wunsch, Pianistin zu werden. Sie schwor sich, etwas zu lernen, das Menschen von Qual und Krankheit heilt. Sie würde Ärztin werden, und nichts Anderes.
Als die heutige Vorlesung beendet war, verstaute sie rasch ihre Utensilien im Ranzen, um dann zügig den Hörsaal zu verlassen. Die Mittagspause verbrachte sie alleine im Park, wo sie auf einer Bank ihren teuren »Atlas des menschlichen Gehirns« studierte. Dennoch blieb ihr der scheue junge Mann mit den dunklen Locken nicht verborgen, der sich in ihrer Nähe niedergelassen hatte und sie verstohlen betrachtete. Eduard. Ein überaus netter, auffallend schmächtiger Kommilitone, der zum Verlieben leider völlig ungeeignet war. Er wirkte so sanft und gutmütig, dass seine Gegenwart ebenso entspannend wie langweilig war. Seine schwitzigen Hände und sein häufig schlechter Atem verwiesen auf permanente Nervosität, die zu seinem scheuen, linkischen Wesen passte. Clara biss gedankenverloren in ihre Butterstulle und bemühte sich, so versunken wie möglich zu wirken. Bald war sie tatsächlich so eingetaucht in die Welt aus Neuronen, Synapsen und Nervensträngen und deren Degenerationen, dass sie die Zeit vergaß. Heute Nachmittag stand die praktische Unterweisung in der geschlossenen Irrenanstalt auf dem Plan, und sie wollte gut vorbereitet sein.
Erst das laute Geläut der Turmuhr ließ sie aufschrecken. Hastig machte sie sich auf den Weg.
Die universitäre Irrenanstalt war ein fünfstöckiger neugotischer Ziegelbau mit vergitterten Fenstern, der von einer hohen Mauer umgeben war und nur durch eine doppelte Schleuse aus schweren Eisentoren betreten werden konnte.
Bereits als die Studenten sich dem Tor näherten, waren Schreie zu hören und verzweifelte Rufe, die wie lautes Gelächter klangen. Eine Frau kreischte, wie vom Satan selbst gepeinigt. Ein Mann winselte mit hoher Stimme irgendwelche Gebete. Eine andere Männerstimme schien die Dämonen der Finsternis heraufzubeschwören. Obwohl sie sich bemühte, gefasst zu wirken, war Claras Kehle wie zugeschnürt. Sie fürchtete sich vor der Verzweiflung, diesen verlorenen Seelen, die kein Mensch mehr erreichen konnte, und erschrak vor der gnadenlosen Brutalität, die sich ihr hier offenbarte.
»Sie glauben, Sie begeben sich geradewegs in die Hölle, nicht wahr?«, schnarrte Professor Krauß, der jetzt am Rundbogen des Haupteinganges auftauchte, zu dem die breite, von Rosensträuchern gesäumte Steintreppe führte. Er musterte die Studenten wie ein General und stemmte dabei die Fäuste in die von seinem weißen Kittel umhüllten wuchtigen Seiten. »Ich kann Ihnen allen nur raten: Vergessen Sie jede Art von abergläubischem Gewäsch. Das, was Ihren Ohren so gespenstisch oder gar teuflisch erscheint, ist nichts weiter als das Zusammenwirken verschiedenster Symptome von Erkrankungen des Zentralnervensystems. Vergessen Sie auch die merkwürdigen Ansichten eines gewissen Doktor Freud, von dem einige von Ihnen womöglich auch schon gehört haben. Anders als er behauptet, handelt es sich bei diesen Erkrankungen nicht um Verirrungen der Seele, die mit Worten geheilt werden könnten, sondern um Degenerationen des Gehirns, denen wir ausschließlich mit Medikamenten und direkten Eingriffen am Gehirn beikommen können. Je früher Sie sich damit auseinandersetzen, desto besser. Vergessen Sie nie: Wir sind Wissenschaftler und keine Exorzisten.«
Auf eine militärische Handbewegung hin strömten die jungen Männer und die wenigen jungen Frauen über die Stufen in den langen Korridor, der von einem dunkelgetäfelten Pförtnerhäuschen auf der rechten, und einem durch große Fenster einsichtigen Büroraum mit schweren dunklen Holzmöbeln auf der linken Seite flankiert war.
Das Gekreische der Insassen war allgegenwärtig. Die Gruppe patrouillierte den Hauptgang an den Zellen entlang, die alle ein verriegelbares Guckloch aufwiesen. Krauß wies die Studenten an, den einen oder anderen Blick hineinzuwerfen. Die meisten Patienten, die Clara dadurch flüchtig beobachten konnte, saßen teilnahmslos auf ihrer Pritsche und starrten vor sich hin, einige waren zusätzlich gefesselt oder trugen Zwangsjacken.
Eine junge, verwahrlost aussehende Frau trottete immerfort im Kreis herum, ein dicker Mann murmelte in einem fort eine unverständliche Litanei vor sich hin.
Ein einziger Mann bemerkte, dass Clara den Sichtschutz beiseiteschob und seine schmale Zelle begutachtete, und zuckte zusammen, als habe er einen elektrischen Schlag bekommen. Ruckartig schoss er in die Höhe, hechtete auf die Zellentür zu, um erst ein gewaltiges Geschrei anzustimmen und dann mit den Fäusten und Füßen gegen die Tür zu trommeln. Dann fing er an, mit dem Kopf dagegen zu schlagen, dass es knackte.
»Nun haben Sie Gelegenheit, die alltägliche Arbeit in der Psychiatrie zu schauen«, sagte Krauß und drückte einen der porzellanenen Knöpfe, die neben jeder Zelle angebracht waren. Sofort erschienen im Laufschritt drei mit diversen Utensilien beladene Wärter, die durch die Gruppe der zurückweichenden Studenten zur Tür drängten, sie aufsperrten und den tobenden Mann überwältigten. Sein Gesicht sah bereits aus wie eine blutige Masse, obwohl es vermutlich größtenteils nur Platzwunden waren, die er sich zugefügt hatte. Immerhin hatte er einen schmierigen, triefendenden Blutfleck an der blassgrün lackierten Metalltür hinterlassen. Sie drückten ihn zu Boden, einer presste ihm einen mit Äther getränkten Lappen ins Gesicht, bis das Gebrüll in einem würgenden Laut erstarb und die Gliedmaßen nach einigen Zuckungen erschlafften. Die kräftigen Kerle wuchteten den Körper auf die mitgebrachte Bahre und trugen ihn fort.
»Was geschieht mit ihm?«, fragte Clara.
»Er wird strengstens fixiert und kommt dann zunächst in die chirurgische Ambulanz. Dort werden die Verletzungen untersucht und er wird entsprechend versorgt. In der nächsten Zeit wird er betäubt, um Neuverletzungen zu vermeiden. Dann wird er unter Beobachtung gestellt, bis wir uns sicher sein können, dass die Erkrankung abgeklungen ist.«
»In Fixationsjacke und gepolsterter Zelle, nehme ich an?«, ließ sich Friedrich Lohmanns gelangweilte Stimme vernehmen.
»Ganz recht«, antwortete Krauß.
»Ich könnte mir denken, eine Schlafkur wäre alsdann indiziert?«
»Sehr naheliegend. Ausgezeichnet, Herr Lohmann.« Dann bedeutete Krauß der Gruppe, ihm zu folgen.
Clara spürte einen feuchten Hauch an ihrem Ohr.
»Ist das auch das Richtige für eine so zarte Seele?«, ließ sich eine zuckersüß lispelnde Stimme vernehmen. Sie gehörte Albrecht Jessel, einem feisten, stiernackigen Kerl, den man für einen Metzgergesellen hätte halten können. »Wollen Sie mir damit sagen, ausgerechnet ich soll Sie stützen, wenn Sie ohnmächtig zu werden drohen?«, gab Clara zurück. »Atmen Sie gut durch, dann werden Sie es durchstehen.« Sie registrierte Albrechts beleidigt säuerliches Grinsen nur aus dem Augenwinkel, während sie schnellen Schrittes und klopfenden Herzens zu Krauss aufschloss.
Der Weg führte in einen kahlen, blassgelbgekachelten Behandlungsraum, wo ein schmaler, elend aussehender Bursche in grauer Anstaltskleidung saß, der kaum siebzehn Jahre alt sein mochte und von einem älteren Wärter bewacht wurde. Er war mit einer Zwangsjacke fixiert und um seinen Kopf war eine Art Käfig geschnallt, der wie ein kugelförmiges, massives Sieb aussah.
»Ich möchte Ihnen diesen juvenilen Patienten vorstellen«, erklärte Professor Krauß. »Es handelt sich hier um eine schwere dementia praecox, auch neuerdings Schizophrenie genannt. Wie Sie sehen, ist der Patient aus Gründen der Sicherheit - sowohl für Ärzte, Pflegepersonal, aber vor allem für sich selbst - mit einer Zwangsjacke fixiert. Um den Kopf trägt er eine Spuck- und Beiß-Maske, um mögliche Angriffe und Selbstverletzungen zu verhindern. Die Medikation besteht vor allem aus Laudanum, welches wir heute Morgen ausnahmsweise reduziert haben, um Ihnen das Krankheitsbild besser vorführen zu können. Ohne das Mittel verhält er sich wie von furchtsamer Unruhe getrieben und zeigt eine bizarre Symptomatik mit Wahninhalten und Halluzinationen, typischerweise vor allem akustischer Art.«
Der Patient blickte schwach lächelnd in die Runde der angehenden Ärzte und machte Anstalten, sich zu erheben, was von dem Pfleger sofort rigoros unterbunden wurde. Clara versuchte, durch das Gitternetz Details seines Gesichtes zu erkennen, sah aber nur hohle Wangen und übergroße, triefende Augen. Über allem schwebte die Ahnung eines beißenden chemischen Geruchs und einer Andeutung von Urin.
»Hör nicht auf all die Idioten. Sie verachten alles, was über ihren Horizont geht. Und dieser Horizont ist nicht der weiteste.« Eduards tiefe Stimme wirkte beruhigend und schuf einen angenehmen Kontrast zu der gespenstischen Gestalt vor ihnen.
Krauß wandte sich nun an den Patienten. »Klaus, möchten Sie sich vorstellen?«, fragte er ungewöhnlich sanft. Der Patient blickte nervös um sich. »M-mein N-name ist … ist K-klaus G-g-g… Gutmann«, brachte er mühsam mit kehligem Laut hervor.
»Machen Sie sich keine Sorgen. Die jungen Herrschaften sind hier, um zu lernen, damit sie in Zukunft Menschen wie Ihnen besser helfen können«, sagte Krauß. »Können Sie uns mitteilen, weshalb Sie hier sind?«
»I-ch b-bin krank …«
»Wissen Sie, was für eine Erkrankung Sie haben?«
»I-I-Irrsinn.«
Krauß wandte sich an die Studenten. »Der Patient gibt selbst an, dass er irrsinnig ist. Damit zeigt er sich eingeschränkt einsichtig. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ein erster Behandlungserfolg! Leider kann man sich nicht immer darauf verlassen, ob die Distanzierung von einem Wahne wahrhaftig ist oder nur vorgetäuscht wird. Die meisten Patienten halten ihre Hirngespinste für völlig real und reagieren oft feindselig auf all jene, die sie nicht teilen.«
Er wandte sich wieder an Klaus Gutmann. »An was für Symptomen leiden Sie?« »Ich h-höre Stimmen.«
»Was sagen Ihnen diese Stimmen?«
»Sie erzählen mir sch-schlimme Dinge … von den Blumen. Den bösen Blumen. Sie wachsen aus der Erde. In dem bösen Garten. Der ganze Garten ist böse!«
»Warum ist der Garten böse? Wie können Blumen böse sein?«
Der Patient begann schneller zu atmen. »Weil das Böse in der Erde ist und die Blumen es in sich aufnehmen! Und durch ihren Duft verbreiten sie es! Man muss die Nase und den Mund verschließen vor dem Unheil! Sonst erfüllt es die ganze Seele!«
»Woher wissen Sie das?«
»Ich spüre es … Ich rieche den verdorbenen Duft des Todes, den sie verströmen!«
»Sie hören, dass sich der Irre nicht vollständig von seinem Wahne lösen kann«,
dozierte Krauß. »Sobald sich das imaginierte Bild verfestigt, treten sofort Symptome auf. Wie Sie erkennen, haben diese eine künstlerische, in diesem Fall poetische Komponente; auf die Idee eines ›bösen Gartens‹ könnte auch ein expressionistischer Dichter verfallen.«
»Warum ist er so mager?«, fragte jemand von hinten mit sächsischem Akzent.
Der Mund des Professors verwandelte sich in einen dünnen Strich. »Dies ist eine Nebenwirkung des Opiates«, erklärte er. »Dauerhaft angewandt führt es zu vermindertem Appetit.«
»Haben die surrealen Phantasmen des Patienten einen verborgenen Sinn?«, wollte jemand anders wissen.
»Was für ein dummes Zeug! Selbstverständlich nicht!«, entrüstete sich der Professor. »Es sind allesamt Auswüchse einer krankhaften cerebralen Degeneration! Sie kommen als Arzt in Teufels Küche, wenn Sie anfangen, irgendwelche Bedeutungen zu suchen, die es nicht gibt. Merken Sie sich: Diese Narren sind krank. Ihre Wahninhalte haben einen ähnlich tiefen Sinn wie ein Eitergeschwür oder eine Darmperforation!«
»Heißt das, es ist gänzlich zufällig, welche Gedanken der Kranke äußert?«, fragte Clara.
»Herrgott! Fetzen biographischer Natur mögen eine Rolle spielen. Sie sind aber zu vernachlässigen. Vielleicht hatten seine Eltern einen Garten. Vielleicht ist er einmal durch einen Park spaziert. Unwichtig.« Die neue Studentin begann schon jetzt, ihn zu nerven mit ihrer ungebildeten Dummheit. Gut, dass die anderen der anwesenden Damen ihren hübschen Mund hielten.
Auf Anweisung Krauß’ öffnete der Pfleger Klaus Gutmanns Spuckmaske und verabreichte ihm einen Löffel gezuckerter Tinktur. Damit schien die Anschauung beendet und die Gruppe verließ den Raum in Richtung des Stationsbades. Clara blieb zurück. Dann wandte sie sich verstohlen zu Klaus Gutmann. Mitleiderregend sah er aus, gerade jetzt, wo ihn kein Gitter mehr verdeckte. Und ganz hübsch, wären nicht das ausgemergelte Gesicht und die dunklen Ringe unter den Augen gewesen.
»Wo befindet sich der Garten, von dem Sie sprachen?«
»Oh, das darf ich nicht sagen … Es ist ein verwunschener Ort …« »Warum dürfen Sie es nicht sagen?«
»E-e-es ist verboten …«
»Aber wer verbietet es Ihnen?«
Klaus starrte Clara gequält an. Dann blickte er auf ihre Bernsteinkette. »Ihre Mutter ist tot. Das ist traurig.«
Clara versagte im ersten Augenblick die Stimme. Sie versuchte zu lächeln. »Woher … woher wissen Sie …?«
Der Pfleger schloss und verriegelte die Maske wieder. »Geben Sie nichts darum! Ich bringe ihn in den Besucherraum!«
Clara eilte den anderen Studenten hinterher, die sich bereits im Sanitärbereich versammelt hatten. Der große Waschraum war derzeit nicht frequentiert, die zwölf Wannen, die in zwei Reihen den Raum ausfüllten, waren alle leer. Jede von ihnen hatte einen hölzernen Deckel, der fest arretiert werden konnte, nur ein Loch an der Stirnseite für den Hals des Patienten war ausgespart. Die herbeieilende Clara erfasste die Umgebung nur flüchtig, während sie versuchte, sich wieder auf die akademische Information zu konzentrieren. »Hier finden nicht nur die Aufrechterhaltung der Hygiene unserer Patienten statt, sondern auch unsere Bäderkuren«, erklärte Professor Krauß. »Das Lagern in warmem Wasser bewirkt auf Dauer eine wohltuende Gemütsumstimmung. Zuweilen sind Stadien von 24 Stunden notwendig und zweckmäßig. Für die rasche Korrektur der Handlungen tobsüchtiger Irrer dagegen verwenden wir kaltes Wasser. Bewährt hat sich das Plongir-Bad, das sich dort drüben im angrenzenden Raum befindet, in das der Tobsüchtige überraschend hineingestoßen und untergetaucht wird. Der Schock des kalten Wassers bewirkt eine radikale Realitätsorientierung.«
Clara trat ein paar Schritte zurück und blickte verstohlen durch die schummrige Türöffnung in den von Krauß genannten Raum, der innen nur von einer winzigen runden Luke über der Raumdecke erhellt wurde. Sie erkannte schemenhaft ein großes, kreisrundes Becken, über das sich eine brückenartige Eisenkonstruktion wölbte.
»Ebenso verwenden wir Sturzbäder, auf dem ganzen Körper angewandt, sowie Übergüsse des Kopfes mit Eiswasser, um die Raserei durch extreme Körpersensationen zu beenden«, fuhr Krauß fort. »Dazu sind zuweilen sechsunddreißig Eimer erforderlich.«
»Wie genau ist das Kaltwasser temperiert?«, wollte jemand mit krächzender Stimme wissen.
»Etwa 12° Réaumur. Also 15° Celsius, nach moderner Skalierung.«
»Besteht nicht die Gefahr der Unterkühlung?«, fragte Johannes Pape, ein hochgewachsener Student mit gewaltiger Hakennase und bereits leicht schütterem Haar.
»Dummes Zeug!«, bellte Krauß. »Die Vorteile der Wasserkur überwiegen die Risiken! Kaltes Wasser ist ein bewährtes Mittel zur Heilung überreizter Nerven! Es hat zudem eine reinigende Wirkung: Der veränderte Stoffwechsel bewirkt eine vermehrte Ausscheidung von Urin und eine Verbesserung der Verdauung, zumal in diesem Behandlungsabschnitt die Medikation reduziert werden kann - von der Stärkung des gesamten Körpers gegen jede Verweichlichung ganz abgesehen! Sie müssen lernen, in größeren Zusammenhängen zu denken, wenn Sie fachlich ernstgenommen werden wollen!« Johannes sah betreten zu Boden. Einige Kommilitonen sahen ihn mitleidig an, andere unterdrückten ein schadenfrohes Grinsen. »Ein lächerlicher Einwand«, kommentierte Friedrich Lohmann.
Die nachmittägliche Übung fand ihren Abschluss in dem Besucherraum, der durch einen langen tunnelartigen Gang zugänglich war und der die geschlossene Psychiatrie mit einer Art Vorposten der Außenwelt verband. Auch der karge, mit wenigen schlichten Holztischen und ebensolchen Stühlen möblierte Besucherraum konnte von den Angehörigen nur durch eine doppelte Schleuse betreten werden.
Als die Studenten eintraten, waren fast alle Tische besetzt. Einige Patienten waren mit Lederriemen an die am Boden angeschraubten Stühle gefesselt, die meisten wirkten apathisch und so sediert, dass sie kaum sprechen konnten, ja ihre Besucher nicht einmal wahrzunehmen schienen. Eine junge Frau mit wilden, ungeordneten Haaren wurde von zwei Wärtern hinausgetragen, da sie offenbar auf ihren Stuhl defäkiert hatte. Ein schwacher Geruch von Kot schwebte in der Luft, von krankhaftem Aroma, fast wie Karbid oder wie Verwesung, vermutlich aufgrund der starken Medikamente.
Auf einem der Stühle saß Klaus Gutmann, jetzt ohne Maske, aber offenbar wieder stark betäubt. Seine Handgelenke waren mit Lederriemen an seine breiten Gürtel gebunden. Sein Kopf kippte ständig schwer vornüber, aber er bemühte sich, aufmerksam zu bleiben.
Ihm gegenüber saß eine elegant gekleidete Dame von etwa dreißig Jahren. Zu ihrem kinnlangen, schwarzen Haar sah ihre helle Haut sehr blass aus. Ihr kleingeschminkter, dunkelroter Mund stach entsprechend hervor, noch mehr als die großen, meerblauen Augen, die von schweren, langen Wimpern umkränzt waren. Durch den federbesetzten Glockenhut und die violette Satinjacke sah sie im Kontrast zur Anstaltskleidung fast frivol aus. Sie hatte Klaus’ Hand ergriffen und strich ihm zuweilen über die Wange.
Als sie Professor Krauß inmitten der Studentenschar ausgemacht hatte, erhob sie sich und steuerte direkt auf ihn zu. Ihr Gang war langsam und fast schwebend. Sie war hochgewachsen, mindestens einen Meter und achtzig, und Krauß musste den Kopf heben, um ihr in die Augen sehen zu können.
»Herr Professor! Was für ein guter Umstand, Sie hier anzutreffen!« Ihre Stimme war tief und voll, und obgleich sie sehr verhalten sprach, schien sie den ganzen Raum ohne jede Anstrengung auszufüllen.
Sie reichte ihm eine behandschuhte Hand mit feingliedrigen, langen Fingern. Krauß ergriff sie fast ein wenig verdutzt.
»Mein Name ist Eva Gutmann. Mein Bruder ist bei Ihnen in Behandlung.«
»Sehr angenehm, Frau Gutmann.« Krauß wirkte wie verwandelt; ein Lächeln stand plötzlich auf seinem sonst so eingefrorenen Gesicht.
»Verzeihen Sie meine Aufdringlichkeit«, sagte Eva Gutmann, »aber meine Sorge bringt mich dazu.«
»Ihr Bruder ist leider sehr krank«, sagte Krauß. »Wir tun unser Bestes, um ihn von seinem Irrsinn zu heilen.«
»Das weiß ich sehr zu schätzen«, sagte Eva Gutmann. Etwas Eigenartiges war in ihrer Stimme – warme, fast wollüstige Freundlichkeit und schneidende Kälte zugleich. »Ich beobachte leider, dass es meinem Bruder immer schlechter geht. Er hat an Gewicht verloren, sein Wahn hat sich in keiner Weise gebessert. Welches Behandlungskonzept verfolgen Sie eigentlich? Was glauben Sie, wird ihm helfen?«
»Ich verfolge das modernste Konzept, das wir kennen«, gab Krauß zurück. Er wirkte wie gebannt, von hündischer Ergebenheit beherrscht. Ein kurzer Blick auf Friedrich Lohmanns verächtlich hochgezogene Oberlippe genügte Clara, um sich ihrer Wahrnehmung sicher zu sein.
»Nun, das scheint nicht zu genügen.« Eva Gutmanns Lächeln strahlte unverändert. Krauß erwachte jäh aus seinem Traum und bekam schmale Augen, Clara hatte den Eindruck, dass er einige Sekunden vergaß zu atmen. »Was genau tun Sie für ihn, und wenn Sie etwas tun: Warum tun Sie es?« Sie beugte sich vor und näherte ihr Gesicht dem des Chefarztes. »Sie wissen es doch gar nicht, nicht wahr?«, hauchte sie. Es war kaum zu hören, doch Clara konnte es förmlich von ihren Lippen ablesen – als habe sie es geahnt.
»Sie können sich darauf verlassen, dass …«, begann Krauß, der seine beherrschte Stimme wiederzufinden suchte. »Oh, ich weiß, dass er hier in den besten Händen ist!« Eva Gutmann hatte sich wieder kerzengerade aufgerichtet und ihre Altstimme umwallte die Sinne aller Anwesenden wie ein betäubender Duft. »Ich danke Ihnen, Herr Professor Krauß.« Sie warf einen strahlenden Blick in die Runde. Clara spürte, dass sich ihre Blicke kurz begegneten.
»Wie schön, dass auch eine Frau zu Ihren Schülern zählt!«, bemerkte sie.
»In der Tat. Das Weibliche bringt ein wenig Wärme in den kalten, von männlicher Intellektualität beherrschten Alltag«, sagte Krauß spitz.
»Ich bin sicher, gerade diesen sensiblen Menschen wird dies mehr helfen als so manche medizinische Anwendung«, sagte Eva Gutmann. Mit einem verführerischen Augenaufschlag wandte sie sich ab.
Kapitel II.
Dienstag, 10. Mai 1927. Dom des hl. Pankratius. 8:32 Uhr abends.
DER KLANG DER GLOCKEN hallte durch die Abenddämmerung. Der hochgewachsene Mann, der auf die ehrwürdige gotische Kathedrale zuging, hatte in der Abendkühle den Kragen seines schäbigen Mantels hochgeschlagen und den Hut tief ins Gesicht gezogen. Vorsichtig schlich er durch die Schatten der Häuser und beäugte durch seine dicken, runden Brillengläser argwöhnisch den Platz vor dem gewaltigen Gebäude. Der nahegelegene große Fluss schickte feuchten Bodennebel aus, der überall durch die Gassen kroch und auch den Platz vor seinen Augen in geisterhafte Schleier hüllte. Sein nervöser Blick vermochte die Umgebung nur fetzenweise zu erkunden. Nachdem er eine Weile abwägend verharrt hatte, warf er noch einen Blick auf seine Taschenuhr. Acht Uhr abends; ausnahmsweise war er pünktlich. Er pflegte normalerweise, chronisch zu spät zu kommen; für ihn war es angemessen, seinen Rhythmus den Mitmenschen zuzumuten, und er hasste jede Art von Druck und Einengung durch Andere. Hier um diese Zeit einbestellt zu sein, empfand er als Demütigung, die seiner nicht würdig war. Widerstrebend gab er sich nun einen Ruck und schritt zügig über den großen Platz. Dort erklomm er verbissen die Stufen. Das mächtige Hauptportal erwies sich als verschlossen, doch die Tür des Nebeneinganges ließ sich zu seiner Erleichterung öffnen.
Im Dom war es dunkel und kaum wärmer, aber die Sicht war hier wenigstens klar. Verächtlich betrachtete er das Taufbecken, die Kreuze und die zahlreichen flackernden Kerzen, die die lächerlichen Götzenbilder hingerichteter Schwachköpfe beleuchteten. Wie die Menschheit immer wieder dazu gebracht worden war, diese syrische Irrlehre zu ihrem Credo zu machen und Blut, Schweiß und Leben in den Bau steingewordener Machtdelirien zu investieren, brachte jedes Mal sein Blut in Wallung. Er hasste die Macht der Herrschenden, den verlogenen Prunk, diese heuchlerische Heiligkeit.
Beim Betreten des Hauptschiffes hielt er kurz inne. Sein Blick fiel auf das marmorne Weihwasserbecken an dem gewaltigen Pfeiler neben ihm. Trotz seines Abscheus tauchte er seine Finger in das Wasser und bekreuzigte sich. Dann nahm er Kurs auf das Seitenschiff. Ein paar wenige Gläubige saßen versunken in den hinteren Bänken, lächerliche Sklaven ihrer infantilen Ängste, und erhofften das Heil von etwas Höherem, das nur in ihrer Phantasie existierte. Er steuerte sein Ziel an, den vordersten Beichtstuhl, dessen über das Türchen geschlagener Vorhang verriet, dass ein Geistlicher dort drinnen saß – soweit kannte er sich mit den katholischen Gepflogenheiten noch aus. Schwaches Licht, das durch einen Spalt austrat, bestätigte dies. Flüchtig sah er sich noch um, nahm den Hut vom Kopf und betrat den Beichtstuhl. Dort schloss er die Tür hinter sich und kniete nieder.
»Im Namen des Vaters, des Sohnes, und des Heiligen Geistes!«, flüsterte eine Stimme, und eine von zahlreichen Ringen dekorierte Hand machte das Kreuzzeichen.
»Lass den Quatsch, Meinrad. Ich bin es, Oskar.«
»Der heilige Segen wird dir nicht schaden«, sagte der Geistliche.
»Wenn du das sagst …«
»Ich vermute, du bist wieder einmal in Bedrängnis?«
Oskar kaute auf seiner Unterlippe. »Ja. Das kann man wohl sagen.«
Meinrad drückte sein Gesicht nahe an das Sprechgitter. »Du siehst blass aus«, konstatierte er. »Und dieser schwarze Kinnbart macht es noch schlimmer. Er steht dir nicht.«
»Mein Aussehen lass meine Sorge sein«, entgegnete Oskar.
»Immerhin bist du mein kleiner Bruder. Max und ich machen uns zunehmend Sorgen um dich«, raunte Meinrad. »Fünfundvierzig Jahre bist du jetzt alt, und noch immer hast du dein Leben nicht im Griff.«
»Ich kämpfe für eine gute Sache. Das kostet viel Lebenskraft. Ich glaube daran ebenso fest, wie du an deinen Gott.«
»Mich hat mein Glaube aber zu einer Bestimmung geführt, zu einer wertvollen Aufgabe. Du dagegen hast deinen Platz noch immer nicht gefunden. Wer sagt mir denn, dass das besser wird?«
»Du hast gut reden!«, stieß Oskar hervor, und seine Stimme wurde für kurze Zeit erheblich lauter als für einen Beichtstuhl angemessen. Dann beherrschte er sich und flüsterte erregt weiter: »Du als Kardinal verfügst über Würde, Respekt und eine Menge Geld! Geld, das ein Hofstaat von arbeitenden Gläubigen für dich aufbringt! Ich dagegen trete dafür ein, dass alle Menschen etwas haben!«
»Das Geld, über das ich verfüge, ist größtenteils nicht meines; es gehört der Kirche. Und auch ich arbeite für mein Geld; ich leite ein Bistum, dem viele Gemeinden angehören. Viele Menschen finden bei uns Trost und Geborgenheit.«
»Hätten sie mehr Geld, bräuchten sie die Kirche nicht.«
»Ich verspüre wenig Lust, mit dir über solche Fragen zu diskutieren«, entgegnete der Kardinal jetzt scharf. »Was willst du von mir? Doch sicher jenes Geld, das du glaubst von Moral wegen beanspruchen zu dürfen?«
»Ich beanspruche es nicht. Ich möchte dich nur um einen Gefallen bitten.«
»Wieviel brauchst du?«
Oskar holte tief Luft. »Fünftausend Reichsmark«, antwortete er zerknirscht.
Der Kardinal schwieg. »Für einen Kommunistenführer führst du ein ausschweifendes Leben. Mir ist zu Ohren gekommen, dass du regelmäßig Damen zu anrüchigen Clubs mitnimmst, sie in teure Restaurants ausführst, sie mit edlen Kleidern ausstaffierst – du lebst völlig über deine Verhältnisse.«
»Ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Unter meinem Mantel trage ich nurmehr ein zerlöchertes Hemd. Ich bin mit meiner Miete im Rückstand. Zahle ich nicht bald, setzt man mich auf die Straße.«
»Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Du bist wie ein Fass ohne Boden.«
»Wo ist denn die vielgerühmte Barmherzigkeit, von der ihr Paffen immer predigt?«
»Beim heiligen Franziskus! Ich habe dir schon dreimal Geld geliehen! Später erfuhr ich, dass auch Max dich schon unterstützt hat! In ein paar Monaten wirst du wiederum auftauchen!«
»Ich bin dein Bruder!«
»Ach, bist du das? Es fällt dir immer nur dann ein, wenn du in Schwierigkeiten steckst! Ansonsten höre ich nichts von dir außer dem, was man mir so zuträgt. Noch nicht einmal ein gemeinsamer Name verbindet uns mehr miteinander! Wie nennst du dich derzeit?«
»Wernicke. Was soll ich mit Veidt oder Kersch? Ich habe weder mit deinem noch Max‘ Vater etwas zu tun. Ich trage den Namen meiner Großmutter mit Andacht und Stolz.«
»Und warum nicht den Namen unserer Mutter?«
»Weil sie eine gottverdammte Hure war. Ich möchte durch nichts an sie erinnert werden.«
Der Kardinal schnappte nach Luft und fand erst nach einer Weile seine Stimme wieder. »Das Verurteilen anderer fiel dir schon immer leicht«, sagte er dann. »Aber dann finde dich auch damit ab, dass andere sich von dir abwenden.«
»Was willst du damit sagen?«
»Dass ich einen Parasiten wie dich nicht weiter unterstützen werde. Ich vermute, du hast die Chuzpe, mich erneut aufzusuchen, weil du nicht das geringste Unrechtsbewusstsein hast. Du glaubst, die ganze Welt schuldet dir etwas. Ansonsten wärest du eine Spur demütiger. Und ich dulde es nicht, dass du den Namen unserer Mutter beschmutzt, die ihr Leben dafür hingab, dir deines zu schenken.«
»Ich habe nicht darum gebeten. Weder, dass sie mir das Leben schenkt, noch, dass sie dabei verreckt.«
»Deine Wortwahl zeigt, dass du ein Kind der Gosse bist. Das Gespräch ist beendet. Leider kann ich dich von deinen Sünden nicht lossprechen, da bei dir keinerlei Reue zu spüren ist.«
Oskar Werneckes Stimme verwandelte sich in ein lauerndes Raunen. »Du sprichst mir von Unrecht und Reue? Sagt dir der Name Friederike von Orlock etwas?«
»Was willst du mir damit sagen?« Kardinal Meinrad Veidt klang jetzt rau und gequält.
»Ich bitte dich nur um eine Gefälligkeit, nichts weiter.«
Es war still im Beichtstuhl. Um die Lippen des Kardinals formte sich ein bitteres Lächeln. »So«, murmelte er schließlich, »sind wir jetzt also tatsächlich dort angekommen, was Max mir immer prophezeit hat und ich mich stets weigerte zu sehen. Mein kleiner Bruder versucht ganz offen, mich zu erpressen.«
»Ich möchte dich nur darauf hinweisen, dass du keinen Deut besser bist als ich. Ja, ich bin ein Kommunist, der zuweilen zuviel Geld ausgegeben hat. Aus Liebe zu Frauen! Ist das ausschließlich schlecht? Und du? Habt ihr Priester nicht Enthaltsamkeit und Keuschheit gelobt? War da nicht etwas von Nächstenliebe? Wer ist einem denn am nächsten, wenn nicht die eigenen Kinder?«
»Maße dir nicht an, das zu beurteilen. Gerade, wenn du von Liebe zu Frauen sprichst. Und wage es nicht, etwas anzuprangern, was mir heilig ist, auch, wenn es gegen den Kodex eines Geistlichen verstößt.«
Oskar Wernicke schürzte die Lippen. Endlich hatte er ihn soweit. »Sind wir uns denn nun einig?«
»Ich habe deine Absicht wohl verstanden«, schnaubte der Kardinal. »Ich werde dir das Geld zukommen lassen.«
»Wann?«
»Ende dieser Woche. Die gleiche Adresse wie beim letzten Mal?«
»Ja. Ich danke dir. Damit sind wir beide gerettet.« Oskar Wernicke erhob sich. »Jetzt fühle ich mich ganz leicht. Als hättest du mich doch von allen Sünden losgesprochen.«
Der Kardinal grunzte missfällig. Wernicke öffnete die Holztür, verließ den Beichtstuhl und schlenderte gelassen gen Ausgang.
Kardinal Veidt starrte noch eine Weile vor sich hin. »Ich muss mit Max sprechen«, murmelte er.
Kapitel III.
Freitag, 13. Mai 1927. Chocolatérie und Pralinenmanufaktur Trávníček. 8:17 Uhr morgens.
DER PULS DER GROßEN STADT begann, sich schon im Morgengrauen zu regen, gleich einem schlafenden Riesen, der langsam erwachte. Zunächst waren es nur ein paar blasse Gestalten, die von der Nachtschicht kamen, vereinzelte Hundebesitzer, ein paar Schupos. Dann wurden es immer mehr; die ersten Plakatankleber bewegten sich zu den Litfaßsäulen, die Zeitungsausträger schwärmten aus. Vor den Bäckereien war bereits der Duft von frisch gebackenem Brot, Brötchen, Hörnchen und Brezeln zu riechen. Die dampfenden Loks der Hochbahn zogen Waggons, die sich mit schlecht angezogenen Menschen füllten und die in Richtung der rauchenden Schornsteine fuhren, um ihre Arbeit anzutreten. Motoren setzten sich dort dröhnend in Betrieb, Maschinen begannen zu stampfen, Fließbänder zu rollen. Sehnige, schwielige Hände griffen zu Hebeln, Werkzeugen, Eimern und Stangen. Die Straßenkehrer hatten bereits zu Sonnenaufgang den größten Teil ihrer Arbeit vollendet und ihre Karren mit Kehricht und Unrat gefüllt. Die Geschäfte entriegelten ihre Gitter vor den Schaufenstern, beladene Pferdefuhrwerke fuhren durch die nun geöffneten Toreinfahrten in die Höfe, um ihre Waren abzuliefern. Aus den Häusern quollen immer mehr Menschen, und drängten sich in die Trambahnen und Etagenbusse, von denen nun immer mehr durch die Stadt rollten. Stinkende und knatternde, mit vornehmen und reichen Bürgern befüllte Automobile gesellten sich hinzu, aus den U-Bahnhöfen ergossen sich Massen von Volk, um schwatzend und schwitzend die Bürgersteige in Besitz zu nehmen. Die Bettler hielten ihre fleckigen Hüte in die Menge und die Stadtstreicher griffen nach all den weggeworfenen Zigarettenkippen und Zigarrenstumpen, die in den Rinnstein gerollt waren. Die Straßenhändler klappten ihre Kisten auf und begannen, lauthals ihre Waren anzupreisen.
Hinter den dicken Mauern von Trávníčeks Pralinenmanufaktur tauchte Bogdana Trojanovas Konditorengabel den gekühlten Schokoladentrüffel, den sie von ihrer Nachbarin erhalten hatte, sorgfältig in die flüssige Couverture, legte ihn auf das feine Abtropfgitter und streute rasch ein paar Walnusssplitter auf die noch warme Oberfläche. Seit den frühen Morgenstunden war es vermutlich der dreitausendste Trüffel, der durch ihre geschickten Hände gegangen war. Sie fühlte sich schwindelig, und ihr Rücken schmerzte vom ständigen gebeugten Stehen. Benommen wandte sie sich um und strebte auf das Waschbecken zu. Gierig hielt sie ihren Mund unter den Wasserhahn und ließ das kalte Nass in ihre ausgedörrte Kehle strömen.
Plötzlich fühlte sie einen harten Griff an ihrer Schulter. Ein kräftiger Ruck riss sie nach hinten.
»Faulenzen kannste in der Pause! Hier wird gearbeitet!« Der glatzköpfige Konditormeister packte sie an dem Träger ihrer Schürze und schubste sie rüde an ihren Platz.
»Verzeihen Sie!«
»Verzeihen tu ich garnüscht! Kannst froh sein, dassde hier arbeiten kannst! Andere sitzen aufda Straße! Nochmal, und du fliegst raus!«
Er schien die verächtlichen Blicke der Hilfsarbeiterinnen zu bemerken. Er baute sich vor ihnen auf, stemmte die Hände in die Seiten seines makellos weißen Arbeitskittels.
»Schön weitermachen, allesamt! Seid euch klar, dass ihr hier in der besdn Pralinenmanufaktur der Stadt arbeitn dürft! Unser Konfekt landet bei den höchsten Herrschaftn! Wir haben einen hervorragendn Ruf, und den gedenkn wa zu erhaltn! Schlendrian und Schluderei werdenwa nich dulden!«
Bogdana tupfte sich den Schweiß von der Stirn und machte sich zitternd an die Arbeit. Sie spürte die Blicke des Konditors noch in ihrem Nacken, als er längst zu einer anderen Stelle der Arbeitskette geschlendert war und ein anderes Mädchen zusammenschrie, das offenbar den Schichtnougat nicht exakt quadratisch geschnitten hatte.
Die schrille Klingel läutete die erlösende Pause ein. Alle drängten sich zum Wasser, um ihre Blechtassen zu füllen. Der Anblick der verschwitzten Körper in ihren weißen Schürzen und weißen Hauben verschmolz mit dem geflüsterten Stimmengewirr in verschiedensten osteuropäischen Sprachen. Die Frauen schoben sich gegenseitig beiseite, kniffen, traten. Eine wogende Masse magerer, wütender Körper, namenlose unterbezahlte Handlanger des großen Namens Trávníček, deren Wirken sich in prächtigem Konfekt, verpackt in edlen Schachteln mit Goldprägung erfüllte - zergehend auf den Zungen fetter, blasser Damen und Herren, die jemanden wie Bogdana niemals bewusst wahrnehmen würden.
Ein böser Gedanke erfüllte plötzlich Bogdanas Geist.
Ruhig entfernte sie sich und ging auf den Abort. Ein zugiger, aber äußerst gepflegter Bereich, im Winter unbeheizt und eiskalt, jetzt, im Frühsommer, erträglich. Man legte größten Wert auf Sauberkeit im Hause Trávníček. Sie sperrte ihre Tür zu, raffte Rock und Schürze nach oben, streifte ihre Unterhose ab und setzte sich erschöpft auf die kalte Schüssel. Während sie urinierte, fixierte sie ihren behaarten Schamhügel, schwarz wie ihr Haupthaar. Mit spitzen Fingern wühlte sie in den Locken, ergriff einige der Schamhaare und machte einen kräftigen Ruck. Sie rupfte einen ganzen Strauß ihrer schwarzen Blüten. Sorgfältig tunkte sie das Haarbüschel in den dunkelgelben Urin, wischte sich selbst trocken und erhob sich.
Die Pause war nach einer Viertelstunde zu Ende. Weiter ging es im Akkord. Bogdana sah sich verstohlen um. Der Konditormeister war nirgends zu sehen. Die Arbeiterinnen starrten geistesabwesend auf ihre Arbeitsfläche, links von Bogdana wurden die Trüffel gerollt, rechts von ihr in violette Wachspapierförmchen gelegt.
Bogdana ergriff die bereitliegenden Trüffel und drückte ihre ausgerupften, uringetränkten Schamhaare in die cremige Masse. Sorgfältig überzog sie sie dann mit Schokolade, bestreute sie routiniert mit den Nüssen und ließ sie auskühlen. Sie beobachtete befriedigt, wie die Hände ihrer teilnahmslosen russischen Kollegin die speziellen Trüffel in den Förmchen platzierten, die dann weiterwanderten, um in die vorgefertigten Schachteln einsortiert zu werden. Ein Blatt Seidenpapier kam darauf, dann der goldgeprägte Deckel, sowie ein seidenes Band mit Schleife. Und dann kam die edle Ware in den Laden.
Die Schachtel mit Bogdanas Spezialpralinen machte den üblichen Eindruck in der Auslage. Ein Bediensteter der Medikamentenhersteller Rieß & Matthey erwarb gleich zwölf Schachteln verschiedenster Sorten für eine Firmenfeier. Dort, im Firmenhaus, wurden sie am Ende des festlich dekorierten Büffets auf einem runden Tisch drapiert, die Schachteln erst zu fortgeschrittener Stunde einladend geöffnet, nachdem die zahlreichen Gäste Ihren Schampus getrunken, die Vorspeisen genossen, und sich an den Hauptgerichten delektiert hatten. Nachdem die Käseplatten weitgehend abgeräumt waren und man sich zu Kaffee und Cognac munter Konversation pflegend zu angeregt bis gelangweilt plaudernden Gruppen formiert hatte, griffen immer mehr Finger in die herrlichen Schatullen und ließen sich die Krone der Konditorenkunst auf der Zunge zergehen.
Dr. Rieß war ein würdiger, alter Herr mit strengem Gesicht und kurzgestutztem Schnurrbart, hochgewachsen und mit steifer, disziplinierter Haltung, dessen Seidenanzug sich jeder seiner dezenten Bewegungen vollendet anglich. Obwohl er mit dem gelungenen Fest sehr zufrieden war, diskutierte er wallenden Zornes mit den anderen Herren aus Industrie und Wirtschaft, die ob des ausgezeichneten Mahles und des guten Cognacs sehr aufgeschlossen waren und ihm beifällig zunickten.
»Noch dieses Jahr, meine Herren«, tobte er, »werden wir unseren Arbeitnehmern Versicherungen zahlen müssen! Nicht genug, dass wir vermehrt die Kosten für höhere Löhne und Urlaubstage tragen! Das ist das, was uns die verfluchten Sozis eingebrockt haben!«
»So ist es! Die Gewerkschaften werden viel zu mächtig. Sie schließen sich zunehmend zusammen. Bald werden sie uns ihre Bedingungen diktieren!«, grunzte der Abgeordnete der Deutschnationalen Partei.
»Ich halte alle nicht-konservativen Parteien ohnehin für vom Teufel gesandt«, bemerkte der Kardinal und nippte an seinem Eierlikör. Den italienischen Botschafter kostete dies ein Lächeln.
»Unsere Regierung ist sowieso weitgehend unfähig. Viel zu sanft mit dem ganzen bolschewistischen Gesocks. Ich hoffe auf eine entsprechende Veränderung bei der nächsten Reichstagswahl«, bemerkte ein junger, dicklicher Mann mit straff zurückgekämmtem Haar.
Richter Kersch, ein hagerer, kahlköpfiger Mann mit gewaltiger Hakennase und stechenden Augen, hatte bisher geschwiegen und an seiner Pfeife gezogen. Jetzt meldete er sich zu Wort. »Sie sind naiv, junger Freund. Das Volk ist viel zu dämlich, um die Politik zu durchschauen. Niemals wird es von selbst auf kritische Ideen kommen. Es wird alles mit sich machen lassen, bis unser Staat vor die Hunde geht. Und dabei werden sie noch jubeln, weil sie es nicht wahrhaben wollen. Erst wenn es nichts mehr zu fressen gibt, beginnt das Gejammer!«
»So ist es!«, ließ sich der General vernehmen, »man muss dem dummen Volk alles vorkauen! Aber es muss das Richtige sein!«
»Und die mundtot machen, die den Karren vor die Wand fahren!«, ergänzte der Bankier, ein finster aussehender Mann mit eingefallenen Wangen und hoher Stirn.
»Viel wichtiger noch wäre es, an den richtigen Stellen die Fäden zu ziehen. Wir brauchen noch mehr fähige Leute wie unseren famosen Politiker hier«, sagte Richter Kersch und hob sein Cognacglas in Richtung des DNVP-Abgeordneten.
Er trat an den schön dekorierten Tisch. Genüsslich nahm er aus einer der Schachteln ein Praliné heraus und schob es in den Mund. Die ganze Runde tat es ihm nach.
»Was ist DAS?« Der Richter verzog das Gesicht. Er steckte seine Finger in den Mund und fischte mehrere schwarze, krause Haare heraus.
»Pfui Teufel!« Der dicke junge Mann betrachtete angeekelt das Büschel von mindestens drei Haaren, das in seinem Trüffel gewesen war.
»Sieht ja fast aus wie Schamhaare«, stellte der italienische Botschafter fest. Der Kardinal wurde käseweiß. Dr. Rieß erstarrte. Er trat beiseite und griff einen der Kellner am Ärmel. »Welcher unfähige Idiot hat diese Pralinen besorgt?«, zischte er ihn an. »Unser Chefkoordinator, gnädiger Herr!«, stotterte der junge Mann verschüchtert. »Er hat sie von Trávníček, der ersten Konditorei der Stadt erworben!«
»Was für ein beschissener Laden«, rief der Abgeordnete, der noch immer versuchte, eines der Haare aus seinen Zähnen zu entfernen. »Wenn ich schon den Namen höre! ›Trávníček‹! Ist das überhaupt ein deutsches Unternehmen?«
»Ein Unternehmen, das es hierzulande seit 1883 gibt. Soweit ich aber weiß, beschäftigt es lauter Polinnen, Russinnen und Bulgarinnen«, sagte der finstere Bankier und beförderte die halbzerkaute Trüffelmasse samt Haaren in sein Taschentuch.
»Und wahrscheinlich Juden!«, grollte der DNVP-Abgeordnete.
»Freunde, denkt nach!«, beschwichtigte der Richter, und schenkte sich rasch einen neuen Cognac ein. »Das ist kaum die Schuld von Dr. Rieß’ Bediensteten, und mit Sicherheit nicht die dieses renommierten Konditors. Das ist Revolution! Da versucht jemand, dessen Ruf zu ruinieren, indem er seine Produkte verdirbt! Und dieser Mensch will uns zu seinem willfährigen Instrument machen, indem er uns seine ekelhaften Streiche zumutet, um uns zu erzürnen, auf dass wir für ihn Rachefeldzüge austragen! Im Grunde ist das Ganze eine Kleinigkeit, aber bedenken Sie das Prinzip, das dahintersteckt!«
»Ich werde Trávníček unverzüglich darüber informieren!«, zürnte Dr. Rieß.
»Tun Sie das! Das sollten Sie sogar! Trávníček muss wissen, was in seinem eigenen Betrieb vor sich geht.«
»Aber er wird seine ganze Belegschaft dafür bestrafen. Und womöglich entlassen!« sagte der italienische Botschafter.
»Das wollen wir doch auch hoffen!«, sagte Richter Kersch. »Die Arbeiter müssen wissen, dass sie nicht in die Hand beißen sollten, die sie nährt. Nur mit drakonischen Maßnahmen kann dies glaubwürdig vor Augen geführt werden!«
»Genau! Solches Tun muss im Keim erstickt werden!«, bellte der General, begleitet von zustimmendem Gemurmel.
Eine schlanke Frauenhand langte in ein Pralinenkästchen.
»Tun Sie das nicht!«, rief der dickliche junge Mann. »Die Trüffel sind schlecht!«
»Ich wollte auch keine Trüffel«, sagte Eva Gutmann. »Ich bevorzuge Blätterkrokant.«
Kajetán Trávníček erfuhr von dem Ereignis bereits am nächsten Morgen. Schon vor Ladenöffnung begab er sich in die Manufaktur, um von seinem glatzköpfigen Konditormeister in Begleitung einiger Gehilfen zu den Arbeiterinnen geführt zu werden.
»Alle herhörn!«, brüllte der Glatzkopf in die Halle. »Eine von Euch hat gestern absichtlich die Trüffelproduktion versaut. Obwohl wir hier größtn Wert auf Hygiene und Sauberkeit legn! Also muss es absichtlich geschehn sein! Dunkle Haare in größrer Zahl sind in die Pralinen reingearbeitet wordn. So etwas darf nich passiern und wird auch nich mehr passiern! Daher werdn wir alle, die bei der Herstellung der Trüffel beteiligt sind, entlassn!«
Ein Raunen der Empörung erscholl.
»… es sei denn: Die Schuldige stellt sisch von selbst!«
Die Frauen sahen sich nervös an. Lautes Stimmengewirr schwoll an. Die ersten begannen, sich anzuschreien.
»Ruhe!« Das laute Organ des Konditormeisters brachte alle schlagartig zum Schweigen.
»Du da!« Sein langer Zeigefinger bohrte sich durch die Luft in Bogdana.
»Haben Sie diese Frau in Verdacht?«, wollte Trávníček wissen.
»Und ob ich das hab! Sie war bereits gestern sehr rebellisch. Hat sich nich an die Vorschriften gehaltn. Und an ihrer Position wär es für sie leicht, was reinzuknetn. Durch das Eintauchen in die Schokolade konnt sies sofort kaschiern.«
»Eine von den anderen davor hätte es auch sein können«, meinte Trávníček.
»Die sind strohblond«, sagte der Glatzkopf triumphierend. »Und mit Sicherheit nich nur aufm Kopf.«
Trávníček trat zu Bogdana. »Haben Sie das getan?«
Die Frau zitterte und brachte kein Wort heraus.
»Na?«
Sie schüttelte wild den Kopf.





























