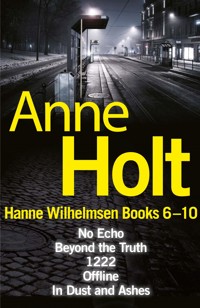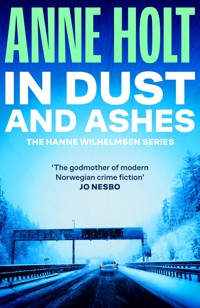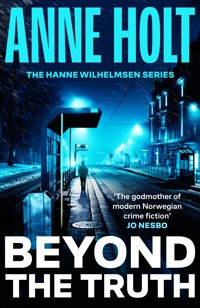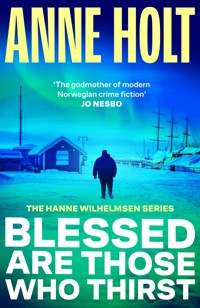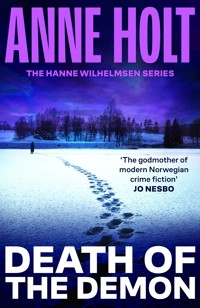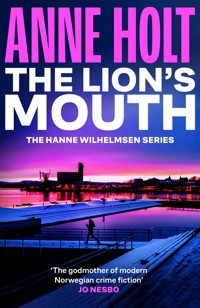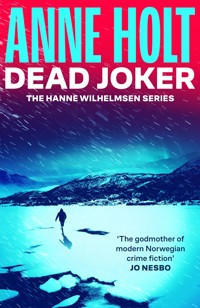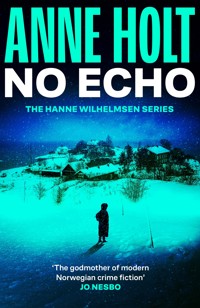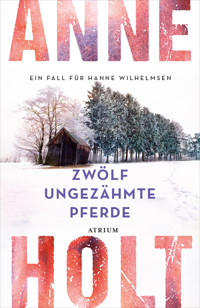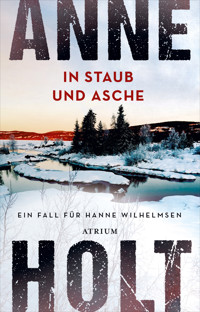11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atrium Verlag AG
- Kategorie: Krimi
- Serie: Hanne-Wilhelmsen-Reihe
- Sprache: Deutsch
Eine Geschichte über Fürsorge, Schutz und Schuld Das Kinderheim "Frühlingssonne" am Rande von Oslo hat einen neuen Mitbewohner. Dem zwölfjährigen Olav fällt es schwer, sich in die Regeln des beinahe idyllischen Lebens in der alten Villa einzufügen, und mit Erschrecken stellt die Leiterin Agnes Vestavik fest, etwas in seinen Augen zu entdecken, was sie bei einem Kind bisher noch nie gesehen hat: Hass. Eines Tages ist Olav verschwunden und Agnes Vestavik wird tot an ihrem Schreibtisch aufgefunden – erstochen mit einem Küchenmesser. Die frisch zur Hauptkommissarin ernannte Hanne Wilhelmsen macht sich auf die Suche nach dem Jungen. Doch dieser Fall wird sie an die Grenzen ihrer Fähigkeiten als Ermittlerin führen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Anne Holt
Das einzige Kind
Hanne Wilhelmsens dritter Fall
Aus dem Norwegischen von Gabriele Haefs
Die deutsche Erstausgabe erschien 1998 im Piper Verlag, München.
This translation has originally been published with the financial support of NORLA, Norwegian Literature Abroad
Das Gedicht »An –« von Edgar Allan Poe wurde den
»Gesammelten Werken in zehn Bänden«, hrsg. von Kuno Schumann
und Hans Dieter Müller, Walter Verlag, Olten 1966, entnommen.
© Atrium Verlag AG, Zürich, 2024
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © Anne Holt 1995
Die Originalausgabe erschien 1995 unter dem Titel Demonens død
bei Cappelens Forlag, Oslo.
Für die vorliegende Ausgabe wurde die deutsche Übersetzung
von der Übersetzerin überarbeitet.
Published by agreement with Salomonsson Agency
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: Arcangel Images/Des Panteva,
Shabby vintage grain Struktur: FinePic®, München
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
ISBN978-3-03792-212-5
www.atrium-verlag.com
www.facebook.com/atriumverlag
www.instagram.com/atriumverlag
Für Erik Langbråten, der mir so viel über Die Wichtigen Dinge beigebracht hat.
An –
Gleich gilt mir’s, dass mein irdisch Geschick
mir so wenig Irdisches erwies –
dass Jahre der Liebe ein Augenblick
des Hasses vergessen ließ: –
auch dass noch glücklicher sind denn ich
die Einsamen, acht’ ich gering –
doch es quält mich, dass du dich grämst um mich,
der doch nur vorüberging.
Edgar Allan Poe
1
»Ich bin der Neue!«
Mit energischen Schritten stapfte er mitten ins Zimmer. Dort blieb er stehen, und der an seinen riesigen Turnschuhen klebende Schnee bildete um seine Füße herum kleine Lachen. Breitbeinig, wie um seine X-Beinigkeit zu verbergen, stand er da, dann breitete er die Arme aus und sagte noch einmal: »Ich bin der Neue!«
Sein Kopf war auf der einen Seite kahl rasiert. Vom rechten Ohr aus waren widerspenstige rabenschwarze Haare über seinen Schädel gekämmt und endeten dann, glatt abgeschnitten, einige Millimeter über der linken Schulter. Eine dicke, verfilzte Locke hing über das eine Auge. Der Mund formte ein wackeliges U, als der Junge immer wieder versuchte, sich diese Locke aus dem Gesicht zu blasen. Seine Steppjacke war Größe 56, um die Taille herum passte sie genau, aber ansonsten war sie einen halben Meter zu lang, während die dreißig Zentimeter überflüssiger Ärmelstoff zu dicken Manschetten aufgerollt waren. Die Hosenbeine schlackerten um die Waden. Als er mit einiger Mühe die Jacke öffnete, wurde allerdings klar, dass sie an den Oberschenkeln trotzdem saßen wie angegossen.
Das Zimmer war groß. Der Junge hielt es nicht für ein Wohnzimmer, es gab schließlich weder eine Sitzecke noch einen Fernseher. An einer Wand befanden sich eine Art Anrichte, ein Spülbecken und ein Herd. Aber nach Essen roch es hier nicht. Er hob die Nase, schnupperte und überlegte, dass es noch eine weitere Küche geben müsse. Eine richtige Küche. Dieses Zimmer hier war ein Aufenthaltsraum. An den Wänden waren Zeichnungen befestigt, unter der ungewöhnlich hohen Decke hingen kleine Mobiles und Wollfiguren, offenbar von Kindern gebastelt.
Über seinem Kopf flatterte eine Möwe aus Pappe und Wolle, grau und weiß und mit feuerrotem Schnabel, der halb abgefallen war und wie ein lockerer Zahn an einem dünnen Faden hing. Er streckte die Hand danach aus, reichte aber nicht hoch genug. Statt des Schnabels riss er ein Osterküken aus Eierkarton und gelben Federn von der Decke. Er hob es auf, rupfte ihm alle Federn aus und warf den Karton wieder auf den Boden.
Unter zwei großen Fenstern mit aufgeklebten Sprossen stand ein riesiger Arbeitstisch. Vier Kinder unterbrachen ihre Beschäftigung. Sie starrten den Neuankömmling an. Das älteste, ein Mädchen von vielleicht elf, musterte ihn ungläubig von Kopf bis Fuß. Zwei Jungen, die mit ihren identischen Pullovern und kreideweißen Mähnen Zwillinge sein konnten, kicherten, tuschelten und stupsten sich gegenseitig an. Eine rothaarige Vier- oder Fünfjährige saß einige Sekunden ganz verängstigt da, dann rutschte sie von ihrem Stuhl und lief zur einzigen Erwachsenen im Raum hinüber, einer kräftigen Frau, die die Kleine sofort hochhob und ihr beruhigend über die Locken strich.
»Das ist der Neue«, sagte sie. »Er heißt Olav.«
»Hab ich doch schon gesagt«, erklärte Olav sauer. »Ich bin der Neue. Bist du verheiratet?«
»Ja«, antwortete die Frau.
»Und wohnen hier nur diese Kinder?«
Seine Enttäuschung war deutlich zu hören.
»Nein, das weißt du doch«, sagte die Frau und lächelte. »Hier wohnen sieben Kinder. Die drei da hinten …«
Sie nickte zu den dreien am Tisch hinüber und bedachte sie gleichzeitig mit einem strengen Blick. Die Jungen ließen sich davon nicht beeindrucken.
»Und die da? Wohnt die nicht hier?«
»Nein, das ist meine Tochter. Sie ist nur heute mal mitgekommen.«
Sie lächelte, während das Kind seinen Kopf an den Hals der Mutter schmiegte und sich noch fester an sie klammerte.
»Ach so. Hast du viele Kinder?«
»Drei. Das hier ist die Jüngste. Sie heißt Amanda.«
»Blöder Name. Und außerdem seh ich selber, dass sie die Jüngste sein muss. Du bist doch zu alt, um noch Kinder zu kriegen.«
Die Frau lachte.
»Da hast du recht. Jetzt bin ich zu alt. Meine beiden anderen Kinder sind fast erwachsen. Aber möchtest du nicht Jeanette Guten Tag sagen? Sie ist fast so alt wie du. Und Roy-Morgan? Der ist acht.«
Roy-Morgan wollte den Neuen durchaus nicht begrüßen. Er rutschte auf seinem Stuhl hin und her und tuschelte demonstrativ abweisend mit seinem Nachbarn.
Jeanette runzelte die Stirn und rutschte auf ihrem Stuhl nach hinten, als Olav mit ausgestreckter Hand, von der schmutziger schmelzender Schnee heruntertropfte, auf sie zukam. Ehe er Jeanette erreicht hatte und ehe sie auch nur Anstalten machen konnte, die gespreizten Finger zu berühren, die ihr da angeboten wurden, machte er eine tiefe Verbeugung und erklärte feierlich: »Olav Håkonsen. Es ist mir ein Vergnügen.«
Jeanette presste sich an die Stuhllehne, packte den Sitz mit beiden Händen und zog die Knie bis ans Kinn. Der neue Junge wollte die Hände seitlich herabhängen lassen, aber seine Körperform und seine Kleidung sorgten dafür, dass seine Arme wie beim Michelinmännlein schräg abstanden. Seine offensive Haltung war wie weggeblasen, und er vergaß das Breitbeinig-Stehen. Jetzt berührten die Knie sich unter seinen dicken Oberschenkeln, und die Spitzen der großen Zehen in den riesigen Turnschuhen zeigten aufeinander.
Die kleinen Jungen verstummten.
»Ich weiß, warum du mir nicht Guten Tag sagen willst«, sagte Olav.
Die Frau hatte das kleinste Kind in ein anderes Zimmer gebracht. Als sie zurückkam, entdeckte sie in der Türöffnung Olavs Mutter. Mutter und Sohn sahen einander ungeheuer ähnlich; die gleichen schwarzen Haare, der gleiche breite Mund mit einer auffälligen Unterlippe, die ungewöhnlich weich und außerdem feucht und dunkelrot aussah, nicht trocken und rissig, wie es eigentlich zur Jahreszeit gepasst hätte. Bei dem Jungen wirkte diese Lippe kindlich. Bei der Erwachsenen sah sie abstoßend aus, vor allem, weil immer wieder eine ebenso rote Zunge hervorschoss und sie anfeuchtete. Neben dem Mund zogen vor allem die Schultern die Blicke auf sich. Genauer gesagt, die Frau hatte gar keine Schultern. Vom Kopf her zog sich ein gleichmäßiger Bogen nach unten, wie bei Bowlingkegeln oder Birnen, eine gewölbte Linie, die an unfassbar dicken Hüften endete, unter denen dicke Oberschenkel und dünne Waden die Gestalt trugen. Ihre Körperform war deutlicher zu sehen als die des Jungen, vermutlich, weil ihr Mantel so eng saß. Die andere Frau versuchte erfolglos, ihren Blick aufzufangen.
»Ich weiß, warum du mir nicht Guten Tag sagen willst«, sagte Olav noch einmal. »Weil ich so fett und hässlich bin.«
Er sagte das, ohne sich auch nur im Geringsten verletzt anzuhören, mit leichtem, zufriedenem Lächeln, fast als wäre es eine soeben erst entdeckte Tatsache, die Lösung eines komplizierten Problems, das ihn nun schon zwölf Jahre lang beschäftigt hatte. Er drehte sich um und fragte, ohne die kräftige Kinderheimangestellte anzusehen, wo er wohnen sollte.
»Würdest du mir bitte mein Zimmer zeigen?«
Die Frau streckte die Hand nach seiner aus, aber statt danach zu fassen, machte der Junge mit dem Arm eine galante Bewegung und verbeugte sich leicht.
»Damen haben Vortritt.«
Dann watschelte er hinter ihr her in den ersten Stock.
Er war so groß. Und ich wusste, dass etwas nicht stimmte. Sie legten ihn mir in die Arme, und ich empfand keine Freude, keine Trauer. Sondern Ohnmacht. Eine riesige, schwere Ohnmacht, so als sei mir eine Aufgabe gestellt worden, der ich niemals gewachsen sein würde. Sie trösteten mich. Alles sei ganz normal. Er sei einfach nur groß.
Groß! Normal? Hatten sie je versucht, einen Brocken von 5340 Gramm aus sich herauszupressen? Ich war drei Wochen über die Zeit, aber das wollte die Ärztin mir nicht glauben. Als ob die eine Ahnung hätten! Ich wusste genau, wann er entstanden war. An einem Dienstagabend. Einem der Abende, an denen ich nachgegeben hatte, weil ich keinen Streit wollte, als meine Angst vor einem weiteren seiner Wutanfälle so groß war, dass ich nicht dagegen ankonnte. Nicht an diesem Abend. Nicht bei dem vielen Alkohol im Haus. Am nächsten Tag hatte er dann seinen tödlichen Unfall gebaut. An einem Mittwoch. Und seither hatte ich keinen Mann in meine Nähe gelassen, bis dieses schwabbelige Baby mit einem Lächeln auf die Welt kam. Das stimmt! Er lächelte! Die Ärztin behauptete, das sei nur eine Grimasse. Ich weiß, dass es ein Lächeln war. Dieses Lächeln hat er noch immer, hat er immer gehabt. Seine beste Waffe. Zum letzten Mal geweint hat er mit anderthalb Jahren.
Sie legten ihn auf meinen Bauch. Eine unbegreifliche Masse neues Menschenfleisch, das sofort die Augen aufriss und mit seinem breiten Mund meine Haut nach der Brust absuchte. Die Leute in den weißen Kitteln lachten und gaben ihm noch einen Klaps aufs Hinterteil. Was für ein kleiner Kobold, sagten sie.
Ich wusste, dass etwas nicht stimmte. Sie sagten, alles sei normal.
Acht Kinder und zwei Erwachsene saßen um einen ovalen Esstisch. Sieben Kinder sprachen zusammen mit den Erwachsenen ein Tischgebet. Der Neue hatte recht gehabt. Er war bei seiner Ankunft nicht in die Küche geführt worden.
Die Küche lag weiter hinten in der großen umgebauten Villa aus der Jahrhundertwende, und damals war sie wahrscheinlich nur eine Anrichteküche gewesen. Sie war anheimelnd und gemütlich, mit blauen Möbeln und Flickenteppichen. Das Einzige, was hier anders war als in einem normalen Wohnhaus, waren die ungewöhnlich große Kinderschar und die Dienstpläne. Die hingen an einer großen Pinnwand neben der Tür, die in eins der Wohnzimmer führte, in den Aufenthaltsraum, das wusste der Neue schon. Außer mit den Namen waren die Dienstpläne auch mit kleinen Fotos der Angestellten versehen. Der Junge hatte erfahren, dass nicht alle Kinder lesen konnten.
»Ha, die können nicht lesen!«, hatte er spöttisch kommentiert. »Die sind doch alle schon über sieben!«
Als Antwort hatte ihm die kräftige Frau, die die Heimleiterin war, nur ein freundliches Lächeln zugedacht.
»Das heißt nicht Heimleiterin«, hatte er behauptet. »Das heißt Heimleiter. Immer. Genau wie es Doktor heißt, auch bei einer Frau.«
»Mir gefällt Heimleiterin aber viel besser«, sagte die Frau. »Außerdem kannst du mich Agnes nennen. So heiße ich nämlich.«
Agnes war jetzt nicht da. Die Erwachsenen am Abendbrottisch waren viel jünger. Der Mann hatte noch jede Menge Pickel. Die Frau war ziemlich hübsch, sie hatte lange blonde Haare, auf eine seltsame Weise schon ganz hoch oben am Kopf zu einem Zopf geflochten, der in einer roten Seidenschleife endete. Der Mann hieß Christian, die Frau Maren. Alle fassten einander an den Händen und sangen ein kurzes Lied. Der Junge wollte nicht mitmachen.
»Das brauchst du auch nicht, wenn du nicht willst«, sagte Maren. Sie war wirklich lieb. Dann fingen sie an zu essen.
Neben Olav saß Jeanette, die ihn morgens nicht hatte begrüßen wollen. Sie war auch ein bisschen dick, und immer wieder lösten sich ihre struppigen braunen Haare aus dem Gummiband. Sie hatte nicht neben Olav sitzen wollen, aber Maren hatte jegliche Diskussion energisch unterbunden. Jetzt war sie so weit an die Stuhlkante herangerückt, wie es überhaupt nur möglich war, was wiederum Roy-Morgan veranlasste, ihr immer wieder den Ellbogen zwischen die Rippen zu stoßen und sich zu beschweren, weil sie ihm angeblich Mädchenläuse verpasste. Auf Olavs anderer Seite saß Kenneth. Kenneth war mit seinen sieben Jahren der jüngste Hausbewohner. Er mühte sich mit der Butter ab und zerbrach eine Schnitte.
»Du bist noch ungeschickter als ich«, sagte Olav zufrieden, schnappte sich noch ein Stück Brot, bestrich es sorgfältig mit Margarine und legte es auf Kenneths Teller. »Was willst du darauf haben?«
»Marmelade«, flüsterte Kenneth und schob die Hände unter seine Oberschenkel.
»Marmelade, du Trottel! Dann brauchst du doch keine Butter!«
Olav nahm noch ein Stück Brot, platzierte einen dicken Löffel Blaubeermarmelade in die Mitte und verteilte sie mit energischen Bewegungen.
»Hier!«
Er klatschte das Brot auf Kenneths Teller und nahm sich das mit der Margarine. Er schaute sich um.
»Wo ist der Zucker?«
»Wir brauchen keinen Zucker«, sagte Maren.
»Ich will Zucker aufs Brot.«
»Das ist nicht gesund, das machen wir hier nicht.«
»Weißt du überhaupt, wie viel Zucker in der Marmelade ist, mit der dieser Trottel da sich vollstopft?«
Die anderen Kinder verstummten und lauschten interessiert. Kenneth war knallrot angelaufen und hörte, den Mund noch voll Brot, zu kauen auf. Maren erhob sich. Christian wollte etwas sagen, aber nun ging Maren um den Tisch herum und beugte sich über Olav.
»Dann kannst du ja auch Marmelade essen«, sagte sie freundlich. »Übrigens ist das Diätmarmelade, sieh her.«
Sie griff nach dem Glas, aber der Junge kam ihr mit einer blitzschnellen Bewegung zuvor, die man ihm gar nicht zugetraut hätte. Er sprang so plötzlich auf, dass sein Stuhl umfiel, und schleuderte das Glas quer durch das Zimmer gegen die Kühlschranktür. Die Tür wurde eingebeult, das Glas blieb aus unerfindlichen Gründen heil. Ehe irgendjemand ihn aufhalten konnte, stand er vor dem Küchenschrank auf der anderen Seite und riss einen großen Zuckertopf heraus.
»Hier ist der Zucker«, schrie er. »Hier ist der verdammte Scheißzucker!«
Er riss den Deckel vom Topf und warf ihn auf den Boden, dann wirbelte er in einer Zuckerwolke durch die Küche. Jeanette lachte. Kenneth weinte. Glenn, der vierzehn war und schon dunkle Haare auf der Oberlippe hatte, murmelte, Olav sei ein Idiot. Raymond war siebzehn und mit allen Wassern gewaschen. Er betrachtete den Aufstand mit stoischer Ruhe, nahm dann seinen Teller und verschwand. Die sechzehnjährige Anita folgte seinem Beispiel. Roy-Morgans Zwillingsbruder Kim-André packte aufgeregt und glücklich die Hand seines Bruders. Er schaute zu Jeanette hinüber und fing ein wenig unsicher ebenfalls an zu lachen.
Der Zuckertopf war leer. Olav wollte ihn auf den Boden werfen, wurde aber in letzter Sekunde von Christian daran gehindert, denn Christian packte ihn am Arm und hielt ihn mit eisernem Griff fest. Olav schrie und versuchte, sich loszureißen, aber nun stand Maren neben ihm und legte die Arme um ihn. Für seine zwölf Jahre war Olav ungewöhnlich stark, aber sie merkte doch nach zwei Minuten, dass er sich langsam beruhigte. Sie redete die ganze Zeit leise auf ihn ein.
»Aber, aber, jetzt beruhige dich doch. Es ist alles in Ordnung.«
Als er merkte, dass Maren den Jungen unter Kontrolle hatte, ging Christian mit den anderen Kindern in den Aufenthaltsraum. Kenneth hatte sich erbrochen. Ein kleiner unappetitlicher Haufen aus Brotmasse, Milch und Blaubeeren lag auf dem Teller, den er mit unsicherem Griff mit hinaus nehmen wollte, wie die anderen es ihm vorgemacht hatten.
»Lass den stehen, du«, sagte Christian. »Ich geb dir eins von meinen Broten.«
Kaum waren die anderen Kinder verschwunden, als Olav auch schon ganz zur Ruhe kam. Maren ließ ihn versuchsweise los, und er sank wie ein Sitzsack auf dem Boden in sich zusammen.
»Ich esse immer Zuckerbrot«, murmelte er. »Und meine Mutter findet das in Ordnung.«
»Dann schlage ich vor«, sagte Maren, setzte sich neben ihn und lehnte den Rücken an die verbeulte Kühlschranktür, »dass du bei deiner Mutter Brot mit Zucker isst, wie du es gewohnt bist, und dass du hier so isst wie wir anderen alle. Ist das nicht eine gute Idee?«
»Nein.«
»Vielleicht gefällt sie dir nicht, aber es muss leider dabei bleiben. Wir haben hier einige Regeln, an die alle sich halten müssen. Alles andere wäre ziemlich ungerecht. Oder nicht?«
Der Junge gab keine Antwort. Er schien sehr weit weg zu sein. Vorsichtig legte sie eine Hand auf seinen dicken Oberschenkel. Er reagierte augenblicklich. Er versetzte ihrem Arm einen Schlag.
»Fass mich nicht an, zum Teufel!«
Ruhig erhob sie sich, blieb stehen und blickte auf ihn hinunter.
»Möchtest du noch etwas zu essen, ehe ich abräume?«
»Ja. Sechs Brote mit Zucker.«
Maren lächelte kurz, zuckte mit den Schultern und fing an, die Lebensmittel in Plastikfolie zu wickeln.
»Muss ich in diesem Drecksloch auch noch hungrig ins Bett gehen?«
Jetzt blickte er ihr zum ersten Mal in die Augen. Seine waren ganz schwarz, zwei tiefe Löcher in seinem fetten Gesicht. Ihr kam der Gedanke, dass er hübsch sein könnte, wenn er nicht so riesig wäre.
»Nein, Olav, du brauchst nicht hungrig ins Bett zu gehen. Das liegt allein bei dir. Du bekommst keinen Zucker aufs Brot, jetzt nicht, morgen nicht. Nie. Du wirst verhungern, wenn du darauf wartest, dass wir nachgeben. Alles klar?«
Er begriff nicht, wieso sie so ruhig bleiben konnte. Es verwirrte ihn, dass sie nicht nachgab. Er konnte noch immer nicht fassen, dass er hungrig zu Bett gehen sollte. Ganz kurz dachte er, dass Salami eigentlich auch gut schmeckte. Doch diesen Gedanken ließ er sofort wieder fallen.
Mühsam und vor Anstrengung schnaufend kam er auf die Beine.
»Ich bin verdammt noch mal so fett, dass ich nicht mal aufstehen kann«, sagte er leise zu sich selbst und ging zur Tür.
»Du, Olav!«
Maren hatte ihm den Rücken zugekehrt und untersuchte die Beule im Kühlschrank. Er blieb stehen, drehte sich aber nicht zu ihr um.
»Es war sehr nett von dir, dass du Kenneth bei seinem Brot geholfen hast. Er ist so klein und empfindlich.«
Der Zwölfjährige blieb kurz stehen und zögerte, dann drehte er sich langsam um.
»Wie alt bist du?«
»Ich bin sechsundzwanzig.«
»Ach so.«
Olav ging hungrig ins Bett.
Raymond schnarchte. Er schnarchte wirklich wie ein Erwachsener. Das Zimmer war groß, und im trüben Licht, das aus der Nacht draußen kam, konnte Olav über dem Bett seines Zimmernachbarn ein riesiges Rednex-Plakat erkennen. In der Ecke stand ein zerlegtes Geländefahrrad. Raymonds Schreibtisch war ein Chaos aus Schulbüchern, Butterbrotpapier, Comics und Werkzeug. Olavs eigener Tisch stand kahl und nackt da.
Das Bettzeug war sauber und ein bisschen steif. Es roch fremd, aber gut. Irgendwie nach Blumen. Es war viel schöner als das bei ihm zu Hause, es war mit Formel-1-Autos in vielen Farben bedruckt. Kissen- und Deckenbezug hatten dasselbe Muster, und das Laken war blau, so wie einige Autos. Zu Hause hatte er nie passendes Bettzeug gesehen.
Die Vorhänge bewegten sich im Luftzug des angekippten Fensters. Raymond hatte es so haben wollen. Olav war an ein warmes Schlafzimmer gewohnt, und obwohl er einen neuen Schlafanzug und eine warme Decke hatte, fror er ein wenig. Er hatte Hunger.
»Olav!«
Das war die Heimleiterin. Oder Agnes. Sie flüsterte von der Tür her: »Schläfst du?«
Er drehte sich mit dem Gesicht zur Wand und gab keine Antwort.
Geh weg, geh weg, sagte eine Stimme in seinem Kopf, aber das half nichts. Jetzt saß sie auf der Bettkante.
»Fass mich nicht an!«
»Ich will dich nicht anfassen, Olav. Ich will nur ein bisschen mit dir reden. Du bist beim Abendessen wütend geworden, habe ich gehört.«
Kein Wort.
»Du musst doch verstehen, dass ihr euch hier nicht so aufführen könnt. Stell dir vor, alle feuerten die ganze Zeit Zucker und Marmelade an die Wand!« Sie lachte ein leises, perlendes Lachen. »Das wäre vielleicht eine Bescherung!«
Er sagte noch immer nichts.
»Ich habe dir was zu essen mitgebracht. Drei Brote. Mit Wurst und Käse. Und ein Glas Milch. Ich stelle alles neben dein Bett. Wenn du es essen magst, freue ich mich, wenn nicht, dann können wir ausmachen, dass du es morgen früh wegwirfst, ohne dass die anderen es sehen. Dann weiß niemand, ob du es gegessen hast oder nicht. Okay?«
Der Junge bewegte sich ein wenig und drehte sich dann plötzlich um.
»Hast du entschieden, dass ich hier wohnen muss?«, fragte er wütend.
»Nicht so laut«, sagte sie. »Sonst weckst du Raymond. Nein, du weißt genau, dass ich das nicht entscheiden kann. Meine Aufgabe ist es, mich um dich zu kümmern. Zusammen mit den anderen Erwachsenen. Das wird schon alles gut laufen. Auch, wenn deine Mutter dir sicher fehlen wird. Aber du kannst sie ja oft besuchen, das darfst du nicht vergessen.«
Jetzt hatte er sich im Bett halb aufgesetzt. Im trüben Licht sah er aus wie ein dicker Dämon; seine rabenschwarzen Haare mit der unvorteilhaften Frisur, der breite Mund, der selbst in der Dunkelheit blutrot leuchtete. Unwillkürlich wandte sie ihren Blick ab. Die Hände auf der Decke waren die eines kleinen Kindes. Groß, aber mit Babyhaut, und hilflos umklammerten sie nun zwei Autos auf dem Bettbezug.
Himmel, dachte sie. Dieses Monstrum ist zwölf Jahre alt. Zwölf Jahre!
»Eigentlich«, sagte er und starrte ihr ins Gesicht, »bist du mein Kerkermeister. Das hier ist ein verdammtes Gefängnis!«
Und die Leiterin des Kinderheims Frühlingssonne, von Oslos einzigem Wohnheim für Kinder und Jugendliche, sah etwas, das sie in ihren dreiundzwanzig Dienstjahren in der Jugendfürsorge noch nie gesehen hatte. Unter den schwarzen schmalen Augenbrauen des Jungen erkannte sie das, was so viele verzweifelte Erwachsene mit sich herumschleppten; Menschen, denen ihre Kinder weggenommen worden waren und die sie, Agnes, mit dem Rest der Bürokratie, die sie verfolgte, auf eine Stufe stellten. Bei einem Kind hatte Agnes Vestavik das noch nie gesehen.
Hass.
Mit neuen Versprechungen wurde ich dann aus der Klinik nach Hause geschickt. Alles sei in Ordnung. Er sei nur ein bisschen gierig. Und das liege nur daran, dass er so ein fescher großer Bursche sei. Nach drei Tagen wurde ich in eine leere Wohnung zurückgeschickt. Das Sozialamt hatte mir Geld für ein Bett, einen Wippstuhl und ein wenig Kinderwäsche gegeben. Zwei- oder dreimal hatte mich eine Mitarbeiterin besucht, ich hatte mitbekommen, dass sie heimlich in die Ecken schaute und behauptete, sie müsse zur Toilette. Nur um zu sehen, ob es bei mir sauber war. Als ob das je ein Problem gewesen wäre. So oft, wie ich putze. Bei uns riecht es doch die ganze Zeit nach Ajax.
Er füllte die Wohnung sofort aus. Ich weiß nicht so recht, aber schon am ersten Abend schien er davon auszugehen, dass das hier sein Platz sei, seine Wohnung, seine Mama. Seine Nächte. Er weinte nicht. Er lärmte nur. Andere hätten vielleicht gesagt, er weine, aber das tat er nicht. Er vergoss nur selten Tränen. Wenn er ein seltenes Mal wirklich weinte, ließ er sich rasch trösten. Dann hatte er Hunger. Ich steckte ihm die Brust in den Mund, und schon hielt er die Klappe. Ansonsten machte er nur Krach. Einen schreienden, klagenden Krach, und dabei fuchtelte er mit den Armen, strampelte sich aus der Decke heraus und riss sich die Kleider vom Leib. Er füllte die Wohnung dermaßen aus, dass ich ab und zu einfach wegmusste. Ich steckte ihn ins Badezimmer, weil das am besten isoliert ist, und schnallte ihn auf dem Wippstuhl fest. Sicherheitshalber legte ich ringsherum Kissen auf den Boden. Er war erst einige Monate alt, er konnte sich also unmöglich aus dem Stuhl befreien. Dann ging ich. Ins Einkaufszentrum, wo ich eine Tasse Kaffee trank, eine Illustrierte las, Schaufenster ansah. Ab und zu rauchte ich auch eine. Ich hatte während der Schwangerschaft mit dem Rauchen aufgehört und wusste, dass ich nicht wieder anfangen sollte, solange ich ihn noch stillte. Aber hin und wieder mal eine Zigarette konnte doch nicht so schlimm sein. Und trotzdem hatte ich danach jedes Mal ein schlechtes Gewissen.
Als er fünf Monate alt war, nahmen diese Ausflüge ein jähes Ende. Ich war nicht lange weg gewesen. Zwei Stunden vielleicht. Höchstens. Als ich nach Hause kam, war es beängstigend still. Ich riss die Badezimmertür auf, und da lag er, leblos, halb aus dem Stuhl gefallen, den Gurt um den Hals. Ich brauchte eine Weile, ein paar Sekunden vielleicht, um mich so weit zu fassen, dass ich ihn losmachen konnte. Er würgte und hustete und war ganz blau im Gesicht. Ich weinte und schüttelte ihn, und nach und nach wurde sein Gesicht wieder normal. Aber er war so still.
Ich drückte ihn an mich und spürte zum ersten Mal, dass ich ihn liebte. Mein Junge war fünf Monate alt. Doch empfunden hatte ich bis dahin nichts für ihn. Von Anfang an war alles ganz unnormal gewesen.
Es war spät. Der Neue war schlimmer, als sie vorhergesehen hatte. Sie blätterte im psychologischen Gutachten, war aber zu nervös, um Einzelheiten mitzubekommen. Und sie wusste ohnehin, was dort stand. Über alle Kinder wurde das Gleiche geschrieben, nur jeweils mit einem etwas anderen Ausgangspunkt und neuen Wörterkombinationen. »Massives jahrelanges Fürsorgedefizit«; »die Mutter kann den Jungen nicht vor Schikanen schützen«; »der Junge ist leicht lenkbar«; »der Junge weist ein schulisches Leistungsdefizit auf«; »umfassende und ernsthafte Grenzziehungsprobleme«; »der Junge pendelt zwischen ausagierendem, aggressiven Verhalten und einem parentifizierten, übertriebenen und fast galanten Auftreten seiner Mutter und anderen Erwachsenen gegenüber, was einwandfrei die Hypothese von ernsthaften Entwicklungsstörungen als Folge des Fürsorgedefizits untermauert«; »die mangelnde Impulskontrolle kann in Kürze für seine Umwelt zur Gefahr werden, wenn er nicht in einen geeigneten Fürsorgebereich kommt, wo er Festigkeit, Sicherheit und Vorhersagbarkeit erlebt, die ihm so sehr fehlen«; »der Junge tritt anderen Kindern mit einer Erwachsenenhaltung gegenüber, die ihnen Angst macht, deshalb wird er ausgestoßen und verfällt in aggressives, asoziales Verhalten.«
Eigentlich landeten nur die allerschlimmsten Fälle hier im Heim. Kinder, die aus irgendeinem Grund nicht bei ihren leiblichen Eltern leben können, werden in Norwegen in Pflegefamilien gegeben. So ist das. Es ist sehr leicht, für Babys solche Familien zu finden. Auch bei kleinen Kindern, so etwa bis zum Einschulungsalter, gibt es keine großen Probleme. Aber dann wird es sofort schwieriger. Trotzdem klappt es in den meisten Fällen. Abgesehen von den allerschlimmsten. Denn die sind so anspruchsvoll, so verletzt, schon so weit zerstört vom Leben oder von untauglichen Eltern, dass keine Einzelfamilie eine solche Aufgabe bewältigen könnte.
Solche Kinder landeten bei Agnes.
Sie unterdrückte ein Gähnen und massierte ihr gut gepolstertes Kreuz. Olav würde sich schon eingewöhnen. Sie hatte noch nie ein Kind aufgegeben. Außerdem war Olav streng genommen im Moment nicht ihr ärgstes Problem. Sie versuchte, sich bequem hinzusetzen, was ihr allerdings nicht gelang, dann legte sie Olavs Papiere in eine Schublade und öffnete eine andere. Ein Ordner aus Pappe enthielt fünf Blätter, und diese Blätter starrte sie nun an. Schließlich packte sie auch diese Blätter zusammen, atmete schwer und schloss die Schublade sorgfältig ab. Der Schlüssel war ein wenig verbogen, aber am Ende konnte sie ihn doch herausziehen. Steif erhob sie sich, nahm eine Topfblume aus dem Bücherregal neben dem Fenster und legte den Schlüssel in sein Versteck. Dann blieb sie noch einen Moment vor dem Fenster stehen und schaute hinaus.
Nachts wirkte der Garten immer größer. Das Mondlicht ließ eisblaue Schatten über den spärlichen Schnee wandern. Ganz hinten, zur Straße hin, an einem niedrigen Drahtzaun, stand Glenns Fahrrad. Sie seufzte und beschloss, ihn diesmal wirklich in die Mangel zu nehmen. Bei Glatteis wurde nicht Rad gefahren. Vor zwei Tagen war Glenn befohlen worden, sein Rad in den Keller zu bringen. Entweder hatte er diesen Befehl nicht befolgt, oder er hatte den Kellerverschlag aufgebrochen und das Rad wieder herausgeholt. Sie wusste nicht so recht, was sie schlimmer finden sollte: schlampige Angestellte oder ein zutiefst ungehorsames Kind.
Es zog vom Fenster her, das Fenster war alt und undicht. Sie mussten Prioritäten setzen, und als Erstes hatte das Erdgeschoss, wo die Kinder sich tagsüber zumeist aufhielten, neue Fenster erhalten. Die Götter mochten wissen, wann Agnes’ Büro auf der Prioritätenliste auftauchen würde. Sie seufzte leise und ging zur Tür. So wie die Situation zwischen ihr und ihrem Mann im Moment war, sehnte sie sich nun wirklich nicht nach Hause, aber ihr Körper schmerzte vor Müdigkeit. Wenn sie Glück hatte, war ihr Mann schon im Bett.
Ehe sie ging, schaute sie noch einmal bei Olav hinein. Ein Vierteljahrhundert Erfahrung mit Kindern sagte ihr, dass er schlief, obwohl sie den Umriss der schweren Gestalt im Bett nur ahnen konnte. Er atmete ruhig und gleichmäßig, und sie nahm sich die Zeit, seine Decke richtig festzustecken, ehe sie vorsichtig die Tür hinter sich schloss. Und sie hatte gelächelt, weil Brote und Milch verschwunden waren. Sie hielt sich an die Abmachung und ließ Teller und Glas stehen.
Christian saß, die Beine auf dem Tisch, im Aufenthaltsraum und döste vor sich hin. Maren saß mit hochgezogenen Knien in einem Sessel und las einen Kriminalroman. Als die Heimleiterin das Zimmer betrat, ließ Christian wie im Reflex seine Füße auf den Boden knallen. Er hätte schon längst gehen können, er hatte seit über einer Stunde Feierabend. Aber er war einfach zu faul.
»Ehrlich gesagt ist es schwer, den Kindern Manieren beizubringen, wo sie dir so ganz und gar abgehen«, sagte Agnes zu dem Studenten, der eine halbe Stelle hatte und zu Abend- und Nachtdiensten eingesetzt wurde. »Und wir hatten doch abgemacht, dass Glenns Fahrrad im Keller eingeschlossen wird.«
»O verdammt. Das habe ich ganz vergessen.«
Er machte ein beschämtes Gesicht und betastete einen riesigen Pickel an seinem linken Nasenflügel.
»Hör mal, Christian«, sagte die Heimleiterin und setzte sich mit geradem Rücken und zusammengepressten Knien neben ihn. »Dieses Haus wird von der Heilsarmee betrieben. Wir geben uns alle Mühe, den Kindern ihre Gossensprache abzugewöhnen. Warum fällt es dir so schwer, meinen Wunsch, nicht immer diese Flüche hören zu müssen, zu respektieren? Verstehst du nicht, dass du mich im Grunde jedes Mal beleidigst, wenn du solche Wörter benutzt? Kinder sind Kinder. Du bist ein Erwachsener, der Rücksichtnahme gelernt haben sollte. Kannst du das nicht einsehen?«
»Tut mir leid«, murmelte er betreten, und plötzlich platzte der Pickel. Gelber Eiter quoll heraus, und Christian starrte seinen Zeigefinger fasziniert an.
»Himmel und Ozean«, stöhnte Agnes, erhob sich und wollte gehen.
Während sie ihren Mantel anzog, drehte sie sich zu Maren um, die sich durch den kleinen Auftritt nicht von ihrem Krimi hatte ablenken lassen.
»Ich muss bald unter vier Augen mit dir sprechen«, sagte Agnes und fügte – mit einem Blick auf Christian, der noch immer darüber staunte, wie viel Eiter doch in einen Pickel passte – hinzu: »Wir müssen über die Dienstpläne für Februar und März reden. Kannst du einen Vorschlag ausarbeiten?«
»Mhm«, sagte Maren und legte ihr Buch für einen Moment beiseite.
»Es wäre schön, wenn du das bis morgen schaffen könntest. Dann sprechen wir morgen Nachmittag darüber.«
Maren schaute wieder auf, lächelte und nickte.
»Alles klar, Agnes. Der Vorschlag ist morgen Nachmittag fertig. Kein Problem. Gute Nacht.«
»Wünsche ich euch auch. Gute Nacht!«
2
Es war eine prachtvolle Villa. Die Mittel für die Renovierung hatten zwar nicht ausgereicht, um die ursprünglich achtfach unterteilten Fenster im Erdgeschoss zu erneuern, weshalb sie durch Plastikfenster mit aufgeklebten Sprossen ersetzt worden waren, aber trotzdem prangte das Haus stolz mit seinen spitzen Giebeln hinten in seinem großen Grundstück. Es war aus beige verputzten Steinen, die grünen Holzverkleidungen jedoch gaben ihm ein Schweizer Gepräge. Vor fünf Jahren waren die beiden Stockwerke neu aufgeteilt worden; nun gab es zwei Wohnzimmer, einen Besprechungsraum, Küche, Bad, Waschküche und ein Zimmer, das sie Bibliothek nannten, das im Grunde aber eine Art Archiv war. Im ersten Stock gab es für die Kinder sechs Schlafzimmer, aber einige davon waren für zwei Personen eingerichtet, und deshalb dienten derzeit zwei Einzelzimmer als Schulzimmer und als zusätzlicher Aufenthaltsraum. Außerdem gab es noch ein Schlafzimmer für Angestellte. Das Arbeitszimmer der Heimleiterin lag am Ende des Ganges, rechts von der Treppe. Gegenüber befanden sich ein großes Badezimmer mit Wanne und ein kleineres mit Dusche und Toilette. Außer den beiden gut ausgenutzten Stockwerken gab es noch einen Keller und einen hohen, geräumigen Dachboden. Nach einer Feuerwehrinspektion waren vor einigen Jahren an den Fenstern jeweils am Ende des Flurs Leitern angebracht und jedes Schlafzimmer mit einer Rettungsleine versehen worden.
Die Kinder liebten Feuerübungen. Alle, außer Kenneth. Und jetzt Olav. Kenneth saß mitten auf dem Gang, weinte und klammerte sich an den an der Wand befestigten Feuerlöscher. Olav stand breitbeinig und sauer da, die Unterlippe weiter vorgeschoben als sonst.
»Ja Scheiße«, sagte er wütend. »Ich rutsch doch nicht die Scheißleine runter!«
»Dann nimm die Leiter«, schlug Maren vor. »Die Leiter ist nicht so schlimm. Und hör endlich mit dem Fluchen auf. Jetzt bist du schon seit drei Wochen hier, und dein ganzes Taschengeld ist dafür draufgegangen.«
»Na los, Olav!«
Terje stupste Olav in den Rücken. Terje war Anfang dreißig und auf dem Papier stellvertretender Heimleiter.
»Ich gehe vor dir her. Oder, besser gesagt, unter dir. Wenn du fällst, kann ich dich gleich auffangen. Okay?«
»Ja Scheiße«, sagte Olav und trat einen Schritt zurück.
»Ich wette zehn Kronen, dass der Trottel sich nicht traut«, rief Glenn von draußen hoch, er war schon viermal nach unten und wieder nach oben geklettert.
»Was soll denn aus dir werden, wenn es brennt?«, fragte Terje. »Willst du dann mit verbrennen?«
Olav starrte ihn hasserfüllt an.
»Das kann dir doch egal sein! Meine Mama wohnt in einem Betonblock. Ich könnte ja zum Beispiel zu ihr ziehen!«
Terje gab auf, schüttelte den Kopf und überließ dieses störrische Kind Maren.
»Wovor hast du eigentlich Angst?«, fragte sie leise und winkte ihn in sein Zimmer.
Widerwillig stapfte er hinter ihr her.
»Ich habe keine Angst.«
Er ließ sich auf sein aufächzendes Bett fallen, und Maren ertappte sich dabei, wie sie dieses solide Möbelstück bewunderte. Sie setzte sich neben ihn.
»Wenn du keine Angst hast, warum willst du dann nicht klettern?«
»Mir ist eben nicht danach. Ich habe keine Angst.«
Vom Flur her hörten sie Kenneths verzweifeltes Weinen, aber sie hörten auch die anderen Kinder begeistert johlen und Tarzanrufe ausstoßen, wenn sie sich an den Leinen nach unten schwangen.
Sie war keine Heilige. Der blödeste Spruch, den sie kannte, war die Behauptung: »Ich bin ja so kinderlieb!« Kinder waren wie Erwachsene, manche bezaubernd, manche hinreißend, andere wiederum Miststücke. Als professionelle Fürsorgerin glaubte sie, niemand könne es ihr ansehen, wenn sie ein Kind nicht leiden mochte. Sie behandelte nicht alle Kinder gleich, denn sie waren nicht gleich, aber sie war gerecht und machte keine Unterschiede. Olav aber sprach sie auf ganz besondere Weise an.
Seit er hier war, hatte niemand ihn anfassen dürfen. Und doch hatte er etwas, wie er hier so saß. Wie ein bekleideter Buddha, der wütend aussehen will und doch nur traurig ist; seine ganze makabre Gestalt hatte etwas, das sie zu ihm hinzog. Sie trotzte dem Berührungsverbot und fuhr ihm langsam über die Haare. Er wehrte sich nicht.
»Was ist denn bloß los mit dir, kleiner Olav?«, fragte sie leise und streichelte ihn noch einmal.
»Besonders klein bin ich ja nicht gerade«, sagte er, aber sie ahnte ein Lächeln in seiner Stimme.
»Ein bisschen schon.« Sie lachte. »Ab und zu zumindest.«
»Arbeitest du gern hier?«, fragte er plötzlich und schob nun doch ihre Hand weg.
»Ja. Ich arbeite sehr, sehr gern hier. Ich möchte um nichts in der Welt einen anderen Arbeitsplatz.«
»Wie lange bist du denn schon hier?«
»Seit etwa drei Jahren …« Sie zögerte, dann fügte sie hinzu: »Seit ich von der Schule gekommen bin. Von der Sozialschule. Bald sind es vier Jahre. Und ich will noch viele, viele Jahre hierbleiben.«
»Warum legst du dir nicht lieber eigene Kinder zu?«
»Das mache ich vielleicht irgendwann einmal. Aber deshalb arbeite ich nicht hier. Weil ich keine eigenen Kinder habe, meine ich. Die meisten, die hier arbeiten, haben welche.«
»Wie viele Seiten hat die Bibel?«, fragte er unvermittelt.
»Die Bibel?«
»Ja, wie viele Seiten hat die? Das müssen doch verdammt viele sein. So dick, wie sie ist.«
Er schnappte sich die Bibel, die auf seinem Nachttisch lag, denn in diesem Haus lag auf jedem Nachttisch eine Bibel, und schlug sich damit ein paarmal auf den Oberschenkel, ehe er sie Maren reichte.
Maren blätterte darin herum.
»Du kannst auf der letzten Seite nachsehen«, schlug er vor. »Du brauchst sie nicht zu zählen.«
»Tausendzweihunderteinundsiebzig«, sagte sie. »Und ein paar mit Landkarten. Und du … ich meine das mit der Flucherei wirklich ernst. Sollen wir jetzt die Feuerleiter ausprobieren?«
Er stand auf, und das Bett seufzte vor Erleichterung. »Ich gehe jetzt nach unten. Über die Treppe.«
Hier gab es nichts mehr zu diskutieren.
Ich habe mich ans Jugendamt gewendet, als er zwei Jahre alt geworden war. Ich war außer mir vor Angst, ich brauchte Hilfe. Ich hatte schon seit Monaten dort anrufen wollen, aber ich hatte es immer wieder aufgeschoben, weil ich doch nicht wusste, was sie tun würden. Sie durften ihn mir nicht wegnehmen. Wir hatten doch nur einander. Ich stillte ihn noch immer, obwohl er nun schon neunzehn Kilo wog und jeden Tag fünf weitere Mahlzeiten zu sich nahm. Er aß alles. Ich weiß nicht, warum ich so lange so weitergemacht habe. Wenn ich ihn stillte, war er wenigstens diese zehn Minuten lang ruhig. Alles war unter Kontrolle. Es waren kleine Momente des Friedens. Als er das Interesse daran verlor, bedeutete das einen Verlust für mich, nicht für ihn.
Sie waren wirklich nett. Nachdem sie mich einige Male besucht hatten, vielleicht zwei- oder dreimal, bekam ich einen Kindergartenplatz. Von Viertel nach acht bis fünf: Sie sagten, ich brauchte ihn nicht die ganze Zeit dort zu lassen; weil ich doch nicht berufstätig sei, könne ich seine Tage dort abkürzen. So lange Tage seien anstrengend für ihn, hieß es.
Ich lieferte den Jungen jeden Morgen um Viertel nach acht dort ab. Ich holte ihn nie vor fünf. Aber ich kam auch nie zu spät.
Ich bekam einen Kindergartenplatz und überlebte.
Olav hatte Heimweh. Es schien in seinem Körper zu bohren, und er hatte so ein Gefühl noch nie erlebt. Er war aber auch noch nie so lange von zu Hause fort gewesen. Er versuchte, das Loch in seinem Bauch kleiner zu machen, indem er schnell und kurz atmete, aber davon wurde ihm nur schwindlig, und er bekam richtiges Bauchweh. Also versuchte er, tief durchzuatmen, aber dann war das Bohren wieder da, das böse Gefühl kam zurück. Er hätte weinen mögen.
Er wusste nicht, ob er sich nach seiner Mutter sehnte oder nach der Wohnung oder nach seinem Bett oder nach seinem Spielzeug. Er dachte auch nicht darüber nach. Alles war einfach nur eine einzige riesengroße Sehnsucht.
Er wollte nach Hause. Aber das durfte er nicht. Erst nach zwei Monaten im Heim durfte er auf Besuch nach Hause, hatten sie ihm gesagt. Seine Mutter besuchte ihn zweimal die Woche. Als ob sie hier im Kinderheim etwas zu suchen gehabt hätte. Er sah, dass die anderen Kinder sie anstarrten und dass die Zwillinge immer lachten, wenn sie auftauchte. Kenneth war der Einzige, der mit ihr redete, der Arme hatte ja selber keine Mutter, und da war er sicher ein bisschen neidisch. Eine hässliche und scheußliche Mama war irgendwie immer noch besser als keine.
Sie durfte zwei Stunden dableiben. Die erste Stunde war kein Problem. Sie redeten ein bisschen oder gingen einmal um den Block. Zweimal waren sie in ein Café gegangen und hatten Kuchen gegessen. Aber das Café war ziemlich weit weg, und der Weg hatte fast alle ihre Zeit verschlungen. Das eine Mal waren sie eine halbe Stunde zu spät gekommen, und Agnes hatte seine Mutter ausgeschimpft. Olav hatte gesehen, wie traurig die wurde, auch wenn sie nichts sagte. Deshalb hatte er den Garderobenhaken zerbrochen, und dann war Agnes auf ihn böse gewesen.
Nach der ersten Stunde wussten sie meistens nicht mehr so recht, was sie machen sollten. Agnes hatte vorgeschlagen, seine Mutter könne ihm doch bei den Schulaufgaben helfen. Aber das hatte sie noch nie getan, und er wollte es auch nicht. Deshalb blieben sie einfach in seinem Zimmer sitzen, ohne besonders viel zu sagen.
Er hatte so schreckliches Heimweh.
Er hatte Hunger.
Er hatte immer, immer Hunger. Hier im Kinderheim war der Hunger nur noch schlimmer geworden. Er bekam einfach nicht genug zu essen. Am Vortag hatte er eine dritte Portion Frikadellen mit sehr viel Soße haben wollen. Die hatte Agnes ihm verweigert, obwohl noch genug übrig gewesen war. Kenneth hatte ihm seine Portion geben wollen, aber gerade als Olav sie auf seinen Teller schob, hatte Agnes ihm den Teller weggenommen und ihm stattdessen einen Apfel gegeben. Olav wollte aber keinen Apfel, er wollte Frikadellen.
Er hatte einen verdammten Hunger.
Im Moment waren die anderen Kinder nicht da. Es war jedenfalls ziemlich still in dem großen Haus. In der Schule war ein Besprechungstag, deshalb war die Feuerübung sicher für heute angesetzt gewesen. Er stand vom Bett auf und schüttelte sein eingeschlafenes Bein. Es prickelte und pikste, und obwohl es wehtat, kitzelte es auch ein wenig.
Das Bein hätte fast unter ihm nachgegeben, als er auftrat, und er humpelte zur Treppe hinüber. Von unten konnte er Stimmen hören, aber das waren sicher die Erwachsenen. Er stapfte ans Fenster hinten im Flur und sah Kenneth und die Zwillinge den Hang zur Straße hinunterrodeln. Das war ein Hang für Schlaffis. Viel zu kurz, und außerdem musste man bremsen, um nicht gegen den Zaun zu prallen. Wo die großen Kinder steckten, wusste er nicht. Aber die durften eigentlich fast alles. Gestern war Raymond sogar bei McDonald’s gewesen. Mit seiner Freundin. Er hatte Olav eine kleine Figur mitgebracht. Olav, der sie total kindisch fand, hatte sie an Kenneth weitergereicht.
Er versuchte, die Treppe hinunterzuschleichen, aber die Stufen knackten. Dann fiel ihm ein, dass sie nicht knacken würden, wenn er die Füße ganz am Rand aufsetzte. Lautlos gelangte er fast bis ganz nach unten.
»Hallo, Olav!«
Er zuckte heftig zusammen. Es war Maren.
»Du bist im Haus? Die anderen sind doch alle draußen!«
»Keinen Bock. Ich will fernsehen.«
»So früh am Tag ist das aber nicht erlaubt, und das weißt du. Du musst dir schon eine andere Beschäftigung suchen.«
Sie lächelte ihn an. Sie war unter den Erwachsenen hier im Heim die Einzige, die er leiden konnte. Sie war logisch. Das war sonst fast keine. Auch seine Mutter nicht. Und Agnes schon gar nicht.
»Ich hab solchen Hunger«, beklagte er sich leise.
»Aber wir haben doch erst vor einer halben Stunde gegessen!«
»Ich hab aber nur zwei Brote gekriegt.«
Maren schaute sich um und konnte niemanden entdecken. Mit übertriebenen Bewegungen legte sie den Zeigefinger an ihren lächelnden Mund und schlich in die Küche, wobei sie das Lied der Räuber von Kardemomme summte. Olav lächelte und schlich hinterher, obwohl er das alles ziemlich beknackt fand.
Sie öffnete den Kühlschrank einen Spaltbreit. Beide lugten sie durch den Spalt. Das Licht ging an und aus, weil die Tür nicht ganz offen war, und deshalb mussten sie den Spalt verbreitern.
»Was möchtest du denn?«, flüsterte Maren. »Frikadellen«, flüsterte Olav zurück und zeigte auf die Reste vom Vortag.
»Das geht nicht. Aber du kannst einen Joghurt haben.« Damit war er nicht sonderlich zufrieden, aber es war immerhin besser als nichts.
»Kann ich Müsli dazutun?«
»Klar.«
Maren nahm einen Haushaltsbecher Joghurt aus dem Kühlschrank und goss etwas davon in einen Napf. Olav hatte die Müslipackung aus dem Schrank geholt und leerte gerade den dritten Löffel über seinem Napf aus, als Agnes in der Tür erschien.
»Was macht ihr denn hier?«
Beide erstarrten für einen Moment, dann packte Maren den Napf und stellte sich vor Olav hin.
»Olav hat solchen Hunger. Und ein bisschen Joghurt kann doch nicht schaden.«
Agnes sagte kein Wort, als sie um den großen Esstisch herumging und Maren den Napf wegnahm. Immer noch schweigend zog sie Plastikfolie aus einer Schublade, umwickelte damit den Napf und schob die beiden Sünder beiseite, um den Napf in den Kühlschrank zu stellen und die Tür zu schließen.
»So. Wir essen in diesem Haus nicht zwischen den Mahlzeiten. Das wisst ihr beide ganz genau.«
Sie sah Olav kein einziges Mal an. Sie starrte die ganze Zeit Maren an. Maren zuckte verlegen mit den Achseln und legte die Hand auf Olavs Schulter. Olav dagegen hatte sich nach dem ersten Schrecken wieder gefasst.
»Verdammte Kuh!«
Agnes hatte die Küche gerade verlassen wollen, aber nun erstarrte sie. Langsam drehte sie sich um.
»Was hast du gesagt?«
Zur Warnung drückte Maren die Schulter des Jungen. »Verdammte blöde Scheißkuh!«
Jetzt schrie der Junge.
Agnes Vestavik war schneller bei ihm, als irgendwer erwartet hätte. Sie packte sein Kinn und zwang sein Gesicht hoch zu ihrem. Er protestierte, indem er die Augen zusammenkniff.
»Solche Ausdrücke werden hier nicht benutzt«, fauchte sie, und Maren hätte schwören können, dass ihre linke Hand sich wie zu einem heftigen Schlag hob. Es wäre das erste Mal in der Geschichte gewesen, dass Agnes Vestavik Hand an ein Kind legte. Nach kurzem Zögern ließ sie die Hand sinken, hielt aber das Kinn des Jungen weiterhin fest.
»Sieh mich an!«
Er kniff die Augen noch fester zusammen.
»Olav! Mach die Augen auf und sieh mich an!«