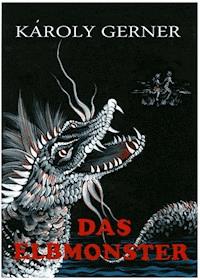
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Aus einem Hamburger Forschungsinstitut entflieht unversehens ein vierjähriges Monstrum. Es handelt sich um eine von Experten gewollt vollzogene Kreuzung zweier Reptilien, nämlich einer Schlange mit einem Krokodil. Das künstlich gezüchtete Ungetüm schwimmt elbaufwärts und sorgt zuerst bei Magdeburg für sensationelles Aufsehen. Wochen danach taucht es plötzlich in Meißen auf, und es geschieht höchst Merkwürdiges in der Wiege Sachsens. Verursacht durch Mensch oder Tier?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 814
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gerner, Károly
Das Elbmonster
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Epilog
Impressum neobooks
Prolog
Mein Freund Peter entdeckte mit knapp fünfundzwanzig Lenzen ein Mädchen, dessen graziöses Wesen ihn regelrecht überwältigte. Es begegnete ihm als die personifizierte Verkörperung einer nahezu idealen Harmonie von Natürlichem und Geistigem. Das nahm ihn restlos gefangen. Daraufhin frohlockte er dergestalt wonnetrunken, als hätte ihn Amors Pfeil mitten ins Herz getroffen und ihm zugleich von allen möglichen Geschenken das kostbarste verabreicht. Seine freudvolle Erwiderung gipfelte in zahllosen Dankeshymnen. Selbst im biblischen Hohelied Salomos findet sich keine schönere Lobpreisung der Liebe. Nichts war mehr wie früher. Alle Sinne unseres lichterloh entflammten Akteurs gerieten unweigerlich in höchst erquickende Wallung, ein Zauber, von dem man sich wünscht, er möge niemals vergehen.
Obgleich Peter sich einst vorgenommen hatte, möglichst lange als Single durchs Leben zu tigern, vermochte er einem derart unübersehbaren Liebreiz von jungfräulicher Anmut und betörender Eleganz nicht zu widerstehen. Sonach warb der schmachtende Jüngling fortan überaus leidenschaftlich um die Gunst seiner Angebeteten. Und die Schicksalsgöttin meinte es offenbar gut mit ihm, denn nach anfänglichem Zögern erwiderte das Mädchen bereitwillig sein glutvolles Begehren.
Allerdings zeigte er sich nicht minder aus erlesenem Holz geschnitzt. Naturgegeben körperlich schon im Kindesalter tadellos ausgestattet, blieb alles andere eine Frage von sinnträchtiger Bildung und Erziehung. Dazu waren seine Eltern durchaus fähig und auch fest entschlossen: die Mutter als angesehene Lehrerin, der Vater im Dienste eines hoch verehrten Priesters. Zudem galt ihnen Goethes Ideal vom Humanismus sowohl für ihr berufliches als auch privates Handeln als richtungweisend. Dort heißt es: „Edel sei der Mensch, hilfreich und gut.“ Und der Erfolg ihrer vielfältigen Bemühungen blieb nicht aus, denn ihr Sohnemann erfreute sich allenthalben und gleichermaßen fortwährend als ein besonders geachteter Erdenbürger. Selbstredend erfüllte das seine Familienangehörigen mit großem Stolz.
Die Liebe zwischen Peter und seiner unsäglich faszinierenden Veronika musste zwar im Verlauf von Jahrzehnten mehrere, teils auch ziemlich harte Proben überstehen, doch sie ward umso tiefer und fester. Wäre ich nicht persönlich vielfach Zeuge ihrer einzigartigen Zuneigung gewesen, ließe ich gegebenenfalls jene alltägliche Meinung vorbehaltlos gelten, wonach es solch phänomenale Bindungen auf Dauer nur in Märchen oder in den unzähligen Herz-Schmerz-Verlautbarungen gäbe.
Anscheinend widerfahren uns doch immer und überall im Leben bestimmte Ausnahmen, was fraglos auch in diesem Falle zutraf. Das wage ich mit Fug und Recht zu behaupten, denn Peter zählte schließlich seit unserer frühen Jugend zu meinen besten Freunden. Dazu will ich hier gerne bekunden, dass wir fortlaufend eine Beziehung pflegten und genossen, die von innigster Vertrautheit geprägt war.
Jedenfalls wandelten die beiden Sonntagskinder bereits vor und erst recht nach ihrer Vermählung wie dauerhaft von der Muse geküsst durch mancherlei Höhen und Tiefen irdischen Daseins, wohl kaum ahnend, dass ihr Stern jemals plötzlich an Leuchtkraft verlieren könnte, geschweige denn, sie als begnadete Geschöpfe irgendwann völlig überraschend und obendrein äußerst schmerzvoll vom drohenden Unheil befallen würden. Das wiederum kommt bekanntlich selten allein.
Immerhin zeugten sie zusammen auch drei Kinder, und ihr Glück schien geradezu perfekt, weil solide fundiert von einer rundum intakten Familie, die sich vor allem durch Nähe, Wärme und Geborgenheit auszeichnete. Auch beruflich waren sie erfolggekrönt, da sie ihre Arbeit mit Sachkenntnis, Zuversicht und beflissen verrichteten, was ihnen hohe Anerkennung einbrachte. Müßigkeit blieb ihnen stets wesensfremd.
Ihren Freundeskreis pflegten sie wie zarte Pflanzen, mit denen man behutsam umgeht, damit sie prächtig gedeihen.
Kein Wunder also, dass die Entwicklungsgeschichte meines Freundes Peter fast durchgängig so verlief, als hätte man sie einem hinreißenden Bilderbuch entnommen, deren Krönung freilich erst durch die ausnehmende Partnerschaft mit Veronika erfolgte. Beiden war die hilfreiche Gabe eigen, stets füreinander da zu sein. Ihr gegenseitiges Vertrauen war unerschütterlich. Es hatte sich mannigfach bewährt. Keinerlei Alltagsprobleme oder sonstige Konflikte vermochten ihre berückende Zweisamkeit zu gefährden oder sie gar aus der gewohnten Lebensbahn zu werfen.
Ich gestehe, dass mich angesichts ihrer fabelhaften Gepflogenheiten vereinzelt sogar ein leichter Neid beschlich, denn ich muss zugeben, dass sie die Lenkung des eigenen Schicksals oftmals viel cleverer meisterten, als ich es vermochte. Sie verfügten über die eher seltene Veranlagung, vielerlei positive Seiten des Lebens gezielt herauszufinden und klug zu nutzen. So hatten sie beizeiten auch folgenden Leitspruch verinnerlicht: „Erfreue dich möglichst täglich an dem, was du hast und kannst, statt unentwegt nach irgendwelchen Luftschlössern zu trachten!“
Insbesondere ihre praktizierte Toleranz gegenüber anderen Denk- und Verhaltensweisen beeindruckte mich nachhaltig. Ihr Umgangsmotto lautete: „Es sei alles erlaubt, was keinem schadet.“ Wer schafft das schon?
In ihrer Nähe musste man sich einfach wohlfühlen, denn bessere Freunde kann man sich gar nicht wünschen. Kurzum, sie wirkten in fast jeder Hinsicht als Vorbild für das Tun und Lassen ihrer Mitmenschen.
Namentlich ihr Ehebund übertraf fast alles an liebevoller Zuneigung. Das habe ich immer bewundert. Sie veranschaulichten quasi die ideale Partnerschaft, indem sie gegenseitig zuließen, dass jedem genügend Freiräume blieben, um sich zu entwickeln und auch eigene Interessen wahrzunehmen. Ebenso respektierten sie die individuellen Grenzen des anderen. Ihr Verhältnis zueinander war großmütig und von unerschütterlichem Vertrauen geprägt. Ich hätte jederzeit bereitwillig schwören können, dass sie sich gegenseitig auch immer treu waren.
So entrannen mehrere Jahrzehnte voller Glückseligkeit, bis das Unheil jählings wie aus heiterem Himmel mit brutalster Gewalt und obendrein gleich im Doppelpack über sie hereinbrach.
Genau zwölf Monate nach Eintritt ins Rentenalter befiel meinen selbstlosen Gefährten das allseits gefürchtete, weil unberechenbare, hinterlistige und immerwährend böse Haustier namens Krebs. Es nistete sich unversehens fest in seinen Körper ein und trieb fortab sein mörderisches Spiel. Bevor man erkannte, um welch ein zerstörerisches Biest es sich handelte, hatte es bereits in Windeseile zuhauf Metastasen hervorgebracht. Obgleich die Hoffnung meist zuletzt stirbt, blieb Peter keinerlei Chance mehr, dem grausamen Würgeengel zu entrinnen.
Wenigstens gewährten ihm die Mächte der Finsternis ein bisschen Zeit, die er eifrig nutzte, um wichtige Angelegenheiten zu erledigen. Auf den nahenden Tod war er ja überhaupt nicht vorbereitet. Eher glaubte er, der allmächtige Sensenmann befände sich noch in weiter Ferne, was sich freilich als schwerwiegender Irrtum herausstellte.
Indessen boten sich mir wiederholt Gelegenheiten, mit ihm aufschlussreiche Gespräche zu führen, so auch kurz bevor er unwiderruflich von uns ging. Die abermalige Begegnung war sein eindringlicher Wunsch, obwohl er bereits auf dem Sterbebett lag und sich zusehends anschickte, dem Irdischen endgültig Adieu zu sagen.
Unser Gedankenaustausch wandelte sich allerdings beizeiten zum Monolog, indem ich aufmerksam zuhörte, was der auserlesen gütige, jedoch todkranke Kamerad während seiner letzten Stunden noch unbedingt kundtun wollte.
Er sprach zwar leise, trotzdem klar und verständlich, auch nicht im Geringsten wehklagend. Dabei betonte Peter, dass er gerne noch einige Jahre mitgemacht hätte, schon allein deshalb, um die redlich verdiente Seniorenzeit mit seiner lieben Veronika weiterhin zu genießen. Aber es sollte eben nicht sein. Dennoch wäre er nicht unzufrieden mit seiner Lebensgestaltung, weil ihm und seinen Angehörigen der Grundsatz „Nutze den Tag, er kehrt nicht wieder!“ stets ein wichtiger Begleiter war. Mit besonderer Genugtuung erfülle ihn die feste Zuversicht, dass seine Frau auch als Witwe in fast allen Belangen bestens zurechtkäme, da sie gottlob im hohen Maße eigenständig sei. Dessen ungeachtet hätte er nichts dagegen, fügte er zaghaft hinzu, wenn sie sich später einen anderen Mann suchte, mit dem sie glücklich wäre. Ergo könne er auch hierauf einigermaßen beruhigt bei Petrus anklopfen. Es bliebe ihm ja sowieso nichts weiter übrig, als die Segel für immer zu streichen. Demgemäß gehe er in Frieden mit sich und der Welt, lauteten seine warmherzigen Worte.
Obwohl ich von ihm nichts anderes erwartet hatte, war ich doch aufs Angenehmste berührt. Danach beobachtete ich jedoch gespannt, wie sich auf seiner Stirn auffallend Sorgenfalten bildeten, die mir aus früheren Zeiten durchaus vertraut waren. Mithin hatte ich den Eindruck, als wollte Peter noch etwas Außergewöhnliches, vielleicht sogar ein anhaltend streng behütetes Geheimnis meiner Obhut übertragen, um sein Herz zu erleichtern. Und tatsächlich flüsterte er nach längerem Zögern mit größter Anstrengung drei Worte in mein Ohr. Sie lauteten: „Sohn…Abel…Elbmonster“. Deren Sinn habe ich allerdings nicht begriffen.
Umso mehr hoffte ich beschwörend, er könne einiges hinzufügen, damit ein Zusammenhang entstünde, der mir zumindest eine gewisse Deutung ermöglicht hätte. Aber dazu kam es nicht mehr, denn seine Kräfte waren erschöpft. Schließlich vernahm ich auf seinem Antlitz, das bereits den nahenden Tod spüren ließ, eine besonders ausdrucksstarke Veränderung, die sich auf seinen Lippen unverkennbar zu einem dankbaren Abschiedslächeln formte. Und mir war klar, darin offenbarte sich zugleich der letzte Gruß eines wahrhaft edlen Freundes.
Ich zog leise davon. Doch etwas Rätselhaftes, vorerst noch stark nebulös, blieb in meinem Inneren haften, denn ich konnte mir trotz ernsthaften Grübelns keinen passenden Reim darauf machen, was er mir noch anvertrauen wollte.
Tags darauf war es mit Peter vorbei. Geist und Seele glitten ins Jenseits. Nur seine leibliche Hülle befand sich weiterhin in unserer Nähe, und die sollte uns bald geheimnisumwittert aufhorchen lassen, ein Ereignis, das ich garantiert niemals vergessen werde.
Ungeachtet seines erwarteten Ablebens und der Erlösung vom grauenhaften Leiden wurde seine Witwe, unsere großartige Gefährtin Veronika, mehr denn je von zermürbender Trauer geplagt. Gewiss, ihr blieben die fürsorglichen Kinder und deren ebenso tüchtigen Partner, dazu eine wohltuende Schar von liebenswürdigen Enkeln und nicht zuletzt der vielfach bewährte Freundeskreis. Doch all das zusammen ersetzte nicht jene beflügelnde Energie einer harmonischen Lebensgemeinschaft, die sich fortwährend aus innigster Zuneigung und respektvollem Umgang miteinander nährte.
Zu allem Unglück sollte sich der erste Teil des Abschiedsrätsels, ein unvermutet bizarres Geheimnis meines Freundes Peter, welches er notgedrungen auch mir gegenüber bis zu seinem Tod hinaus bewahrte, schon nach einer Woche lüften. Die wundersame Szene war nicht nur für mich eine handfeste Überraschung. Auf seine Frau und die anderen Familienangehörigen wirkte sie regelrecht schockierend und niederschmetternd.
Was war geschehen?
Die Trauerfeier für den Dahingeschiedenen fand in einem relativ großen Raum statt, der sich zusehends füllte. Unmittelbar vor Beginn der Zeremonie, als die Anwesenden schon Platz genommen hatten, öffnete sich nochmals die Eingangstür. In Begleitung eines jungen Mannes trat eine sichtlich ältere Dame herein. Wir trauten unseren Augen nicht. Die Verwunderung steigerte sich mit jedem Schritt, den die beiden Fremden in Richtung des Verstorbenen machten, weil sie dadurch noch klarer ins Blickfeld rückten. Sie verneigten sich gleichsam im Zeitlupentempo ehrfurchtsvoll vor dem Bildnis und Sarkophag des Entschlafenen. Danach wendeten sie sich ebenso bedächtig zum Publikum, blieben vorne stehen und suchten gezielt nach freien Plätzen. Jetzt befanden sie sich vollends im Sichtbereich aller Teilnehmer. Ein deutliches Raunen belebte den Saal, ausgelöst durch eine gespenstische Szene. Sie hatte den Anschein, als wäre der Tote wieder zum Leben erwacht, heimlich dem Sarg entstiegen und stünde nun um Jahrzehnte verjüngt vor all den Menschen, die um ihn trauern. Ein unsäglich rätselhaftes und daher abgründig beklemmendes Bild, das sämtliche Anwesende sofort in seinen Bann zog, denn es war kein Gespenst, sondern eine reale Person.
Da meiner Frau und mir die Anerkennung zukam, uns in Veronikas Nähe zu setzen, konnte ich direkt beobachten, wie sie infolge der hochgradig überraschenden Situation zusehends kreidebleich und sogar vorübergehend ohnmächtig wurde. Ihre Kinder griffen sofort zu, richteten sie bedachtsam auf und stützten die fassungslose Mutter fortab während der Trauerfeier und später auf dem Weg zur Grabstätte.
Die beiden Unbekannten, offensichtlich Mutter und Sohn, verharrten ziemlich lange an der Stelle, wo sie nach freien Sitzplätzen Ausschau hielten. Einheimische konnten es wohl nicht sein, denn das hätte sich in unserer Kleinstadt längst herumgesprochen. Weil ich jedoch nach Veronikas Bittgesuch die Todesanzeige selbst verfasste und einer überregionalen Tageszeitung übertrug, war das vermutlich der maßgebliche Ausgangspunkt für das Erscheinen der Überraschungsgäste.
Beide waren dem Anlass entsprechend adrett gekleidet, von schlanker Gestalt und auffallend nobler Eleganz. Sie wirkten durch ihr stattliches Auftreten sehr attraktiv. Der junge Mann überragte seine Begleiterin um gut eine Kopflänge. Die Frau trug ihr dunkles Haar straff nach hinten gekämmt und dort zu einem Dutt zusammengefügt.
Das ungleiche Paar erregte auf Anhieb sensationelle Aufmerksamkeit und rumorendes Staunen im Saal. Möglicherweise versetzte es einzelne Teilnehmer sogar in Angst und Schrecken, zumindest in sprachlose Fassungslosigkeit. Kein Wunder, denn der Jüngling glich dem Verstorbenen buchstäblich wie aus dem Gesicht geschnitten. Doch alle wussten, dass Peter keinen Sohn hatte. Oder man glaubte es wenigstens bis dahin. Selbst ich hätte darauf Brief und Siegel geben können. Und ich kannte ihn, außer seiner Gattin, mit Sicherheit besser als jeder andere. Zudem war nicht zu übersehen, dass der junge Mann bei Weitem nicht so viele Jahre hinter sich hatte, wie die Ehe meines Freundes mit seiner wunderbaren Veronika, die vermutlich eigens deshalb in Ohnmacht fiel.
„Auweia, da muss also dereinst etwas höchst Merkwürdiges passiert sein“, schoss es mir durch den Kopf. „Peter, du Schlawiner, wie hast du es nur fertiggebracht, deine bezaubernde Frau derart zu hintergehen und auch mich im Dunkeln zu lassen? War es ein leichtfertiger Seitensprung oder eine andauernde Liebschaft? Und welch düstere, markerschütternde Gedanken mögen angesichts einer solch tiefgreifenden Überraschung jetzt in Veronikas Haupt spuken? Ob sie den Verlust ihres geliebten Partners im Moment oder künftig überhaupt noch leidvoller empfindet als seine verheimlichte Untreue?“ Diese und andere Fragen surrten unaufhörlich durch mein Oberstübchen. Die Antwort darauf konnte ich allenfalls erahnen.
Zweifelsfrei hatte unsere herzensgute Freundin von da an mit neuen, außerordentlich schmerzhaften Seelenqualen zu kämpfen. Indessen war mir blitzartig klar geworden, welches Geheimnis ihr Mann am Ende unserer Abschiedsstunde durch seine zögerliche Formulierung „Sohn“ mir noch anvertrauen wollte.
Seit jenem denkwürdigen Ereignis vom Oktober 2008 treibt mich fortlaufend eine heftig anstachelnde Wissbegierde, der Sache auf den Grund zu gehen, herauszufinden, wie es dazu kam und was dahinter steckt.
Doch wie sich Peters einstiger Fehltritt auch immer offenbaren mag, im Vergleich zum Schicksal seines um fast sechs Jahre älteren Bruders wird den meisten Interessenten eine derartige Sünde nach einschlägiger Sachkenntnis gewiss als reinste Bagatelle vorkommen. Abel war nämlich für lange Zeit der Dritte in unserem Bunde, zudem stets ein fester Anker, gewissermaßen der Fels in der Brandung. Ihm war es jedoch nicht vergönnt, an der Trauerfeier teilzunehmen, weil er infolge widriger Umstände nichts davon erfahren konnte. Er befand sich damals auf einer längeren Studienreise in afrikanischen Ländern und blieb für uns, trotz vielfältiger Bemühungen, einfach unerreichbar.
Endlos schlimmer hingegen ist der jetzige Tatbestand: Abel wird seit geraumer Zeit von beauftragten Häschern des Rechts über alle Kontinente gejagt. Interpol ist ihm hart auf den Fersen, wenngleich bislang vergeblich.
Da ich mit ihm über weit mehr als ein halbes Jahrhundert hinweg nicht minder herzlich verbunden war als mit Peter, teilweise sogar noch inniger, beschäftigt mich inzwischen seine überaus konfliktreiche, zuweilen abgründig dramatische Lebensreise viel stärker als der besagte Ehebruch.
Der Not gehorchend, will und muss ich unbedingt auch dem nachgehen, was mir der verstorbene Intimus durch den Verweis auf das vermeintliche Elbmonster in Verbindung mit dem Namen seines Bruders noch preisgeben wollte.
Die aufgeblasene und weitverbreitete Story vom menschenfressenden Ungeheuer in Deutschlands zweitgrößtem Fluss ist ja sicherlich dem meisten Zeitgenossen sattsam vertraut, spukte sie doch oft genug durch den Medienwald (ich werde sie später vorsichtshalber nochmals darbieten). Was jedoch die wundersame Geschichte mit Abel zu tun haben könnte, bleibt mir vollkommen schleierhaft. Gleichwohl bin ich davon überzeugt, dass irgendetwas dran sein muss. Ansonsten hätte Peter während seiner letzten Atemzüge bestimmt Wichtigeres zu sagen gehabt.
Das und vieles mehr aufzuspüren, wird zweifelsohne ein sehr langwieriges und gleichermaßen dornenreiches Unterfangen, gleichsam eine Bürde, die ich mir beileibe nicht unbekümmert auflade.
Insofern sind meine bisherigen Ausführungen tatsächlich nur die Vorgeschichte, der eigentliche Beweggrund für die herannahende Erzählung, quasi eine Art schriftstellerische Ouvertüre, auch wenn es sich dabei ebenso um wahre Begebenheiten handelt wie bei den noch zu verfassenden Geschehnissen.
Diese besonders gewissenhaft und ausführlich zu schildern, empfinde ich derweil schon beinahe als geziemende Pflicht. Sie wird zwangsläufig ungleich härter sein als das bisher Gebotene.
1
Mit dem Alter ist es wie in höheren Ämtern: Kaum jemand will freiwillig abtreten. Die einen hängen am Leben, die anderen an ihrer Funktion und meist noch viel stärker am Geld, dem nahezu sämtliche Bereiche unserer oftmals recht merkwürdigen Zivilisation knechtenden Abgott.
Weil ich mittlerweile selbst bereits sechsundsiebzig Lenze überschreiten durfte, also dank Fortunas Gunst schon mancherlei irdische Prüfungen halbwegs bestanden habe, sind mir derartige Behauptungen sicherlich unbesehen gestattet. Sie beruhen im erheblichen Maße auf eigener Erfahrung.
Mithin frage ich gezielt: Wer möchte nicht seinen diesseitigen Aufenthalt möglichst bis zum letzten Atemzug genießen, anstatt fortwährend auf das mutmaßliche Paradies im ungewissen Himmelreich zu hoffen?
Und die Liebe, das mit Sicherheit betörendste aller Phänomene? Ich gestehe: So manche Wogen jugendlicher Leidenschaft haben sich bei mir allmählich geglättet. Dergestalt bezirzende Schmetterlinge suchen und finden woanders ein ersprießlicheres Domizil als bei spürbar betagten Adressaten. Doch an ihrer Stelle wachsen neue Werte, die selbstredend auch ihren speziellen Reiz entfachen, wenn man sie entdeckt, bewusst nutzt und achtsam pflegt. Immerhin darf ich hierzu mit gewissem Stolz verkünden, dass ich beispielshalber meine goldene Hochzeit im vertrauten Familien- und Freundeskreis längst ausgiebig feiern konnte. Ein wahrhaft erhebendes Gefühl! Obendrein veredelt eine famose Schar von Kindern und Enkeln mein Dasein. Glück oder Verdienst? Wohl eher beides.
Zugegeben: Manchmal wundere ich mich auch schon ein wenig darüber, wie es eigentlich kommt, dass meine Gemahlin und ich es so lange miteinander aushielten. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich ein besonders geduldiger Knabe bin, ohne hörig zu sein (glaube ich zumindest). Keinesfalls möchte ich nämlich als Weichling durch die Gegend schleichen. Das wäre mir höchst fatal, denn mir liegt sehr daran, erhobenen Hauptes meiner Bestimmung so nachzukommen, wie sie mir von Natur aus zuteilwurde, eben als Mann, auch wenn einige überdrehte Emanzen in Gestalt ziemlich merkwürdiger Nebelkrähen das heutzutage allenfalls infrage stellen.
Ich mag zwar Gleichberechtigung und weiß auch, dass Vertreter des schöneren Geschlechts in mancher Hinsicht selbst bei uns in Deutschland noch echt benachteiligt sind. Das ist schlimm genug! Aber für untertänige Typen, die man vor allem in häuslichen Bereichen antrifft, habe ich wenig übrig, obwohl sie mir zuweilen wirklich leidtun (wie uns bestimmte Verhaltensweisen allmählich zur Auslöschung der Liebe und daraufhin zu einer solch unerquicklichen Situation führen können, wird in einem späteren Abschnitt anhand eines konkreten Beispiels ausführlich dargestellt).
Zweifelsohne gab es auch in unserer Ehe mitunter heftige Stürme, aber niemals in der Stärke eines Orkans, der womöglich alles zerstört hätte. Das Schicksal hat uns nun mal zusammengefügt, und ich sehe nicht den geringsten Grund, das jemals ändern zu wollen (bis der Tod …).
Gleichwohl bin ich fest davon überzeugt, dass es viele Frauen gibt, mit denen ich ebenso zufrieden durchs Leben wandeln könnte und sie nicht minder glücklich wären als ich.
Umgekehrt will ich das auch gerne meiner Holden zubilligen. Oftmals ist nämlich eine gedeihliche Zweisamkeit gar nicht so schwer zu formen, wie es gegenwärtig die fast unzähligen Zerwürfnisse und Scheidungen befürchten lassen. Andererseits wusste bereits der römische Dichter Ovid vor zweitausend Jahren poetisch festzuhalten, dass leidenschaftliche Hingaben nicht ewig währen: „Jupiter lacht aus der Höhe über die Meineide der Liebenden und lässt sie bedeutungslos im äolischen Südwind verwehen“. Aber eine solide Partnerschaft ist mehr als überschäumende Schwärmerei. Wenn man allerdings erfährt, dass gegenwärtig (2013) in Ostdeutschland nur noch vierundfünfzig Prozent der Eltern minderjähriger Kinder mit Trauschein zusammenleben, kommt man schon ins Grübeln, ob die Familienform Ehe überhaupt noch eine Zukunft hat. Möglicherweise unterliegt sie tatsächlich einer schleichenden Auflösung.
Das wäre aber insbesondere deshalb fatal, weil sie von allen Bindungsarten immer noch über das sicherste, günstigste und höchste Geburtenpotenzial verfügt. Und nichts braucht unser arg verschrumpelter Lebensbaum dringender als eigenen Nachwuchs. Dabei geht es bei Weitem nicht nur um die künftige Sicherung des Wohlstandes, sondern ums Überleben schlechthin. Also müsste die Institution Ehe perspektivisch wieder gestärkt werden, wofür es durchaus reelle Chancen gibt.
Solche und weitere Themen werden im vorliegenden Buch tiefer ausgelotet.
Den Hauptteil meiner Ausführungen widme ich jedoch einer fast dämonenhaften Geschichte, deren Spukgeister mich unglaublich lange gefangen hielten, weil sie größtenteils realen Vorkommnissen entsprangen. Diese martervolle Peinigung will ich nun endgültig aus meinem Innersten verbannen, indem ich mir freiweg von der Leber schreibe, was mich eine halbe Ewigkeit unbarmherzig in Fesseln schlug.
Damit auch meine geschätzte Leserschaft rasch erahnt, was hinsichtlich des absonderlichen Geschehens als Lektüre zu erwarten ist, sei nachfolgend eigens dafür der wesentliche Handlungsverlauf unserer Story kulant preisgegeben.
Sonach flugs hin zu den Säulen der Ereignisse! Sie begegnen uns vorerst, trotz meines größtenteils atheistischen Weltbildes, im betont religiösen Gewand, und zwar wie folgt:
Die auffallend schöne und ebenso kluge Diana lag in den letzten Wehen und erwartete ein Kind der Sünde. Das vermochte in der Gemeinde von immerhin knapp viertausend Seelen kaum noch jemanden zu überraschen. Es hatte sich nämlich schon vor Monaten mit Windeseile herumgesprochen, dass ihre bezaubernde Lehrerin vom gleichermaßen attraktiven Priester geschwängert wurde.
Und nun erntete das aufsehenerregende Liebespaar die kostbarste Frucht seiner inbrünstigen Zuneigung. Auch diese Nachricht machte blitzschnell die Dorfrunde.
Obwohl die sensationelle Begebenheit unverblümt vom sträflichen Vergehen des katholischen Würdenträgers am Keuschheitsgelübde kündete, das er während seiner Weihe zum Kaplan andächtig vollzog, waren dennoch allesamt zutiefst erfreut und buchstäblich glückstrunken über den neuen Erdenbürger, den sie Abel nannten.
Jeder genoss auf seine Weise in vollen Zügen das augenscheinlich wohlwollende Entgegenkommen Fortunas: die stolze Mutter, weil sie ihrem Erwählten einen gesunden Sohn schenkte; der frischgebackene Vater, da ihm seine Angebetete den größten Herzenswunsch erfüllte; die Eltern der umschwärmten Wöchnerin, zumal sie bereits seit Längerem sehnsüchtig auf einen oder mehrere Enkel hofften. Und alle Einheimischen sowieso.
Keiner empfand die Botschaft als beunruhigend, wie üblicherweise zu befürchten wäre. Das Gegenteil davon trat ein: Die Menschen zeigten sich hellauf begeistert. Sie strömten trotz winterlicher Kälte am 18. November 1936 eilends zum großen Marktplatz, umarmten einander jubilierend, stimmten enthusiastisch Lobgesänge an, wiegten sich immer schneller im heißen Rhythmus ihres Nationaltanzes, dem Csárdás, und gerieten dabei zusehends in stürmische Euphorie, gleichsam, als ob sie der Himmel unverhofft mit lauter auserlesenen Gaben überschüttet hätte.
Nur die Erzeuger des scheinbar tollkühnen Missetäters erfuhren nichts vom ungezähmten sexuellen Begehren ihres Nachfahren. Dessen vorgeblich frevelhafte Exzesse hätten sie als strenggläubige Christen ohnehin nicht schadlos verkraftet. Insofern kam ihnen vielleicht der Umstand zugute, dass sich ihr Domizil in der Landeshauptstadt befand. Und Budapest war weit entfernt.
Da ihre Empfindlichkeit den Verwandten in der südlichen Provinz hinreichend vertraut war, hütete man sich streng davor, ihnen die für sie zweifellos unangenehme Nachricht zu übermitteln. Also vernahmen sie bis auf Weiteres nichts von der vermeintlichen Gotteslästerung ihres Filius.
Demgegenüber beflügelte das spektakuläre Geschehen sämtliche Bewohner der Siedlung, zählten doch sowohl die Pädagogin als auch der Pfarrer bei Jung und Alt zu den angesehensten und am meisten verehrten Persönlichkeiten der Ortschaft. Ebendarum hielten sie fortan gütlich ihre schützenden Hände über die junge Familie. Nicht einer der Bodenständigen sollte die faszinierende Harmonie des edlen Bundes jemals beeinträchtigen oder gar bewusst schädigen. Dieses hehre Versprechen krönten die Ansässigen einvernehmlich mit einem feierlichen Gelöbnis.
Aber da waren noch dunkle Mächte im Spiel, vornweg Luzifer. Selbstredend rieb sich der Höllenfürst infolge der zwar allseits beglückenden, jedoch unschicklichen Niederkunft genüsslich die Hände, denn er witterte einen besonders leckeren Braten. Ihm war geläufig, dass den Liebenden der kirchliche Segen andauernd versagt blieb. Sonach gewahr er eine durchaus reelle Chance, sich bei passender Gelegenheit ihres Sprösslings zu bemächtigen und dessen Schicksal zweckgerichtet zu beeinflussen. Dabei könne er sich als Geist der Finsternis viel Zeit lassen. Auch wenn Jahrzehnte vergingen, wäre es für ihn überhaupt kein Problem, denn sein Vorhaben werde ihm bestimmt niemand mehr streitig machen, auch wenn es sich manchen Sachkundigen als noch so verwegen und eigennützig darböte. Nicht einmal der himmlische Vater würde ihn daran hindern, sein Ziel zu erreichen, weil der besagte Bastard auch für den Heilsbringer als ein mit Fluch beladenes Wesen gälte.
Andererseits wäre zu erwägen, sorgte sich der Beelzebub jählings ein wenig verunsichert, dass der Erbarmer den Sterblichen schließlich alles verzeihen könne, solange sie fest an seiner Allmacht glauben.
Doch schon kurz darauf verwarf er rigoros sämtliche Einwände und sprach, um sich selbst nachhaltig anzustacheln, die folgenden Worte: „So ein Zinnober! Weg mit diesen unsinnigen Bedenken und hin zu meinem Plan mit Abel! Eine derart reizvolle Trophäe darf ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Ich muss und werde mir diese verheißungsvolle Beute aneignen, koste es, was es wolle! Dann mache ich die Nacht zum Tage, um mich ausgiebig zu sonnen, denn es wird mit Sicherheit ein grandioser Erfolg!“, frohlockte der Antichrist. „Am besten, ich würde dem Heranwachsenden schon im Knabenalter einen ordentlichen Denkzettel verpassen, damit der Jüngling wenigstens in dunklen Umrissen erahne, wer tatsächlich über ihn herrscht“, war des Gehörnten spontane Idee.
Möglicherweise werde er dem Spross zuerst die Eltern rauben und ihm später noch härtere Bewährungsproben aufbürden, grübelte der Widersacher des Herrn weiter. So könnte er den Burschen zum Beispiel mit einer äußerst mysteriösen Waffe ausstatten, über die bisher weltweit kein anderer Zweibeiner verfügt. Abel würde sich ihrer garantiert auch bedienen, beim ersten Mal als Halbwüchsiger wohl eher zufällig und dann, im Herbst seines Lebens, gewiss mit voller Absicht, um sich für mannigfach erlittene Schmähungen gnadenlos zu rächen.
„Doch sobald er dabei seine persönliche Gepflogenheit, die ‚heilige Zwölf’ tunlichst niemals zu überschreiten, auch nur einmal vernachlässigt und seine glühende Vergeltungssucht ein dreizehntes Todesopfer fordert, gerät er unabwendbar in jene Fänge, die man im abendländischen Kulturkreis als des ‚Teufels Dutzend’ oder ‚Zahl des Unheils’ bezeichnet. In diesem Falle wäre es um ihn geschehen, denn er befände sich vollends in meinem Reich“, johlte lautstark der Leibhaftige.
Dabei lockte ihn auch der Gedanke, Abel einst mit einem grauenhaften Monster in Verbindung zu bringen, das entlang des Elbstromes sein Unwesen treibt und besonders in der Wiege Sachsens für sensationelles Aufsehen sorgt, weil angeblich ein Mann in dessen Rachen verschwindet. Das Scheusal müsste eine von Experten bewusst vollzogene Kreuzung zweier riesenhafter Reptilien sein, welches sich unversehens deren Aufsicht entzieht, um danach landesweit Angst und Schrecken zu verbreiten.
„Okay, genau so muss es ablaufen! Damit hätte ich mein reizvolles Vorhaben mit dem außergewöhnlichen Sündenbock erfolgreich beendet. Ja, das ist ein überaus trächtiger Plan!“, schätzte der gewiefte Beelzebub seine typischen Überlegungen unter Dach und Fach gebracht zu haben, worauf ein überschäumender Freudentanz folgte, der ihn fast in Ekstase versetzte.
„Ach, da fällt mir doch noch etwas ein“, kam ihm plötzlich in den Sinn.
Inzwischen schon spürbar außer Atem geraten, fügte er seinem bereits gefassten Vorsatz mit vertrautem Selbstgespräch weitere Gedanken hinzu, indem er meinte: „Eigentlich brauchte ich den Jungen während seines ersten Jahrzehnts nicht unbedingt zu behelligen. Es gereichte mir sogar zum Vorteil, wenn er sich einstweilen aufs Beste entwickelt, zumal er fraglos eine vortreffliche Kinderstube haben wird.
Aber infolge des bevorstehenden großen Völkergemetzels (Zweiter Weltkrieg) treibe ich die ganze Sippschaft zu den besiegten Teutonen, und zwar in deren sowjetisch besetzten Ostzone. Von da ab müsste ich allerdings ununterbrochen ein Auge auf meinen künftigen Fang haben, damit mir nichts Wesentliches entgeht. Dessen ungeachtet werde ich Abel sofort auf eine äußerst grauenhafte Probe stellen. Obendrein könnte ich ihm nur wenige Lenze danach ein nahezu unglaubhaft düsteres Geheimnis anvertrauen, das er für lange Zeit strengstens behüten müsste, sofern er sich nicht freiwillig ans Messer liefern will.
Sollte er den erneut kaum zu übertreffenden Härtetest überstehen, gewähre ich ihm allenfalls in bewährter Spendierlaune noch über ein halbes Jahrhundert hinweg die üblichen Freuden der Homo sapiens, womit ich meiner angehenden Siegesbeute das irdische Dasein gebührend versüße, bis ich endgültig zuschlage.
Ergo stelle ich ihm geringstenfalls einen verlässlichen Freund zur Seite, mit dem er gemeinsam durch mancherlei Höhen und Tiefen des Lebens wandelt. Vielleicht wird er auch noch mit einem leiblichen Bruder beschenkt.
Ferner will ich dafür sorgen, dass Abel sich ab und zu in ein menschenähnliches Tier verwandelt, in dessen Gestalt er sich beliebig austoben kann, allerdings nur während seiner bildlichen Vorstellungen im Schlaf, eben als Traumaffe.
Na, das wird gewiss ein höchst merkwürdiges Spektakel, eine Art Rambazamba. Ich freue mich schon riesig darauf, denn es bereitet mir und meinesgleichen bestimmt einen Heidenspaß. Man darf also gespannt bleiben!“, jubelte der hinterlistige Urian und fügte schelmisch hinzu: „Des Weiteren beglücke ich ihn mit einer phänomenalen Eheliebsten, die ihrem Gemahl reichlich Wonnetrunkenheit bescheren wird. Auch Kinder soll er mit ihr zeugen, vorher jedoch einen ordentlichen Beruf erwerben und ihn dann so lange erfolgreich ausüben, bis ich eine ideale Gelegenheit erspähe, ihm ein für alle Mal den Garaus zu machen. Endlich hätte ich mein verlockendes Ziel erreicht. Oh ja, ein wahrhaft meisterliches Unterfangen! Gebongt!“, triumphierte der Satan abermals frenetisch.
Resümee:
Das waren spornstreichs nach Abels Geburt die makabren Überlegungen des überall bekannten und namentlich unter Gläubigen mitunter auch sehr gefürchteten Erzhalunken. Und sein Vorhaben mit unserem literarischen Helden sollte sich fast detailgetreu erfüllen.
Oder sind es im Grunde genommen doch stets konkrete Gestalten jener Denkgeschöpfe, die bisweilen eine geradezu verhängnisvolle Niedertracht im Schilde führen, um ihre teils mehr als fragwürdigen Interessen mit allen Mitteln durchzusetzen, selbst wenn sie dadurch unabwendbar die Boten des Todes wachrütteln?
Schließlich gilt: Ein Paradies für alle wird es auf unserem einzigartigen Blauen Planeten mit Sicherheit niemals geben und im Himmel erst recht nicht. Stattdessen müssen wir mehr denn je aufpassen, dass die Höllenqualen unzähliger Erdenbürger nicht ständig zunehmen, denn „die Linie, die Gut und Böse trennt, verläuft quer durch jedes Menschenherz“ (Alexander Issajewitsch Solschenizyn).
Ja, ich stimme dem Nobelpreisträger für Literatur hierauf vorbehaltlos zu: Im Grunde genommen schlummert sogar in jedem von uns ein potenzieller Mörder, auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen. Ob das launenhafte Monster erwacht und in welchem Maße es aktiv wird, hängt ganz von den jeweiligen Umständen ab.
Freunde, wir sind unterrichtet und nicht minder gewarnt!
Wer trotzdem seinen entsprechenden Wissensdurst stillen möchte, ist natürlich ausgesprochen willkommen!
Deshalb gleich ein vertraulicher Hinweis an meine verehrten Leser:
Zum glaubhaften Erzählen dieser vielschichtigen Story fühle ich mich aus mehreren Gründen in der Lage.
Ausschlaggebend hierfür ist der Sachverhalt, dass Abel nach einer unsäglichen Heimsuchung, die er mit elfeinhalb Jahren im Mai 1948 in Pirna/Sachsen erlitt, bei meinen Eltern neue Geborgenheit erfuhr und seither zu unserer Familie gehörte.
Auch war ich gottlob zugegen, als ihm bereits während seiner frühen Sturm-und-Drang-Zeit ein auserlesen knuspriges Mädchen in die Arme lief, mit dem er sich bald darauf vermählte. Das kündete offenbar von einem verheißungsvollen Spiel Fortunas, denn ich durfte häufig ein freudvoller Zeuge dessen sein, wie ihm seine schönere Hälfte allein schon mit ihrem ausnehmend bezauberndem Lächeln ständig neue Pforten zum Glück öffnete, wobei sein Wohlbefinden durch ihre augenscheinliche Warmherzigkeit und überaus faszinierende Intelligenz erst recht nachhaltig beflügelt wurde.
Und er blieb über Jahrzehnte hinweg mein bester Freund, bis ihn abermals eine unerhörte Tragödie überraschte und er daraufhin beinahe notgedrungen oder wie vom Teufel besessen selbst das Zepter des Grauens ergriff, um es auf seine Art zu handhaben.
Ja, die Wirklichkeit ist manchmal noch viel entsetzlicher als die verwerflichsten Produkte unserer regen Fantasie, mag sie gelegentlich noch so abartige Blüten treiben.
Wie viel Leid muss ein Mensch erfahren, welches Quantum an Schmach ihm zugefügt werden, bis das Maß des Erträglichen voll ist und plötzlich ein Umschwung seines Charakters vom allenthalben Barmherzigen zum unerbittlichen Rächer erfolgt?
Damit wir hinreichend verstehen, warum Erwachsene dies tun und jenes lassen, besonders wenn es sich um eine abrupte Änderung ihres Verhaltens im soeben erwähnten Sinne handelt, sind wir meist hilfreich beraten, uns ihre Kindheit und Jugend zu veranschaulichen. Sonach bedrängt mich die schier bodenlose Lebensgeschichte meines brüderlichen Weggefährten geradezu ungestüm, nachfolgend sehr weit auszuholen, einen großen Bogen zu spannen, mich nicht mit Halbheiten abzufinden, sondern aus der prallen Widersprüchlichkeit unserer individuellen sowie gemeinsamen Laufbahn vieles einzufangen, das auf irgendeine Weise mit seiner absonderlichen Schicksalsfügung verwoben sein könnte.
Außerdem werde ich gerne mit reichhaltigen Angeboten zur Diskussion über verschiedene Themenbereiche sowohl auf privater Ebene als auch in sozialer Hinsicht aufwarten. Derlei Einschübe geschehen im Vertrauen darauf, dass sie nicht nur bei mir noch manch graue Zellen im Oberstübchen wecken und aktivieren, um mein Urteilsvermögen weiter zu schärfen, sondern hoffentlich auch den empfänglichen Leser zum Nachdenken anregen und ihm darüber hinaus wohltuende Abwechslung bieten. Möge es so kommen!
Es ist nämlich nicht meine Absicht, bloß die Befindlichkeit zweier Menschen in der Partnerschaft oder anderweitig nach eigener Betrachtungsweise zu durchleuchten. Dazu reichen Groschenhefte und einschlägige Trivialliteratur schlechthin sowie dazugehörige Fernsehserien, wovon es gewiss mehr als genug gibt, denn der Markt ist regelrecht übersättigt. Solcherart Geplauder ist nicht mein Begehren. Es brächte allenfalls ein laues Behagen in mein Gemüt, aber noch lange keine echte Zufriedenheit. Dies gilt auch für jegliche Wort- und Textspielereien mit nur lausigen oder keinen Inhalten.
Das Leben ist doch viel zu reichhaltig, als dass wir uns allein mit dem gezielten Durchforsten der gelegentlichen oder teils auch ständig wiederkehrenden Freuden und Kümmernisse in den unterschiedlichsten Intimsphären begnügen sollten. Mir liegt also sehr daran, hin und wieder auch bewusst zu provozieren, Betroffenheit auszulösen oder das Gemüt in Wallung zu bringen, wenigstens aber besonnen zu unterhalten und originellen Genuss zu bewirken.
Ich werde mich auch nicht davor scheuen, bestimmte Passagen aus meinen frühren Büchern einzubinden. Das geschieht zum einen, weil sie nicht mehr im Handel sind, und zweitens glaube ich, auch damals schon ab und an belebende Gedanken verkündet zu haben.
Mein ziemlich eigenwilliges Vorgehen ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass ich seit Langem den gesellschaftlichen Zuständen und Prozessen große Aufmerksamkeit schenke, weil ich selbst am Puls der Zeit teilnehmen möchte, um dessen Atem zu spüren. Insofern ist das Buch zum Teil auch stark politisch sowie weltanschaulich orientiert und keine durchgängige, linientreue Erzählung oder Kriminalstory.
Unsere Erdentage eilen ohnehin in steter Veränderung von dannen. Sie gleichen wiederholt einer fortwährenden Balance zwischen Spiel und Pflicht sowie Verlangen und Wagnis. Machen wir das jeweils Beste daraus!
2
Abel Kager und ich erblickten im selben Jahr das Licht der Welt, er genau zwei Wochen später als ich und beide im Zeichen des Skorpions (Letzteres erscheint mir zwar absolut belanglos, ist aber für manche Leser sicherlich erwähnenswert).
Damals, neunzehnhundertsechsunddreißig, kam das krisengeschüttelte Europa immer noch nicht zur Ruhe. Kaum waren die unsäglich schmerzhaften Wunden des Ersten Weltkrieges einigermaßen verheilt und die furchtbar bitteren Tränen der Leidtragenden halbwegs gestillt, schon formten sich erneut drohende Gewitterwolken am Himmelszelt. Sie nahmen der wunderbaren Sonne zusehends einen Teil ihrer Leuchtkraft, welche seit Urzeiten irdisches Leben spendet. Aber nur wenige Zeitgenossen auf unserem überaus faszinierenden Himmelskörper erkannten das fatale Donnergrollen als ein nahendes Unheil, gleichsam einer Apokalypse, die schon bald alles Vorangegangene an Grausamkeiten und Todesopfern (wenigstens fünfzig Millionen Seelen!) in den Schatten stellen sollte.
Die Götter meinten es anscheinend wiederum nicht unbedingt gut mit ihren Erdenkindern und wohl am allerwenigsten mit den Bewohnern Teutonias.
Vielleicht öffnete auch die sagenumwobene Pandora als Abgesandte des Zeus in mannigfach bewährter Tradition ein weiteres Mal ihre Büchse, um die Sterblichen für ihr sündhaftes Verhalten zu bestrafen, weil diese trotz beschenkten Verstandes sämtliche Warnungen der legendären Kassandra ein weiteres Mal in den Wind schlugen.
Womöglich war es auch der Teufel in persona, „denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht“, sagte bereits Mephisto zu Faust.
Wie dem auch sei, ein jeder urteile nach eigenem Gutdünken, zeige sich jedoch stets aufgeschlossen für eventuelle Korrekturen!
Indessen bekunde ich sogleich freiheraus, dass sich mir derartige Schuldzuweisungen für menschliche Konflikte und Tragödien seit Langem als vollkommen abwegig darbieten. Es sind vielmehr gesellschaftliche Ursachen, oft direkt einherschreitend mit teils stark negativ ausgeprägten Eigenschaften von Individuen, welche fortwährend irgendwelche Katastrophen heraufbeschwören. Dazu gehören vor allem die egozentrischen Machtgelüste der Stärkeren zur Unterdrückung und Ausbeutung anderer, was zwangsläufig soziale Ungerechtigkeit zur Folge hat, obendrein angespornt durch blindwütigen religiösen oder politischen Fanatismus und dieser wie eh und je gepaart mit garstiger Intoleranz. Hinzu kommen Begehrlichkeiten diverser Art, ferner Missgunst, Rachsucht sowie die maßlose Selbstüberschätzung bestimmter Subjekte.
Das sind meines Erachtens die maßgeblichen Triebkräfte des Bösen, und sie wirken heute nicht anders als früher. Allein wenn wir uns die laufenden Vorgänge im Weltgeschehen kritisch ins Blickfeld rückten, hätten wir bereits genügend geistigen Zündstoff.
Diesen jetzt zu entfachen, dürfte momentan wohl kaum jemanden ernsthaft nötigen. Darum wieder schnurstracks zurück zum Ausgangspunkt meiner Schilderungen!
Als Abel und ich 1936 geboren wurden, tobte in Spanien ein abgründig grausamer Bürgerkrieg, und deutsche Verbände testeten an der Seite dortiger Faschisten ihre neuen Waffen („Legion Condor“). Es kämpften indessen auch viele Freiwillige (circa 60.000!) aus allen Herren Ländern gegen die aufkommende Franco-Diktatur. Darunter befanden sich solch namhafte Persönlichkeiten wie George Orwell, Egon Erwin Kisch, Ernest Hemingway, Ilja Ehrenburg, Hans Beimler und André Malraux. Ihr dort gezeigter Heldenmut war allerdings vergebens, sofern man vom weithin leuchtenden Fanal jener heroischen Aktionen einmal absieht (der auserlesen talentierte Schriftsteller Ken Follett setzte ihnen sowie dem spanischen Volksheer mit dem zweiten Teil seiner im September 2012 erschienen Jahrhundert-Saga „Winter der Welt“ ein überwältigendes literarisches Denkmal).
Ähnlich in Germanien: Überaus blindwütige Nationalsozialisten schickten sich an, das Tausendjährige Reich zu errichten, konzentrierten ihre Kräfte jedoch zunächst auf den bevorstehenden irrsinnigsten Waffengang aller Zeiten. Dafür diente ihnen das fraglos schändliche Friedensdiktat der Siegermächte von 1919 als willkommener Vorwand. Unter der Ägide ihres vom manischen Cäsarenwahn befallenen Führers Adolf Hitler machten sie sich also ans Werk, um die „Schmach von Versailles“ gezielt und ebenso unerbittlich zu vergelten. Doch es kam weit schlimmer, denn nie zuvor ward ein derart bestialisches Völkermorden inszeniert. Die verbrecherische Elite der „reinrassigen Arier“ vermochte etwas zu bewirken, das in der gesamten Menschheitsgeschichte seinesgleichen sucht und glücklicherweise nicht findet. Dabei hatte sie auch zahlreiche Befürworter sowie aktive Förderer, vornweg durch Rüstungsindustrielle, Teile der Finanzoligarchie und andere Monopolhaie.
Und kaum waren die Nazis zur Macht befördert, gewährten sie Heiratswilligen ein zinsloses Ehestandsdarlehen von bis zu eintausend Reichsmark. Das feierliche Ja-Wort verpflichtete daraufhin die Braut, ihren Arbeitsplatz aufzugeben und Kinder zu gebären (Frauenemanzipation war für Hitler ohnehin eine jüdische Marotte). Nach jedem frischen Sprössling erließ man den betreffenden Eheleuten fünfundzwanzig Prozent der vom Staat dargebotenen Summe. Mit der vierten Geburt war die Mutter schließlich „abgekindert“, wie man es treffend im Volksmund nannte.
Demzufolge ist es nicht verwunderlich, dass selbst die XI. Olympischen Sommerspiele 1936 in Berlin, welche für die Sportler der Gastgeber überragende Erfolge brachten, von den erkorenen Leitwölfen der frenetischen braunen Horden sogar als internationale Tribüne für ihre Zwecke missbraucht wurden, indem man deutsche Frauen gezielt dazu aufrief, emsig für mehr Nachwuchs im Lande zu sorgen.
Ach, wenn alle heutigen Mitbürger wenigstens einen blassen Schimmer davon hätten, was damalige Machthaber mit ihrer Familienpolitik tatsächlich beabsichtigten!
Dem „Führer“ und seinen Schergen ging es in besagter Hinsicht allein darum, „deutschblütige und erbtüchtige“ Eltern anzufachen, damit sie dem Regime genügend Kanonenfutter für die beabsichtigten Eroberungskriege lieferten. Waren Frauen und Männer indessen von Erbkrankheiten geplagt, drohte ihnen obendrein Zwangssterilisierung und den betroffenen Kindern Euthanasie (bewusste Herbeiführung des Todes). Handelte es sich gar um Menschen jüdischen Glaubens, wurden sie in Konzentrationslager getrieben, was gemeinhin ihr physisches Ende bedeutete.
Das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ wurde übrigens schon im Juli 1933 vom Deutschen Reichstag beschlossen, und es trat bereits Anfang 1934 in Kraft. Damit überantworteten die neuen politischen Herrscher eine ungeheure ethische Last den Ärzten, weil diese fortan verpflichtet waren, „mögliche Erbdefekte“, die sie bei ihren Patienten oder deren Familien vermuteten, den zuständigen Ämtern zu melden. Namentlich der Hausarzt sollte „Hüter am Erbstrom der Deutschen“ sein, wie es offiziell lautete. Sonach oblag es in erster Linie ihm, entsprechende Anträge an das Erbgesundheitsgericht zu stellen. Befand man dort, dass ein Mensch „erbkrank“ war, wurde er sterilisiert, selbstredend auch gegen seinen Willen. Und es gab durchaus genügend Leute, die wenig oder keinerlei Skrupel hatten, der inhumanen Order nachzukommen.
Sachbezogen wäre hier allerdings einzuräumen, dass die Zwangssterilisation keine Erfindung der Nationalsozialisten war. Sie wurde beispielsweise in den USA oder Dänemark wesentlich früher praktiziert, aber in Deutschland besonders radikal durchgesetzt. Daher wird es kaum jemanden überraschen zu erfahren, dass bis zum Mai 1945 im hiesigen Altreich mindestens 400.000 Menschen ihrer Zeugungsfähigkeit beraubt wurden, was rund einem Prozent der Bevölkerung im fortpflanzungsfähigen Alter entsprach. An dem Eingriff starben etwa 5.500 Frauen und 600 Männer. Außerdem wurden mehr als zehntausend Kinder in Gaskammern getötet. Doch bevor man sie als „unwert“ brandmarkte und sonach der Vernichtung preisgab, wurden nicht wenige der jungen Todeskandidaten „zu Forschungszwecken“ von Ärzten, Psychiatern und deren Helfern gezielt infiziert und teils auch mörderisch gequält.
Welch eine Barbarei! Gleichwohl darf das soeben Dargelegte nur als ein kleiner Einblick in jene Verhältnisse gewertet werden!
Sicher, niemand ist gezwungen, sich mit historischen Fakten und Zusammenhängen besonders intensiv zu beschäftigen. Es wäre ohnehin nicht jedermanns Sache. Das muss man akzeptieren, keine Frage. Aber wer sich mit der Vergangenheit nicht gründlich auseinandersetzt, sollte sie auch nicht als Kronzeugen für eigennützige Vorhaben missbrauchen, wie es hierzulande noch viel zu oft praktiziert wird. Das ist schlichtweg unredlich, selbst wenn man sich dabei noch so heftig auf die Freiheit des Geistes beruft.
Doch blicken wir nochmals kurz auf 1936 zurück!
Zweifellos gab es auch zu jener Zeit viele ehrbare Persönlichkeiten, darunter den pazifistischen Publizisten Carl von Ossietzky (1889 bis 1938), der im selben Jahr den Friedensnobelpreis nachträglich für 1935 zugesprochen bekam. Er konnte die hohe Auszeichnung als typischer KZ-Häftling „wegen Landesverrats“ freilich nicht eigenhändig entgegennehmen. Das haben ihm die regierenden Nationalsozialisten strikt verwehrt. Wohin ihre Wahnsinnsideologie letztlich führte, dürfte jedem ausreichend bekannt sein, der sich halbwegs dafür interessiert.
Sonach könnte die Erkenntnis reifen, dass ausnahmslos jedes gesellschaftliche System die ihm genehmen Herrscher, Befürworter, Mitläufer und Speichellecker, doch auch fortwährend seine Widersacher hervorbringt.
Das Land der Magyaren, unsere einstige Heimat, ward hingegen bereits seit 1920 vom Horthy-Regime beherrscht. Die Bezeichnung verweist auf jenen rechtsradikalen Reichsverweser, welcher sich 1941 beim Überfall auf die Sowjetunion der verheerenden Torheit Hitlers anschloss und schließlich mit seiner diktatorischen Regierungsform endete, wie es gerechterweise früher oder später allen militärisch gedrillten, auf Aggression gerichteten und obendrein vom Größenwahn befallenen Staatsgebilden widerfahren sollte, nämlich mit einer bedingungslosen Kapitulation.
Damit war auch ein beträchtlicher Abschnitt unseres künftigen Lebens weitgehend besiegelt, denn wir mussten Ungarn verlassen, wurden als Bürger mit ursprünglich deutscher Herkunft gewaltsam ausgewiesen.
Unsere Vorfahren kamen einst aus Schwaben und machten sich wohl schon zu Beginn des achtzehnten Jahrhunderts auf dem Balkan sesshaft (was ich allerdings für meine konkrete Ahnenreihe vorerst nur bis zum Jahre 1795 nachweisen könnte).
Die Ansiedlung der Siebenbürger Sachsen erfolgte indessen bereits im zwölften und dreizehnten Jahrhundert. Sie wurde amtlich besonders gefördert, nachdem die eroberungs- und zerstörungssüchtigen Reiterheere der kriegslüsternen Mongolen während ihrer Raubzüge ganze Landstriche verwüsteten, indem sie zahlreiche Städte und Dörfer buchstäblich dem Erdboden gleichmachten. Zugleich löschten sie deren Bewohner fast vollständig aus, sofern es sich nicht um auffallend schöne Frauen, begabte Handwerker oder namhafte Künstler und Gelehrte handelte, die sie zwanghaft mitnahmen, damit sie ihnen fortan uneingeschränkt dienen konnten: die Evastöchter als begehrte Sexualobjekte und die anderen mit ihren speziellen Fertigkeiten und Kenntnissen. So geschehen im Gefilde der Magyaren anno 1241.
Bemerkung: Das obige Wort „Sachsen“ ist kein Verweis auf die Herkunft der einstigen Kolonisten, sondern eine südosteuropäische Bezeichnung für deutsche Bergleute in Transsilvanien (jetzt rumänisch, ehedem Teil Ungarns). Jene Volksgruppe stammte höchstwahrscheinlich überwiegend aus Moselfranken.
Unsere Zwangsverschickung ereignete sich Anfang Mai 1948. Sie war eine der vielen Deportationen. Warum gerade meine elterliche Familie überhaupt vertrieben worden ist und alle unsere Verwandten bleiben durften, vermag ich bis heute nicht eindeutig zu erklären, denn wir waren weder reich noch faschistoid. Und mit waghalsigen Vermutungen will ich gar nicht erst aufwarten. Offensichtlich herrschte auch in dieser Frage ziemliche Willkür.
Aber Schwamm darüber! Ungarn ist ein herrliches Land mit ebenso tüchtigen wie freundlichen Menschen und darum garantiert jederzeit meines persönlichen Wohlwollens sicher. Ich verspüre zumindest keinerlei Missbehagen oder gar nachträgliche Rachegelüste für jene Schmach, welche dereinst meinen Eltern zugefügt wurde.
Die für mich äußerst merkwürdige Beförderung in Richtung „Ostzone“ der besiegten Teutonen dauerte annähernd sechs Tage und endete in Pirna, einem interessanten Städtchen an der Elbe, etwas größer als Meißen und in entgegengesetzter Richtung von Dresden. Dort hatte man uns für drei Wochen gemeinsam mit vielen anderen Leuten, die vom gleichen Schicksal betroffen waren, in einem großen Sammellager untergebracht beziehungsweise kurzerhand eingepfercht.
Schon während der ersten Stunden unserer seltsamen Beförderung in einem fest verschlossenen und daher furchtbar stinkenden Viehwaggon, zumal er mit „Umsiedlern“ berstend gefüllt war, bemerkte ich eine leise Sympathie gegenüber Abel, den ich vordem nicht kannte.
Trotz der widerwärtigen Bedingungen führten wir vielerlei Gespräche miteinander. Und so wuchs zwischen uns allmählich das zarte Pflänzchen echter Zuneigung, welches wir im anschließenden Wartelager sorgsam pflegten, damit es prächtig gedeihe, denn in uns keimte bereits zusehends die vage Hoffnung, es könne sich vielleicht allmählich zum kräftigen Baum als Symbol tiefer Freundschaft entwickeln.
Genau so kam es dann auch, wenngleich eine schier unglaubliche Tragödie, die wir damals im Alter von elfeinhalb Jahren gemeinsam in Pirna erlebten, unseren nachfolgenden Werdegang ebenso sprunghaft wie einschneidend beeinflusste.
Jener grauenvolle Zwischenfall war besonders für Abel ein derart harter Schicksalsschlag, dass er sich buchstäblich für immer in seiner arg verletzten Seele einbrannte. Seither plagen ihn unentwegt dahingehend Gewissensqualen, ob denn das schreckliche Ereignis gegebenenfalls durch mehr Besonnenheit und beherzterem Auftreten seinerseits hätte verhindert werden können. Diesen nervenaufreibenden Bazillus wird er zeitlebens nicht mehr los.
Obendrein wurde in ihm durch dieselbe verhängnisvolle Episode urplötzlich etwas ausgelöst, das nicht nur ihn, sondern auch mich wie vom Blitz getroffen auf der Stelle erstarren ließ, eine mysteriöse Kraft, die ich nach wie vor kaum zu beschreiben wage, geschweige denn umfassend erklären könnte.
Der Mensch ist ja so eine Art biochemische Fabrik, freilich eine hochmoderne, weil mit Gefühl und Verstand ausgestattet. Sobald ein Teil nicht mehr richtig funktioniert, gerät bisweilen das ganze System durcheinander. Handelt es sich dabei ausschließlich um einen körperlichen Defekt, sind die jeweils zuständigen Fachleute oftmals in der Lage, die genaue Ursache herauszufinden, um sie gezielt zu beheben oder hinsichtlich ihrer negativen Folgen wenigstens zu lindern. Wenn jedoch die gesamte Psyche erfasst wird, etwa durch ein unangenehmes Schockerlebnis, welches jählings eine hochgradige seelische (mitunter auch physische) Erschütterung in uns auszulösen vermag, kann es für die Lebensperspektive des Betroffenen sehr problematisch werden, sofern nicht rechtzeitig eine geeignete Therapie erfolgt. An eine solch medizinische Hilfe für Abel war damals überhaupt nicht zu denken. Er hatte weit und breit nicht die geringste Chance, entsprechend betreut zu werden.
Doch ehe ich detaillierter auf die grenzenlos fatale Begebenheit eingehe, um eine bedeutsame Grundlage für das Verständnis all dessen zu schaffen, was uns an nahezu Unfassbarem noch bevorsteht, will ich meinen verehrten Lesern zunächst eine Reihe persönlicher Erlebnisse und Gedanken anvertrauen, die in bestimmter Weise zum Thema gehören. Es fällt mir ohnehin schwer genug, das Kernproblem der Geschichte treffend und vor allem glaubwürdig zu übermitteln, weil es im europäischen Raum und anscheinend sogar weltweit bisher tatsächlich nichts Gleichartiges gibt, wie sämtliche Recherchen erneut bestätigt haben, die ich eigens wegen dieser autobiografisch untersetzten (Kriminal-)Erzählung in jüngster Zeit außerordentlich intensiv geführt habe.
Apropos Internet: Dank mehrmaliger und gleichermaßen drängender Aufforderungen durch meine liebe Frau habe ich mir nun endlich einen Personalcomputer angeschafft. Und ich gestehe leicht beschämt: Das hätte ich schon viel früher tun sollen! Obwohl er mich vorläufig mehr beherrscht als ich ihn, ist er mir dennoch bereits eine enorme Hilfe (wobei mich meine Enkel gerne unterstützen, zumal sie diesbezüglich schon viel mehr draufhaben als ich jemals erreichen werde).
Manchmal gebärde ich mich offenbar wie ein störrischer alter Esel. Vielleicht bin ich zuweilen auch einer. Na und? Ich kann mich trotzdem ganz gut leiden, ohne deshalb gleich ein Narzisst zu sein, jemand, der zunächst sein Spiegelbild anhimmelt und schließlich nur noch sich selbst liebt. Nein, solcherart egozentrische Vergötterung gehört wirklich nicht zu meinem Naturell. Das überlasse ich gerne Leuten wie etwa dem Modezaren Karl Lagerfeld, der sich nach eigener Bekundung nur für sich und sein künstlerisches Abbild interessiert. Dergestalt extravagante Allüren entsprächen überhaupt nicht meinem Charakter.
Außerdem weiß man doch spätestens im fortgeschrittenen Alter, dass viele Dinge und Geschehnisse, die wir ab und zu für höchst bedeutsam halten, erst recht, wenn wir sie auf irgendeine Weise selbst erlebt, gestaltet oder beeinflusst haben, ihrem Wesen nach nichts weiter sind als Nichtigkeiten im ewigen Reigen belangloser Ereignisse. Da stimme ich dem griechischen Schriftsteller Antonis Samarakis vorbehaltlos zu, indem er meinte, dass namentlich in einer Gesellschaft, wo Unsicherheit und Angst überwiegen, letztlich alles fließend wäre und es keine beständigen Werte mehr gebe: „Alles ähnelt Schatten, Erscheinungen, Sinnestäuschungen, die Welt ist nichts anderes als der flüchtige Traum eines Toten.“
Wer sich dennoch eigensüchtig erhöht und meint, ohne seine Existenz und Taten ginge die Menschheit zugrunde, ist zumindest ein bedauernswertes Geschöpf, wenn nicht gar ein armer Irrer.
Wir sind trotzdem gehalten, solche Persönlichkeiten zu achten und obendrein gefordert, möglichst immer und überall unser Bestes zu geben. Schließlich gilt: Wer für seine Ideale nicht lichterloh brennt, wird auch andere kaum entflammen. Es sind nicht die Satten und Genügsamen, auch nur vereinzelt die Glücklichen, von denen man nennenswerte Veränderungen erwarten darf. Vielmehr waren, sind und bleiben es die Unzufriedenen und erst recht die von ihrem jeweiligen Vorhaben Besessenen, deren Absichten und Handlungen den irdischen Dunstkreis zuweilen nachhaltig aus den Angeln heben.
Im Grunde genommen strebt doch fast jeder Mensch zuerst nach dem eigenen Wohlbefinden. Dessen erhoffte Verwirklichung bleibt hingegen oftmals ein frommer Wunsch.
Da helfen auch keine Zeitschriften, Bücher oder Schulen mit dem vielversprechenden Slogan „Wege zum Glück“ (ganz abgesehen davon, dass individuelles Heil in einer erstaunlichen Variationsbreite aufzutreten vermag).
Dank unserer notorischen Leichtgläubigkeit ist der Markt regelrecht übersättigt von derart scheinheiligen Seelentröstern. Offenbar lässt sich damit zur Genüge Bares verdienen.
Wer sich jedoch unentwegt von solcherlei Wunschvorstellungen statt von realen Zielen anstacheln lässt, wird immer der Getriebene sein, sich gleichsam wie in einem Hamsterrad wähnen. Man will fortwährend nach den Sternen greifen und versäumt, sich an der unendlichen Vielfalt und Schönheit irdischen Lebens selbst zu erfreuen.
Weil dem so ist, beschäftigt mich schon seit Längerem die Frage, was uns tatsächlich zeitweise daran hindert, einfach der Vernunft zu folgen, anstelle wiederholt begierig im Nebel zu stöbern.
Genau dieser Problematik widmete ich bereits mein erstes Buch, das unter dem Titel „Offenbarung“ im Juli 2005 vom damals noch blutjungen Arrival Verlag herausgebracht wurde. Die Erstauflage umfasste lediglich einige Hundert Exemplare, obzwar ich bereits im Voraus für ein Vielfaches davon bezahlt hatte. Ein Nachdruck konnte nicht mehr erscheinen, weil das kleine, speziell auf Belletristik orientierte Unternehmen anscheinend schon während seiner frühen Kinderjahre in zu heftiges Fahrwasser geriet und daher im Februar 2007 zwangsläufig Konkurs anmelden musste.
Ach, wie treffend, ja regelrecht bildhaft anschaulich du doch ähnliche Erfahrungen formulieren konntest, mein lieber Goethe: „Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt.“ Das war’s, aus und vorbei, fast umsonst der enorme Aufwand an Zeit und Kraft, glaubte ich ehedem, zumal meine einschlägigen Vorhaben sich nachgerade in Brodem auflösten. Schließlich nutzte ich über drei Jahre hinweg beinahe jede freie Minute, um ein lang gehegtes Vorhaben zu verwirklichen.
Es war mein heiß ersehnter Wunsch, vor meinem endgültigen Abflug ins Nirwana, das ich übrigens probeweise schon zweimal flüchtig aufsuchte (später mehr dazu!), möglichst noch etwas Gescheites auf den Markt zu bringen. Ich wollte meine Zeit am wenigsten mit dem üblichen Rentnerdasein vertrödeln (was freilich nicht etwa gegen die individuellen Praktiken der Senioren spricht; es sollte doch ein jeder tun oder lassen, was er für richtig hält, sofern es anderen nicht schadet!).
Einer Heldentat glich meine eigenwillige Beflissenheit keinesfalls. Das ist mir durchaus bewusst. Sie war einfach die Folge eines schier unbändigen inneren Dranges, meine Ansichten zu bestimmten Dingen des Lebens sowie aktuellen Begebenheiten in der Welt frisch von der Leber zu schreiben, natürlich stets verknüpft mit der vagen Hoffnung, das Ergebnis könne überwiegend Zuspruch finden und namentlich meine Getreuen vereinzelt sogar dazu beflügeln, fortan weniger Fehler zu begehen, als ich es bislang vermochte. Zudem hatte ich schon mehrere Verträge für Lesungen außerhalb meiner altehrwürdigen Heimatstadt Meißen unter Dach und Fach. Unterdessen konnte ich auch eigens dafür einen befreundeten Musikus überzeugen, künftig gemeinsam mit mir aufzutreten, dem empfänglichen Publikum seine faszinierende Kunst zusätzlich darzubieten, damit das ohnehin reizvolle Unterfangen noch attraktiver werde. Doch mein schöner Traum erfuhr schon bald einen spürbaren Wandel hin zur bitteren Realität, denn die überaus beflügelnde Gunst des Schicksals zog schleunigst von dannen.
Sicher, es gibt unzählige Ereignisse, die wesentlich schlimmer sind als das soeben grob geschilderte. Aber das Leben widerfährt uns stets konkret. Was dem einen als nichtige Lappalie erscheint, kaum erwähnenswert begegnet, kann sich dem anderen zur mittleren oder großen Katastrophe ausweiten. Deshalb sind auch Pauschalurteile äußerst selten dienlich, meistens regelrecht falsch und daher nahezu unstatthaft, weil irreführend.
Es sei hier auch meine fast beiläufig gewonnene Erfahrung unverblümt kundgetan: Wahrscheinlich ist es meist leichter, ein Buch zu schreiben, als es gegenwärtig hierzulande erfolgreich zu vermarkten, sofern man auf sich allein gestellt bleibt. Autoren in spe, ihr seid gewarnt! Aber lasst euch trotzdem nicht entmutigen, zumal sich die Geschmäcke des Publikums ja ständig ändern!
Wer in besagter Branche noch keinen Namen hat, weder auf einschlägige Beziehungen vertrauen kann noch hinreichend über den schnöden Mammon verfügt, muss sich eben um eine besondere Qualität seines Produkts bemühen und obendrein auf den Beistand der Glücksgöttinnen Fortuna oder Tyche hoffen, es sei denn, er nennt ein ausgeprägtes Naturtalent schriftstellerischer Art sein Eigen. Aber wer besitzt sie schon, die geniale Fabulierkunst, wähnt sich dergestalt begnadet? Kurzum, ich zaudere oftmals sehr hartnäckig bei jedem Wort, welches ich im Reigen mit anderen nach meinem geistigen Bilde suche, damit es mir gefalle und der Sache diene. Wohl dem, der lockerer damit umzugehen vermag! Eine gewisse Nonchalance ist fast immer von Vorteil, kostet bestimmt weniger Aufwand und Nerven. Doch kann jemand einfach aus seiner Haut springen, festgefahrene Gewohnheiten mühelos abstreifen?
Darum sei hier meiner verehrten Leserschaft auch gleich zusätzlich verraten, dass ich im Sommer 2009 eine 560 Seiten umfassende sozialkritische Erzählung beim Shaker-Media-Verlag herausbrachte. Sie trug den Titel „Abels Orakel“. Doch beachtliche Erfolge konnte ich auch mit diesem Buch nicht erzielen. Finanziell gesehen war es unterm Strich sogar erneut ein deutliches Minusgeschäft. Mir fehlt anscheinend das nötige Geschick, meine Produkte gewinnträchtig anzupreisen. Und als Selbstläufer taugen sie offenbar nicht. Trotzdem empfinde ich das kaum als ein nennenswertes Hindernis, denn für unseren Lebensunterhalt reicht bisher die Rente. Klar würde ich unsere Kinder und Enkel auch mit Geld gerne unterstützen, und doch betrachte ich das Verfassen von Texten eher als ein verlockendes Hobby.
Meine bessere Hälfte schätzt den Sachverhalt allerdings ganz anders ein. Sie meint, ich solle doch die Schreiberei endlich aufgeben und stattdessen des Öfteren an die frische Luft gehen. Das würde meiner Gesundheit bestimmt mehr dienen, als stundenlang am Computer zu sitzen. Obwohl mir Stubenhockerei auch zuwider ist, bin ich meines Vorhabens wegen doch gewillt, sie mehr als üblich zu erdulden.
Ach, die edlen Damen! Erst bedrängt sie mich ungestüm, mir einen Laptop zu kaufen, und nachdem ich einigermaßen mit ihm umgehen kann, sollte ich lieber wieder die Finger von der Kiste lassen.
Nun, wie dem auch ist, in meinem Alter zankt man sich nicht mehr. Das wäre schlichtweg vertane Zeit, weil es sich doch gemeinhin um belanglose Dinge handelt. Insofern sind wir gut beraten, über allen Zweifel erhaben zu sein. Je früher, desto besser. Das schont unser Nervenkostüm. Schließlich wissen wir doch längst, dass Frauen nicht selten mit dem beeindruckenden Drang ausgestattet sind, über Probleme endlos zu reden. Männer hingegen wollen sie lösen, möglichst schnell abhaken. Darin verbirgt sich freilich ein gewaltiger Unterschied, indessen gleichermaßen eine besondere Verlockung jedweder Partnerschaft. Wir beide sagen uns jedenfalls offenherzig die Meinung und schweigen hinterher oder handeln nach eigenem Gutdünken. Böse Worte sind tabu, gegenseitige Beleidigungen verabscheut, zumal wir es ernst nehmen mit den nötigen Freiräumen, die jeder braucht, um seinen Seelenfrieden zu wahren und sich wohlzufühlen.
Ergo habe ich des heiligen Einklangs wegen meinem holden Weiblein mit leichtem Augenzwinkern Folgendes mündlich zugesichert: Sobald ich nach Fertigstellung und erfolgreichem Vertrieb dieser Abhandlung Millionär bin, höre ich mit derlei Beschäftigungen sofort auf. Und sollte das nicht eintreten, was ja nahezu hundertprozentig sicher ist, beende ich erst recht meine einschlägigen Bemühungen. Der alte Shakespeare würde hierauf sicherlich entgegnen: „Die Botschaft hör’ ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.“ Ich teile seine Erfahrung. Zudem sollte man ja auch niemals nie sagen. Lassen wir es einfach an uns herankommen!
Meine verehrten Leser haben gewiss schon beizeiten erfasst, dass es sich hier weder um Selbstmitleid noch um ein wehmütiges oder gar zorniges Klagelied handelt. Die vielleicht etwas merkwürdig anmutenden Äußerungen sollen lediglich etwas aufmunternd unterhalten. Vorerst wenigstens.
Eigens deshalb werde ich mich im nächsten Kapitel absichtlich noch tiefer in jene abenteuerliche Begebenheiten hineinbemühen, die auf irgendeine Weise mit meiner bisherigen Tätigkeit als Autor verknüpft sind. Eine selbstgefällige Nabelschau ist dabei nicht beabsichtigt, denn sie wäre garantiert unersprießlich.
Demnach betone ich aus vollem Herzen: Es reizt und treibt mich mehr denn je, Abels höchst seltsame Schicksalsfügung einer interessierten Öffentlichkeit schonungslos preiszugeben. Außerdem sind bekanntlich aller guten Dinge drei. Darum will ich auch dieses Buch trotz mancher Widrigkeiten unbedingt fertigstellen.
Sollte es jedoch nach einer gewissen Zeit ebenso wenig erfolggekrönt bleiben wie seine zwei Vorgänger, dann müsste ich wohl endgültig die Segel streichen, indem ich eingestehe, dass mir jedwedes Talent zum Verfassen schöngeistiger Literatur fehlt oder es kaum jemanden interessiert, was ich zu Papier bringe. Die bisher rund dreihundert veräußerten Exemplare sind schließlich kein beachtenswerter Erfolg, zumal ich gut ein Drittel davon verschenkt habe. Kurzum: Aufwand und Ertrag stünden weiterhin in einem denkbar schlechten Verhältnis zueinander. Da müsste ich notgedrungen meiner lieben Frau zubilligen, dass sie den entsprechen Sachverhalt beizeiten richtig einschätzte. Aber Langeweile käme bei mir trotzdem nicht auf, denn es gibt allerlei Möglichkeiten, die verbleibende Freizeit auch im Seniorenalter sinnvoll zu nutzen, solange unsere geistigen und körperlichen Kräfte einigermaßen mitspielen. Auf einer Insel trunkener Seligkeit wäre ich aller Voraussicht nach nicht lange glücklich, weil ich das süße Nichtstun erst in meinem nächsten Leben genießen möchte. Aber so weit ist es gottlob noch nicht.
3
Ja, manchmal erweisen sich uns die Schicksalsmächte in Gestalt holder Weiblichkeit reichlich gewogen, offenbaren ihren Liebreiz und verwöhnen uns mit ihrem ungemein betörenden Wesen. Aber sie bleiben fortwährend unberechenbar. Gleichwohl halte ich es für das Kostbarste, was uns Staubgeborenen jemals anrühren kann, nämlich persönliches Wohlergehen, das wiederum überaus facettenreich auftritt, weil es vielerlei Gesichter hat. Was um Himmels willen könnte erhabener sein, als unaufhörlich nach ihm zu streben, damit möglichst alle Menschen ein glückliches Dasein finden, und zwar hier auf Erden und nicht irgendwann im vermeintlich paradiesischen Jenseits? Die Gefilde der Erlösten können also warten und die Hölle sowieso. Diese erlebt man ja ohnehin nach wie vor vielerorts auf unserem einzigartigen Planeten.
Ich weiß, mein beschwörendes Ersuchen zum aktiven Handeln sind hehre Worte. Aber wir können wirklich etwas dafür tun, jeder auf seine Weise und das vornehmlich auf heimatlichem Boden. Dabei brauchen wir uns um die oberen Achtzigtausend nicht zu kümmern, deren Privateigentum derzeit nahezu ein Viertel des Vermögens aller Deutschen ausmacht. Sie verkörpern quasi das reichste Promille und sind gewiss auch besonders stolz darauf, obgleich sich die landestypisch unerbittliche Jagd nach materiellem Besitz als am wenigsten sinnstiftend darbietet. Sie wirkt letztlich inhuman.
Wenn ich hierzu exemplarisch dem üblichen Blätterwald entnehmen durfte, dass Josef Ackermann, einst Vorstandschef der Deutschen Bank, uns auch als markanter Typ mit seinem demonstrativen Victoryzeichen sattsam bekannt, ein Jahressalär von bis zu vierzehn Millionen Euro erhielt, so frage ich gezielt: Was macht ein Mensch eigentlich mit so viel Geld? Er könnte doch allerlei Gutes bewirken. Manche werden sicherlich auch danach handeln, und Egoisten gibt es schließlich überall. Ob der clevere Schweizer besagte Moneten redlich verdiente, sie einfach erhielt oder sich kraft seines Amtes wie in einem Selbstbedienungsladen kurzerhand nahm, vermag ich nicht zu beurteilen. Dessen ungeachtet verkünde ich unverblümt, ja sogar mit fühlbarer Genugtuung, dass solche ichsüchtigen Charaktere in mir keinerlei Neid aufblühen lassen, ergo auch nicht die riesige Summe ihrer Penunzen (Wendelin Wiedeking von der Porsche AG konnte sogar auf stolze sechzig Millionen Euro Jahreseinkommen verweisen, was aber noch keine Obergrenze markiert, sofern die Politik keinen Riegel vorschiebt). Mir hingegen reicht wahrhaftig eine vergleichsweise winzige Kleinigkeit davon, um frohgemut durch den Tag zu wandeln. Dafür sei meinen lieben Eltern gerne noch posthum gedankt.
Außerdem dürfte sich die wissenschaftlich belegte Erkenntnis herumgesprochen haben, dass es sich bei Führungskräften, namentlich in großen Höhen, fast immer und überall um „Menschen mit psychopathischer Tendenz“ handelt (Daniel Nettle), also Persönlichkeiten mit Neigung zu gestörtem oder widernatürlichem Gefühls- und Gemütsleben. Sie gebärden sich nach dem bewährten Grundsatz: je rücksichtloser, desto größer der Erfolg. Jedwede Verträglichkeit wäre kontraproduktiv.
Solcherart Charaktereigenschaften empfinde ich jedenfalls als nicht erstrebenswert (wenngleich es offenbar auch sie geben muss).
Hinzu kommt, dass man in jener Sphäre anscheinend weder irgendwelche moralische Skrupel noch einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn vorfinden dürfte.





























