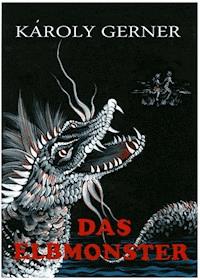Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vor nicht allzu langer Zeit konnte man sich noch ohne Furcht und Argwohn am Liebreiz Meißens erfreuen, einem Kleinod deutscher Geschichte und Kultur, einem altehrwürdigen Städtchen mit bezauberndem Flair. Doch nun ist das heimische Wohlbefinden aus den Fugen geraten, und es vergeht kein Tag, an dem nicht voller Entsetzen und tiefer Sorge über die unerklärbaren Geschehnisse gesprochen wird. Schon trauen sich Frauen und Kinder spätestens nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr allein auf die Straße. Dies ist eine wohl verständliche, aber dennoch seltsame Reaktion, da bisher keine einzige Frau von den verhängnisvollen Ereignissen unmittelbar betroffen war. Kinder ebenso wenig. Es sind ausschließlich Männer … Etwas Ungeheures geht um in der Kleinstadt. Warum springen lebensfrohe Menschen reihenweise in den Tod? Ist es ein Virus, der sie befällt und in den Suizid drängt? Oder treibt ein Serienkiller sein Unwesen? Der kurzweilige und fesselnde Krimi enthält autobiografische Züge. Durch eine anschauliche und unterhaltsame Erzählweise gelingt es dem Autor, seine Leser mit überaus merkwürdigen Begebenheiten vertraut zu machen. Heike Deschle, Leipzig
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 132
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Kapitel XX
Kapitel XXI
Kapitel XXII
Kapitel XXIII
Kapitel XXIV
Kapitel XXV
Kapitel XXVI
Kapitel XXVII
Kapitel XXVIII
Kapitel XXIX
Kapitel XXX
Kapitel XXXI
Kapitel XXXII
Kapitel XXXIII
Kapitel XXXIV
Kapitel XXXV
Epilog
I
Die auffallend schöne und ebenso kluge Diana lag in den letzten Wehen und erwartete ein Kind der Sünde. Das vermochte in der Gemeinde von immerhin fast viertausend Seelen kaum noch jemanden zu überraschen. Es hatte sich nämlich schon vor Monaten mit Windeseile herumgesprochen, dass die bezaubernde Lehrerin vom gleichermaßen attraktiven Priester geschwängert worden war.
Obwohl diese Begebenheit unverblümt vom sträflichen Verstoß des katholischen Würdenträgers gegen das Keuschheitsgelübde kündete, waren dennoch allesamt zutiefst erfreut und buchstäblich glückstrunken über den neuen Erdenbürger, den sie Abel nannten.
Jeder genoss auf seine Weise in vollen Zügen das augenscheinlich wohlwollende Entgegenkommen Fortunas: die stolze Mutter, weil sie ihrem Erwählten einen gesunden Sohn schenkte; der frischgebackene Vater, da ihm seine Angebetete den größten Herzenswunsch erfüllte; die Eltern der umschwärmten Wöchnerin, zumal sie bereits seit Längerem sehnsüchtig auf Enkel hofften. Und alle Einheimischen sowieso. Sie strömten trotz winterlicher Kälte am 18. November 1936 eilends zum großen Marktplatz, umarmten einander jubilierend, stimmten enthusiastisch Lobgesänge an, wiegten sich immer schneller im heißen Rhythmus ihres Nationaltanzes, dem Csardas, und gerieten dabei zusehends in stürmische Euphorie, gleichsam, als ob sie der Himmel unverhofft mit lauter auserlesenen Gaben überschüttet hätte.
Nur die Erzeuger des scheinbar tollkühnen Missetäters erfuhren nichts vom ungezähmten sexuellen Begehren ihres Nachfahren. Dessen frevelhafte Exzesse hätten sie als strenggläubige Christen ohnehin nicht schadlos verkraftet. Insofern kam ihnen vielleicht der Umstand zugute, dass sich ihr Domizil in der Landeshauptstadt befand. Und Budapest war weit entfernt.
Demgegenüber beflügelte das spektakuläre Geschehen sämtliche Bewohner der Siedlung, zählten doch sowohl die Pädagogin als auch der Pfarrer bei Jung und Alt zu den angesehensten und am meisten verehrten Persönlichkeiten. Ebendarum hielten sie fortan gütlich ihre schützenden Hände über die junge Familie. Nicht einer der Bodenständigen sollte die entzückende Harmonie des edlen Bundes jemals beeinträchtigen oder gar bewusst schädigen. Dieses hehre Versprechen krönten die Ansässigen einvernehmlich mit einem feierlichen Gelöbnis.
Aber es waren dunkle Mächte im Spiel, vornweg Luzifer. Selbstredend rieb sich der Höllenfürst infolge der unschicklichen Niederkunft genüsslich die Hände, denn er witterte einen besonders leckeren Braten. Ihm war geläufig, dass den Liebenden der kirchliche Segen andauernd versagt bleiben musste. Sonach gewahrte er eine durchaus reelle Chance, sich bei passender Gelegenheit ihres Sprösslings zu bemächtigen und dessen Schicksal zu beeinflussen. Dabei könnte er sich als Geist der Finsternis viel Zeit lassen, denn sein Vorhaben würde ihm bestimmt niemand streitig machen, auch wenn es sich als noch so verwegen und eigennützig darböte. Nicht einmal der himmlische Vater würde ihn daran hindern, sein Ziel zu erreichen, weil der besagte Bastard auch für den Heilsbringer als ein mit Fluch beladenes Wesen galt.
Andererseits müsste er erwägen, sorgte sich der Beelzebub ein wenig unsicher, dass der Erbarmer den Sterblichen schließlich alles verzeihen könnte, solange sie fest an seine Allmacht glaubten. Doch schon kurz darauf verwarf er rigoros sämtliche Einwände und sprach, um sich selbst nachhaltig anzustacheln: „So ein Zinnober! Weg mit diesen Bedenken und hin zu meinem Plan mit Abel! Eine derart reizvolle Trophäe darf ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Ich muss und werde mir diese Beute aneignen, koste es, was es wolle! Dann mache ich die Nacht zum Tage, um mich ausgiebig zu sonnen, denn es wird mit Sicherheit ein grandioser Erfolg!“, frohlockte der Antichrist. „Am besten, ich würde dem Heranwachsenden schon im Knabenalter einen ordentlichen Denkzettel verpassen, damit der Jüngling wenigstens in dunklen Umrissen erahnt, wer tatsächlich über ihn herrscht“, war seine spontane Idee.
Vielleicht sollte er dem Spross zuerst die Eltern rauben und künftig noch härtere Bewährungsproben aufbürden, grübelte der Widersacher. Er könnte ihn mit einer Waffe ausstatten, über die kein anderer verfügt. Abel würde sich ihrer bedienen, beim ersten Mal als Halbwüchsiger wohl eher ungeplant, doch später, im Herbst seines Lebens, mit voller Absicht, um sich für mannigfach erlittene Schmähungen gnadenlos zu rächen. „Sobald er jedoch die ,heilige Zwölf’ überschreitet und seine glühende Vergeltungssucht ein dreizehntes Opfer fordert, wird es um ihn geschehen sein. Dann befindet er sich vollends in meinem Reich“, johlte der Leibhaftige und fiel in einen überschäumenden Freudentanz, der ihn fast in Ekstase versetzte.
„Ach, da fällt mir ein“, kam es ihm plötzlich in den Sinn, „ich werde den Jungen während seines ersten Jahrzehnts nicht behelligen. Er soll sich einstweilen aufs Beste entwickeln. Aber nach dem großen Völkergemetzel1 treibe ich seine ganze Sippschaft nach Deutschland und werde dann ununterbrochen ein Auge auf ihn haben, damit mir nichts Wesentliches entgeht.
Des Weiteren beglücke ich Abel mit einer phänomenalen Eheliebsten, die ihm reichlich Wonnetrunkenheit bescheren wird. Auch Kinder soll er mit ihr zeugen, vorher jedoch einen ordentlichen Beruf erwerben. Darüber hinaus gewähre ich ihm weitere Freiheiten und Genüsse. Doch meinem Plan entkommt er nicht!“, sprach’s und triumphierte begeistert.
1 Gemeint ist der Zweite Weltkrieg.
II
Es war eine sonderbare Begebenheit, die mich dazu bewog, mich mit Abels höchst merkwürdiger Laufbahn auseinanderzusetzen. Den entscheidenden Antrieb dafür erhielt ich durch Peter, und zwar ausgerechnet zu jener Stunde, in der er sich von allen irdischen Gefilden endgültig lossagen musste. Da ich sowohl mit Abel als auch mit Peter lange innig befreundet war, halte ich es für angebracht, dessen Lebensgeschichte wenigstens in groben Zügen ins Blickfeld zu rücken, denn immerhin gaben mir seine Abschiedsworte schwer lösbare Rätsel auf.
Peter entdeckte mit knapp fünfundzwanzig Lenzen ein Mädchen, dessen einnehmendes Wesen ihn regelrecht überwältigte. Es begegnete ihm als die personifizierte Verkörperung einer nahezu idealen Harmonie von Natürlichem und Geistigem. Das nahm ihn restlos gefangen, und er frohlockte, als ihn Amors Pfeil mitten ins Herz traf und er von allen möglichen Geschenken das kostbarste erhielt. Sonach warb der Jüngling überaus leidenschaftlich um die Gunst seiner Angebeteten. Die Schicksalsgöttin meinte es offenbar gut mit ihm, denn nach anfänglichem Zögern erwiderte das Mädchen bereitwillig sein Begehren.
Die Liebe zwischen Peter und seiner hinreißenden Veronika musste zwar im Verlauf von Jahrzehnten mehrere, teils auch ziemlich harte Proben überstehen, doch ward sie umso tiefer und fester. Sie zeugten drei Kinder, und ihr Glück schien perfekt. Auch beruflich waren sie erfolggekrönt, da sie ihre Arbeit mit Sachkenntnis, Zuversicht und beflissen verrichteten, was ihnen hohe Anerkennung einbrachte.
Ihren Freundeskreis pflegten sie wie zarte Pflanzen, mit denen man behutsam verfährt, damit sie prächtig gedeihen. Ihr Umgangsmotto lautete: „Es sei alles erlaubt, was keinem schadet.“ In ihrer Nähe musste man sich einfach wohlfühlen, denn bessere Freunde kann man sich gar nicht wünschen. Kurzum, sie wirkten in jeder Hinsicht als Vorbild für das Tun und Lassen ihrer Mitmenschen.
Genau zwölf Monate nach Eintritt ins Rentenalter befiel meinen Freund das allseits gefürchtete, unberechenbare und überaus böse Haustier namens Krebs. Es nistete sich unversehens in seinen Körper ein und trieb ein mörderisches Spiel, indem es zuhauf Metastasen hervorbrachte. Peter blieb keinerlei Chance, dem grausamen Würgeengel zu entrinnen.
Wenigstens gewährten ihm die Mächte der Finsternis ein bisschen Zeit, die er eifrig nutzte, um wichtige Angelegenheiten zu erledigen. Auf den nahenden Tod war er ja nicht vorbereitet. Indessen boten sich mir wiederholt Gelegenheiten, mit ihm Gespräche zu führen, so auch das letzte Mal, kurz bevor er unwiderruflich von uns ging. Unser Gedankenaustausch wandelte sich allerdings beizeiten zum Monolog, indem ich aufmerksam zuhörte, was der todkranke Kamerad noch unbedingt loswerden wollte.
Er sprach zwar leise, trotzdem klar und verständlich, auch nicht im Geringsten wehklagend. Peter betonte, dass er gerne noch einige Jahre mitgemacht hätte, schon allein deshalb, um die redlich verdiente Seniorenzeit mit seiner lieben Veronika zu genießen. Aber es sollte eben nicht sein. Dennoch wäre er nicht unzufrieden mit seiner Lebensgestaltung, weil ihm und seinen Angehörigen der Grundsatz „Nutze den Tag, er kehrt nicht wieder!“ stets ein wichtiger Begleiter war.
Mit besonderer Genugtuung erfülle ihn die Zuversicht, dass seine Frau auch als Witwe in fast allen Belangen bestens zurechtkäme, da sie gottlob im hohen Maße eigenständig sei. Dessen ungeachtet hätte er nichts dagegen, fügte er zaghaft hinzu, wenn sie sich später einen anderen Mann suchte, mit dem sie glücklich wäre. Ergo könne er auch hierauf einigermaßen beruhigt bei Petrus anklopfen. Insofern gehe er in Frieden mit sich und der Welt.
Obwohl ich von ihm nichts anderes erwartet hatte, war ich doch aufs Angenehmste berührt. Danach beobachtete ich jedoch, wie sich auf seiner Stirn Sorgenfalten bildeten. Ich hatte den Eindruck, er wollte noch etwas Außergewöhnliches, vielleicht sogar Geheimes, meiner Obhut übertragen. Und tatsächlich flüsterte er nach längerem Zögern mit größter Anstrengung drei Worte in mein Ohr. Sie lauteten: „Sohn ... Abel ... Elbmonster.“ Deren Sinn habe ich allerdings nicht begriffen. Umso mehr hoffte ich, er füge noch etwas hinzu, damit mir ein Zusammenhang entstünde, der mir zumindest eine gewisse Deutung ermöglicht hätte. Aber dazu kam es nicht mehr. Seine Kräfte waren erschöpft. Schließlich vernahm ich ein dankbares Lächeln, und ich spürte, dass dies zugleich sein letzter Gruß war. Leise zog ich davon. Doch etwas Rätselhaftes blieb in meinem Inneren haften. Ich konnte mir trotz intensiver Grübelei keinen Reim darauf machen, was er mir anvertrauen wollte. Tags darauf war es mit Peter vorbei. Geist und Seele glitten ins Jenseits.
Ungeachtet seines Ablebens und der Erlösung vom Leiden wurde seine Witwe Veronika mehr denn je von Trauer geplagt. Gewiss, ihr blieben die fürsorglichen Kinder und deren tüchtige Partner, dazu eine Schar liebenswürdiger Enkel und nicht zuletzt der Freundeskreis. Doch all das ersetzte nicht jene harmonische Lebensgemeinschaft, die sich fortwährend aus innigster Zuneigung und respektvollem Umgang miteinander nährte.
III
Die Trauerfeier für den Dahingeschiedenen fand in einem relativ großen, gut gefüllten Raum statt. Unmittelbar vor Beginn der Zeremonie, als die Anwesenden schon Platz genommen hatten, öffnete sich nochmals die Eingangstür. In Begleitung eines jungen Mannes trat eine zirka fünfzigjährige Dame herein. Wir trauten unseren Augen nicht. Die Verwunderung steigerte sich mit jedem Schritt, den die beiden Fremden machten, weil sie mehr und mehr ins Blickfeld rückten. Sie verneigten sich gleichsam im Zeitlupentempo ehrfurchtsvoll vor dem Bildnis des Entschlafenen. Danach wandten sie sich ebenso bedächtig zum Publikum und suchten nach freien Plätzen. Jetzt befanden sie sich vollends im Sichtbereich aller Teilnehmer. Ein deutliches Raunen belebte den Saal, ausgelöst durch die gespenstische Szene. Es hatte den Anschein, als wäre der Tote wieder zum Leben erwacht, heimlich dem Sarg entstiegen, und stünde nun, um Jahrzehnte verjüngt, vor all den Menschen, die um ihn trauerten. Ein rätselhaftes und beklemmendes Bild, das sämtliche Anwesende in seinen Bann zog, denn dort stand kein Gespenst, sondern eine reale Person.
Die beiden Unbekannten, es handelte sich ganz offensichtlich um Mutter und Sohn, waren dem Anlass entsprechend gekleidet, von schlanker Gestalt und auffallender Noblesse. Der junge Mann überragte seine Begleiterin um gut eine Kopflänge. Die Frau trug ihr dunkles Haar straff nach hinten gekämmt und zu einem Dutt zusammengefügt. Dass das ungleiche Paar auf Anhieb volle Aufmerksamkeit erregte und Einzelne sogar in Angst und Schrecken versetzte, war kein Wunder, denn der Jüngling glich dem Verstorbenen buchstäblich wie aus dem Gesicht geschnitten. Doch alle wussten, dass Peter keinen Sohn hatte. Oder man glaubte es wenigstens bis dahin. Auch war es nicht zu übersehen, dass der junge Mann bei Weitem nicht so viele Jahre hinter sich hatte, wie die Ehe meines Freundes mit seiner wunderbaren Veronika, die vermutlich eigens deshalb in Ohnmacht fiel.
Indessen wurde mir nun blitzartig klar, welches Geheimnis mein Kamerad am Ende unserer Abschiedsstunde durch seine zögerliche Formulierung „Sohn“ mir anvertrauen wollte. Seit jenem denkwürdigen Ereignis vom Oktober 2008 treibt mich fortlaufend eine heftige Wissbegierde, der Sache auf den Grund zu gehen, herauszufinden, wie es dazu kam und was dahinter steckt.
Allein wie sich Peters einstiger Fehltritt auch immer offenbaren mag, im Vergleich zum Schicksal eines weiteren Freundes wird den meisten Interessenten eine derartige Sünde als reinste Bagatelle vorkommen. Abel war nämlich für lange Zeit der Dritte in unserem Bunde, zudem sein fester Anker, der Fels in der Brandung. Ihm war es jedoch nicht vergönnt, an der Trauerfeier teilzunehmen, weil er infolge widriger Umstände nichts davon erfahren hatte. Er befand sich angeblich auf einer Studienreise in afrikanischen Ländern und blieb für uns, trotz vielfältiger Bemühungen, einfach unerreichbar. Doch nicht nur das, er wird inzwischen auch von der Polizei weltweit gesucht. Bisher gibt es allerdings keine verwertbaren Hinweise zu seinem Verbleib. Ist er womöglich Opfer eines Verbrechens geworden? Oder hat er vielleicht selbst einen triftigen Grund zum Untertauchen? –
IV
Abel Kager und ich erblickten im selben Jahr das Licht der Welt, er zwei Wochen später, aber beide im Zeichen des Skorpions. Damals, neunzehnhundertsechsunddreißig, kam das krisengeschüttelte Europa immer noch nicht zur Ruhe. Kaum waren die Wunden des Ersten Weltkrieges einigermaßen verheilt, schon formten sich erneut drohende Gewitterwolken am Himmelszelt, was nur wenige Zeitgenossen als ein nahendes Unheil erkannten, gleichsam einer Apokalypse, die schon bald alles Vorangegangene an Grausamkeiten und Todesopfern in den Schatten stellen sollte.
Als Abel und ich geboren wurden, tobte in Spanien ein grausamer Bürgerkrieg, und deutsche Verbände testeten an der Seite dortiger Faschisten ihre brandneuen Waffen („Legion Condor“). In Germanien verkündeten blindwütige Nationalsozialisten, das Tausendjährige Reich zu errichten. Sie konzentrierten ihre Kräfte jedoch zunächst auf den bevorstehenden irrsinnigsten Waffengang aller Zeiten.
Das Land der Magyaren, unsere einstige Heimat, war bereits seit 1920 vom Horthy-Regime beherrscht, jenem rechtsradikalen Reichsverweser, welcher sich 1941 beim Überfall auf die Sowjetunion dem verhängnisvollen Machtstreben Hitlers anschloss. Sonach endete auch dessen Hochmut 1945 mit der bedingungslosen Kapitulation.
Damit war zugleich ein beträchtlicher Abschnitt unseres künftigen Lebens weitgehend besiegelt, denn wir mussten drei Jahre später Ungarn verlassen, wurden als Bürger mit ursprünglich deutscher Herkunft gewaltsam ausgewiesen.
V
Im Unterschied zu Abel standen an meiner Wiege keine anmutigen Grazien und erst recht nicht der über alles gebietende Mammon. In meiner Familie dominierte überwiegend der Küchenmeister Schmalhans. Es herrschte nahezu ständig ein Mangel, insbesondere an Lebensmitteln. Während mein Vater noch eine zumindest vierjährige Schulbildung hatte genießen dürfen, blieb unserer Mutter selbst das verwehrt. Sie war mehr als zwei Jahrzehnte lang Analphabetin, gleichwohl nicht ungebildet, denn sie verfügte über ein erstaunliches Erfahrungswissen, stets aufs Engste verknüpft mit einer beflügelnden Warmherzigkeit.
Wir hatten weder Strom, ergo auch kein Radio oder Fernsehen, noch Anschluss an ein öffentliches Wassernetz. Bei Dunkelheit zauberte eine Petroleumlampe spärliches Licht. Geld war uns zwar nicht völlig fremd, aber wir besaßen denkbar selten etwas davon. Natürlich verfügten wir Kinder über kein gekauftes Spielzeug. Doch Langeweile kam nicht auf. Wir halfen uns selber. Außerdem hatten wir von klein auf regelmäßig bestimmte Pflichten zu erledigen, was uns mit Stolz erfüllte, wenn wir unseren eigenen Beitrag zum Wohle der Familie leisten durften. So kümmerten wir uns beispielshalber um die verschiedenartigen Haustiere. Da gab es immer reichlich zu tun.
Unsere Mutter brachte insgesamt acht Kinder zur Welt. Zwei davon waren allerdings bereits gestorben, bevor ich als sechster Spross geboren wurde.
Wir lebten in einem winzigen Dorf namens Kispuszta2 mit insgesamt sechzehn datschenähnlichen Gebäuden, die lediglich aus Holz, Lehm und Spreu errichtet worden waren. Die Bewohner schufen ihre Katen selbst, wobei sich die Nachbarn gegenseitig halfen. In der spärlichen Siedlung, welche sich obendrein noch auf drei Täler verteilte, wohnten ungefähr achtzig bis neunzig Menschen, die sich hauptsächlich von der Landwirtschaft aus eigenem Anbau oder vom Wildern ernährten. Dies war freilich strengstens untersagt, wehe dem, der sich dabei erwischen ließ.
Das Dörflein befand sich im Süden Ungarns, unweit der Grenze zum ehemaligen Königreich Jugoslawien. Mittlerweile ist es längst dem Erdboden gleichgemacht, doch die Erinnerung stirbt nicht.