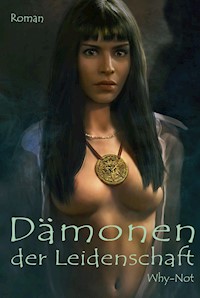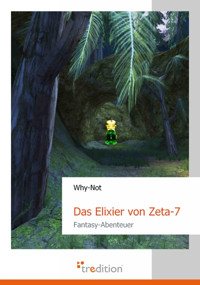
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im vorliegenden Roman steht das Abenteuer klar im Vordergrund. Spannende Unterhaltung mit überraschenden Wendungen erwartet den Leser, aber gelegentlich auch dezente Romantik und knisternde Erotik. Der Autor »Why-Not« hat bereits mehrere Kurzgeschichten in den SM-Szenezeitschriften »Schlagzeilen« und »Böse Geschichten« veröffentlicht. Außerdem ist von ihm im Marterpfahlverlag das Buch »Walters neue Welt« erschienen, eine Sammlung fünf erotischer Erzählungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 180
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Der Autor »Why-Not« hat bereits mehrere Kurzgeschichten in den SM-Szenezeitschriften »Schlagzeilen« und »Böse Geschichten« veröffentlicht. Außerdem ist von ihm im Marterpfahlverlag das Buch »Walters neue Welt« erschienen, eine Sammlung fünf erotischer Erzählungen.
Im vorliegenden Roman steht das Abenteuer klar im Vordergrund. Spannende Unterhaltung mit überraschenden Wendungen erwartet den Leser, aber gelegentlich auch dezente Romantik und knisternde Erotik.
Why-Not
Das Elixier von Zeta-7
Fantasy-Abenteuer
Kapitel 1 – Fremde Kulturen
Auf zur Jagd
Willst du dir nicht langsam mal einen Mann aussuchen?«, begann ihr Vater wieder mit dem Thema, das sie seit ihrem 17. Geburtstag mindestens schon hundert Mal besprochen hatten. Lissa hatte sich jetzt schon seit fast zwei Jahren geweigert, eine feste Bindung einzugehen. Und sie gedachte, das auch auf unbestimmte Zeit so zu halten.
»Wollen wir nicht lieber über das Wetter reden?«, gab sie genervt zurück. »Du kennst meine Antworten jetzt doch wirklich schon zur Genüge. Ich bin einfach nicht bereit, mich für den Rest meines Lebens an einen Mann und ein Heim binden zu lassen. Finde dich damit ab. Und – bevor du wieder damit anfängst – es ist mir egal, ob meine Einstellung unnatürlich ist.«
Lissas Vater seufzte und schaute sie traurig an.
»Warum nimmst du mich nicht einfach, wie ich bin?«, fragte sie ihn und gab ihm zwinkernd einen Kuß auf die Wange.
Dann schnappte sie sich ihren Bogen und den Köcher mit den Pfeilen und trat aus der Hütte auf den Platz. Zwei junge Männer mit Speeren standen bereits dort und warteten auf sie. Ihren breit grinsenden Gesichtern nach zu schließen, hatten sie Lissas Unterhaltung mit ihrem Vater mit angehört. Sie verdrehte die Augen und bedeutete den beiden, ihr zu folgen.
»Der Erste, der jetzt eine blöde Bemerkung macht, bekommt eine Kopfnuß«, raunte sie ihnen zu.
Marc und Rolf nahmen diese Drohung ernst. Lissa hatte schon mehr als eine Nase gebrochen, wenn ihr jemand zu aufdringlich wurde. Die Männer des Dorfes hatten gelernt, daß man Handgreiflichkeiten mit ihr besser aus dem Weg ging. Sie war zwar nicht außergewöhnlich stark, aber sehr flink und zielsicher. Sie gingen zu dritt zum Rande des künstlichen Plateaus, auf dem die Hütten standen. Während die beiden Männer darauf warteten, daß einer der Wächter eine Strickleiter herunterließ, faßte Lissa in die Schlaufen ihres weiten Umhangs und sprang einfach nach unten. Der Umhang blies sich auf und ließ sie in einer ungefährlichen Geschwindigkeit dem Boden entgegenschweben. Die beiden jungen Männer schüttelten nur den Kopf über so viel unnötigen Leichtsinn und ließen sich an der Strickleiter nach unten rutschen. Einerseits waren sie froh, daß Lissa sie begleitete, da niemand im Dorf so gut mit dem Bogen umgehen konnte wie sie. Andererseits war ihre Waghalsigkeit berüchtigt. Und schließlich tat es auch dem Selbstbewußtsein der Männer nicht gut, daß ausgerechnet eine Frau mehr wagte als jeder von ihnen. Aber das hätten sie nie zugegeben.
»Irgendwann einmal brichst du dir beide Beine oder krachst durch den Boden und landest auf dem Speiseplan eines Blutwurms«, meinte Rolf, der ältere der beiden, als sie Lissa eingeholt hatten.
»Vielleicht hast du ja Glück und darfst dabei zuschauen«, gab Lissa schnippisch zurück. »Und wer weiß, vielleicht ist es dann ja der Blutwurm, der auf meinem Speiseplan landet.«
»Weiber!«, formte Marc lautlos mit seinem Mund, während er Rolf ansah.
Dann gingen sie tiefer in den Wald hinein, der ihr Dorf umschloß. Es störte sie nicht weiter, daß der Wald abseits des Plateaus dichter und das Licht diffuser wurde. Sie alle hatten nie eine andere Umwelt kennengelernt. Der Wald mit all seinen Möglichkeiten, aber auch mit seinen vielfältigen Gefahren, war Teil ihres Lebens. Sie wußten, zu welchen Zeiten sie bestimmte Gegenden durchqueren durften und wann sie zu einer tödlichen Falle werden konnten. Das galt allerdings nur für die nähere Umgebung von etwa einem Tagesmarsch um das Dorf herum. Weiter entfernten sie sich nur selten von den Hütten. Denn eine Übernachtung außerhalb des einigermaßen sicheren Plateaus war immer ein großes Risiko.
Der heutige Ausflug ging bis an den Rand dieser gedachten Grenze. Von Zeit zu Zeit brauchten sie bestimmte Früchte im Dorf, um keine Mangelkrankheiten zu bekommen. Es wurden nicht einmal große Mengen benötigt. Einige, wenige Früchte würden für das ganze Dorf genügen. Ein paarmal hatten einige Dorfbewohner schon versucht, die Früchte näher am Dorf anzupflanzen, aber sie wuchsen nur an bestimmten Stellen. Und die nächste Stelle war eben gut eine Tagesreise vom Dorf entfernt.
Nachdem sie zwei Stunden unterwegs waren, wurden sie sehr schweigsam. Sie mußten durch eine gefährliche Gegend, aus der noch nie jemand zurückgekehrt war, der versucht hatte, sie nachts zu durchqueren. Sie wußten nicht, warum diese Gegend nachts tödlich war. Aber zumindest die Älteren im Dorf erzählten, daß sie einmal jemanden gefunden hatten, der es versucht hatte. Er sei fürchterlich zugerichtet gewesen, berichteten sie schaudernd. Lissa fragte sich manchmal, ob das nur Schauergeschichten waren. Aber auch für sie gab es eine Grenze zwischen Mut und Leichtsinn, die sie nicht überschritt. Die meisten Dorfbewohner hielten sie zwar für leichtsinnig und verrückt, aber sie ging nur dort Risiken ein, wo sie sie einschätzen konnte.
Als sie den gefährlichen Abschnitt unbehelligt hinter sich gelassen hatten, waren alle drei spürbar erleichtert. Marc stimmte ein leises Lied an und die beiden anderen stimmten ein. So würde Lissa zwar kein schmackhaftes Wieselhuhn vor den Bogen bekommen, da ihr Gesang diese scheuen Tiere in die Flucht trieb, aber Lissa hatte ohnehin erst auf dem Rückweg vor, ein oder zwei dieser Tiere zu erlegen, um sie mit ins Dorf zu bringen. Ein Feuer für die Zubereitung konnten sie sowieso nur auf dem Plateau entfachen, wenn sie nicht riskieren wollten, einen unberechenbaren Waldbrand auszulösen. Für unterwegs hatte jeder einen kleinen Essensvorrat dabei, den sie unterwegs noch mit einigen Früchten ergänzen wollten.
Plötzlich machte Lissa das Schweigezeichen und die beiden anderen verstummten augenblicklich und erstarrten. Wie in Zeitlupe nahm Lissa einen Pfeil aus dem Köcher und legte ihn in ihren Bogen. Konzentriert spannte sie die Sehne. Jetzt sahen auch Marc und Rolf, was sie entdeckt hatte. In etwa hundert Metern Entfernung fraß ein grüner Panther ein Erdferkel. Bislang schien er die kleine Gruppe von Menschen allerdings nicht bemerkt zu haben. Als er unbeirrt weiterfraß, entspannte Lissa langsam die Sehne ihres Bogens wieder, blickte allerdings weiterhin konzentriert in die Richtung des Panthers.
»Können wir nicht einfach einen Bogen um ihn herum machen?«, fragte Marc leise. Der Gedanke daran, durch die Raubkatze langsamer voranzukommen und womöglich eine zweite Nacht außerhalb des Dorfes verbringen zu müssen, behagte ihm gar nicht.
»Jetzt kann er uns nicht wittern, da der Wind aus seiner Richtung weht«, erklärte Rolf ihm. »Schleichen wir uns jetzt an ihm vorbei, bemerkt er uns. Und ich möchte nicht gerne herausfinden, ob er uns dem Erdferkel vorzieht.«
»Wir warten, bis der Panther fertiggefressen hat«, stimmte Lissa zu. »Dann ist er satt und wird uns von selbst aus dem Weg gehen.«
Sie mußten noch eine ganze Stunde warten, bis Lissa schließlich ihren Pfeil wegsteckte und direkt auf den Panther zuging. Rolf grinste, während ihr Marc, der noch nicht so viel Erfahrung hatte, mit offenem Mund hinterherstarrte. Lissa gab sich keine Mühe mehr, vom Panther unentdeckt zu bleiben. Dieser hatte bereits vom Erdferkel abgelassen und schaute träge in ihre Richtung. Dann sprang er mit einer geradezu lässig wirkenden Bewegung aus dem Stand auf einen fast zehn Meter entfernten, dicken Ast und blinzelte sie an. Rolf folgte Lissa inzwischen. Und auch Marc lief hinter den beiden her, den Speer fest umklammert.
»Er ist jetzt satt«, meinte Rolf und deutete mit seinem Speer auf den grünen Panther. »Nach dieser Mahlzeit wird er die nächsten drei Tage nicht auf die Jagd gehen. Er will jetzt einfach nur seine Ruhe haben.«
Marc schaute sich noch eine ganze Weile immer wieder nach dem Panther um, als sie ihn schon lange hinter sich gelassen hatten. Er hatte schon oft Geschichten gehört, in denen grüne Panther mit einem Sprung aus zwanzig Metern Entfernung angegriffen hatten. Und nach dem lässigen Zehn-Meter-Sprung von vorhin war jeder Zweifel darüber verflogen, ob das vielleicht Übertreibungen gewesen waren.
»Sag’ mal, Lissa«, begann er, »ab welcher Entfernung hättest du vorhin eigentlich auf den Panther geschossen, wenn er uns angegriffen hätte?«
»Ich hätte gewartet, bis er zum letzten Sprung angesetzt hätte. Dann reißt er das Maul auf und man kann ihm einen tödlichen Schuß in den Rachen geben.«
Marc schluckte.
»Das heißt, du hättest nur einen Versuch gehabt?«
»Wenn er auf mich zugerast wäre, ja. Hätte er einen von euch angefallen, hätte ich wohl auch noch einen zweiten Schuß gehabt. Obwohl das wahrscheinlich gar nicht nötig gewesen wäre.«
Sie drehte sich wieder nach vorne und konzentrierte sich auf den Weg.
»Was meint sie damit«, wollte Marc von Rolf wissen.
»Wenn der Panther seinen ersten Biß oder einen Schlag mit seinen scharfen, giftigen Krallen angebracht hat, kommt für den Angegriffenen jede Hilfe zu spät. Wenn er dich erwischt hätte, hätte er uns danach in Ruhe gelassen und sich darauf konzentriert, dich aufzufressen, solange wir ihn nicht angreifen. Und dir hätten wir sowieso nicht mehr helfen können.«
Marc schauderte.
»Dann lasse ich euch wohl besser vorgehen.«
»Prima Idee«, mischte sich Lissa grinsend ein, »die meisten Raubtiere würden ohnehin den letzten angreifen, nicht den ersten.«
»Ihr seid Idioten!«
Rolf und Lissa lachten.
Abschied von Neu-Orlando
Sie stöhnte und krallte sich mit den Fingern in das Bettlaken. Ricardo wendete sein ganzes Können auf und beobachtete nicht ohne Stolz die Wirkung. Ihr Atem kam jetzt nur noch stoßweise und heiser. Dann verkündete ein langgezogener Schrei ihren Orgasmus. Und unmittelbar danach hatte auch Ricardo seinen Höhepunkt erreicht. Ermattet rollte er von ihr herunter und blieb neben ihr liegen. Einen Moment genossen sie schweigend das Abklingen ihrer Lust.
»Du bist zweifellos der begabteste Schüler, den ich je hatte«, meinte sie nach einiger Zeit.
»Du bist ja auch eine begnadete Lehrerin«, gab er zurück.
»Danke für die Blumen. Aber die meisten meiner Kunden glauben, daß ihr Geld das einzige sei, was sie beizutragen brauchen. Na ja, genaugenommen haben sie ja auch recht. Es kommt selten vor, daß jemand so intensiv an der Vervollkommnung seiner Fähigkeiten arbeitet wie du. Manchmal habe ich direkt ein schlechtes Gewissen, dir dafür auch noch Geld abzunehmen.«
»Geld ist so ziemlich das letzte, was mich interessiert«, antwortete Ricardo, während er seine Hände über ihren aufreizenden Körper streichen ließ. »Wenn ich heute abend aufbreche, ist Geld eines der wenigen Dinge, die ich überhaupt nicht brauchen werde.«
»Wie lange wirst du denn auf deiner geheimnisvollen Mission sein?« »Die Chancen, sie überhaupt zu überstehen, stehen bei etwa 1:1000 – optimistisch geschätzt.«
Sie schaute ihn erschreckt an.
»Du machst dich über mich lustig, oder?«
»Nein. Ich werde die Stadt verlassen.«
»Die Stadt verlassen?«, fragte sie ungläubig. »Du bist ja verrückt. Warum begibst du dich auf so eine selbstmörderische Mission?«
»Dazu wurde ich schon mein ganzes Leben lang ausgebildet. Würde ich hierbleiben, falls man mich überhaupt ließe, wäre meine ganze Ausbildung – nein, nicht nur die Ausbildung, mein ganzes Leben – sinnlos. Alles, wofür ich gelernt und trainiert habe. Ich muß diese Herausforderung einfach annehmen.«
»Was kann man denn für diese mörderische Welt da draußen lernen und trainieren? Jenseits der Stadtmauern gibt es doch nichts als den Tod.«
»Du wärst überrascht, was es dort alles gibt. Aber du hast schon recht. Der Tod gehört auf jeden Fall dazu.«
Sie blieben noch eine Weile schweigend nebeneinander liegen. Schließlich erhob sich Ricardo. Beim Abschied sah er, wie sich eine kleine Träne in ihr linkes Auge stahl. Er verließ das Haus der Freuden und schlenderte in der Morgendämmerung zur Stadtmauer. Dies war sein letzter Tag in Neu-Orlando. Zumindest für einige Zeit, wahrscheinlich aber für immer. Es war schon ein seltsames Gefühl, diese Stadt hinter sich lassen zu müssen. Theoretisch war er zwar schon oft außerhalb von ihr unterwegs gewesen, aber eben nur theoretisch. Oder in einem Simulator. Und heute Abend würde es ernst werden. Für viele Sachen, die er in den nächsten Tagen tun würde, hatte er nur einen einzigen Versuch. Fehler außerhalb der Stadt zu begehen, war meist tödlich.
Inzwischen hatte er die Stadtmauer erreicht und erklomm die Stufen des Turmes. Die Sonne müßte jeden Moment am Horizont von Zeta-7 aufgehen. Ein Schauspiel, das er wohl auch heute das letzte Mal erleben durfte. Er erreichte die Aussichtsplattform gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie der Himmel kurz vor Sonnenaufgang rot erglühte, um dann langsam in ein immer schwächeres Rosa überzugehen. Schließlich blitzten die ersten Strahlen der Sonne über den Horizont, zunächst noch in einen rosa Schleier gehüllt. Wenige Minuten später stand sie schon gleißend am Himmel und erleuchtete die Landschaft unter ihm. Am Horizont war bereits der dichte Urwald zu erkennen. Ricardo warf einen Blick direkt nach unten. In einer Tiefe von etwa 5000 Metern ging gerade eine schroffe Küste in ein brodelndes Meer über. In wenigen Minuten würde die Stadt bereits über dem Ozean entlang schweben. Und einige Stunden später würden sie den Wald erreicht haben.
Eine gewisse Anspannung machte sich in Ricardo breit – keine Angst – nein, Angst hatte er wirklich nicht. Aber eine angespannte Unruhe und die Ungeduld, seine Fähigkeiten endlich einsetzen zu können. Wie es dort unten wohl wirklich roch? Die Simulation basierte auf Annahmen und einigen, wenigen Analysen unbemannter Sonden. Und bei der Simulation war es hauptsächlich um den höheren Luftdruck und die größere Luftfeuchtigkeit gegangen, mit der er dort unten würde zurechtkommen müssen. Der Geruch würde eine Überraschung werden. Es wurde Zeit für ihn, ein letztes Mal seine Ausrüstung zu kontrollieren. Mit einem leicht melancholischen Gefühl stieg er wieder vom Turm herunter und schlenderte ein letztes Mal durch die Stadt, in der er sein ganzes, bisheriges Leben zugebracht hatte. Ein bißchen hatte er sich hier immer wie ein Fremdkörper gefühlt. Es war ihm zwar alles vertraut, aber es war ihm nicht ans Herz gewachsen. Seine Haut war etwas dunkler als die der anderen Bewohner und hatte einen schwachen, olivfarbenen Schimmer. Man hatte ihm erklärt, daß das seine Chancen im Wald erhöhen würde, genau wie seine Fähigkeit, in geringen Höhen gut atmen zu können. Allerdings hatte ihn das hier immer etwas kurzatmig gemacht. Und seine Hautfarbe schaffte eine gewisse Distanz zu den anderen Bewohnern. Er war im wahrsten Sinne des Wortes für seine Mission »erschaffen« worden – in einem Gen-Labor der Stadt.
Als er schließlich das Gebäude des Expeditions-Corps erreichte, hatte er sich bereits innerlich von der Stadt verabschiedet. In drei Stunden würde er hier das letzte Mal etwas essen. Seine Ernährung war bereits seit Monaten so umgestellt worden, daß er im Wald keinerlei Probleme mit der dort vorhandenen Nahrung bekommen sollte. Er würde heute noch ein letztes Mal im Simulator trainieren, um Kraft, Schnelligkeit, vor allem aber das blitzschnelle Erfassen einer Situation und den Umgang mit unerwarteten Ereignissen zu trainieren. Am Anfang hatte er den Simulator verflucht, der ihn immer wieder mit scheinbar unlösbaren Aufgaben und Situationen konfrontierte. Inzwischen war er für Ricardo auch im höchsten Schwierigkeitsgrad keine echte Herausforderung mehr. Nach zwei Stunden kam er schließlich leicht verschwitzt, aber kaum angestrengt aus dem Gerät heraus. Er duschte ein letztes Mal und verabschiedete sich von seinen Trainern, die ihm viel Glück und gutes Gelingen wünschten. Dann überprüfte er mit großer Konzentration jedes Teil seiner Ausrüstung. Er war zwar trainiert, auch ohne diese Ausrüstung zurechtzukommen, aber die Vorteile, die sie ihm im Wald bescherte, würde er dringend brauchen, um sich doch den einen oder anderen Fehler erlauben zu dürfen. Er wußte, daß seine Kenntnisse über den Wald, seine Eigenheiten und Gefahren unvollständig waren.
Wie erwartet war jeder seiner Ausrüstungsgegenstände in einwandfreiem Zustand. Er verstaute sie sorgfältig in seinem Rucksack. Mit geschlossenen Augen tastete er noch einmal jede Seitentasche des Behälters ab, um auch unter schwierigen Umständen alles Wichtige sofort zur Hand haben zu können. Schließlich nahm er seine letzte Mahlzeit ein und ruhte sich aus. Denn er mußte topfit sein, wenn sein Einsatz begann. Später prägte er sich anhand von Luftaufnahmen sein Zielgebiet ein. Es würde sehr schwierig werden, da es nur sehr wenige markante Punkte in dem Urwald gab. Außerdem würde es Nacht sein, wenn die Stadt in die Nähe dieses Gebiets kam. Aber es war ohnehin ein Gebiet von mehreren Quadratkilometern, innerhalb dessen irgendwo sein eigentliches Ziel lag, die Absturzstelle eines der Alten Schiffe. Selbst, wenn er sein Zielgebiet erreichte, würde es wahrscheinlich Wochen oder Monate dauern, das Schiff zu finden – immer vorausgesetzt, der Wald brachte ihn nicht vorher um. Verfehlte er das Gebiet, würde seine Suche noch länger dauern.
Ganz allmählich stieg sein Adrenalinspiegel, und Ricardo begab sich mit seiner Ausrüstung zu einer der unteren Luken der Stadt. Ein Mitglied des Expeditions-Corps zeigte ihm anhand eines Monitors, wo die markanten Landmarken bereits in Sicht kamen. Da die Luft über dem Wald gegen Abend zunehmend nebliger wurde, war das Zielgebiet bald nur noch anhand der Geschwindigkeit und Richtung der Stadt zu ermitteln, die sich unbeirrt von Wind und Wetter über die Oberfläche des Planeten bewegte. Ricardo prägte sich die ungefähre Lage und Richtung des Gebiets ein und führte im Geiste die Bewegung des farbigen Quadrats weiter, das der Monitor über die Außenaufnahme projiziert hatte. Dann ging er zur Luke und leitete die Öffnung ein. Rings um die Luke fuhren zunächst seltsam geformte Stäbe und Flächen aus, die den Wind in der Nähe der Luke so verwirbelten, daß er nicht beim Herausspringen von den Luftströmungen um die Stadt erfaßt und gegen ihre Unterseite geschleudert werden konnte. Dann endlich öffnete sich die Luke und Ricardo stand direkt an einem 5000 Meter tiefen Abgrund. Seine Ausrüstung hatte er bereits umgeschnallt. Dann warf er einen letzten Blick auf den Monitor, der inzwischen nur noch schematisch die Lage des Zielgebiets zeigte, da von der Waldfläche in der Dämmerung kaum noch etwas zu erkennen war. Schließlich atmete er noch einmal tief ein, trat einen Schritt nach vorne und ließ sich in die Tiefe fallen.
Nach den ersten tausend Metern öffnete er die kurzen Flügel seines Gleiters und steuerte die ungefähre Position des Zielgebietes aus dem Gedächtnis an. Dreihundert Meter über dem Boden – soweit er das durch den immer dichter werdenden Nebel erkennen konnte – löste er den Fallschirm aus. Zunächst öffnete sich ein kleiner Schirm, dessen Hauptaufgabe es war, den nächst größeren aufzuspannen. Dieser bremste mit einem kräftigen Ruck die Fallgeschwindigkeit deutlich ab und riß den dritten Schirm aus dem Rucksack, der sich in gewissem Umfang lenken ließ. Schließlich sah Ricardo die Baumwipfel unter sich aus dem Nebel auftauchen. Eine Lichtung war nicht in Sicht. So krachte er mit seinem Schirm durch die oberen Äste der Bäume und blieb auf halber Höhe mit dem Schirm in den Ästen hängen. Dann begann er, sich aus dem Fallschirm nach unten abzuseilen, wie er es bereits hunderte Male geübt hatte. Im letzten Moment entschloß er sich, die Nacht doch lieber am Fallschirm hängend zu verbringen und bei Tageslicht zu erkunden, wo er genau heruntergekommen war.
Am nächsten Morgen betrat er zum ersten Mal den Waldboden und war überrascht darüber, daß dieser leicht zu federn schien. Er nahm seine Ausrüstung auf und überprüfte anhand der aufgehenden Sonne seine Position. Da er durch die vielen Bäume keinen direkten Blick auf die Sonne erhielt, schätzte er ihre Position anhand der Schatten in den Baumwipfeln. Mit einem empfindlichen Meßgerät ermittelte er die Richtung, in der sich eine für diese Gegend ungewöhnliche Metall-Anhäufung befinden mußte. Dann befestigte er einen kleinen Sender an einem der Bäume, damit er für seine zukünftige Positionsbestimmung eine Basis hatte. Er war noch keine 300 Meter gelaufen, als er plötzlich eine Stimme hörte:
»Noch einen Schritt und du bist tot!«
Knallkürbisse
Ricardo blieb abrupt stehen und versuchte festzustellen, woher die Stimme gekommen war. Er zeigte seine leeren Hände und drehte sich langsam um.
»Ich komme in Frieden«, sagte er dabei mit einem, wie er hoffte, entwaffnenden Lächeln.
Er erhielt das helle Lachen einer jungen Frau als Antwort.
»Ich bezweifle, daß der Knallkürbis vor dir das wirklich zu schätzen weiß. Wenn du ihn berührst, wird er dich sicher ganz friedfertig in Stücke reißen.«
Ricardo kam sich etwas blöd vor, daß er ihre Warnung als Drohung mißverstanden hatte. Langsam nahm er die Hände wieder herunter. In Ruhe schaute er sich jetzt auch auf dem Boden um. Einen halben Meter vor sich sah er eine dicke, schrumpelige Kugel liegen. Ihre Farbe ging von gelb in braun über und wirkte irgendwie schmuddelig.
»Komm zu uns herüber«, forderte ihn die Frau auf.
Ricardo sah jetzt, daß sie in Begleitung zweier Männer war. Alle drei hatten beigefarbene Hemden und Hosen und weite, dunkelbraune Umhänge an. Während die Männer je einen Speer in der Hand hielten, war die Frau mit einem Bogen bewaffnet. Sie wirkten allerdings nicht sehr kriegerisch.
»Ich bin nicht aus dieser Gegend.«
»Das ist mir auch schon aufgefallen«, sagte die Frau, während sie ihn ganz unverhohlen musterte. »Offensichtlich gibt es dort, wo du herkommst, keine Knallkürbisse. Und seltsam gekleidet bist du auch.«
Damit bezog sie sich wohl vornehmlich auf seine tarnfarbenen Sachen. Wenn sie um die Eigenschaften des Stoffs gewußt hätte, der zwar leicht aber absolut reißfest und schmutzabweisend war, hätte sie das sicher noch mehr überrascht.
Als Ricardo näher kam, fiel ihm auf, daß die drei Waldbewohner eine Hautfarbe hatten, die seiner sehr ähnlich war, ein helles Braun mit olivfarbenem Schimmer. Es war ein seltsames, aber nicht unangenehmes Gefühl für ihn.
»Ist dein Dorf hier in der Nähe?«, wollte die Frau wissen. Offenbar gab sie in der kleinen Gruppe den Ton an.
»Nein. Es ist ziemlich weit weg.« Mit einem dünnen Grinsen dachte Ricardo, daß das wohl die Untertreibung des Jahres war.
»Ich frage mich, wie du es geschafft hast, unbeschadet bis hierher zu kommen, wenn du dich so tolpatschig verhältst.«
Er zog es vor, diese Frage nicht zu beantworten.