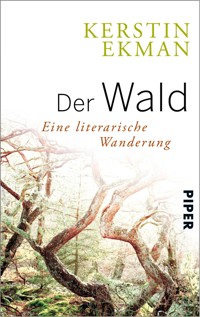5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
'Das Engelhaus' ist das Haus, in dem Tora Otter, dem Leser schon aus 'Hexenringe' und 'Springquelle' bekannt, vom Beginn der dreißiger Jahre an bis in die ersten Nachkriegsjahre wohnt. Tora Otter kämpft inzwischen mit dem Herannahen des Alters. Schwer kann sie sich an den Gedanken gewöhnen, daß ihr Körper, der ihr bisher nur selbstverständliches Arbeitsgerät und Fortbewegungsmittel war, zunehmend schwächer wird. In ihrer schlaflosen Einsamkeit kriecht sie die Angst vor dem Tode an, und sie beginnt, ihr bisheriges Leben kritisch zu überdenken. Tora Otter und das 'Engelhaus' spielen auch für die heranwachsende Ingrid, die Tochter von Toras Freundin, eine große Rolle. Sie träumt bereits in ihrer Jugend von einem Leben frei von den Sorgen des Alltags. Bald aber, als sie schwanger wird, einen Sohn gebärt und das ganz normale Familienleben einer Erwachsenen führt, muß sie feststellen, daß sie nicht die Kraft hatte, ihre Träume wahr werden zu lassen. Auch Jenny Otter, Toras Schwiegertochter, fühlt sich in ihrer Ehe nicht wohl. Schwer liegt auf ihr die ganze Verantwortung für die Versorgung der Familie. Aus Sehnsucht nach dem 'wirklichen Leben' beginnt sie ein Verhältnis mit einem jüdischen Flüchtling aus Ungarn...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Übersetzung aus dem Schwedischen von Hedwig M. Binder
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 1990
ISBN 978-3-492-95758-8
© 1979 Kerstin Ekman First published by Albert Bonniers Förlag AB, Stockholm 1979: Änglahuset Deutschsprachige Ausgabe: © Piper Verlag GmbH München Das Buch erschien erstmals 1990 bei Neuer Malik Verlag, Kiel Umschlaggestaltung: Dorkenwald Design, München Umschlagfoto: Lucian Milasan / Fotolia.com Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Gegenüber der Genossenschaft, an der windigen Ecke der Landsvägsgata und der Industrigata, standen eine Linde und ein altes Holzhaus. Da stand, will man genau sein, auch ein Kiosk. Die Linde und das Haus pflegten sich miteinander zu unterhalten. Zwischen den Worten verging jedoch viel Zeit.
Die großen Häuser haben ihre eigene, langsame Zeitrechnung und vertragen sich mit den Bäumen deshalb relativ gut. An Menschen haben sie dagegen nicht viel Freude. Und aus dem Kiosk schlau zu werden war auch schwierig. Der war nicht dafür gebaut, dort länger als ein paar Jahrzehnte zu stehen, und gehetzt hechelte er alles heraus, was er zu sagen hatte, wie ein Hund oder ein Radioreporter. Leute erschossen sich, stürzten mit Maschinen vom Himmel und verwursteten Pferde. All dem vermochte das Haus nicht zu folgen, und die Linde auch nicht. Der Kiosk war achteckig, bucklig, und seine Nase glich einem Schnabel. Er war grün gestrichen, und das spitze Dach hatte einen Belag aus körniger Teerpappe. Er war leicht reizbar und geschwätzig, keine rechte Gesellschaft für eine Linde und ein verziertes Haus aus dem letzten Jahrhundert.
Das alte Haus selbst fand nicht, daß es sonderlich bedächtig sei, denn es verglich sich gern mit erdverbundenen Steinen. Wie langsam Steine rufen und sprechen, ist ja bekannt. Zuerst muß sich tief in ihrem Inneren eine Verdichtung bilden. Dann folgt ein langsames Heben, und zum Schluß rufen sie, und das geschieht in einer anderen Zeit. Es ist ganz einfach nicht faßbar. Doch rufen tun sie. Selbst im Sockel des alten Hauses, wo die Katzen aus und ein schlichen, riefen die Steine.
Eine Straßenlaterne schien so weit im Innern in der Krone der Linde, daß das Licht auf dem Kioskdach gefleckt wurde. Die Lichtsprenkel bewegten sich zuckend über die schwarze Pappe, deren Teertropfen aufglänzten. Dann wurde es fast eine Stunde lang ruhig, kein Wind bewegte die Blätter, und das Muster blieb unverändert. Das alte Haus räusperte sich, und schließlich sprach es. Das war am Samstagabend. Am Montag spät morgens, nachdem viele Lichtsprenkel, Kelchblätter und Wogen feuchter Nebel über das Kioskdach hinweggetanzt waren, war der Satz vollendet.
Im Inneren der Linde heulte es vielleicht vor Ungeduld. Unter der Erde aber waren ihre Wurzeln um den Steinsockel des Hauses geschlungen, so, wie die Wurzeln eines kräftigen Bakkenzahnes einen Kieferknochen umfangen, weshalb sie aus guten Gründen glaubte, daß sie zusammen stehen oder fallen würden, am liebsten natürlich stehen, und zwar für ewige Zeiten. Deshalb beherrschte sie sich und antwortete, ehe die letzten kalten Nächte des Spätsommers zur Neige gegangen waren.
Die Linde schüttelte sich in einem Windhauch und ließ einen Regen hellgrüner Blüten auf das Kioskdach niedergehen. Das alte Haus fürchtete dieses Geräusch, glaubte, daß es sich um einen Blutsturz handelte. Das kannte es nämlich. Nicht alle Zeiten eigneten sich gleichermaßen für ein Gespräch. Im Hochwinter, wenn die Linde scheinbar ruhte, gingen in den Knospen und Blütenanlagen so bedeutungsvolle Dinge vor sich, daß die Linde nicht zu antworten vermochte. Und der Knospenaustrieb war eine verzwickte Arbeit, die damit begann, daß der Saft in den haarfeinen Gefäßen stieg und alles, was wächsern und trocken gewesen war, anschwellen und sich aufrichten ließ. Tat das weh? Eigentlich nicht. Aber es war ungeheuer mühevoll, und sie mußte konzentriert sein, wenn sie assimilierte. Es war sehr ungeschickt von dem Haus, gerade diesen Moment zu wählen, um mit einer Ausführung zu beginnen, die in der ersten Juliwoche beendet war, als der Sommerwind in der Krone der Linde großes, grünes Laub bewegte.
Die Linde war lebendes Holz. Das Haus war ebenfalls Holz und nicht wirklich tot. Nein, man kann vom Holz nicht behaupten, daß es so leicht stirbt; es macht Wandlungen durch. Auch das Haus reckte sich noch, schwoll an, ächzte in der Kälte der Winternächte, zog sich zusammen und schuf Risse, durch die Wanzen und Silberfische schlüpften.
Das Haus war ja vor allem eine Wohnstätte oder eine Anhäufung von Wohnungen, Bauen und Höhlen. Es barg viele Bewußtheiten in sich, mehrere Gesellschaften, zufällige und aufgezwungene Gemeinschaften und tiefe Zusammengehörigkeit: Die Katzen schlichen beim Steinsockel aus und ein, und in den Hausfluren schlabberten sie so stürmisch Milch, daß die angeschlagenen Untertassen gegen den Fußboden klapperten. Außer Katzen gab es Feldspatzen, Menschen, Hausspatzen und Läuse, Kakerlaken, Ratten und kleine Mäuse, Hunde und ihre Flöhe, Spinnen, Fliegen, Ameisen, Springwürmer, Mehlkäfer, Spinnmilben und Nachtfalter und Blattläuse auf den Balsaminen: Hausböcke knabberten sich in das Fleisch des Hauses, und unter den Balken auf dem Dachboden hingen in langen Reihen Fledermäuse, hingen mit den Köpfen nach unten, ihre kleinen, mit Klauen versehenen Hände fest geschlossen.
Die Linde beherbergte nur Zufallsgäste, denn sie war ein Fremdling an der Straßenecke. Ihre Besucher kamen als Sendboten mit anderen Gerüchen als denen der Landsvägsgata und der holprigen Industrigata, die bei der Gießerei begann und in einer Emballagefabrik endete. Die Linde stand ja an einer graubraunen, gepflasterten, duftlosen Kreuzung, die an allen Ecken vor Trostlosigkeit heulte. Sie trug eine Mütze aus wattigem Himmel, und rings um sie herum ragten Kulissen aus Undurchdringlichkeit, aus Beton, aus behauenem Stein und Maschendraht, Putz. Schilfrohr, Ziegel und arsenikgetränktem Holz auf. Sie versuchte, die Winde einzufangen, es stieg ihr jedoch ein Geruch von Müll zwischen die Äste, süß und dumpf, und von verbrannten Gummireifen, von Öl, Kellermief und Mundgeruch, von alten Schuhen und vom Humus des Kirchhofs, wo man eben erst ein Grab ausgehoben hatte. Sie konnte aber auch, wenn die Windrichtung günstig war, einen Duft von Reseda erhaschen.
Der Morgen brach zuweilen mit dem Dunst frisch gewässerter Mistbeete an, der guten Kohlensäuredüngung, die der Linde mit einem launischen Windstoß zu Nutzen und Nahrung werden konnte. Sie wurde von Hummeln mit fremdem Staub an den runden, pelzigen Körpern gestreift: Blütenstaub von Glaskirschen, Graf Moltke und Säfstaholm. Unterdes konnte man das steife Rascheln der einzigen Blutbuche in der Stadt belauschen und das Knacken, wenn die Roßkastanien unterhalb der Landsvägsbrücke ihre stachligen Kugeln öffneten und feuchte, braune Nüsse, die niemand berührt und niemand gesehen hatte, herabfallen ließen. Manchmal wurde sie von einem Wind geschüttelt, der vielen Anemonen die Kronblätter entrissen hatte.
Als das Haus gebaut worden war, hatte es eine prächtige Fassade. Da waren Fahnenstangen auf dem Dachfirst und zwei Vortreppen an der Längsseite zur Industrigata hin, Wetterfahnen mit Jahreszahl, kunstvoll wie Schuppen gelegte Holzschindeln an den Giebeln und verzierte Geländer an den Vortreppen. Es hatte komplizierte Spenglerarbeiten und viele Schornsteine. Zur Einweihung wurde die Linde gepflanzt, und die Festreden knatterten wie Wimpel in starkem Wind.
Es war jedoch ein schlechter Bau, ein Bau mit eingebautem Ungeziefer. Man hatte für die Ausstattung einiger Küchen und Wohnküchen Abbruchholz hergenommen. Es war fußkalt und zog in den Ecken, denn es gab keine richtigen Zwischenböden. Die Füllung in den Wänden rutschte mit der Zeit nach unten, und die Kinder konnten nicht daneben schlafen, denn da bekamen sie Ohrzwang. Aber trotzdem war das hier kein elendes Armenquartier, nein, weit davon entfernt! Hier wohnten die ordentlichen der Arbeiter der Schreinereifabrik, wie es die Redner bei der Einweihung mit den unbearbeitetsten Worten der Sprache, wie Rechtschaffenheit und Ehre und guter Arbeitswille ohne Klassenegoismus, ausgeschmückt und garniert hatten. Sie waren Petrus Wilhelmsons Augensterne und, soweit er das kontrollieren konnte, völlig abstinent. In den Vorratsschränken auf den Fluren mangelte es hier nicht an Essen. Man hielt zusammen Schweine und verfügte über Kartoffeläcker und gute Stuben, diese heiligen, ergreifenden guten Stuben mit ihrem Duft nach Mottenkugeln und schrumpligen Äpfeln in einer Schale, wo sich die Porzellanblume im Dunkeln und Kühlen wand und die Kerzen unangezündet dastanden, bis der Sommer kam und sie sich in der Hitze krümmten. Ja, diese guten Stuben waren eine Versicherung dafür, daß der Kern des Daseins Seligkeit und Feinheit, nicht Knitter und Qualm und blutende Wunden ist.
Das Haus, das nie eine Jugend gehabt hatte, sondern im schilferigen Mannesalter in die Welt und an die Straßenkreuzung hinausgeschmettert worden war, verfiel bald. Es hustete Rauch und ächzte und wimmerte in den Herbststürmen. Dachluken wurden losgerissen, und der Holzschuppen bekam Rachitis.
Doch genau so sollte es sein, denn nun verrottete das alte Schweden hinter seinen Verzierungen und Fassaden. Nun kamen Männer mit steifen Hüten heraus, die schiefen Türen knallten zu. Frisch und beherzt ging es her. Die Welt sollte völlig neu werden. Es roch nicht nach Branntwein, sondern nach Hektografentinte. Der alte Egoismus und Individualismus wurde mit Füßen getreten, daß es krachte und rumste, und er blieb liegen, ein Bündel in einer Ecke (aber ein Bündel, das sich regte), und die Streikbrecher bezogen Prügel.
In den Flurschränken mit den in die Tür gebohrten Luftlöchern aber war nichts mehr zu essen. und die Kinder hatten Magenschmerzen vor Hunger. Die Männer mußten an die Arbeit zurückkehren.
Dann kam der Krieg, und hinterher gab es kaum Arbeit und Wohnungen, weswegen man froh sein müsse, wenn man ein Dach über dem Kopf habe, sagte David Eriksson, der damals dorthin zog. Er war in Stockholm gewesen und hatte sich nach Arbeit umgesehen, und dort wohnten die Leute sogar in der Turnhalle der Polizei in Verschlägen. Da hatten sie Räume aus zusammengenagelten Brettern, Uhr und Öldruck an der Wand, und im Korridor zwischen den Boxen knäuelten sich die Kinder. »Das war was andres«, sagte David Eriksson, der sich draußen in der Welt umgesehen hatte. »Hier ist die reinste Idylle«, sagte er, und da knallten die Türen, und zwischen den Wohnungen dröhnte es im Ofentelegrafen.
Das Haus gehörte nicht mehr Petrus Wilhelmsson; der war jetzt tot. Es gehörte nicht einmal mehr Wilhelmssons Schreinereien. sondern war im Besitz eines gottesfürchtigen Baumeisters, der gelernt hatte, daß alles eitel sei, weshalb er nichts reparierte. Er wartete freilich nicht auf den Jüngsten Tag, sondern auf bessere Zeiten, in denen das Bauland hier gegenüber der Genossenschaft im Wert steigen würde. Dann sollte das Haus abgerissen werden.
Der Dachboden war jetzt nicht mehr dichter als ein Spreukorb aus Spänen, und wenn die Frauen Wäsche aufhängten, pfiff es da oben wie in kaputten Lungen. Die Kaminrohre waren verstopft, die Eulen hatten eine Vorliebe für sie entwickelt.
Die Menschen seien aber auch von anderer Art, sagte man, als Petrus Wilhelmssons überwiegend nüchterne und ordentliche Arbeiter. Es gäbe Menschen, die herunterkämen, sagte man auch, so daß sie wohl die Ansteckung mit Tbc suchten (David Eriksson war jetzt rezesiert) und Arbeit scheuten und in den AK-Baracken* Fusel tranken, um Bauchspeicheldrüsenentzündung zu bekommen. Um die schloß sich das Haus und um ihre Überzeugung, daß sie von anderer Art seien, einer besonders bitteren und verdorbenen Art, die die Gesellschaft im Mund gehabt, dann aber ausgespuckt hatte.
Das Haus, das jetzt in seinem allzu zeitigen Alter so lange Weilen schlief, daß manchmal Jahre darüber vergingen, bemerkte die Veränderungen nicht, wußte nichts von den verwahrlosten guten Stuben in seinem Inneren, von Maischetöpfen und Abfallpaketen auf dem Dachboden.
Kreuger erschoß sich, und der Kiosk fuchtelte mit dem Ereignis herum, er rappelte acht Wochen lang mit klapperndem Laden dieselbe Neuigkeit, doch weder die Linde noch das Haus schienen es zu hören. Ja, das Geratsche und Getratsche und Gehuste der Menschen ging weiter, das war ganz offensichtlich, und das Haus schlief wieder ein.
Zwischen den neuen, stolzen Gebäuden mit verputzten Wänden lag nun, gestrandet am Rand des Trottoirs, dieses alte Wrack mit seinen buckligen Schuppen und wackligen Verschlägen im Hof. Es hustete nach wie vor Rauch, allerdings in dünnen Streifen, denn jetzt wurden zertrümmerte Kisten verfeuert. Etliche seiner Fensteraugen waren ausgedrückt und die Öffnungen mit einem Stück Pappe abgedichtet, andere waren trüb vor Staub und Spinnweben, die von Essensdünsten zottig herabhingen. Sie schielten mit blasigem Glas und Blindhäuten aus grauem Staub, diese Fenster mit steifen Gardinen, wo eine Pilsnerflasche ein halbes Jahr neben einem Glas mit Immortellen stehen konnte, ohne von der Stelle gerückt zu werden.
Die Linde wisperte vom Wald, und das machte auf das alte Haus Eindruck. Sie hatte ein Bewußtsein vom Wald, obschon sie auf Anordnung eines Großhändlers an diese Straßenecke gepflanzt war. Allen Bäumen ist dies gleichsam in den Samen geprägt. Da ist nicht nur das kleine Bild des ganzen Baumes, seiner Ausdehnung zwischen Himmel und Erde, der beiden Kronen, derjenigen, die nach dem Licht und der Kohlensäure der Luft strebt, und der anderen, die die Feuchtigkeit und die Salze sucht, sondern ebenso die Vorstellung vom niemals endenden Wald.
So ist das natürlich mit allem, was lebt. Menschen stellen sich vor, daß es immer Menschen geben wird, auch weit jenseits der nächsten Sterne. Eine Wanze will eine Million Wanzen sein, und ein Baum will ein Wald ohne Ende werden. Der Wald der Linde war der, der nach dem großen Eis mit Ulmen und Linden und Eichen und Haseln gekommen war, mit spielendem Laub, mit Geziefer, Gesumm und Honigduft, mit funkelnden Augen unten in dem wohlriechenden würzigen Gewirr, das am Boden raschelte, mit nordischer Nachtigall und Kuckuck und einem kleinen, verrückten Schmetterling, der still und berauscht zwischen honigfeuchten Fruchthüllen umherflatterte.
Das Haus hatte keine Vorstellung von einer niemals endenden Stadt. Es wollte sich dem Wald ergeben. Doch das war schwierig. Eine Scheune, sogar eine alte Soldatenkate, kann sich ihm ergeben. Sie kann einstürzen und die Stämme, die im Wald gefällt und behauen und mit Moos abgedichtet worden waren, vermodern und zu Wurzelstöcken von Preiselbeeren werden lassen. Es knackt und winselt in solch alten, silbergrauen Häusern, wo nicht einmal mehr Tapetenfetzen an den Wänden kleben. Sie fallen langsam ein und werden fortgetragen, sie sinken tief hinab ins Grün.
Doch von hier an der Ecke der Landsvägsgata und der Industrigata war es ziemlich weit bis zum Wald. Hier war die Stadt mit ihrem kiesigen Marktplatz, ihren ausgefahrenen Straßen und Schächten voller Gesteinsschutt, mit den Blechdächern, die in der Morgensonne von der Feuchtigkeit der Nacht dampften, ihrer Kirche mit spitzem Turm, ihren geheimen Höhlen und Löchern, Pferden, Schatten und steilen Giebeln, schiefen Bretterzäunen, Schildern, die quietschend an rostigen Eisen schwangen, ihren letzten nach Ratten stinkenden Winkeln, Überlandbussen, auf denen der Lehm zu einer Haut aus Staub getrocknet war, Bahngleisen, Bretterstapeln, Bauten, Tonnenhäuschen, hohen Schloten über der Gießerei und dem Sägewerk, den Wagen auf dem Bahnhof, die immer und immer wieder gegeneinanderstießen, ja, diesen Geräuschen von Eisen gegen Eisen, Eisen gegen Stein und Eisen in Holz, das die klagenden Fasern verdrehte und splitterte. Es gab keinen Weg zurück.
Drei Leute kamen eines Nachmittags im Spätwinter 1931 die Magasinsgata entlanggegangen. Der Schneeregen gefror zu Eis und knirschte wie die Dragees, die Tora Otter zu kochen pflegte. Es zeigte sich ihnen nichts Erschreckendes auf dieser festgetrampelten Magasinsgata: keine klaffende Wunde, keine geheime Senkung in der Erde, nicht einmal ein totes Tier. Im Schaufenster der Sparkasse stand nur ein Schild mit den Worten:
DAS GLÜCK DES HEIMS GRÜNDET AUF EINER GEORDNETEN ÖKONOMIE
Sie sahen jedoch nicht auf, als sie daran vorbeigingen. Vornweg ging Tora mit ihrem Sohn Fredrik, der Galoschen und einen eleganten Paletot, der fast 70Kronen gekostet hatte, trug. Jenny, die Schwiegertochter, blieb etwas zurück, sie sah verdrießlich drein. Hin und wieder besann sich Fredrik und blieb stehen, um auf sie zu warten. Sie sah recht niedlich aus in ihrem schwarzen Mantel mit Pelzkragen und dem kleinen Hut, den sie auf der einen Seite weit heruntergezogen hatte. Eine Reiherfeder steckte daran, eine ganz kleine nur, an der das Schneewetter zauste. Toras Ansicht nach trug sie viel zu dünne Strümpfe.
Toras Fesseln wirkten in der braunen Wolle stämmig. Sie hatte keinen Hang zur Koketterie. Es war jedoch deutlich, daß die Geschäfte auf dem Markt gutgingen, denn der Mantel war aus gutem schwarzen Tuch, und Kragen und Mütze waren mit Pelz besetzt. Doch sie war müde. Zu Weihnachten erzielte sie einen großen Teil ihres Einkommens, und früher war sie bis in den Januar hinein ein paar Wochen müde gewesen. Nunmehr wollte die Müdigkeit kein Ende nehmen, obwohl es schon März war.
Sie kannte so gut wie jeden Menschen, dem sie begegneten, sagte ständig »Grüß dich!« und nickte. Dort kam ein Laufbursche mit seinem großen Fahrrad. Bei diesem Straßenzustand war Radfahren schier unmöglich, aber er tat es trotzdem. Er kam vom Käse- und Wildhändler und hatte die Kiste vorn schwer mit reifem Käse, Geflügel und Orangen beladen.
Tora hatte Schweinsfüße eingekocht, die sie mit Roten Beten essen würden, wenn sie nach Hause kämen. Sie beneidete die jenigen, die Geflügel aßen, nicht, nein, wahrlich nicht, und man merkte das fast ihrem Rücken an. Jenny wurde plötzlich noch wütender, ihr fiel ihre eigene Mutter ein, Stella Lans, die auch allein war. Die hatte allerdings einen Versorger gehabt. Jetzt war sie nur noch ein verirrter Vogel auf leeren herbstlichen Feldern, nachdem die Scharen weitergezogen waren. Bald würde sie erfrieren oder der Habicht sie holen.
Es war kein Markttag, da wäre Tora hier nicht unterwegs gewesen. Der große Marktplatz war leer, abgesehen von ein paar Leuten, die, den Wind im Rücken, diagonal über ihn strebten. Auf der Storgata war dagegen ziemlich viel los. »Grüß dich, du, grüß dich!« Jenny sah ihr Spiegelbild in einem Schaufenster, aber es war nicht ganz so, wie sie es sich gedacht hatte. Ihr schoß der Gedanke durch den Kopf, daß sie irgendwo anders sein wollte. Sie wollte irgendwo gehen, wo niemand sie kannte, durch große Straßen, wo gleichgültige Gesichter wie Laub auf dem Wasser dahinströmten. Sie packte Fredriks Arm, als fürchtete sie, erhört zu werden. Im Augenblick ging sie hier, der Mantelkragen konnte ihr Gesicht nicht verbergen. »Ist das nicht Fredrik Otters Frau, die Tochter des Sattlers Lans in Åsen? Lebt die Mutter noch?« »Aber ja, obwohl sie ein paar Gehirnblutungen hinter sich hat.« »Haben sie noch nichts Kleines?« »Nein, es sieht nicht so aus, als würde das etwas werden. Verwandt sind sie, vielleicht liegt es daran.«
Deren Augen hatten sich an ihr festgesogen und wanderten langsam über ihren Körper bis hinein in ihren verborgenen Raum mit seiner Leere. Und Fredrik trabte weiter. Ging er nicht ein wenig über den großen Onkel?
Er wollte Schuhe kaufen. Doch das hier entsprach eigentlich nicht seiner Vorstellung davon, wie man sich ein paar Schuhe kaufen geht. Er wäre natürlich lieber allein gegangen, nonchalant oder doch zumindest lässig ins Geschäft geschlendert, als wäre ihm eben eingefallen, daß er vielleicht ein Paar neue Schuhe brauchte. Nicht so, wie sie sich jetzt hineinverfügten, er und die Mama und die Ehefrau, in Wolle eingemummelt und den Matsch von den Überschuhen stampfend, ehe sie hineingingen. – »Grüß dich«, sagte Tora zu Schuhhändler Ölander, als sie unter der bimmelnden Glocke eintraten, und er grüßte umständlich zurück. Außer dem Inhaber war in dem Geschäft kein Mensch, und es roch vornehm nach Leder und ein wenig nach Alkohol. Im Schaufenster stand ein Paar helle, cremefarbene Damenschuhe mit kleinen Knoten an den Schnürsenkeln. Außerdem waren da Damenhausschuhe aus imitiertem Schlangenleder und Bottinen mit umgeschlagenen und mit Samt eingefaßten Schäften.
EIN GUTSITZENDER SCHUH STEIGERT DAS BEHAGEN AN DER PROMENADE
stand auf einem Schild, und Tora sah dieses Schild und wurde böse, weswegen, wußte sie nicht. Sie wurde böse auf Ölander, und das hatte etwas mit Schuhen zu tun. Jenny las das Schild und meinte, daß Ölander sie durchschauen müsse oder genauer gesagt, ihre Überschuhe.
Tora sah sich wütend um. Solche Schilder mit Bildern ondulierter Damen mit kleinen roten Mündern und staunend hochgezogenen, fadendünn gezupften Augenbrauen und geraden Nasen mochte sie nicht. Ihr Blick fiel auf Jenny, die dastand und sich spiegelte, unbemerkt, wie sie glaubte. Wahrscheinlich versuchte sie wie Clara Bow auszusehen mit ihren wuscheligen Haaren und dem kleinen, tief in den Pelzkragen aus Kanin gedrückten Kopf. Tora knöpfte den Mantel auf und nahm ihr Halstuch ab, das vorn auf der Brust über Kreuz gelegt war. Jenny wandte sich ab. Dann stellte Tora, demonstrativ, wie Fredrik fand, ihre Handtasche auf die Theke. Es war eine schwarze, glänzende Ledertasche, an den Ecken etwas abgestoßen. An der pflegte sie festzuhalten, zeitweilig war sie wohl die Sicherheit der ganzen Familie gewesen. Der schwarze Riemen war geflickt und das Nickel auf dem Metallbügel abgeblättert, so daß sichtbar wurde, daß er aus Messing war.
Fredrik sagte nun rasch, daß er sich gern ein Paar Schuhe ansehen wolle. Ölander wandte sich jedoch an Tora und fragte, ob es Stiefel oder Halbschuhe sein sollten, und Jenny wurde rot vor Verdruß. Er mußte nun seiner Mutter ins Wort fallen:
»Halbschuhe natürlich!«
»Natürlich« sagte Tora. Darüber hätten sie reden sollen, bevor sie losgingen, doch er war ein Dickschädel.
»Ja, Halbschuhe.«
»Aber das ist doch wohl nichts für dieses Wetter.«
Jenny drückte den Kopf in den Kaninkragen und dachte: »Wenn der Stiefel kauft, dann sterbe ich schlicht. Stiefel mit Schaft und langen Schlaufen.« Sie hatte nicht übel Lust, ihn beiseite zu nehmen und ihm zuzuflüstern: »Wenn du dir so was kaufst, sterbe ich.« Doch er war Gott sei Dank unerschütterlich. Das Ärgerliche, das Gräßliche war nur, daß der Schuhhändler dennoch keine Halbschuhe holte. Erst nachdem Tora heftig durch die Nase schnaubend nachgegeben hatte, ging Ölander, der die ganze Zeit über mit schräggehaltenem Kopf dagestanden und zugehört hatte, zur Treppenleiter, stieg hinauf und holte einen Karton aus dem Regal herunter. Er öffnete den Deckel, schlug das Seidenpapier auf und sagte:
»Hier habe ich eine ausgezeichnete Ware, eine wirklich gute Arbeit.«
Es war ein Paar stumpfe, solide Schuhe, schwarz und neu und glänzend. Er zog den kleinen Schemel mit dem Spiegel hervor, und Fredrik stellte den Fuß auf die schräge Stütze. Dann setzte sich der Schuhhändler auf den Schemel und bediente ihn.
Fredrik hatte leider nicht ebenso schöne Füße, wie sie sein Vater gehabt hatte, dieser Gedanke huschte Tora durch den Kopf, als er den Schuh aufgeschnürt und ausgezogen hatte. Was immer das nun bedeuten mochte: Im Verhältnis zu seiner Größe waren sie kurz und breit. Sie hatte ihren Jungen jedoch stets gute Schuhe gegeben. etwas anderes ließ sich nicht sagen. Die Zehen waren nicht allzu krumm, und am Gelenk der großen Zehe hatten sich keine Knoten gebildet. Genau wie Jenny hatte er jedoch Frostbeulen an den Fersen. Viele hatten während des Krieges Frostbeulen bekommen. Jenny hatte sich ihre in Stockholm geholt, als sie nach Kartoffeln anstand. Sie war bei einem Doktor in der Fleminggata Kindermädchen gewesen, doch der war nur Lehrer in einer Oberschule und kein richtiger Doktor, weshalb er ihr mit den Frostbeulen nicht hatte helfen können.
Bei dieser Witterung waren Fredriks Fersen leuchtend rot und angeschwollen. Noch ein paar Grad Kälte mehr und sie würden ziehen wie entzündete Zähne.
Nun probierte er die schwarzen an. Es war ein solides Paar Schuhe, mit denen wer weiß wer zufrieden sein konnte. Es verstand sich von selbst, daß er mehrere anprobieren würde. Ölander hatte bereits mehrere Kartons heruntergeholt und sie neben dem Schemel gestapelt. Die Schuhe waren jedoch alle ungefähr gleich, schwarz und vorn stumpf. Es ging nun vor allem um die Perforierung oder darum, wie hoch die Hinterkappe sein sollte. War der Leisten breit genug?
Ihnen war allen vieren, ohne es auszusprechen, klar, daß diese schwarzen Schuhe mit recht kräftigen Sohlen Fredriks Stellung in der Welt und in der Stadt als Reisemonteur bei Svenska Motor und noch nicht arbeitslos entsprachen. Tora war es, die fragte, was sie kosteten.
»Zwölf fünfzig«, antwortete Ölander, und sie erwiderte brüsk, daß das nicht gerade billig sei, jetzt, da sie nur drei Tage in der Woche arbeiteten. Sie sagte das möglicherweise, um zu unterstreichen, daß hier ihr Sohn saß, eins neunzig groß und vierundachtzig Kilo schwer, und daß er seine Schuhe selbst bezahlen würde. Falls da irgend jemand etwas anderes angenommen haben sollte. Jenny wurde flammendrot und spürte, wie sich aus einem plötzlichen Haß gegen sie ihr Zwerchfell krampfte.
»Wie fühlt sich die Hinterkappe an? Stell dich hin. Du mußt schon ein bißchen rumlaufen. Das macht dem Teppich hier doch wohl nichts?«
Jetzt kam auch der zweite Schuh hinzu, und Fredrik machte auch seinen linken Fuß frei. Da kam zutage, was Tora eine Morchel nannte. Es war eine von Jennys grauenhaften Strumpfstopfereien. Unglücklich und verlegen merkte sie, daß Tora sie sah. Einzig der Schuhhändler schwebte in seiner leichten Wolke von Alkohol ein wenig über dem Ganzen, und es schien nicht, als merkte er etwas. Fredrik ging mit beiden Schuhen an den Füßen auf dem grauen Teppich hin und her, und sie waren sich einig, daß dies ein Schuhwerk für einen Mann wie ihn war. Nur Ölander faßte irgend etwas anderes auf. Er kreiste um diesen noch nicht dreißigjährigen Jungen und schien seinen Duft einzuatmen, das Aroma und die Eigenart seines Wesens zu prüfen. Und mit Sicherheit erfaßte er da gar nichts, einen schwachen Ton allenfalls, eine gewisse Färbung.
Nun kletterte er ganz weit hinauf. Er stellte sich auf die Zehen und zog einen Karton herunter. Der war hellbraun, und als er den Deckel abnahm und das Seidenpapier aufschlug, war das dick und doppelt gelegt.
»Hier«, sagte er. »Hier haben wir etwas.«
Er stellte einen Schuh auf den Schemel. Der Schuh war weinrot und schmal, hatte eine Rahmennaht und keine Perforierung. Er hatte ganz dünne Sohlen und eine schöne Leiste, die den Fuß schmal aussehen ließ.
»Bordeauxfarbenes Chevreau«, sagte Ölander. Er ließ Fredriks Gesicht nicht aus den Augen.
»Rot kann man doch nicht zum schwarzen Anzug tragen«, meinte Tora.
Fredrik schwieg, und der Teufel von Schuhhändler schwieg. Der Schuh schien. schon wie er da auf dem Schemel stand, auf eine wunderliche Weise zu Fredrik zu gehören. Er hatte in dem Karton gelegen und war mit seinen Vorstellungen von Leben angefüllt worden. Es waren solcherart Schuhe, die viele ziemlich lästige Dinge zu nichtigen Begebenheiten machten. Man bildete sich ein, daß man in Verwandlung auf Verwandlung aus seinem Leben wie aus knitterigen Puppenhüllen heraussteigen könnte.
»Probieren Sie ihn an!« sagte Ölander.
Das tat er. Dann stand er auf und stellte sich hin und wandelte auf dem weichen Teppich die paar Schritte zu dem großen Wandspiegel. Ein Fuß steckte in einem höchst alltäglichen schwarzen Schuh, der ein wenig abgetragen und rissig war. Aber ordentlich geputzt. Der andere in bordeauxrotem Chevreau. Er bewegte sich steifbeinig.
»Treten Sie mit dem ganzen Fuß auf!« forderte ihn der Schuhhändler auf. »Prüfen Sie nur richtig! Na?«
Um keine großen Spuren auf dem hellen Teppich zu hinterlassen, hatte er, als er hereinkam, die Galoschen ausgezogen, und nun lagen sie dort und gafften ihn an.
Jenny war etwas beklommen zumute. Sie betrachtete die Sachen, die in dieser nach Leder duftenden Welt um sie herum waren. Ein langer Schuhlöffel aus Schildpatt mit Seidenquaste. Jesses, wie elegant hier alles war! Warum gingen sie hierher? Nun ja, Tora kannte Ölander natürlich. Sie kannte Gott und die Welt. Bald dreißig Jahre stand sie schon da draußen und verkaufte Bonbons.
Warum wurde sie nicht alt? Jenny ließ den Schildpattschuhlöffel kreiseln, hielt ihn an der langen Seidenquaste. Tora war bald vierundfünfzig und hatte immer gleich ausgesehen, fand Jenny, der manchmal durch den Kopf ging, daß ihre und Fredriks Ehe nicht ganz wirklich sei. Sie war eine Art Spiel, wie Kinder es treiben. Wenn sie bei Tora schliefen, trauten sie einander nicht zu berühren. Jedenfalls traute Fredrik sich nicht, das hatte sie gemerkt.
Jenny war der Ansicht, daß sie zweierlei tun sollten: Kinder kriegen und von der Stadt wegziehen. Man zog heutzutage aber nirgendwohin. Man hielt an dem, was man hatte, fest, und wenn es auch nur drei Tage in der Woche bei Svenska Motor waren. Es gebe zwanzig Millionen Arbeitslose auf der Welt, sagte Fredrik. Deshalb blieben sie hier, und jede Woche aßen sie sonntags zusammen mit Jennys Mutter bei Tora zu Mittag. Da war Tora jedoch recht sanft und nachgiebig. Sie war müde vom Verkaufen auf dem Markt. Am Montag und Dienstag erwachten ihre Lebensgeister wieder, und bis zum Freitag war sie wieder die alte.
Jetzt war er eine Weile mit den weinroten Schuhen auf dem weichen Teppich umherspaziert und zu einer Stellungnahme gelangt. Er drückte sie so aus: »Das ist etwas ganz anderes.«
Und der Schuhhändler bekräftigte es, es war etwas ganz anderes. Da fragte Tora, was sie kosteten.
»Zweiundzwanzig fünfzig.«
Lächerlich. Sie sagte es nicht, aber man sah ihr an, was sie dachte. Sie sah stolz und böse und zugeknöpft drein. Jenny wurde so nervös, daß sie sich umdrehte und so tat, als studierte sie den Apparat, mit dem man die Leistenweite maß.
»Jaja«, meinte Tora. »Wenn Adam in solchen Schuhen daherkäme, würde mich das nicht wundern. Wo der Kaffee vier Kronen das Pfund kostet und das Fleisch zwei.«
Jenny fand das peinlich, doch Fredrik mußte schmunzeln. Er dachte an seinen Bruder, der Bertil Franzon zum Kinobesitzerkongreß nach Stockholm hatte begleiten dürfen. Er hatte dessen Chrysler Six gefahren. Den Kongreß richtete Aga-Baltic aus, um Tonfilmapparate vorzustellen, und dorthin hatte sich Franzon, mit Pelz auf dem Mantel, hellgrauen Gamaschen, Borsalino und Stock begeben. Adam war fast genauso elegant gewesen.
»Es ist wirklich recht wichtig, daß man tadellose Füße hat«, sagte Fredrik zu seiner Mutter.
Das wußte sie wohl. Doch sie schwieg. Jenny war nach wie vor so nervös, daß sie durch den Raum irrte und den Kalender, die Hausschuhe im Schaufenster und die niedlichen Miniaturschuhe aus Goldleder studierte. Da kamen plötzlich mehr Kunden herein, traten den Schnee von den Schuhen und grüßten nach rechts und links. Sie mußten sich beeilen. Mutter und Sohn sahen einander an.
»Nimm sie!« sagte sie.
Was war das? Sie wußte es nicht. War es vielleicht die Erinnerung an ein Paar unerhört schöne Füße in eleganten Schuhen aus Göteborg? Oder merkte sie, daß sie ohnehin besiegt war, daß sie jetzt schlichtweg besiegt sein mußte, daß Fredrik, einsneunzig groß und vierundachtzig Kilo schwer, ein Wesen und eine Art von Empfindsamkeit zu eigen waren, an die sie nicht heranreichte?
Im übrigen wußte sie ja, daß ein Paar Schuhe ein Paar Schuhe war. Man aß es nicht auf wie Fleisch. Es wurde nicht wertlos wie Aktien und Obligationen. Sie liebte feste Werte, und darin glich sie Bertil Franzon, der beizeiten sein Haus bestellt und die Geschäfte mit Papieren aufgegeben hatte.
»Nimm sie!« sagte sie. »Nimm sie schon!«
Sie wußten alle, daß er sie sich nicht leisten konnte. Nicht, daß Tora ihn damit kompromittierte, daß sie ihm, noch während sie im Geschäft waren, angeboten hätte, den Differenzbetrag zu bezahlen. Doch ihre schwere schwarze Handtasche stand dort auf der Theke. Sie war in sich zusammengesunken.
Was hätte sie tun sollen? Hätte sie zum Kauf dieser Schuhe nein gesagt, wäre es genauso schlimm gewesen. Das einzig Gute war, daß Fredrik mit den Schuhen in einer eigenen Welt, in der es nach feinem Leder duftete und Seidenpapier raschelte, allein war.
»Ja, pack sie schon ein, dann gehen wir«, sagte Tora. Sie verstand, daß sie wahrscheinlich zum letzten Mal dabei war, wenn er etwas kaufte.
Wieder auf der Straße, ging sie vor ihnen her. »Ist Mutti nicht ein bißchen schief?« fragte sich Fredrik, als er mit Jenny Arm in Arm hinter ihr herging. Eine schiefe Hüfte? Er war sich nicht sicher. Es war glatt und beschwerlich. Vielleicht ging sie nur deshalb so schlecht. Es war ihm bisher nie aufgefallen.
Ingrid näherte der Bandsäge einen Dosendeckel mit zackigen Kanten, um ihn zurechtzuschneiden. Sie fürchtete sich ein wenig vor dem schmalen, flattrigen Blatt und dem Geheul beim Schneiden. Um sieben Uhr morgens ertrug sie überdies das Geräusch der Pressen, die neue Dosen formten, nur schwer. In einiger Entfernung in dem Saal schliff Maud an den großen Sandpapierklötzen einer Schleifmaschine Deckel. Es stob und zischte.
Das Leben spielte sich an drei Stellen ab. Hier an der Bandsäge natürlich. Da war es wohl am wirklichsten oder sollte es zumindest sein. Vor den Fenstern waren der Duft nach Tannennadeln in der aufgehenden Sonne, der Geruch nach Holz vom Sägewerk her, die Insekten, das Glitzern auf dem Laub. Wenn von da draußen ein Lüftchen hereinwehte, glaubte sie den Kiesweg unter den Füßen spüren zu können. In ihrem Kopf setzte sich der Roman fort, schändlicherweise. »Der Ball ging ohne irgendwelche störenden Unterbrechungen weiter«, hatte sie kichernd in »Verheiratet oder ledig« gelesen, das einem Woche um Woche, durch Krisen und Konkurse hindurch, auf der letzten Seite der Zeitung begegnete.
Ihre eigenen Geschichten waren aber nicht viel besser. Mehrere Male hatte sie sich schon verletzt, weil sie mit ihren Gedanken weit weg gewesen war. Sie wußte, daß sie damit aufhören sollte. Es machte aber so viel Spaß. Es spielte doch auch keine Rolle. Niemand wußte etwas davon. Ob wohl Maud an ihrer Schleifmaschine manchmal zwinkerte, als ob sie etwas wüßte. Es staubte und sirrte, so daß es meist schwierig war, ihr Gesicht zu sehen. Sobald Ingrid zehn Deckel auf einem Tablett fertig hätte, sollte sie damit zu ihr hingehen, und da konnten sie sich ein Weilchen unterhalten, falls der Deutsche nicht kam.
»Präzzission, Fräulein! Präzzission!«
Verflixt nochmal. Er war die Treppe vom Laboratorium heruntergekommen, ohne daß sie es gemerkt hatte. Drüben senkte Maud ihren Kopf, dessen Locken sie unter einem Tuch versteckt hatte, und tat, als sähe sie nichts, doch ihr Rücken bebte vor Lachen. Er ging zu Ingrid hin und paßte einen ihrer Deckel in eine Dose ein. Da klaffte eine große Lücke.
»Das ist zum Wegschmeißen«, sagte er. »Präzzission! Mitdenken, Fräulein!«
Ja, es war leider so, daß das Leben an drei Stellen verlief. Im Kopf spulte sich, vage und murmelnd, der Roman ab. Vor dem Fenster war das richtige Leben mit Tannennadelduft und Freiheit und Stockholm. Und schließlich war da das Leben in der Fabrik, die sie »Die Dose« nannten, und hier hatten sie freilich auch ihren Spaß. Aber Himmel, wie war das schön, wenn es an einem Sommernachmittag endlich fünf Uhr war und sie von dort wegradelte!
Da wehte die Luft kühl ins Gesicht. Die Werkzeugtasche klapperte, wenn sie über die Regenlöcher der Straße fuhr, und zwischen den Beinen war die Sattelspitze zu spüren, und das war nicht unangenehm. Ach ja, herrje, wie schnell man doch von allem wegkam, wenn man ein Fahrrad besaß!
Es war ein Hermes mit hellgrauen Ballonreifen, schwarz lackiert und fast neu. Es hatte einen Gepäckträger und eine Werkzeugtasche mit einer Luftpumpe. Das schien unnötig, denn bislang war nichts passiert. Nicht einmal ein Ventilgummi war kaputtgegangen. An der Lenkstange baumelte ein Beutel mit den eingepackten Frühstücksbroten, dem Kamm und dem Portemonnaie. Das Fahrrad hatte einen blanken, hellen Kettenschutz und ein aus gelbem und schwarzem Garn gehäkeltes Kleidernetz.
»Die Dose« lag ganz draußen, dort, wo die Industrigata beim Sägewerk zu Ende war. Sie fuhr bis zur Landsvägsgata und bog beim Kiosk ab, und dann strampelte sie im Stehen die Brücke hinauf. Auf der anderen Seite der Bahnlinie ging es dagegen fast bis zur Eisenbahnersiedlung bergab. Nach Hause und essen, das dauerte nicht lange. Sowohl Assar als auch Ingeborg guckten etwas verstört drein, wenn sie Ingrid heute ansahen. Die packte ihren Beutel schon wieder voll.
»Was gibt denn das jetzt?«
Sie hatte ihr feines blaues Kleid auf dem Küchensofa ausgebreitet und legte es nun zusammen.
»Packst du das Kleid ein? Wollt ihr tanzen gehen?« »Ich fahre erst zu Maud rauf. Ich bügle es dort.«
Und dann hinein mit den Haarklammern und diversen Kleinigkeiten, die Ingeborg am besten nicht zu Gesicht bekam: Spiegel, Zigaretten, Puderdose.
»Tschüs dann!«
»Jaja«, sagte sie. »Tschüs, du. Komm nicht so spät heim!«
Assar hatte die ganze Zeit über die Zeitung hochgehalten, doch er las nicht. Er guckte über den Rand.
Es war weit bis zu Maud. Sie wohnte ganz oben beim Friedhof. Wenn Ingrid radelte, hing sie selten irgendwelchen Gedanken nach. Sie war ganz da, und das war auch das Leben. Es war hier. In der Luft, die ihr Gesicht umspülte, und im Kies, der davonspritzte, als sie vor der Genossenschaft in die Bremse stieg, weil ein großer Überlandbus angeschaukelt kam. Er hatte den ganzen Nachmittag in der prallen Sonne gestanden und kehrte nun mit erhitzten Menschen in dunklen Kleidern nach Stegsjö und Vallmsta zurück. Ihr war, als schauten alle im Bus sie an. Vor einigen Jahren hätte sie das noch aus der Fassung gebracht, doch nun versetzte sie das nur in gute Laune. Da drinnen saß sogar ein Hund am Fenster und sah sie an!
Bei Maud zog es, als sie die Haustür aufmachte. Die weißen Gardinen flatterten, daß die Messingringe gegen die Stange klirrten, als die Luft durch das große, stille Haus brauste. Außer Maud war niemand daheim. Ihre Eltern wohnten in dem Sommerhäuschen, das ihr Vater selbst gezimmert hatte. Sie weigerte sich jedoch, mit ihnen hinauszuziehen und den ganzen Sommer dort zu wohnen. Sie war zweiundzwanzig Jahre alt und hatte wenig Geduld mit ihnen. Die beiden waren gutmütig, und sie wußten nicht einmal, daß sie rauchte.
Sie hatte die Küche der oberen Wohnung als eigenes Zimmer bekommen, denn sie vermieteten sie jetzt nicht mehr. Aufgrund der Seidenblumen und Volantgardinen sah man jedoch kaum, daß es sich um eine Küche handelte. Jetzt, wo sie allein war, hatte sie den großen Schrankspiegel aus dem Zimmer der Eltern nach oben geschleppt. Sie hatte einfach die Tür des Kleiderschranks ausgehängt.
»Ja, Bammel hast du keinen«, sagte Ingrid.
»Komm jetzt und trink einen Schluck Kaffee! Das Bügeleisen ist warm. Hast du das Kleid dabei?«
Es war ein blaues Kleid, das Ingrids Schwester Dagmar genäht hatte. Es war wahrlich keine schlechte Arbeit, doch Maud fand es langweilig.
»Warte mal! Mach doch den obersten Knopf auf!«
Sie hatte die Zigarette zwischen den Lippen, während sie Ingrid das bügelwarme Kleid über den Kopf ziehen half, und dann ließ sie die Asche auf den Kragen fallen, bürstete und lachte.
»Warte mal, du mußt zwei Knöpfe auflassen. Schau dich im Spiegel an!«
»Das kann ich nicht machen«, sagte Ingrid.
»Aber klar doch! So macht Margit das. Du solltest mal sehen, wenn sie diese weiße Bluse da anzieht, nachdem Mama sie ihr gebügelt hat. Die knöpft sie bis oben hin zu, doch kaum ist sie draußen im Flur, pusselt sie die zwei Knöpfe auf. Dann rennt sie hinaus zu Jörgen, der sich die Beine in den Bauch steht und wartet, weißt du. Hinter der Hecke. Er hat so wahnsinnig Angst vor Vati.«
Maud spannte und dehnte den Stoff des Kleides, damit der Rock besser fallen würde.
»Meine Güte, wie gut dir Blau steht, obwohl es ja eigentlich die reinste Kinderfarbe ist. Jedenfalls …«
Maud sprach dies mit großem Nachdruck aus, und sie lachten beide, denn nun äffte sie Edvin Jansson aus der »Dose« nach.
»Jedenfalls, sie hat mir gezeigt, wie sie sich hinsetzt. So, weißt du. Sozusagen den einen Arm nach oben drücken. Nein, setz dich mal her. Ich kann das nicht vormachen, weil ich ja den Kimono anhabe.«
Mit warmen, flinken Fingern machte sie die oberten Perlmuttknöpfe von Ingrids Kleid auf, und dann zeigte sie ihr, wie sie sich hinsetzen sollte, die eine Brust auf den Unterarm gestützt, so daß sie sich im Ausschnitt ein bißchen nach oben schob. Dann tätschelte sie sie und sagte:
»Das wirst du nie machen, ich weiß schon. Aber denk an Margit, die die Realschule und alles gemacht hat. Jetzt geht sie seit neuestem mit Erik Falk.«
»Vom Anwaltsbüro? Ist der nicht sehr viel älter als sie?«
»Na klar. Aber sie macht, was sie will, weißt du.«
Maud flatterte in ihrem bunten Kimono wie ein großer Schmetterling im Zimmer umher. Ihr Beine waren jedoch so lang und staksig. daß sie eigentlich eher einer Schnake glich. Ingrid stellte dies mit Verwunderung fest, als sie ihre Seidenstrümpfe anzog. Wenn sie angezogen war, merkte man das gar nicht. Maud hatte irgendwie Talent zum Hinzaubern und Wegzaubern.
Sie hatte im Damenfrisiersalon, wo sie ein Mädchen kannte und wo sie selbst gern arbeiten wollte, eine Brennschere ausgeliehen. Die war nicht mehr ganz in Ordnung, deshalb hatte sie sie mitnehmen dürfen. Der Stoffbezug des Kabels war aus gefranst, und das Kabel selbst war nun so ziemlich verschlissen. Wenn es sich lockerte, schüttelte Maud es, bis sie wieder Kontakt bekam, und dann schlugen blaue Funken aus der Kabelhalterung. Ingrid duckte sich, wenn sie mit dem großen, rauchenden Stahlwerkzeug ankam.
»Ach was, das ist nicht gefährlich«, sagte Maud, und dann fuhr sie ihr damit in die Haare und machte die erste lange Welle über Ingrids Nacken. Sie sagte, sie sei zur Damenfriseuse geboren, und hoffte, bald eine Stelle zu bekommen. Obwohl sie zu alt war, um noch Shampooniermädchen zu werden. Diese Fertigkeit hatte sie in den Fingern. Die rupften und zupften gern an Haut und Haar, sie zogen an Kleidern und taten und machten. Sie selbst war nicht besonders schön. Doch daran dachte man gar nicht, wenn sie herausgeputzt war. Sie war indes nicht im geringsten mißgünstig und hätte gern allen möglichen geholfen, das Beste aus ihrem Aussehen zu machen, wie sie sagte.
Sie legten die Haare mit Pilsner, denn da behielten sie die Fasson besser, und es roch nur, solange es naß war. Mit kleinen Metallklammern legten sie an den Wangen entlang und oben an der Stirn flache Locken. Die übrigen Haare ondulierte Maud in lange, schräge Wellen, die sie zusammenhängend hinbrachte, so daß Ingrids Kopf einem gelben Sandstrand glich, der von langen Wogenschlägen gesäumt wurde.
Ingrid zupfte vor dem kleinen Kommodenspiegel, den Maud heruntergehoben und auf den Küchentisch gestellt hatte, die Augenbrauen. Sie traute sich nicht, sie so hoch zu zupfen, wie Maud es sagte, der Unterschied würde zu groß. Außerdem tat es weh. Sie hatte eine Unmenge hellblonder Härchen um die Augen, die ganz und gar nicht dort versammelt saßen, wo sie es in einem langen und staunenden dünnen Bogen sollten.
Es war jetzt still hier oben, still und heiß. Eigentlich hätten sie sich mit ihren Gläsern gern auf den Balkon gesetzt. Maud hatte süßen Vermouth eingeschenkt. Draußen trauten sie sich jedoch nicht zu rauchen, deshalb blieben sie in der Küche zwischen verstreuten Kleidungsstücken, Flaschen und Cremedosen sitzen. Ingrid mochte dieses Samstagschaos im Parfüm- und Bügelgeruch und in dem Rauch der flachen türkischen Zigaretten. Wiewohl ihr manchmal davon übel werden konnte, wenn sie zuviel geraucht hatte.
Maud hatte in der Hitze den Kimono ausgezogen. Er lag auf dem Sofa, und dort lag auch wie abgefallene Kronblätter eines großen, welken Mohns ihr Kleid. Sie trug eine Kombination mit schmalen Trägern und Spitzen an der Büste. Sie war leicht gelb, und die Spitze war beigefarben. Ingrid sah sie fast unablässig an. Im Hosenteil saß kein Gummiband, die Beine flatterten leicht. Sie selbst hatte nur Hemd und Hose und fand eigentlich auch nicht, daß sie etwas anderes brauchte. Das sagte sie freiweg zu Maud:
»So was spielt doch wohl keine Rolle. Das sieht man ja nicht.«
Doch da lachte Maud und strich ihr über die Wange. Das war nicht sehr angenehm. Sie spürte, daß Maud sie für eine hielt, die sie nicht war. Ingrid erzählte ihr nicht alles. Maud sagte oft, daß sie einander alles erzählen sollten. Sie legte ihre warmen Hände an Ingrids Wangen und sagte das.
Sie konnte sich an Maud nicht satt sehen. Obgleich sie überhaupt nicht schön war, war sie jetzt betäubend. Ihre Haut war erhitzt und rosig, gleichwohl matt von dem feinen Puder aus der »Three Flowers«-Dose. Die Augenbrauen waren so richtig staunend hochgezogen, der Mund war rot und auf der Oberlippe mit extra hingemalten Bogen versehen. Die hatte sie sonst nicht. Unter den Armen war sie glatt, denn dort hatte sie die Haare mit einer Paste, die sie kräuselte und ausfallen ließ, entfernt. Auch unter den Seidenstrümpfen war sie glatt und rasiert.
Ja, es war eine Art Betäubung, mit ihr in dem heißen Zimmer oberhalb des Kirchhofs zusammenzusein, auf dem sich jetzt am Samstagnachmittag schwarzgekleidete Menschen so vorsichtig über die Kieswege unter den großen Bäumen bewegten, als fürchteten sie, jemanden aufzuwecken.
Hin und wieder kam es vor, daß die Mädchen auch werktags abends hier saßen. Dann zogen sie sich Strickjacken über, gingen auf den Balkon, setzten sich hin und sahen sich die Männer an, die vorbeiradelten. Nicht die alten Kerle und die Familienväter mit ihren Proviantboxen auf den Gepäckträgern, die nach Schichtschluß von Svenska Motor kamen, und fast ebensowenig die jüngeren, wenn sie in Arbeitskleidung ankamen. Es gab nichts Tristeres als diesen langen, sich dahinschlängelnden, da und dort unterbrochenen Zug von Fahrrädern, nachdem die Fabriksirene geheult hatte. Sie kamen drei und drei, und schließlich ein einsamer Griesgram mit hoch hinaufgeschraubtem Sattel, so einem, wie ihn alte Männer haben. Nein, sie gingen nicht eher auf den Balkon, als bis es so dunkel geworden war, daß die Straßenlaternen brannten. Da waren sie selbst nicht zu sehen. Im Schutz des sanften sommerlichen Dunkels konnten sie Kaffee trinken und lange Züge aus den Zigaretten tun. Sobald die Laternen brannten, kamen die jungen Männer angeradelt, angetan mit über den Haaransatz heruntergezogenen weichen Hüten und Hemdkragen, die in der Dunkelheit blitzten, nachdem alles andere farblos und undeutlich geworden war.
Wenn die Abstände zwischen den Fahrrädern abends größer wurden und keine Schritte mehr im Kies zu hören waren, gingen sie hinein, denn es machte keinen Spaß, im Dunkeln über den Friedhof zu schauen und das Geräusch des Windes zu hören, der sich in den großen Baumkronen bewegte. Maud pflegte Ingrid an solch stillen und ereignislosen Abenden einen Stern zu legen. Sie verschob Karten und legte sie um und sprach kundig von Liebe und Geld. Das Ganze wirkte abseitiger als »Verheiratet oder ledig«, das in der Zeitung ablief. Doch das sagte Ingrid nicht, denn Maud schien daran zu glauben.
Wenn es Samstagabend war und sie etwas von dem süßen Vermouth getrunken hatten, radelten sie zum Park oder zu einem Tanzboden außerhalb, am liebsten zum Snickarbacken draußen beim Fideikommiß*. Das war der anerkanntermaßen vergnüglichste Ort. Warum das so war, konnte niemand sagen. Sie waren leicht verschwitzt, wenn sie ankamen, und mußten hinter einem Busch ihre Strümpfe ausrichten, damit die Nähte gerade saßen. Wenn sie sich pudern wollten, zerrten sie an den Handtaschen und ließen den Spiegel fallen. Es war nervig. Einen Flachmann hatten sie nicht dabei, sie fühlten sich vom Vermouth oft schon ein bißchen beschwipst. Natürlich rauchten sie nicht. Das hätte am Beginn des Abends zu schlecht ausgesehen.
Es waren noch mehr Mädchen da, die sich um sie herum kichernd zurechtmachten und dann auf wackeligen Absätzen ins Licht traten. Snickarbacken war uneben. Im Gras vor dem Tanzboden lagen Steine. Zwischen den Eichen sah man den See, und es roch nach Seerosen und süßem schwarzen Wasser. Den Park mit seinen knatternden Glücksrädern und den elektrischen Lampen in den Bäumen vermißten sie nicht. Hier glühten Zigarettenspitzen im Dunkeln und weiße Hemdkragen leuchteten. Vögel wurden von ihren Nachtzweigen aufgescheucht und flogen verschreckt und lautlos davon, wenn die Paare aus der Dunkelheit hereinstolperten. Viele Seidenstrümpfe mußten daran glauben. Am Samstagabend fand Ingrid nicht, daß das etwas ausmachte, aber am Sonntagnachmittag, der lang und besinnlich war, saß sie da und versuchte sie wieder aufzumaschen, und manchmal grämte sie sich und wünschte, sie wäre mit nackten Beinen gegangen.
Die Roxy Band, die im Park am populärsten war, spielte hier natürlich nie, es waren vielmehr Ziehharmonikatrios und zusammengewürfelte Besetzungen von mitunter recht alten Männern. Die kannten tausend Seemannswalzer. Zu Beginn stand der Talkumstaub wie eine Wolke über dem Boden, und die dunklen Hosenbeine wurden weiß.
Sie mochte die Spannung. Anfangs hatte ihr davor gegraut, stehenzubleiben und mit einem, der betrunken war, tanzen zu müssen. Es war nicht ratsam, abzulehnen. Man konnte dann die Röcke hochgehoben bekommen oder den ganzen Abend nicht zum Tanzen kommen. Und es war ein himmlisches Vergnügen zu tanzen, einen Körper so nahe bei sich zu haben, einen, den man überhaupt nicht kannte und dessen Gesicht man womöglich nicht einmal sah. Der Geruch eines weißen, frisch gebügelten Hemdes konnte sie ein wenig schwindlig machen, Hemd und Haut, sogar der Geruch nach Angesengtem an einem Hemdkragen. Dieser schwache Essiggeruch, der petzte, daß eine unglückliche Mutter den Kragen angesengt und mit Essigessenz zu bleichen versucht hatte. Er saß fest, sosehr man auch spülte, und machte diesen Heroen mit seinen schweren Valentinoaugenlidern so menschlich. Wie er geflucht haben mußte, wie seine Mama gejammert haben mußte!
Sicherlich gab es Arbeitslosigkeit und Freudlosigkeit, doch daran dachte man nicht so viel, jedenfalls nicht, wenn man tanzte. Hier draußen sah man keinen AK-Beschäftigten. Sie hatte allerdings gehört, wie es an manchen Orten zugehen konnte, doch hier sprach man nicht über so etwas. Es hatten wohl alle ihr Päckchen zu tragen. Konnte man sich für den Samstag eine Flasche beschaffen, dann war es schön zu tanzen und über etwas anderes zu reden, nahm sie an. Viele Hosen wurden unter der Matratze gebügelt, danach sahen sie auch aus. Sie merkte, daß sie anfing, pingelig zu werden. Das hatte ihr wohl Maud beigebracht.
Nein, hier draußen redete man nicht über AK und sonstige Hoffnungslosigkeiten. In der Stadt konnte sie schon manchmal Sticheleien ausgesetzt sein, weil sie in der »Dose« Arbeit hatte, während so viele Familienväter arbeitslos waren. Aber hier nie, hier war man keinen Sticheleien ausgesetzt. Hier hatte man seidige Beine, warm war einem, und man hatte frisch gezupfte Augenbrauen. Hier wollten sie einen am liebsten nach Hause begleiten und ganz, ganz lieb sein. Sie mußte von all dem wegradeln, wenn sie zu sehr bedrängt wurde.
Maud und sie verloren sich aus den Augen, nachdem der letzte Tanz gespielt war. Das passierte immer häufiger. Sie stand da und sah sich nach ihr um, nachdem sie ihr Fahrrad hervorgezerrt hatte. Ihr war etwas mulmig zumute, und sie mußte sich wohl oder übel an irgendeine Clique dranhängen. Das würde sicher gehen. Der, der zuletzt mit ihr getanzt hatte, hatte ihren Arm gedrückt, doch sie fand tausend Fehler an ihm. Langweilig und schwerfällig und stur kam er ihr vor. Und aus seiner Jacke ragte der Kragenknopf heraus.
Was Maud hinterher trieb, wußte sie nicht genau. Sie wollte es auch gar nicht wissen. Maud erzählte gewöhnlich, mit wem sie zusammengewesen war. Sie wollten einander doch alles erzählen, sagte sie. Doch Ingrid wollte es gar nicht hören. Das war eine andere Welt. Das war kein Spaß mehr.
Spaß konnte es jedenfalls recht lange sein. Sie sagte nicht immer nein, wenn jemand sie auf dem Heimweg begleiten wollte. Sie war auch schon einmal mit einem Jungen etwas zeitiger aufgebrochen. In weiter Entfernung hatten sie die Musik gehört, sie lag auf dem erleuchteten Laubwerk der Ebene und wiegte sich, Stimmen riefen. Sie hatten auf einem Stapel Heureuterstangen gesessen, um sich auszuruhen, und sie hatte seinen Hemdkragen mit Speichel ganz naß gemacht. Sie waren nicht weiter weg gewesen, als daß sie noch lachende Stimmen und das Dröhnen des Basses hörten. Als sie die Augen geschlossen hatte, war ihr, als schaukelte die grauschimmernde Dunkelheit, und obwohl sie grobes Holz im Rücken spürte, wähnte sie sich außerhalb aller gewöhnlichen Begriffe. Sie hatte keine Lust, sich über das, was sie gerade tat, Gedanken zu machen. Daß sie ihn nicht kannte, war in dem Moment nur gut. Er war nur kalte Lippen und eine heiße Zunge, ein harter Rücken unter ihren Händen. Sie kam sogar flüchtig an sein Glied unter dem rauhen Hosenstoff und fragte sich hinterher, ob er das wohl gemerkt habe.
Seltsamerweise war er es, der sagte, daß sie weiterradeln sollten. Sie wußte nicht, warum er das wollte. Sie fühlte sich jedoch ein wenig erleichtert.
Eine Unschuld sollte ja wie der Besitz eines kleinen Schatzes sein, eine süße Nuß in einem Versteck. Ingrid hatte diese Nuß nicht mehr, sie war aber dahintergekommen, daß man genausogut ohne sie zurechtkam, es durfte nur niemand wissen.
Sie war ganz und gar nicht diese Kostbarkeit und reine, kleine Knospe, wie sie sie sich aufgrund von Ingeborg Eks scheuen Beschreibungen vorgestellt hatte. Sie war lediglich eine kleine Unkenntnis und ein Risiko, das man nicht eingegangen war. Hinterher fühlte man sich ungefähr genauso wie vorher. Sie hatte es nämlich erst einmal getan.
Sie war mit einem Jungen, der älter war als sie, zusammengekommen. Sie selbst war da erst neunzehn. Es war just hier draußen auf Snickarbacken, an einem Augustabend. Er hieß Åke Ekengren. Das war ein toller Name, und Åke sah sehr gut aus. Als er sie auserwählte, merkte sie, daß sie sich dem Kreis der hübschen oder jedenfalls ziemlich hübschen Mädchen zu nähern begann. Wahrscheinlich hatte sie das Maud zu verdanken. Sie hatte mehrere Samstagabende mit ihm getanzt. Manchmal hatten seine Lippen ihre Schläfen berührt, und sie konnte sich das immer noch in Erinnerung rufen, besser als das, was später passierte. Eines Abends stand er neben ihr, als sich einer der Veranstalter räusperte und verkündete:
»Im Namen der Arbeiterkommune von Forstorp möchte ich den Anwesenden ganz herzlich für diesen Abend danken und sie auch nächsten Samstag hier wieder willkommen heißen dürfen. Und nun spielt das Egils Trio den absolut letzten Tanz.«
Es gab dann aber noch einen. Als sie nach Hause radelten, war es ganz warm und dunkel. Die Luft war mild. Sie konnte sich nicht erinnern, daß sie die erste halbe Meile* sehr viel gesprochen hätten. Er hielt schließlich bei einem weißen Haus hinter einer Fliederhecke an. Es war die Personalunterkunft eines Kinderheims, das hier draußen auf dem lehmigen Acker stand. Er erzählte, daß seine Schwester dort arbeite. Sie könnten bei ihr Kaffee bekommen.
Die Schwester war jedoch nicht zu Hause, als sie den knarzenden alten Holzkasten betraten.
»Wir warten solang«, sagte er.
Ingrid fand das spannend. Sie ging umher und guckte, faßte die Haarbürste und den Kamm auf der Kommode an, betrachtete die Sachen genau. Es war geheimnisvoll und interessant, das Leben dieses unbekannten Mädchens, obwohl die Sachen, die es hatte, ganz alltäglich waren: Haarspangen in einem Kästchen, ein Gaskocher auf einer Kiste in einer Ecke. Den schmiß er an.
»Wir machen derweil Kaffee«, sagte er.
Und daran war ja nichts Schlimmes. Jetzt erst sah sie, was für ein Profil er hatte. Und was für ein weiches Hemd, von ungeheuer guter Qualität.
Sie tranken den Kaffee, und er setzte sich neben sie auf die Ottomane seiner Schwester und umarmte sie stürmisch. Dann begannen sie sich zu küssen. Sie verstand, daß er sehr viel Erfahrung hatte. Das empörte sie ein wenig, doch dieses Gefühl ließ sich leicht vertreiben, weil das, was er machte, so genüßlich war. Und es konnte ja nichts passieren. Er streichelte und streichelte sie jedoch, bis er zwei Finger unter ihrem Hosengummi hatte, und dann half nichts mehr. Sie wollte aufstehen, wurde aber nicht gelassen. So könne man sich nicht aufführen. Habe sie ihn soweit gehen lassen … Aber die Schwester!
»Ach was. die kommt nicht. Das ist dir doch wohl klar!«
Sie kam nicht von ihm los, von seiner Erfahrenheit und seinem Ungestüm. Sie fand es auch schön, bis er es dann wirklich tat. Da wurde sie vollkommen kalt und ängstlich.
Er wurde ebenfalls recht kalt hinterher. Sie wußte nicht, ob er enttäuscht war oder was es sonst war. Er schien fast ein bißchen böse auf sie. Als sie sich in den Korbstuhl setzte, bekam sie hinten am Rock einen großen Fleck.
»Ja du meine Güte, du kannst dich doch nicht einfach so hinsetzen«, sagte er und reichte ihr ein zusammengelegtes Handtuch. Dann fuhren sie nach Hause. Es war jetzt viel kälter, und sie hatten praktisch noch eineinhalb Meilen zu radeln. Ihr tat der Rücken weh. Sie dachte: »Das ist mir nicht passiert, nein, mir ist das nicht passiert. Es hat ja auch gar nicht weh getan. Es ist wohl nicht richtig gewesen. Man blutet doch normalerweise. Normalerweise kommt Blut, das hatte Maud gesagt.«
Sie war so kindisch, ihm das zu sagen. Das war die allerschlimmste Erinnerung: wie sie durch die kalte Nachtluft fuhren, schnell und monoton traten, so daß die Wadenmuskeln zu schmerzen anfingen, und sie ihn fragte, ob es richtig gewesen sei, ob man normalerweise nicht ein bißchen blute.
»Doch, es war richtig«, sagte er mit rauher, belegter Stimme. Er hatte wohl auch zuviel geraucht.
»Du mußt jetzt zusehen, daß du nach Hause kommst«, sagte der, den sie nicht kannte. Sie sah ihn mehrmals von der Seite an, doch er zeigte ihr nur unverwandt sein schönes Profil. Sie konnte nicht wissen, was er dachte.
Danach sah sie ihn nur noch von weitem. Er grüßte sie. Aber er forderte sie nicht mehr auf.
Sie hatte es jedenfalls nicht wieder getan. Es war jetzt bald drei Jahre her, daß das passiert war. So nach und nach hatte das Tanzen wieder Spaß gemacht. Sie mochte die Spannung. Es machte Spaß, in einer großen Clique oder schlimmstenfalls, wenn sie einen, der hartnäckig war, loswerden mußte, allein auf Pfaden und durch die Felder heimzuradeln.
»Du bist vielleicht lustig«, sagte Maud manchmal. »Wozu machst du dir denn die Mühe und richtest dir die Haare, wenn du dann doch mit keinem zusammensein willst?«
Darauf antwortete sie jedoch nicht.
Es war Nacht. Über ihrem Kopf raschelte und rauschte das Laub, während sie durch die Allee radelte. Von den Feldern wehte ab und zu ein warmes Lüftchen herein, als hätte der Sommerwind den ganzen Tag über zusammengerollt dagelegen und bewegte sich nun plötzlich im Dämmer der Nacht. Ein Fuchs erhob sich draußen auf dem Feld von einem flachen Stein. Hatte er dort geschlafen? Sie sah seine Silhouette. Bedächtig erhob er sich, streckte sich wie ein Hund, und dann horchte er ihr nach. Die Fahrradkette schepperte wohl ein bißchen. Er lief jedoch nicht weg.
Dies war eine Landschaft, die Menschen gemacht hatten. Äcker, Felder, Alleen. Laubwäldchen und Weiden mit kleinen Steinhaufen. Die Seen tasteten sich zwischen das Laub, ihr hingegossenes Wasser spiegelte Himmel und Bäume.
Auf einer Anhöhe lag schlafend und ruhig der Hauptmannssitz. Er hatte einen strengen und dunklen roten Anstrich, als wäre er in einer ganz anderen Zeit aufgetragen worden. Mitten auf dem Hof stand ein eiserner Topf mit einem Rosenstrauch. Die Katzen waren draußen, die Katzen, der Fuchs und Ingrid. Die Vögel schliefen auf Nachtzweigen in dichten Büschen und Bäumen, die schwarz aussahen. Himmel, wie müde sie war. müde und ein wenig erregt von der Einsamkeit.
Diese Landschaft mit ihren tiefen, weichen Linien hatte keinen Horizont. Sie war laubreich und anmutig, gezüchtigte Natur und die ruhige Überzeugung, daß es um Menschen herum so und nicht anders sein sollte. Schwäne saßen ganz still im Teich und leuchteten. Sie hatten die Köpfe mit den langen, geschmeidigen Hälsen unter die Flügel gesteckt. Hinter den Bäumen des Parks sah sie dunkelgelb das Schloß stehen. Der Mühlwasserfall mit eisenbeschlagenen Überfällen. Er murmelte in den Holzrinnen, und als sie über die Brücke fuhr, hatte sie den Eindruck, als spreche er.
Alte Steinkeller duckten sich unter wucherndem Wolfsmilch- und Himbeergestrüpp. Die Scheunen wurden von der Dämmerung nahezu verschluckt, so grau war ihr Holz. Auf dem Weg saßen seltsame Vögel. Erst nach einer Weihe begriff sie, daß das Ziegenmelker sein mußten. Fünf, sechs Stück hatte sie bereits davongescheucht. Dort draußen auf dem Acker war der Wachtelkönig zu hören.
War diese Landschaft tot oder verlassen? Erinnerung oder Traum? Über der Lenkstange halb schlafend kam ihr der Gedanke, daß sie nicht richtig wirklich sei. Der Dämmer der Nacht hatte ihre Farben ausgebleicht. Bisweilen waren da aber die Gerüche, die ein Windhauch gelöst hatte. Sie wogten heran, ein Duft nach verblühtem, echtem Labkraut und beinahe moderndem Jasmin aus einem Garten hinter einem weißen Zaun. Sie fuhr an einem Viehstall vorüber. Der Geruch des Mists war streng und scharf, ganz und gar nicht wie der, den man von grasenden Kühen auf einer Weide und ihren frischen Ausscheidungen her kannte.
Hier standen still große Pferde. Sie schliefen, das Maul am Schwanz des anderen, befreit von Fliegen, befreit. Sie schliefen in großen, dunkelblauen Träumen, ihre zottigen Sprunggelenke und gewaltigen Schenkel in Ruhestellung. Sie schnauften kaum merklich durch die Nüstern. Ingrid war froh, daß sie diese Koppel nicht durchqueren mußte. Waren das überhaupt Pferde? Nun war sie vorüber und sah sich um. Pferde oder große Steinblöcke.
An einigen Stellen mußte sie durch den Wald, und sie fand ihn unheimlich. Er war etwas ganz anderes, eine unmenschlich rauhe und dichte Finsternis herrschte darin. Die letzten zwei Kilometer in die Stadt waren fast nur Wald. Himmel, wie sie in die Pedale trat! Sie hatte von dem anhaltenden Gegenwind eine ganz kalte Brust:
Die Stadt kam ihr in diesem stillen, freundlichen Laubreichtum, durch den sie gefahren war, wie ein bösartiges Geschwür vor, vielleicht ein Fleck und etwas Zufälliges. Sommerhäuschen lagen an einem stillen See hier mitten im Wald, Häuschen an einem finstern Tannenstrand. So lagen keine alten Amtssitze. Sie klammerten sich hier am Uferrand fest, und hinter ihnen war die Finsternis. Eine seltsame Art zu wohnen.
Eigentlich wollte sie nicht in die Stadt. Sie empfand gegen sie den gleichen Widerwillen wie gegen die Art, in der die anderen, die Erwachsenen und die im Leben Eingerichteten, lebten.