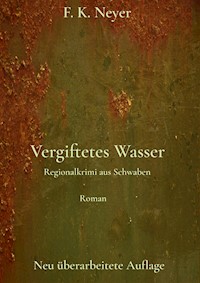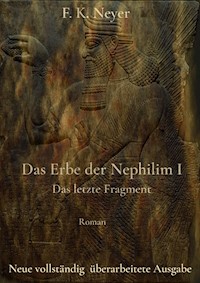
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Auf einer Urlaubsreise nach Ägypten findet Helmut Zahn aus Deutschland einen seltsamen Stein mit eingravierten, unbekannten Schriftzeichen. Entgegen jeder Vernunft schmuggelt er ihn aus dem Land. Auf dem Rückflug wird er von einem angeblichen Mitarbeiter des ägyptischen Geheimdienstes angesprochen, der ihm den Stein für eine sechsstellige Summe abkauft. Zahn findet heraus, dass der Stein ein Fragment einer sagenumwobenen Tafel sein muss, die in ferner Vergangenheit von einem Nephilim, einem illegitimen Nachkommen eines gefallenen Engels, geschaffen würde. Semyazza, der Anführer der gefallenen Engel zwingt den Nephilim dazu, die Tafel zu vernichten Zahn begibt sich auf die Suche nach den fehlenden Fragmenten und trifft dabei auf zwei konkurrierende Orden. Den der Wächter und den der Jäger. Aufgabe des Wächterordens ist es zu verhindern, dass die zerbrochene Tafel wieder zusammengesetzt wird, die Jäger wollen genau das erreichen. Während die Wächter Mischwesen sind, die aus Verbindungen zwischen Menschen und Nephilim hervorgegangen sind, handelt es sich bei den Jägern um reinrassige Nephilim, die in ferner Vergangenheit von Semyazza beauftragt wurden, diese Mischwesen zu jagen und zu elimieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 567
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
F. K. Neyer
Das Erbe der Nephilim
Band 1
Das letzte Fragment
Roman
Das Buch
“Das letzte Fragment” ist der erste Teil einer Dilogie. Auf einer Urlaubsreise nach Ägypten findet Helmut Zahn aus Deutschland in der Oase Siwa einen seltsamen flachen Stein mit eingravierten, unbekannten Schriftzeichen. Er schmuggelt ihn, wider besseren Wissens aus dem Land. Auf dem Rückflug wird er von einem angeblichen Mitarbeiter des ägyptischen Geheimdienstes angesprochen, der ihm den Stein für eine sechsstellige Summe abkauft. Zahn findet heraus, dass es sich um ein Fragment einer sagenumwobenen Tafel handelt, die in ferner Vergangenheit von einem Nephilim, einem illegitimen Nachkommen eines gefallenen Engels, geschaffen wurde. Semyazza, der Oberste, zwingt diesen Nephilim, die Tafel zu zerstören, damit sie keinem Unbefugten in die Hände fallen kann.
Zahn begibt sich auf die Suche nach den restlichen Fragmenten und trifft dabei auf zwei miteinander konkurrierende Orden, den der Wächter und den der Jäger. Die Aufgabe des Ordens der Jäger ist es, zu verhindern, dass die zerbrochene Tafel wieder zusammengesetzt wird. Die Jäger wollen genau das erreichen. Während die Wächter Mischwesen sind, die aus Verbindungen zwischen Menschen und Nephilim hervorgegangen sind, handelt es sich bei den Jägern um reinrassige Nephilim, die in ferner Vergangenheit von Semyazza beauftragt wurden, die Mischwesen zu eliminieren.
Der Autor
F. K. Neyer wurde im Jahr 1960 in einem kleinen Dorf im Schwabenland geboren. Nach der mittleren Reife 1977 war er in unterschiedlichen Bereichen tätig. Eine Ausbildung zum Programmierer ermöglichte ihm den Einstieg in die IT. Nach mehr als 20 Jahren in dieser Branche erfüllte er sich im vorgezogenen Ruhestand im Jahr 2022 einen langgehegten Wunsch und begann zu schreiben.
Impressum:
Texte:
© Copyright by F. K. Neyer
Umschlaggestaltung:
© Copyright by F. K. Neyer
Verlag:
Friedhelm Neyer
Hauffstraße 21/1
73084 Salach
Vertrieb:
epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Prolog
Unbekannte Zeit, unbekannter Ort
Jedes Mal beginnt er mit derselben unheilvollen Sequenz. Dieser Traum, der ihn seit Monaten in unvorstellbar verstörender Weise heimsucht. Nicht jede Nacht und nicht nach einem erkennbaren Muster. Er beginnt mit einer Art rasender Fahrt, die an einem glutrot leuchtenden Tor endet und dessen Feuer keine Hitze ausstrahlt. Nur unerträglich grelles Licht. Hinter diesem Tor beginnt der freie Fall in eine apokalyptische Tiefe. Wie in 㼀jedem dieser Träume dauert dieser Sturz lediglich den Bruchteil einer Sekunde und währt gleichwohl eine Ewigkeit. Er endet mit dem typischen heftigen Zucken des Körpers. Dennoch erwacht er nicht. Er übersteht diesen Fall absolut unversehrt und ist sich zu seinem Erstaunen in jedem Moment bewusst, dass er träumt. Trotzdem sieht er sich außerstande, ausreichend Willenskraft aufzubringen, um diesen befremdlich luziden Traum zu beenden oder verlassen zu können. Er kommt in einem düster erleuchteten Raum zur Ruhe. Wenn er wüsste, was dieser Traum zu bedeuten hat. Dass er eine Bedeutung haben muss, scheint sicher zu sein, denn er sieht die Ereignisse des Traumes aus der beobachtenden Perspektive des Träumenden. Dennoch ist er nicht nur der Träumer sondern gleichzeitig die geträumte Figur. Der Traum verändert sich niemals. Bis auf das kleinste Detail ist es stets derselbe. Er kann sich an jede Einzelheit erinnern. Immer! Als ob er die Ereignisse in diesem Moment selbst erleben würde. Oder sie erst noch erleben würde? Er kann sich keinen Reim darauf machen. Die schemenhafte Gestalt wirbelt herum wie ein außer Kontrolle geratener, orientalischer Derwisch. Ihre brennend aggressive Wut ist fast körperlich zu spüren. Niemand hätte sagen können, wer diese Gestalt ist. Außer der stille Beobachter, der vollkommen sich gekehrt und äußerlich absolut ruhig an einer der grob behauenen Wände lehnt. Hätte die Gestalt über die Macht verfügt, sie hätte den vermeintlich stillen Beobachter sofort und für alle Zeiten in den Abgrund gestoßen. Den bodenlosen Schlund, der Äonen später als Hölle oder Fegefeuer in den allgemeinen Sprachgebrauch der Menschen einfließen würde. Die Gestalt ist sich darüber im Klaren, dass sie als Verräter gilt. Als Verräter ihrer Väter, denen sie gleichgestellt ist. Wenngleich sie sich nicht als gleichgestellt betrachtet. Sie ist der erstgeborene Sohn des Obersten. Keiner seiner Brüder ist wie er. Keiner wird je so sein wie er. Außer vielleicht … nein, er verdrängt diesen Gedanken … er ist es nicht wert gedacht zu werden. Die Wut, dieser unglaubliche Zorn, der sich seit langer Zeit ihren Weg aus den dunkelsten Tiefen seiner schwarzen Seele nach oben bahnt und ihn jetzt übermannt, hat ihn dazu gebracht. Er hat nichts anderes im Sinn, als das Meisterwerk, an dem er seit Jahren arbeitet und es schließlich vervollkommnen konnte, zerstören zu wollen. Wenn auch unter dem unvorstellbaren, psychischen Zwang, den der stille Beobachter auf die Gestalt ausübt. Kurz hält die Gestalt inne. Scheint darüber nachzudenken sich diesem Zwang entgegenzustellen. Ob sie es überhaupt kann? Macht es nicht, weil klar ist, dass es keine Gegenwehr geben kann. Niemand kann sich diesem Einfluss widersetzen. So hebt sie mit einer gewaltigen Kraftanstrengung die schwere Steintafel hoch über den Kopf. Fast treten ihr die Augen aus dem Schädel angesichts des Gewichts von zweihundert manûm.[Fußnote 1] In ihrer jetzigen Gestalt verfügt sie nur über unwesentlich mehr Kraft als einer der Niederen. Sie schmettert die Tafel auf den Boden. Unzählige winzige Splitter und Steinstaub verteilen sich überall in dem durch drei Fackeln erhellten Gewölbe tief unter der Oberfläche der Erde. Und eine Anzahl größerer, unregelmäßig geformter Fragmente. Ein schmerzhafter, unglaublich schriller Ton liegt in der Luft. Einer der Niederen wäre sofort um den Verstand gebracht worden, wäre auf der Stelle wahnsinnig geworden. Das unnachahmliche Meisterwerk ist zerstört. Aber nicht verloren. Der stille Beobachter ist in dem Moment verschwunden, in dem die Tafel auf dem Boden aufschlägt. Er hat erreicht, was er wollte, der weitere Fortgang der Ereignisse scheint ihn nicht zu interessieren. Die Gestalt wird die größeren Teile über die ganze Welt verstreuen. Das Risiko, dass eines der Fragmente durch die kaum sichtbaren Absplitterungen unbrauchbar wird, hält sie für vernachlässigbar. Und sie wird ausreichend Hinweise darauf hinterlassen, wo diese Teile zu finden sind. Falls die Niederen je in der Lage sind, diese nicht nur zu finden, sondern deren Bedeutung zu erkennen. Auf dass sie eines Tages vielleicht alle gefunden und wieder zusammengesetzt würden. Zum Wohl oder zum Fluch ihrer selbst. Das mussten sie selbst entscheiden. Das interessiert die Gestalt ihrerseits nicht. Wenn das eines fernen Tages der Fall ist, ist sie längst zu Staub zerfallen sein. Sie hat getan, wozu sie der stille Beobachter gezwungen hat. Welcher Art dieser Zwang war, weiß die Gestalt nicht. Niemals hätte sie sich vorstellen können, dass jemand oder irgendetwas Zwang auf sie ausüben kann. Und doch ist es so gewesen.« Mit einem heftigen Zucken erwachte er schweißgebadet. Wieder dieser unheilvolle Traum, dessen Bedeutung sich ihm nicht erschloss. Er kann weder die seltsame Gestalt, noch den stillen Zeugen identifizieren, der ihm als Beobachter natürlich nicht verborgen geblieben war. Unbekannt auch das, was die Gestalt als ihr Meisterwerk betrachtete. Wer war diese seltsame Gestalt, die ihn seit Monaten um den Schlaf brachte? Was hatte es mit diesem Meisterwerk auf sich? Das jedes Mal zerstört wurde. Dessen Fragmente auf der ganzen Welt verteilt wurden? Wer sind diese Niederen? Fragen über Fragen. Keine davon kann er beantworten. Falls sich der Traum nicht eines Tages verändern würde. Er brannte vor Neugierde, ob das je geschähe. War gespannt, wie der Traum weitergehen würde. Neugierig darauf, ob er irgendwann erfahren würde, wer diese Gestalt ist. Und gleichzeitig hatte er Angst davor, wirklich zu erfahren, erfahren zu müssen, was sich dahinter verbarg.
Kapitel 1
Oase Siwa, Ägypten, Nordafrika
Weshalb ein bodenständiger Landwirt von den Höhen der Schwäbischen Alb auf die, nun ja verrückte Idee kam, mehrere Wochen lang Ägypten zu bereisen, konnte sich in dem etwas größeren Dorf niemand erklären. Mit großer Wahrscheinlichkeit würde es nie jemand erfahren. Er war zeit seines Lebens ein Sonderling, ein Außenseiter gewesen. Selbst nach den Maßstäben des Dorfes auf der Hochfläche der südlichen Schwäbischen Alb. Jemand, der sich an Dinge heranwagte, auf die andere in seinem Heimatdorf nicht einmal im Traum gekommen wären. Ebenso hochintelligent wie rücksichtslos stellte er seine Interessen stets in den Vordergrund. Und, mit etwas Abstand, die seiner Ehefrau Sophia und seiner Tochter Paula. Das war schon bei seinem Vater und Großvater so. Niemand im Dorf wollte sich den Zorn seiner Familie zuziehen. Niemand hatte es je gewagt, sich gegen seine Familie zu stellen. In diesem Jahr hatte er eben beschlossen, den Urlaub, den sich ein Ackerbauer ohne Viehhaltung erlauben konnte, in Ägypten zu verbringen. Den ersten Familienurlaub überhaupt. Wobei verbringen vielleicht nicht ganz das richtige Wort war. Er hatte eine umfangreiche Rundreise ins Auge gefasst, die vor allem für seine Tochter, die sechsjährige Paula interessant, aber ebenso anstrengend sein würde. Beginnend im Norden in Alexandria wollte er alle wichtigen, historischen Orte in dem geschichtsträchtigen Land mit seiner uralten Kultur besuchen. Obwohl ihm natürlich klar war, dass er nicht einmal einen winzigen Bruchteil dieser Orte kannte. Geschweige denn diese aufsuchen konnte. Er hatte die Pyramiden von Gizeh, das Tal der Könige sowie die Tempel von Karnak, Abu Simbel und den der Hatschepsut in seine Liste aufgenommen. Bevor er als Abschluss die über 1.200 Kilometer lange Reise zur Oase Siwa machen würde. Zuvor gestand er seiner Frau und seiner Tochter einen mehrtägigen Badeurlaub in einem Hotel in dem aufstrebenden Küstenort Hurghada direkt am Mahmya Beach am Roten Meer zu. In der durchschnittlich 18 Meter unter dem Meeresspiegel liegenden, 80 Kilometer langen und bis zu 20 km breiten Oase, wo manchen Quellen zufolge Alexander der Große seine letzte Ruhestätte gefunden hatte, wollte er sich alles ansehen, was es zu sehen gab. Nicht nur die angeblich 300.000 Dattelpalmen und 70.000 Olivenbäume. Dass sich das Grab des berühmten makedonischen Eroberers tatsächlich dort befand oder befunden hatte, glaubte er nicht. Vielleicht würde er auf ein antikes Artefakt stoßen. Ein Schmuckstück, ein Amulett, irgendetwas. Der geschichtsträchtige Boden in dieser Oase musste nach seiner Überzeugung voll von solchen Überresten sein. Wie und ob er ein mögliches Fundstück aus dem Land schmuggeln könnte, darüber würde er erst nachdenken, wenn er etwas gefunden hatte. Die darauf stehenden drakonischen Strafen waren ihm bekannt, doch mit seinem schwäbischen Sturschädel war er davon überzeugt, dass man ihn nicht erwischen würde. Seit zwei Tagen trieb er sich trotz der gnadenlosen Hitze, die um die Mittagszeit 40 Grad im Schatten erreichen und oft überschreiten konnte, in den Randbezirken der riesigen Oase herum. Falls es irgendetwas zu finden gäbe, was das Risiko wert war beim Schmuggel erwischt zu werden, war das nicht im städtisch anmutenden Zentrum der Oase. Dort waren überall Bauarbeiten im Gang und die Maschinen hatten längst das halbe Zentrum umgegraben. Andererseits war eine gezielte Suche aussichtslos, er wusste nicht einmal, wonach er suchen sollte. Der Zufall, und davon war er überzeugt, würde ihm zu Hilfe kommen. Und falls nicht, hatte er wenigstens einmal in seinem Leben eine echte Oase gesehen. Die einzige der Welt, die tiefer als der Meeresspiegel lag. Soeben hatte er den Tempel der Offenbarung des Amun auf dessen rechter Seite passiert. Hier war in der Antike das Orakel von Siwa beheimatet, das dafür bekannt war, keine Orakelsprüche zu verkünden, sondern Ja- oder Nein-Antworten. Nun wollte er das Gelände von Umm Ubayd durchstreifen, den Tempel des Nektanebos, von dem kaum mehr etwas übrig geblieben war, nachdem das Mauerwerk zum Bau der Moschee abtransportiert worden war. Direkt vor der Hinweistafel, die diesen Tempel beschrieb, stieß er mit dem Fuß gegen ein Hindernis, das deutlich sichtbar aus dem Boden ragte und von dem allgegenwärtigen Wind frei geweht worden war. Ansonsten wäre es 㼀nicht mehr an dieser Stelle gewesen. Erschöpft von der Hitze und gehörig genervt wollte er das Hindernis zur Seite kicken, als er auf die seltsamen Zeichen auf dem hellen Stein aufmerksam wurde. Hieroglyphen, welche anderen Schriftzeichen sollten hier sonst verbreitet sein? Er war ja in Ägypten. Zumal auf einem - vielleicht - historischen Artefakt. Was keine Rolle spielte, denn entziffern konnte er diese Zeichen ohnehin nicht. Er wusste, wie Hieroglyphen aussahen. Und auf diesem Stein befanden sich keine Hieroglyphen, wie er sie aus seinen Büchern kannte. Zumindest keine ägyptischen. Ob es in anderen Gegenden der Erde ähnliche Schriftzeichen gab, wusste er nicht. Ohne einen Moment nachzudenken, sah er sich verstohlen um. In der Mittagshitze hielt sich kein vernünftiger Mensch im Freien auf, dem es auffallen würde, wenn er irgendwas vom Boden aufhob. Den Behörden würde ein potentieller Beobachter ihn ohnehin nicht melden. Der würde eher an seine Brieftasche appellieren. Er tat, als ob er seinen Schnürsenkel binden müsse, zerrte den etwa fünfzehn mal zwanzig Zentimeter messenden Stein aus dem lockeren Sand und ließ in mit einer fließenden Bewegung in seiner Umhängetasche verschwinden. Geschafft! Wie er das Artefakt, falls es eines war, nach Deutschland bringen würde, darüber hatte er noch nicht nachgedacht. Damit würde er sich später beschäftigen, wenn er sich den Stein näher angesehen hatte. Wahrscheinlich nur ein steinernes Artefakt ohne jeden Wert. Zwei Stunden später lag das Fundstück auf dem Tisch in dem großen Familienzimmer. Seinen beiden Frauen hatte er einen ausgedehnten Ritt auf einem Kamel spendiert. Oder war es ein Dromedar? Egal, das, was man als Wüstenschiff bezeichnete. In den nächsten drei Stunden hatte er ausreichend Zeit, seinen Fund unter die Lupe zu nehmen. Konzentriert betrachtete er die Zeichen, die mit höchster Präzision in den Stein graviert waren. Wie erwartet waren es keine ägyptischen Hieroglyphen. Die sahen völlig anders aus. Das wusste er seit seinen Besuchen in einigen der bekanntesten Orte Ägyptens mit Sicherheit. Andere Symbolschriften kannte er nicht. Ihm fiel auf, dass die Oberfläche des Steins vollkommen glatt war, wie mit einer Schleifmaschine poliert. Nachdem er erkannte, dass er dem Artefakt seine Geheimnisse nicht entreißen konnte, machte er sich Gedanken darüber, wie er das Täfelchen aus dem Land bringen könnte. Zunächst wickelte er den Stein sorgfältig in mehrere benutzte Slips seiner Tochter und seiner Frau, die alle verräterische Spuren aufwiesen und nicht sehr angenehm rochen. Kein Zollbeamter in diesem Teil der Erde würde dieses Bündel anfassen. Es war nach den hier verbreiteten Sitten absolut unrein. Zur Sicherheit packte er fünf oder sechs Paar getragene Socken dazu, die einen säuerlichen Geruch absonderten.
Flug Kairo – Stuttgart via Zürich
Die Rückfahrt von der Oase Siwa nach Kairo war die reinste Tortur. Selbst die kürzere Route über Marsa Matruh. Und nicht wegen des allgegenwärtigen Sandes und der unmenschlichen Temperaturen. Mehrere Straßensperren, die plötzlich hinter einer Düne auftauchten und an denen er durch großzügige Zuwendungen an die dort stationierten Polizisten ohne Kontrolle durchgewunken wurde, schmälerten seine Barschaft deutlich. Dazu kam die ständige Angst, dass einer der Beamten trotz des Bakschisch das Gepäck durchsuchen würde. Mit Sicherheit das Ende der Reise. Anstelle der Rückkehr auf die Schwäbische Alb stünden ihm Jahre in einem verwahrlosten Gefängnis in Ägypten bevor. Vielleicht sein restliches Leben. Nach jeder Kontrolle vergewisserte er sich, dass der Stein gut verpackt war. Mochten die Beamten in diesem Land durch und durch korrupt sein, wenn es um den Schmuggel von nationalen Kulturgütern geht, verstanden sie keinen Spaß. Auch Geld würde dieses Problem nicht lösen. Als sie Maṭār al-Qāhira ad-duwalī, den internationalen Flughafen Kairo erreichten, atmete er auf. Nur noch die Zollkontrolle, dann wäre es ausgestanden. Und die fand überraschenderweise kaum statt. Niemand wollte sein Gepäck kontrollieren und das Boarding ging problemlos über die Bühne. Eine Großdemonstration gegen Präsident Mubarak in der Stadt band einen Großteil der üblichen Sicherheitskräfte. Die Reisenden mit Ziel Europa wurden unkontrolliert durchgelassen. Die Boeing 737 war nahezu voll besetzt. Sophia und Paula saßen in der linken Reihe, er musste mit dem Fensterplatz der anderen Reihe vorlieb nehmen. Er wunderte sich, dass die beiden Plätze neben ihm kurz vor dem Start frei waren. Er beschloss, die Stewardess nach dem Start zu bitten, seine Frau und seine Tochter neben ihm zu platzieren. Die Maschine rollte schon, als sich ein elegant gekleideter Herr in einem dunklen Businessanzug, der ein herbes Eau de Toilette benutzte, neben ihm niederließ und seinen Aktenkoffer ungeniert auf den mittleren Sitzplatz legte. Die Boeing beschleunigte und hob in einem steilen Winkel ab. Nachdem mit einem satten Klacken das Fahrwerk eingefahren und die Maschine auf Reiseflughöhe war, wandte sich der Mann ihm zu und sagte kaum hörbar: »Herr Zahn? Helmut Zahn?« Misstrauisch murmelte er: »Was wäre, wenn ich Ihre Vermutung nicht bestätige?« »Sinnlos und unnötig«, sagte der Andere, »ich weiß, dass Sie Helmut Zahn aus Deutschland sind. Lassen Sie uns zum Geschäftlichen kommen. Sie haben in Ihrem Gepäck etwas, das mir gehört und das ich wieder haben will. Ohne Rücksicht auf Verluste wieder haben will. Um jeden Preis. Jedes Mittel ist mir recht! Wenn Sie verstehen, was ich meine.« »Ich bin ja nicht taub«, setzte Zahn aufbrausend alles auf eine Karte, »was sollte das sein, das Sie haben wollen? Wie hätte ich irgendetwas an mich nehmen können, was angeblich Ihnen gehört? Sie dürfen nach der Landung in Stuttgart gerne mein Gepäck durchsuchen. Ich bin sicher, dass Sie nichts finden werden, dass Sie haben wollen.« Der Mann grinste überlegen und gleichzeitig unsicher. Er ließ ihn einen Blick auf ein echt aussehendes Ausweisdokument werfen und erwiderte: »Lassen wir das Geplänkel, Herr Zahn. Mein Auftraggeber ist die ägyptische Regierung, genauer gesagt der Mukhabarat, der ägyptische Geheimdienst. Leider sind wir zu spät gekommen, sonst hätten Sie dieses Flugzeug nie bestiegen. Ebenso wenig wie ihre reizende Frau«, er warf einen Blick nach links, »oder ihre kleine Tochter. Reden Sie mit mir, ich bin sicher, dass wir eine für beide Seiten befriedigende Lösung finden werden.« »Eine Lösung wofür?« fragte Zahn, »wenn eine Lösung erforderlich ist, sollte es vorher zumindest ein Problem geben. Oder sehen Sie das anders? Falls Sie vom Geheimdienst sind, warum beschlagnahmen Sie das, was ich angeblich habe und das ihnen gehört nicht. Sollte kein Problem sein.« »Oh«, machte der Mann überlegen, ohne auf Zahns Zweifel an seinem Auftraggeber einzugehen »glauben Sie mir bitte, wir haben ein Problem. Genauer gesagt, Sie haben eines. Ich weiß es und Sie wissen es. Sie haben in der Oase Siwa widerrechtlich ein historisches Artefakt – sagen wir – gefunden, das sie nach Europa schmuggeln und verkaufen wollen. Und glauben Sie mir bitte auch«, seine Stimme klirrte wie Eis, »dass wir das verhindern können und werden. Sie sagen sich wahrscheinlich, dass ich in diesem Flugzeug nichts gegen Sie unternehmen kann und damit haben Sie recht. Wir bleiben nicht immer in dieser Maschine. Hören Sie sich in aller Ruhe meinen Vorschlag an und entscheiden Sie sich dann für das Richtige.« Zahn dachte einen Moment nach. Er war unkonventionell, anders als die meisten Leute und ging einer Auseinandersetzung selten aus dem Weg. Doch dumm war er nicht. Er spürte deutlich, dass sein Gesprächspartner am längeren Hebel saß. Und dass er diesen benutzen würde, wenn er es für erforderlich hielte. »Wer sind Sie und vor allem, wie lautet ihr Vorschlag?« fragte er kurz und bündig. Sein Sitznachbar stellte sich unter dem Namen Hosni Mubarak vor, was logischerweise Quatsch war. Wie der ägyptische Staatspräsident sah er nicht aus. Er atmete deutlich hörbar auf und antwortete: »Freut mich, dass Sie sich meinen Vorschlag zumindest anhören. Ich bin sicher, dass Sie ihn akzeptieren werden. Geben Sie mir nach der Landung in Stuttgart dieses Artefakt aus der Oase. Der deutsche Zoll macht keine Probleme, niemand wird ihr Gepäck kontrollieren. Im Gegenzug«, er klopfte auf den neben ihm liegenden Aktenkoffer, »erhalten Sie von mir 100.000 US-Dollar, die sich in diesem Koffer befinden. In bar. Was meinen Sie?« Zahn rechnete kurz im Kopf nach und kam zum Ergebnis, dass er für diesen Stein mehr als 130.000 DM bekäme. Um ein Vielfaches mehr als er erwarten konnte, wenn er ihn in Deutschland verkaufte. Dämlich wäre noch milde ausgedrückt, lehnte er dieses Angebot ab. »Sie haben recht, das Angebot kann ich nicht ablehnen, zumindest nicht ohne mir weitere Details anzuhören«, antwortete er, »wer sagt mir zum Beispiel, dass Sie mir kein Falschgeld unterjubeln? 100.000 Dollar sind keine Kleinigkeit. Dass die Summe steuerfrei ist, nehme ich ohnehin an. Sie werden dem Finanzamt kaum eine Meldung über dubiose Zahlungen machen.« »Ich gehe davon aus«, lächelte der Mann, »dass Ihnen meine mündliche Zusicherung nicht ausreicht. Schriftlich können wir das nicht machen. Und ja, Ihr Finanzamt bleibt außen vor.« »Sie wären an meiner Stelle ebenso misstrauisch«, erwiderte Zahn, »oder nicht?« »Natürlich wäre ich das. Was halten Sie von einem Deal?«, sagte Mubarak und ließ die beiden Schlösser des Aktenkoffers aufschnappen, »greifen Sie in den Koffer, nehmen Sie sich aus einem beliebigen Bündel eine oder zwei Banknoten. Wir haben eine Stückelung aus Zwanzigern und Fünfzigern gewählt. Stecken Sie diese ein und kaufen in Stuttgart irgendetwas damit. Wenn es keine Probleme beim Bezahlen gibt, und das wird es nicht, geben Sie mir den Stein und Sie bekommen den Koffer.« »Und wenn ich mit den beiden Scheinen verschwinde?« provozierte er ihn. »Herr Zahn«, lachte der Mann, »so dumm sind sie nicht. Ich hätte im schlechtesten Fall einhundert Dollar verloren. Verschmerzbar für mich. Sie aber könnten nie wieder sicher sein, ob nicht jemand hinter Ihnen her ist. Wollen Sie dieses Risiko eingehen. Wegen lumpiger hundert Dollar?« »Austausch Zug um Zug«?, wollte er wissen, ohne auf die Antwort Mubaraks einzugehen. Ihm war klar, dass der Mann gehörig unter Druck stand. Dass er sich einen Misserfolg nicht leisten konnte. Nicht ohne sich den Zorn seiner Auftraggeber einzuhandeln. Ob das der ägyptische Geheimdienst war oder nicht. Wovon er nicht überzeugt war. Ein Geheimdienst hatte andere Möglichkeiten, den Stein in die Finger zu bekommen. Weshalb sollte jemand eine Menge Geld für irgendetwas bezahlen, das er sich anderweitig beschaffen konnte? »Natürlich, was denn sonst?« »In Ordnung«, stimmte er zu, »wir haben einen Deal.« »Es ist eine wahre Freude mit Ihnen Geschäfte zu machen«, atmete Mubarak erneut hörbar auf. Nach der Landung in Stuttgart und dem erfolgreichen Versuch, mit den Dollarscheinen Mubaraks einzukaufen, wechselten Aktenkoffer und Artefakt den Besitzer. Mubarak eilte sofort nach dem Austausch zu einem anderen Gate. Er hatte er einen Misserfolg nie in Erwägung gezogen. Helmut Zahn dagegen konnte nicht ahnen, dass der Geldkoffer der Auftakt zu einer jahrzehntelangen Jagd war. Dass er Länder und Gegenden sehen würde, von denen er zum jetzigen Zeitpunkt nicht einmal den Namen gehört hatte.
Kapitel 2
Gorges du Verdon, Alpes-de-haute-Provence
Manchmal konnte er nicht mehr sicher unterscheiden, ob er nicht wahnsinnig war. Oder es erst geworden war, nachdem sich dieser unheilvolle Traum vor einiger Zeit von heute auf morgen verändert hatte. In wenigen Details nur, ausreichend, um ihn auf diese Jagd zu zwingen, von der er nicht wusste, nicht wissen konnte, wohin sie ihn führen würde. Was er finden würde. Oder nicht. Ganz am Ende der Traumsequenz blitzte eines Nachts ein Name an einer der Wände des Gewölbes auf. Weniger als eine Sekunde lang. Von da an wiederholte sich diese kaum wahrnehmbare Ergänzung Nacht für Nacht. Es dauerte lange, eigentlich seinem Unterbewusstsein gelang, diesen Namen aus der Traumwelt in die Realität zu transferieren. Oh ja, er kannte diesen Namen. Sehr gut sogar. Ohne zu wissen, ob er sich mit einer real existierenden Person verbinden ließe. Sicher, es gab viele Erwähnungen dieses Namens. Waren das alles Auswüchse kranker Geister? Erfindungen? Oder steckte ein Körnchen Wahrheit dahinter? Ihm blieb keine andere Wahl. Er musste es herausfinden, sonst würde er keine Ruhe mehr finden. SEMYAZZA – das war der Name. Den uralten Überlieferungen zufolge der Oberste der gefallenen Engel, die sich vor Äonen gegen Gott auflehnten und infolgedessen aus dem Himmel verbannt wurden. Bei dem stillen Beobachter konnte es sich nur um diesen Semyazza handeln, der die seltsame Gestalt zur Zerstörung der Tafel zwang. Wer mochte diese Gestalt sein? Es konnte kein Gleichrangiger sein, sonst hätte der ausgeübte Zwang keinerlei Wirkung entfaltet. Der Regen trommelte sein Stakkato gegen die dünne Plane, die er sich über Kopf und Schultern gezogen hatte. In ständig kürzer werdenden Abständen fuhren weißglühende, vielfach verästelte Blitze durch die Nacht. Wie die unheilverkündenden Vorboten des Jüngsten Gerichts. Unmittelbar gefolgt von halllenden Donnerschlägen, die sich an den steilen Felswänden der gewaltigen Schlucht brachen und dadurch noch ohrenbetäubender wirkten. Nicht der beste Ort, um ein derartig heftiges Gewitter auszusitzen. Seit Stunden schwoll der sonst geruhsam dahinfließende Verdon immer mehr an. Das rasend schnell steigende Wasser würde bald seinen Standort auf halber Höhe der Schlucht erreichen und ihn ernsthaft gefährden. Höchste Zeit für einen Ortswechsel. Da! Was war das? Irgendetwas Rotes trieb im schäumenden Wasser. Der nächste Blitz suggerierte ihm, dass es menschlicher Kopf sein müsse. Er beugte sich vor. Fast zu weit. Dann atmete er erleichtert auf. Ein halb zerfetzter rot-blauer Rucksack, der einem leichtsinnigen Wanderer vom Rücken gerutscht sein mochte. Der heftige Wind trieb ihm den eiskalten Regen waagrecht ins Gesicht, während der Himmel in einem dunkel-düsteren Graublau mit dem Horizont verschmolz. Trotz der angeblich absolut wasserdichten Plane war er nach wenigen Minuten vollkommen durchnässt. Seit Jahren war er auf der Suche und hatte bisher nichts gefunden. Auf einen ersten ernstzunehmenden Hinweis war er in dem alten walisischen Buch Carmarthen gestoßen. Darin wurden Steine mit seltsamen Zeichen erwähnt, wie sie niemand zuvor gesehen hatte. Allerdings endete diese Spur dort, wo sie angefangen hatte. Am Ende des Buches konnte er keine weiterführenden Informationen finden. Es schien, dass der oder die Autoren diese Steine nicht selbst gesehen hatten, sondern nur davon gehört haben mochten. Dennoch war er felsenfest überzeugt, dass er keinem Phantom nachjagte. Dieser wiederkehrende Traum und vor allem dieser Name – SEMYAZZA – sagte ihm, dass das, wonach er suchte, existiert. In unzähligen Kulturen hatten sich ähnliche Legenden manifestiert und waren zu einem festen Bestandteil der Geschichte geworden. Die Menschen glaubten daran. Oder waren zumindest nicht abgeneigt, es zu glauben. Selbst wenn kaum jemand etwas darüber wusste. Die seit knapp zweitausend Jahren aufstrebende neue Religion und ihre Führer hatten es trefflich verstanden, dem einfachen Volk einzureden, dass Satan real existiere. Sie hatten die Menschen gleichzeitig davon überzeugt, dass es dessen größte Leistung sei, sie glauben zu machen, dass er nicht real und eine Erfindung der Religionsführer sei. Wer dieses umfassende Credo ernsthaft anzweifelte, wurde als Gegner der neuen Religion betrachtet. Als Ketzer. Und was diese Kirche mit Ketzern machte, war aus der unmenschlichen Geschichte dieser Religion sattsam bekannt. In der verqueren Logik der Kleriker musste es einen Gegenspieler des einen Gottes geben, denn ohne einen solchen würde das Kartenhaus der Kirche und damit die Macht der Päpste in sich zusammenfallen. Mit einfachen Worten ausgedrückt - es konnte ohne die Hölle keinen Himmel geben. Er war sicher, dass es zu jeder Zeit einige Wenige gegeben hatte und bis heute gab, die die Wahrheit kannten. Die reine Wahrheit, die die reale Existenz dieser unheiligen Kreaturen bestätigte. Und er war kurz davor, diese Wahrheit aufzudecken. Nicht dass er wusste, wer oder was diese Kreaturen waren. Er war nicht einmal sicher, ob er es wissen wollte. Nicht um mit dieser Wahrheit hausieren zu gehen und sich lächerlich zu machen. Sollten die Menschen weiterhin glauben, was sie wollten. Das interessierte ihn nicht im Geringsten. Er wollte versuchen, seinen persönlichen Vorteil daraus ziehen. Nicht mehr und nicht weniger. Wie und in welcher Form das sein würde, wusste er zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Nicht, ob das möglich war. Das war irrelevant. Zuerst musste seine Suche erfolgreich sein. Dann würde sich alles Weitere ergeben. Sobald er das erste Puzzleteil in Händen hielt. Das erste Fragment. Dieser Moment schien unmittelbar bevorzustehen. Sofern nicht alle seine gesammelten Informationen Makulatur waren. Hier in dieser urtümlichen Gegend, in einer längst in Vergessenheit geratenen ehemaligen Mönchsklause, hatte er einen Hinweis gefunden, den er als ersten für echt hielt. An der rückwärtigen Felswand dieser Klause, die vor langer Zeit einem Eremiten als Zuflucht gedient haben mochte, entdeckte er seltsame Schriftzeichen, von denen er zunächst nicht wusste, woher sie stammten. Von welcher Kultur sie entwickelt worden oder wie alt sie waren. Und nicht, wer diese Zeichen hier hinterlassen hatte. Älter als alles, was er bisher gesehen hatte. Bald wusste er, dass es sich um Zeichen aus dem thebanischen Alphabet, dem so genannten Hexenalphabet, handeln musste. Und das Beste – er konnte sie entziffern. Flüssig lesen konnte er sie nicht, das wäre übertrieben, doch mit einiger Mühe hatte er die uralten Zeichen entschlüsselt.
Es ragt ein altes Gemäuer hervor aus Waldesnacht, Es liegen im kühlen Grunde behauene Steine gereiht Dort schlummern die Frommen. Die Starken, die Mächt'gen der alten Zeit.
Es ragt ein altes Gemäuer hervor aus Waldesnacht, Es liegen im kühlen Grunde behauene Steine gereiht Dort schlummern die Frommen. Die Starken, die Mächt'gen der alten Zeit.Die Schriftzeichen waren nicht völlig identisch mit dem thebanischen Alphabet. Sie schienen älter zu sein. Nachdem er tagelang über diesen Zeichen gebrütet hatte, glaubte er, sie entziffert zu haben. Zumindest soweit, dass sich ein Sinn ergab. Wenn er diesen auch noch nicht verstand. Nach umfassenden Recherchen war er auf ein Kloster in der Dordogne gestoßen. Älter als jede andere, bekannte Anlage dieser Art. Nicht die Gebäude des Klosters. Diese waren kaum älter als tausend oder ein paar Jahre mehr. Und alle mehr oder weniger zerfallen. Zumindest kurz davor, dies zu tun. Was er suchte, musste sich unter den ältesten Mauern des Klosters befinden. Er hatte herausgefunden, dass die Kapelle innerhalb dieser heiligen Mauern, die vor ihm im Dunkeln lagen, ein Geheimnis bergen mussten. Von dem die wenigen Mönche, die hier ihr abgeschiedenes Dasein fristeten, mit Sicherheit nicht ahnten, dass es existierte. Nicht einmal der ehrwürdige Abt, der über alles informiert sein sollte, was in seinem Kloster vor sich ging oder welche dunklen Geheimnisse sich dort verbargen. Einer der Mönche müsste seinen Nachforschungen zufolge davon wissen. Der zu denen gehörte, die seit Jahrtausenden über diese Informationen wachten. Deren einzige Aufgabe es war zu verhindern, dass Außenstehende davon erfuhren. Welcher der Mönche das war, hatte er noch nicht herausgefunden. Das würde kein Problem sein. Bei sieben verbliebenen Brüdern. Zudem sollte diese Person an ihrer Ausstrahlung zu erkennen sein. Den Abt zählte er nicht dazu. Er hatte erst vor wenigen Jahren sein hohes Amt übernommen und konnte somit kaum zu denen gehören, die über die Existenz derer informiert sein konnte, die er bei sich als die Wächter bezeichnete. Ohne zu ahnen, dass diese sich so nannten. Den Abt musste er davon überzeugen, ihm ungehinderten Zugang zur Klosterbibliothek zu gewähren. Leise machte er sich auf den Weg zu dem zerfallenen Portal in der massiven Mauer aus grob behauenen Feldsteinen, die unzählige Jahrhunderte gesehen hatten. Dennoch waren sie nicht das Älteste in dieser heiligen Anlage. Auf der Suche nach vorchristlichen Artefakten, die in Wirklichkeit solche dieser uralten Wesen waren, hatte er bereits die halbe Welt bereist. Noch immer konnte er nicht mit letzter Sicherheit sagen, ob es diese Wesen jemals gegeben hatte oder ob diese nur einer der vielen Legenden entsprangen, die es dazu in allen Kulturen gab. Mit absoluter Sicherheit waren es keine Engel, auch keine Gefallenen. Egal, was immer die Bibel in dieser Hinsicht verbreiten mochte. Wobei selbst in diesem Sammelsurium von Geschichten, Legenden und Sagen erwähnt wurde, dass es zu dieser Zeit Riesen auf der Erde gegeben habe, die die Söhne von Engeln und Menschenfrauen gewesen seien. Dass Engel, nach allem, was man annahm, geschlechtsneutral waren und sich somit nicht auf herkömmlichem Weg fortpflanzen konnten, wurde in der Bibel unterschlagen. Offensichtlich hatten diese mysteriösen Wesen einen Weg gefunden, sich mit menschlichen Frauen zu paaren. Daraus entstanden dann diese ebenso mysteriösen Riesen. Reale Geschöpfe – wenn man das alles glaubte. Und einer dieser Riesen hatte der Legende zufolge diese Tafel erschaffen. Der Name desjenigen wurde nirgendwo erwähnt, vielleicht hatte er keinen gehabt. Auf dieser Tafel waren angeblich die Namen der Väter dieser Riesen verewigt worden. Zu welchem Zweck war ebenso unbekannt. Ob die Tafel, wenn sie je existiert hatte, irgendwelche besonderen Kräfte aufwies, die auf den Entdecker übergehen würden – wer konnte das wissen? Er suchte nach den Bruchstücken dieser legendären Tafel, auf die er während seiner bisherigen Nachforschungen gestoßen war. Nein, zuerst eher nach Hinweisen, wo diese Bruchstücke verborgen sein könnten. Ein namenloser Riese hatte, der Legende nach, die tatsächlichen Namen seiner Erzeuger, die als Egrigoroi bekannt sind, auf dieser Tafel hinterlassen. Und damit die vage Möglichkeit geschaffen, diese in irgendeiner Form anzurufen oder beschwören zu können. Oder Anderes damit anzustellen. Die Sage und ebenso sein Traum endeten beide mit der erzwungenen Zerstörung der Tafel durch ihren Erschaffer und der Verteilung der Fragmente auf der ganzen Welt. Manche gingen davon aus, dass es ein Nachkomme des höchsten der Egrigoroi gewesen sein musste, der diese Tafel geschaffen hatte. Dem sein Erzeuger diese Namen anvertraut hatte. In einem Anfall von Schwachsinn. Kein anderer konnte die Namen aller anderen Egrigoroi kennen.
L’ Abbaye Nouvelle, Frankreich
Im französischen Kernland war es ihm gelungen, eine erste wirkliche Spur zu entdecken. Mühelos konnte er den ehrwürdigen Abt davon überzeugen, ihm den Zugang zu der Klosterbibliothek zu gewähren. Ohne zu erwähnen, dass er auf der Suche nach derartigen Artefakten war. Der Abt hätte ihm und jedem anderen, der es wagte, diese unheiligen Gegenstände zu erwähnen, auf dem schnellsten Weg die Tür gewiesen. Die Zusage einer nennenswerten Spende, ausschließlich zu Händen des Abtes, verlieh seinem Ansinnen zusätzliches Gewicht. Abgesehen davon, dass er nicht die Absicht hatte, dem Abt eine Spende zukommen zu lassen, war er nicht in der Lage dazu. Eine Bibliothek, die man, angesichts der relativen Bedeutungslosigkeit des Klosters, nur beeindruckend nennen konnte. Selbst der Abt wusste nicht mit Sicherheit, welche Schätze die Sammlung enthielt. Zumindest waren die brüchigen Pergamentrollen, verstaubten Folianten und anderen Schriften zu einem maßgeblichen Teil alphabetisch geordnet. Soweit der jeweilige Verfasser bekannt war. Von einer kompletten Katalogisierung konnte dennoch nicht Rede sein. Für diese zeitraubende Tätigkeit hatte den frommen Brüdern in den Jahrhunderten, in denen das Kloster bestand, die Zeit gefehlt. Er war sich im Klaren darüber, dass er einer vagen Idee hinterherjagte. Das war irrelevant und störte ihn nicht im Geringsten. Die meisten Legenden enthielten einen wahren Kern. Er musste diese Tafel haben! Um jeden Preis! Ob er je alle Fragmente finden würde? Ob er es schaffen würde, das Artefakt der gefallenen Engel zu rekonstruieren? Nahezu rund um die Uhr hatte er in der Bibliothek, recherchiert, geforscht und nach längerer Zeit gefunden, was er gesucht hatte. Einen uralten Plan der ursprünglichen, vorchristlichen Anlage, bedeutend älter als das Kloster. Darauf war eine Krypta eingezeichnet, deren Zugang sich, dem Plan zufolge, in der Kapelle befinden musste. Hier war mehr Diskretion geboten. Es war nicht so, dass ständig einer der Mönche in der Kapelle gewesen wäre. Das Risiko, dass überraschend einer der frommen Brüder auftauchen würde, war nicht zu unterschätzen. Er musste sich auf die Stunden nach der Komplet beschränken, um den Eingang zu suchen. Natürlich durfte er nicht beliebig Löcher in die Wände schlagen, das würde in kürzester Zeit entdeckt werden. Bis er den Zugang gefunden hatte, musste er die Kapelle mindestens eine Stunde vor der Prim verlassen haben. Fünf, maximal sechs Stunden blieben ihm für die Suche pro Nacht. Dabei war es so einfach, wie er im Nachhinein feststellte. Der Eingang zum Gewölbe befand sich unter dem Altar. Eine unscheinbare Steinplatte tarnte den Zugang. Die allerdings war absolut fugenlos in den Boden eingepasst. Ein Zufall brachte ihn auf diese Spur. Eines Nachts lehnte er sich an den Altar und bemerkte, dass sich der schwere Steinblock bewegen ließ. Eine ausgeklügelte Mechanik erlaubte es, den kompletten Altar um einen Meter zu verschieben. Leichtgängig, wenn man den Verschlussmechanismus, der die Form einer kunstvollen Rosette hatte, um neunzig Grad drehte. Kein Rätsel im Stil von Indiana Jones, das er hätte auflösen müssen. Keine Sicherung in Form einer tödlichen Falle. Nichts. Nur diese unscheinbare Verzierung. Das Gewölbe existierte mehr als tausend Jahre nach seiner Erbauung noch immer. In bemerkenswert gutem Zustand und allen Umbaumaßnahmen, die im Lauf der Jahrhunderte ausgeführt worden waren, zum Trotz. Sechzehn Quadratmeter, geschätzt 150 Zentimeter hoch. Zu seinem Erstaunen vollkommen leer. Kein Tisch aus unbehauenen Steinen, nicht eine Nische in der Wand. Keine Halterung für eine Fackel oder einen Kienspan. Nichts. Erst im Licht seiner Taschenlampe bemerkte er einen helleren Sandstein, der nicht zu den anderen passte. Er kratzte die Fugen aus und stellte fest, dass es sich nicht um Stein handelte, sondern um eine exakt eingepasste, zehn Zentimeter dicke Steinplatte, die einen Hohlraum verbarg. Darin wieder eine flache Platte, die in die Grundmauern eingelassen war. Anderes Material. Kalkstein oder Granit. Dennoch nicht einfach herauszulösen, die umgebenden Quader aus Sandstein waren nahezu fugenlos verarbeitet worden.
Behutsam schlug er mit einem Hammer, um dessen Kopf ein Lappen gewickelt war, auf den Meißel. Mit kaum hörbaren Knirschen fuhr das dünne, rasiermesserscharfe Werkzeug aus hochverdichtetem Stahl lumpige drei Millimeter in die Fuge der Mauer aus uralten Sandsteinen. Ein weiterer Schlag. Verflucht! Tat das weh! Er hatte sich unvorsichtigerweise an der scharfen Schneide des Meißels verletzt. Der nächste Hammerschlag. Der brüchige Mörtel rieselte auf den Boden. Zentimeterweise arbeitete er sich um den ersten Stein herum. Lockerte ihn ausreichend, um ihn mit Mühe aus der Mauer herauszulösen. Er legte den gut zwanzig Kilogramm schweren Brocken neben sich auf den Boden. Der Anfang war gemacht. Alle weiteren Steine konnten leicht aus der Mauer gelöst werden. Über die Statik musste er sich keine Gedanken machen. Vier oder fünf der Quader würden diese nicht beeinträchtigen. Nach einer Stunde hatte er die umliegenden Steine entfernt. Der hellere Kalkstein war frei zugänglich. Jetzt war auch klar erkennbar, dass schwach sichtbare Zeichen eingemeißelt, eingefräst oder eingebrannt waren. Er drückte den Meißel sanft unter das Fragment. Erstaunlich leicht gelang es ihm, die etwa zwei Zentimeter dicke Platte aus der Vertiefung heraus zu nehmen.
Als er den Fund in seinem Rucksack verstauen wollte, zischte eine brüchige und dennoch scharfe Stimme direkt hinter ihm und fragte, ob er verrückt geworden sei: »Êtes-vous fou? Que faites vous ici?« Er wirbelte er herum wie von einer starken Feder getrieben und hieb dem Neuankömmling mit ungeheurer Präzision die Handkante seiner rechten Hand gegen dessen rechte Halsschlagader. Wie vom Blitz getroffen brach der Andere zusammen und blieb flach atmend auf dem Rücken liegen. Er fühlte den Puls des Bewusstlosen. Tot war er nicht und sterben würde er aller Wahrscheinlichkeit nach ebenso wenig. Gut. Es handelte sich um einen alten Mann. Genauer gesagt um Bruder Paolo, den Cellerar, der wohl an Schlaflosigkeit litt und die kaum vermeidbaren, leisen Geräusche gehört hatte.
Er zerrte den Mönch mühsam die vier Stufen in den Altarraum und legte ihn auf eine der Holzbänke. Den Altar konnte er nicht wieder in die Ausgangsposition bringen. Irgendetwas blockierte den Mechanismus. Unwichtig. Bis das geöffnete Gewölbe entdeckt würde, war er längst über alle Berge. Mitsamt dem Fragment.
Weder der Abt noch einer der sieben Mönche wusste, wer er war. Sicher kein Mörder, doch wenn es unvermeidbar wäre, würde er auch den Tod eines unerwünschten Mitwissers in Kauf nehmen. Als bedauernswerten, aber unvermeidlichen Kollateralschaden.
Ein letztes Mal prüfte er Bruder Paolos Puls. Deutlich fühlbar. Er verstaute seine Werkzeuge in seinem Rucksack und verließ die Kapelle. Lautlos huschte er zwischen den alten Grabsteinen auf den Vorplatz hinaus.
Er konnte nicht wissen, dass Bruder Paolo an einer unerkannten Stenose der litt. Der Schlag mit der Handkante gegen die Vena jugularis externa – der äußeren Halsschlagader - löste fast sofort ein thrombotisches Ereignis aus, das einen heftigen Schlaganfall zur Folge hatte. Diese führte wenige Minuten, nachdem er die Kapelle verlassen hatte, zum Tod des alten Mönchs. Er verließ das halb zerfallene Kloster und eilte zielstrebig zu seinem Wagen, einem uralten Citroën, den er auf dem Parkplatz vor der Klosteranlage abgestellt hatte. Startete ihn und fuhr zunächst auf der D673 in Richtung Pont Carral. Nach einigen Kilometern bog er auf die D6 ab und fuhr am Flüsschen Céou entlang bis zu einem Parkplatz nicht weit von Les Écuries des Chênes. Er holte das gestohlene Fragment aus dem Rucksack und bemerkte überrascht ein Kribbeln in den Fingern. Als ob Elektrizität flöße. Quatsch, sagte er sich, ein Stein kann keinen Strom leiten. Er führte es auf seine überreizten Nerven zurück. Er achtete nicht weiter darauf.
Nur wenige der eingravierten Zeichen waren zu erkennen. Wie ein mentaler Blitz fuhr es ihm durch seine Synapsen. Er erkannte die Symbole, diese absolut präzisen Piktogramme. Der Stein, den er vor Jahren in Ägypten gefunden hatte, wies dieselben Symbole auf. Damals hatte er nicht weiter darüber nachgedacht und den Stein für viel Geld verkauft. An einen dubiosen Ägypter, der sich angeblich ein Angehöriger des Geheimdienstes war. Ohne zu wissen, worum es sich handelte. Nur das Geld, die ungeheure Summe von 100.000 Dollar hatte ihn interessiert. Und doch war das der Beginn der nun seit Jahren andauernden Jagd nach den Fragmenten. Besser gesagt dieser seltsame und überaus beängstigende Traum, der ihn seit damals verfolgte.
Die Inschrift endete an der Bruchkante auf der rechten Seite des fünfundzwanzig mal achtzehn Zentimeter messenden Fragments. Es musste sich um einen Teil des Originals handeln, dessen Bruchstücke der Legende nach überall auf der Erde verteilt worden waren. Er erkannte die uralten Zeichen. Konnte sie übersetzen, wenn auch mühsam. Erneut durchfuhr es ihn wie ein Blitzschlag. Der Name, den er entzifferte, lautete AZAZEL. Einer der Engel der angeblich geschlechtlichen Verkehr mit Frauen aus dem Menschengeschlecht gepflegt hatte. Nicht nur einer der angeblich zweihundert gefallenen Engel. Einer der zwanzig Egrigoroi. Wieder spürte er das seltsame Kribbeln in den Händen. Dieses Mal merklich stärker.
Kapitel 3
Archäologische Fakultät der Universität Tübingen
Die sechsundzwanzigjährige Paula hatte sich verspätet. Sie verfluchte ihre pathologische Unpünktlichkeit und stellte sich zum wiederholten Mal die Frage, weshalb sie es selten schaffte, zu einem vereinbarten Zeitpunkt an einem konkreten Ort zu sein. Ihre langen, dunkelblonden Haare mit einem kaum zu erahnenden Stich ins Rötliche flatterten hinter ihr her wie ein Bündel fasriger Fremdkörper. Der November in diesem Jahr war überraschend mild. Die Temperaturen lagen während des Tages über dem Gefrierpunkt. Von Schneefall keine Spur. Laut Wettervorhersage würde sich das demnächst ändern, die „Experten“ fabulierten von arktischen und apokalyptischen Schneemengen.
Um nicht noch mehr Zeit zu vergeuden, hatte sie auf Mantel oder Jacke verzichtet. Ausgebleichte, ehemals schwarze Jeans mit fadenscheinigen Stellen an Knie und Oberschenkeln, die nach der Kleidersammlung riefen. Pastellfarbene Bluse, die ihre besten Zeiten hinter sich hatte. Dünner, anthrazitfarbener Pullover. Unzureichend, wie sie feststellte. Nicht passend 㼀zum weit fortgeschrittenen Jahr. Das bekannte Dilemma. Hätte Paula sich mit der Frage beschäftigt, welche Jacke angezeigt wäre, hätte sie die anstehende Vorlesung gleich streichen können. Eindeutig ein weiteres Defizit. Ihre Entschlusslosigkeit in manchen Angelegenheiten. Fröstelnd rannte sie die Wilhelmstraße entlang. Überquerte direkt vor einem zügig fahrenden Linienbus in nahezu selbstmörderischer Manier die Straße und bog nach rechts in die Silcherstraße ein. An der Osho-Meditationswiese, die direkt am teilweise verdohlten Flüsschen Ammer lag, spurtete Paula quer durch die parkartige Anlage und fragte sich, innerlich schmunzelnd, wer hier angeblich meditierte. Zweihundert Meter bis zum archäologischen Institut. Langsam ging ihr die Puste aus. Sie musste ihr Tempo reduzieren. Die sich andeutende Atemnot würde ihr ansonsten noch mehr als die bereits zehn Minuten Verspätung aufzwingen.
Zwei Jahre war sie inzwischen am Institut für naturwissenschaftliche Archäologie eingeschrieben. Selten hatte sie es geschafft, ihren chaotischen Tagesablauf so zu organisieren, dass sie rechtzeitig im Hörsaal eintraf. Dennoch war sie eine der wenigen Studierenden, die alle Vorlesungen bei Professor Bantleon besuchten. Keine einzige hatte sie bisher versäumt. Paula wollte um jeden Preis dabei sein, falls sich Bantleon eines Tages entschlösse, der Feldforschung mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Wo immer auf der Erde das sein mochte, sie würde alles dafür tun, um dabei zu sein. Wobei das Ziel einer solchen Forschungsreise mit größter Wahrscheinlichkeit nur irgendwo im ehemaligen Mesopotamien sein konnte. Bantleon war der führende Experte für die Kulturen der Babylonier und der Sumerer.
Wieder die Vermutung auf, dass der Professor genau wusste, er sie war. Nein, nicht sie selbst. Ihr Vater war es, den Bantleon mit Sicherheit kannte. Er genoss in der Welt der Archäologen und Historiker nicht den besten Ruf. Skrupelloser Scharlatan war eine wohlwollende Bezeichnung für das, was die Gilde der Altertumsforscher von ihm hielt. Grabräuber wäre die korrekte Berufsbezeichnung für ihn.㸀 Nicht dass er sich ausschließlich persönlich bereichert hätte, das nicht. Den größten Teil seiner Funde stellte ihr Vater unterschiedlichen Museen zur Verfügung. Als Geschenk und manchmal als Dauerleihgabe. Andere Funde dagegen hatte für hohe Summen an dubiose Sammler verhökert und das tat er noch immer. Als er vor acht Jahren zum letzten Mal zuhause aufgekreuzt war, hatte er Paulas dahingehenden Vorwurf nur mit einem Lachen beantwortet. Er wollte ihr einreden, dass sie stolz auf ihn sein könne. Er bezeichnete sich als eine Reinkarnation von Indiana Jones, der Artefakte gefunden habe, von denen seine akademischen Widersacher nicht geahnt hätten, dass sie existieren. Er war davon überzeugt, dass man ihm eines Tages die ihm zustehende Aufmerksamkeit zollen würde.
Sobald er das gefunden habe, wonach er seit zwei Jahrzehnten suche. Was er suchte, erwähnte er mit keinem Wort. Davon abgesehen müsse er seine kostenintensiven Expeditionen in die abgelegensten Gegenden der Erde irgendwie finanzieren.
Am selben Tag war er erneut auf zu dieser Reisen aufgebrochen. Seitdem hatte sie ihn nicht mehr gesehen. So lange war er nie zuvor weggewesen. Seiner Frau, ihrer Mutter, war das gleichgültig. Sie hatte ihr Auskommen. Solange ihr Mann kein Geld von ihr forderte, sollte er machen, was er wollte. Sie gingen beide inzwischen davon aus, dass er an irgendeinem Ort auf der Erde in einem namenlosen Grab die letzte Ruhe gefunden hatte.
Überraschenderweise berührte Paula dieser Gedanke nicht in dem Maß, wie es genau genommen sein sollte. Sie kannte ihren Vater als den Mann, der zu vereinzelten Gelegenheiten auftauchte und nach einigen Tagen wieder verschwand. Nur der alte Keller unter der Scheune füllte sich mit jedem Auftauchen ihres Vaters zunehmend mit Kisten und Kartons. Niemand wusste, was sie enthielten.
Weder Paula noch ihre Mutter hatten sich die Mühe gemacht, herauszufinden, was er dort horten mochte. Ob das alte Gerümpel, wie ihre Mutter es nannte, überhaupt einen nennenswerten Wert besaß, interessierte die beiden nicht im Geringsten.
Helmut Zahn war nicht immer der gewesen, der er jetzt war. Oder besser gesagt vor acht Jahren, als Paula ihn zum letzten Mal gesehen hatte. Vor etwa zwanzig Jahren, sie war noch ein Kind, hatte er auf einer Urlaubsreise nach Nordafrika einen seltsamen Stein entdeckt. Er hatte ihn im Gepäck außer Landes gebracht. Im Bewusstsein, dass er bei Entdeckung des Schmuggelgutes in einem orientalischen Gefängnis vermodern würde.
Der Stein war mit seltsamen Verzierungen übersät, die keinen erkennbaren Sinn ergaben. Ineinander verschlungene Linien, exakt rechteckige Formen und andere Gravuren. Paula erinnerte sich daran, dass er einen gewaltigen Wutanfall bekam, als sie ihn sich näher ansehen wollte. Ihn zwischen ihre Hände nahm und fast sofort wieder fallen ließ, weil der Stein ihr einen Stromschlag versetzt hatte. Seit diesem Urlaub war er besessen von seinem seltsamen Fund. Zuhause hatte er plötzlich die Taschen voller Geld. Paula glaubte ferner, sich daran zu erinnern, dass ihm Flugzeug ein orientalisch aussehender Mann mit ihrem Vater geredet hatte. Der Ägypter, oder was immer er gewesen sein mochte, schien die Bedeutung des Steins gekannt zu haben. Er hatte ihn ihrem Vater für eine Menge Geld abgeschwatzt. Kurze Zeit später verschwand Paulas Vater. Ohne Vorankündigung reiste er mit unbekanntem Ziel ab. Nur eine kurze Notiz hatte er hinterlassen, die besagte, dass er sich auf die Suche nach weiteren dieser Stein machen würde. Das hatte er über viele Jahre fortgesetzt. Hin und wieder war auf dem Hof aufgetaucht, meist mit einem Transporter, aus dem er allerlei Zeug in den Keller schleppte. Jedes Mal hatte er ihrer Mutter ein dickes Bündel Bargeld in die Hand gedrückt und war wieder verschwunden. Manchmal in derart exotischen Währungen, die selbst der Angestellte der örtlichen Bank nicht kannte. Dementsprechend war sein Misstrauen. Er wechselte dieses Geld erst nach Rückfrage bei der Bundesbank in Deutsche Mark um.
Auch vor acht Jahren. Damals hatte er kein Geld hinterlassen. Vielmehr machte er einen gehetzten, panischen, fast paranoiden Eindruck und verschwand sofort nach der üblichen Deponierung seiner Funde. Seitdem hatten ihn weder Paula noch Ihre Mutter wieder gesehen. Dieses Mal schien er für immer verschwunden zu sein. Nach ein paar Jahren waren sich beide sicher, dass er verschollen oder tot sein müsse. Paulas Gedanken kehrten wieder in die Realität zurück. Sie hatte ihr Ziel erreicht. Zwei Treppen nach oben und einmal links abbiegen. Sie huschte in den Hörsaal. Ein kurzer Blick durch die Reihen bestätigte ihr, dass - wie erwartet - in der ersten Reihe ausreichend Plätze frei geblieben waren. Sie war eine der Studierenden, die dort einen Sitzplatz bevorzugten. Alle anderen hatten sich so weit als möglich in die hinteren Reihen verzogen. Kaum einer wollte im Blickfeld des Professors sein. Warum auch immer. »Meine Damen und Herren, bitte!« rief Professor Walter Bantleon soeben energisch in die ansteigenden Ränge des durchschnittlich besetzten Hörsaales der archäologischen Fakultät der Uni Tübingen, »Ruhe, bitte!« Der Professor war, anders, als man es von einem Archäologen erwarten würde, keiner der typischen Vertreter seines Berufsstandes. Keine Jacke mit aufgesetzten, ledernen Flicken an den Ellbogen. Keine Hose aus Breitcord und kein kariertes Hemd. Selbstverständlich kein brauner Hut und keine Peitsche. Stattdessen eine helle Cargohose mit unzähligen Taschen an allen möglichen Stellen, von denen einige irgendetwas enthalten mussten, ausgebeult, wie sie aussahen. Ein schwarzes T-Shirt mit dem Logo von AC/DC und dem Aufdruck »Back in Black« in der typischen Schriftart der Hardrocker. Zudem sah der Mann unverschämt gut aus. Volles, dunkles Haar mit grauen Schläfen. Ebenmäßige Gesichtszüge mit kantigem Kinn und Augen undefinierbarer Farbe, die förmlich strahlten. Bantleon mochte zwischen vierzig und fünfzig Jahre alt sein und damit im besten Alter für einen Mann. Derzeit führte er eine Vorlesungsreihe durch mit dem vielsagenden Titel »Mythen der Archäologie - wie sind sie zu verstehen.« Nicht überraschend war das Interesse an diesem Thema deutlich größer als bei den eigentlichen archäologischen Vorlesungen. Die Zuhörer erwarteten eine Reihe von haarsträubenden Abenteuergeschichten. »Ich bitte Sie«, fuhr Bantleon fort, »denken Sie einfach nach. Eine steinerne Tafel, die von einem Nachkommen eines gefallenen Engels persönlich geschaffen worden sein soll? Einem Nachkommen eines ehemaligen Engelsprinzen aus der Hierarchie der Fürsten? Die … äh … eine Aufzählung der Kollegen seines Erzeugers aufweisen soll? Das glauben Sie nicht wirklich?« Paula hatte nur diese letzten Worte des Professors gehört. Ob er zuvor irgendetwas anderes gesagt hatte, konnte sie nicht wissen. Sie meldete sich sofort zu Wort. »Herr Professor, die Wesen, die Sie gefallene Engel nennen, sind, wenn ich mich nicht irre, die Engel, die gegen die geltende, göttliche Ordnung verstoßen haben. Sie haben den Überlieferungen zufolge Geheimnisse an die Menschen weitergegeben, die sie nicht hätten weitergeben dürfen, weil die Menschen nicht bereit waren, diese Dinge zu erfahren. Die darüber hinaus Geschlechtsverkehr mit menschlichen Frauen hatten. Die sich gegen Gott aufgelehnt haben. Warum sollte dieser namenlose Nachkomme nicht keine Tafel geschaffen haben? Wenn er nicht ohnehin auf der schwarzen Liste stand? Aus Rache an seinem Erzeuger?« Bantleon erinnerte sich an sie und antwortete: »Paula, ich bitte Sie. Soll ich Ihre Frage ernst nehmen? Tut mir leid, das kann ich nicht! Das meinen Sie nicht im Ernst?« Das verhaltene Lachen auf den Rängen brachte sie nicht im Geringsten aus dem Konzept. Sie setzte sich aufrechter hin und erwiderte angriffslustig: »Doch, das tue ich! Sie wissen ebenso wie ich, dass es unzählige Legenden gibt, die wir zu schnell ins Reich der Fantasie verbannt haben und es bei jeder sich bietenden Gelegenheit immer noch tun. Und das, weil sie nicht in unser Weltbild passen. Oder der herrschenden Meinung widersprechen. Dass der Nachkomme eines gefallenen Engels diese Steintafel höchstpersönlich geschaffen haben soll, nun ja, das erscheint in der Tat weit hergeholt. Was wäre denn, wenn jemand anderes der Urheber war? Einer, dem die erwähnten Geheimnisse ebenso bekannt waren?« Professor Bantleon musste ein Schmunzeln unterdrücken, als er auf diese provozierende Frage antwortete: »Paula, ich kann Ihnen nicht widersprechen. Wir wissen nicht, ob diese Tafel existiert hat oder noch existiert. Wir gehen davon aus, dass sie niemals geschaffen wurde und somit nicht existieren kann. Nicht von einem Nachkommen eines gefallenen Engels. Dass sie ein Mythos ist, der solange und oft verbreitet wurde, bis er eines Tages zur Tatsache wurde.« Bantleon hatte diese Reihe zum ersten Mal in sein Programm aufgenommen. Vor allem wegen des nachlassenden Interesses an den normalen archäologischen Vorlesungen. Was ihn nicht wunderte, denn Archäologie hatte mit den Filmen um Indiana Jones nichts zu tun. Es war 㼀tatsächlich so, dass nie ein rotes Kreuz auf einer Karte den Ort einer Entdeckung markiert hatte - genauso wie es Henry Jones jr. im ersten Film gesagt hatte. Paulas nächste Antwort beeindruckte ihn: »Herr Professor, damit legen Sie sich im weitesten Sinn darauf fest, dass es weder diese gefallenen Engel noch ihre Nachkommen je gegeben hat. Obwohl sie in der Bibel erwähnt werden und im äthiopischen Henoch-Buch, das zu den Pseudoepigraphen des Alten Testaments gehört, um genau zu sein. Die ältesten Teile stammen aus dem dritten Jahrhundert vor Christus.« »Wenn Sie das so interpretieren wollen, Paula, dann ja.« Es schien interessant zu werden. Sie bot ihm Paroli. Mal sehen, dachte er amüsiert, wie das weitergeht. Er war mehr beeindruckt. Paulas Einlassungen bestätigten, dass ernsthafte Archäologie wesentlich weniger Interessenten fand, als die verbreiteten Mythen aus diesem Fachbereich. »Lobenswert, Paula«, ergänzte er, »Sie haben sich offensichtlich mit der Thematik auseinandergesetzt. Dennoch«, fuhr er fort, »diese gefallenen Engel und deren Nachkommen werden in der Bibel an mehreren Stellen erwähnt, das ist korrekt. Hat es sie gegeben? Wir wissen es nicht!« Paula steckte nicht zurück. Keinen Millimeter wich sie von ihrer Meinung ab. »Ich zitiere Sie mit ihren eigenen Worten, Herr Professor«, erwiderte sie voller Überzeugung, »etwas nicht zu wissen, heißt nicht, dass es nicht möglich oder real ist.« »Das habe ich gesagt, ja«, brummte er, überrascht davon mit seiner eigenen Aussage konfrontiert zu werden, »etwas nicht zu wissen, heißt auch nicht, dass wir davon ausgehen dürfen, dass es real ist und wir es noch nicht entdeckt haben!« Paula gab nicht auf und widersprach: »Finden Sie nicht, Herr Professor, dass diese Sichtweise etwas zu kurz greift? Ich bin der Ansicht, dass wir davon ausgehen sollten, dass alles, was wir vorschnell ins Reich der Sagen und Legenden verweisen, wirklich existiert oder existiert hat. Jede Sage, jede Legende, vielleicht jedes Märchen, enthält einen wahren Kern. Wir haben zu beweisen, dass dem nicht so ist.« Bantleon begann dieses Streitgespräch Spaß zu machen. Seit Jahren hatte ihm niemand mehr derartig Kontra gegeben. »Paula« stellte er eine zugegebenermaßen unfaire Frage, »was ist Ihrer Meinung nach einfacher? Die Existenz von irgendetwas zu beweisen, von dem wir annehmen, dass es nicht existiert? Oder die Nicht-Existenz von irgendetwas zu beweisen, von dem wir annehmen, dass es existiert?«
Die Studentin überlegte eine Moment und antwortete: »Diese Frage ist unfair. Dennoch – beides ist ebenso schwer zu beweisen wie zu widerlegen. Sind diese Beweise immer erforderlich? Sollten wir uns nicht hin und wieder auf die Überlieferungen verlassen?« »Dann sind wir ja auf einer Linie, Paula«, schmunzelte er, dabei den zweiten Teil von Paulas Antwort ignorierend, »das beste Beispiel dafür ist, die Existenz Gottes zu beweisen oder zu widerlegen. Beides können wir nicht. An dieser Stelle greift regelmäßig der Glaube des Einzelnen. Können wir uns darauf einigen, dass wir bei diesem Thema beide Agnostiker sind? Dass wir nicht wissen, ob diese … ääh … gefallenen Engel oder ihre Nachkommen existiert haben oder nicht?« Paula antwortete nicht. Sie packte stattdessen ihre Unterlagen zusammen, erhob sich und verließ den Hörsaal. Zum ersten Mal während ihres Studiums beendete sie eine Vorlesung. Im Hinausgehen wandte sie sich um und sagte beiläufig: »Wir werden sehen, Herr Professor. Wir werden sehen!« Bantleon hatte plötzlich das überragend starke Gefühl, dass diese Auseinandersetzung, auch wenn sie im Moment rein verbal stattgefunden hatte, noch lange nicht am Ende war. Im Gegenteil, dass das erst der Anfang gewesen war. Er war tief beeindruckt von dieser Studentin, die sich getraut hatte, ihm, einem ausgewiesenen Experten, zu widersprechen. Und er hoffte, dass sich dieses Gespräch fortsetzen lassen würde. Irgendwann. Dass das in wenigen Tagen der Fall sein würde, konnte er zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen. Wie auch?
Kapitel 4
Arbeitszimmer Bantleon, Tübingen, Deutschland
Bantleons eindrucksvolle Sammlung von Single Malt Whiskys war etwas ganz Besonderes. Wie schon so oft betrachtete der Professor gedankenverloren die unzähligen Flaschen, die er im Lauf von Jahrzehnten zusammengetragen hatte. Ausschließlich von der Insel Islay. Andere Single Malts mochten in Ordnung sein, doch Bantleon war auf diese schottische Insel abonniert. Er achtete penibel darauf, sofort für Nachschub zu sorgen, wenn eine Flasche sich dem Ende zuneigte. Was nicht immer einfach war. Vor allem bei den hochwertigen Bränden. Andere Malts würde er niemals in Erwägung ziehen. Er bevorzugte die rauchigen Single-Malt-Sorten. Die kamen nun einmal fast ausschließlich von dieser Insel in den inneren Hebriden. Nicht weit entfernt von einem der weltweit größten Meeresstrudel, Corryvreckan oder auf gälisch Coire Bhreacain genannt, lag seine Lieblingsbrennerei. Dieser Strudel lag in der Meerenge zwischen den Inseln Jura und Scarba und hatte keinen Bezug zu Islay. Die Ardbeg Distillery, wo zwei seiner bevorzugten Single Malts gebrannt wurden, Ardbeg Corryvreckan und Ardbeg Uigeadal, hatte sich diesen einprägsamen Namen gesichert. Von den ehemals über zwanzig Brennereien auf der Insel waren derzeit neun aktiv. Wie immer konnte er sich nicht sofort entscheiden, welchem Malt er heute Abend den Vorzug geben sollte. Am meisten war er darauf stolz, dass es ihm vor Jahren gelungen war, eine der letzten Flaschen des hervorragenden Port Ellen Single Malts bei einer internationalen Auktion zu erwerben. Zu einem Preis, der weit jenseits von Gut und Böse lag. Der es von selbst verbot, diese Flasche jemals zu öffnen. Eigentlich. Er wusste, dass sich eines Tages ein Anlass bieten würde, dies zu tun. Dann allerdings wäre er der Einzige, der diese Rarität genießen würde. Nicht unter Androhung von Gewalt würde er diesen edlen Brand einem Gast anbieten. Jeden anderen Malt aus seiner Sammlung. Jederzeit und gerne. Nicht den Port Ellen. Wie man sich täuschen kann. Das konnte er in diesem Moment nicht ahnen. Er ließ seinen Blick erneut an der Flaschenreihe entlang wandern. Ardbeg, Bowmore, Bunnahabhain, Caol Ila, Laphroaig und andere. Er wog Pro und Contra der einzelnen Destillate gegeneinander ab und entschied sich für einen eher einfachen und unspektakulären zehnjährigen Laphroaig Cask Strength. Wie jeden Sonntagabend ein Dram, fünf Zentiliter. Mit fast achtundfünfzig Volumenprozent Alkohol hatte es der extrem rauchige Malt in sich und sollte eigentlich mit ein paar Tropfen Wasser verfeinert werden. Natürlich Wasser, das idealerweise aus derselben Quelle kommt, die auch der Brennerei als Wasserquelle diente. Leider war die Insel zweitausend Kilometer entfernt und das Leitungswasser hier in der Gegend um Tübingen zu kalkhaltig. Damit durfte man diesen Tropfen nicht verwässern. Niemals! Das würde einem ungeheuren Sakrileg gleich kommen. Blasphemie wäre das. Dann unverdünnt. Er ließ sich in den uralten, bequemen Ohrensessel sinken, den sein Vater benutzt hatte und den er vor ein paar Jahren aufwändig hatte aufarbeiten lassen. Er räkelte sich wohlig. Beschloss den Abend hier sitzend zu verbringen. Sich eventuell auch eine der Romeo et Julieta Petit Churchill Tubo zu gönnen, die er in einem Humidor aus spanischem Zedernholz aufbewahrte. Er hob das Glas an die Nase. Atmete genüsslich die komplexen Aromen nach Torfrauch, Eichentanninen und Meersalz ein. Bevor er sich an dem Laphroaig ergötzen konnte, wurde diese heilige Zeremonie vom elektronischen Gong der Türglocke unterbrochen. Ein unangenehmes Geräusch, das geeignet war, jede entspannte Stimmung zu zerstören. Nach Jahren war er nicht dazugekommen, eine andere Glocke einbauen zu lassen. »Verflucht«, schimpfte er lautlos vor sich hin und erwog einen Moment, sich tot zu stellen. Schließlich hatte auch ein Professor der Archäologie das Recht auf einen ungestörten Sonntagabend. Die natürliche Neugier des Wissenschaftlers trug den Sieg davon. Wer würde es unverschämterweise wagen ihn um diese Uhrzeit zu stören. Seufzend stellte er Nosing-Glas beiseite und legte einen ledernen Deckel über die Öffnung. Er erhob sich und machte sich grummelnd auf den Weg zur Haustür. Wieder hallte der Gong, jetzt unterstützt von einem Hämmern an die Tür. Na, jetzt schlug’s aber dreizehn! Der Störenfried wurde unverschämter!
»Ja, verdammt«, rief Bantleon erbost, »was soll denn das? Wer ist denn da?« Wieder hämmerte der bodenlose Frechling, dieser unverschämte Lümmel, an die Tür. Wesentlich ausdauernder. Bantleon öffnete die Haustür einen Spalt. Wie immer war der stabile Panzerriegel vorgelegt, der das komplette Öffnen verhinderte und ungebetene Gäste davon abhielt, gegen seinen Willen hereinzuplatzen. Vorsicht war nicht umsonst die Mutter der sprichwörtlichen Porzellankiste. Ihm war klar, dass er in dieser Hinsicht paranoid war. Er wollte nicht auf diesen zusätzlichen Schutz verzichten. Der Professor warf einen Blick durch den Türspalt. Seine Überraschung hätte nicht größer sein können. Mit Allem hätte er gerechnet, damit nicht. Draußen stand Paula, die Studentin, mit der er vor zwei Tagen dieses, zugegebenermaßen sehr interessante, Streitgespräch geführt hatte. »Paula, was fällt Ihnen ein, mich ...?«, begann er. Paula unterbrach seine Tirade und erwiderte atemlos: »Herr Professor, lassen Sie mich ein. Bitte! Ich habe etwas bei mir, das sie ganz sicher interessant finden werden. Machen Sie schon auf!«