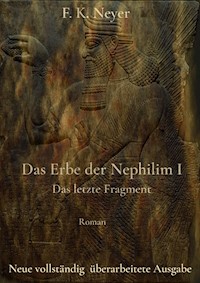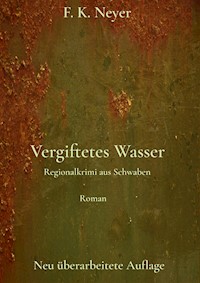
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein idyllischer See mitten im Wald. Drei Jungs und drei Mädchen verbringen dort mit Liebe, Lust und heftigem Streit den Sommer des Jahres 1977. Jahre später verschwindet eines der drei Mädchen, inzwischen eine junge Frau, spurlos. Man findet nie heraus, was geschehen ist. Das Mädchen bleibt verschwunden. Das perfekte Verbrechen ... wenn es eines war. Bis Jahrzehnte später ein leeres Fass aus dem See auftreibt. Einer der Jungs von damals erinnert sich nach all den Jahren an eine scheinbar nebensächliche Begebenheit viele Jahre nach dem wunderschönen Sommer 1977 am See. Aus den Tiefen des Sees werden zwei Leichen geborgen ... und große Mengen an hochgiftigem Müll. Kommissar Klemens Maier ermittelt in einem verwirrenden Fall. Wer ist wer ... muss er sich fragen. Kann er den oder die Täter rechtzeitig aus dem Verkehr ziehen? Das überraschende Ende des eigentlich uralten Falles zeigt dem Kommissar die Grenzen eines Ermittlers auf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
F. K. Neyer
Vergiftetes Wasser
Regionalkrimi aus Schwaben
Der Autor
F. K. Neyer wurde im Jahr 1960 in einem kleinen Dorf im Schwabenland geboren. Nach der mittleren Reife 1977 war er in unterschiedlichen Bereichen tätig. Eine Ausbildung zum Programmierer ermöglichte ihm den Einstieg in die IT. Im vorgezogenen Ruhestand erfüllte er sich 2022 einen langgehegten Wunsch und begann zu schreiben.
Das Buch
Ein idyllischer See mitten im Wald.
Drei Jungs und drei Mädchen verbringen dort mit Liebe, Lust und heftigem Streit den Sommer des Jahres 1977.
Jahre später verschwindet eines der Mädchen, inzwischen eine junge Frau, spurlos. Man findet nie heraus, was geschehen ist. Das Mädchen bleibt verschwunden.
Das perfekte Verbrechen ... wenn es eines war.
Bis Jahrzehnte später ein leeres Fass aus dem See auftreibt.
Einer der Jungs von damals erinnert sich nach all den Jahren an eine scheinbar nebensächliche Begebenheit viele Jahre nach dem wunderschönen Sommer 1977 am See.
Aus den Tiefen des Sees werden zwei Leichen geborgen ... und große Mengen an hochgiftigem Müll.
Kommissar Klemens Maier ermittelt in einem verwirrenden Fall.
Wer ist wer ... muss er sich fragen.
Kann er den oder die Täter aus dem Verkehr ziehen?
Das überraschende Ende des eigentlich uralten Falles zeigt dem Kommissar die Grenzen eines Ermittlers auf.
Impressum:
Texte: © Copyright by F. K. Neyer
Umschlaggestaltung: © Copyright by F. K. Neyer
Verlag:
Friedhelm Neyer
Hauffstraße 21/1
73084 Salach
Vertrieb:
epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1 – Die Explosion7
Kapitel 2 – Dorfleben16
Kapitel 3 - Ricks Spaziergang24
Kapitel 4 – Gelb-grüne Überraschung35
Kapitel 5 – Annabelles Besorgnis54
Kapitel 6 – Im Wellenhallenbad71
Kapitel 7 – Grillparty am See83
Kapitel 8 – Frau Dallmanns Verständnis165
Kapitel 9 – Endlich volljährig175
Kapitel 10 – Offene Kriegserklärung181
Kapitel 11 – Das Ultimatum193
Kapitel 12 – Adressen198
Kapitel 13 – Weitreichende Erklärungen202
Kapitel 14 – Erfreuliche Bankgeschäfte209
Kapitel 15 – Wohnung gesucht218
Kapitel 16 – Ein verstörender Brief …234
Kapitel 17 – Rückkehr247
Kapitel 18 - Spannung251
Kapitel 19 – Interessante Telefonate260
Kapitel 20 – Es geht wieder los …272
Kapitel 21 – München – Stadt von Welt274
Kapitel 22 – Die Immobilie320
Kapitel 23 – Johanns Rechtfertigung341
Kapitel 24 – Der erste Mord364
Kapitel 25 – Jede Menge Vorbereitungen370
Kapitel 26 - Wieder zurück …383
Kapitel 27 – Gesucht und gefunden387
Kapitel 28 – Wer war Claudia?410
Kapitel 29 – Wer ist hier wer?423
Kapitel 30 – Schweizer Angelegenheiten431
Kapitel 31 – Es wird eng ... verdammt eng434
Kapitel 32 – High Noon am Ratzenbergli440
Epilog448
Prolog
27. Oktober 1976
02:44 Uhr
Mit ohrenbetäubendem Donnern raste der Schallkegel einer gewaltigen Explosion durch die Gassen des unscheinbaren Dorfes auf der Anhöhe des Schurwalds zwischen Fils- und Remstal. Brach sich als vielfaches Echo in den schmalen Straßen und ließ die Fensterscheiben zittern. Verhallte nur langsam. Minuten später gefolgt von deutlich merkbaren Erschütterungen. Manche Scheiben zerbarsten mit silberhellem Klirren. Früher Sonntagmorgen. Die Zeit der Stille im Grunde genommen. Es dauerte, bis die Dörfler realisiert hatten, dass irgendetwas ihren verdienten Schlaf unsanft unterbrochen hatte. Licher erstrahlten in und vor den Heimen. Viele der 1.200 Einwohner rannten auf die Straße. Ahnungslos. Furchtsam. Unwissend.
Kapitel 1 – Die Explosion
27. Oktober 1976
Hölzernen Marionetten gleich, an unsichtbaren Fäden geführt, trotteten die Menschen auf den Dorfplatz vor dem Rathaus zu. Dorthin, wo seit Jahrhunderten bedeutsame Mitteilungen bekanntgegeben wurden. Bis weit in die 60er-Jahre hinein oblag diese Aufgabe einem Dorfbüttel genannten Angestellten der Gemeinde. Später wurden amtliche Bekanntmachungen und Neuigkeiten auf einer Anschlagtafel hinter Glas ausgehängt. Zwanzig Minuten nach der ohrenbetäubenden Detonation hatte sich eine bemerkenswerte Menschenmenge eingefunden. Die Menschen diskutierten über die Ursache des überlauten Knalls. Niemand hatte die Explosion überhören können. Es sei, denn er wäre stocktaub. Manche waren überzeugt, dass eine Lockheed F-104 zu nachtschlafender Stunde die Schallmauer durchbrochen hatte. Verbotenerweise zu tief fliegend. Andere waren der Ansicht, dass der Militärjet der Bundesluftwaffe, im Volksmund »Starfighter« oder »Witwenmacher« genannt, unweit des Dorfes abgestürzt und explodiert sei. Ein Überschallknall sei heftig aber nicht dermaßen dröhnend. Er grollte hinterher auch nicht nach. Die Pessimisten in der versammelten Menge waren sicher, dass aus dem seit Jahrzehnten schwelenden »Kalten Krieg« endgültig ein heißer Krieg geworden war und das Grollen von den Einschlägen der Artilleriegranaten und abgeworfenen Bomben ausgelöst worden sein müsse. Minuten später traf Bürgermeister Rasch ein. Selbst zu dieser unchristlichen Stunde untadelig gekleidet. Sofort nahm ihn die Menge in Beschlag. Der nach der langen, hitzigen Gemeinderatssitzung am vergangenen Abend unübersehbar mitgenommene Lokalpolitiker war von dem Knall ebenso aus dem Schlaf gerissen worden wie seine Bürger. Und hatte ebenfalls keine Ahnung von der Ursache. Das brachte er deutlich zum Ausdruck: »Leute!« Rief er aus voller Kehle, um sich Gehör zu verschaffen, »Leute, ich weiß genauso wenig wie ihr, was dieser Knall zu bedeuten hat. Sicher ist kein Krieg ausgebrochen. Legt euch wieder hin, morgen wird sich alles aufklären!« Gemeinderat Alfred »Doblo« Dobler, erklärter politischer Gegner des amtierenden Bürgermeisters und wenn es nach ihm ginge, dessen potentieller Nachfolger, erklärte seinen Parteifreunden soeben, dass der Bürgermeister wisse, was hinter der Sprengstoffexplosion steckte. Denn um eine solche müsse es sich gehandelt haben. Man habe ihn zum Schweigen verdonnert. Auf wessen Veranlassung das geschehen war, führte Dobler nicht weiter aus. Er habe keinen Beleg dafür. Eine andere Möglichkeit gäbe es kaum, sei der Bürgermeister seit Langem dafür bekannt, ein Meister der Vertuschung zu sein.
29. Oktober 1976
Zwei Tage später, am Dienstagvormittag, kam Wilhelm »Willi« Mardter, seines Zeichens örtlicher Jäger und Förster, außer Atem ins Rathaus gerannt und verlangte, lauthals brüllend, den Bürgermeister zu sprechen. Wäre die Sekretärin des Rathauschefs nicht reflexartig zur Seite gesprungen, hätte der massige Jäger sie rücksichtslos umgerannt. Er fuchtelte mit seinem Gewehr, einer Blaser Bockdoppelflinte F3 Competition Baronesse im Kaliber 20/76, herum als wolle er jemandem drohen. Bürgermeister Wolfgang Rasch hörte Mardters Geschrei auch, er war ja nicht taub. Riss die Tür seines Amtszimmers auf. Sein Blick fiel zuerst auf das Gewehr. Erst dann bemerkte er, wer da herumbrüllte. »Verdammt, Willi!« fuhr er ihn heftig an, »spinnst du total? Was ist los? Und leg‘, verdammt nochmal, den Schießprügel zur Seite! Du erschießt noch jemand!« »Raschle!« stieß Mardter hervor, den allgemein bekannten Spitznamen des Bürgermeisters verwendend, »Raschle, ich habe herausgefunden, was vor zwei Tagen hochgegangen ist. Du glaubst es nicht!« »Solange ich nicht weiß, was du meinst, glaube ich gar nichts. Auch dir nicht!« erwiderte Rasch fahrig. »Hör‘ zu«, rief Mardter aufgeregt, »irgendwer hat den aufgelassenen Sandsteinbruch im Kohlbachtal in die Luft gejagt. Das war kein Dummer-Jungen-Streich. Da hat jemand Ernst gemacht!« »Ernst gemacht? Womit denn? Du hast einen Vogel, Willi«, erklärte Rasch und tippte sich bedeutungsvoll mit dem Zeigefinger der rechten Hand an die Stirn, »einen Steinbruch hochjagen. Du spinnst! Das ist unmöglich.« »Es ist machbar! Ich war dort! Ich habe es gesehen!« Bürgermeister Rasch war in Termindruck. Hatte keine Zeit für Mardters Geschichten.
Denn nur um eine solche konnte es sich handeln. In einer halben Stunde hatten sich die Vertreter der Landesregierung aus Stuttgart angekündigt, die über die Zuschüsse für die Sanierung der Ortsstraßen entscheiden und diese genehmigen sollten. Oder auch nicht. Viel Geld war im Spiel. Geld, das die Gemeinde nicht hatte. Ihm war aber auch klar, dass Wilhelm Mardter kein Phantast war. Irgendetwas musste an der Sache dran sein. Wenn in seinem Dorf jemand mit Sprengstoff hantierte, Explosionen auslöste, konnte er das um keinen Preis ignorieren. Vor allem hatte er solche Umtriebe zu unterbinden. Sofort! »In Ordnung«, sagte er, »wir nehmen deinen Wagen. Zu Fuß ist es zu weit. Eigentlich habe ich keine Zeit!«
»Frau Weller«, bat er seine Sekretärin, »versuchen Sie bitte, die Idi ..., äääh, die Herren aus Stuttgart eine halbe Stunde zu vertrösten. Lassen Sie sich etwas einfallen. Irgendetwas. Ich bin so schnell ich kann zurück. Und erwähnen Sie mit keinem Wort diese Explosion! Unter keinen Umständen!« Mardter raste mit seinem alten, robusten WAS-2121, der unter dem Namen Lada Niva bekannt war, durch die engen Straßen des Dorfes. Nach zwei touchierten Hausecken und einem umgerissenen Verkehrsschild erreichten die beiden über die Forststraße nach fünfzehn Minuten den seit Jahren stillgelegten Sandsteinbruch. Sofort sah der Bürgermeister, dass Willi Mardter in keinerlei Hinsicht übertrieben hatte. Eher untertrieben. Der bisher annähernd ebene Boden unterhalb der Steilwand glich einem militärischen Übungsgelände für Bomberpiloten. Dort wo noch vor ein paar Tagen auf einer Länge von siebzig Metern der nahezu fünfzehn Meter hohe Steilhang gewesen war, türmten sich tonnenschwere Sandsteinbrocken übereinander. Als hätte sich die Faust eines Titanen an der Wand ausgetobt. Die bisherige Abbruchkante war von der Explosion um wenigstens einen Meter in Richtung Wald verschoben worden. Unzählige Bäume lagen entwurzelt und wüst durcheinander geworfen herum. Automatisch kamen Rasch die Bilder aus der steinernen Tunguska in den Sinn, wo sich Anfang des Jahrhunderts eine gigantische, bis heute ebenso unerklärliche Explosion ereignet hatte. Ein massiger Felsblock, doppelt so groß wie ein VW-Bulli, war bis auf die Zufahrt geschleudert worden. Das waren fünfzig Meter. In der Tat dachte Rasch das war kein Streich. Er erinnerte sich an die kleineren Detonationen, die man nach der Stilllegung des Steinbruchs vor ein paar Monaten eine Zeitlang gehört hatte. Es hatte sich herausgestellt, dass Jugendliche aus dem Dorf dafür verantwortlich waren. Sie hatten zufällig entdeckte Restbestände von Sprengschnüren und Zündern zur Explosion gebracht. Ohne Schaden anzurichten. Von Anfang an hatte er drei bestimmte Jungs in Verdacht, nachweisen hatte er ihnen nichts können. Hier war ein echter Sprengsatz verwendet worden. Dynamit. Möglicherweise C4 oder Semtex. Militärisches Material. Wer würde einen stillgelegten Steinbruch in die Luft sprengen? Und zu welchem Zweck? Das der Explosion folgende, weithin hörbare, Grollen und Beben war von der in sich zusammenstürzenden Steilwand ausgelöst worden. Rasch war sicher, dass ein Seismograph deutlich ausgeschlagen hätte. Der Boden des Steinbruchs, rund zehntausend Quadratmeter, war meterhoch von zerschmettertem Geröll bedeckt. »Hast du eine Idee, was das bedeutet?« fragte Mardter. »Nicht die geringste«, erklärte der Bürgermeister, »der geplante See wird dadurch sicher nicht verhindert. Falls das der Grund für die Sprengung war.« Die Kommune plante seit längerem, an der Zufahrt einen Damm aufschütten zu lassen, um auf dem Gelände des ehemaligen Steinbruchs einen See aufzustauen. Bequemer und kostengünstiger kam keine Gemeinde zu einem See.
Wofür dieser genutzt würde, stand bisher nicht fest. Als Badesee. Als Fischwasser. Sicher war, dass der See kommen würde. »Hast du die Polizei verständigt?« fragte Rasch. »Sollte ich denn?« erwiderte Mardter lauernd. »Eigentlich will ich die nicht hier haben«, sanktionierte Rasch das Versäumnis des Jägers nachträglich, »sowas regeln wir besser in Eigenregie, nicht wahr? Es ist ja niemand zu Schaden gekommen. Der Wald gehört ohnehin der Gemeinde. Dann gibt es in nächster Zeit günstiges Brennholz für die Leute.« Mardter antwortete: »Wenn einen Tag später kein Sheriff da war, kommt kein Schwanz mehr. Allerdings ...« »Allerdings ... was?« echote Rasch verständnislos. »Na, was wohl? Dobler. Der rennt seit gestern in der Gegend ’rum und verbreitet seine Gerüchte«, brummte Mardter. »Der weiß nichts!« »Wir doch auch nicht ... oder?« »Was soll das wieder heißen, Willi? Was willst du damit behaupten? Glaubst du, ich wüsste mehr?« »Nichts für ungut, Raschle. Bei euch Politikern ist Vorsicht angeraten. Ihr sagen irgendetwas und meint das Gegenteil.« »Jetzt ist Matthäi aber am Letzten«, protestierte Rasch energisch, »hab‘ ich euch irgendwann angelogen oder es versucht? Ich habe stets und ständig alles offen gelegt. Der Einzige, der mir bei jeder Gelegenheit ans Bein pinkelt, ist Dobler!« »Lassen wir das«, brummte Mardter erneut, »wir haben keine andere Wahl als herauszufinden, was hier passiert ist. Hast du irgendeine Idee?« »Warum sprengt man irgendetwas in die Luft?« fragte Rasch mehr sich selbst. »In erster Linie, um es auszuradieren, würde ich sagen«, brummte Mardter. »Was hätte man hier noch zerstören können? Den Steinbruch? Wozu? Die Maschinen und alles, was noch brauchbar war, hat Klein wegschaffen lassen. Da war nichts mehr von Wert.« »Hmm«, überlegte der Jäger halblaut, »um irgendetwas zu vertuschen?« »Was gäbe es hier zu vertuschen? Unter den abgesprengten Felsbrocken sind nur Steine.« »Um das mit letzter Sicherheit zu wissen, kämen wir nicht umhin, das ganze Geröll, wegschaffen zu lassen. Um was zu finden?« sinnierte Mardter. »Vergiss‘ es. Sieh dich doch um. Das sind gut und gern hundert Ar, die wir abräumen lassen müssten. Wer soll denn das bezahlen?« »Was erzählst du deinen Bürgern?« »Kann ich mich auf dich verlassen, Willi?« »Du weißt haargenau, dass du das kannst«, erwiderte Mardter säuerlich, »hast du eine Idee?« »Selbstredend! Ich bin nicht umsonst Politiker geworden!« erwiderte Rasch schmunzelnd, »als dieser Klein hier alles weggeschafft hat, haben seine Leute versehentlich eine Kiste Dynamit vergessen. Das Zeug schwitzt in feuchter Umgebung Nitroglycerin aus, das sich an den tiefsten Stellen sammelt. Das ist Fakt! Nitro ist hochexplosiv. Das ist alles. Ein Steinblock ist auf die Kiste gefallen und – BUMMM!« »Und wenn doch irgendetwas unter dem Geröll liegt?« »... lassen wir es einfach liegen«, erwiderte Rasch, »in spätestens einem Jahr ist hier alles überflutet. Wenn der See erstmal da ist, interessiert sich keine Sau mehr dafür.« »Bleibt Dobler«, meinte Mardter, »was machen wir mit dem?« »Dem Idioten lasse ich diese Geschichte zutragen. Unter dem Siegel der Verschwiegenheit«, sagte Rasch. Und nach einer kurzen Pause: »Und biete ihm gleichzeitig das verwilderte Grundstück am Schutterwald an, auf das er schon jahrelang scharf ist. Zu einem Preis, den er nicht ablehnen kann.« »Politik, oder?« »Nein«, widersprach der Bürgermeister, »geben und nehmen. Das ist alles.« Keiner der beiden ahnte, dass diese Idee eine Zeitbombe aktiviert hatte.
Kapitel 2 – Dorfleben
März - August 1977
Rick
Die gewaltige, alles erschütternde Detonation im alten Sandsteinbruch vor einem halben Jahr hatte das lang geplante Aufstauen des Sees nicht verhindert. Nicht einmal verzögert. Der Erddamm war Ende des Jahres 1976 fertiggestellt worden. Seit im ausgehenden Winter Tauwetter eingesetzt hatte, stieg das Wasser im neuen See permanent an. Wenn die seit sechs Wochen anhaltenden Regenfälle weiter andauerten, war der angepeilte Wasserstand wesentlich früher erreicht als ursprünglich angenommen. Der erst vor kurzem neu gegründete Angler- und Fischereiverein hatte das Gewässer vorab für 99 Jahre gepachtet. Es würde den Anglern und denen, die es werden wollten, als Fischwasser dienen. Fische hatte der Verein noch nicht eingesetzt, das würde frühestens im Herbst geschehen. Bis dahin verirrte sich mit Sicherheit kein Angler hierher. Wozu auch? Das kam uns Jugendlichen aus dem nahen Dorf verständlicherweise gelegen. Das erst kürzlich neu eröffnete Wellenhallenbad war die Attraktion in der Gemeinde. Der abgelegene See war dessen ungeachtet im noch kühlen Frühjahr der deutlich beliebtere Treffpunkt für allerlei Aktivitäten. Hier stand nicht ständig zu befürchten, dass irgendwelche Erwachsenen mit drohend erhobenem Zeigefinger und moralinsauren Kommentaren den Anstandswauwau heraushängen. Andererseits lag der See nahe genug beim Dorf, um ihn in einer Viertelstunde mit dem Fahrrad erreichen zu können. Dieter »Dietze« Weller, Peter »Pitt« Klein und ich, Frederik »Rick« Epple, hatten diese Vorteile in null Komma nichts erkannt. Wir genossen in unserem Dorf mit seinen kaum mehr als 1.200 Einwohnern nicht das, was man einen guten Ruf nennt. Wie beinahe alle Teenager. Nichts Außergewöhnliches also. Weshalb sollte uns ein zweifelhafter Ruf stören? Wir waren die, die wir waren und hatten keinerlei Veranlassung uns zu ändern. Alle Dorfbewohner kannten uns und wussten, dass wir im Grund harmlos waren. Nicht im mindesten angepasst. Aufsässig auf jeden Fall und mitunter auch rebellisch. Wann die Verhältnisse es eben erforderten - aus unserer Sicht. Vor nicht allzu langer Zeit hatte uns Raschle, eigentlich Bürgermeister Wolfgang Rasch, verdächtigt, für die im Dorf deutlich hörbaren Explosionen verantwortlich zu sein. Womit er, wenig überraschend, recht hatte. Einen Beweis für diesen Verdacht fand er nicht. Nachdem wir die zufällig gefundenen Sprengschnüre und Zünder verbraucht hatten, kehrte wieder Ruhe ein. Und Raschle grämte sich erkennbar, dass er uns nichts nachweisen konnte.
Mit sechzehn Jahren und vier Monaten war Peter Klein der jüngste von uns und - nomen est omen - mit einer Körpergröße von 170 Zentimetern der Kleinste von uns dreien. Ein bisschen kurzgeraten und schmächtig. Das schien Peter mit seiner mehr als schulterlangen, fast weißen Haarpracht, ausgleichen zu wollen. Was ihm nie recht gelang. Der Körperbau hat mit langen Haaren nichts zu tun. Pitt verwendete Fremdworte aus allen bekannten Sprachen, die er nicht annähernd begriff. Selbst für die Hauptschule war er um Welten zu merkbefreit. Eine Sonderschule - Pestalozzi-Schule hieß diese Schulform damals - wäre die bessere Wahl für ihn gewesen. Dieter »Dietze« Weller war 3 Monate älter. Zwei, drei Zentimeter größer und wesentlich bulliger gebaut. Schon als Teenager hatte er einen Stiernacken wie ein ausgewachsener Ochse. Er war extrem cholerisch und durchgehend provokant. Ein falsches Wort oder eine Bemerkung, die ihm nicht passte und er schlug zu. Hart und kompromisslos. Kam er in diesem Zustand auf jemanden zu, drängte sich automatisch der Eindruck einer außer Kontrolle geratenen, hundert Tonnen schweren Amtrak-Lokomotive auf. Seine für diese Zeit deutlich zu kurzen, dunklen und stets fettigen Haare brachte er mit Haaröl oder dem in dieser Zeit beliebten Oil of Olaz in Form. Auch das konnte niemand nachvollziehen. Er selbst fand das allerdings megacool. Behauptete er zumindest. Dabei wusste jeder, dass ihm sein Vater längere Haare einzeln mit dem Ochsenziemer[Fußnote 1] vom Kopf geprügelt hätte. Sein deutlich hörbarer Dialekt verriet noch immer, dass seine Familie vor Generationen aus dem tiefsten Niederbayern ins Schwabenland gekommen war. Ich, Frederik “Rick” Epple, war mit siebzehn Jahren und zwei Monaten der Älteste. Mit aller Bescheidenheit gesagt und ohne mir selber auf die Schulter zu klopfen, der Intelligenteste. Leider auch der Schüchternste. Aus irgendeinem Grund fehlte mir jedes Selbstbewusstsein. Ständig meinte ich, für alles Negative in meiner Umgebung verantwortlich zu sein. 177 Zentimeter groß, mittelbraune, glatte Haare bis über die Ohren und schlank. Fast schlaksig. Mit Sicherheit nicht die Figur, die ich mir gegeben hätte, wäre das möglich. Breitere Schultern und kräftigere Oberarme würde ich nicht ablehnen. Stattdessen die Nase. Das größte Manko. Im wahrsten Sinne des Wortes. Zu ausladend und zu breit. Ein Erbe meines Großvaters mütterlicherseits. Dieter und Peter standen kurz vor dem Hauptschulabschluss. Nach der einen oder anderen Ehrenrunde und anderweitigen Schwierigkeiten würden sie in diesem Jahr erfolgreich sein. Sofern ein gerade noch so erreichter Hauptschulabschluss ein Erfolg war. Sie hatten vor Wochen großspurig verkündet, nach der letzten Prüfung nicht länger zur Schule gehen zu wollen. Schulpflicht bis zum achtzehnten Lebensjahr? Interessierte sie nicht die Bohne. Die weiteren Pläne? Mehr als verschwommen. Eine Lehrstelle suchen? Ja, durchaus. Welchen Beruf erlernen? Nebulös. Sie wollten beide ab dem kommenden Sommer noch einmal die Freiheit der letzten, langen Ferien genießen und feiern, was das Zeug hielt. Ohne Rücksicht auf Verluste die Sau rauslassen. Bevor der Alltag einer zufällig am Horizont auftauchenden Lehrstelle sie endgültig ins richtige Leben katapultierte. Ich verschaffte mir meine Bildung in der 10. Klasse auf einem Gymnasium in der Kreisstadt und hatte nach einer Ehrenrunde in der neunten Klassentufe, bis zum Abitur mindestens zwei lange Sommerferien vor mir. Woraus drei werden könnten, falls die im Moment drohende, nächste Ehrenrunde meinen Zeitplan gehörig durcheinanderwirbelte. Nach dem Abitur wollte ich Archäologie studieren. Oder irgendetwas anderes. So gesehen waren meine Zukunftspläne ebenso unausgegoren wie die meiner beiden Freunde. Mit deutlich besseren Voraussetzungen. Das größte Problem war im Moment die anstehende Musterung zum Wehrdienst. Überzeugter Pazifist, der ich war, suchte ich seit langem nach einer Möglichkeit diesem hanebüchenen Quatsch zu entgehen. Wer braucht die Bundeswehr? Die Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer? Nahezu unmöglich. Die Gewissensprüfung eine schier unüberwindbare Hürde. Eines Tages kam ich auf die Idee, der Freiwilligen Feuerwehr beizutreten. Eine Verpflichtung auf zehn Jahre machten den kaum abwendbaren Wehrdienst obsolet. Nebenbei bemerkt, Feuerwehrleute waren in unserem Dorf Mangelware.
Aber genug der Vorstellungsrunde.
Der im Entstehen befindliche See im vorderen Kohlbachtal würde ideal, um im kommenden Sommer bei ansprechendem Wetter hin und wieder ein wenig ausgelassener zu feiern. Ohne die im Dorf überall präsenten Erwachsenen im Rücken zu haben. Das mit weitem Abstand größte Problem war allerdings, dass es zu wenig Mädchen in passendem Alter gab. Jüngere? Ja, das schon. Mit 13 bis 15 Jahren deutlich zu jung für ... was immer uns im Kopf herumspukte. Auch das Äußere eines Mädchens musste unseren Fantasien zumindest nahe kommen. Das schränkte die Auswahl zusätzlich ein. Zwei oder drei weibliche Wesen wohnten im Dorf, die wir der Rubrik hübsch zuordneten. Der Rest war annehmbar, höchstens aber Durchschnitt. Ein kleines Schmankerl - wie Dieter es in seinem bayerisch gefärbten schwäbisch ausdrückte - war, dass die meisten Eltern ihre Töchter, hübsch oder nicht, eindringlich vor uns langhaarigen Burschen warnten. Zwar hatte mit Ausnahme von Peter keiner von uns wirklich lange Haare. Knapp schulterlang, wie die aktuelle Mode es verlangte. In den Augen der älteren Bevölkerung war jede Frisur, die die Ohren nicht freiließ, lang. Darüber hinaus hatten wir in deren Sichtweise außer ohrenbetäubender Musik, die sie Krach nannten, Alkohol - wenn auch in Maßen - und anderen, dubiosen Beschäftigungen nichts im Hirn. Ab und zu machte ein Joint die Runde. Harte Drogen dagegen waren nie ein Thema. Natürlich gab es im Dorf ein paar Mädchen, auf die wir ein Auge geworfen hatten. Oder gern werfen wollten. So weit konnten wir unsere Augen nicht werfen. Diese Mädchen waren unerreichbar für uns. Töchter aus so genanntem gutem Haus. Die Eltern das, was man bessere Leute nannte. Um es mit Karl Marx, von dem meine beiden Freunde mit Sicherheit nicht wussten, wer er war, zu sagen, passten wir als Abkömmlinge des Proletariats nicht zu diesen Kreisen. Wie zum Donnerwetter sollten wir an die dringend benötigte weibliche Gesellschaft kommen? Eine drängende, wenn nicht die zentrale Frage, die uns ständig beschäftigte. Dessen ungeachtet es gab seit einigen Wochen andere Möglichkeiten. Einfallsreich wie wir in unserem Alter waren, verlegten wir die Jagd auf das andere Geschlecht in das erst kürzlich, mit großen Bahnhof und noch größerem TamTam neu eröffnete Wellenhallenbad. Das erste seiner Art in Baden-Württemberg. Millionen waren investiert worden. Ein unerhörter Kraftakt für ein Dorf dieser Größenordnung. Die Honoratioren wollten um jeden Preis den Status eines staatlich anerkannten Luftkurortes bekommen. Das Hallenbad wurde von Besuchern überrannt. Und wie sollte es anders sein, auch von der angepeilten Zielgruppe. An manchen Tagen schloss man bereits vormittags wegen drohender Überfüllung. Nicht für uns. Wir waren im Besitz von Dauerkarten. Nahezu täglich trieben wir uns nach der Schule dort herum. Ehrlich gesagt nie zum Schwimmen. Den normalen Eintrittspreis von einer Mark fünfzig für drei Stunden hätte unser Taschengeld zwei oder dreimal hergegeben. Wenn es den Förderverein nicht gegeben hätte. Nahezu alle Dorfbewohner waren bei Baubeginn diesem Verein beigetreten und erhielten für ihren monatlichen Beitrag von zehn Mark in den ersten 24 Monaten nach Eröffnung kostenlose Familiendauerkarten. Ein Problem weniger. Wir legten uns ständig mit dem Bademeister an. Walter Freitag hatte seine liebe Not damit, uns einigermaßen unter Kontrolle zu halten. Was ihm, ehrlich gesagt, nie gelang. Wir waren zu schnell für ihn. Normale Badegäste wären nach wenigen Tagen mit einem, vermutlich lebenslangen, Hausverbot belegt worden. Dauerkarte war Dauerkarte. Wir hatten diese mit dem Mitgliedsbeitrag bereits bezahlt. Unsere rebellische und aufsässige Art blieb den immer anwesenden Mädchen nicht verborgen. So ergaben sich im Lauf der Zeit eine Reihe von Kontakte, die man ausbaufähig nennen konnte. Sobald wir den Wohnort eines Mädchens herausgefunden hatten. Das war problemlos. Und Voraussetzung für einen näheren Kontakt. Lange bevor es die sozialen Medien gab, reichte die Frage nach der Adresse aus. Die meisten Mädchen waren einer Freundschaft, dem, was man damals »miteinander gehen« nannte, nicht abgeneigt. Sich mit Mädchen zu verabreden, die aus weiter entfernten Orten kamen, war von vorneherein sinnlos. Ebenso wie wir hätten diese, Interesse an einem von uns unterstellt, dasselbe Problem mit der Entfernung zwischen unseren Wohnorten. Dessen ungeachtet war hin und wieder ein Mädchen dabei, das zumindest für die Dauer ihres Aufenthalts im Wellenbad - sagen wir - sehenswert war. Was nie zu einer echten Freundschaft - heute würde man das eine Beziehung nennen - führte. Wie auch?
Kapitel 3 - Ricks Spaziergang
Gegenwart
Ein Wetter, das man aus dem ewigen Kalender verbannen muss. Wegen totaler Unbrauchbarkeit. Kaum Sonne. Dennoch 16 Grad Celsius. Dafür umso mehr Wolken, die für die behagliche Temperatur verantwortlich sind. Dazwischen kurze, aber sehr heftige Regenschauer. Und Wind. Dessen ungeachtet hat diese Wetterlage keinerlei Bedeutung. Nicht für Frederik »Rick« Epple. Nicht das schlechteste Wetter hält ihn davon ab jeden Tag mindestens zwei Stunden an der frischen Luft zu verbringen. Oft mehr. Außer, was man nicht betonen muss, seiner besseren Hälfte. Gottfried rennt, glühend vor Begeisterung, hin und her und lässt manchmal ein leises »Wuff« hören, wenn er irgendetwas, vermeintlich Aufschlussreiches, entdeckt. Aufschlussreich für einen Retriever. Einem mit leuchtend goldener Färbung, um genau zu sein. Golden Retriever eben. Er fragt sich oft, ob der Hund je müde wird. Er hat ihm diesen Namen gegeben, weil er ihn an einen Gottfried erinnert. Die meisten Leute im Dorf bezeichnen Rick als stattliche Erscheinung. Er selbst sieht sich als ein wenig übergewichtig an. Obwohl er sich zu seiner eigenen Beruhigung sagt, dass Übergewicht nicht existiert. Allerhöchstens Untergröße. Diesem Credo folgend hat er sich damit abgefunden, dass er 10 bis 15 Zentimeter zu klein ist. Heute mehr, morgen weniger. Menschen in seinem Alter wachsen nun mal nicht mehr. Zumindest nicht in die Höhe. Das ist eben sein Schicksal, dem er nicht entgehen und das er nicht ändern kann. Das bodenständige, schwäbische Essen ist alles andere als kompatibel zu der Figur, die er gerne hätte. Seine schneeweißen, schulterlangen Haare, generell zu einem Pferdeschwanz zusammengefasst, sind sein Markenzeichen. Sie machen ihn einmalig, unverwechselbar und harmonieren perfekt mit seiner, bei Wind und Wetter gegerbten Haut. Seine Ehefrau hatte ihn »nemme ganz bacha« genannt, als er ihr vor einigen Jahren kundgetan hatte, ab sofort jeden Friseur zu boykottieren. Dass er es höchstenfalls zulassen will, dass sie seine Frisur ab und zu in Form bringt. Ihr nahezu perfekt schwäbisches »nemme ganz bacha« kann dennoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie auch nach über 40 Jahren im Schwabenland keine Schwäbin ist und das auch nicht mehr werden kann. Ursprünglich kommt sie aus der Gegend um Hannover, versteht mittlerweile aber nahezu jedes Wort. Bei dem kruden Schwäbisch das man auf der Schwäbischen Alb zu hören bekommt, muss sie passen. Damit hat selbst ein geborener Schwabe wie Rick seine Probleme. Echtes Schwäbisch kann niemand lernen㼀. Es ist angeboren oder eben nicht. Seine sechzig Jahre sieht man ihm nicht an. Er geht jederzeit als gut erhaltener Fünfziger durch. Vorteilhafte Entwicklungen finanzieller Art haben es ihm erlaubt, mit Mitte fünfzig das aktive Erwerbsleben an den sprichwörtlichen Nagel zu hängen und als Privatier das zu tun, was ihm Spaß macht. Und alles andere zu lassen. Nun ja, nicht in Wirklichkeit. Wie jeder verheiratete Mann weiß, entspricht das in keiner Weise den Tatsachen. Signifikante Entscheidungen treffen die Frauen. Immer. Das gilt genauso für ihn. Ist eine solche Entscheidung gefallen, kann man als Mann zustimmen, oder eben kleinere und manchmal auch größere Auseinandersetzungen riskieren. Bis zu seinem Ausstieg aus dem Berufsleben vor einigen Jahren war er, ein anerkannter IT-Spezialist, bei einem der größten deutschen Systemhäuser angestellt. Seine ehemals anspruchsvolle Tätigkeit als Systemprogrammierer war im Lauf der Jahre zum Telefondienst mutiert, den ein Angelernter ohne Probleme erledigen konnte. Jahrelanger Ärger am Arbeitsplatz. Die mehr und immer rascher zunehmende Ignoranz der Führungskräfte, die immer jünger wurden und vieles mehr, hatten ihn bewogen, einen Aufhebungsvertrag zu akzeptieren. Gegen eine großzügige Abfindung im mittleren sechsstelligen Bereich hatte er seinen Posten geräumt. Nicht ungern. Nach Rücksprache mit Belle und einer sorgfältigen Abwägung der Vor- und Nachteile. Vor allem hinsichtlich der steuerlichen Gestaltung. Ach ja, Belle. Eigentlich Annabelle. Ein wunderschöner, wie Musik klingender Name. Ricks und ohne jeden Zweifel die allerbeste Ehefrau, die ein Mann finden kann. 43 Jahre sind sie zusammen, davon knapp 40 Jahre verheiratet. Es bedarf keiner speziellen Erwähnung, dass sie glücklich miteinander sind. Von der einen oder anderen kleineren Auseinandersetzung abgesehen, die zu beider Zufriedenheit aus der Welt geschafft wurde. Ohne jemals zu einem richtigen Streit zu werden. Seit diesem einen Tag, an dem sie sich zum ersten Mal begegnet waren und sich sofort ineinander verliebt hatten. Der beste Tag seines ganzen Lebens. Ein Besserer würde unter Garantie nicht mehr kommen. Nicht in diesem Leben und in einem nächsten ohnehin nicht.
Rick plant, zu der am vorderen Ende des Kohlbachtales liegenden, so genannten Börtlinger Sägemühle zu wandern. Vor Jahrzehnten schon war dort der letzte Baumstamm gesägt worden. Inzwischen ist das Anwesen ein rentabel arbeitender landwirtschaftlicher Betrieb. Ein sanft abfallender Weg durch einen Mischwald mit altem Baumbestand führt zu seinem Ziel. Rechts der schmalen Straße sind in den letzten Jahren viele neue Häuser gebaut worden. Rick versteht bis heute nicht, wie jemand auf die Idee kommt, an derart exponierter Stelle zu bauen. Zugegeben, die Aussicht mit weitem Blick bis zu den Hügeln der schwäbischen Alb ist phänomenal und unverbaubar. Die Alten im Dorf wissen indessen, dass der ganze Hang instabil ist und zusätzliche Bebauung an oder über der Kante den Druck auf den Boden erhöht. Solange bis sich alles in Bewegung setzt und die Verantwortlichen, wie üblich, von nichts gewusst haben und mit tiefster Betroffenheit von einer unvorhersehbaren Katastrophe redeten. Mensch Epple, fragt er sich in diesem Moment, was geht dich das überhaupt an. Weshalb soll ich mich mit den Problemen anderer Leute befassen? Ihn plagt seit einiger Zeit ein eigenes Problem. Eines, das er zwar nicht als drängend betrachtet, das ihm gleichwohl zu schaffen macht. Wenn er es bisher auch erfolgreich vor seiner Umgebung verbergen kann. Glaubt er. Diese verdammte Vergesslichkeit. Bis heute sind es ausschließlich Nebensächlichkeiten, die er übersieht, wie er es verharmlosend nennt. Wenn sich das auch in Zukunft darauf beschränkt, kann er damit umgehen. Panische Angst hat Rick vor einer Diagnose, die ihm Demenz oder Alzheimer bescheinigen würde. Sollte eine derartige Diagnose gestellt werden, weiß er nicht, wie er das verkraften würde. Ob Belle irgendetwas ahnt oder sogar davon weiß, fragt er sich immer öfter und ist zugleich sicher, dass es so sein muss. In all den Jahren hat er nie irgendetwas vor ihr verbergen können. An diesem Tag hat er sich für anthrazitfarbene Cargohosen entschieden. Ein farblich passendes, helleres Hemd aus dünnem Flanellstoff sowie eine kurzärmelige Fotografenjacke in derselben Farbe wie die Hose. Das Flanellhemd ist fast zu warm. Cargohose und Jacke aus dem robusten G1000-Material. Wasserabweisend und nahezu unverwüstlich. Ricks größtes Dilemma heute war die Auswahl des Hutes gewesen. Ohne Hut trifft man ihn nur selten außerhalb des Hauses an. Welchen nehmen? Den waschechten texanischen Stetson, den er vor Jahrzehnten einem echten Cowboy für eine Menge Geld abgeschwatzt hatte. In einem Kaff im Norden von Texas namens Orogrande, nicht weit von El Paso. Genauso sieht der Hut aus. Der Geruch ist atemberaubend. Belle hat ihm unmissverständlich verboten, ihn ins Haus zu bringen. Dennoch hütet er den Stetson wie einen dritten Augapfel. Den kann man nicht in einem Geschäft kaufen. Oder den Sundowner aus dem strapazierfähigen Leder eines Kängurus, den er im australischen Outback entdeckt und gekauft hatte. Neu. In einem winzigen Laden in Tennant Creek in den Northern Territories. Letzten Endes entscheidet er sich für den Sundowner. Bei dem unbeständigen Wetter sicher die bessere Wahl. Ein dicker Stock aus knotigem Eichenholz vervollständigt sein Erscheinungsbild. So kennen ihn seine Dörfler seit Jahrzehnten. Er ist nur »dr Epple«. Seinen Vornamen kennt, außer Belle und ihm, kaum jemand. Abgesehen von ein paar Jahren in der Kreisstadt, hat er sein ganzes Leben in dem kleinen Dorf zwischen Fils- und Remstal verbracht. Zusammen mit Annabelle. Hier soll man ihn eines hoffentlich noch sehr fernen Tages begraben. Viele traumhafte Erinnerungen sind untrennbar mit dem Dorf verbunden. Ein paar Unerfreuliche ebenso. Im Grund ist Rick das Kind geblieben, das er als Junge war. Störrisch und voller Tatendrang. Rebellisch und manchmal auch streitlustig. Zeit seines Lebens hat er es dennoch vorgezogen, seine Auseinandersetzungen mit Worten zu lösen. Nur mir Belle, seiner über alles geliebten Annabelle, würde er niemals streiten. Weil er den kleinsten Streit mit ihr nicht ertrüge, sie ihm rhetorisch haushoch überlegen ist und ihn als Psychologin ohnehin in Grund und Boden quasseln würde. Linksseitig ist die Bebauung in Wiesen und Felder übergegangen. Ein Fußball, den Kinder vergessen haben, springt ihm mit seinem rot-weißen Fünfeck-Muster ins Auge. Schmunzelnd zirkelt er den Ball in die Wiesen, bevor der Retriever ihn erwischen und zerfetzen kann. Was er zweifelsohne getan hätte. Gottfried schüttelt unwillig den Kopf und quittiert diese schreiend ungerechte, kaum zu verzeihende Untat seines Herrchens mit einem vorwurfsvollen Blick, wie ihn nur Hunde zustande bringen. Soll ich schon wieder zur Sägemühle wandern? überlegt er unentschlossen, dort bin ich erst vor einigen Tagen gewesen. Kurz hinter dem letzten Haus führt ein zugewachsener, schmaler Wirtschaftsweg nach links in die Wiesen und später in den Wald. Ohne Umschweife beschließt er, sein Ziel zu ändern und an dem vor 40 Jahren entstandenen See, der den Namen eines früheren Bürgermeisters trägt, nach dem Rechten zu sehen. Ein künstlich aufgestauter See. Den später Zugezogenen ist das nicht bekannt. Nur die Einheimischen wissen, dass dort vor Jahrzehnten ein Sandsteinbruch war. Einer der letzten in der näheren und weiteren Umgebung. Der in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts aufgeschüttete Erddamm hat auf dem Areal einen stattlichen, gut viertausend Quadratmeter großen See entstehen lassen, den der Angler- und Fischereiverein als Fischwasser nutzt. Rick betrachtet es als passives Mitglied des Vereins als seine Pflicht, dort hin und wieder nach dem Rechten zu sehen. Auch wenn ihn nie jemand dazu aufgefordert hat. Erfreut sieht er auf seinem Weg durch die Wiesen ein eingehegtes Gelände, auf dem Kühe mit ihren Kälbern grasen. Zurück zur Natur, denkt er bei sich. Um Gottfried von Dummheiten abzuhalten, die er mit Sicherheit bereits ausheckt, will Rick den Retriever an die Leine nehmen. Der hat das aufziehende Unheil gewittert und ist blitzartig im Wald verschwunden. »Komm‘ schon, Gottfried«, ruft Rick dem Hund hinterher, »du weißt, dass du an die Leine musst, wenn Weidetiere in der Nähe sind.« Der Hund weiß, was Rick von ihm erwartet, ignoriert ihn aber nicht einmal. Achselzuckend wendet er sich nach rechts. Gottfried würde zurück kommen. Irgendwann. Hat er bisher jedes Mal getan. Ein Stück weiter führt ein Trampelpfad in den Wald. Rick versucht, den schlammigen Passagen, die der letzte Regen zurückgelassen hat, auszuweichen. Der Weg endet über dem See an einer Steilwand, die vor langer Zeit noch 15 Meter tief abgefallen ist. Eine bis heute ungeklärte Explosion vor mehr als vierzig Jahren hat diese teilweise abrutschen lassen. Seitdem ist sie nur noch 10 Meter hoch. Diese Detonation wird bis zum heutigen Tag als Verkettung verhängnisvoller Umstände dargestellt. Die Dörfler sind da anderer Meinung. Die Gerüchte sind nie verstummt. Rick steht über dem See, zu dem es von dieser Stelle aus keinen direkten Zugang gibt. Nicht für jemanden, der den kaum sichtbaren Pfad nicht kennt. Seit Jahrzehnten überlässt man den Wald sich selbst. So ist im Lauf der Zeit eine urtümliche Umgebung entstanden. Umgestürzte und langsam vor sich hin modernde Bäume. Verschlammte Wasserlöcher und undurchdringliches Dornendickicht. Alles, was einen Urwald ausmacht. Nur keinen tropischen, widerhakenbewehrten Lianen und Schlingpflanzen. Kurze Orientierung, dann entdeckt er den zugewachsenen Weg und erreicht auf einem steilen Pfad bald das südliche Seeufer. Ab hier ist der Weg besser ausgebaut und begehbar. Links oben zwischen gewaltigen Sandsteinblöcken liegt der verlassene Fuchsbau, den er an diesem für immer unvergesslichen Tag vor langer Zeit seiner Belle gezeigt hat. Füchse haben sie schon damals keine entdeckt. Ein Stück darüber die auch heute noch mit dichtem, weichem Moos bewachsene Fläche am Waldrand. Dort hat er mit Belle unvergessliche Stunden erlebt. Ein Blick auf den See. Der Wasserstand ist hoch. Das Wasser schwappt bis an die Dammkrone. Lange hielt der alte Erddamm dem Wasserdruck nicht mehr. Bräche er, würde die Flutwelle gewaltig sein. Das weite Kohlbachtal würde die schlimmsten Auswirkungen verkraften. Einzig die Keller der Börtlinger Sägemühle würden überflutet. Moment mal, was dümpelt denn da auf dem Wasser? Rostig. Gelb vor Jahren. Das sehe ich mir nachher genauer an. Illegal entsorgter Abfall? Die Schutz- und Gerätehütte, in der die meisten Angler ihre Ruten, andere Utensilien und logischerweise allerlei Getränke in ausreichender Menge aufbewahren. Angler sind ein durstiges Volk. Vor allem wenn ihnen der heilige Petrus gewogen ist. Das Schloss unversehrt. Bänke und Tische unter dem Vordach in ebenso gutem Zustand. Hervorragend. Er hebt ein paar leere Flaschen auf, die womöglich 㼀Jugendliche hier zurückgelassen haben, und wirft sie in den Abfallkorb. Ein Blick über die Wasserfläche. Kann der Mönch defekt oder verstopft sein? Fließt deswegen nicht ausreichend Wasser ab? Rick macht sich auf den Weg, um die Betonkonstruktion zu überprüfen. Bevor er dort ankommt war, fegt Gottfried aus dem dichten Unterholz. Stolpert fast über seine vier Läufe. Direkt vor Rick lässt er sich auf die Seite fallen, ständig mit den Vorderpfoten über seine Augen wischend. Er winselt zum Gott erbarmen. Rick erschrickt furchtbar. So hat er den Retriever nie erlebt. Irgendetwas ist ihm in die Augen gekommen. Was kann das sein? Hier in der unberührten Natur? »Junge, was ist denn los?« murmelt Rick beruhigend und streichelt Gottfried über den Kopf, »was hast du? Sitz! Lass‘ mich sehen.« Der Hund sieht zu Rick auf. Auf der Suche nach Hilfe. Seine Augen sind rot unterlaufen und tränen extrem stark. Wieder wischt sich der Retriever mit den Pfoten über die Augen. Rick holt die Feldflasche, die er auf jeder Wanderung dabei hat, aus der Seitentasche seiner Cargohose und gießt das lauwarme Wasser großzügig über Gottfrieds Kopf. Befeuchtet sein kariertes Taschentuch und versucht, den Hund bei seinen Bemühungen zu unterstützen. Gottfried weiß, dass sein Herrchen ihm helfen will und nimmt die Pfoten zur Seite. Mehr Wasser. Jetzt direkt in die Augen. Der Retriever zuckt unwillig, hält aber still. Bald scheint das Brennen nachzulassen. Rick kommt das seltsame, gelbe Ding wieder in den Sinn, das in der Bucht auf der anderen Seeseite im Wasser treibt. Er schlendert die hundert Meter hinüber. Und erkennt sofort, worum es sich handelt. Die Erinnerung kommt wie ein vom Himmel zuckender, weiß-gelber Blitz. Die Fässer. Das Floss. Andrea und die schöne Claudia. Dietze und Pitt. Alles wieder präsent. Als ob es gestern gewesen wäre. Warum kommt dieses Fass jetzt an die Oberfläche? Und weshalb nur eines von den sechs, die wir für die
CLAUDABELLA verwendet haben?
Kapitel 4 – Gelb-grüne Überraschung
Gegenwart
Gottfried hat sich inzwischen erholt und lässt sich von Rick seine Augen untersuchen. An den Lidern bemerkt er beunruhigende Veränderungen. Hoffentlich keine Verätzungen hofft er. Zum Glück hat der Hund instinktiv die Augen geschlossen, bevor ihm etwas von ... wovon eigentlich ... die Augen verletzen kann. Erneut kühlt er die Augen des wimmernden Retrievers. Dann sagt er: »Such, Junge! Wo hast du das Zeug entdeckt?« Für Rick gibt es keinen Zweifel, dass die gesuchte Stelle am Auslauf des Sees sein muss. Untypisch für einen Golden Retriever, die Wasser lieben, ist Gottfried total wasserscheu. Seit er als Welpe in einen Gebirgsbach gefallen und beinahe ertrunken wäre, meidet er Wasser wie die Pest. Ohne Not würde er niemals ins Wasser gehen. Rick geht langsam bis zu dem sieben Meter hohen aufgeschütteten und verdichteten Erddamm. Unten ragt die Öffnung des rund zwanzig Zentimeter durchmessenden Abflussrohres heraus, durch das überschüssiges Seewasser in den Bach abfließen soll. Was derzeit nicht oder nur ungenügend der Fall ist. Sechs komplett naturbelassene, mit dicken Baumstämmen gesicherte Stufen, führen an die Basis des Damms hinunter. Bevor Rick die letzte Stufe erreicht, steigt ihm ein markanter Geruch in die Nase. So als ob eine ganze Kompanie besoffener Soldaten an eine einzige Stelle gekotzt hätten. Stechend. Säuerlich. Ungesund. Dann sieht er es. Unter dem Damm, meterweit vom Abflussrohr entfernt, sickert eine grün-gelb schillernde Flüssigkeit in Schlieren heraus. Inzwischen stinkt es bestialisch. Das Zeug, was immer es ist, hat seinen Weg durch den Damm gesucht und gefunden. Rick zieht sein Halstuch über Mund und Nase. Kann man wissen, was das Zeug in den Atemwegen anrichtet? Er sucht sich einen Ast und stochert in der dickflüssigen Brühe herum. »Verflucht!« murmelt er, »was kann das sein? Ich muss Hans informieren!« Er zieht sein Smartphone aus der Tasche, das er seit einigen Monaten ständig mit herumschleppt. Belle hat mit Nachdruck darauf bestanden, dass er sich so ein Gerät anschafft. Gegen seinen ausdrücklichen Protest. Doch wenn Belle irgendetwas will, gibt es kein Argument, das sie vom Gegenteil überzeugen kann. Für alle Fälle – hat sie gesagt. Welche Fälle sie meint, erschließt sich Rick nicht. Zunächst hat er vermutet, dass sie wissen will, wo er sich aufhält. Das ist mit diesen neumodischen Geräten ja problemlos möglich. GPS nennt sich das. Er hat diese Vermutung beschämt beiseitegeschoben. Annabelle würde ihm niemals nachspionieren. Dafür vertrauen sich die beiden gegenseitig zu sehr. Er scrollt durch das Telefonbuch und wählt den Eintrag von Hans Miklund, dem Vorsitzenden des Fischereivereins und damit demjenigen, der als erster von dieser Schweinerei erfahren muss. Nach fünfmaligem Klingeln meldet sich Miklunds Mailbox. Kurz und knackig wie von ihm gewohnt: »Hans Miklund. Ich bin im Moment nicht erreichbar. Nachricht nach dem Ton. Wenn es wichtig ist, rufe ich zurück. Wenn nicht, dann nicht! Piep!« Er hat eine seltsame Marotte. Landet ein Anrufer auf der Mailbox und verwendet nicht im ersten Satz das Wort »wichtig«, beantwortet er diesen Anruf nicht. Rick weiß das selbstverständlich: »Hans«, beginnt er, »es ist wichtig! Ich bin’s, Epple. Wenn du das abhörst, ruf‘ mich zurück! Sofort! Oder noch besser, komm‘ runter zum See. Umgehend! Hier ist irgendetwas faul. Ich warte hier auf dich. Zur Sicherheit verständige ich Polizei und Feuerwehr. Komm sofort her, Hans! Es ist wirklich wichtig.« Er beendet das Telefonat und wählt neu. Einhundertzwölf. Jetzt muss er zwingend Feuerwehr und Polizei von der Geschichte informieren. Sofort legt er wieder auf und reibt sich seine brennenden Augen. Verdammt, das brennt wie Feuer. Rick fliegt die Treppen nach oben zum See. Sein einziger Gedanke ist Wasser! Nur Wasser! Er geht am Ufer in die Hocke und schaufelt sich Unmengen des trüben Wassers ins Gesicht. Eine gefühlte Ewigkeit später lässt das Brennen nach. Er kann wieder klarer sehen. Erneut wählt er die 112. Sofort meldet sich Notrufzentrale.
»Notrufzentrale! Wie kann ich helfen?«, eine neutrale Stimme. »Hier Epple. Rick Epple. Schicken Sie Feuerwehr und Polizei an den Anglersee im Kohlbachtal. Da ist irgendetwas im Wasser, was nicht hineingehört. Giftig oder ätzend. Keine Ahnung. Das Zeug brennt wie Feuer in den Augen.« Routiniert spult die Stimme ihr Programm ab. »Was genau ist passiert? Gibt es Verletzte? Wie viele?« Wohlwissend, dass der Mann am anderen Ende nur seinen Job macht, faucht Rick genervt: »Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß nicht, wer verletzt ist oder wie viele. Außer mir und meinem Hund!« »Beruhigen Sie sich bitte!« »Ich bin ruhig«, erwidert Rick mühsam beherrscht, »es ist wirklich dringend. Auf jeden Fall muss die Feuerwehr her. Nochmals, irgendetwas Giftiges ist im See und sickert langsam heraus in den Bach.« Er weiß, dass der Mann im Hintergrund bereits alle notwendigen Maßnahmen in die Wege leitet. Das Telefonat dient der Gewinnung weiterer Informationen. »Wo genau ist das?« Als Einheimischer kennt Rick die Umgebung wie seine Westentasche und beschreibt den Weg detailliert. »Von Göppingen kommend die Bundesstraße 297 bis zur Abzweigung Adelberg / Herrenbachstausee. Landstraße 1147 bis zur Zachersmühle. Davor rechts abbiegen und vor der Steigung nach Börtlingen links in den Wald Richtung Börtlinger Sägemühle. Daran vorbei einen Kilometer auf der Forststraße weiter. Ich warte an der Zufahrt zum See. Sonst findet die niemand, ist ziemlich zugewachsen.« Rick weiß ebenso, dass die ersten Einsatzfahrzeuge während des Telefonats ausgerückt sind. Der Mann in der Leitstelle wiederholt Ricks Wegbeschreibung. Aus der Kreisstadt sind es wenig mehr als fünf Kilometer, dennoch dauert es mindestens zehn Minuten, bis als Erstes die Polizei einträfe. »Bleiben Sie bitte an Ort und Stelle, bis die Einsatzkräfte eintreffen. Man wird weitere Informationen von Ihnen erwarten.« »Ich warte am Forstweg direkt am See.« Das Brennen in Ricks Augen ist erträglich geworden und einem unangenehmen Gefühl gewichen. Als ob irgendetwas von innen 㼀gegen seine Augäpfel drückt. Ihm fällt ein, dass er auf der Forststraße warten soll, denn die Zufahrt zum See ist zugewachsen und niemand, der nicht ortskundig ist, würde sie von der Straße aus sehen können. Die Angler fahren mit dem Auto ohnehin nicht hierher. Ist nicht erlaubt. Die meisten bewahren ihre Utensilien in der Hütte am See auf. Sie nehmen alle den kurzen Weg über das Unterdorf und den »Alten Steinbruch«. In zwanzig Minuten kann jeder, der nicht unheilbar fußkrank ist, vom Dorf aus den See erreichen. Diejenigen, die von weiter her kommen, parken an der Sägemühle und gingen den einen Kilometer zu Fuß. Langsam steigt er wieder die Treppen hinunter. Aufgewühlt tigert er dort hin und her. Was mag das sein? Wie kommt es ins Wasser? Rick zerbricht sich den Kopf. Ohne jedes Ergebnis. Nein, tief in seiner Erinnerung vernimmt er ein Glöckchen. Es scheint ihn auf irgendetwas aufmerksam machen zu wollen. Etwas versucht, an die Oberfläche, in die bewussten Sektionen seines Gehirns zu kommen. Er bekommt es nicht zu fassen. Irgendetwas ist gewesen. Vor langer Zeit. Verdammt! flucht er lautlos. Die einzige Erinnerung im Zusammenhang mit dem See ist die an den Sommer 1977. Und das erstaunlich detailliert. Wie hätte er diese Zeit je vergessen können? Die ausgedehnten Aufenthalte am See. Unzählige Übernachtungen gemeinsam mit Belle, lange bevor sie geheiratet haben. Die unglaublich schönen und anregenden Nächte, die sie zusammen in ihrem Zelt verbracht hatte. Hätte im Dorf jemand davon gewusst, wäre das wochenlang Thema Nummer 1 beim Dorftratsch gewesen. Jedes Detail ist präsent, als ob alles erst gestern geschehen wäre. Ein auf- und abschwellendes Martinshorn unterbricht seine Erinnerungen. Ich muss mich später damit befassen nimmt er sich vor. Befürchtet aber, dass ihm nichts einfiele. Das Gefühl, dass hier vor einem halben Menschenalter irgendetwas geschehen ist, will nicht weichen. Dann sind sie da. Ein blau-silbern lackierter Mercedes neuester Bauart rast mit heulendem Martinshorn in einer Staubwolke heran und kommt direkt vor ihm zum Stehen. Ein Polizist springt federnd heraus. Der andere ist noch mit dem Funkgerät beschäftigt. »Epple?« ruft er. »Herr Epple, bitte«, erwidert Rick ungehalten. Er legt Wert auf gute Umgangsformen, »die Zeit muss sein. Mir wäre nicht bewusst, dass wir schon Schweine zusammen gehütet hätten. Aber ja, der bin ich.« »Meinetwegen, Herr Epple«, sagt der Polizist ruppig, »was ist hier los?« »Woher soll ich das wissen?«, antwortet Rick mit einer Gegenfrage. »Was soll das heißen?«, bellt der Beamte scharf. Dieser Kasernenhofton gefällt Rick überhaupt nicht. Warum ist der Beamte so schlecht gelaunt? fragt er sich erstaunt. Habe ich ihm den Feierabend versaut? Er macht zwei Schritte auf den Beamten zu und blafft im selben Ton zurück: »Dass ich nicht weiß, was hier los ist. So einfach ist das.« »Ganz langsam«, erwidert der Polizist. Rick hat das Gefühl, dass er am liebsten das Wort »Freundchen« dazusetzen will, »Sie haben uns verständigt, Sie müssen wissen ...« »... nein, nicht langsam«, unterbricht Rick ihn barsch, »hier läuft eine Riesensauerei. Es ist euer Job, herauszufinden, was hier passiert ist. Ich habe euch alarmiert. Der Rest ist einzig und allein euer Bier!« Der andere, deutlich ältere Polizist kommt dazu, wirft seinem Kollegen einen undefinierbaren Blick zu und sagt verhalten: »Herr Epple? Können Sie uns irgendetwas sagen? Warum haben Sie uns verständigt? Was ist hier geschehen?« Aus der Entfernung sind erneut Martinshörner zu hören. Rick kann die verschiedenen Tonlagen gut unterscheiden. Der Notarzt, gefolgt von Fahrzeugen der Feuerwehr. »Nein, leider kann ich nicht viel sagen«, erwidert Rick und weist in Richtung des Sees, »irgendetwas befindet sich im See. Gift. Vielleicht ätzend. Ich weiß es nicht. Und das sickert durch den Damm heraus. Nicht durch das Abflussrohr. Keine Ahnung, wie lange schon. Es ist eine ganze Weile her, dass ich zuletzt hier war. Das Zeug brennt wie Feuer in den Augen.« »Ääh ...«, macht der Beamte verwirrt, »das verstehe ich nicht. Wie kommt das Zeug, wie Sie es nennen, in Ihre Augen?« »Es hat eine hohe Viskosität und leuchtet in allen Farben. Es stinkt bestialisch und verdunstet oder verdampft an der Luft. So kommt es in meine Augen.« Hinter dem Streifenwagen kommen der Audi SQ5 des Notarztes und ein Kommandowagen der Feuerwehr zum Stehen. »Was ist hier passiert?« will der Kommandoführer der Feuerwehr sofort wissen. »Irgendwelche Giftstoffe im See, die heraus sickern«, erwidert der ältere Polizist. Kaum hat der Feuerwehrmann das Wort »Gift« vernommen, dreht er auf dem Absatz um, geht zu seinem Wagen und fordert den Gefahrgut-Zug aus Salach und weitere Einsatzkräfte aus der Kreisstadt an. »Hier muss die Berufsfeuerwehr ran«, erklärt er, »es dauert zu lange, bis die Kollegen der Freiwilligen verfügbar sind. Alle berufstätig. Die wenigsten an ihrem Wohnort. Zu Ihnen. Herr Epple? Richtig?« »Ja«, sagt Rick. »Ich bin Wilfried Miller«, stellt er sich vor, »was genau ist Ihnen aufgefallen?« »Endlich jemand, der klare Fragen stellt«, erwidert Rick, dem die Zielstrebigkeit Millers gefällt, »zuerst hat mein Hund etwas von dem Zeug abbekommen. Als ich gesucht habe, wo Gottfried - so heißt er - sich die Augen verletzt hat, habe ich auch etwas davon erwischt.« Miller winkt den Notarzt heran und bittet ihn, sich Ricks Augen anzusehen und bei der Gelegenheit auch die des Hundes. Der Notarzt wundert sich zwar, dass er ein Tier untersuchen soll, sagt aber nichts. »Kommen Sie bitte zu mir«, fordert er Rick auf, »mal sehen, was mit Ihren Augen ist. Haben Sie irgendwelche Beschwerden? Sehbehinderungen? Irgendetwas Außergewöhnliches?«
»Nein«, antwortet Rick, »ich sehe etwas verschwommen und spüre einen leichten Druck von innen auf die Augen. Sonst nichts.« Der Mediziner leuchtet ihm mit einer Bleistift-Lampe, in beide Augen, scheint aber nichts festzustellen, was ihn beunruhigen würde. »Eine leichte Rötung, kein Grund zur Besorgnis. Ich kann keine Verätzungen erkennen. Mir scheint, Sie haben Glück gehabt und nur wenig abbekommen. Was immer das sein mag. Gehen Sie vorsichtshalber zum Augenarzt, ich bin kein Fachmann auf diesem Gebiet. Wo ist Ihr Hund?« Rick stößt einen gellenden Pfiff aus, von dem Gottfried weiß, dass es das ultimative Kommando ist, sofort her zu kommen. Er fegt heran und setzt sich neben Rick. »Ruhig, Junge«, sagt Rick zu dem Hund und streichelt ihm über den Kopf, »lass‘ den Mann deine Augen ansehen.« Der Arzt kann sich nicht vorstellen, dass der Retriever das versteht. Das tut Gottfried auch nicht, es ist allein Ricks Stimme, auf die er reagiert. »Darf ich deine Augen sehen?«, sagt er mit leiser Stimme zu Gottfried. Der hebt den Kopf und der Mediziner leuchtet hinein. »Dasselbe wie bei Ihnen, Herr Epple«, diagnostiziert er nach einem Moment, »eine unbedeutende Reizung. Kein Anlass zur Sorge. Aber auch hier ist ein Besuch beim Tierarzt zu empfehlen. Das bin ich natürlich auch nicht.« An Gottfried gewandt: »Gut gemacht, braver Kerl!« Zwischenzeitlich hat die Feuerwehr den Forstweg in beide Richtungen abgesperrt. Vor allem wegen der Radfahrer und Wanderer, die hier ständig unterwegs sind. Eine rein präventive Maßnahme. Sicherheit geht über alles. Erst die Leute des Gefahrgut-Zuges sind in der Lage, weitere Untersuchungen anzustellen, und können herausfinden, was da aus dem See sickert.
Rick wendet sich an den Kommandanten und sagt: »Sie sollten die beiden Waldwege oberhalb des Sees absperren. Bei diesem Wetter sind sicher eine Menge Leute unterwegs. Und die kommen nicht alle über die Forststraße her.«
Miklunds Desinteresse
In halsbrecherischem, selbstmörderischem Tempo schießt in diesem Moment ein Mountain-Biker den geschotterten Forstweg aus Richtung Dorf herunter und bremst so brachial ab, dass die grobstolligen Reifen sofort blockieren. Beinahe wäre der Fahrer über den Lenker gesegelt. Rick fragt sich, wer derart rücksichtslos unterwegs ist. Erst als der Radler den Helm abnimmt und seine glänzend-spiegelnde Glatze zum Vorschein kommt, erkennt er Hans Miklund, den er vorhin angerufen hat. Und wie fast jedes Mal, wenn er ihn sieht, wird er das starke Gefühl nicht los, Miklund schon viele Jahre lang zu kennen. Obwohl das nicht sein kann. Rick kennt ihn erst, seit er vor einigen Jahren dem Verein beigetreten ist. »Zum Donnerwetter, was ist hier los, Epple?« bellt er, »was macht die Feuerwehr hier? Ist unsere Hütte abgebrannt?« Dann grinsend: »Oder ist der See ausgelaufen?« »Wenn es nur das wäre, Hans ...«, erwidert Rick. »Was soll das heißen, Epple?« »Hans, du solltest dich setzen. Es ist ... es ist kompliziert ...« Hans Miklund reagiert ungewohnt. Er zuckt zusammen, panisch. Rick hat den Eindruck, dass Miklund sich weder um die Hütte noch um den See sorgt. Irgendetwas hat ihn furchtbar erschreckt. Und er betrachtet Polizei und Feuerwehr als Bedrohung. Absolut ungewöhnlich für den bekennenden Choleriker setzt er sich auf einen Baumstamm in der Nähe und sagt gepresst aber ruhig: »Raus‘ mit der Sprache, Epple. Was ist hier los?« Der jüngere Polizist kommt zu den beiden herüber und bellt scharf: »Ich denke, das überlassen sie uns, Herr Epple! Wir werden den Herrn zu gegebener Zeit informieren!« Miklund fährt wie von der Tarantel gestochen herum und herrscht den Beamten an: »Geht mir kilometerweit am Arsch vorbei, was Sie denken! Ich will sofort wissen, was hier los ist! Haltet ihr euch da ‘raus! Das ist meine Sache!« Rick legt dem Polizisten, der zu einer geharnischten Antwort ansetzt, beschwichtigend seine Hand auf den Arm und sagt: »Lassen Sie mich das machen, bitte. Ich weiß besser, wie man Hans anpacken muss.« Unwillig nickt der Beamte. Er versteht, dass Rick einer Eskalation zuvorkommen will. In der ihm eigenen, direkten und schonungslosen Art, sagt er: »Hans, ich glaube, der See ist vergiftet!« »Wie? Vergiftet?«, erwidert Miklund verständnislos, »Spinnst du, Epple? Was redest du da für einen Stuss? Unser Wasser war immer das Sauberste in Baden-Württemberg. Und darauf sind wir stolz. Und das mit Recht. Aus dem See kann man bedenkenlos trinken. Außer den Fischen, die hinein pissen, ist nichts drin. Na ja, das Wasser natürlich.« »Ich fürchte doch, Hans«, antwortet Rick, »unter dem Damm sickert eine grün-gelbe Brühe heraus, die aus dem See kommt. Es ist nicht das Wasser, sonst trieben die Fische längst mit dem Bauch nach oben. Und das weißt du. Es muss irgendetwas sein, dass ... ich weiß nicht recht ... im See deponiert worden ist.« Miklund wird schlagartig leichenblass. Wieder hat Rick den Eindruck, dass er Polizei und Feuerwehr am liebsten wegschicken würde.
Dann faucht er: »Das will ich mit eigenen Augen sehen. So ein Blödsinn! Vergiftet! Das ist total hirnrissig! Das wird irgendeine Algenbrühe sein.« Der jüngere Polizist hat das Geschrei Miklunds gehört. Er kommt wieder zu den beiden und sagt mit Bestimmtheit: »Nein, auf keinen Fall! Sie dürfen nicht an den See. Solange nicht auszuschließen ist, dass keine unmittelbare Gefahr besteht.« Rick weiß, dass Hans mitunter cholerisch reagiert, wenn ihm jemand in die Quere kommt. Dennoch überrascht ihn dessen heftige Reaktion. »Leck‘ mich doch am Arsch! Das ist mein See und ich gehe dahin, wann es mir passt. Und du«, faucht er aufgebracht, »hältst mich bestimmt nicht davon ab! Du nicht! Kapiert?« Bevor die verfahrene Situation vollends eskaliert, sagt Rick zu dem Polizisten: »Lassen Sie ihn gehen, bitte. Ich verbürge mich dafür, dass er keinen Blödsinn macht.« »Aber das geht nicht!« »Kommen Sie. Sie haben bestimmt einen gewissen Ermessensspielraum? Der See ist für Herrn Miklund eine sehr persönliche Angelegenheit.« Der Beamte denkt nach und erwidert: »Spielraum habe ich schon. Der reicht allerdings nicht so weit, dass ich einen gesperrten Bereich für Zivilpersonen freigeben kann.« Rick kommt eine Idee. Er raunt verschwörerisch: »Unter uns Pfarrerstöchtern, sind Sie Raucher?« »Was hat denn das damit zu tun?« entgegnet der Polizist verwundert, »aber ja, ich rauche hin und wieder eine Zigarette.« »Ein Vorschlag zur Güte«, insistiert Rick, »sie gehen rauchen und schon sind wir weg. Niemand hat irgendetwas gesehen oder gehört und wenn sie ausgeraucht haben, sind wir schon wieder zurück.« Der Beamte grinst und antwortet: »Sie sind der geborene Diplomat, Herr Epple. Einverstanden. Ich geh‘ eine rauchen. Vielleicht auch zwei oder drei.« »Los, Hans«, sagt Rick sofort, »gehen wir.« Auf dem Weg, den die beiden gemächlich zurücklegen, rumort es erneut heftig in Epple. Verdammt, grübelt er, irgendetwas ist damals geschehen. Da bin ich sicher. Wenn ich nur wüsste, was ... Miklund kann er nicht fragen, ob vor vierzig Jahren am See irgendetwas passiert ist. Falls etwas vorgefallen ist und ihn die vage Erinnerung nicht in die Irre führt. Außerdem raten ihm sein sechster Sinn und die seltsame Reaktion Miklunds auf die Geschichte vehement davon ab. Hans ist um die Zeit, um die es Epple geht, zum ersten Mal im Dorf aufgetaucht. Um 1994 oder kurz darauf. Und da ist er! Der Trigger! Unerwartet beginnt sich das Räderwerk in Epples Kopf wie rasend zu drehen. Wer ist Hans? fährt es ihm durch den Kopf. Er ist seit über zwanzig Jahren im Dorf. Dennoch weiß ich nichts über ihn. Ein Freund? Nein, mein Freund ist er nicht. Ein Bekannter. Hat er überhaupt Freunde? Echte Freunde? Rick denkt darüber nach und kommt zum Schluss, dass es niemanden gibt, der Miklund als echten Freund betrachtet. Zumindest nicht im Dorf. Der See ist von der Gemeinde erbaut und bezahlt worden. Es kann keine Rede davon sein, dass es Miklunds See ist, wie er vorhin dem Polizisten gegenüber behauptet hat. Hans hat sich allerdings im Nu im Vereinsleben des Dorfes breitgemacht. Vor allem durch großzügige Geldzuwendungen. Als der Angler- und Fischereiverein um die Jahrtausendwende einen neuen Vorsitzenden suchte, hat Hans die Gelegenheit ergriffen, sich aufstellen lassen und ist gewählt worden. Ebenso bei allen folgenden Wahlen. Bis heute wird gemunkelt, dass Geld im Spiel gewesen sei. Man kann Miklund allerhand nachsagen, ein Angler ist er sicher nicht. Äußerst selten trifft man ihn am See an. Dass er je einen Fisch gefangen hätte, daran kann sich niemand erinnern. Böse Zungen vermuten, dass an seiner Angel gar kein Haken ist. Sein Interesse an diesem Verein muss andere Gründe haben. Oder genaugenommen an dessen See. Was, wenn die Gerüchte stimmen, rätselt Rick. Hans hat viel Geld in die Hand genommen, um Vorsitzender zu werden. Es kann nur um den See gehen. Weshalb? sinniert er. Was ist an diesem gewöhnlichen Gewässer Besonderes? Ricks Gedanken rasen. Wovon lebt er? Wie verdient er sein Geld? Unbekannt! Hat er Frau und Kinder? Unbekannt! Das Haus auf dem riesenhaften Grundstück muss ein Vermögen gekostet haben. Und nicht zuletzt ... der Name Miklund. Hört sich skandinavisch an. Rick weiß, dass Hans in seinem Alter ist. Er ist mit Mitte dreißig ins Dorf gekommen. Hat er in diesen jungen Jahren schon soviel verdient, dass er solche Summen aufbringen kann? Für nutzlose Zwecke.
Er kommt zum Schluss, dass es sich nur um »altes Geld« handeln kann. Hans ist ein einziges Rätsel, denkt er beunruhigt und doch ... ich kenne ihn irgendwoher. Annabelle will er nicht fragen, ob und was sie über Miklund weiß. Sie konfrontiert ihn ohnehin seit einiger Zeit mit Vorfällen, die er angeblich vergessen hat. Rick findet nie die Zeit, das eine oder andere zu erledigen. Nein, gesteht er sich selber ein, ich werde langsam alt und vergesse sogar, dass man regelmäßig trinken soll.