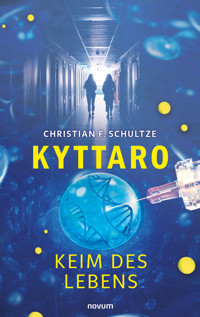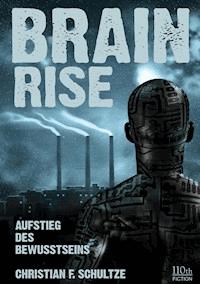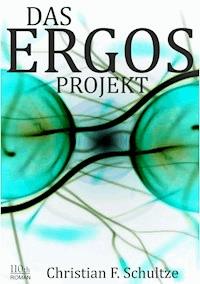
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Eine Zukunftsfiktion Unabhängig voneinander entdecken der chilenische Astrophysiker Manuel Sandros und der deutsche Mathematiker Sebastian Grüner wissenschaftliche Grundlagen, um einen Schwarzlochgenerator entwickeln zu können. Damit wollen sie das immer eklatanter werdende Energie- und Umweltproblem ein für alle Mal lösen. Doch obwohl der Bau des Large-Hadron-Colliders (LHC) bei Genf weitere wichtige Erkenntnisse verspricht, können sich die führenden Industrienationen weder in der Umweltpolitik noch in der Energieforschung auf gemeinsame Anstrengungen einigen. Da unbegrenzte Energie auch die Anwendung einer neuen Superlaser-Waffe ermöglicht, entwickelt sich ein Wettrennen der Großmächte um diese Technologie. Wissenschaftler und Agenten finden sich alsbald zwischen den Mahlsteinen der Machtpolitik der um Vorherrschaft ringenden Länder wieder. Das Verhängnis nimmt seinen Lauf… "…and the monkeys looked up at the stars…“
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DAS
ERGOS
PROJEKT
Roman
von
Impressum
Cover: Karsten Sturm – Chichili agency
Foto: dreamstime.com
© 110th / Chichili Agency 2014
EPUB ISBN 978-3-95865-462-4
MOBI ISBN 978-3-95865-463-1
Urheberrechtshinweis:
MENE MENE TEKEL U-PHARSIN
(„gewogen und zu leicht befunden“)
Prolog
1.
Dr. Manuel Sandros schüttelte sich fröstelnd, als er aus der Glasdrehtür des kleinen Berghotels hinaus ins Freie trat. Werbeplakate und Postkarten, die im Foyer des im Tiroler Holzbaustil errichteten Komplexes verkauft wurden, versprachen eine weiße Winterpracht mit Sonne und blauem Himmel. Seit ihrer Ankunft war es stattdessen grau, nebelig und stets über dem Gefrierpunkt geblieben, obwohl das Hotel in elfhundert Meter Höhe lag und es Mitte Februar war. Er hatte nur noch drei Tage! Um Winter zu erleben, das war ihm klar, musste er mindestens auf 2000 Meter hinauf, was bei solchem Wetter aber sinnlos blieb. Denn dort oben gab es derzeit nur vereiste Wege, Pisten, Bäume und Skiliftmasten, die man bei diesem Nieselwetter nicht einmal richtig sehen konnte, geschweige das versprochene Panorama über dem Winterkurort Halanx und dem herrlichen Tal des gleichnamigen Flüsschens, das irgendwo da oben entspringen musste.
Sandros hatte den Admiral um eine Woche Ruheurlaub ersucht, um endlich wieder einmal mit seiner Frau und der Kleinsten zusammen sein und womöglich etwas Wintersport treiben zu können. Seit dem Jahre sechs des neuen Jahrtausends hatte es zwar in den gemäßigten Zonen der nördlichen Halbkugel kaum mehr richtige Winter gegeben. Trotzdem hatten es in den letzten Jahren noch viele versucht, in den klassischen Wintersportorten der Rockys und der Europäischen Alpen so etwas Ähnliches wie Skiurlaub zu machen. Es gelang ihnen aber immer seltener, denn entweder war zuviel und zu nasser Schnee gefallen, den wegen ständiger Lawinengefahr keine Pistenpflegemannschaft jemals bewältigen konnte. Oder es vereiste plötzlicher Graupelregen zu solchen kompakten Eisdecken, dass an Skifahren überhaupt nicht zu denken war. Dazu musste man nun wohl in die neu erschlossenen Gebiete in Nordschweden und Alaska nahe dem nördlichen Polarkreis reisen. Für die Wintersportindustrie Europas und den mittleren USA war es anscheinend vorbei. War das schon jetzt tatsächlich der unumkehrbare Klimawandel, vor dem die UNO in ihren spektakulären Klimaberichten vom Jahre 2007 warnte?
Nach einem entspannten, lange währenden Frühstück mit seinen beiden Damen hatte sich Sandros entschlossen, an diesem Vormittag die zwei Kilometer zum Ort hinunter und wieder zurück zu wandern, um sich wenigstens etwas Bewegung zu verschaffen. Sie hatten nun schon Halbzeit und am Wetter hatte sich die ganze Zeit nichts geändert, so dass er überhaupt nicht dazu gekommen war, etwas Skisport zu treiben. Der Wetterbericht versprach bis auf weiteres keine Besserung. Frau und Tochter wollten dagegen in die kleine Eishalle des Berghotels Schlittschuhlaufen gehen. Das war ihm aber für sich, mit seinen diesbezüglichen Laufkünsten zu riskant.
Gerade als er sich noch einmal umdrehte, um seinen „beiden Frauen“ zurück zu winken, klingelte das Mobiltelefon. Immerhin hatte es bisher keine Störungen gegeben. Die Vorschrift, das Handy auch in seinen Urlaubstagen aktiv zu lassen, gehörte zum Vertrag, und es hatte keinen Zweck, darüber zu lamentieren. Schließlich wusste er, dass nur zwei Menschen die Nummer für dieses Teil hatten. Einer davon war ihr Sohn Patricio. Anrufe waren daher nur in wirklich wichtigen Fällen zu erwarten. Noch bevor er die Taste drückte, erkannte Sandros am Display, dass sein Aufenthalt in Halanx zu Ende war. Es meldete sich der Admiral.
„Wie sieht es aus da oben bei Ihnen? Geht es Ihnen gut?“
„Das Wetter ist deprimierend, aber sonst geht es schon. Wenigstens kann ich mal mit meinen beiden Damen in Ruhe frühstücken“, antwortete Sandros.
„Die Mittel sind soeben bewilligt worden. Über die Zeit von vorerst fünf Jahren. Es geht los! Wie schnell meinen Sie, können Sie in Salt Lake City sein?“
„Haben sie alles bewilligt? Und was ist mit der Location?“, fragte Sandros zurück.
„Hören Sie, Sandros, das ist doch jetzt nicht wichtig! Außerdem weiß keiner, ob nicht doch einer ihren Code geknackt hat, also reden wir später drüber. Jedenfalls haben wir schon genug Zeit verloren. Sie sind doch derjenige, der sich am meisten darüber aufgeregt hat. Also vorwärts! Wir müssen unverzüglich loslegen.“
„Ist mir klar, Admiral. Haben sie alles bewilligt?“
„Fast! Sie haben ein paar Bedingungen daran geknüpft. Also, wann treffen Sie in Salt Lake City ein? Ich lasse für Sie das Ticket hinterlegen.“
„Na, vor morgen Mittag wird der Bus nicht dort sein, selbst wenn ich früh zeitig start.“
„Das dauert mir zu lange“, knurrte der Admiral. „Wir machen es so: Ich schicke Ihnen einen Hubschrauber nach Evanstone. Der holt Sie um vier ab. Es geht eine Maschine nach Washington zwischen fünf und sechs. Da können Sie morgen früh um neun in meinem Büro sein. Tex Barkley, die Chinesin und zwei, drei Leute von der neuen Regierung werden auch da sein. Ich organisiere alles.“
Sandros seufzte. Ihm war klar, dass eine Bitte um Aufschub keinen Zweck und auch keinen Sinn hatte. Denn schließlich hatte er schon fast fünf Jahre auf diesen Punkt hin gearbeitet. Und nun, da es soweit war, hätte er ohnehin keinerlei Ruhe mehr. Das Wetter war zudem obermies. Nur seine „beiden Frauen“ taten ihm leid. Aber Raja wusste, mit wem sie verheiratet war. Sie verlor über derlei dienstliche Kamikazetouren nie ein unnötiges Wort. Manchmal fragte er sich, ob sie eher froh darüber war, dass ihre Ehe im zeitlichen Stakkato verlief und vielleicht gerade deswegen in den bisherigen zehn Jahren noch keiner größeren Krise ausgesetzt war, sah man einmal von der schweren Krankheit ihres Großen vor fünf Jahren ab.
„Ok, Admiral, wir machen es, wie Sie sagen. Ich geh´ packen. Bis morgen früh also.“
„Good luck, Sandros, ich freue mich und bin nervös.“
„Ich auch, Sir. Good luck.“
Er kehrte zurück und traf seine Frau und Marga, seine Tochter, in der kleinen Eishalle. Er sah dem Gesicht seiner Frau an, dass sie sofort wusste, was los war. Sie sagte etwas zu der Kleinen, die gerade an einer Pirouette übte, und kam dann an die Bande.
„Soll ich einpacken helfen oder haben wir noch die halbe Stunde Zeit, die wir hier gebucht haben?“, fragte sie.
„Ich fange schon mal an. Wir können noch miteinander Mittag essen, wenn du mich nach Evanstone fährst. Ich bin nervös.“
„Was hat er gesagt?“, fragte sie nur.
„Es geht wirklich los. Wie viel sie bewilligt haben, sagte er nicht. Er meinte, fast alles, was wir beantragt haben und sie haben ein paar Bedingungen gemacht, die ich jetzt noch nicht kenne. Er hatte Angst, dass die Leitung angezapft sein könnte.“
„Es wird alles anders werden“, sagte sie und blickte ihm ins Gesicht.
Er war über diese Aussage nicht überrascht. Er sah sie auch an und entdeckte Schatten unter ihren dunklen Augen. Das war das Faszinierende an ihr, dass sie die Dinge intuitiv sehr schnell in ihrer ganzen Komplexität erfassen konnte, ohne dass er ihr etwas erklären musste. Leider konnte er deshalb auch kaum etwas vor ihr verbergen. Aber das würde er bei diesem Projekt weiterhin müssen. Sie spürte das und daher hatte sie die Sache mit ihrem einfachen Satz auf den Punkt gebracht. Dass sich etwas ändern würde, war wohl beiden schon lange klar, wenn sie es auch nur ungern in ihr Bewusstsein dringen ließen.
„Nicht alles, Liebling“, sagte er aber, nahm mit den Fingern eine dunkle Haarsträhne aus ihrem Gesicht und berührte mit seinen Lippen ihren Mund. „Aber wohl manches. Also sehen wir uns gleich und gehen dann essen.“
„Ok, ich fahre Dich“, sagte sie und drehte sich um, um zu ihrer Tochter zu gleiten. „Fragst Du nach dem Rover?“
2.
Jeremias Alban Redcliff hatte gerade seinen 45. Geburtstag hinter sich gebracht, als er endlich in das Büro des Energieministers eingeladen wurde. Man schrieb den 1. September 2004. Es war ein sonniger, warmer Mittwochnachmittag in Washington. Am Vorabend jenes Datums war auf dem Parteitag der Republikaner gerade George W. Bush junior mit einer Politshow, wie sie bisher ohne Beispiel in der gesamten amerikanischen Geschichte gewesen war, zum neuerlichen Präsidentschaftskandidaten der Republikaner ausgerufen worden. Das Desaster seiner Wahl vom Sommer 2001 war längst vergessen. Die Macher wetteten auf die Macht der Bilder. Und nach 9/11 und dem Einmarsch der von den USA geführten Alliierten in Afghanistan und im Irak war sowieso nichts mehr wie vordem. Nation in war! George John Tenet, CIA-Direktor, hatte das erwartet. Er hatte nur kurze Zeit benötigt, bis ihm dämmerte, was mit dem WTC-Desaster bezweckt worden war. Meist hatte der CIA in den entscheidenden Missionen eine Aufgabe gehabt. Bei 9/11 waren sie im Dunkeln getappt. Jedenfalls hatten jetzt die evangelikalen Fundamentalisten in Washington das Sagen und die Pragmatiker waren in die Minderheit geraten. In Redcliffs Kopf setzte sich der Verdacht fest, dass die neuen Jungs im Pentagon um Verteidigungsminister Donald Henry Rumsfeld gerade dabei waren, die Dienste umfassend zu instrumentalisieren und im Pentagon eine eigene Geheimtruppe zu etablieren. Weiter vorausschauende Projekte standen offenbar weniger im Blickpunkt des Oval Office.
Der Admiral kannte E. Spencer Abraham von seinem kurzen Gastspiel in Harvard 1996. Er hatte an der Universität nur als Gast Vorlesungen über Energiewirtschaft angehört, bevor er dann am Massachusetts Institut of Technologie (MIT) dasselbe machte. Der Sohn libanesischer Einwanderer hatte aber Redcliffs Aufmerksamkeit geweckt, weil er als Tutor in den dortigen Seminaren an wirklichen Zukunftsfragen des Erdballs, wie Energie und Trinkwasser, ebenso interessiert schien, wie er selber, wenn auch aus vollkommen anderen Gründen. Während er nach seinem Studium an der Columbia University, der folgenden Ausbildung in Westpoint und seinem steilen Weg hinein in den Auslandsgeheimdienst, entsprechende Vorlesungen der nordamerikanischen und ausländischen Koryphäen an den Universitäten Amerikas vor allem aus dienstlichen Gründen, die sich in wunderbarer Weise mit seinen persönlichen Intentionen deckten, anhörte, war Abraham zu der Zeit gerade kurz davor, an Harvard eine Professur zu bekommen und glaubte, mit sorgfältig recherchierten Abhandlungen über die zukünftigen Probleme der Menschheit Bewegung in die Gehirne der Mächtigen pflanzen zu können.
Hieraus ergaben sich für die beiden Männer vielfältige Anknüpfungspunkte und Redcliff hatte in zahlreichen abendlichen Gesprächen manches von Abraham lernen können, da dieser die Probleme in Mittelost, insbesondere des Libanon mit seinen Anrainern Israel, Palästina und Syrien, wo schon längst massiv um Energie und Wasser für die zukünftigen Generationen gerungen wurde, tiefgründig kannte. Zwar konnte er damals Abraham nicht näher erläutern, in wessen Auftrag und unter welchen Umständen er als frischgebackener Ressortleiter für Energie- und Trinkwasserressourcen im CIA an dessen Universität weilte. Aber dennoch hatte sich zwischen den beiden Männern in jener Zeit, wenn auch keine Freundschaft, so doch respektvolle Zuneigung entwickelt. Inzwischen waren einige Jahre vergangen. Abraham hatte es in verhältnismäßig kurzer Zeit und aus Gründen, die Redcliff immer noch nicht ganz klar waren, bis zum Energieminister der Vereinigten Staaten gebracht. Und der jetzige Chef des Energieministeriums hatte sich Redcliffs erinnert, als dieser ihn telefonisch um eine inoffizielle Unterredung gebeten hatte. Es hatte nicht lange gedauert, bis er aus dessen Büro angerufen wurde. Nun, etwas mehr als fünf Jahre nach ihren gemeinsamen Tagen in Harvard, war er an diesem Nachmittag über die sonnenüberflutete Independence Ave auf dem Weg in den Amtssitz des bei der Bush-Administration nicht mehr ganz unumstrittenen DOE-Bosses.
Der Wagen wurde nach Nennung des Namens durch Redcliffs Fahrer und kurzem Check in die Schleuse der Tiefgarage eingelassen. Ein Bediensteter wartete schon am Lift, um den CIA-Mann nach oben zu geleiten. Nachdem der Begleiter die Tür des schmucklosen Besprechungsraumes, aus dessen mannshohem Fenster man allerdings einen sehr schönen Ausblick auf Arlington hatte, lautlos von außen geschlossen hatte, erschien durch eine andere, kaum sichtbare Türe augenblicklich der Minister, schoss einen kurzen Blick durch seine randlose Brille auf Redcliff, eilte auf ihn zu und drückte ihm herzlich die Hand.
„Schwierige Zeiten, was, Jerome.“ Und „Seien Sie gegrüßt“, sagte er in herzlichem Ton. Spencer war etwas fülliger und etwas grauer geworden. Aber seine dunklen libanesischen Augen hatten ihren Glanz nicht verloren. „Man nennt Sie jetzt den Admiral?!“, fügte er fragend hinzu.
„Na ja, es hat mit der Navy nichts zu tun“, erwiderte Redcliff. „Es ist wegen des Wassers, ein Spitzname.“
„Und Sie arbeiten für John McLaughlin?“, bemerkte Abraham.
„Nun ja, eigentlich arbeitete ich für George Tenet, aber der hatte gerade seine Probleme mit G.W auszufechten. Wird wohl bald ein anderer kommen für John. Aber das halte ich eher für nebensächlich.“
„Wer hat keine Probleme mit G.W.?“, erwiderte Abraham. „Waren Sie seinerzeit schon dabei?“
„Ich war damals gerade frisch ´reingekommen und beauftragt, das neue Ressort aufzumachen, weil George es für wichtig hielt für die Zukunft und mich für den richtigen Mann dafür“, sagte Redcliff. „Deshalb haben wir alle Vorlesungen der Starleute in den führenden Universitäten angehört und uns ein Bild über die möglichen eigenen Ressourcen machen wollen.“
„Und, was ist ´rausgekommen?“, fragte der Minister.
„Unsere eigenen Besatzungen reichen wahrscheinlich nicht, weil andere womöglich weiter sind als wir“, raunte der Admiral. „Ist es hier abhörsicher?“, flüsterte er schließlich.
„Worüber wollen Sie mit mir reden?“, fragte Abraham erstaunt.
„Es geht um Wichtigeres als um Öl, es geht um unsere Zukunft“, flüsterte Redcliff immer noch.
„Ist das nicht dasselbe? Und weshalb wollen Sie darüber gerade mit mir reden? Hat Sie Tenet beauftragt?“ fragte der Minister in normalem Ton und machte eine Handbewegung, die dem Admiral verdeutlichen sollte, dass hier in Washington jedes Departement seine eigene Abhörabwehr beschäftigte.
„Nein, wirklich nicht. Wenn er noch dran wäre, hätte er wohl selber mit Ihnen gesprochen. Wir waren uns aber einig, dass wir an Sie herangehen müssen, für die Zeit nach G.W. Nur, McLaughlin interessiert nach 9/11 gänzlich anderes als die wirklich entscheidenden Fragen. Er ist – wie soll ich sagen – bisschen einfach gestrickt. Und ob er länger bleibt, ist ja auch ungewiss. Was uns interessiert ist, dass die Bonesman aus dem Weißen Haus verdrängt werden müssen, damit wir uns mit dem wirklich Notwendigen beschäftigen können.“
„Kann mir schon denken, was Tenet bewegt hat“, knurrte der Minister. „Behaglich ist der Gedanke nicht, dass die CIA auch in mein Departement ihre Lauscher steckt. Aber G.W. hat selbst wirklich keinerlei Vorstellungen, was für die Zukunft wichtig sein könnte. Er ist ein Chaot. Ich vermute, er ist sowieso nur für seine Shareholder unterwegs. An dem Irakgeschäft verdienen vor allem Halliburton, Carlyle und Brown&Roots, das ist seine Familie.“
Redcliff war überrascht über die Direktheit des Ministers, der ja immerhin zu den Republikanern gezählt wurde. „Danke für Ihre Offenheit“, erwiderte er.
„Ist ziemlich egal jetzt. Aber auch ich kann zwei und zwei zusammenzählen. Wenn Sie von niemandem kommen, haben Sie wohl auch noch niemanden im Boot? Ich habe im Oval Office ebenfalls nur noch wenige Freunde und nachdem G.W. mit seiner Familie meint, er müsste um die letzten fossilen Brennstoffe Krieg führen, ist es mit sinnvoller Zukunftspolitik ziemlich düster bestellt. Von der einstigen Ordnungsmacht sind wir zum ersten Unruhestifter geworden und vergraulen uns immer mehr wichtige Freunde.“
„Da sind wir bei der Sache“, sagte Redcliff erfreut. „Wir möchten Sie bitten, etwas mit uns für die Zukunft zu machen. Vergessen Sie dabei mal, dass ich beim Dienst bin, was vielleicht auf Zeit gesehen sogar ein Vorteil ist. Es gibt ´ne ganze Menge Leute auch außerhalb, denen klar ist, dass es sich bald nicht mehr lohnt, mit derartig hohen Kosten militärisch ums Öl, ja nicht einmal mehr ums Wasser, zu kämpfen. Wir wissen, dass Ihr Ministerium nicht mehr so weit weg ist von der Kernfusion. Wenn unsere Informationen stimmen, vielleicht noch zwanzig Jahre. Wenn wir die Energiefrage als Erste lösen können, lösen wir auch alle anderen Probleme, die wir haben. Wir könnten nicht nur die entscheidende Wende im Problem mit dem Klimawandel angehen, wir könnten sogar in der Welt noch eine Weile als Nummer eins mitmischen, unabhängig davon, wie viel Manpower die Inder und Chinesen auf die Beine stellen werden.“
„Wir sind mindestens noch dreißig Jahre weg von der Kernfusion, obwohl wir in Los Alamos einige fähige Leute damit beschäftigen“, knurrte der Minister. „Und ich kann vermutlich wenig für Sie tun, denn ich werde auch hinschmeißen. Die Gelegenheit ist günstig, mich mit meiner bescheidenen Pension in meinen Bungalow nach Casa Grande zurückzuziehen.“
„Das wäre schade“, erwiderte Redcliff. „Wir haben da vielleicht einen Mann gefunden, der uns entscheidend weiterhelfen kann. Es wäre eine ganz neue Möglichkeit. Uns fehlen allerdings noch die Mittel, um unsere Ideen umzusetzen. Und überhaupt müssten wir erst mal das notwendige Netzwerk schaffen. Vielleicht haben Sie auch paar geeignete Leute in ihrem Departement, in Los Alamos oder im Fermilab.“
„Unser Budget reicht nicht mal für das Wichtigste, beziehungsweise für das, was ich für das Wichtigste halte. Für 28 Milliarden bekommen Sie keine Kernfusionstechnologie!“, stellte Abraham trocken fest.
„Das sehen wir auch so“, sagte Redcliff. Wir brauchen nach unseren Berechnungen für unser Projekt wenigstens erstmal 300 Milliarden, innerhalb von acht bis zehn Jahren. Dann könnten wir es anschieben.“
„Das wird unter den Bonesman niemals was. Die brauchen jährlich 350 Milliarden für Mittelost und noch mal 250 Milliarden für den Rest unserer glorreichen American Army“.
„Gerade das macht uns optimistisch. G.W. wird bald aus Mittelost herausgehen müssen. Die Führung nach ihm könnte lernen, dass ihr die Navy mit ihren sechsundzwanzig Flugzeugträgern und ´zig Atom-U-Booten und auch die ganze beknackte Raketenabwehr der Army in Zukunft überhaupt nichts mehr bringen kann. Wir verplempern massenhaft Geld, ohne noch ´was dafür zu bekommen, außer Ärger außen und innen. Ganz abgesehen davon, dass dauernd ein gewaltiger Finanzcrash droht, wenn die Araber und die Chinesen mal keine Lust mehr verspüren sollten, unser Leistungsdefizit zu finanzieren. Wenn man der Militärindustrie ein anderes Geschäft anbieten könnte, bekommt der Neue vielleicht die nötigen Mehrheiten. Nur – das Ding können wir nicht allein einsteuern:“
Der Minister schwieg. Er sah den Einmeterneunzigmann mit seiner grauen Stoppelfrisur und den grüngrauen hellwachen Augen im kantigen Gesicht nachdenklich an. Dann sagte er: „Klingt nicht unplausibel. Ich könnte, wenn Sie mir mehr erzählen, versuchen, ein paar Freunde zu mobilisieren, die mich hier überleben werden. Denn auch für den nächsten Vormann dieses schönen Departements brächte es ja was, wenn er Mittel in solchen Größenordnungen für Energieentwicklung erhielte. Es ist sehr interessant, was Sie hier vortragen, Admiral. Ich möchte gern mehr dazu hören. Allerdings benötigte man für solch ein Projekt nicht nur das Geld und geeignete Spitzenkräfte, sondern wohl auch einen ganz neuen Präsidenten. Vielleicht muss man erst den Kandidaten suchen und ihm dann das Projekt anbieten. Für heute müssen wir leider Schluss machen. Es wartet noch mein ganzer Terminplan.“
„Sind Sie ad hoc abkömmlich?“ fragte Abraham nach einer kleinen Pause.
„Für diese Sache Tag und Nacht, Spencer. Glauben Sie mir, das ist wirklich eine lebenswichtige Angelegenheit! Und wenn Sie sich tatsächlich entschließen könnten, uns zu helfen, stelle ich Ihnen auch unseren Mann aus Palo Alto vor. Der kann Sie noch besser überzeugen, weil er mehr Zukunft in seinem Kopf hat, als wir alle.“
„Ok, Sie hören so bald wie möglich von mir. Was meinten Sie damit, dass ´die anderen´ womöglich bereits weiter sind als wir?“
„Wir hören von unseren Gewährsleuten, die derzeit leider nicht speziell darauf angesetzt sind, und sehen auch bei unseren diesbezüglichen Recherchen, dass sich die Deutschen und die Russen und auf der anderen Seite die Chinesen und sogar die Inder ebenfalls mit diesem Thema beschäftigen. Und man weiß nie, wer zuerst den Durchbruch schafft. Wenn sie es am neuen Beschleuniger, den die Europäer in Bern bauen, schaffen, wären sie uns ein ganzes Stück voraus. Das ist bekanntlich nicht nur eine Sache des Geldes.“
„Wohl, wohl, aber Genies sind selten geworden“, erwiderte Abraham. Sie verabschiedeten sich und der wartende Dienstmann brachte den Admiral in die Tiefgarage.
Die Nachmittagssonne stand, als sie aus der Tiefgarage ans Tageslicht fuhren, nur noch in halber Höhe über Arlington und tauchte den Obelisken und die National Mall im Osten in ein warmes, goldenes Herbstlicht.
Der Admiral war nicht unzufrieden mit diesem Treffen. Aber es würde noch viel Arbeit machen, bis ein Durchbruch erreicht werden könnte, da war er sich sicher.
3.
„Könnten Sie sich vorstellen, dass unsere beiden Länder an einem gemeinsamen Wissenschaftsprojekt größter Dimension arbeiten?“, fragte Jurij Demtschenko den schmächtigen, dunkelhaarigen Deutschen.
Es war im Weißen Haus in Moskau lange überlegt worden, ob die Zeit herangereift sei, an die Deutschen heranzutreten, nachdem es in den vergangenen zwei Monaten einige nicht vorhergesehene Abkühlungen zwischen der Europäischen Union und Russland, dem Führungsland der neuen GUS-Vereinigung, gegeben hatte. Deutschland war zu wenig unabhängig von den Machern in Brüssel und Washington und Kanzler Schröder hatte wenig eigenen Spielraum. Zwar traute Wladimir Putin dem Sozialdemokraten und hatte ein gutes persönliches Verhältnis zu ihm. Aber viele im inneren Zirkel dachten, dass Schröders Tage im Berliner Kanzleramt gezählt seien. Und ob die kommenden Leute um den neuen, merkwürdig trockenen und amerikahörigen, bayrischen Kandidaten ein Projekt an den Amerikanern vorbei wagen würden, war äußerst ungewiss. Aber ohne die Hilfe der deutschen Koryphäen, das war von den Diensten deutlich nachgewiesen worden, hatte Russland keine Chance, in dem zu erwartenden Konkurrenzkampf zu bestehen.
„Das kommt auf das Projekt und die Dimension an“, erwiderte der Deutsche. „Sie wissen, dass wir gerade ihm Wahlkampf sind. Und wir haben keine Ahnung, wie es ausgehen wird. Die Umfragen sprechen derzeit gegen uns.“
Franz Meyer, die graue Eminenz im engsten Beraterstab des Kanzlers für Auslandsbeziehungen, war außerdem zuständig für Zukunftsressourcen, speziell für Energie und Trinkwasser. Nur wenige kannten ihn, denn er trat nie nach außen in Erscheinung. Umso enger war seine Zusammenarbeit mit dem Geheimdienstkoordinator Ernst Uhrlau und dem Direktor des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Etwas verwundert waren die Experten der inneren Runde über diesen Anlauf der Russen, denn Putin stand seit seiner gerade deutlich gewonnenen Wahl neuerdings unter internationalem Beschuss, weil er einen politischen Bürgerkrieg gegen die Oligarchen und eine ganze Reihe Kremlgrößen aus der Ära seines Ziehvaters Jelzin eingeleitet hatte. Der Ausgang dieses Machtkampfes war noch offen. Meyer schätzte, dass der russische Präsident im Augenblick die Hälfte seiner Kraft für diese innenpolitischen Probleme verbrauchte, vom Krieg gegen die aufständischen Islamisten in Tschetschenien mal ganz abgesehen. Aber es sah so aus, als ob er Erfolg haben würde. Schröder hatte Meyer mit der Abklärung der Offerte beauftragt.
„Der Kanzler schätzt die Hochachtung, die ihm Ihr Präsident entgegenbringt. Er selbst würde gern die Zusammenarbeit vertiefen. Er kann die Amerikaner aber nicht noch mehr vor den Kopf stoßen. Wenn es ein Projekt ist, das gegen die Interessen der USA läuft, werden wir nicht mitmachen können“, gab er zur Antwort.
„Wollen wir erst mal in den Schnee gehen?“, forderte Demtschenko den Deutschen auf. Seit die Beziehungen zwischen Russland und Deutschland nach der Glasnost-Periode und Boris Jelzins Tänzen vor Kohls halbem Kabinett in freundschaftlicherem Geist geregelt wurden, war es Mode geworden, dass man sich zur Besprechung höchst geheimer Fragen auf den Datschen der russischen Regierung zur Sauna traf. Die Aufforderung des Russen, in den Schnee zu gehen, bedeutete, dass sich Putins Petersburger Connection immer noch nicht ganz sicher war, dass die rasant emporgekommenen Finanztycoone des Landes bereits schwach genug waren und sich nicht mehr an die russische Regierung heranwagten. Mit den Auslandsspionagediensten musste zudem immer gerechnet werden.
Es war kalt an jenem Märztag im Norden Moskaus, der Himmel war verhangen. Meyer fror, aufgeheizt von der Hitze der Blockstube, zunächst jedoch nicht.
„Es geht gegen die Interessen der USA. Oder wenigstens gegen die der gegenwärtigen Administration dort“, sagte Demtschenko ungerührt. „Aber Deutschland wird sich in den nächsten Jahren ohnehin entscheiden müssen. Die Franzosen haben hierbei weniger Probleme, aber ihnen fehlen die wirklichen Topleute in der Wissenschaft. Sie dagegen haben ein paar Startypen, die durchaus in der Lage wären, uns zu helfen. Die Deutschen mischen schließlich bei CERN ganz schön mit. Wir haben andere Ressourcen. Wir sind das Land mit den größten fossilen und mineralischen Vorräten auf der Welt. Aber auch die werden in nicht allzu ferner Zeit zu Ende gehen. Das allein ist aber nicht unser Motiv. Wir denken, dass das Energieproblem der Kern aller weiteren Probleme ist. Das Diktat der Energiesyndikate zu brechen, ist nach unserer Ansicht Voraussetzung dafür, eine vernünftigere Weltpolitik auch in Umwelt- und Sozialfragen durchzusetzen. Uns geht es nicht um Hegemonie, sondern um Balance. Die Vereinigten Staaten werden ihre weltweite Vormachtstellung wegen ihrer veralteten Prioritäten und ihrer überdehnten Militärpräsenz bald einbüßen. Ihr Vorderasienabenteuer wird sie Ihren Rang kosten. Wir denken jetzt schon an das Danach. Vor allem, seit wir wissen, dass der Klimawandel auf dem Globus nahezu unumkehrbar ist, wenn wir nicht schleunigst massiv was dagegen machen.“
„Wen meinen Sie mit Topleuten der Wissenschaft?“ entgegnet Meyer überrascht. Er glaubte, sich in der deutschen Forschungsszene auszukennen, einschließlich aller Projekte, die derzeit von der Regierung unterstützt wurden.
„Kennen Sie die Studie aus ihrem Fraunhofer Institut für Elektronenstrahl- und Plasmaforschung FEP über die Nutzung Schwarzer Löcher für die Energie- und Informationsgewinnung der Zukunft?“, fragte Demtschenko zurück.
„Habe wohl mal davon gehört aber niemals dazu recherchiert. Es ist vom wissenschaftlichen Informationsdienst auch nie in eine Priorität gestellt worden“, gab Meyer zu. Er war beunruhigt wegen der Erkenntnis, dass die Russen offenbar ziemlich genau wussten, was in deutschen Spitzenforschungsinstituten vor sich ging. „Ist doch wahrscheinlich ziemliche Utopie, oder?“
„Na, die haben den jungen Mann dort natürlich nicht ernst genommen. Utopien werden heute aber schneller Realität als früher. Wir haben Computer, wir haben einige Erfahrungen in Dubna und wir haben Dollarreserven. Was uns fehlt, ist der Wille zur Bündelung der Kräfte“, meinte der Russe trocken.
„Was ist mit den Chinesen?“, fragte Meyer. Die Deutsche Wirtschaft hatte gute Beziehungen und einen umfangreichen Austausch von Studenten und Wissenschaftlern mit dem Land der Mitte. Man wusste in Berlin, dass China auch in der Technologie mit einem steilen Aufstieg begann und die Russen traditionsgemäß dabei immer noch eine bedeutende Rolle spielten.
„Mit Peking reden wir über alles mögliche“, sagte der Russe. „Die Kernfusion oder die theoretische Physik sind allerdings nicht dabei. Da muss man erst sehen, was sich in der nächsten Zeit entwickelt. Gehen wir wieder rein?“
Man hatte vor den Blockhütten auf dem Gelände, das hinunter zum Flüsschen führte, einige größere Schneehaufen aufgeschüttet. Dort konnte man sich, aus dem Dampfbad kommend, nackt hineinlegen. Demtschenko war Sibirier wie Jelzin und entsprechend groß und kompakt, wenn auch Teile seiner Blondheit bereits etwas ergraut waren. Meyer wirkte gegen diesen Hünen zart und im Gegensatz zu seinem urdeutschen Namen war er ein südländischer Typ mit dunklem Teint. Zur Vollkommenheit dieses Erlebnisses fehlte freilich die Sonne. Als Meyer das erste Mal zu dieser Übung aufgefordert wurde, hatte er nicht geglaubt, dass man nach einer solchen Prozedur, die allerdings nur ein paar Minuten benötigte, sogar ein wenig süchtig werden könnte. Damals hatten ihm seine Begleiter erzählt, dass ihr neuer Präsident in seiner Grundausbildung zum Geheimdienstmann der damaligen Sowjetunion eine Nacht nackt im Schnee überleben musste. Das konnte er sich freilich heute noch nicht vorstellen.
„Wie lange würde eine Untersuchung, ob es sich lohnen würde, ein so geartetes Projekt anzuschieben, dauern?“, fragte Meyer.
„Wir haben es bereits untersucht. Wir meinen, es lohnt sich. Es wird sehr teurer. Wir geben Ihnen den Bericht, wenn Sie möchten. Sie können es daheim besprechen. Das Problem sehen wir darin, wie wir solch ein Vorhaben über die Wahlperioden bringen und wie wir es tarnen können. Vielleicht haben Sie ja eine Idee dazu. Na starowje…“
Meyer konnte inzwischen wie die Russen „Stogramm“ trinken. Die Russen, die Putin schickte, konnten außerdem ausgezeichnet deutsch sprechen und verstehen…
4.
Sebastian L. Grüner wurde als einziges Kind seiner Eltern am 18. September 1969 in Zeuthen bei Berlin geboren. Das L. stand für Ludwig, so hieß sein Urgroßvater, der in Königsberg gestorben war, bevor die Wirren des 2. Weltkrieges diese ostdeutsche Provinz in russischen Besitz trieben. Nach Aussagen seiner Mutter war seine Geburt normal verlaufen, sofern man unter den damaligen Umständen in der Deutschen Demokratischen Republik von normal sprechen konnte. Die DDR hatte die Säuglingssterblichkeit auf internationales Niveau gesenkt. Im Kreißsaal lagen die Gebärenden aber lediglich durch hohe Paravents aus weißem Leinenstoff getrennt zu viert bis zu sechst in den Kreißsälen. Das hatte den Vorteil, dass sie nicht alleine ihrem Gebärschmerz hingegeben waren. Ein Arzt oder eine Hebamme kam während der Wehen nur hin und wieder vorbei. Väter waren beim Kinderkriegen nicht zugelassen. Und irgendwie war es ja auch kulturgeschichtlich berechtigt, den Geburtsvorgang als etwas entmystifiziertes, gesellschaftlich millionenfach Normales zu behandeln. Daher schickte man die Väter nach Hause, ließ die Frauen mit den Geburtshelfern allein und machte ansonsten kein größeres Gewese um das Erscheinen eines neuen Erdenbürgers auf diesem Planeten. Wie Sebastians Mutter ihm später berichtete, war sie zu der Zeit seiner Geburt gerade im Frieden mit seinem Vater und hätte sich gewünscht, dass dieser bei der Geburt seines Sohnes bei ihr gewesen wäre. Stattdessen kam in Abständen von vielleicht zwanzig Minuten der diensthabende junge Stationsarzt in den großen Raum, besuchte alle durch die spanischen Wände abgeteilten Wehenboxen nacheinander und hielt den Gebärenden sogar minutenweise die Hand. Merkwürdigerweise, so berichtete ihm seine Mutter einmal, als er an der Schwelle des Erwachsenwerdens stand, habe sie dieses Händchenhalten beruhigt und ihre Urängste ein wenig gemildert, obwohl der junge Assistenzarzt erstens verdächtig gut aussah, weil er Alain Delon ähnelte, andererseits aber in seinen Jeans und dem roten Blazer offenbar bereits auf dem Nachhauseweg war.
Als der Geburtsvorgang wirklich begann, war dieser junge Mann leider nicht mehr zugegen, sondern statt seiner eine ältere und ganz merkbar erfahrene Hebamme, die, als Sebastian ans Licht des Kreißsaales des Zeuthener Kreiskrankenhauses geschlüpft war, lediglich trocken bemerkte: „He, der Kleine hat ja ein bemerkenswertes Teil. Der wird mal ein guter Liebhaber.“ Das hatte seine Mutter ziemlich schockiert, weil solche profane Art, einen neuen Menschen auf dem Erdball zu begrüßen, nicht in ihr bisheriges Weltbild passte. Außerdem kam ihr das, was sie gerade in den vergangenen Stunden geleistet hatte, entgegen allen materialistischen Weltsichten ihres Landes, als etwas Übermenschliches und Einmaliges vor. Sebastians Vater soll jene Nacht, nachdem er pflichtgemäß seine Parteiversammlung absolviert hatte, auf einer privaten Tanzparty gesichtet worden sein.
Das Kind wuchs unter der Obhut seiner werktätigen Eltern und der sozialistischen Jugendeinrichtungen, von der Kinderkrippe über den Kindergarten, zur Grundschule und zur Zeuthener erweiterten Oberschule, ohne größere Zwischenfälle heran. Schon im Kindergarten hatte sich offenbart, dass dieser Junge außergewöhnliche Begabungen in logischen Bereichen hatte. Daher konnte er auf Betreiben seiner gesellschaftlich beflissenen Eltern ein Jahr früher als normal eingeschult werden. Da er von Anfang an in den Fächern Mathematik und später auch in Physik überdurchschnittlich war, wurde er schon frühzeitig zu den Mathematikolympiaden des sozialistischen Staatenbundes gesandt. Nachdem er die Mittlere Reife mit glatter Eins gemacht hatte, wurde er auf Anraten seiner Lehrer, des Parteiaktives der Schule und weiterer Freunde und Bekannten auf die Mathematik-Spezialschule nach Berlin-Weißensee delegiert. Dies förderte seine genetisch bedingte Neugier auf Neues, Anderes, Fremdes, über seinen Ort und seinen Staat, der ihm bisher alles gegeben hatte, hinaus. Denn, das hatte er als überdurchschnittlich Jugendlicher seines geteilten Vaterlandes deutlich bemerkt: Es gab erheblich mehr an Information, als die Partei- und Staatsführung des DDR-Staates ihm zugestehen wollten.
Sein Abitur absolvierte er 1987 wieder mit „Sehr gut“ und es stand fest, dass er, wenn er seinen Grundwehrdienst in der Nationalen Volksarmee geleistet haben würde, an der Humboldt-Universität zu Berlin Mathematik studieren würde. Seine Hobbys hatten ebenfalls überwiegend mit Mathematik zu tun und er war bereits mehrfacher Jugendmeister seines Landes im Schachspiel geworden, bis er seinen Eltern klar gemacht hatte, dass Mathematik-Olympiaden auf Dauer zu langweilig für ihn waren. In der Oberschulzeit war er immerhin mit seinen Eltern mehrfach zu Wanderurlauben in die Tschechoslowakei und nach Rumänien mitgefahren, was ihm damals nicht besonders gefiel, später aber zu seinem Interesse an Outdoor-Aktivitäten führte, die ihm gelegentliche entspannende und erholsame reale Erlebnisse zu seiner überirdischen mathematischen Welt, die in seinem Kopf stattfand, brachten.
Im Frühjahr 1988 wurde er zum Artillerieregiment Nr. 12 in Eggesin eingezogen. Dort erlebte er in den gefilterten Informationsrinnsalen der noch bestehenden Armeeführung das bemerkenswerte Glasnost-Frühjahr und die gefälschten Wahlen des Jahres 1989 in der DDR, den merkwürdigen Fluchtsommer mit den Besetzungen der BRD-Botschaften in Ostberlin und in Prag sowie die Grenzöffnung in Ungarn. Und kurz nach seiner Entlassung aus seinem Wehrdienst erlebte er den politischen Herbst 1989, der als so genannte „Wende“ in Mittel- und Osteuropa in die Geschichte eingehen sollte.
Als er im September 1989, zwei Tage vor seinem zwanzigsten Geburtstag, mit seinem Zivilköfferchen am Gartentor des bescheidenen Einfamilienhauses seiner Eltern klingelte, spürte er bereits, dass sein zukünftiges Leben nicht mehr so vorprogrammiert und ruhig ablaufen würde, wie bisher. Im Lande fanden gerade die Vorbereitungen zum 40. Jahrestag der Gründung der DDR statt und der Besuch des Führers der Sowjetunion und Erfinders von Glasnost und Perestrojka in der Hauptstadt, Michail Gorbatschow, stand kurz bevor. In den folgenden länger währenden Gesprächsabenden mit seinen Eltern und deren Freunden wurde ihm das ganze Ausmaß der Umwälzungen, die diesmal von der Sowjetunion ausgingen und nicht von deren Bündnisländern wie Polen oder der DDR, erst bewusst.
Sein Vater sah bereits den Untergang des sozialistischen Staatenbundes voraus, weil er der Auffassung war, dass schon kleinste Öffnungen in der Mauer, dem Schutzwall gegen den Kapitalismus, zu einem Dammbruch und zu einer Überschwemmung mit amerikanisch-westlicher Unkultur führen würden. Das hatten die Genossen um Gorbatschow mit ihrer Glasnost nicht bedacht, meinte er. Mutters Freundin, Sebastians Quasi-Patin, die Kernphysikerin Dr. Jutta Fauth, die den jungen Mann seit seiner Geburt kannte, sah die Dinge positiver. Das war kein Wunder, denn sie weilte in ihrem Wissenschaftlerleben für längere Zeitspannen nicht nur in der DDR, sondern war auch in Dubna und im vorletzten Jahr sogar bei CERN in der Schweiz tätig gewesen. Sie meinte, dass eine Öffnung Fortschritte für Kultur, Wissenschaft und Frieden bringen und die gegenseitige atomare Bedrohung der beiden Militärbündnisse verringern könnte. Letztlich würde auch der Wohlstand und die Versorgung der Bevölkerung verbessert werden können, wenn mehr Offenheit und Demokratie in die sozialistischen Länder käme.
Sebastians Mutter dagegen sah die kommenden Dinge wohl am realistischsten. Das lag vielleicht auch daran, dass sie als Ökonomieprofessorin an der Hochschule für Ökonomie in Karlshorst Zugang zu Informationen über den wahren Zustand der Volkswirtschaften des Ostblocks und deren Auslandsverschuldung hatte und außerdem im Austausch mit höheren DDR-Ökonomen das Innovationsdefizit des Ostens besser kannte, als die Genossen in den unteren Betriebsebenen oder die Führer um Honecker ganz oben, der erst vor kurzem begeistert der Welt einen eigenproduzierten Elektronikchip präsentiert hatte. Sie prophezeite den sowieso unabwendbaren Untergang der Binnenwirtschaften des Comecon und deren Übernahme durch das internationale Kapital unabhängig davon, ob die Oberen eine Öffnung wollten oder nicht. Das restliche Beiwerk, also der Überbau, würde anschließend so organisiert, wie in Westdeutschland.
„Ja, was soll ich aber nun machen?“, wandte Sebastian am dritten Abend ein.
„Na, du studierst Mathematik wie geplant, das ist deine Berufung und dein Talent!“, erwiderte seine Mutter zärtlich.
„Und wo?“, fragte er.
„In Berlin natürlich, in unserer Nähe“, antwortete der Vater. „Wenn es wirklich zum Umbruch kommt, weiß niemand von uns, was aus uns werden wird, außer dem gerade Studierenden“.
Jutta Fauth fügte hinzu: „Wissenschaftler braucht jedes System; gute Wissenschaftler und die Geheimdienstleute. Außerdem ist die Mathematik die Mutter aller Wissenschaften. Eliminiert werden nur die mittleren Etagen und ein paar ganz Große. Denk an die Nazis.“
„Willst du uns mit den Nazis vergleichen?“, fuhr Sebastians Vater auf.
„Natürlich nicht. Aber mit Sozialismus hatte selbst die Nachstalinära nicht viel zu tun. Da hat mal einer gesagt, ich glaube es war ein Schweizer Mathematiker: ´Jede Wissenschaft bedarf der Mathematik, die Mathematik bedarf keiner´“, erwiderte Jutta trocken. „Übrigens wissen wir ja gerade überhaupt nicht, was aus unserer Kooperation in Dubna wird und ob die sowjetischen Kollegen uns weiter dort haben wollen.“
5.
Im Herbst 1989 wurde Grüner an der Mathematischen Fakultät der Humboldtuniversität zu Berlin immatrikuliert. Sein Studium unter Professor Paul Meinelt begann genau am 20. Oktober. Am Vorabend des 40. Jahrestages der DDR prägte der Generalsekretär der KPdSU, Michail Gorbatschow, angesichts der Berliner Mauer seinen denkwürdigen und tausendfach zitierten Satz: ´Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.´
Am 7. Oktober hatten zahlreiche Jugendliche und Intellektuelle abends den Aufstand in Ostberlin geprobt und wurden von uniformierten und zivilen Sicherheitskräften zusammengeschlagen oder besonders vorbereiteten Verwahrungsorten „zugeführt“. In der Rumpfhauptstadt der Deutschen wurde der Ausnahmezustand ausgerufen. Kurz darauf begannen die Montagsdemonstrationen für Glasnost und Perestrojka auch in der DDR, zunächst in Leipzig, dann in anderen Städten des Landes. Gorbatschow hatte Honecker deutlich gemacht, dass die DDR-Führung das Problem alleine lösen musste und diesmal keine sowjetischen Panzer rollen würden. Der DDR-Staatsratsvorsitzende und Generalsekretär der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands wurde unter maßgeblicher Mitwirkung seines Genossen und Sicherheitsministers Mielke von der eigenen Parteiführung abgesetzt. Am 4. November fand in Berlin die erste Großdemonstration der DDR-Bürger ohne Kontrolle der SED-Organe statt. Eine Million Menschen verlangten Meinungs- und Reisefreiheit. Die Macht der Partei begann zu bröckeln. Die Risse im Damm wurden deutlicher. Am 9. November 1989, diesem schicksalsträchtigen Tag der Deutschen, verkündete der Ostberliner Parteisekretär und das Politbüromitglied Günther Schabowski in einer Pressekonferenz die Reisefreiheit für die Ostdeutschen, weil er einen ihm zugeschobenen Merkzettel des SED-Krisenstabes, formuliert von zwei StaSi-Obristen, falsch interpretierte. Der Damm brach, die Berliner Mauer ebenfalls. Noch in der Nacht setzte sich ein gewaltiger Strom Ostberliner Bürger und stinkender Trabis in Richtung Westberlin, am nächsten Tag in Richtung Westdeutschland, in Bewegung. Das Ende des Ostblocks war eingeleitet. Am 7. Dezember 1989 wurde der bis dahin allmächtige Stasichef Erich Mielke verhaftet und kurz darauf unter Anklage gestellt. Seine Beteuerungen vor der sich auflösenden so genannten Volkskammer, dem Scheinparlament der DDR, dass er doch alle Menschen liebe, halfen ihm in diesen Umbruchswirren wenig.
Sebastian studierte sein angeborenes Fach also zuerst in Berlin. Dann, im Strudel der politischen Wende in Europa, führte ihn sein Weg nach Hamburg und zuletzt nach Gießen, wo er 1998 seine Studien abschloss. Während seines Eindringens in die besondere Welt der Mathematik beschäftigten ihn mehr und mehr zwei damit scheinbar kaum zusammenhängende und bislang noch unaufgeklärte Rätsel der Menschheit. Ein sehr altes, nämlich die ungeheure Präzision und Periodiziät des Kalenders der alten Maya-Kultur. Und ein sehr modernes, nämlich die verbrennungsfreie Erschaffung von Energie. Dies veranlasste ihn, zusätzlich ein Studium der theoretischen Physik zu beginnen. Zuletzt hatte er sich unter Professor Ihrwinger mit Fuzzy-Logik und Vektortheorien befasst und sein Diplom darüber gemacht. Alle seine Professoren hatten Grüner ein weit überdurchschnittliches Talent bescheinigt und es war für seinen Diplomvater nicht leicht gewesen, die weitgehenden Vorstellungen des Studenten in seinen Aussagen über mögliche Weiterentwicklungen im Bereich der Fuzzy-Logik und der weltweiten Zusammenfassung von Rechnerleistung überhaupt noch zu bewerten.
Jutta Fauth, die Familienfreundin, hatte seinen Weg aus der Zeuthener Ferne freundlich und geistig begleitet. Ihr offenbarte er seine wissenschaftlichen Probleme, seine studentischen Abenteuer und ersten Liebschaften in Deutschlands Norden. Sie verstand als Physikerin auch einiges von seinen mathematischen Theorien und ihr vertraute er in dieser Lebensphase mehr an, als seinen exkommunistischen Eltern. Jutta Fauth war abgewickelt worden, nachdem sie das Angebot der Russen, ganz in deren neu formierten Staatenbund GUS zu kommen, abgelehnt hatte. Das wiedervereinte Deutschland hatte für ostdeutsche Kernphysikerinnen vorläufig keine Verwendung. Überfluss herrschte von nun an nicht nur an Gütern des täglichen Bedarfs und an Informationen, sondern auch an Wissenschaftlern und ehemaligen Funktionären. Ihre Bemühungen, beim CERN in Meyrin bei Genf eine Anstellung zu bekommen, schlugen gleichermaßen fehl. Man war gerade dabei, den alten LEP - Large Elektron-Positron Beschleuniger - auszumustern und ein neues Projekt mit dem Namen LHC - für Large Hadron Collider - zu verwirklichen. Dieser Teilchenbeschleuniger sollte fast doppelt so groß werden, wie der bisherige. Aber vor 2005 würde er wohl nicht in Betrieb gehen. So trat sie in eine wissenschaftliche Korrespondenz mit ihrem „Patenkind“, befasste sich mit seinen mathematischen Erkundungen und besuchte ihn auch gelegentlich in einer seiner Studienstädte. Ansonsten züchtete sie in ihrer unfreiwilligen Arbeitslosigkeit Rosen im kleinen Garten ihres Zeuthener Häuschens, wie es viele große Geister in ihrem Ruhestand vor ihr schon gepflegt hatten.
Überrascht hatte sie, als sie auf Sebastians Bitte hin den Exzerpt für seine Diplomarbeit studierte, seine darin enthaltene Aussage, dass die Mathematik maßgeblich dazu beitragen und daran arbeiten könne und müsse, das Energie- und Informationsproblem des Globus generell zu lösen. Dieser Gedanke war Fachleuten nicht neu. Aber die mehr am Rande seiner Arbeit vorkommende Behauptung, dass es grundsätzlich möglich und berechenbar wäre, Gravitationskraft gesteuert physikalisch zur Energiegewinnung zu nutzen und zwar in größerem Maßstab als mit Hilfe der Kernfusion, möglicherweise durch Nutzung des Phänomens der Schwarzen Löcher, die man dafür herstellen müsste, war bei ihr doch auf nicht unerhebliche Skepsis gestoßen. Das hatte ihm nicht nur ihre Nachfrage, sondern auch die Kritik oder das Lächeln seiner Mathematikerkollegen eingebracht. Wie das Problem der Verarbeitung der dabei entstehenden ungeheuren Datenmengen zur Steuerung derartiger physikalisch-materieller Abläufe gelöst werden sollte, hatte er sich zum Thema seiner Abschlussarbeit gemacht. Sie hatte Sebastian gebeten, ihr seine Ansichten einmal in einem abendlichen Gespräch leichter verständlich zu erklären. Im Sommer 1996, kurz bevor er seine Diplomarbeit an der traditionsreichen Universität in Gießen einreichte, hatten sie sich dann getroffen.
Ideen
1.
Juli war eine angenehme Jahreszeit in Deutschlands zweitgrößter Stadt. Zwar konnte es vorkommen, dass Hamburg dann ein wenig mehr verregnet war als andere Orte. Wenn aber die Sonne schien, wurde es wegen des meist hereinwehenden leichten Nordost und des vielen Wassers inmitten der Stadt niemals zu heiß. Sebastian hatte seine „Patentante“ Jutta in die weltoffene Hafenstadt am Unterlauf der Elbe eingeladen, da sich eine günstige Unterkunftsmöglichkeit geboten hatte. Seine früheren Kommilitonen, die sich gerade im Semesterurlaub befanden, hatten ihm, der nun schon seit achtzehn Monaten in Gießen war, freundlich ihre WG-Wohnung, in welcher er drei Jahre lang Mitbewohner gewesen war, zur Verfügung gestellt, als er sie darum gebeten hatte. Es war nicht mehr ganz die alte WG, denn zwei seiner Mitstudenten waren inzwischen ausgezogen und beschäftigten sich ebenfalls mit ihrer Diplomverteidigung. Aber George, der Engländer, und Sergeij, der Russe, wussten noch nicht genau, wann sie ihre Arbeiten schreiben konnten. Eigentlich, so hatten sie ihm bedeutet, hatten sie noch nicht einmal ein vernünftiges Thema dafür gefunden.
Es war nicht allein ihre Schuld, dass ihr Studium ein paar Halbjahre länger dauerte. Die Herren Professoren hatten zumeist Reputierlicheres, mit Sicherheit auch Profitableres im Sinn, als besondere Themen, die eher im Sinne ihrer Diplomanden als in ihrem lagen, zu erfinden. So passte die Bereitschaft und Notwendigkeit bei den Studierenden, ihr Studium endlich mit einer passablen Diplomarbeit abzuschließen, nur zuweilen mit den Interessen der Lehrstuhlinhaber überein, die sich national und international zu profilieren suchten. Bei ihm hatte der Fall etwas günstiger gelegen, und er war stets gefördert worden.
Dr. Jutta Fauth war Sebastians Einladung gerne gefolgt, da sie die deutsche Hansestadt überhaupt noch nicht kannte und auf beides gespannt war, auf die ihr fremde deutsche Stadt und auf Sebastians Thema. Sie war eine erfahrene Wissenschaftlerin und hatte Übung darin, theoretische Sachverhalte in knappe, genaue und redundanzfreie Abhandlungen zu fassen. Sebastian hatte sie gebeten, seine Abschlussarbeit dahingehend zu redigieren. Er war froh darüber, dass ihm diese Frau, die etwas älter als seine Mutter war, aber die von seinen Ideen mehr verstand als diese, zu helfen versprochen hatte. Gießen, die geschichtsträchtige Mathematikerstadt, hatte Jutta jedoch nicht so gereizt, und auch ihm war es günstiger erschienen, für ein paar Tage nach Hamburg zu fahren. Einerseits, um den nötigen Abstand zu gewinnen, andererseits, weil man dort noch einmal das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden konnte. Im Osten, in Prag, Warschau, Moskau, Dubna, kannte die Patentante sich besser aus, als in Westdeutschland. Und er hatte diese Weltstadt des deutschen Nordens lieben gelernt.
Jutta hatte Sebastian am Telefon klar gemacht, dass es besser wäre, wenn sie über ihre Fragen zu seinen Vorstellungen reden könnten, bevor sie seine Arbeit redigiere. Denn so könne sie besser beurteilen, ob er seine Darlegungen ausreichend deutlich auf den Punkt gebracht hätte. Er solle ihr das Manuskript also nicht einfach zu-mailen, sondern sie wolle sich mit ihm treffen. So kam der Besuch im Stadtstaat an der Elbe zustande. Ob denn auch ausreichend Zeit für Sightseeing wäre, hatte sie gefragt.
Jetzt saßen sie also an diesem lauen Freitagabend im Juli des Jahres 1998 in einem kleinen kultigen Fischrestaurant etwas außerhalb der Stadt am rechten Damm der Unterelbe, und Sebastian freute sich, dass er seiner Wahltante diese schöne Stadt, die ihm als die schönste Stadt Deutschlands vorkam, vorführen konnte.
Sie hatten einen portugiesischen trockenen Weißwein zum pflichtgemäßen Fischmenue geordert und beim Anstoßen der Gläser ein geschichtsträchtiges Gefühl, denn Hanseaten und Portugiesen waren immer große Seefahrer gewesen und hatten erheblich dazu beigetragen, dass die Menschheit verstehen konnte, dass die Erde rund, abenteuerlich und faszinierend ist. Und hier roch es allenthalben nach Seefahrt und Meer.
„Das hast Du also drei Jahre lang unter ´Studieren´ verstanden?“, frozzelte die „Patentante“. Sie war stolz auf ihren Jungen, der inzwischen ein drahtiger, hochgewachsener Mann geworden war, und sie mit seinen blauen Augen glücklich und fröhlich anstrahlte.
„Manchmal haben wir auch gearbeitet“, meinte Sebastian trocken.
„Kann man hier überhaupt arbeiten?“, fragte sie zurück. „Hier ist doch viel zu viel los.“
„Man könnte hier auch gut ohne Arbeit leben, wenn man genug Geld hätte“, sagte er bestätigend. „Wir gehen morgen mal an die Außenalster. Da bin ich nicht so gerne gewesen, da ich dort das blöde Neidgefühl bekomme und denke, dass die Leute, die an diesem herrlichen Gestade in ihren weißen Villen wohnen, wohl kaum mehr gearbeitet haben, als wir. Aber sehen musst Du es unbedingt.“
„Na, vielleicht ist die Zeit gar nicht mehr so fern, dass auch Du dort wohnst, wenn deine Ideen erstmal Wirklichkeit werden!“, lächelte die Tante.
„Vorläufig tun mich die, denen ich was drüber erzählt habe, als Spinner ab. Denn um das, was ich vermute, näher zu untersuchen, müsste man einen ziemlich kolossalen Aufwand betreiben und noch dazu den Willen aufbringen, einen Großteil der vorhandenen Ressourcen darauf zu bündeln. Aber selbst Stephen Hawking mit Roger Penrose am DAMTP oder Kip Thorne mit seinen Leuten am California Institute of Technology stellen eher die Fragen nach dem Woher und Warum anstatt: Wohin? Wer wird sich schon mit den Träumen eines jungen Studienabsolventen befassen?“
„Na ja, ich habe auch meinen Stephen Hawking gelesen. Und als ich beim CERN war, meinten damals schon einige Kollegen, dass nicht die Kernspaltung, nicht einmal die Kernfusion, sondern die Nutzung der Gravitationskraft das Ziel der Zukunft sei. Aber niemand hatte eine Vorstellung davon, wie man schnellstmöglich dahin kommen könnte.“
„Es gibt ein paar Teilchenphysiker in Deutschland, besonders die Leute um Professor Horst Stöcker in Frankfurt, die es für möglich halten, in Superbeschleunigern schwarze Minilöcher zu produzieren, die Energie im Dauerbrand mit einer Effizienz von neunzig Prozent abblasen würden, wenn man sie einmal angezündet hat“, erläuterte er. „Sie wissen natürlich nicht, wo sie die Anschubenergie hernehmen und wie sie´s steuern können. Solche Rechner und solche Reaktoren gibt´s noch gar nicht, mal ganz abgesehen von den mathematischen Modellen, nach denen solche Rechner es machen müssten.“
„Wäre sowas nicht viel zu gefährlich?“, fragte Jutta. „Heute macht sich ja schon ein Großteil der Bevölkerung in die Hosen, wenn sie nur von Kernenergie hören. Ein Supergravitator würde noch ganz andere Wirkungen entfalten.“
„Stöcker ist der Ansicht, dass es jedenfalls sicherer als Kernspaltung wäre, weil sich schwarze Minilöcher sofort wieder abbauen, wenn man ihnen kein Futter mehr gibt.“
„Was denn für Futter?“
„Abfälle; Sand, Dreck, einfach alles. Das würde fast vollkommen in Energie umgewandelt. Du kennst die Gleichungen!“
„Das wäre ja nicht auszuhalten!“ erwiderte die „Patentante“ euphorisch. „Stell Dir mal vor, was das bedeuten würde!“
„Kann ich mir gar nicht alles auf einmal vorstellen“, sagte der Student. „Der ganze Irrsinn mit der Verbrennung der Fossilien würde aufhören. Wir könnten alle blödsinnigen Windmühlen, die die Landschaft verschandeln, wieder abbauen; die Kernspaltungsbetriebe auch. Wir wären außerdem mit einem Schlag unabhängig von diesen ewig gestrigen Fuzzies der Energiewirtschaft. Selbst das Trinkwasserproblem würde sich aufgrund des schieren Energieüberflusses lösen lassen. Die Klimaforscher könnten von solcher Mathematik womöglich auch profitieren. Für die gibt´s ja auch noch keine brauchbaren Modelle, geschweige denn Maschinen, die belastbare Voraussagen berechnen könnten. Deshalb können sie auch nicht beweisen, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt.“
„Mein Gott, kannst Du Dir vorstellen, was da losgehen würde in der Wissenschaftswelt – und“, fügte sie nach kurzer Überlegung hinzu, „in der Politik?!“ Jutta Fauth konnte sich gar nicht beruhigen.
„Na ja, wir haben mal in der WG nachgedacht, was man für ein solches Weltprojekt brauchen würde“, erwiderte er. „Selbst der neue LHC in Bern wäre dafür zu klein, denke ich. Stöcker hofft zwar, dass er damit seine Hawkingsche Strahlung oder die berühmten Bosonen finden kann, aber um den Durchbruch zu erreichen, müssten die Dimensionen ungleich größer sein. Dafür würde nie einer die Mittel zusammenkriegen. Mal ganz abgesehen von den technischen und mathematischen Problemen, die man lösen müsste.“
„Und Du denkst, Du hast dafür die zündende Idee?“, fragte die Tante.
„Eine Idee schon, aber keine Lösung und vor allem kein Geld. Man müsste besonders eine Menge gute Mathematiker und Physiker, wahrscheinlich auch Astrophysiker, zusammenbringen, um dafür ein funktionierendes Modell entwickeln zu können. Es könnte mit der Fuzzy-Logik womöglich gehen. Alles andere überlastet die Rechenkapazität, selbst wenn man verschiedene Großrechner auf der Welt zusammenbinden könnte, wie die es bei ATLAS und CMS machen wollen. Die Grid-Technologie kann man nach meiner Meinung dafür nicht anwenden, weil zur Steuerung solcher Kraftwerke schnell interaktiv reagiert werden muss. Ein ganz unbekanntes Terrain ist ja für alle noch die technische Geschichte mit der Rückführung der Energie der Gravitatoren in ihren eigenen Beschleunigungsprozess. Die würden ja dann wie ein perpetuum mobile arbeiten, wenn man sie erst mal in Gang gebracht hat, abgesehen von der Zuführung des ´Futters´.“
„Hast Du das schon mal jemandem vorgetragen?“, fragte die Tante.
„Das auf gar keinen Fall! In der Arbeit sage ich ja nur, dass in Zukunft solche Problemdimensionen entstehen werden und schlage ein mathematisches Modell vor, wie man mit Hilfe der Fuzzy-Technologie auch mit einer Kapazität der derzeit gängigen Spitzenrechner auskommen könnte. Die Datenmengen, die zu erwarten sind, kann man ja darstellen und die erforderlichen Rechenkapazität auch.“
„Na gut, mein Junge, hoffentlich kann ich was von Deinem mathematischen Geschreibsel verstehen. Nur, was machen wir mit Dir, wenn du verteidigt hast?“
„Erst mal muss