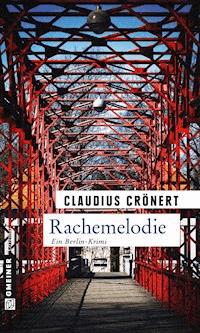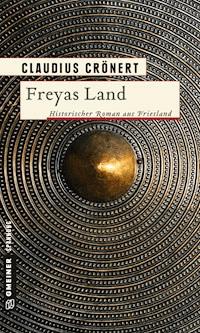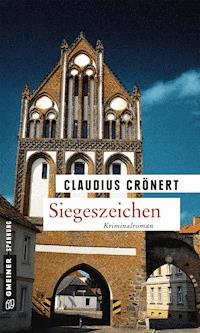10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Intrigen, Ehrgeiz und Liebe im mittelalterlichen Paris Nach dem Tod seiner Mutter kommt Pierre 1238 für die Lehre als Steinmetz nach Paris. Am Seineufer steht er eines Abends dem Rohbau der größten und schönsten Kathedrale gegenüber, die er je gesehen hat: Notre-Dame de Paris. Als der dortige Bauherr stirbt und Pierres Lehrmeister Jean mit viel Geschick seine Mitbewerber aussticht, kann Pierre sein Glück kaum fassen. Auch, weil er fortan seine Tage an der Seite der schönen Bildhauerin Agnes verbringen kann. Doch Baumeister Jean wird sein Erfolg nicht gegönnt und seine Neider intrigieren, kaum dass er die Arbeit auf der neuen Baustelle begonnen hat. Die Spenden für die Kathedrale versiegen und ein schrecklicher Unfall setzt Jean beinahe außer Gefecht. Pierres größte Bewährungsprobe steht bevor: Kann er es schaffen, seine Vision von Höhe und Licht Wirklichkeit werden zu lassen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Das ewige Licht von Notre-Dame
Der Autor
CLAUDIUS CRÖNERT, geboren 1961 in Hamburg, studierte Kunstgeschichte und arbeitete als politischer Journalist, bevor er sich ganz dem Schreiben widmete. Imposante Bauwerke und historische Stoffe haben es ihm schon immer angetan; die Idee, einen epischen Roman über die Notre-Dame zu schreiben, lag also auf der Hand. Claudius Crönert lebt in Berlin.
Das Buch
Nach dem Tod seiner Mutter kommt Pierre 1237 für die Lehre als Steinmetz nach Paris. Hier gerät er sogleich in den Bann der größten Kathedrale, die er je gesehen hat: Notre-Dame de Paris. Als sein Lehrherr Jean der neue Baumeister der Notre-Dame wird, kann Pierre sein Glück kaum fassen. Auch weil er fortan an der Seite der schönen Bildhauerin Agnes arbeiten wird. Doch Jean wird sein Erfolg nicht gegönnt, und die Neider intrigieren. Als es zu einem schrecklichen Unfall kommt, steht Pierres größte Bewährungsprobe bevor: Kann er Jeans Vision von Höhe und Licht Wirklichkeit werden lassen?
Claudius Crönert
Das ewige Licht von Notre-Dame
Historischer Roman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2022Umschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenTitelabbildung: © akg-images (Notre-Dame mit Landschaft); © Brooklyn Museum of Art / Bridgeman Images (Muster); © Florilegius / Bridgeman Images (Bildrand) Autorenfoto: © Martin KunzeE-Book-Erstelllung powered by pepyrus
ISBN 978-3-8437-2781-5
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
Epilog
Nachwort
Glossar
Personen
Social Media
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Widmung
Wir steigen in die wiegenden Gerüste,in unsern Händen hängt der Hammer schwer,bis eine Stunde uns die Stirnen küsste,die strahlend und als ob sie alles wüsstevon dir kommt, wie der Wind vom Meer.Rainer Maria Rilke (aus »Werkleute sind wir«)Prolog
Die Stadt schläft.
Kein Wunder, es ist ein früher Sonntagmorgen und noch einige Stunden hin, bis die Kirchenglocken läuten und der Gottesdienst beginnt. Da macht sich’s mancher bequem und ruht aus von sechs Tagen Plackerei. Der eine oder andere dreht sich noch einmal im Bett herum und tastet nach seiner Frau neben ihm oder fasst sich an den pochenden Schädel, denn am Ende der Woche neigen die Leute dazu, zu viel unverdünnten Wein zu trinken, und am Morgen zahlen sie den Preis dafür.
Ich bin allein auf dem Kirchhof. Nur die Vögel zwitschern bereits. In den halbhohen Sträuchern, die diesen geweihten Ort begrenzen, sitzen sie und singen ihre Lieder. Ob Sonntag oder Montag, das ist ihnen ganz egal, und der himmlische Vater nährt sie doch, wie der Evangelist sagt.
Ich bin allein, und ich habe Zeit.
Auch in diese Pfarrkirche werden bald die Gläubigen strömen. Dann wundern sie sich vielleicht, was ein einzelner Mann hier an den Gräbern macht, und winken mich zu sich. Ich werde sie übersehen. Es ist mir nicht leichtgefallen, doch ich habe gelernt, stur zu sein. Wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, bleibe ich dabei. Das ist heute der Fall. Ich will Euch meine Geschichte erzählen, Meister. Sie hat viel mit Euch zu tun.
Der Sommer ist vorbei. An den ersten Bäumen färbt sich das Laub, und die Sonne hat nicht mehr die Kraft, einen ins Schwitzen zu bringen. Passender wäre es, ich stünde im Frühling hier; das hätte etwas Rundes, einen Anfang und ein Ende, die sich harmonisch fügen. Doch es geht nicht immer alles auf, auch das habe ich im Laufe der Jahre begriffen. Das wahre Ziel ist, das Beste aus dem zu machen, was man hat.
So oder so ähnlich lautet, glaube ich, der Leitsatz meines Lebens.
I
1237
An einem Sonntag im April kam ich zum ersten Mal in meinem Leben nach Paris.
Zwei Tage waren wir gewandert, Vater oft einige Schritte vor mir, und ich sah immerzu seinen Rücken und den Stab, den er bei jedem zweiten Schritt in die Erde stieß. Seine Schritte waren weit, der Gang stapfend, den Kopf hielt er meistens gesenkt.
Schon aus der Ferne konnte ich die Stadt am Horizont ausmachen. Zunächst war sie vom Waldrand und den Feldern aus gesehen nur ein schwarzer Punkt in der Landschaft. Beim Näherkommen dehnte er sich langsam aus, wurde ein Fleck, dann ein Fels, nahm scharfe Konturen an und war am Ende größer als alles, was ich bis dahin gesehen hatte.
Alles hatte gewaltige Ausmaße, selbst die Schlange, die sich vor dem südlichen Tor gebildet hatte. Eine endlose Reihe von Ochsenkarren stand da, einer hinter dem anderen. Die Bauern aus den umliegenden Dörfern, die selbst am Tag des Herrn die Stadt versorgten, warteten auf Einlass. Die meisten saßen zusammengesunken auf ihren Kutschböcken, dämmerten in einer Art Halbschlaf, während ihre Tiere die Köpfe zum Wegrand gedreht hatten und die letzten Grasbüschel aus dem sandigen Boden zu ziehen versuchten.
Vater wartete auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf mich. Sicherlich fürchtete er, mich im Gedränge zu verlieren. »Pierre, trödle nicht«, rief er. »Komm endlich.«
Für Fußgänger gab es ein eigenes kleineres Tor. Die Wachsoldaten, mit Piken bewaffnet, winkten uns hindurch, genauso wie all die Händler, Musikanten, Bettelmönche und sonstigen Reisenden, die mit uns Einlass begehrten. Ich war erschöpft, außerdem hatte ich Durst. Mein Wasserschlauch war leer.
Unterwegs hatte ich mir oft vorgestellt, dass meinen Vater sein Gewissen quälte, weil er mich mit dreizehn Jahren weggab. Wissen konnte ich das nicht, er redete zwar mit mir, wenn wir zwischendurch nebeneinander gingen, doch kaum über das, was ihn beschäftigte. Stattdessen benannte er die Bäume des Waldes und die Vögel, die wir hörten, und zeigte mir, welche Beeren essbar waren und von welchen ich lieber die Finger ließ.
Sein Lieblingsthema aber war das Bauen, und er sprach viel über die Kathedralen, die überall im Land entstanden, gedacht zur höchsten Ehre Gottes, große Kirchen, die alles überragten, was je von Menschenhand geschaffen worden war. Jede französische Stadt, die etwas auf sich hielt, wollte eine haben, auch Chartres, von wo wir kamen. Ich kannte die Baustelle der dortigen Kathedrale und hatte deshalb eine Vorstellung von dem, was er mir vermittelte, von der Höhe der Mauern, den spitzen Bögen und den schlanken Türmen.
Paris kam mir vor wie ein gigantischer Ameisenhaufen. Menschen und Fuhrwerke, die alle ein Ziel hatten, unzählige Häuser, immer neue Märkte für Getreide, Obst und Gemüse, für lebende Tiere und für geschlachtetes Vieh, für gesponnene Wolle, Kleidung und Schuhe, ein wenig abseits auch für schützende Amulette, Hellseherei und andere heidnische Gebräuche. Dazu ununterbrochener Lärm und beißender Gestank. Jemandem wie mir, der nicht viel mehr als unser überschaubares Chartres kannte, kam all das unwirklich vor.
Ein nie abreißender Strom von Menschen bewegte sich durch die lehmigen Straßen und die engen Gassen, Männer genauso wie Frauen, und alle trugen irgendetwas bei sich. Auch eine Menge Kinder waren unterwegs. Ich bekam vor Staunen den Mund kaum zu. Am liebsten wäre ich stehen geblieben und hätte dem Treiben zugeschaut, doch Vater drängte vorwärts, und inzwischen fürchtete auch ich, wir könnten uns verlieren. Er kannte den Weg, während ich keine Ahnung hatte, wo wir waren oder wohin wir mussten.
Die Häuser und Hütten standen meist dicht an dicht, eine Wand lehnte sich an die nächste. Die meisten von ihnen waren mit Schilf gedeckt, und ihre Fensterläden waren geschlossen, sodass sie abweisend wirkten. In der Straßenmitte lief der Unrat durch eine steinerne Rinne. Ich fragte mich, ob die Anwohner in ihren Höfen keine Gruben hatten. Kannte man so etwas in Paris nicht?
Die Gerüche verschlugen mir den Atem, während der Lärm der Stadt in mich eindrang wie ein Messer in einen weichen Käse. Leute stritten oder lachten, beides gleich laut. Vor mir gingen zwei Frauen Hand in Hand und sangen ein lustiges Lied, wobei sie ihre Arme im Takt schwenkten. Ein Bauer mit rotem Kopf brüllte seinen unbeweglichen Ochsen an und wedelte mit der Knute vor seinen Augen. Hinter ihm drängten drei Reiter in edler Kleidung, adelige Herren, Pelze an ihren Umhängen, gewohnt, dass man ihnen Platz machte. Der eine von ihnen zog sein Schwert und befahl dem Bauern, den Weg freizugeben. Dessen Ochse aber rührte sich nicht. Der Bauer brüllte noch lauter und begann, auf das Tier einzuschlagen. Dabei wurde sein Kopf dunkelrot und sah aus, als würde er gleich platzen.
Ich konnte nicht bleiben und den Ausgang der Auseinandersetzung abwarten, mein Vater war schon wieder ein ganzes Stück vor mir. Er schien keinen Blick für die Stadt zu haben, sondern stieß seinen Wanderstab wieder in den Lehm und stapfte immer weiter. Ich rannte hinter ihm her und holte ihn kurz vor dem Flussufer ein, wo Angler bis zu den Knien im Wasser standen und ihre Ruten ausgeworfen hatten.
Die Seine war genauso befahren wie die großen Straßen. Obwohl es kaum Wind gab, flatterten bunte Segel auf dem Wasser, dazwischen fuhren Ruderkähne, große wie kleine, alle beladen, manche so sehr, dass sie zu tief lagen und Wasser über die Bordwand hineinschwappte.
Ich fragte mich, ob in einer Stadt wie Paris der Sonntag überhaupt eine Bedeutung hatte. Glaubten die Bürger hier an denselben Gott wie wir in Chartres, an den, der, nachdem er die Erde erschaffen hatte, nicht nur selbst am siebten Tag ruhte, sondern von uns Menschen verlangte, es ebenso zu halten? Meinem Vater konnte ich diese Frage nicht stellen, er war schon wieder voraus.
Er bog ab, weg vom Wasser. Offenbar wohnten die Leute, zu denen er wollte, auf dieser Uferseite. Doch dann blieb er plötzlich stehen und wirkte unentschlossen. Sein Kopf bewegte sich erst in die eine, dann in die andere Richtung. Er drehte um. Nahm doch die Brücke.
Ich eilte ihm hinterher.
Mir kam es vor, als ob die Gassen auf der anderen Seite des Flusses noch einmal enger und voller waren. Überall Menschen und Tiere, ein einziges Gewühl. Die Mitte von Paris, das Herz des Ameisenhaufens.
Ich griff nach dem Saum von Vaters Kittel und hielt mich daran fest. Tapste ihm hinterher und schaute erst wieder auf, als er an einem Holzzaun haltmachte.
Als ich zwischen den Latten hindurchlinste, erblickte ich eine Baustelle, so groß, dass sie weder Anfang noch Ende zu haben schien. Ein Himmelsschiff, dachte ich. Entweder eins, das gerade gebaut wurde. Oder aber eins, das hier gelandet war, und Gott selbst hatte den Handwerkern befohlen, es wieder flottzumachen.
Der Platz war am Sonntag menschenleer, doch es gab deutliche Spuren, die mir zeigten, dass viele von ihnen Seinem Aufruf gefolgt waren. Eine Menge Leitern und Bottiche waren ordentlich aufgereiht, leere Wagen und Karren standen dort nebeneinander. Die Wände des Gebäudes in ihrer unterschiedlichen Höhe bildeten Absätze mit scharfen Kanten. Sie waren aus dem gleichen grauen Stein gemauert, wie er in Paris für die Häuser verwendet wurde. Das ganze Gebilde, ohne Fenster und Dach, sah aus wie das Skelett eines Riesen. An vielen Mauern waren Gerüste befestigt, und es gab Dutzende von Seilzügen.
Ich versuchte, die Bauhütten zu zählen, scheiterte aber zweimal. So oder so war es mehr von allem, als ich mir hatte vorstellen können. Gegen diese Baustelle kam mir die in Chartres geradezu übersichtlich vor.
Mein Vater stand und schaute.
»Wird das auch eine Kathedrale? Oder …?« Aus Sorge vor Zurückweisung wollte ich nicht »Himmelsschiff« sagen, aber ein anderes Wort fiel mir nicht ein.
»Sicher«, erwiderte er, »und da wir in Paris sind, soll sie mächtiger werden als alle anderen im Land.« Er neigte den Kopf, ein feines Lächeln umspielte seinen Mund. »Aber in Chartres sind wir um einiges weiter.« Er klang zufrieden. Das war verständlich, schließlich war er dort der Baumeister.
»Das wird noch dauern«, sagte er kopfschüttelnd. Er legte seinen Arm um mich. »Komm, jetzt suchen wir dein neues Zuhause.«
Wir nahmen wieder die Holzbrücke und kehrten zum südlichen Flussufer zurück, wo er nach rechts abbog. Ich fand es verblüffend, wie zielsicher er uns durch die Gassen führte. Für mich sahen sie alle gleich aus.
Er blieb vor einem Haus stehen, das ein wenig zurückgesetzt lag. Auf dem Vorplatz stand rechter Hand ein Schuppen mit einer Bank davor, die aus groben Brettern gezimmert war. Auf der linken Seite gab es einen gemauerten Brunnen. An einer Stange darüber baumelte ein Eimer. Mit Erleichterung stellte ich fest, dass diese Leute auch eine Grube hatten. Wie bei uns war sie mit Brettern abgedeckt, die man hochhob, wenn man seinen Nachttopf darin ausleerte.
Das Haus selbst hatte ein Erdgeschoss aus Stein und einen etwas schiefen ersten Stock aus Holz. Oben standen die Fensterläden offen.
Vater zögerte zum ersten Mal. Schaute nach links und nach rechts. Wieder zu dem Haus. An der Tür gab es keinerlei Hinweis auf die Bewohner, keinen Namen, kein Symbol einer Bruderschaft oder überhaupt eines Handwerks. Er legte den Kopf schief. Ich stellte mich neben ihn. Er schritt beherzt auf die Haustür zu. Ich blieb hinter seinem Rücken, wo ich nicht gesehen werden konnte, wie ich hoffte. Ein mulmiges Gefühl breitete sich in mir aus. Ich fürchtete mich und fühlte mich schon jetzt, obwohl mein Vater noch bei mir war, allein und verloren. Ich sehnte mich nach zu Hause und nach meinen Geschwistern.
Vater klopfte vorsichtig.
Niemand öffnete.
Er klopfte erneut, diesmal etwas kräftiger. Ich wäre am liebsten davongelaufen, doch im nächsten Moment erschien schon eine Frau an der Tür. Sie trug ein hellgraues Wollkleid, das bis zu den Knöcheln reichte, und eine weiße Haube. Ihr Gesicht konnte ich nicht erkennen, da sie im Halbdunkel der Türschwelle stand.
»Entschuldigen Sie, Madame«, brachte mein Vater stockend hervor. Seine Stimme klang rau, wie eine Säge auf Holz. »Ist dies das Haus von Meister Jean?«
»Dann seid Ihr Meister Hugo aus Chartres?«
»Der bin ich.«
Die Frau drehte ihren Kopf und rief ins Haus: »Jean, dein Besuch ist da!« Meinem Vater entbot sie einen Willkommensgruß. »Und du«, sagte sie zu mir, »bist sicher Pierre.«
»Ja, Madame«, erwiderte ich mit meinem trockenen Mund und ohne sie anzuschauen.
Sie lächelte mir zu. »Komm rein, Pierre.«
Ich trat in die Stube und blinzelte. Meine Augen mussten sich an das Halbdunkel gewöhnen. Im Raum stand links ein Tisch mit einer Bank und vier Hockern darum. Dort saß ein Mann mit schwarzem Haar und buschigem Bart. Auf der anderen Seite war ein Herd mit einem großen Topf auf dem Feuer. Die Holzscheite knisterten. Das Regalbrett darüber bog sich unter all den Tellern, Schüsseln und Kochtöpfen, die darauf standen. An ihm hing, ähnlich wie bei uns zu Hause, ein Strick, an dem Blümchen befestigt waren. Sie sollten für gute Luft sorgen. Auch meine Mutter hatte oft gesagt, dass es der Gestank ist, der Krankheiten verbreitet.
Überhaupt fühlte ich mich an mein Elternhaus erinnert. Der größte Unterschied waren die bunten Wolldecken, die hier an den Wänden hingen und die dem Raum etwas Warmes und Wohnliches gaben. Dafür hatten wir in unserem Haus zusätzlich zu unserem Herd eine Feuerstelle, um es im Winter zu heizen.
Der Mann erhob sich vom Tisch und gab meinem Vater die Hand. Mir fiel auf, dass die Finger an seiner rechten Hand schmutzig, geradezu schwarz waren, als würde er sie nie waschen. Insgesamt war etwas Düsteres um ihn, fast so wie der Himmel kurz vor einem Gewitter. Die beiden Männer setzten sich an den Tisch. Meister Jean schenkte Wein ein, woraufhin beide ihre Tonbecher anhoben und gegeneinanderstießen.
Da betrat ein Mädchen den Raum. Sie war etwas jünger als ich, ebenfalls mit schwarzem Haar, das über seine Schultern hing. Sie setzte sich ganz hinten an den Tisch. Als ich näher trat, wandte sie sich ab.
»Agnès, sagst du unserem Besuch nicht Guten Tag?«, fragte ihre Mutter.
Das Mädchen gab keine Antwort.
Ich blieb neben einem der bunten Teppiche an der Wand und drückte die Fingerknöchel hinter meinem Rücken gegen den körnigen Stein. Die fremde Umgebung schüchterte mich so sehr ein, dass ich wie gelähmt war, unfähig, den Mund aufzumachen oder einen Gedanken zu denken.
Ich blieb so lange dort stehen, bis Madame die Hand nach mir ausstreckte. »Komm, Pierre, ich zeige dir dein Zimmer.«
Mit vorsichtigen Schritten folgte ich Madame ans andere Ende der Stube, wo eine Treppe lag, die ich bis dahin noch nicht bemerkt hatte. Sie knarrte, als wir sie hinaufstiegen.
Der Flur oben war wegen der offenen Fensterläden weniger dunkel. Madame führte mich nach links in ein Zimmer. In der schmalen Stube lag ein Strohsack auf dem Boden, daneben standen ein Nachttopf und ein Stuhl.
»Hier wirst du wohnen, Pierre. Ich hoffe, du fühlst dich wohl.«
Ich nickte, immer noch unfähig zu einer Antwort.
»Hast du noch andere Kleidung?«
»Ja«, brachte ich hervor. Ich zeigte auf den geschnürten Beutel, den ich über der Schulter trug.
»Dann häng sie hierher.«
Es gab einen Haken an der Wand. Mit zitternden Fingern knüpfte ich meinen Beutel auf, zog meinen anderen Kittel, der aus grauem Leinen war und den ich in der warmen Jahreszeit trug, und eine zweite Hose heraus und tat, was sie mir gesagt hatte.
Nun sah ich ihr Gesicht besser. Es war rund und kam mir freundlich vor, was, wie ich meinte, an den kleinen Grübchen auf ihren Wangen lag. Ihre Nase war klein, das Haar unter der Haube aufgesteckt, doch es hatten sich zwei Strähnen gelöst, die zu beiden Seiten herabfielen und das Gesicht einrahmten. Sie war damals Anfang dreißig – für mich dreizehnjährigen Jungen also jemand, dem ich mit äußerstem Respekt zu begegnen hatte. Immerhin ließ meine Furcht in ihrer Gegenwart ein wenig nach.
»So«, sagte sie, »jetzt gehen wir wieder hinunter und essen. Du hast doch sicher Hunger?«
Ich hatte vor unserem Aufbruch am Morgen ein Stück harten Käse, ein Ende Wurst und etwas Brot bekommen. In meinem Bauch war ein Loch. Vor allem aber war mein Mund inzwischen so trocken, dass er schmerzte und mir die Lippen aufrissen, wenn ich sie bewegte.
»Entschuldigung, Madame«, sagte ich, ohne den Blick zu heben, »ich habe Durst. Dürfte ich etwas trinken?«
»Aber sicher.«
Unten stand ein Wasserfass neben dem Herd, aus dem sie mir mit einer Schöpfkelle einen Becher füllte. Dazu goss sie Wein. Das Gemisch schmeckte vertraut, verdünnten Wein hatte ich auch zu Hause immer getrunken. Ich bemühte mich, nicht alles herunterzustürzen, sondern trank langsam. Bald fühlte ich mich ein wenig sicherer, und eine angenehme Wärme stieg in mir auf.
Madame deckte den Tisch. Jeder bekam eine eigene Schüssel. Ich dachte, der Sonntag wird in Paris doch geheiligt. Auch in Chartres aßen wir sonntags von Tellern, während in der Woche jeder seinen Löffel in den Topf tunkte und sich etwas herauszufischen versuchte.
»In diesem Haus beten wir vor dem Essen«, sagte Madame.
Ich beeilte mich, wie alle anderen am Tisch die Hände zu falten. Im Augenwinkel bemerkte ich, dass auch das Mädchen betete, von dem ich bis dahin geglaubt hatte, dass irgendetwas mit ihm nicht stimmte, weil es nicht gesprochen und überhaupt nicht auf uns reagiert hatte.
»Herr, wir danken dir für deine Gaben, für die Speise auf unserem Tisch und für den Wein. Was wir sind, sind wir durch dich. Amen.«
Madame verteilte das Essen. Es gab einen sämigen Eintopf mit Erbsen, Bohnen und dunklen Fleischstückchen, die sie vor allem in die Schüsseln der Männer legte. Ich erhielt nur ein einziges davon. Es war verkocht, ich kaute lange darauf herum.
Die beiden Männer führten das Gespräch. Mein Vater hatte inzwischen Wein getrunken und erzählte wortreich von seinem Bau, der Kathedrale, wegen der wir damals, als ich noch klein war, von Montreuil nach Chartres gezogen waren. Mit einigem Stolz berichtete er, wie gut der Bau voranschritt, und Meister Jean hörte ihm aufmerksam zu. Er redete längst nicht so viel wie mein Vater, dennoch verstand ich nach und nach, dass der Kirchenbau, den er verantwortete, in Saint-Denis lag, irgendwo außerhalb von Paris.
Nach dem Essen wurde ich müde. Mein Körper und mein Geist sehnten sich nach der Kammer, die Madame mir zugewiesen hatte, das Strohlager dort kam mir wie eine Verheißung vor. Aber ich blieb, wo ich war. Vater hatte mich darauf vorbereitet, dass wir einander für lange Zeit nicht sehen würden, weil wir beide in der warmen Jahreszeit beschäftigt sein würden und man im Winter den Weg durch den Wald nicht machen konnte. So wollte ich den Abschied, solange es ging, hinauszögern und saß wie festgewachsen auf meinem Platz.
Doch irgendwann fielen mir die Augen zu. Mein Kopf sackte zur Seite.
Madame legte mir ihre Hand auf den Arm. »Komm, geh schlafen, Pierre.«
»Ja, Madame.«
Mir war schwindelig vor Müdigkeit, als ich die Treppe hinaufstieg. In meinem Zustand und in der Dunkelheit, die im oberen Stockwerk inzwischen beinahe vollkommen war, bog ich auf dem Flur aus Versehen nicht nach links, sondern nach rechts.
In dem Zimmer, das ich betrat, brannte eine Öllampe, die den Raum in ein schummriges Licht tauchte. Das Mädchen mit den schwarzen Haaren saß auf dem Bett und hatte den Rücken an die Wand gelehnt. Augenblicklich schoss mir die Röte ins Gesicht.
»Hau ab!«, rief sie und warf mit einem Gegenstand nach mir. Es war ein Holzlöffel, der meinen Oberschenkel streifte.
Erschrocken wich ich zurück und eilte zu meiner Kammer. Ich war zu müde, um mir Gedanken über die Feindseligkeit meiner Flurnachbarin zu machen.
Ich hatte noch nie ein Zimmer nur für mich gehabt. Zu Hause schlief ich neben meinen Brüdern und war an ihren Atem gewöhnt, an das Rascheln, wenn sie sich auf die andere Seite drehten, an die Seufzer und ihr Aufschreien im Traum. Die Ruhe hier war so bedrückend, dass ich zu weinen begann. Doch noch während mir Tränen über die Wangen liefen, nickte ich ein.
Zum Glück wurde ich wach, als im Morgengrauen Schritte und Abschiedsworte zu hören waren. Ich eilte hinunter.
Mein Vater war schon an der Tür. Ich trat vor und legte wortlos meine Arme um ihn. Mein Kopf reichte ihm bis an die Brust.
Er klopfte mir auf den Rücken. »Vergiss nicht, was ich dir gesagt habe, mein Sohn«, sagte er leise. »Vergiss es nie.«
Selbst zu dieser frühen Stunde hätte ich die Ermahnung nicht gebraucht, denn seine Worte waren tief in mich eingedrungen.
»In Paris«, hatte er gesagt, »bist du der Lehrling eines bedeutenden Baumeisters, Pierre. Sei bescheiden und fleißig, so kannst du viel von ihm lernen und wirst später selbst ein Baumeister. Dann will ich stolz auf dich sein.«
Diese Sätze hatte er gesprochen, während wir nebeneinander gingen und er den Arm um meine Schulter gelegt hatte. Wir durchquerten einen Wald, der so dicht und düster war, dass ich immerzu mit dem Angriff eines wilden Tieres oder einer Bande Räuber rechnete. Doch mit dieser Aufforderung war meine Angst wie weggeblasen. Zum ersten Mal seit dem Tod meiner Mutter sah ich wieder eine Zukunft vor mir. Ich wollte von ganzem Herzen, dass er stolz auf mich war. Er sollte so stolz sein, dass er seine Entscheidung, mich fortzugeben, bereute.
Auch als er jetzt davonging und ich ihm durch die offene Haustür nachsah, war ich mehr als bereit, seinem Rat zu folgen. Ich würde bescheiden und fleißig sein und als Baumeister nach Hause zurückkehren.
II
Mir blieb nicht viel Zeit, mich von der Reise zu erholen, denn früh am Morgen klopfte Meister Jean energisch an die Tür meiner Kammer und drängte zum Aufbruch. Offenbar hatte er selbst nicht geschlafen. Er stützte sich mit einer Hand auf den Tisch und trank seinen Becher in einem Zug leer.
Ich nahm mir den Becher, von dem ich glaubte, dass mein Vater ihn am Abend benutzt hatte. Es war noch ein Rest Wein darin. Ich füllte ihn mit Wasser auf. Er schmeckte so sauer, dass es mich schüttelte.
»Los geht‘s«, sagte der Meister und hängte sich einen Umhang über, zwei lange Wollstücke, die an den Schultern zusammengenäht waren, sodass man den Kopf durchstecken konnte.
Draußen herrschte jene graue Stunde, die nicht mehr Nacht ist und auch nicht Tag. Das Viertel schlief noch, überall waren die Fensterläden geschlossen, niemand war auf der Straße. Der Meister ging zu jener Holzbrücke, die auf die Seine-Insel führte. Bald darauf nahmen wir eine zweite ans Nordufer. Wie mein Vater schritt Meister Jean ein Stück vor mir, ich trottete hinterher und bemühte mich, den Abstand nicht zu groß werden zu lassen. Dazu musste ich immer mal wieder ein Stück rennen.
Während wir weiter nordwärts vorankamen, wurde die Stadt langsam wach. Frauen kamen aus den Häusern und kippten den Unrat aus ihren Nachttöpfen in die Gosse. In Chartres war das verboten, und ich verstand nicht, warum sie nicht ihre Gruben benutzten. Waren die denn alle voll? Andere Frauen schüttelten vor ihren Türen die Säcke mit dem Bettstroh auf. Ich sah viele Tiere, gackernde Hühner, meckernde Ziegen und sogar Schafe. Magere Hunde streunten durch die Straßen.
Einer von ihnen lief mir nach, wedelte mit dem Schwanz und strich mir um die Beine. Doch ich hatte nichts für ihn und marschierte eilig weiter, um den Meister nicht aus den Augen zu verlieren. Als der Hund erkannte, dass bei mir nichts zu holen war, blieb er zurück.
Es war noch kühl, doch mir wurde durch die schnellen Bewegungen warm. Ich ging davon aus, dass dieses Saint-Denis, von dem der Meister am Vorabend gesprochen hatte, unser Ziel war. Wir waren auf einer der breiten Straßen, die sich wie Schneisen durch die Stadt zogen. Bauernwagen kamen uns entgegen, beladen mit Getreide und lebenden Tieren.
Paris schien kein Ende zu nehmen. Immer wieder gab es neue Häuser und Gassen, Stände, die aufgebaut wurden, Schuppen und Scheunen, Wirtshäuser, Schmieden und Tischlereien. Ich weiß noch gut, dass ich glaubte, die Stadt würde bis ans Ende der Welt reichen, und irgendwann müsste ich aufpassen, um nicht von der Erdscheibe zu stürzen. Als wir schließlich das nördliche Stadttor erreichten, war ich froh, mich geirrt zu haben.
Der Meister beachtete weder Tor noch Wächter, sondern stapfte einfach hindurch. Ich folgte ihm.
Außerhalb der Stadtmauern wurde die Straße nicht schmaler. Auch hier kamen uns beladene Karren entgegen, Bauern mit Zügeln in der Hand, die mit der Zunge schnalzten, was ihre Ochsen aber nicht schneller machte. Einzig der Geruch veränderte sich schlagartig. Der Wind wehte hier draußen kräftig und hatte Platz, sich zu entfalten. Er vertrieb den Gestank nach Unrat und Fäulnis, nach Mensch und Tier.
Ich atmete tief ein und lauschte dem Gezwitscher der Vögel, das in der Stadt nicht zu hören gewesen war. Dabei bemühte ich mich, sie zu benennen, wie ich es von meinem Vater gelernt hatte.
Wir durchquerten kleine Wälder und kamen an gefurchten Feldern vorbei, auf denen die Saat bereits ausgebracht war. Als der Meister weit voraus war, schickte ich ein Stoßgebet zum Himmel, er möge langsamer werden. Es dauerte nicht lange, bis mein Gebet erhört wurde. Meister Jean hielt am Wegrand, um sich zu erleichtern.
Ich schloss zu ihm auf.
»Dein Vater redet ziemlich viel«, sagte er, während er pinkelte. Es waren die ersten Worte, die er seit dem Morgen an mich richtete.
Da es keine Frage war, gab ich auch keine Antwort.
»Er tut so, als wäre er der Baumeister von Chartres.«
»Aber das ist er!«, platzte es aus mir heraus.
»So? Als wir uns kennengelernt haben, war er noch Parlier. Weißt du, was das ist, Junge?«
Ich schüttelte stumm den Kopf.
»Das ist der Vorarbeiter auf der Baustelle. Er hat dafür zu sorgen, dass alle Handwerker den Anweisungen des Baumeisters Folge leisten.« Meister Jean lachte auf. »Damals hat er schon so viel gequatscht. Deshalb war Parlier, der Redner, eine treffende Bezeichnung für ihn.«
Ich wollte erneut widersprechen, aber Meister Jean ließ mir keine Zeit.
»Na ja«, sagte er, »wie hätte ich ablehnen sollen, als er fragte, ob er dich zu mir schicken könne?«
Er zog seine Hose hoch und ging weiter, während ich seinen seltsamen Worten nachhing. Hatte der Meister gar nicht gewollt, dass ich zu ihm kam? Wenn dem so war, würde ich ihm nicht länger als nötig zur Last fallen. Ich wollte Vater stolz machen und nach meiner Lehrzeit nach Chartres zurückkehren.
Ich ließ wieder Abstand zwischen uns. Nach einiger Zeit erreichten wir ein Dorf. Meister Jean hielt auf die Kirche zu. Sie war nicht so groß wie die von Chartres, längst nicht so hoch, gleichwohl beeindruckte sie mich, weil sie etwas Gewichtiges ausstrahlte. Ihr Stein war weißgrau, drei Portale führten hinein. Über ihnen waren spitze Bögen errichtet.
Erst auf den zweiten Blick verstand ich, was der Meister hier tat – er befehligte keineswegs den Bau einer Kirche, wie ich erwartet hatte, sondern nur den eines Glockenturms.
Ich war ein wenig enttäuscht, schließlich hatte mein Vater mir angekündigt, ich käme zu einem bedeutenden Baumeister. Mir schien seine Aufgabe ziemlich klein zu sein.
Doch das täuschte, denn ich begriff bald, dass dieser Turm bis zu den Wolken reichen sollte. In seinen unteren Etagen glich er dem, der auf der linken Seite bereits stand. Aber er war bereits dabei, über ihn hinauszuwachsen, und machte keine Anstalten, zu einem Dach zusammenzulaufen.
Ich fragte mich, warum Meister Jean das Gleichgewicht dieser Kirche für einen höheren Turm opferte. Schon jetzt machte das gesamte Gebäude den Eindruck, als würde es demnächst zur rechten Seite kippen. Weshalb verhinderte der Meister das nicht?
Mir schien, als wolle er mit dem Bau beweisen, dass er in der Lage wäre, mit der Turmspitze an den Himmel zu stoßen. Und damit nicht genug, sein Kirchturm sollte stabil und gleichzeitig zart aussehen.
Meine Scheu war wie weggeblasen, und mir kamen Hunderte Fragen in den Sinn. Doch ich bekam keine Gelegenheit, sie zu stellen. Meister Jean war bereits beschäftigt. Er redete mit einem Handwerker, ging zum nächsten, wechselte auch mit ihm ein paar Worte, rief einen dritten. Er war in seine Arbeit versunken.
Ich blickte an der Fassade empor. Auf dem Gerüst, das in schwindelerregender Höhe angebracht war, kletterten Bauarbeiter herum. An einem Seilzug brachten einige Männer einen Holzbottich in die Höhe, um dessen Griff das Seil gebunden war. Der Bottich schwankte in der Luft, was die Bauarbeiter aber nicht kümmerte, sie zogen ihn immer höher, bis schließlich oben auf dem Gerüst jemand danach griff.
Ein Mann kam auf mich zu, ein Handwerker, der Furcht einflößend wirkte. Zum einen hatte er schrundige Pockennarben an den Wangen, die wie ein vertrocknetes Flussbett wirkten, zum anderen Zähne, die spitz und scharf waren und an eine Säge erinnerten. Direkt vor mir spuckte er aus. Ich wich zurück. Er ging weiter seines Weges.
Mir viele Gedanken über diese Geste zu machen, dazu hatte ich keine Zeit. »Junge!«, rief der Meister. »Komm endlich. Oder bist du eingeschlafen?«
Er stand mit einem Mann zusammen, der ebenfalls bärtig war und dennoch ganz anders aussah. Wo das Gesicht von Meister Jean schmal und knochig wirkte, war das des anderen breit, er hatte einen weichen Mund und einen sanften Blick.
»Meister Victor, das ist der Junge, von dem ich gesprochen habe«, sagte Meister Jean und zeigte auf mich. »Er ist gestern aus Chartres gekommen, um bei uns etwas zu lernen. Ich möchte, dass Ihr ihm das Handwerk der Steinmetze beibringt.«
»Wie Ihr wünscht.«
»Gut.«
Ohne ein weiteres Wort ging Meister Jean davon und verschwand in einer Holzhütte am Fuße des Turms. Ich blieb mit dem Fremden zurück.
»Wie ist dein Name?«, fragte Meister Victor.
»Pierre.«
»Oh. Ein guter Name für einen Steinmetz.«
Mein Vater hatte mir die Bedeutung meines Namens erklärt, als ich ein Kind war, damals aber hinzugefügt, dass ich mit meinen dünnen Armen und Beinen kein Stein, sondern bestenfalls ein Kieselsteinchen sei und meine Eltern sich geirrt hätten. Meine Mutter widersprach. Sie meinte, mein Name würde mich mein ganzes Leben begleiten, und eines Tages wäre ich ein großer und kräftiger Mann, der ihn zu Recht trug.
»Komm, ich zeige dir, was wir machen.«
Der Steinmetz hatte eine warme Stimme, die gut zu seinem freundlichen Gesicht passte. Er führte mich an die Längsseite der Kirche. Dort lagerten Quader aus einem hellen Stein, riesige Klötze ursprünglich, die bereits in mehrere, etwas handlichere geteilt waren. Es gab vier Steinmetze, zwei Männer, eine Frau und einen Jungen, der nicht viel älter war als ich. Er war der Einzige, der aufschaute, als der Meister mich heranführte. Sie alle hatten eins dieser großen Steinstücke vor sich und bearbeiteten es mit Hammer und Meißel.
»Die Aufgabe des Steinmetzen ist es, aus den Quadern Steine in der richtigen Größe zu schlagen, die die Maurer dann verbauen. So weit, so einfach. Verstanden?«
Ich nickte stumm.
»Wir haben Maßbänder, aber ich sage dir, wir brauchen sie kaum. Mit der Zeit entwickelt man ein Gefühl dafür, wie groß der Stein werden muss. Unsere Kunst ist es, mit Hammer und Meißel die richtige Schlaghärte zu finden. Einerseits braucht es Kraft, sonst geben die Quader die Stücke nicht frei, andererseits kann jedes Zuviel alles kaputt machen. Wenn der Stein einen Riss hat, ist er nicht mehr zu gebrauchen.«
Er nahm Hammer, Meißel und ein Maßband von einem Tisch und reichte sie mir. »Vorerst wirst du mit den Resten üben. So hat jeder angefangen. Einen Quader kann ich dir nicht geben, die sind zu wertvoll.« Er führte mich zu einem Haufen Steinreste. »Such dir die besten Stücke aus. Behaue sie, und versuche, maßgerechte Steine aus ihnen zu machen. Hast du verstanden?«
»Ja, Meister.«
Er ließ mich allein. Ich schaute unauffällig zu den Steinmetzen. Was sie taten, sah einfach aus, deshalb zog ich mir frohen Mutes ein paar der angeschlagenen Steine aus dem Haufen, trug sie dorthin, wo ich arbeiten wollte, kniete mich nieder wie die Steinmetze und nahm mein Werkzeug in die Hände. Der Hammer war schwer, der Meißel hatte an seinem Kopf schon viele Schläge abbekommen, das Eisen war verformt.
Ich setzte den Hammer an und schlug zu. Ein paar graue Körner stoben zur Seite, doch der Stein selbst blieb wie vorher. So versuchte ich es ein zweites und drittes Mal, wandte mehr Kraft auf und traf zwischendurch mit dem Hammer meine Hand, was so schmerzhaft war, dass ich den Meißel fallen ließ und mir auf den Handrücken pustete und ihn sogar mit der Zunge ableckte. Am Stein hatte sich nichts verändert.
Ich blickte wieder auf die Steinmetze und versuchte zu verstehen, was sie anders machten. Nun erkannte ich, dass sie ihre Schläge vorbereiteten, indem sie mit dem Meißel zunächst eine Linie in den Stein ritzten, an der entlang sie den Stein spalten wollten. Sobald sie ihr Maß festgelegt hatten, holten sie stärker aus, und ihr Hammer traf jedes Mal den Meißelkopf, und dabei entstand ein charakteristisches Geräusch, das über dem weiten Platz lag, klong, klong, klong. Wenn der Stein abgeschlagen war, befühlten sie ihn, bevor sie noch ein paar Kanten begradigten. Am Ende setzten sie die Meißelspitze in einer Ecke an und schlugen mit dem Hammer noch einmal vorsichtig auf den Eisenkopf. Ich glaubte, dass sie ein Zeichen auf den Stein machten.
Die beiden Männer und die Frau schlugen in erstaunlich kurzer Zeit acht oder zehn Steine zurecht, bevor sie aufstanden und sie zu dem Ort brachten, wo sie gestapelt wurden. Der Junge hingegen trug jeden fertigen Stein einzeln dorthin. Er war ein Lockenkopf mit einem weichen Gesicht und blauen Augen. Am meisten fiel mir seine Langsamkeit auf. Er schaffte einen Stein in der Zeit, in der die anderen zwei schlugen. Sein Gang war ohne jede Eile, und weil er für jedes neue Stück aufstand, war er im Vergleich zu den anderen noch stärker im Hintertreffen.
Von den aufgeschichteten Steinen bedienten sich die Maurergehilfen, die mit ihren einrädrigen Holzkarren kamen, sie befüllten und zum unteren Ende der Seilwinde brachten. Weil sie regelmäßig Nachschub holten, wurde der Stapel der Steinmetze nie größer.
Ich wandte mich wieder meiner Arbeit zu. Ritzte mir, wie ich es gesehen hatte, zwei Linien, eine lange und eine kurze, in den Stein. Sie wurden ziemlich breit, was etwas plump aussah. Ich wusste nicht, wie dick die Linien der Steinmetze waren, deshalb schlug ich versuchsweise mit dem Meißel darauf. Es war wie verhext, egal, was ich probierte, ob ich mit viel Kraft hämmerte oder mit wenig, mein Klotz veränderte sich nicht. »So ein Mist!«, stieß ich halblaut hervor.
Inzwischen stand die Sonne hoch über uns, und die Wärme auf dem Platz mischte sich mit den Schlaggeräuschen, mit diesem ewigen Klong, klong, klong. Vom Staub bekam ich Durst. Mein Magen knurrte. Ich hatte zuletzt am vorigen Abend etwas gegessen. Von zu Hause war ich zwei Mahlzeiten gewöhnt, eine am Morgen und eine am frühen Abend. Außerdem gab es immer genug verdünnten Wein. Beides fehlte mir hier.
Vor allem ärgerte ich mich darüber, dass ich nicht weiterkam. In einem letzten verzweifelten Versuch ließ ich den Hammer aus großer Höhe auf den Meißel treffen.
Das Ergebnis war, dass der blöde Klotz entzweibrach.
Ich schaute zu den anderen und hoffte, dass niemand mein Missgeschick gesehen hatte.
»Mit einem stumpfen Meißel kann man nicht arbeiten«, sagte jemand hinter mir. Ich drehte mich um. Es war der Junge mit den Locken. »Komm. Wenn’s der Meister nicht tut, dann zeige ich dir, wie man die Kante schärft.«
Er führte mich zu einem Rad aus einem grobkörnigen Stein, das von einer Achse gehalten und mit einer Kurbel in Schwung gesetzt wurde. »Gib mal her.«
Ich gab ihm meinen Meißel. Der Junge setzte das Rad in Bewegung und hielt die spitze Seite des Meißels dagegen. Funken flogen auf. Ich wich unwillkürlich zurück, aber der Junge drehte das Rad schneller, bis das Eisen laut und schrill am Stein kratzte und der Funkenflug stärker wurde. Ohne die Kurbel loszulassen, drehte der Junge den Meißel, um auch die andere Seite zu schärfen. Ein ganzer Funkenregen in Silber und Gold sprühte hervor. Der Junge schenkte dem Schauspiel keine Beachtung. Er pustete den Staub von der Meißelspitze, dann reichte er mir mein Werkzeug.
»Jetzt sollte es gehen.«
»Danke.«
»Ich heiße übrigens Clément.«
»Pierre«, erwiderte ich.
»Freut mich. Wir sehen uns.« Er hob die Hand und ging davon.
»Warte«, rief ich ihm hinterher. »Was macht ihr da für seltsame Zeichen auf die Steine?«
»Jeder hat eins. Nach ihnen werden wir bezahlt. Zwei Steine ein Denier, so ist die Regel.«
Er nickte mir zu und kehrte zu seinem Quader zurück. So hörte er das lang anhaltende Knurren nicht, das mein leerer Bauch von sich gab. Mein Hunger war mittlerweile so groß, dass ich es kaum noch schaffte, den Hammer anzuheben, geschweige denn einen richtigen Schlag zu setzen, und das gerade jetzt, wo ich dank Cléments Hilfe Aussicht hatte, die Aufgabe zu bewältigen.
Als Meister Victor schließlich rief, es sei Mittagspause, war ich erleichtert. Ich stand auf. Meine Knie waren weich, im Kopf drehte es sich mir. Für einen Augenblick wurde mir schwarz vor Augen. Dann folgte ich Clément und den anderen Steinmetzen in eine der Holzhütten an der Längsseite der Kirche.
Es waren grob gezimmerte Verschläge mit Türen, die nicht richtig schlossen. Jedes Gewerk hatte seine Unterkunft, die Maurer, die Zimmerer, die Mörtelmischer und natürlich auch wir, die Steinmetze. Die erste und größte Hütte war dem Baumeister vorbehalten. Ihr Fundament war aus Stein, sie sah solider aus. Ob Meister Jean dort war, wusste ich nicht, ich hatte ihn den ganzen Vormittag nicht gesehen.
In der Hütte erwartete mich eine böse Überraschung. Die Steinmetze hatten sich ihr Essen mitgebracht. Es war hauptsächlich Brot, harter Käse, der in kleine Leintücher eingeschlagen war, und gekochtes Getreide oder Mus aus Erbsen und Bohnen. Auf einem Regalbrett lagen Wasserschläuche, und sie alle griffen mit großer Selbstverständlichkeit nach einem. Genau wie die Steine hatten sie Zeichen. Jeder wusste, welcher ihm gehörte. Nur ich hatte keinen. Es war zum Heulen.
Ich setzte mich auf einen Stuhl an der Wand. Meine Arme sackten herab, die Beine waren schwer. Um nicht zusehen zu müssen, wie die anderen aßen, schloss ich die Augen und wäre am liebsten eingeschlafen. Durst und Hunger waren übermächtig.
»Hast du nichts zu essen, Junge?«
Ich schlug die Augen auf. Es war die Frau, die sich an mich wandte. Ihre Stimme war tief, auf ihrem Gesicht lag Staub. Mit ihren kleinen braunen Augen schaute sie zu mir. Mein trockener Mund öffnete sich für eine Antwort, aber ich brachte nur ein leises Krächzen heraus, das klang wie von einem Vogel, der aus dem Nest gefallen war. Sie saß an der gegenüberliegenden Wand. Ich wich ihrem Blick aus.
»Kannst du nicht reden?«, fragte einer der Männer spöttisch. Er hatte ein grobes Gesicht mit einer dicken Nase, die von vielen roten Adern durchzogen war. Ich hörte ihn schmatzen.
»D … doch«, brachte ich mühsam hervor.
»Er hat nicht mitbekommen, dass die Fastenzeit vorüber ist«, sagte der andere Mann, der neben dem ersten saß, und lachte. Ich sah, dass ihm mehrere Zähne fehlten.
»Du lebst bei Meister Jean?«, fragte die Frau.
»Ja.«
»Er ist wohl nicht besonders umsichtig.« Sie wandte sich zu den Männern um. »Kommt, wir geben dem Jungen etwas ab.«
Sie nahm eine Tonschüssel aus dem Regal, pustete den Staub heraus und kippte etwas von ihrer Getreidegrütze hinein. Auch ein Stück von ihrem Käse brach sie ab.
»Also ich nicht, Ysobel«, sagte der Steinmetz mit der Knollennase. »Wenn er nicht daran denkt, dass der Tag lang ist und man mittags Hunger bekommt, muss er dafür büßen. Wir kennen ja nicht einmal seinen Namen.«
»Er heißt Pierre«, sagte Clément, bevor ich Spucke sammeln konnte, um für mich selbst zu sprechen.
Nach diesem Satz durchströmte mich ein Gefühl von Dankbarkeit, das bis in die Finger und die Fußspitzen ging. Ich schloss die Augen und wünschte mir, diesen Jungen zum Freund zu haben.
Clément stand auf, ging zu Ysobel und schüttete ebenfalls etwas von seiner Grütze in die Schüssel, die für mich gedacht war.
»Hast du auch Durst?«, fragte er.
Ich nickte.
Er reichte mir seinen Schlauch. Ich setzte ihn an. Ich trank langsam, hielt die Flüssigkeit in meinem Mund und spülte den Staub aus. Einen zweiten Schluck zu trinken wagte ich nicht, sondern reichte Clément den Schlauch zurück.
Ysobel gab mir die Schüssel. Als ich sie nahm, schossen mir plötzlich Tränen in die Augen, und ich kämpfte darum, nicht loszuheulen wie ein kleines Kind, das versorgt werden musste.
»Sind wir Steinmetze, oder sind wir das nicht?«, fragte Ysobel den Mann mit der roten Nase.
»Wir schon. Ob er einer ist, wissen wir nicht.«
»Sitzt er in unserer Hütte?«, gab sie zurück. »Also wird er wohl zu uns gehören.«
Die Tür wurde geöffnet. Meister Victor kam herein. Er schaute sich um, während er sich am Bart kratzte. »Es gibt doch keinen Streit in der Hütte?«
»Wir streiten nicht«, erwiderte Ysobel, die noch stand. »Wir sind nur unterschiedlicher Meinung darüber, ob wir Pierre Essen und Trinken abgeben oder nicht.«
Der Meister schaute zu mir. Dann nahm er den letzten Schlauch, der dort lag, vom Regalbrett und reichte ihn mir. Ich nahm ihn mit der Linken, denn in der anderen Hand hatte ich Ysobels Schüssel.
»Trink, Junge. Bei uns verdurstet keiner. Und morgen bringst du dir selbst etwas mit.«
»Ja, Meister«, sagte ich. »Bestimmt.«
Satt und mit dem geschliffenen Meißel gelang es mir am Nachmittag, mehrere Steine zu spalten. Wie ich es bei den Gesellen beobachtet hatte, zog ich mir zunächst Markierungslinien, setzte das Werkzeug darauf und trieb es hinein. Mit der Zeit wurden meine Linien schmaler, und die Stücke, die ich abschlug, ähnelten von der Form her schon denen auf dem Stapel, nur dass sie viel kleiner waren, weil mein Ausgangsmaterial aus dem Abfall stammte.
Nach der Arbeit wischten die Steinmetze mit Lappen den Staub von ihrem Werkzeug, brachten es in die Bauhütte und wuschen sich Hände und Gesicht an einer Regentonne. Ich machte ihnen alles nach und stand schließlich vor dem Baustellentor, bereit für den Rückweg. Meine Hände waren sauber und trocken, nur von den Haaren tropfte noch ein wenig Wasser.
Meister Jean war nicht zu sehen.
Ich ging zu seiner Hütte und klopfte an die Tür. Da ich keine Antwort bekam, öffnete ich sie. Der Meister war nicht da.
In der Hütte sah es viel ordentlicher aus als bei den Steinmetzen. In der Mitte stand ein Arbeitstisch mit einigen Kohlestäbchen darauf. Nun verstand ich, warum der Meister immer schwarze Finger hatte. Mit diesen schmalen Stiften zeichnete er. Die Kerzen brannten nicht. Ich entdeckte Baupläne, manche zusammengerollt, andere offen auf dem Tisch, wo sie von Steinen gehalten wurden.
Mir wurde auch klar, warum Meister Jean sich keinen Proviant mitgenommen hatte. Auf einem zweiten Tisch an der Seite lagen Vorräte, ein Stück Schinken, eine lange Wurst und Brot.
Ich ging hinaus und fühlte mich hundeelend. Wie konnte er mich denn allein hier zurücklassen? Wie sollte ich jemals nach Hause finden?
Da kam Clément auf mich zuspaziert. Ich hatte vermutet, dass er wie alle anderen längst fortgegangen war.
»Na, ist Meister Jean verschwunden?«, fragte er.
»Sieht ganz danach aus.«
»Das wundert mich nicht.«
»Wie meinst du das?«
Er zuckte mit den Achseln. »Wenn du willst, gehen wir zusammen zurück nach Paris.«
»Weißt du denn, wo sein Haus ist?«
»So ungefähr. Ich bring dich hin.«
»Das ist nett von dir.«
Er reichte mir seinen Schlauch, wir tranken jeder einen Schluck und verließen den mittlerweile verwaisten Kirchplatz.
»Was hältst du von deinem Meister?«, fragte er unterwegs.
Als Erstes fiel mir die Düsternis ein, die von Meister Jean ausging. Dann dachte ich an die wenigen Worte, die er machte. Und an den Turm, den er entworfen hatte. Ein eindeutiges Bild ergab sich aus alldem nicht. »Ich weiß nicht. Ich bin erst gestern zu ihm gekommen. Was denkst du?«
Clément schaute über die Felder und Wiesen. Einige frühe Blumen und die ersten Obstbäume blühten. Am Morgen hatte ich kaum Augen für die Pracht gehabt. Jetzt fand ich sie wunderschön.
»Ich sehe ihn jeden Tag«, sagte er, »aber ich kann nicht behaupten, ihn zu kennen. Er hat noch nie mit mir geredet.«
»Er ist schweigsam, ja«, verteidigte ich ihn.
»Er ist mehr als schweigsam.«
»Was meinst du?«
»Er ist abweisend«, erwiderte er. »Man hat immerzu den Eindruck, man dürfte ihn in seinen Gedanken nicht stören. Unser Meister Victor ist ganz anders. Er hat eine Nase für das, was passiert. Als er heute Mittag in die Bauhütte gekommen ist, wusste er sofort, dass wir gestritten haben. Das riecht er, und dann mischt er sich ein. Ich würde meinen Tageslohn wetten, dass Meister Jean so etwas nicht bemerken würde.«
»Weil er an seinen Bau denken muss.«
»Ja, vielleicht.«
»Der Turm wird wohl bis an den Himmel reichen«, sagte ich.
»So sieht es aus. Genau wissen wir es aber nicht, weil er uns seine Pläne nie gezeigt hat. Trotzdem, du hast recht, die Idee ist ziemlich wagemutig. Und dennoch …«, sagte er achselzuckend.
Clément brachte seinen Satz nicht zu Ende. Ich verstand ihn auch so. Mein Vater hatte mich bei einer seltsamen Familie abgegeben. Der Mann redete nicht, die Tochter hatte mit einem Löffel nach mir geworfen. Meine einzige Hoffnung war Madame.
»Komm«, sagte er, »wir tragen uns. Abwechselnd. Du fängst an!«
Bevor ich Einspruch erheben konnte, sprang er mir auf den Rücken, klammerte die Beine um meine Hüften und hielt sich mit den Händen an meiner Schulter fest. Ich war erschöpft und kam mit der Last auf mir kaum voran, schon nach wenigen Schritten musste ich ihn wieder abschütteln.
»Tut mir leid, Clément, aber du bist einfach zu schwer«, keuchte ich.
»Werd nicht frech, Frischling«, sagte er grinsend. »Aber ich will mal nicht so sein an deinem ersten Tag.« Er beugte sich nach vorne und forderte mich auf, mich auf seinen Rücken zu setzen. Man merkte, dass er durch die Arbeit deutlich besser in Form war als ich. Das weckte meinen Ehrgeiz, und kurz darauf wechselten wir uns wieder ab. Bald wurde ein Spiel daraus. Wir zählten, wie lange einer den anderen tragen konnte, und darüber vergaß ich, dass ich keine Ahnung hatte, wo es langging. Es war mir egal. Zum ersten Mal seit meiner Ankunft hatte ich keine Sorgen.
In Paris, auf der Hauptstraße, die mir am Morgen so endlos vorgekommen war, entdeckte ich in all dem Gedränge Meister Jean. Er stand mit einem anderen Mann vor einer Gaststätte. Beide hatten Becher in der Hand und ließen sie durch den offenen Fensterladen auffüllen.
Ich trat schüchtern heran.
»Ah, Junge, da bist du ja endlich. Wir müssen nach Hause, Nathalie wartet bestimmt schon mit dem Essen.«
Meine gute Laune war so schnell verflogen, wie sie aufgekommen war. »Ich fürchte, du hast recht«, flüsterte ich Clément zu. »Wenn es nicht anders geht, redet er zwar mit mir, aber er hat sich nicht einmal meinen Namen gemerkt.«
Clément nickte. »Das wird schon. Wir sehen uns morgen. Mach’s gut.« Er hielt inne und grinste. »Pierre«, sagte er dann.
Vor dem Haus des Meisters saß seine Tochter auf der Bank am Schuppen. Sie hielt einen Holzklotz in der einen Hand und ein Messer in der anderen. Versunken schabte sie mit der Klinge über das weiche Holz, hoch und runter, immer wieder. Dabei schwangen ihre Haare hin und her. Erst als wir heran waren, blickte sie auf.
»Guten Abend, Vater«, sagte sie.
An mir schaute sie vorbei. Ich konnte mir ihr Verhalten nicht erklären. Aber ignorieren konnte ich sie genauso wenig. Irgendetwas hatte sie an sich, das mich interessierte.
Als wir am Esstisch Platz genommen hatten, zeigte sie mit dem Finger auf mich und sagte: »Der soll nicht hier sitzen.«
»Wo soll er denn hin?«, fragte Madame.
»Von mir aus in den Schuppen.«
»Kind, versündige dich nicht an der Gastfreundschaft. Sie ist heilig«, sagte Madame. »Kommt, lasst uns beten.« Sie faltete die Hände.
»Nein!«, rief Agnès und klang jetzt schrill. »Er soll verschwinden!«
Ich öffnete den Mund für eine Erwiderung, aber Madame war schneller und sprach für mich.
»Er lebt jetzt hier«, entgegnete sie. Sie klang immer noch sanft.
»Tut er nicht.«
»Agnès, nun ist es gut.«
Mir fiel auf, dass der Meister sich nicht einmischte. Ich fragte mich, ob er wohl auch beim Essen an seinen Kirchturm dachte. Er kannte meinen Vater, deshalb war ich hier. Aber seiner Tochter gegenüber trat er nicht für mich ein. Es wurde wieder offensichtlich, dass er sich nicht um mich scherte. Ich vermisste meinen Vater. Zwar war auch er für gewöhnlich schweigsam, dafür aber herzlich und zugewandt.
»Nun lasst uns beten.«
Wir falteten die Hände, nur Agnès nicht, die ihre demonstrativ auf den Tisch legte. Als Madame ihr Gebet gesprochen hatte, verweigerte sie auch das »Amen«. Ihre Mutter warf ihr einen scharfen Blick zu, verzichtete aber darauf, sie erneut zu ermahnen.
Gleich nach dem Essen ging ich nach oben und legte mich auf den Strohsack. Ich war erschöpft von dem langen Tag, doch mehr als das beschäftigte mich ein Kummer, der mir auf die Brust drückte. Ich fühlte mich wieder so verloren in dem Zimmer, einsam, von der Welt abgeschnitten, und hatte Sehnsucht nach Chartres. Ich stellte mir mein Elternhaus vor und die Geschwister, vor allem meine kleine Schwester Marie, und musste auch an meine tote Mutter denken.
Meine Erinnerungen machten mich so traurig, dass ich trotz meiner Müdigkeit lange brauchte, um einzuschlafen. Es war seltsam, Arme und Beine lagen schwer auf dem Stroh, doch der Schlaf wollte nicht kommen. Schlagartig fiel mir ein, dass ich vergessen hatte, Madame um Proviant für den nächsten Tag zu bitten, und nun war es dieser Gedanke, der mich zu quälen begann. Ich wagte nicht, noch einmal hinunterzugehen, fürchtete mich vor dem abweisenden Meister und seiner bösen Tochter, und meine Beine und der ganze Körper waren so kraftlos, dass sie jede Bewegung verweigerten. Dagegen stand die Sorge vor dem nächsten Tag, vor dem Durst, vor allem vor der Blamage am Mittag in der Bauhütte. Und dennoch kam ich am Ende nicht mehr hoch und schlief mit dem festen Vorsatz ein, mein Versäumnis am nächsten Morgen auszugleichen.
III
»Wir machen heute einen kleinen Umweg«, sagte Meister Jean zu mir, als wir nach einem langen Tag in Saint-Denis auf dem Rückweg nach Paris waren.
Es war Sommer. Ich arbeitete seit vier Monaten als Steinmetz, schlug und stapelte Steine und schärfte meinen Meißel am Schleifstein wie alle anderen auch.
Meistens ging ich mit Clément nach Hause, und wir dachten uns unterwegs Spiele aus, verbanden dem anderen die Augen und führten ihn wie einen Blinden, rannten kurze Stücke um die Wette, hinkten so weit wie möglich auf einem Bein oder gingen rückwärts, bis einer stolperte.