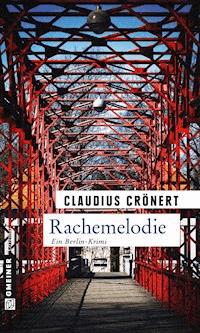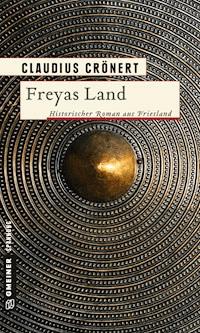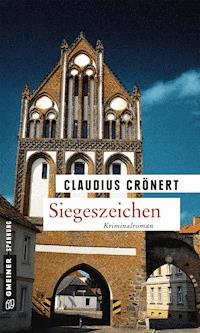Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Hannes Krell
- Sprache: Deutsch
Hamburg 1941: Kriminalkommissar Krell, ein gewissenhafter Beamter, ermittelt in einer Mordsache. Als er feststellt, dass ein hoher SS-Mann in den Fall verwickelt ist, untersagt ihm sein Vorgesetzter weitere Nachforschungen. Aber der Kommissar kann den Fall nicht ruhen lassen. Doch dann wird seine Tochter Jette bei einem Swing-Abend gesehen. Die 16-Jährige hatte kurz zuvor die verbotene Swingmusik für sich entdeckt - und die erste Liebe. Während sich Krell für das Wohl seiner Familie entscheidet, bricht es Jettes Herz, als ihr Liebster eingezogen wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Claudius Crönert
Letzter Tanz auf Sankt Pauli
Roman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2021 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © ullstein bild - Ewald Hoinkis und ullstein bild - mauritius
ISBN 978-3-8392-6930-5
Eins
Der Reisewecker auf dem Nachttisch zeigte kurz nach 1 Uhr, als im Wohnzimmer das Telefon klingelte. Hannes Krell versuchte, das Geräusch in seinen Traum einzubauen, doch der schrille Ton passte nicht, deshalb öffnete er die Augen und stand schnell auf. Er wollte vermeiden, dass die ganze Familie wach wurde. Mit einer Hand am Geländer tastete er sich im stockdunklen Haus die Treppe hinab, einerseits eilig, damit der Anrufer nicht auflegte, andererseits vorsichtig, denn die Stufenbretter knarzten laut. Das Telefon hatte einen durchdringenden Ton, der noch lauter war, weil die Wohnzimmertür offen stand.
Krell riss den Hörer von der Gabel. Die Dienststelle, wie vermutet. Ein Toter auf Sankt Pauli. Neben dem Apparat lag ein Block, dazu ein Bleistift. Da kein Licht brannte, konnte Krell nichts sehen. Trotzdem kritzelte er die Adresse, die der Kollege ihm durchgab, auf das raue Papier.
»Ist gut«, sagte er, »rufen Sie bitte Kriminalassistent Schubert an. Ich mache mich auf den Weg.«
Das Badezimmer lag oben, er musste die knarrende Treppe also wieder hinauf. Unrasiert aus dem Haus zu gehen, war eine lächerliche Vorstellung, und außerdem hingen Hemd und Anzug im Schlafzimmer. Im Bad hatte er das Fenster mit schwarzer Pappe verklebt, so konnte er die Lampe über dem Spiegel anmachen, zumal es nur eine Funzel mit mattem Schein war. Eine stärkere Birne durften sie nicht benutzen, das hatten sie vom Garten aus überprüft, nur dieses schwache Licht war nicht zu sehen. Er schlug die Rasierseife schaumig und pinselte sich ein. Das Messer war nicht richtig scharf, es musste geschliffen werden. Er schob diese Aufgabe bereits seit mehreren Tagen vor sich her, jetzt war er froh über seine Nachlässigkeit, denn wenn man schläfrig war und gleichzeitig in Eile, schnitt man sich leichter.
Er gähnte. Ihm ging ein Gedanke durch den Kopf, den er festhielt: Er konnte selbst entscheiden, wie er sich innerlich zu diesem neuen Fall stellte. Es gab viele Gründe, sich zu ärgern und zu fluchen – nur zwei Stunden Schlaf, und mehr würden es an diesem Tag auch nicht werden, dann das verpasste Frühstück mit der Familie, und möglicherweise würde er auch noch einer Hinterbliebenen die Todesnachricht überbringen müssen. Genauso gut aber konnte er sich frohgemut ans Werk machen. Er war Kriminalbeamter, dies war seine Arbeit, er machte sie gerne, es verschaffte ihm geradezu Freude, mit immer neuen Erkenntnissen und Details Licht ins Dunkel zu bringen. Nicht zu verachten war auch, dass ihm seine Stellung einige entscheidende Vorteile brachte, ein sicheres Einkommen und vor allem, dass er nicht in den Krieg musste. Es gab derzeit wenige Männer in Deutschland, die so gut dastanden wie er.
Dies war die richtige Einstellung. Er nickte seinem Spiegelbild zu, wusch sich den Rasierschaum vom Gesicht, trocknete es ab und schaltete die Lampe aus.
Leise drückte er die Türklinke zum Schlafzimmer herunter.
Wiebke war wach. »Musst du los?«
»Ja.«
»Soll ich dir eine Tasse Kaffee kochen?«
Sie hatten sowieso nur Ersatzkaffee im Haus, ein Zichoriengebräu, das einen nicht wach machte. »Nicht nötig. Schlaf weiter.«
»Bestimmt?«
»Ganz bestimmt.«
Mit Hut und Mantel trat er hinaus in die Nacht. Der Mond stand hinter einer Schleierwolke und schien milchig. Er gab das einzige Licht weit und breit. Krells Augen passten sich schnell an, sodass er zumindest Schemen ausmachen konnte. Die Verdunklungspflicht galt seit Kriegsbeginn, seit anderthalb Jahren, Zeit genug, sich daran zu gewöhnen. Die Bewohner ihrer Siedlung hielten sich streng daran, nicht so sehr, weil der Blockwart sie kontrollierte und strenge Strafen aussprach, sondern weil niemand wollte, dass sein Haus aus der Luft gesehen wurde. Die Flugzeuge der Tommys kamen vornehmlich nachts, die Piloten setzten darauf, zu dieser Zeit die deutsche Flak zu unterlaufen.
Krells Opel stand vor der Tür. Nach Vorschrift hatte er die Lampen zu schmalen Schlitzen verklebt. Bei der nächtlichen Fahrt würde ihr Strahl ihm kaum nützen, aber er fuhr den Weg jeden Tag und würde ihn finden, auch ohne viel zu sehen. In den Straßen war es stockfinster, in keinem der Häuser brannte auch nur das kleinste Lämpchen. Der Mond war inzwischen von einer dichteren Wolke verdeckt.
Krell bog auf die Landstraße. Von nun an ging es praktisch nur noch geradeaus. Erst am Backsteinbau des Altonaer Bahnhofs hielt er sich südwärts Richtung Elbe. Vor ihm tauchte der Schornstein der Sankt Pauli-Brauerei auf. Ein Peterwagen, mit zwei Rädern auf einem Bürgersteig abgestellt, zeigte ihm, dass er angekommen war. Auch an diesem Auto waren die Lampen ausgeschaltet. Die Regeln galten für die Polizei genauso wie für alle anderen. Nachts durfte man nicht einmal das Blaulicht anstellen, selbst in Notfällen nicht.
Krell parkte hinter dem Peterwagen und schritt durch eine Einfahrt, die aus zwei Backsteinpfeilern bestand. Vor ihm lag ein düsterer Hof mit einem Boden aus gestampftem Lehm, trocken und staubig, denn es hatte, untypisch für Hamburg, lange nicht geregnet. Das war ein Vorteil, falls es Spuren gab. Außerdem schonte es seine Schuhe; nichts klumpte und verdreckte mehr als aufgeweichter Lehm. Am Ende des Hofes machte er die Konturen eines Schuppens aus und sah beim Näherkommen, dass er wie ein Kaninchenstall aus ungehobelten Brettern bestand, die auf einem knöchelhohen Fundament aus Steinen aufgerichtet waren. Das Dach war ebenfalls aus Holz, mit ein wenig Teerpappe darüber. Die Schuppentür stand offen, die beiden Schupos hatten sich wie zwei Torwächter davor postiert. Sie rauchten, was Krell nicht passte, weil die Spurensicherung ihre Kippen dem Täter zuordnen würde. Er ging weiter. Der gesamte Platz hatte etwas Gespenstisches, wie ein Friedhof bei Nacht. Kein guter Ort zum Sterben.
Er nickte den beiden Schupos zu und sagte »Moin.«
Sie grüßten zurück.
»Wer hat ihn gefunden?«
Die zwei sahen aus wie Brüder, beide groß gewachsen, hager und kahl. »Wir«, sagte der ältere und ranghöhere der beiden. »Es gab einen Anruf auf der Wache.« Er sprach breites Hamburgisch.
»Von wem?«
»Anonym. Eine Frauenstimme. Das hat der Kollege, der das Gespräch entgegengenommen hat, jedenfalls gesagt. Na, und dann sind wir hergefahren und haben ihn gefunden. Der hatte wohl keine Lust mehr. Wir haben Ihre Dienststelle angerufen.«
»Von dem Fernsprecher da vorne.« Der jüngere zeigte in Richtung Hafenstraße und die Landungsbrücken. Krell schaute dorthin, aber es war kaum etwas zu erkennen, der Hafen lag genauso im Dunklen wie der Rest der Stadt, bestenfalls ein paar Umrisse waren auszumachen. Auch bei Tageslicht gab es dort nicht mehr viel zu sehen, denn Handelsschiffe machten nur noch selten fest. Die zivile Seefahrt war wegen des Krieges weitgehend eingestellt. In der Elbmündung hatten die Briten Minen abgeworfen, in der Nordsee genauso.
Krell forderte die Schupos auf, das Rauchen einzustellen und ihre ausgedrückten Kippen aufzulesen. Dann trat er in den Schuppen. Da drin war es noch dunkler, weil der Mond, so schwach er auch leuchtete, nicht hereinschien. Krells Augen mussten sich wieder umstellen, und bis es so weit war, hörte er nur das surrende Geräusch von Fliegen und roch den Geruch nach Feuchtigkeit, nach Moder, der streng war, obwohl die Tür offenstand. Krell war versucht, sich die Nase zuzuhalten. Als er zumindest ein paar Konturen wahrnehmen konnte, blieb der Eindruck eines schäbigen Ortes, selbst für Sankt-Pauli-Verhältnisse. Für einen Schuppen war der Raum zu groß, eher handelte es sich um eine kleine Lagerhalle. Möglicherweise gehörte sie zur Brauerei, war aber offensichtlich nicht in Betrieb, denn sie stand leer. Eine schwarze Lampe baumelte von der Decke. Der Fußboden bestand auch hier aus gestampftem Lehm. Die Bretterwände hatten daumenbreite Fugen, die Schiebetür rollte auf einer rostigen Schiene. Spinnen hatten sich breitgemacht, ihre Netze hingen in den Ecken und vor dem Fenster.
Er knipste seine Taschenlampe an und beleuchtete den Mann am Boden. Während er ihn betrachtete, kehrte der Gedanke zurück, den er beim Rasieren vor dem Spiegel gehabt hatte. Er war bei dieser Arbeit in seinem Element, sie war ein Teil von ihm, über ihr konnte er vieles, oft sogar alles andere vergessen. Man musste nicht jubeln, wenn man mitten in der Nacht irgendwo auf Sankt Pauli vor einem Leichnam stand, aber beklagen brauchte man sich auch nicht.
Auf den ersten Blick sah er, dass der Tote sich nicht selbst das Leben genommen hatte, wie die Schupos vermutet hatten. Ein Selbstmord war das sicher nicht. Die Pistole lag zwar in der Hand des Toten, der Lauf zeigte aber Richtung Becken. Hätte er sich im Stehen erschossen, in den Kopf, wo die Wunde war, wäre die Waffe heruntergefallen und läge irgendwo in der Nähe. Wenn er sich aber vorher hingelegt und dann abgedrückt hätte – was schon unwahrscheinlich genug war, niemand legte sich gerne in den Dreck, auch nicht in seinen letzten Minuten – dann hätte der Arm mit der Waffe in der Hand diese Bewegung zum Becken hin nicht mehr ausführen können. Und selbst wenn der Mann nach dem Schuss noch einen Rest Leben in sich gehabt und den Arm bewegt hätte, müsste es eine Spur im Staub geben. Die fehlte aber. Nein, hier wollte jemand die Polizei auf eine falsche Fährte locken, höchstwahrscheinlich der Mörder. Bei den beiden Schupos war es ihm auch gelungen.
Krell besah sich den Toten genauer. Die eine Hälfte des Kopfes war durch den Einschuss ziemlich entstellt. An der Schläfe hatte die Kugel ein kraterartiges Loch gerissen, das inzwischen mit getrocknetem Blut verklebt war. Der Einschlag war so heftig gewesen, dass das Auge herausstand und dem Gesicht, das womöglich einmal ganz ansehnlich gewesen war, etwas Abstoßendes gab, so sehr, dass man kaum hinsehen mochte. Der Mann war schmal, auch recht klein, kaum größer als einen Meter 65. Er trug einen graubraunen Anzug, an Ärmeln und Hosensaum abgestoßen, das Muster ausgebleicht, die Wolle an manchen Stellen fadenscheinig. Bei einem seiner Schuhe war die Sohle so dünn, dass das Leder bald ein Loch bekommen hätte. Ein Hafenarbeiter war er nicht, die trugen ihre blauen Hosen und Drillichjacken, und für körperliche Arbeit wäre der Tote sowieso zu schmächtig gewesen. Krell verortete ihn eher auf die Reeperbahn. Ein Animateur an einer Lokaltür vielleicht oder ein Hausmeister in irgendeinem Etablissement. Womöglich ein Arbeitsloser, der sich an der Wehrmacht genauso wie an staatlichen Arbeitsprogrammen vorbeigemogelt hatte. Was mochte so einer ausgefressen haben, dass ihn jemand mit Vorsatz und Planung getötet hatte? Das würde die Frage sein, die ihn auf die Spur des Täters brachte, denn nach einem eskalierten Streit, nach Wut und Prügel und schließlich einer Pistole, sah die Situation nicht aus. So etwas erledigte man direkt vor Ort, dafür ging man nicht in einen Schuppen fernab der Hauptstraße.
Krell zog seine Taschenuhr heraus. Es war inzwischen 2.30 Uhr. Man konnte nicht abschätzen, wann die Kollegen von der Spurensicherung und der Gerichtsmedizin eintreffen würden, unterbesetzt, wie sie waren. Es war überall dasselbe: Mitarbeiter hatten sich freiwillig zur Wehrmacht gemeldet, waren eingezogen oder in die eroberten Länder versetzt worden, und den Aderlass merkte man inzwischen bei allen Dienststellen der öffentlichen Verwaltung, auch bei der Polizei. Gejammert wurde trotzdem nicht, auch Krell verbot es sich. Es galt, mit dem klarzukommen, was war, und das Beste daraus zu machen.
Immerhin traf Schubert ein, sein Kriminalassistent. Er streckte den rechten Arm aus. »Heil Hitler.«
Krell nickte ihm zu, während die Schupos mit den gleichen Worten und ebenfalls ausgestreckten Armen grüßten, wie es deutschen Beamten vorgeschrieben war.
»Wir warten auf die Kollegen von der Technik?«, fragte Schubert, nachdem er einen Blick auf die Leiche geworfen hatte.
»Ja«, erwiderte Krell. Er hielt die Hand vor den Mund, damit Schubert nicht sah, dass er gähnte. »Nach Lage der Dinge kann das allerdings dauern.«
»Wenn Sie wollen«, schlug Schubert vor, »greife ich dem Mann mal vorsichtig in die Jackentaschen. Vielleicht erfahren wir so, wer er war.«
Krell gab nicht gleich eine Antwort. Ein solches Vorgehen verstieß eindeutig gegen die Dienstvorschrift. Er schaute seinen Assistenten an. Schubert mochte um die 30 sein, wirkte aber älter, weil er weitgehend kahl war. Er war ein Provinzei irgendwo aus dem Holsteinischen und noch nicht lange dabei, trotzdem hielt Krell ihn schon jetzt für einen besseren Bewerber als die meisten jungen Männer, die er in den letzten Jahren erlebt hatte. Schubert stellte sich geschickt an und dachte mit, und er wirkte auch intelligent, wozu vor allem seine Nickelbrille beitrug, die ihn ein wenig wie einen Professor, zumindest wie einen Lehrer aussehen ließ. In nicht allzu langer Zeit würde der Assistent einen guten Kommissar abgeben, aller Wahrscheinlichkeit nach bei der Hamburger Kripo. Es gab keinen Grund für ihn, woanders hinzugehen, und eingezogen wurde er nicht mehr. Er war 1939 beim Polenfeldzug dabei gewesen und angeschossen worden, ausgerechnet ins Knie. Jetzt war es steif. Er zog das Bein nicht nach, machte aber beim Auftreten jedes Mal eine seltsame Bewegung, als drehe er das kaputte Gelenk von außen nach innen. Es sah fast wie ein Tanzschritt aus.
Krell nickte. »Also los.«
Schubert stellte sich breitbeinig über den Leichnam und beugte sich herunter, wobei sein Rücken gerade blieb, fast wie ein Brett. Beide Knie hielt er durchgedrückt. Krell hatte sich inzwischen daran gewöhnt, dass seine Haltung manchmal seltsam aussah, genauso wie er akzeptiert hatte, dass Schubert nicht in der Lage war, Verbrecher zu Fuß zu verfolgen. Viel wichtiger war, dass er Aufgaben wie die jetzige gewissenhaft erledigte. Vornübergebeugt knöpfte er dem Mann vorsichtig das Sakko auf und griff mit spitzen Fingern erst in die linke, dann in die rechte Innentasche. In beiden fand er nichts, woraufhin er die Außentaschen betastete, die jedoch ebenfalls leer waren.
Er kam wieder hoch. »Die Hose auch?«
Krell seufzte und drehte den Kopf zur Seite. Es gefiel ihm ganz und gar nicht, seinen Segen zu einem derart vorschriftswidrigen Tun zu geben. Die Regel war eindeutig: Man hatte einen Leichnam unberührt liegen zu lassen, bis das Umfeld nach Hinweisen abgesucht und er von allen Seiten fotografiert worden war. Allerdings bedeutete es eine kolossale Zeitverschwendung, stundenlang auf die Spurensicherung und den Arzt zu warten. Womöglich arbeiteten die Abteilungen nachts gar nicht mehr, dann würden sie bis zum Morgen hier herumstehen müssen. Die Zeit konnte man besser nutzen, zum Beispiel die Kartei nach Vermissten durchforsten und sich dann einen Plan für die Ermittlung machen.
»Doppelt so vorsichtig«, sagte er.
Nur mit Zeige- und Mittelfinger strich Schubert über die vorderen Hosentaschen. Aber die, auf die es ankam – wo Männer ihre Brieftaschen trugen, wenn sie sie nicht im Sakko hatten – waren hinten. Ohne Krells Hilfe würde es nicht gehen. Er kam sich vor, als plante er etwas Verbotenes, und so war es ja auch. Die Aufmerksamkeit der Schupos hatten sie bereits erregt, die beiden langen Kerle sahen ihnen aus sicherem Abstand zu. Selbst wenn sie nicht die Hellsten waren, musste ihnen klar sein, dass der Kommissar und sein Assistent gegen die Vorschriften handelten. Also waren sie nun auch noch ein schlechtes Vorbild.
Und dennoch trat Krell heran und ging neben Schubert – und neben der Leiche – in die Hocke. Während er die Bewegung vollzog, wurde ihm bewusst, dass sie für Schubert unmöglich war. Krell war heilfroh, dass er unversehrt war. Auch er war im Krieg gewesen, damals, 1917 und 1918. Aber er war mit heilen Knochen zurückgekehrt.
»Sie ziehen hier am Gürtel«, sagte er. »Schön langsam, ja? Er braucht nur ein kleines bisschen hochzukommen.«
Er hätte ihn nicht ermahnen müssen, Schubert blieb trotz seiner vorgebeugten Haltung auch bei diesem Handgriff ausgesprochen vorsichtig. Krell tastete die linke hintere Tasche ab, dann wiederholten sie die Prozedur auf der anderen Seite.
Es war nichts zu finden. Krell schüttelte den Kopf.
»So ’n Schiet«, sagte Schubert, als sie wieder aufrecht standen.
»Wohl wahr.«
»Dann können wir nur hoffen, dass uns die Fingerabdrücke des Mannes vorliegen. Wenn nicht, steht uns ein ziemliches Stück Arbeit bevor.«
Krell legte die Hand an die Wange. Ein neuerliches Gähnen kündigte sich an. Er schluckte es herunter. »Wir haben eine Leiche«, sagte er mit einem Blick auf den toten Körper zu ihren Füßen, »und wissen nicht, wer das war. Zeugen gibt es auch keine. Nur eine Anruferin, die anonym bleiben wollte.«
»Wo sollen wir anfangen?«
»Wenn wir Schwein haben, ist er schon vermisst gemeldet. Aber ich kann mir bei jemandem wie ihm auch vorstellen, dass er niemandem fehlt. Das prüfen wir als Erstes. Dann befragen wir die Nachbarn. Der Umkreis muss so weit gezogen werden, wie man einen Schuss hören kann.«
»Wie weit ist das?«, fragte Schubert.
»200 Meter vielleicht. Da hinten stehen ein paar Mietshäuser.« Krell starrte in die Dunkelheit. Er wusste, dass es dort Wohnhäuser gab. Sehen konnte man sie nicht. »Gleich morgen früh fangen Sie damit an. Aber jetzt geht es erst mal in die Dienststelle, und wir kochen uns eine Tasse Kaffee. Hoffentlich gibt’s echte Bohnen.«
Zwei
Länger als eine Woche war die zehnte Klasse der Rissener Schule um den neuen Schüler herumgeschlichen, ohne dass einer von ihnen mehr als drei Worte mit ihm geredet hätte. Der Neue war ein Einzelgänger; er stand abseits auf dem Pausenhof, den Blick sonst wohin gerichtet, die Hände in den Taschen, ohne Interesse an den anderen. Was sie von ihm wussten, dass seine Familie ausgebombt worden war und dass er Christian Ullmann hieß, hatte er der Klasse und ihrem Lehrer Doktor Petersen am ersten Tag mitgeteilt.
Es war direkt nach den großen Ferien gewesen. Der fremde Junge war plötzlich aufgetaucht und hatte ein wenig verloren an der Klassenzimmertür gestanden. Jette hatte den Blick kaum von ihm abwenden können. Jemanden wie ihn hatte sie noch nie gesehen. Seine Haare reichten bis über die Ohren, das karierte Jackett war ihm zu weit. Im Gegensatz zu den anderen Jungen trug er lange Hosen und dazu Lederschuhe wie ein Erwachsener. Er hatte eine Hornbrille auf der Nase, die er mit dem Zeigefinger zurechtrückte, und wusste offenbar nicht, wohin mit sich. Die Aufmerksamkeit der anderen Schüler war ebenfalls geweckt. Jettes Banknachbarin Elisabeth starrte geradezu Richtung Tür. Ihr Kopf bewegte sich nicht, die Augen waren aufgerissen, als wäre eine Figur aus ihrem nächtlichen Traum erschienen. Niemand machte Witze, wie Neue sie sonst über sich ergehen lassen mussten. Karl – einer von denen, die in Zivil in die Schule kamen – klopfte auf den leeren Platz neben sich, auf den der fremde Junge sich setzte.
In langsamen Bewegungen nahm der Neue Heft und Bleistift aus seinem Ranzen und legte beides vor sich auf den Tisch. Er stand weiterhin im Zentrum aller Aufmerksamkeit, und Jette machte da keine Ausnahme. Sie rätselte, was so besonders an diesem Jungen war, und fand für sich schließlich eine Erklärung: In nichts, was er tat, zeigte er jene Zackigkeit, die Schule und Hitlerjugend ihnen beibrachten und die als deutsch galt. Im Gegenteil: Er war – das war das Wort, das ihr in den Sinn kam – lässig.
Doktor Petersen trat in den Klassenraum, schloss mit einer schwungvollen Bewegung die Tür und grüßte mit dem üblichen »Heil Hitler«. Dann hieß er den Neuen, sich vorstellen.
Christian nannte seinen Namen, sagte, dass sie ihre Wohnung verloren hatten und er deshalb zurzeit bei seinem Großvater in Rissen lebe.
»Zurzeit, soso. Und wo wohnst du sonst?«
»In Altona.«
Doktor Petersen war ein älterer Herr im Anzug, mit dünnem weißem Haar und einer kleinen runden Brille, die er oft abnahm. Das S-T sprach er nach Hamburger Art spitz aus, was die Jungen in der Pause manchmal nachmachten. Im Weltkrieg war er Soldat gewesen und erzählte hin und wieder von deutschen Heldentaten in den Schützengräben. Auf der anderen Seite waren die Franzosen gewesen. Doktor Petersen fand sie weibisch und verzog, wenn er sie erwähnte, das Gesicht, als ob er sich ekeln würde. Manche Schüler lachten darüber. Doktor Petersen trug einen Stock, an dem er quer durch den Klassenraum schritt. Vor der Bank von Karl und Christian machte er halt. Jette ahnte, dass der Neue eine Ermahnung bekommen würde, vielleicht sogar Schlimmeres.
»Dein Jackett scheint dir zu gefallen.«
Christian gab keine Antwort.
»Tweed und bunte Muster«, fuhr Doktor Petersen fort. »Solche lächerlichen Karos, das können sich nur die Engländer auf ihrer Insel ausdenken. Weißt du, wer euch in Altona ausgebombt hat? Na?« Er wartete nicht lange auf eine Antwort. »Die Tommys. Bist du ein Dummkopf und trägst die Kleidung deines Feindes?«
Christians Schultern hingen herab, das karierte Jackett war so groß, dass die Ärmel über die Handgelenke reichten. Er sagte nichts, sondern blickte den Lehrer nur mit reglosem Gesicht an.
Doktor Petersen schien die ausbleibende Reaktion zu ärgern. Seine Stimme wurde schärfer. Er war, wie er oft erzählt hatte, Hauptmann gewesen, und so klang er nun auch. »Du bekommst deinen Mund nicht auf? Umso besser, dann hast du die Muße, mir zuzuhören. Erstens: Wenn du glaubst, du könntest hier ein Lotterleben führen wie im roten Altona, so bist du auf dem Holzweg. Das werde ich von Anfang an unterbinden. Zweitens: Deutschland befindet sich im Krieg. Vielleicht hast du es in Altona noch nicht gehört, aber unser Volk hat eine historische Aufgabe. Wir bewahren Europa vor dem Bolschewismus und vor den Juden. Drittens: Wer meint, die Heimat könne der kämpfenden Truppe noch einmal in den Rücken fallen wie 1918, der irrt. Der irrt gewaltig. In meiner Klasse dulde ich das nicht. Wenn du mich verstanden hast, dann möchte ich jetzt ein Ja hören.«
»Ja«, sagte der Neue. Es war wieder nicht das HJ-Ja, das herausgestoßen wurde wie ein Schuss aus einer Pistole, sondern es kam langsam und so trotzig, dass alle in der Klasse die Luft anhielten.
Doktor Petersen starrte ihn an. Sein Kopf war rot. Er hob seinen Stock ein wenig an, gerade so weit, dass es wie eine Drohung wirkte.
»Dein Vater ist Soldat?«
»Ja.« Zackig klang das immer noch nicht.
»Infanterie?«
»Ja.«
»Wo stationiert?«
»In Frankreich. Am Ärmelkanal.« Christian klang weiter wie ein Zivilist. Jette hatte den Eindruck, er verweigere mit voller Absicht, was Doktor Petersen von ihm wollte. Sie alle beherrschten den Soldatenton, einfach weil er in der HJ genauso wie in der Schule verlangt wurde.
»Ach, in Frankreich«, wiederholte Doktor Petersen. Er dehnte die Worte, als wollte er Christian auf den Arm nehmen. »Da lässt er sich’s wohl gut gehen.«
In diesem Satz schwang eine Unterstellung mit, die sie alle schon oft gehört hatten. Wer in Frankreich stationiert war, so hieß es, dem ging es prima, da gab es gutes Essen und Wein, die Frauen trugen aufreizende Kleider und waren leicht zu haben, und in seiner Freizeit konnte man durch Paris spazieren oder sich am Strand in die Sonne legen.
Neben Jette streckte Elisabeth ihren Arm in die Höhe. Es gehörte Mut dazu, Doktor Petersen zu unterbrechen, wenn er in Rage war. Er sah sie nicht gleich und hob seinen Stock noch ein kleines Stück höher. Die Drohung wurde verschärft.
»So, Christian aus Altona, jetzt gibst du mir deine Antworten noch einmal, aber diesmal so, wie es sich für einen deutschen Jungen gehört. Klar und deutlich.«
Elisabeth räusperte sich. »Entschuldigung.«
Sie war ein Liebling der Lehrer, weil sie strebsam war und immerzu alles konnte und wusste. Ob Bockspringen oder Kopfrechnen, sie war fast überall eine der Besten. In der letzten Zeit hatte sie sich verändert. Sie trug keine Zöpfe mehr, sondern eine richtige Frisur, bei der ihre Haare auf eine Seite fielen. Auch war sie etwas runder geworden, nicht mehr nur Haut und Knochen wie früher, sondern sie hatte einen Busen bekommen. Jette musste zugeben, dass sie nicht schlecht aussah. Jetzt hatte sie einen roten Kopf.
»Elisabeth, was gibt’s?« Doktor Petersen drehte sich zur ihr, während er mit beiden Händen seinen Stock umfasste.
»Mein Vater ist auch in Frankreich stationiert. Er hat uns vorgestern geschrieben. Sie bauen Befestigungsanlagen. Er arbeitet jeden Tag mit dem Spaten.«
Jette hielt den Atem an. Bei manchen Lehrern, gerade bei den älteren, die sie aus dem Ruhestand geholt hatten, nachdem viele der jüngeren eingezogen worden waren, konnte man gefahrlos widersprechen, die begriffen kaum noch, was los war. Bei Doktor Petersen war das anders. Er hatte sein Parteiabzeichen am Revers und wollte seine Schüler, wie er oft sagte, zu anständigen Deutschen erziehen, zu Jungen und Mädchen mit Gehorsam und Disziplin.
Die Sekunden verstrichen. Elisabeth war immer noch rot im Gesicht. Mit halb geöffnetem Mund wartete sie auf eine Antwort.
»Es ehrt dich«, sagte Doktor Petersen schließlich, »dass du deinen Vater in Schutz nimmst. Und du hast recht, im vergangenen Jahr hat das ganze Reich bewundert, wie schnell die Wehrmacht Frankreich unterworfen hat. Der Führer selbst war in Paris.«
Doktor Petersen kehrte zu seinem Pult zurück, ohne Christian eines weiteren Blickes zu würdigen. Jette glaubte nicht, dass die Sache für den Neuen damit ausgestanden war, zumal in den nächsten Stunden andere Lehrer ähnlich auf Christian reagierten wie Doktor Petersen. Umso mehr wurde er zum Gesprächsstoff. Es war irgendein Geheimnis um ihn. Wenn Jette und Gregor nach der Schule gemeinsam nach Hause gingen, redeten sie über ihn und zählten auf, was an diesem Christian so besonders war: Kleidung, Frisur, Auftreten, Mut, Lässigkeit. Vor allem, so glaubte Gregor, schien er keine Angst zu haben.
Am Donnerstag berichtete er, Christian sei nicht beim HJ-Nachmittag gewesen.
»Vielleicht war er krank«, vermutete Jette.
»Jette, ich bitte dich. War er gestern in der Schule?«
»Ja klar.«
»Also – was soll das für eine Krankheit sein? Eine, die nur nachmittags auftritt? Oder eine Mittwochskrankheit? Eine Mittwochnachmittagskrankheit? Die will ich auch!«
»Und wo war er?«, fragte sie.
»Das wüsste ich genauso gerne wie du.«
Niemand aus der Klasse schwänzte Hitlerjugend oder Mädchenbund. Jette ging jeden Mittwoch und Sonnabend, zusammen mit Elisabeth und den anderen Klassenkameradinnen. Ihre Mutter entschuldigte sie nur, wenn sie Fieber hatte, einen anderen Grund akzeptierte sie nicht, und wenn Jette jammerte, erklärte sie mit einem Achselzucken, sie müsse auch zum Frauenbund, das gehöre dazu, so sei das neue Deutschland, da gelte es, sich zu fügen.
Allerdings zeigte Jette nicht viel Eifer. Das ewige Medizinballwerfen fand sie langweilig und machte es so langsam wie möglich, erst recht verabscheute sie die Märsche, zehn, manchmal 15 Kilometer, oft im Gleichschritt, mit Stiefeln und schwerem Rucksack, egal bei welchem Wetter, und Pausen wurden nur selten eingelegt, denn: Wer rastet, der rostet. Die Lieder, die sie dabei singen mussten, kamen ihr zu den Ohren heraus: Unsre Fahne flattert uns voran.
Bei den Heimabenden hörte sie nur halbherzig zu. Ihre Mädchenführerin hieß Lina und sprach am liebsten darüber, dass die höchste Bestimmung der deutschen Frau im Kinderkriegen lag. Lina war 18, zwei Jahre älter als sie, trug dicke Zöpfe und hatte stämmige Beine, ihre Füße steckten meistens in klobigen Stiefeln. Es war schwer vorstellbar, dass sich ein Junge für sie interessierte. Kinderkriegen stand bei Lina vorläufig wohl nicht auf dem Programm.
Gregor war schließlich derjenige, der Kontakt zu dem Neuen aufnahm. Es war nach dem Zeichenunterricht bei Herrn Jessen, einem älteren Herrn mit buschigem Schnauzbart, der an ein Walross erinnerte. Jessen trug stets eine schief sitzende Fliege, das war sein Markenzeichen. Die meisten Schüler gingen davon aus, dass er in Wahrheit kein Lehrer war, sondern ein Künstler, der mit anderen Malern und Schriftstellern in finsteren Spelunken auf Sankt Pauli verkehrte, wo sie die Damen mit Vornamen ansprachen. Lehrer war Jessen nach dieser Legende nur geworden, um nicht als Asozialer ins Lager gesperrt zu werden.
Einige aus der Klasse, wie Elisabeth, die eine gute Zeichnerin war, liebten seinen Unterricht. Jessen war immer in gleicher Stimmung, freundlich, aber distanziert. Er gab sich keine Mühe, sich die Namen der Schüler zu merken, sondern sprach einfach jeden mit Du an. Und er war der einzige Lehrer, der die Stunde nicht mit »Heil Hitler« begann und beendete. Er sagte »Guten Tag« und »Auf Wiedersehen«. Meistens dauerte es dann nur ein paar Sekunden, bis einer der uniformierten Schüler ihm sein »Heil Hitler« entgegenrief, dann grüßte Jessen entsprechend zurück. Gleichwohl registrierte Jette, dass er die beiden Wörter nicht von sich aus gebrauchte.
So wie sie im Physikunterricht Geschossgeschwindigkeiten auszurechnen hatten, zeichneten sie bei Jessen Flugzeuge im Luftkampf, brennende Fabriken in England oder den aufopferungsvollen Einsatz von Schwestern des Deutschen Roten Kreuzes. Der Unterschied zum Physikunterricht war, dass sich Jessen, während sie mit ihren Bildern beschäftigt waren, auf einen freien Platz neben einen der Schüler setzte und ihnen von der europäischen Kunstgeschichte erzählte. Er liebte die Renaissance und die niederländischen Maler wie Rembrandt oder Vermeer. Was er schilderte, war unbedenklich, die Italiener waren Verbündete, die Holländer sogar Germanen. Gelegentlich hatte Jessen einen Bildband dabei, den er herumreichte, sodass sie sehen konnten, wovon er sprach. Die Zeichnungen der Schüler dagegen korrigierte er nur, wenn man ihn ausdrücklich darum bat. Auch darin unterschied er sich von den anderen Lehrern: Jessen machte den Eindruck, als überließe er es ihnen, wie viel von seinem Wissen und Können sie abhaben wollten.
Neben der Kunstgeschichte sprach er über alte Literatur und über Musik. Er wusste unendlich viel. Jette vermutete, dass er bei den Schülern die Lücken auszugleichen versuchte, die durch den Krieg und den Ausfall von so viel Unterricht entstanden. Manchmal summte er ihnen sogar Melodien vor, kleine Stücke von Mozart, Beethoven und Wagner, aber selbstverständlich keine verbotenen Komponisten.
An diesem Tag fragte er die Klasse nach Musik aus anderen Ländern. Ein paar Namen wurden genannt – Verdi, Tschaikowski, Berlioz, Grieg. Jessen ergänzte jeweils die Länder.
Schließlich fragte er: »Wie ist es mit Amerika?«
Jette, die bis dahin nichts beigetragen hatte, hätte gerne geantwortet. Sie kannte aber keine amerikanischen Komponisten.
»Cole Porter«, sagte Christian.
»Sehr gut«, erwiderte Jessen. »Keine klassische Musik wie in Europa, sondern Jazz.«
»Das ist verboten«, rief Björn, ein hellblonder Junge mit streichholzkurzem Haar. Er trug eine HJ-Uniform. Seine Stimme war scharf, geradezu schneidend.
»Verboten nicht direkt, aber undeutsch. Doch wenn du aufgepasst hast, Junge, dann weißt du, dass Christian nicht gesagt hat, dass er diese Musik hört. Und ich habe euch nicht dazu aufgefordert. Die Frage war, ob ihr den Namen eines Komponisten kennt, um den ihr besser einen Bogen macht.«
Björn staunte. Jessen hatte ihn reingelegt.
Christian unterdrückte ein Schmunzeln, während Jessens Gesicht keinerlei Regung zeigte, der dunkle Schnauzbart hing herunter wie immer. Am Ende der Stunde tat er etwas Ungewöhnliches, er trat an Christians Bank, schaute auf seine Zeichnung, lobte sie, tippte mit dem Finger auf einige Stellen und machte Verbesserungsvorschläge. Und er nannte ihn ein zweites Mal beim Vornamen. Offenbar mochte er den Jungen, trotz seiner langen Haare. Vielleicht sogar deswegen.
Obwohl sie alle diesem Vorfall zugeschaut hatten, änderte sich nach der Stunde nichts, zumindest nicht sofort. Christian stand allein auf dem Hof, der vor dem Schulhaus, einem eher kleinen Backsteingebäude aus der Kaiserzeit, lag. Das Haus bot Platz für nur eine Klasse pro Jahrgang. Für Rissen war das genug, mehr Schüler gab es nicht, deshalb war hier auch die Anordnung der Behörden nicht umsetzbar, Jungen und Mädchen möglichst getrennt zu unterrichten.
Christians Platz war unter der Eiche, an deren Stamm er lehnte und die ihm Schutz bot. Er tat nichts, redete mit niemandem, schaute die anderen nicht an, sondern war in Gedanken. Jette kam er wie eine Insel vor, ein Stück Erde irgendwo im weiten Ozean. Sie war davon überzeugt, dass er sich nicht für die Klassenkameraden interessierte, weil er sie für hinterwäldlerisch hielt. Sie registrierte auch das Verhalten von Elisabeth, die sich, wann immer es ging, in Christians Nähe stellte. Es war ziemlich offensichtlich, dass sie darauf hoffte, von ihm angesprochen zu werden. Aber das passierte nicht.
Gregor stand mit den anderen Jungs zusammen. Während seine Freunde die üblichen Reden schwangen, wirkte er unruhig. Er knetete seine Finger, trat von einem Bein aufs andere, machte ein paar Schritte aus ihrem Kreis, kehrte zurück.
Schließlich ging er von den anderen fort und schritt mit gesenktem Kopf quer über den Hof auf Christian zu. Jette folgte ihm. Sie wollte mitbekommen, was der Neue sagte.
»Sag mal«, fragte Gregor, »wer ist Cole Porter?«
»Ein amerikanischer Komponist. Hast du doch gehört.«
»Was ist das für Musik?«
»Jazz. Swing, genauer gesagt.« Christian legte den Kopf auf die Seite und grinste. »Verboten.«
»Unerwünscht«, korrigierte Gregor.
»Von mir aus«, meinte Christian achselzuckend.
Gregor nickte schwerfällig. Zwischen den beiden Jungen gab es in diesem Moment ein ziemliches Gefälle, einen Unterschied in dem, was sie kannten und wussten, der nur deshalb nicht noch größer wurde, weil sich Christian zurückhielt. Hätte er weiter über Jazz und Swing gesprochen, hätte er sich Ansehen erworben. Von den linientreuen Schülern war keiner in der Nähe, da waren nur Jette und Elisabeth, die gebannt gelauscht hatten. Aber das kurze Gespräch war schon wieder vorbei. Christian lächelte. Dabei drehte er sich um und wandte ihnen den Rücken zu.
Drei
Nach Ende des Krieges, als er zu Fuß aus Flandern nach Altona zurückkehrte, wog Hannes Krell weniger als 50 Kilo. Er war einen Meter 90 groß, ein Mann, der die Leute in seiner Umgebung stets überragte. Die 50 Kilo brachte er wohlgemerkt in Uniformhose und Hemd auf die Waage, im Lazarett hatte man sich nicht die Mühe gemacht, vor dem Wiegen die Kleidung abzulegen. Am Hintern fehlte jedwedes Fleisch, an der Brust stachen die Rippen heraus, und wenn er unterwegs in ein spiegelndes Fenster blickte, sah er einen hohlwangigen 19-Jährigen mit wirr flackernden Augen. Kurz vor Weihnachten traf er zu Hause ein und fand die Wohnung so, wie er sie zwei Jahre zuvor verlassen hatte. Die Mutter war gestorben, das hatten sie ihm ins Feld geschrieben, aber davon abgesehen hatte sich nichts verändert. Seine ältere Schwester Hilde führte dem Vater den Haushalt, die zweite Schwester Erika unterstützte sie dabei. Sie warteten beide darauf, dass jemand ihnen den Hof machte, doch Männer waren knapp in dieser Zeit, Abertausende waren gefallen, ihre toten Körper verwesten auf den Schlachtfeldern oder waren in endlos langen Reihen auf den Soldatenfriedhöfen in Belgien und Nordfrankreich verscharrt. Es kam niemand, weder für Hilde noch für Erika.
Auf sein Klopfen hin hatte damals der Vater die Tür geöffnet und einen Moment gezögert, während er sich wohl gefragt hatte, was der abgemagerte Kerl wollte, der da vor seiner Tür stand.
Dann hatte er die Hand ausgestreckt. »Ich freue mich, Hannes, dass du heil zurück bist. Auch wenn es um unser Deutschland nicht gut steht.«
Krell war es schwergefallen, sich wieder einzugewöhnen. Beinahe alles in seinem Elternhaus ging ihm auf die Nerven, obwohl er es von früher kannte: die knappen Anweisungen des Vaters, der unbedingte Gehorsam der Schwestern, das viele Schweigen, selbst das Ticken der Standuhr im Wohnzimmer. Den Befehlston des Alten hielt er nur mit größter Selbstbeherrschung aus, und es gab Momente, da formten sich wilde Schreie in ihm und wollten heraus. Es kostete ihn viel Kraft, sie zu unterdrücken. Er schaute sich dabei zu, wie er die Zähne zusammenbiss und die Kiefer anspannte.
Auch das Tischgebet konnte er kaum ertragen:
Alle guten Gaben,
alles was wir haben
kommt, o Gott, von dir,
Dank sei dir dafür.
Gott war nicht in Flandern gewesen, und wenn er dort nicht war, war er auch nirgendwo sonst. War sein Vater blind, dass er das nicht sah? Oder schauten er und die Schwestern nur auf sich und auf niemanden sonst? Der Hungerwinter hatte die Familie nicht weiter beeinträchtigt, ein preußischer Finanzbeamter war auch während des Krieges versorgt worden, und auch jetzt gab es ausreichend zu essen. Aber Krell schmeckte es nicht, weder die sämige dunkelbraune Soße, in der die Kartoffeln schwammen, noch die Linsen und auch nicht das Fleisch am Sonntag. Er kaute auf seinen Bissen herum und nahm nicht zu. Er schlief schlecht, kürzer als je im Feld, schreckte nachts auf und konnte nicht wieder zur Ruhe finden, weil sein Herz so laut pochte. Nicht ein einziges Mal erkundigte sich der Vater nach seinen Erlebnissen, und nach seinem Vorbild taten es die Schwestern auch nicht. Den Krieg – genau genommen die Niederlage – gab es nicht, durfte es nicht geben. Seine einzige Frage stellte der Alte am Abend des zweiten Weihnachtstages. Er saß in seinem Sessel, ein Glas Weinbrand in der Hand und seine Tonpfeife im Mund, ein Rauchutensil aus dem letzten Jahrhundert, während er sich mit zwei Fingern den Backenbart kratzte:
»Was wirst du tun, Sohn?«
»Ich suche mir eine Arbeit«, erwiderte Hannes. Beinahe von selbst kam der zweite Teil des Satzes hinterher: »Und eine Unterkunft.«
Der Vater verzog keine Miene und gab keinen Kommentar ab, neuerliches Schweigen legte sich über das weihnachtliche Zimmer. Man glaubte, das Brennen der Kerzen am Tannenbaum zu hören. Die Standuhr tickte. Hannes schloss die Augen und stellte sich vor, zur See zu fahren, er wollte weg, nur weg, alles hinter sich lassen, Familie und Krieg und Erinnerungen, er träumte vom Blau der Ozeane und sah sich fremde Länder entdecken. In seiner Fantasie tauchte stets der Süden auf, mit bunten Farben und herzlichen, lebensfrohen Menschen. Aber im Hungerjahr 1919 gab es keine deutsche Handelsschifffahrt. Die britische Blockade an der Nordsee dauerte an, nicht weniger total als während des Krieges, die Reedereien im Reich hatten den größten Teil ihrer zivilen Flotte verloren, und den anderen Nationen ging es ebenso. Deutschland durfte nicht einmal Küstenschifffahrt oder Hochseefischerei betreiben. Handel gab es fast nicht, zumal die heimische Industrie daniederlag und die Bevölkerung kein Geld hatte, um eingeführte Waren zu kaufen. Krell fand ein Zimmer auf Sankt Pauli, in der Seilerstraße, mitten im Vergnügungsviertel, eine Dachkammer mit Bett, Kleiderschrank, einem Stuhl und einem gusseisernen Ofen. Er verdingte sich auf dem Bau, manchmal auch am Hafen, wenn doch einmal ein ausländisches Schiff entladen werden musste, und im Spätsommer als Erntehelfer auf den Obstfeldern im Alten Land. Sankt Pauli wurde sein neues Zuhause. An seinen Vater und die Schwestern dachte er am Anfang hin und wieder, dann immer weniger. Zu einem Besuch konnte er sich nicht aufraffen.
Obwohl Hannes Krell seit mehr als 15 Jahren nicht mehr auf dem Kiez wohnte, akzeptierten ihn die Anwohner. Im Normalfall mieden die Sankt Paulianer die Obrigkeit und sprachen nur mit der Polizei, wenn es nicht anders ging, wenn Beugehaft oder Knüppelschläge drohten, und selbst dann behaupteten sie meistens, sie hätten nichts gesehen und wüssten nichts, ehrlich nicht. Bei Krell war das anders. Mit ihm redeten sie.
Er schritt über die Reeperbahn Richtung Große Freiheit und grüßte, wenn er einen Bekannten sah, zweimal deutete er sogar ein Hutheben an. Vor drei Jahren hatte dieser Teil von Sankt Pauli noch zur Stadt Altona gehört, doch das war nun Vergangenheit. Ohne jegliche Ankündigung hatte die NS-Regierung Altona in einem Verwaltungsakt der Stadt Hamburg zugeschlagen. Die Stellung als selbstständige dänische und später preußische Stadt war mit einem Schlag vorbei gewesen. Viele Leute, auch Krell, hatten sich darüber mokiert, allerdings war er Beamter, es stand ihm nicht zu, Kritik zu äußern, und wenn man ehrlich war, musste man einräumen, dass sich durch den Zusammenschluss nicht viel verändert hatte. Auch der Altonaer Teil von Sankt Pauli und die Reeperbahn blieben nach dem Zusammenschluss, was sie vorher gewesen waren. Die Einbußen, unter denen der Kiez litt, waren dem Krieg geschuldet, der eingestellten Handelsschifffahrt. Seit U-Boote den Atlantik beherrschten, kamen kaum noch Matrosen, gleichwohl ging das Leben hier weiter, die Amüsierlokale öffneten Abend für Abend, halbnackte Mädchen tanzten oder warteten auf Kundschaft, es wurde gesoffen, gehurt und um Geld gespielt wie früher, und wie damals fand sich mancher am nächsten Morgen nicht nur verkatert, sondern auch pleite.
Auch das Bild, das die Reeperbahn am Vormittag abgab, hatte sich nicht verändert. Wie früher hatte man den Eindruck, man dürfe nicht zu laut sein, weil die Anwohner noch schliefen. Muffiger Geruch kam aus den Fenstern der Lokale und aus den Hauseingängen, auf dem Bürgersteig lagen Scherben von mancher Bierpulle, an den Wänden gab es gelbliche Pfützen und Flecken. Die Nazis machten den Betrieb in ihren Reden und Zeitungsartikeln verächtlich, weil er unsittlich war. Aber sie duldeten ihn. Offenbar blieb ihnen nichts anderes übrig.
In der Großen Freiheit öffnete Krell eine Tür. Eine Glocke klingelte. Er stieg drei Stufen hinab in ein Souterraingeschäft. Der Mann hinter dem Tresen sah von seiner Lektüre auf. Der Raum war länglich, dabei ziemlich eng. Auf dem Tresen lagen Zeitungen, an der Rückwand waren Zigarettenschachteln in ein Regal sortiert. Schnaps lagerte unter dem Tisch und wahrscheinlich auch in der Kammer, deren Türumrisse in die Tapete geschnitten waren.
»Oh, der Herr Kommissar.« Der Mann hatte eine von Tabak und Alkohol kratzige Stimme. »Da sage ich doch gleich mal brav: Heil Hitler.«
»Heil Hitler, Jan.«
»Moin.«
Jan Weller hatte ein kräftiges Gesicht mit vollem Bart. Die grauen Haare waren nach hinten gekämmt, aber so ganz ließen sie sich nicht zähmen. Er mochte zehn Jahre älter sein als Krell, dann wäre er Anfang 50. In seiner Hand hielt er eine Zigarre.
»Ich habe den Völkischen Beobachter. Druckfrisch von heute Morgen.«
»Schön.«
»Nehmen Sie einen?«
»Nein danke.«
»Seltsam – warum habe ich mir das gedacht? Vielleicht ’ne Zigarre?« Er öffnete ein Holzkistchen und hielt es Krell hin. »Geht aufs Haus.«
Krell griff zu. »Danke«, sagte er, als Jan ihm seine Streichhölzer hinüber schob. Er entzündete den Tabak, beide begannen zu paffen, heller Rauch erfüllte den Laden. Unter dem Fenster gab es einen zweiten Stuhl. Das Polster der Sitzfläche war abgeschabt, man konnte das Muster kaum noch erkennen. Krell zog ihn zu sich heran und setzte sich.
»Büsschen über die alten Zeiten plaudern?«, fragte Jan.
»Jo. Und büsschen über heute.«
»Was gibt’s da zu erzählen? Heldengeschichten aus unserem Krieg? Da kenne ich keine. Für so was habe ich Landserhefte.« Er zeigte auf die Seite des Tresens. »Wenn Sie solche Sachen lesen, Kommissar …«
Anstelle einer Antwort zog Krell an seiner Zigarre und pustete den Rauch aus. Sie brannte nicht gut. Er drehte die Spitze zu sich und blies gegen sie, woraufhin sie aufglühte. Auf Sankt Pauli gehörten die mokanten Töne dazu. Mancher Kollege hätte sie gemeldet, sie erfüllten gleich mehrere Tatbestände, Defätismus, bürgerliche Kritisiererei, vielleicht sogar Wehrkraftzersetzung. Krell aber achtete darauf, sich seine Kontakte auf der Reeperbahn zu bewahren. Sie waren nützlich bei der Verbrechensbekämpfung, und er hatte sich vor Längerem dazu entschieden, nicht jedes Wort auf die Goldwaage zu legen, erst recht nicht bei einem Mann wie Jan.
Die Glocke schlug an, die Tür ging auf, eine junge Frau trat ein. Sie hatte Sommersprossen im Gesicht, war in einen weiten hellen Mantel gehüllt, die roten Haare hatte sie notdürftig zusammengebunden. Ihre Schuhe hatten hohe Absätze, doch ihr Gang darauf schien nicht ganz sicher zu sein. Ohne ein Wort von ihr griff Jan hinter sich und nahm ein Päckchen Juno aus dem Regal.
»Moin«, sagte sie mit leiser Stimme und nickte auch Krell zu. »Herr Kommissar.«
»Morgen, Bella«, entgegnete Krell.
»Wie geht’s dir?«, fragte Jan.
»Wunderbar«, sagte sie gegen den Augenschein. Sie sah blass und übernächtigt aus und wirkte wie jemand, der die Zeit vor dem Mittag verabscheut.
»Das ist schön«, sagte Jan trotzdem.
»Finde ich auch.« Ihre Münzen hatte sie bereits abgezählt, sie legte sie auf den Tresen, nahm die Zigaretten, warf Krell einen Blick zu, nickte und verschwand.
»Sie kennen Bella, Herr Kommissar?«
Krell gab nicht gleich eine Antwort, er war in Gedanken. »Ja«, sagte er schließlich.
»Na, ist ja auch egal. Wo waren wir stehengeblieben?«, fragte Jan. »Beim Krieg, stimmt’s? Ich bin zu alt, um eingezogen zu werden. Ich kann nicht mal mehr richtig laufen. Sie wissen ja, Herr Kommissar, in unserem stolzen Vaterland bin ich nicht der Einzige, der untauglich ist. Unser Flugzeugminister würde mit seiner Wampe in kein Cockpit passen, und der Radiominister hat ’nen Hinkefuß, der schafft es sicher nicht bis Afrika.«
»Jan!«, mahnte Krell.
»Jo. Ich spar mir den Rest. Weiß ja sowieso jeder, dass wir besser nicht nach der Abstammung des obersten Führers fragen. Der hat ja selber keine Ahnung, wer sein Vadda war.«
»Mensch, Jan, nu’ is’ gut. Du sabbelst dich noch um Kopf und Kragen.«
Jan setzte ein unschuldiges Gesicht auf, zog die Schultern hoch und breitete die Hände aus. »Sie haben doch das Thema aufgebracht, Herr Kommissar.«
Krell schüttelte den Kopf. »Ich wollte über einen anderen reden.«
Schubert und er hatten, nachdem sie die Fingerabdrücke des Toten bekommen hatten, mehrere Stunden beim Schein ihrer Schreibtischlampen im abgedunkelten Büro über der Kartei gesessen. Der Abgleich hatte schließlich einen Namen preisgegeben. Der Mann war zu Lebzeiten zweimal wegen Diebstahls aktenkundig geworden. 1931 hatte er sieben Monate in Fuhlsbüttel gesessen.
»Nun bin ich aber gespannt«, meinte Jan.
»Gustav Limba.«
»Ach, Limba. Kein großes Licht.«
»Kein großes Licht gewesen«, sagte Krell.
»Hat jemand ausgepustet«, entgegnete Jan ohne sichtbare Gefühlsregung. »Schon gehört.«
»Ach«, machte Krell.
»Die Reeperbahn ist ganz wie früher.« Jan klopfte auf den Zeitungsstapel vor ihm auf dem Tresen. »Eigentlich brauchst du hier keine Zeitungen, so viel wie hier geschnackt wird.«
»Hast du auch gehört, wem Limba im Weg war?«
Jan lachte. Es klang künstlich, trotzdem lachte er weiter, bis es in ein Husten überging. »Bin ich der Kommissar, oder was?«
»Das nicht. Aber du bist der mit den Ohren auf der Reeperbahn.«
»Das stimmt. Leider kann ich nicht helfen, davon hab ich nichts gehört.«
Krell pustete neuen Rauch in die Luft. Die Glut seiner Zigarre hatte jetzt eine satte rötlichgelbe Farbe. Der Tabak war aromatisch, er schmeckte etwas süßlich. Trotz des Krieges hatte Jan gute Ware in seinem Laden.
»Limbas Leiche wurde in einem Schuppen neben der Sankt Pauli-Brauerei gefunden. Von den Nachbarn dort hat niemand etwas mitbekommen«, behauptete Krell, obwohl Schubert noch nicht zurück war und also auch noch nicht berichtet hatte. »Fast könnte man denken, es sei allgemeine Taubheit ausgebrochen.«
»Tja«, machte Jan.
»Was soll das heißen?«
»Fragt sich der Kriminale da nicht, warum das so ist?«
»Doch, sicher. Und ich frage dich. Müssen wir an ein hohes Tier denken, das allen Leuten auf dem Kiez eingeschärft hat, auf keinen Fall das Maul aufzumachen? Vielleicht sogar einem freundlichen, Zigarre rauchenden Herrn in einem Zeitungskiosk.«
Jan paffte gedankenversunken. Krell hatte den Eindruck, er überlege sich seine Antwort. Anders als bei seinen losen Reden über die hohen Nazis wirkte er auf einmal bedacht, ja kein falsches Wort von sich zu geben. Er bekam eine Verlängerung seiner Bedenkpause, als die Tür ein weiteres Mal aufging. Ein Mann, der seinen Hut nicht abzog, verlangte nach einem Päckchen Nil. Während Jan ihm die Zigaretten auf den Tresen legte, musterte der Mann Krell mit zusammengekniffenen Augen und fragte sich offenbar, ob er von ihm etwas zu befürchten hatte. Dann sagte er zu Jan: »Ich hab so einen trockenen Mund. Gib mir was zum Befeuchten.«
Unter dem Tresen zog Jan eine Schublade auf und nahm ein etwa fingergroßes Glasfläschchen heraus. Der Kunde drehte am Deckel und trank einen ersten Schluck. Er zahlte und grüßte mit einem Nicken, bevor er ging.
»Die Tageszeitungen gehen offenbar nicht so gut?«
»Zeitungen? Die laufen unten am Fischmarkt besser. Als Packpapier. Im Unterschied zu hier ist es da schietegal, wie alt sie sind. Steht doch sowieso nur Mist drin.«
»Mensch, Kerl«, seufzte Krell. »Pass bloß auf, dass sie dich nicht mal abholen. Weißt du noch, wo wir waren?«
»Sicher. Das große Schweigen auf dem Kiez.«
»Lass mich mal theoretisch fragen: Wenn du mir erzählen würdest, was wahrscheinlich schon ganz Sankt Pauli weiß … Aber für mich wäre das ein entscheidender Hinweis … Und daraufhin verhafte ich einen der Großluden, den Kahlen Conny oder Paul mit der Narbe – könntest du dann sicher sein, dass du morgen deinen Laden noch aufschließen kannst?«
»Über die Zukunft kann man sich nie sicher sein. Da ist der liebe Gott vor.«
»Heute kommst du mir aber ganz besonders blöd, Jan. Der liebe Gott lebt nun gewiss nicht auf’m Kiez.«
»Stimmt auch wieder.« Jan rauchte und mied dabei Krells Blick. »Obwohl wir hier ’ne Kirche haben.« Plötzlich richtete er sich auf. Auch seine Stimme veränderte sich, sie bekam etwas Offiziöses. »Sie haben recht, Herr Kommissar, es gibt viel Sünde im Viertel des heiligen Paulus, und es gibt eine Menge Leute, die glauben, der Herr wird eines Tages Feuer über uns ausgießen wie über Sodom und Gomorrha.« Jan steckte seine Zigarre zwischen die Lippen und schmunzelte, er wollte zeigen, dass er einen Scherz gemacht hatte. »Soll ich mal ganz ehrlich antworten, Herr Kommissar?«
»Ich bitte darum.«
»Ich habe keine Ahnung, wer Limba ins Jenseits befördert hat und warum. Das Einzige, was ich sagen kann: Auf Sankt Pauli war der Junge ein kleines Licht. Ein besserer Laufbursche. Manchmal verdiente er ’ne Mark oder zwei damit, dass er mit älteren Damen tanzte, deren Männern das zu anstrengend war. Und wenn sie das mochten, hat er seine Hand auch über ihren Hintern gleiten lassen. So einer war der Limba.«
»Mit einem solchen Typen geben sich die großen Tiere nicht ab?«
Jan zuckte mit den Achseln.
»Verstehe«, sagte Krell. »Wo hat er gewohnt?«
»In der Pension Grüber, soweit ich weiß. Können Sie mich aber nicht drauf festnageln.«
»Am Hamburger Berg?«
»Genau da.«
Krell stand auf. Seine Zigarre war erst zur Hälfte geraucht. Er würde sie mitnehmen und auf der Straße weiterpaffen. »Mach’s gut, Jan. Bis zum nächsten Mal.«
»Es ist mir immer eine Ehre, Herr Kommissar. Viel Glück.«
»Dir auch.«
»Und dann noch Heil Hitler. Damit Sie beruhigt sind.«
»Heil Hitler«, erwiderte Krell und verschwand.
Vier
Schubert war mit jener Nachricht zum vereinbarten Treffpunkt gekommen, die zu erwarten gewesen war – keiner der Nachbarn hatte etwas gehört oder gesehen. In der Brauerei wurde nachts nicht gearbeitet, und die Anwohner hatten in ihren verdunkelten Wohnungen geschlafen. Die beiden Kommissare waren auf dem Weg zum Hamburger Berg. Krell betrachtete die Straßen mit Schuberts Augen. Was mochte der arme Kerl aus der holsteinischen Provinz für einen Eindruck haben? Die wenigen Hakenkreuzfahnen, die es gab, hingen schlaff an den Masten, sie waren schmutzig, eine sogar eingerissen. Von den Schupos der Davidwache abgesehen, trug kein Mensch auf dem Kiez Uniform. Es gab weder Hitlerbilder in den Schaufenstern noch Schmierereien gegen Juden. Krell war sich nicht sicher, wo Schubert politisch stand, eins aber war klar: Dieses Sankt Pauli musste einen Mann, der nicht von hier kam, befremden. Der Stadtteil vermittelte den Eindruck, als gehörte er nicht zum Deutschen Reich, eine Exklave, freizügig und frech wie eh und je, mit Striptease und Prostitution, zudem heimlich dem Kommunismus zugeneigt. Die nationale Erhebung war an diesem Viertel vorbeigegangen. Auch auf Krell wirkte der Kiez, zumindest wenn er Schuberts Blick einnahm, seltsam, und zwar in doppeltem Sinne, denn er spottete nicht nur all dem, wofür das neue Deutschland stand, sondern die Stadtverwaltung schreckte gleichzeitig davor zurück durchzugreifen. Für das Amüsement der Bevölkerung war sie bereit, ein Auge oder gleich beide zuzudrücken.
Altona war schon immer widerständig gewesen, es war kein Zufall, dass gleich hinter der Grenze, wo Hamburg früher endete, die Straße auf Altonaer Seite »Große Freiheit« hieß. Krells Vater hatte diesen Unabhängigkeitsgeist aus tiefster Seele verabscheut, für den Alten war das renitent und unpreußisch gewesen, und er hatte größten Wert darauf gelegt, dass er aus Bahrenfeld stammte, einem zu seiner Kindheit noch eigenständigen Dorf, nur zufällig dem widerborstigen Sankt Pauli benachbart. Krell hingegen war hier nach den beiden Jahren in den Schützengräben wieder ein Mensch geworden, und das vergaß er nicht. Als Polizist hatte er nun dafür zu sorgen, dass Gesetzesübertretungen geahndet wurden. Welche Meinungen die Bevölkerung vertrat, scherte ihn nicht.
Am Hamburger Berg hielten sie vor einem Haus mit schmuddeliger Fassade, an der in ausgeblichenen Lettern »Pension Grüber« stand. Es war eingequetscht zwischen einer düsteren Seemannskaschemme und einem Lokal namens Frivoli, das mit Bildern leichtbekleideter junger Damen im Fenster warb. Da es keine Klingel gab, öffnete Krell die Tür. Ein schummrig beleuchteter Gang führte hinein, eine Art Diele mit einem ausgeblichenen Läufer. Der Eindruck von Unscheinbarkeit, den das Haus von außen gemacht hatte, blieb bestehen, doch wurde er erweitert. Es schien halbwegs sauber zu sein. An den Wänden hingen Bilder, naive Hafenimpressionen mit Segelschiffen, glücklichen Matrosen und winkenden Bräuten. Die Rahmen waren goldfarben gestrichen.
»Hallo«, rief Krell. »Ist jemand da?«
Niemand antwortete. Rechter Hand führte eine Treppe ins Obergeschoss, in dem wahrscheinlich die vermieteten Zimmer lagen. Die Diele selber lief in einem Vorraum aus, von dem drei Zimmer abgingen. Eine Flügeltür stand offen. Sie schauten in ein Esszimmer mit einem langen ovalen Tisch, unter den die Holzstühle geschoben waren. An der Wand hing ein weiteres Ölgemälde, erneut in verziertem Goldrahmen, diesmal eine Hafenansicht mit stürmisch-grauem Himmel.
»Hallo«, wiederholte Krell. »Frau Grüber?«
Eine Tür öffnete sich und eine Frau trat heraus, die Krell auf Mitte 40 schätzte. Ihm fiel der Ausdruck »drall« ein. Ein rot-weiß gestreifter Pullover spannte über Brust und Bauch. Sie hatte blondes gewelltes Haar und ein Schweinchengesicht, das für Krells Geschmack zu stark geschminkt war, Mund und Wangen rötlich, die Lider schwarz. Die vielen modernen Diätratschläge schienen an ihr abzuperlen. Krell unterstellte, dass sie die entsprechenden Zeitschriftenartikel las und trotzdem weiteraß.
»Sie wünschen?« Ihre Stimme klang rauchig. In ihrer kühlen Bestimmtheit hörte man die Geschäftsfrau, die den Umgang mit fremden Männern gewohnt war.
Krell zog seine Dienstmarke hervor. »Kommissar Krell, Kripo Hamburg. Das ist Kriminalassistent Schubert.«
»Die Polizei?«
»Wir haben ein paar Fragen. Könnten wir in einen geschlossenen Raum gehen?«
»Bitte.«
Sie führte sie in das Zimmer, aus dem sie gekommen war. Es war ihr Büro, mit einem weichen, schmuddeligen Teppich ausgelegt. Am Fenster stand ein Schreibtisch, von dem aus man die Tür im Auge hatte. Ein paar Papiere lagen darauf. Neben der Lampe gab es ein schwarzes Telefon, dahinter ein Schlüsselbrett mit Nummern. Gegenüber, an der Wand, war ein breites Sofa, und darüber gab es ein weiteres Bild, diesmal ein Waldidyll. Mit einer Armbewegung bot die Grüber ihnen den Platz darauf an und setzte sich selber in einen Sessel.
»Was kann ich für Sie tun? Sie suchen doch kein Zimmer?«
»Es geht um einen Ihrer Mieter, Gustav Limba.«
Krell fiel auf, dass ihre Mundwinkel für einen kleinen Moment unkontrolliert zuckten. Sofort hatte sie sich wieder im Griff. »Was hat er ausgefressen?«