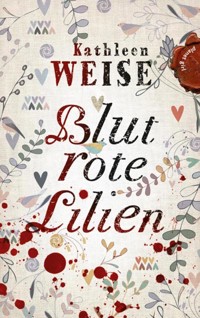3,99 €
Mehr erfahren.
Der erste Fall für den Entomologen Dr. Klaas Hansen Im Rahmen seiner Forschungsarbeit führt Dr. Klaas Hansen in einem Waldstück ein Experiment durch. Seine Bienen sind so konditioniert, dass sie Beweisstücke anhand von Gerüchen erkennen können – ähnlich wie Spürhunde. Während des Experiments finden die Sniffer Bees jedoch unerwartet einen Leichnam. Aber wer ist der unbekannte Tote und warum wurde er im Wald vergraben? Als die Presse von der Sache Wind bekommt, gerät Hansen unter Druck. Um seinen Job zu behalten, muss er nicht nur beweisen, dass das Bienenprojekt ein Erfolg ist, sondern auch der Polizei helfen, den Fall schnellstmöglich aufzuklären. Als wäre das nicht schwierig genug, handelt er sich auch noch Ärger mit den Kollegen der örtlichen Polizeihundestaffel ein und begegnet einer geheimnisvollen Fremden, die der Geschichte um den Toten im Wald eine völlig neue Wendung gibt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Das falsche Grab
Die Autorin
Kathleen Weise, 1978 in Leipzig geboren, veröffentlicht seit über zehn Jahren Romane für Jugendliche und Erwachsene in den Genres Historisches, Krimi und Phantastik. Außerdem arbeitet sie als freie Lektorin und veranstaltet Workshops und Textwerkstätten. Sie lebt mit ihrem Partner, dem Autor Boris Koch, und der gemeinsamen Tochter in Leipzig.
Das Buch
Der erste Fall für den Entomologen Dr. Klaas Hansen
Im Rahmen seiner Forschungsarbeit führt Dr. Klaas Hansen in einem Waldstück ein Experiment durch. Seine Bienen sind so konditioniert, dass sie Beweisstücke anhand von Gerüchen erkennen können – ähnlich wie Spürhunde. Während des Experiments finden die Sniffer Bees jedoch unerwartet einen Leichnam. Aber wer ist der unbekannte Tote und warum wurde er im Wald vergraben? Als die Presse von der Sache Wind bekommt, gerät Hansen unter Druck. Um seinen Job zu behalten, muss er nicht nur beweisen, dass das Bienenprojekt ein Erfolg ist, sondern auch der Polizei helfen, den Fall schnellstmöglich aufzuklären. Als wäre das nicht schwierig genug, handelt er sich auch noch Ärger mit den Kollegen der örtlichen Polizeihundestaffel ein und begegnet einer geheimnisvollen Fremden, die der Geschichte um den Toten im Wald eine völlig neue Wendung gibt …
Kathleen Weise
Das falsche Grab
Kriminalroman
Midnight by Ullsteinmidnight.ullstein.de
Midnight ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinOktober 2018 (1)
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2018Umschlaggestaltung:zero-media.net, MünchenTitelabbildung: © FinePic®Autorenfoto: © privatE-Book powered by pepyrus.com
ISBN 978-3-95819-228-7
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Epilog
Personenregister
Abkürzungsverzeichnis
Leseprobe: Martinsmorde
Empfehlungen
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
1
1
2013
»Die Hunde werden durchdrehen«, sagte Landmann.
Hansen legte den Schalter um, und zweiunddreißig Lämpchen im Gehäuse des Detektors leuchteten grün auf. »Bis die Jagd beginnt, bin ich längst verschwunden«, erwiderte er. Von der morgendlichen Kälte waren seine Finger beinahe steif geworden, und der Bart fühlte sich unangenehm feucht an.
Auch Landmann zog die Schultern hoch, obwohl er im Wagen saß und die Standheizung lief. Einen Arm hatte er auf die heruntergelassene Scheibe gestützt, und trotz seiner sitzenden Position brachte er es irgendwie fertig, auf Hansen herabzusehen. Dabei zog sich sein linker Mundwinkel nach unten, wie immer, wenn er mit einer Sache unzufrieden war. Der Blick hinter der Brille richtete sich mahnend auf Hansen. »Denk daran, dass die Zeit gegen dich läuft«, sagte er. »Sieh zu, dass du nichts übersiehst. Wir kriegen Riesenärger mit der Forstwirtschaft, wenn ihre Hunde etwas ausgraben, das nicht zur Jagd gehört.« Er deutete mit dem Daumen über die Schulter. »Drüben beim Rapsfeld steht der Kollege von der Bundespolizei, die Nummer hast du ja. Ruf ihn an, wenn du die Teile gefunden hast, dann wird er dir sagen, ob du alle erwischt hast.« Bei dem Wort Teile verzog er angewidert das Gesicht.
Hansen konnte es ihm nicht übel nehmen. Selbst für jemanden, der den Anblick von Leichen gewöhnt war, blieb die Vorstellung, im Wald nach vergrabenen Gliedmaßen zu suchen, eine makabre Angelegenheit.
Nach einem letzten skeptischen Blick auf den Detektor startete Landmann den Motor und fuhr über die vom Winter zerfressene Straße davon, während Hansen dem Wagen nachsah und sich fragte, ob sich sein Vorgesetzter je für etwas anderes interessiert hatte als für seinen eigenen Platz im System. Als er das Auto nicht mehr sehen konnte, drehte er sich um und blickte in das Dickicht vor ihm. Entschlossen trat er auf den feuchten Weg. An dieser Stelle war er breit angelegt, aber bald würde er schmaler werden, bis er nach wenigen Minuten Fußmarsch nur noch die Breite von einem Schritt besaß. In dieser Ecke des Waldes kannte sich Hansen gut aus. Von hier aus wollte er sich nach Westen vorarbeiten und dann systematisch den Forst durchkämmen.
In der Luft hing der Geruch von taunasser Erde und Morcheln. Es war nur noch eine Frage von Tagen, bis die ersten Sammler den Wald unsicher machen würden. Das war auch ein Grund gewesen, warum die Forstwirtschaft darauf drängte, die Experimente noch in dieser Woche durchzuführen. Niemand war scharf auf Spaziergänger, die plötzlich einen abgeschnittenen Fuß fanden.
Hansen mochte den Wald. Er war einer der Gründe gewesen, weshalb er sich in Dahlfeld niedergelassen hatte – in dieser Stadt, die weder Bedeutung noch Zukunft besaß und dennoch irgendwie weitermachte. Als ginge es nur darum, bis zu dem Tag durchzuhalten, an dem plötzlich wie aus heiterem Himmel alles besser wurde. Dabei war die Braunkohleindustrie in der Region schon lange in die Knie gegangen, und die letzten zehn Jahre war es auch sonst nicht besser geworden. Es mangelte an Investoren, und selbst die Universität zog nicht mehr genügend junge Leute an. Stattdessen schloss ein Studiengang nach dem anderen.
Einziger wirtschaftlicher Lichtblick blieb der alte Flughafen Dahlfeld-Nord, ein ehemaliger Fliegerhorst, der zu einem zivilen Flughafen ausgebaut werden sollte. Das Gebiet lag günstig, es gab kaum Anwohner, dafür eine ausgebaute Infrastruktur. Mit Blick auf die östlichen Nachbarn und das steigende Frachtaufkommen hoffte man darauf, dass ein Arbeitsplatz auf dem Flughafen zwei weitere in der Region nach sich ziehen würde. Dieser Entwicklung verdankte Hansen auch sein Projekt mit den Sniffer Bees.
Er stellte den Kragen gegen den Wind auf und sah auf den Detektor in seiner Hand hinab. Der besaß große Ähnlichkeit mit einem Handstaubsauger. In Hansens großen Händen wirkte er beinahe wie ein Spielzeug, doch sein finanzielles Potenzial belief sich auf Millionen. Im Inneren des Gehäuses waren zweiunddreißig Honigbienen auf winzigen Haltern festgeschnallt, die aussahen wie Throne.
Als wären sie alle Königinnen, dachte Hansen, und einen Moment lang stellte er sich vor, wie die Bienen unter der Plastikhaube mit den Flügeln zitterten, die Rüssel suchend ausstreckten und dabei von dieser einen Prägung überwältigt wurden, der sich alles andere unterordnen musste – diesem einen Sinn.
Dem Geruch.
Er verriet ihnen das Öffnen einer Blüte und das Verdampfen des Taus auf den Blättern. Sie nahmen das Vorbeiziehen eines Fuchses genauso wahr wie die vergeblichen Versuche eines Rehs, sich durch das Unterholz zu drängen. Selbst vom Blut, das jeden Tag von verletzten Tieren in den Waldboden sickerte, wussten die Bienen. Sie besaßen Kenntnis von Dramen, die Hansen verborgen blieben.
Im Gehen warf er immer wieder Blicke auf das Display, aber noch leuchtete die LCD-Anzeige in einem ungebrochenen Grün. Was immer die Bienen in diesem Augenblick rochen, es war nicht das, wonach er suchte und worauf sie konditioniert waren.
Die Versuche mit Kokain und TNT in Gebäuden oder verschlossenen Gefäßen hatte Hansen bereits hinter sich. Die Bienen hatten immer reagiert. Fäulnisgase in einem Waldstück zu lokalisieren, war ungleich schwieriger, denn die Bienen würden keinen Unterschied zwischen größeren Tierkadavern und Hansens Versuchsteilen machen. Er hoffte, dass in den letzten Tagen keine Rehe verendet waren.
Ungeduldig sah er wieder auf das Display und beschleunigte den Schritt, die Zeit lief gegen ihn. Nur langsam erwärmte sich die Luft, eigentlich war noch keine Flugzeit für Bienen. Doch in ihrem künstlichen Flugraum auf dem Gelände des alten Flughafens herrschte ewiger Sommer, daher waren sie so munter, als wäre schönstes Urlaubswetter. Ein winziges Heizelement erzeugte diese Wärme auch in dem Detektor.
Hansen hingegen fielen Tautropfen in den Kragen, wenn er unter tief hängenden Ästen hindurchging. Die Kälte kroch ihm unerbittlich unter die Haut, ein boshaftes letztes Aufbegehren gegen die wärmeren Tage, die folgen sollten. Das Licht schien blass durch die dichten Zweige.
Gelegentlich hörte er noch ein Auto, aber nach einer Weile war er so weit in den Forst vorgedrungen, dass die lautesten Geräusche von Vögeln kamen. Unter seinen schweren Sohlen knackten Zweige, und hin und wieder gab die nasse Erde schmatzende Geräusche von sich. Schon nach kurzer Zeit waren seine Stiefel und die Ränder der Hosenbeine schlammbedeckt.
Vorsorglich hatte er den alten Pullover und die lange graue Wolljacke angezogen, die ihm bereits an Deck gute Dienste geleistet hatten. Robuste Kleidung war die heimliche Leidenschaft vieler Seeleute, modische Aspekte spielten dabei keine Rolle. Ein Mann wie ein Bär, hätte seine Mutter über ihn gesagt, wenn sie ihn jetzt sehen könnte, und damit vor allem in einer Hinsicht recht gehabt: Er blieb lieber für sich.
Während er weiterlief, versuchte er, die Gedanken an die Vergangenheit abzuschütteln. In letzter Zeit fiel ihm das wieder schwerer. Vielleicht wegen der Sache mit seinem Vater, die ihm keine Ruhe ließ. Der Alte war wie ein Gespenst, das man nicht loswurde.
Hansen warf einen Blick auf die Uhr. Je schneller er war, umso zufriedener war Landmann, umso eher ließ er ihn in Ruhe weiterarbeiten.
Die schlammverklebten Schuhe wurden schwer, der Weg war nur noch ein glitschiger Pfad. Er verließ ihn und stapfte quer durch den Wald. Wurzeln ragten hier und da aus dem Boden, und Hansen geriet mehrmals fast ins Straucheln. Er stieg über Baumstümpfe und eine winzige Anhöhe hinauf, oben atmete er schwerer. Die Wintermonate über hatte er zu viel Zeit im Labor verbracht und zu wenig trainiert. Die selbst gebaute Drückerbank im Keller setzte langsam Staub an, und wenn er nicht aufpasste, würde er bald wieder Schwierigkeiten mit der linken Schulter kriegen.
Auf einem tief sitzenden Ast vor ihm ließ ein Habicht sein verärgertes Gickern hören. Es war ein Männchen, das einfach nicht fortfliegen wollte. Hansen blieb stehen, und ein paar Herzschläge lang sahen sich der Vogel und er in die Augen, bevor Hansen durch ein Flackern am Rand des Sichtfelds abgelenkt wurde. Er schaute nach unten.
Die erste Lampe hatte ihr Licht verändert.
Er blinzelte, doch die Lampe leuchtete immer noch rot. Gleich darauf änderte eine Zweite ihre Farbe.
Er hatte es gewusst! Zwei von zweiunddreißig Lämpchen konnten zwar Zufall sein, aber das glaubte er nicht. Irgendwo hier musste das erste Teil liegen. Langsam ging er in die Richtung weiter, die er ursprünglich eingeschlagen hatte. Jetzt nur nichts überstürzen, um die Fährte nicht zu verlieren. Das meckernde giek, giek, giek des Habichts folgte ihm.
Nach wenigen Metern leuchteten alle Lampen rot. Jetzt hatte auch die letzte Biene den Geruch aufgenommen, auf den sie konditioniert war. Das war ganz sicher kein Zufall mehr. Aufmerksam sah sich Hansen um, während er ganz langsam weiterging.
Das Problem mit den Sniffer Bees war, dass sie manchmal einfach zu gut waren. Man wusste nie genau, ob sie etwas in zwei oder zwanzig Metern Entfernung rochen. Und auch wenn man Bienen nicht wie Hunde abrichtete und ihnen keine Namen gab, wollte er doch stolz auf sie sein. Sie waren mehr als nur funktionierende lebendige Teile eines Detektors.
In der Nähe einer riesigen Buche blieb er stehen und suchte mit dem Blick den Boden ab, bis er die Stelle fand, die am ehesten danach aussah, als wäre der Boden frisch aufgeworfen worden. Vorsichtig legte er den Detektor ab, damit das Gehäuse nicht zu sehr erschüttert wurde, und stellte die Tasche daneben. Er zog eine kleine, schwarz lackierte Schaufel heraus und stach damit schwungvoll in die Erde.
Der Typ von der Polizei hatte den Sack sicher nicht tief vergraben. Keiner macht sich morgens um fünf Uhr die Mühe. Mit ein bisschen Glück musste er nicht lange suchen.
An dieser Stelle war die Erde weich. Die Schaufel fuhr leicht durch die Erdschichten, und schon wenige Stiche später stieß sie auf Widerstand. Hansen hörte Plastik rascheln. Zufrieden wählte er die Nummer, die ihm Landmann ins Handy programmiert hatte.
Am anderen Ende meldete sich der verantwortliche Beamte, schlecht gelaunt und heiser, wie es von einem Mann zu erwarten war, der seit dem Morgen in seinem Wagen saß, nachdem er Leichenteile vergraben hatte.
»Na endlich!«, bellte er ins Telefon. »Ich friere Ihretwegen bald an meinem Sitz fest!«
»Ich habe etwas gefunden. Nicht weit vom Hochsitz.« Hansen nannte ihm die Flurstücksnummer.
Der Beamte nieste. »Welcher Hochsitz?«
Hansen wiederholte die Flurnummer.
»Ganz kalt. Da war ich nicht einmal in der Nähe, Herr Wissenschaftler.«
»Aber …«
»Neumodischer Quatsch«, murmelte der Beamte. »Mit einem Hund wäre das nicht passiert.«
Irritiert runzelte Hansen die Stirn. »Bleiben Sie dran.« Er legte das Telefon auf die Erde und versuchte, mit Hand und Schaufel die Erde weiter abzutragen.
Hatten sich seine Bienen geirrt? Alle? War er nur auf Abfall gestoßen?
Der Plastiksack war viel größer, als er erwartet hatte. Was immer auch darin lag, war weit mehr als nur ein Fuß oder ein Unterarm.
Was zum Henker war das? Verendete Rehe krochen nicht freiwillig in Plastiksäcke. Noch einmal warf er einen Blick auf den Detektor, aber die Lämpchen leuchteten nach wie vor rot. Die Bienen streckten ihre Rüssel nach Zuckerwasser aus, das sie während der Konditionierungsphase immer dann bekommen hatten, wenn sie gleichzeitig Fäulnisgase rochen.
Noch konnte er nicht ertasten, was in dem Sack lag. Es musste zusätzlich eingewickelt sein. Bedächtig legte er die Schaufel beiseite und zückte sein Schweizer Taschenmesser. Mit der großen Klinge stach er vorsichtig ein Loch hinein und schlitzte den Sack dann längs auf. Sofort schlug ihm der allzu bekannte Geruch nach Verwesung entgegen, und die ersten Fliegen schwirrten hervor. Angewidert hielt sich Hansen den Handrücken unter die Nase.
Unter dem Plastik kam Stoff zum Vorschein. Da hörte er die Rufe aus dem Telefon. Zögernd ließ er die Hand sinken, um das Handy vom Boden aufzuheben, während er mit der anderen Hand weiter versuchte, den Stoff zu entfernen. Er durchstach mit dem Messer das Leinen und sah endlich den Inhalt des Sacks.
Instinktiv legte er das Messer ab und griff nach dem Anhänger des heiligen Nikolaus, den er an einer dünnen Kette Tag und Nacht um den Hals trug. Warm lag das Silber in seiner Hand.
»Was treiben Sie denn?«, kam es vom anderen Ende der Leitung.
Aber es dauerte einen Augenblick, bis Hansen antwortete: »Rufen Sie Ihre Kollegen an. Ich habe hier keine Leichenteile.« Er wischte sich den Schweiß von der Augenbraue. »Es ist eine ganze Leiche.«
2
17 Jahre zuvor
Die Party war bereits am Abflauen. Die Pärchen hatten sich gefunden, und in der alten Stereoanlage, deren Kabel mit Pflastern umwickelt waren, liefen nur noch langsame Songs. Der Geruch von Deo, Schweiß und Chili con Carne waberte durch die Räume, als wäre es ein ungeschriebenes Gesetz, dass eine Party erst etwas taugte, wenn die ganze Bude nach Bohnen stank.
Seit zehn Minuten versuchte Mark bereits, Jessie unter die Bluse zu greifen, und gelangweilt kraulte sie ihm den Nacken, damit er nicht merkte, dass ihre Aufmerksamkeit längst etwas anderem galt. Träge glitt ihr Blick über die Leute, von denen sie die meisten nicht kannte und auch nicht kennenlernen wollte. Im Licht der roten Glühlampe an der Decke wirkten ihre schemenhaften Gestalten wie Tiere mit seltsam verrenkten Gliedern.
Am Nachmittag in der Schule hatte Jessie noch geglaubt, dass es irgendwie spaßig werden könnte, mit Mark raus nach Fuchsheim zu fahren. Aber jetzt musste sie erkennen, dass die angeblich heißen Partys, von denen er geschwärmt hatte, doch nur wieder derselbe alte Mist waren wie immer – Saufen, Rauchen, Knutschen. Der Teppich rieb unangenehm an ihren Knien, und ein Ohrring hatte sich in einer Haarsträhne verfangen. Sie wusste nicht genau, was sie erwartet hatte, aber doch irgendwie etwas anderes als das.
Gelangweilt zerrte sie den Ohrring aus der Strähne und warf einen Blick zu Margret, die an der gegenüberliegenden Wand hockte, das Kinn auf die angezogenen Knie gestützt, als wäre sie eine in sich zusammengesunkene Marionette. Im Schein der blöden Glühlampe wirkten ihre nackten Schienbeine wie Keulen in der Auslage eines Fleischers.
Obwohl Jessie es nicht genau sehen konnte, wusste sie doch, dass Margret sie in diesem Moment beobachtete. Der Blick wärmte ihre Schultern und übertrug den stummen Vorwurf wie einen Funkspruch: Warum hast du mich hierhergebracht?
Weil ich nicht allein gehen wollte.
Es überraschte Jessie nicht, dass keiner der Jungs Notiz von Margret nahm. Ihre Freundin war nicht hässlich, sie war nur wie eine dieser Pflanzen, deren Blüten sich bei der geringsten Berührung schlossen. Sie trug ihre Unentschlossenheit wie eine Fahne vor sich her, und die meisten Jungs waren eben wie Mark. Sie wollten ihre Zungen irgendwo reinstecken und vorher nicht noch groß ins Kino gehen. Margret hingegen sah aus wie die Mädchen, die sich erschreckten, wenn man ihnen die Hand unter den Rock schob. Das machte sie bei den Jungs nicht gerade beliebt, obwohl sie eigentlich ein hübsches Gesicht hatte, mit ihren großen braunen Augen und den wenigen blassen Sommersprossen. Aber das glaubte Margret ihr nicht.
Sie mochte die Art, wie Jessie mit Jungs umging, ohnehin nicht besonders. »Musst du schon wieder so gemein sein«, fragte sie manchmal, wenn wieder ein Junge mit gebrochenem Herzen abzog. Sie hatte noch nicht verstanden, dass ein gebrochenes Herz bei diesen Kerlen genauso schnell heilte wie der Schnitt im Daumen, wenn man sich beim Öffnen einer Konservendose verletzte.
Jessie hatte das längst begriffen. Aber es war ihr lieber, Margret in dem Glauben zu lassen, sie wäre manchmal herzlos, als eingestehen zu müssen, dass die meisten Jungs Jessie genauso schnell ersetzt hatten wie die T-Shirts, aus denen sie herauswuchsen.
Wahrscheinlich denkt sie, dass es mir Spaß macht, dachte Jessie und seufzte. Das schien Mark für ein gutes Zeichen zu halten, denn er verdoppelte seine Bemühungen. Sein Speichel lief ihr am Hals hinunter, und auf einmal drückte seine Berührung ihr die Kehle zu, und sie schnappte nach Luft. Angewidert machte sie sich von ihm los und kam schwankend auf die Beine. Umständlich zog sie den Rock herunter.
»Was ist denn?«, maulte er von unten. »Wo willst'n hin?«
»Nach Hause«, murmelte sie, während er sich durch die Haare fuhr und irritiert zu seinem Kumpel sah, der an einer Brünetten mit Doppel-D herummachte, die von der Bowle völlig hinüber war.
Aber der Kumpel zuckte nur ratlos mit den Schultern.
»Spinnst du? Vergiss es, ich fahre euch bestimmt nicht.« Beinahe aggressiv griff Mark nach ihrem Knöchel, aber Jessie schüttelte ihn ab.
»Dann lass es halt sein, auch gut.« Sie durchquerte das Zimmer und streckte Margret mit einem Kopfschütteln die Hand entgegen, zog sie erst auf die Füße und dann hinaus aus der Wohnung und in den dunklen Treppenflur, während Mark ihnen wüste Beschimpfungen hinterherrief und die Jungs zu johlen begannen.
Die ganze Zeit über sagte Margret kein einziges Wort, klammerte sich nur an Jessies Hand, als wäre Jessie irgend so ein Typ aus einem Hollywoodfilm, der eine Jungfer in Not rettete. Dabei hätte nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein können.
Im Dunkeln begann Jessie zu zittern. Sie löste sich von Margret, und es dauerte einen Augenblick, bis sie den Lichtschalter fand. Ihre tastenden Finger fuhren über den rauen Putz. Als sich das Licht über sie ergoss, schloss sie für ein paar Sekunden die Augen und atmete tief durch. Durch die kaputte Haustür zog Nachtluft herein und kühlte ihr die Stirn, auf der plötzlich Schweiß ausgebrochen war. Der Sommer ging langsam in die Knie, und die Kälte kroch ihr unter den kurzen Rock.
Auch Margret rieb sich die Arme. »Wie kommen wir jetzt nach Hause?«, fragte sie, als sie endlich auf der Straße standen. Weit und breit war kein einziger Mensch zu sehen. Die Wohnsiedlung lag ruhig und verlassen da, nur aus einem Fenster über ihnen waren die Geräusche der Party zu hören. Selbst hier unten roch es nach Chili.
»Genauso, wie wir hergekommen sind.«
»Aber Mark hat uns gefahren.«
Genervt hob Jessie die Arme, während sie einfach draufloslief, die Straße runter. »Wir werden wieder jemanden finden, der uns mitnimmt.«
»Das ist mir zu gefährlich …«
»Scheiße!« Sie warf Margret einen verärgerten Blick zu. »Hör mal, wegen dir bin ich jetzt von der Party abgehauen, also stell dich nicht so an. Oder willst du wieder zurück?«
Margret schüttelte den Kopf.
»Wir sind doch zu zweit, da passiert uns schon nichts.« Jessie machte sich nicht die Mühe, Margret zu erklären, dass sie oft auf diese Weise unterwegs war. In anderen Nächten, wenn ihre Freundin längst schlief. Weil sie manchmal eben einfach abhaute aus der Wohnung, wenn ihr alles zu viel wurde. Irgendwer hatte sie immer mitgenommen.
Sie war vorsichtig. Sie ging nicht mit alten Kerlen mit oder welchen, die fies aussahen. Meistens hielt sie sich sowieso an die, die mit dem Moped unterwegs waren. Sie war fünfzehn und keine Idiotin. Und es war doch nicht so, als ob sie noch ihre Jungfräulichkeit zu verlieren hätte. Das war ohnehin längst vorbei, und wirklich dran gehangen hatte sie auch nicht. Dieser Hautfetzen war doch nicht von Bedeutung, er machte das Leben weder besser noch schlechter. Jessie hatte nie verstanden, warum die Leute so viel Aufhebens darum machten.
Aber das sagte sie nicht laut. Jedenfalls nicht mehr, seit ihre Frauenärztin ihr erklärt hatte, dass es etwas mit Selbstrespekt zu tun hätte, wem man sich hingab, und Jessie am liebsten gesagt hätte: Klar, und dass man so aus dem Leim geht wie Sie, auch.
Das war eine Sache, die Jessie inzwischen begriffen hatte, dasselbe Geschlecht machte einen nicht unbedingt zu Verbündeten.
Ohne ein Wort auszutauschen, liefen sie bis an den Ortsrand. Hin und wieder hörten sie Autos, aber keins davon verließ Fuchsheim in Richtung Steinburg. Kurz vor dem gelben Ortsschild, auf das Witzbolde neongrüne Sticker geklebt hatten, stand eine alte Bank, an der bereits die Rückenlehne fehlte und die in besseren Tagen wohl zu einem Haltestellenhäuschen gehört hatte. Jessie hockte sich auf die Bank, und Margret tat es ihr gleich. Grimmig starrte Jessie in die Nacht, über das Feld hinüber zur Autobahn, die am Ort vorbei nach Dahlfeld führte, der größten Stadt in der Region. Unzählige Lichtpunkte tauchten auf und verschwanden wieder – fuhren Leben entgegen, in denen etwas passierte –, und Jessie schwor sich, dass sie eines Tages ebenfalls mit einem Auto verschwinden würde. Sie würde ihr Leben nicht in diesem jämmerlichen Kaff verbringen, in dem nie etwas passierte. In zu vielen Häusern roch es nach Salpeter, und die Leute schlurften durch die Gassen wie ausgeblichene Schornsteinfeger, grau und gebückt. Das würde nicht ihre Zukunft sein.
»Gestern habe ich deinen Vater gehört«, sagte sie nach einer Weile zu Margret, weil sie immer an ihn denken musste, wenn sie an die Dinge dachte, die in diesem Ort schiefliefen.
Margret nickte nur, ohne etwas zu erwidern. »Er schreit in letzter Zeit oft.« Jessie warf ihr einen Blick zu, doch Margret wandte das Gesicht ab und starrte auf die Straße, als könne sie ein Auto herbeiwünschen. Dabei kratzte sie mit dem Fingernagel Farbe von der Holzplanke der Bank. Jessie seufzte tonlos. »Meine Eltern schreien nie. Ich wünschte, sie täten es mal. Dann würde der ganze Frust vielleicht aus ihnen herausplatzen. Wie bei einer Eiterbeule. Und danach wird alles besser, verstehst du, was ich meine?«
Zaghaft nickte Margret.
»Mein Vater hat schon wieder eine Absage bekommen. Er findet einfach keinen Job. Mutsch genauso wenig. Er hockt den ganzen Tag nur vorm Fernseher, und wenn’s ihn packt, will er meine Hausaufgaben kontrollieren. Dabei kann er Englisch noch weniger als ich. Gestern sollte ich meine Pullover im Schrank auf Kante legen. Viermal hat er mich die Dinger zusammenlegen lassen und dann das Lineal angehalten, bis sie alle genau übereinanderlagen. Total durchgedreht.« Sie tippte sich an die Stirn, und ein Frösteln überfiel sie. Jessie rieb sich die Arme. Allzu lange konnten sie nicht mehr in der Kälte auf der Bank sitzen bleiben. Wenn sie niemand mitnahm, mussten sie den Weg zurück zu Fuß über die Bundesstraße antreten.
Sie starrten in die Dunkelheit, in der sich langsam vom alten Plattenladen her die Lichter eines Wagens auf sie zubewegten.
Jessie wusste, dass Margret nicht gern über ihren Vater sprach, weil sie dann auch über ihre Mutter sprechen musste, und das war ein Thema, das sie vermied, wenn sie konnte. Dabei wusste jeder im Wohnblock, dass Margrets Mutter in den Westen gezogen war. Am Anfang hatten noch alle geglaubt, sie würde Margret nachholen, sobald sie einen guten Job gefunden hatte. Aber nach acht Monaten dachte das niemand mehr. Nicht mal Margret selbst. Obwohl Jessie den Verdacht hegte, dass sie es sich manchmal noch wünschte.
Wenn sie abends im Bett lag und hörte, wie Margrets Vater ihre Freundin wegen Nichtigkeiten anschrie, überkam Jessie eine Wut, die noch hundert Mal stärker war als die auf die Typen, mit denen sie ausging. Sie hätte Margret gern geholfen, aber sie wusste nicht, wie. Sie konnte sich ja nicht mal selbst helfen.
»Ist doch alles beschissen hier«, murmelte sie. »Lange bleib ich jedenfalls nicht mehr hier, das kannst du wissen.«
»Wo willst du denn hin?«
»Keine Ahnung, Hauptsache, raus. Wenn ich hierbleibe, werde ich irgendwann genauso grau wie die alte Schneider aus dem Erdgeschoss.«
Margret lachte. »Aber das wirst du doch sowieso.«
»Das meine ich nicht. Es ist einfach so …« Sie suchte nach den richtigen Worten, doch das, was sie empfand, ließ sich nur schwer verständlich machen. Jessie wurde das Gefühl nicht los, dass sich der Staub, den sie jahrelang eingeatmet hatte, von innen durch die Poren nach außen drückte und auf ihre Haut legte. Jedes Mal, wenn sie die Hand vor die Augen hob, sah sie nichts als Grau.
»Kann ich mit dir kommen?«, fragte Margret zaghaft und sah sie nun doch wieder an.
»Wenn du willst.« Jessie zuckte mit den Schultern. »Aber du wirst doch sowieso von hier verschwinden. Mit deinem Einserdurchschnitt gehst du irgend so ein Studium machen und wirst es mal zu was bringen, garantiert.«
»Ich weiß nicht …« Mit dem Handrücken fuhr sich Margret über die Nase, und Jessie hätte sie am liebsten geschüttelt, weil Margret gar nicht wusste, wie viel Glück sie hatte mit ihrem dummen klugen Gehirn. Sie war immer die Schlauere von ihnen beiden gewesen, und die Wahrheit war, dass Jessie Margret um ihre Klugheit beneidete. Sie erschien ihr wie ein Fahrschein aus diesem Kaff raus.
Aber wenn es darum ging, auf andere Menschen zuzugehen, war diese ganze Klugheit an Margret verschwendet. Es war merkwürdig.
Als das Auto endlich bei ihnen ankam, sprang Jessie auf, um den Daumen auszustrecken. Es war ein roter Honda mit schwarzen Stoßstangen, und er hielt direkt neben ihr. Der Fahrer ließ die Scheibe herunter, und sie beugte sich nach vorn. Hinter sich konnte sie Margret tief einatmen hören. Kaum dass Jessie den Fahrer erkannt hatte, nickte sie. Oelschlägel hatte sich offenbar einen neuen Wagen zugelegt, denn mit seinem alten war sie schon ein paar Mal mitgefahren. Letzten Monat hatte er sie nachts bereits zwei Mal aufgelesen, als sie von Partys und er von seiner Verlobten heimgekommen war. Der Typ war in Ordnung, für einen Englischlehrer relativ jung. Ab und zu warf er einen Blick auf ihre Knie, wenn sie neben ihm saß, doch das störte sie nicht. Seine Hände hatte er immer bei sich behalten.
»Hallo, Jessica«, sagte er mit seiner tiefen Brummstimme, die überhaupt nicht zu ihm passte. Er war eher schmal und auch nicht besonders groß. Beinahe enttäuscht lag sein Blick auf ihr.
»Abend, Herr Oelschlägel.«
»Wissen deine Eltern, dass du um diese Uhrzeit allein unterwegs bist?«
Sie lächelte ihn breit an. »Aber natürlich, Herr Oelschlägel, außerdem bin ich ja nicht allein.«
Mit zusammengezogenen Brauen beugte er sich noch ein Stück weiter nach vorn und warf Margret einen Blick zu, die nervös am Daumennagel kaute. Ungeduldig winkte Jessie sie näher.
»Soll ich euch nach Hause fahren?«
»Das wäre prima.« Sie öffnete die hintere Tür und schubste Margret in den Wagen, bevor die irgendetwas dagegen einwenden konnte.
Während der zehnminütigen Fahrt versuchte Oelschlägel nicht, mit ihnen zu reden. Nur hin und wieder warf er einen Blick in den Rückspiegel, worauf Jessie lächelte, aber das schien ihn nicht fröhlicher zu stimmen.
Im Wageninnern machte sich ein merkwürdiges Schweigen breit, das aufgeladen war mit Gedanken und unausgesprochenen Fragen, und Jessie lehnte den Kopf gegen die Scheibe. Darin konnte sie ihr verschwommenes Gesicht erkennen, das blonde Haar umgab sie wie ein Heiligenschein, und ihre Augen wirkten unnatürlich groß, genauso wie ihr Mund, der sich doppelt spiegelte.
Sie wusste, dass sie hübsch war, alle sagten das – schon immer –, doch sie selbst empfand nichts, wenn sie ihr Gesicht betrachtete. Mit ruhigem Puls küsste sie das Spiegelbild. Das Glas war angenehm kühl an ihren Lippen. Ihr Atem beschlug die Scheibe, und sie wünschte sich, dass sie ewig so weiterfahren würden. Einfach auf der anderen Seite der Stadt wieder hinaus und weiter bis zum Sonnenaufgang. Vielleicht, wenn sie Oelschlägel etwas anbieten würde … Sie warf ihm einen Blick zu und erkannte, dass er sie wieder im Rückspiegel beobachtete. Als er ihren Blick bemerkte, sah er rasch auf die Straße.
Einen Moment lang zog sie in Erwägung, es darauf anzulegen, ihn rumzukriegen. Sie fragte sich, wie er unter dem langweiligen Hemd aussah, das er auch in der Schule trug, und wie er sie küssen würde. Er war um einiges älter als die Jungs, mit denen sie sich sonst traf, aber vielleicht konnte er Dinge, die die anderen nicht konnten. Würde sich seine Haut anders anfühlen? Würde er anders riechen?
Sie sah wieder aus dem Fenster. Nein, Oelschlägel war nicht der Richtige für sie. Wahrscheinlich würde er die ganze Zeit nur ein schlechtes Gewissen haben, das konnte sie nicht gebrauchen.
Im Licht der vorbeiziehenden Straßenlaternen flimmerte ihr Gesicht in der Scheibe wie ein Abbild im Wasser. Als wäre sie eine Meerjungfrau. Eine Meerjungfrau an Land, die nicht richtig atmen konnte, weil sie dort fremd war. Und die einzige Möglichkeit, wieder nach Hause zu kommen, bestand darin, einen Seemann zu finden, der sie mit seinem Schiff aufs Meer fuhr, weil er sich in ihr Gesicht verliebt hatte.
Sie legte den Kopf wieder an die Scheibe und ließ sich von den Nachtlichtern einlullen. Eines Tages, schwor sie sich, würde sie Margret und sich hier rausholen. Dann würde Margret begreifen, wie toll sie eigentlich war, selbst wenn Typen wie Mark sie nicht zum Tanzen aufforderten, und Jessie würde endlich frei atmen können.
3
Hansen legte die Wolljacke auf die Rückbank des alten BMW. Die Mittagssonne hatte die Luft so weit erwärmt, dass er in seinem Pullover zu schwitzen begann. Wie mussten sich erst die Männer vom Erkennungsdienst fühlen, die in ihren Plastikanzügen auf der Suche nach verwertbaren Spuren noch immer durch den Wald krochen?
Er lehnte sich ans Auto und nahm einen tiefen Zug von der selbst gedrehten Zigarette. Der Tabak war alt und trocken und zerbröselte auf der Zunge. Eigentlich hatte er schon längst wieder mit den Bienen im Labor sein wollen, aber der zuständige Staatsanwalt hatte unterwegs Schwierigkeiten mit dem Wagen bekommen und war mit einstündiger Verspätung eingetroffen.
Hansen blies den Rauch in Richtung Sonne.
Der Amtsarzt war deutlich schneller gekommen und schon wieder verschwunden. Er hatte – wenig überraschend – auch offiziell den Tod bei Hansens Fund festgestellt. Sein Stempel war eine bürokratische Notwendigkeit, auch wenn niemand auf die Idee gekommen wäre, dass sich eine Wiederbelebung gelohnt hätte. Der Zustand der Leiche ließ keinen Zweifel daran, dass sie schon Wochen alt war. Nur wenige Schritte neben ihr hatte sich ein Polizist übergeben und dafür einen Rüffel seiner Kollegen kassiert, weil er den Tatort kontaminiert hatte.
Der Junge war neu, im Angesicht der zerstörerischen Kraft des Sterbens trug sein Gesicht noch den Ausdruck überraschter Verwunderung, und Hansen beneidete ihn beinahe um seine Unschuld. Er konnte es dem Jungen nicht übel nehmen, es war kein schöner Anblick. Die Fäulnis hatte bereits eingesetzt. Aus allen Körperöffnungen trat dunkle Flüssigkeit, und eine Identifizierung der Leiche anhand des Gesichts war nicht mehr möglich. Schon auf den ersten Blick hatte Hansen die üblichen Verdächtigen gesehen, Fliegen und Maden. Das Fleisch des Toten war aufgequollen und besaß keinerlei Ähnlichkeit mehr mit dem, was es einmal gewesen war: der Mantel eines lebendigen, fühlenden Wesens.
Um diesen Anblick zu ertragen, benötigte man einen starken Magen, und der kam eben oft erst mit der Erfahrung.
Seinen Kaffee hatte Hansen zwar bei sich behalten, aber der unerwartete Fund sorgte dafür, dass er die viermonatige Zigarettenpause unterbrach und sich mit zitternden Fingern eine Selbstgedrehte ansteckte. Den Schwarzen Krauser hatte er in einer zerknitterten Packung gefunden, die noch im Handschuhfach unter dem Autoatlas gelegen hatte. Wie immer schmeckte die Erste nach einer längeren Pause nach Meer und den Nächten an Deck.
Während er weiter Rauch in die Lunge zog, beobachtete er die beiden Polizisten, die in blauen Uniformen nur wenige Meter von ihm entfernt standen und den Zugang zum Fundort bewachten. Hin und wieder warfen sie ihm Blicke zu. Offenbar wussten sie, wer er war. Solche Blicke waren nichts Neues.
Seit es die Runde gemacht hatte, dass das Bienenprojekt die Spürhunde auf dem Flughafen ersetzen sollte, war seine Beliebtheit bei der örtlichen Polizei rapide gesunken.
Nachdem die Kosten, wie bei vielen Großprojekten, zu explodieren drohten, war der Flughafenleitung alles willkommen, was langfristig Einsparungen versprach. Mit BIODetech hatte sie einen Anbieter für Sicherheitstechnik beauftragt, der zur Aufspürung von Sprengstoff und Drogen auf die Entwicklung von Detektoren mittels Bee-Sensor-System spezialisiert war. BIODetech wollte das System weltweit zum Einsatz bringen, und Dahlfeld sollte ihr Vorzeigeflughafen werden. Die Bienen ließen sich schneller trainieren als Hunde und waren auf die Dauer auch billiger im Unterhalt.
Dass Hansen seine Arbeit mit den Bienen ursprünglich aufgenommen hatte, weil ihn Insekten faszinierten und ihn ihr unglaublicher Geruchssinn begeisterte, interessierte die Polizisten nicht. Auch nicht, dass er davon überzeugt war, mit den Bienen eine bessere Aufklärungsrate zu erreichen, und dass seine Forschungen die Polizei in naher Zukunft unterstützen sollten. Er war weder für Budgets zuständig noch irgendwem bei BIODetech verpflichtet, nur der Forschung und seinen Bienen.
Doch der Vorstand war weit weg, und so war er für die meisten das Gesicht der anstehenden Veränderung geworden, und die Kollegen von der Schupo hielten zusammen. Wer an alten Ritualen kratzte, machte sich keine Freunde, das hatte Hansen schon auf See gelernt.
Er spuckte einen Tabakkrümel aus und starrte in den Wald. Auch der Staatsanwalt hatte es vorgezogen, einen Bogen um ihn zu machen und stattdessen Hansens Kollegen Gerhard bei der Leichenschau Gesellschaft zu leisten.
Hansen war an ein solches Verhalten gewöhnt. Auf See hatten sie ihn Rübezahl genannt, seines schwarzen Barts, der Größe und breiten Statur wegen. Er schüchterte die Leute ein, ohne viel dafür tun zu müssen. Niemand will mit einem Bären tanzen.
Er nahm noch einen letzten Zug, dann ließ er die Kippe fallen, trat sie mit der Stiefelspitze aus und blickte auf den Detektor, der auf der Rückbank lag, halb verdeckt durch die Jacke. Es wurde Zeit, die Bienen in den Flugraum zurückzubringen. Er wollte die Tiere keinem unnötigen Stress aussetzen, für sie war der Tag lang genug gewesen. Außerdem behagte es ihm nicht, dass er den Prototypen die ganze Zeit mit sich herumschleppte. Das Ding war teuer, und Landmann würde ihm die Eier abreißen, wenn damit irgendetwas passierte.
Als er wieder aufsah, stieg Kriminalhauptkommissar Paul Jacobsen über das Absperrband und winkte den Bestattern, die auf der anderen Seite des Wegs parkten. Wie immer saß seine Brille schief auf der Nase, aber das schien ihn nicht zu stören.
Hansen verstand nicht, was Jacobsen zu den Männern sagte, als sie mit dem leeren Zinksarg an ihm vorübergingen, aber sein Blick war alles andere als freundlich. Der Mann stand kurz vor der Pensionierung und nahm die Unterbrechung der Routine seiner letzten Tage bei der Polizei wahrscheinlich persönlich.
Unter den Kollegen galt Jacobsen als notorischer Frühaufsteher, der seinen Dienst vor allen anderen antrat und so bei den jüngeren Beamten nach langen Wochenenden für schlechte Gewissen sorgte. Seine Vorliebe für feste Gewohnheiten spiegelte sich auch in seiner Kleidung wider. Selten sah man ihn im Dienst in etwas anderem als blauen Hemden ohne Krawatte, Jeans, braunen Schuhen und einer braunen Lederjacke, die am Bund bereits abgeschürft war. Als er sich Hansen näherte, zog er die Schultern hoch, als wappne er sich für ein Gespräch, das er gern vermieden hätte.
Eine gute Armlänge vor ihm blieb Jacobsen stehen. Auf diese Weise fiel es nicht so sehr auf, dass er Hansen nur bis zur Schulter reichte.
»Da haben Sie ja ganz schön was losgetreten«, eröffnete er das Gespräch, und der Blick hinter den Brillengläsern musterte Hansen streng.
»War nicht meine Absicht.«
»Das glaube ich Ihnen gern.« Jacobsen deutete auf die Kippe zu seinen Füßen. »Sie haben wieder angefangen?«
»Schlechte Angewohnheiten wird man schwer los.«
»Wem sagen Sie das.« Der Polizist seufzte und zog einen Block aus der Jackentasche.
»Und Sie schreiben immer noch auf Papier?«
»Kann mich mit dem neumodischen Zeug nicht anfreunden. Die Kollegen behaupten immer, sie wären schneller mit ihren Taschencomputern, aber am Ende des Tages bin ich derjenige, der pünktlich nach Hause geht, während sie noch ihre Computer synchronisieren.«
Hansen lächelte schwach. Er kannte Jacobsen nur flüchtig, sie waren sich ein paar Mal in der Rechtsmedizin über den Weg gelaufen, wenn jemand forensisch-entomologische Gutachten angefordert hatte, aber jedes Mal war ihm die Aversion des Kommissars gegen alles Schnurlose aufgefallen.
»Sie haben den Kollegen von der Schupo erzählt, dass Sie die Leiche aufgrund Ihrer Bienen gefunden haben«, ging Jacobsen zum relevanten Teil der Unterhaltung über, offenbar reichte seine Geduld an diesem Tag nur für eine oberflächliche Freundlichkeit.
»Sie sind auf Fäulnisgase geeicht. Haben Sie mit Ihrem Kollegen von der Bundespolizei gesprochen?«
Jacobsen nickte langsam. »Er sagt, Sie führen ein Experiment durch.«
»Fürs Institut.«
»Mit Leichen.«
»Leichenteilen.«
»Und die Bienen haben Sie zu der Leiche geführt, sagen Sie? Wegen der Gase?« Jacobsen warf einen Blick über die Schulter. »Ja, das ist nicht gerade unauffällig, was? Der Sack stinkt zum Himmel. Wie funktioniert das eigentlich, Ihre Bienenprägung?«
»Genauso wie bei Hunden auch. Pawlowscher Reflex. Sie verbinden einen bestimmten Geruch mit Futter. In diesem Fall Leichengase mit Zuckerwasser.«
Prüfend schaute Jacobsen ihn an und kniff die Augenbrauen zusammen. Natürlich fragte er sich, womit Hansen die Bienen geprägt hatte, und natürlich kam er zu demselben Schluss wie alle anderen, die von den Bienen wussten: In der Rechtsmedizin mangelte es nicht gerade an Versuchsmaterial.
Sein Gesichtsausdruck zeigte deutlich, was er davon hielt, und Hansen spürte, wie ihn die Ungeduld packte. Er war diesen Blick einfach leid, genauso wie er es leid war, seine Experimente zu erklären. Selbstverständlich konnte er die Bienen auch auf Schwarzwälder Kirschtorte eichen, aber der Nutzen wäre eher beschränkt. Stattdessen würden seine Bienen später einmal Männer wie Jacobsen davor bewahren, auf Urlaubsflügen böse Überraschungen zu erleben, sollte jemand eine Bombe an Bord schmuggeln – aber alles, was die Leute verstanden, war Leichenteile.
Sie konnten noch so aufgeklärt tun und einsehen, dass die Arbeit der Rechtsmediziner für Ermittlungen wichtig war, doch tief in ihrem Innern, da, wo der Verstand nicht alles kontrollierte, lauerte dieses Misstrauen gegen alle Menschen, die sich freiwillig in die Nähe von Leichen begaben. Das galt für Bestatter ebenso wie für Pathologen und Friedhofsmitarbeiter. In der Weltvorstellung der meisten stimmte etwas nicht mit einem, wenn man sich einen solchen Beruf aussuchte. Dieses Misstrauen konnten sie nie ganz ablegen.
»Inwieweit haben Sie den Fundort verändert?«
»Ich habe nur den Sack ausgegraben und mit einem Taschenmesser geöffnet. Das habe ich Ihren Kollegen vom Erkennungsdienst schon gesagt, als sie mir mit Onserts und Tupfern zu Leibe gerückt sind, um Proben zu nehmen.«
»Haben Sie jemanden bemerkt?«
»Nein. Ich denke, außer mir war in dem Moment niemand hier. Der Täter hatte den Ort schon verlassen, es sind ja auch keine Fußspuren zu sehen.«
»Außer Ihren.« Wieder ein scharfer Blick.
»Wahrscheinlich hat der Regen sie vernichtet.«
»Wahrscheinlich.« Während Jacobsen jede Antwort notierte, nickte er, als handle es sich um korrekte Lösungen in einem Quiz. »Das ist ein gefundenes Fressen für die Zeitungen«, murrte er. »Ich hoffe nur, dass die überregionale Presse nichts davon erfährt, sonst haben wir heute Abend RTL vor der Tür stehen, die wieder mal dokumentieren wollen, welche Schrecken hinter ostdeutschen Türen lauern.«
»Halten Sie das da etwa nicht für einen Schrecken?«
»Den Toten oder das Privatfernsehen?« Jacobsen klappte den Block zu. Einen Moment lang sah er sich unschlüssig um. Seine Kollegen vom Erkennungsdienst waren immer noch mit der Beweissicherung beschäftigt.
»Und was passiert jetzt?«
Der Kommissar winkte ab. »Sie kennen doch das Prozedere. Wenn Ihr Kollege mit der Leichenschau fertig ist, wird der Staatsanwalt festlegen, dass eine Obduktion angebracht ist und er die Sache so schnell wie möglich wieder vom Tisch haben will. Also geben wir die Leiche Ihrem Kollegen mit. Hier können wir gar nichts mehr machen, so wie der Tote aussieht. Was denken Sie, wie lange er schon da lag?«
»Schwer zu sagen ohne Obduktion. Der Todeszeitpunkt ist auf jeden Fall schon ein paar Wochen her.«
»Und warum hier?«
»Woher soll ich das wissen?«
»Sie sind doch Experte.«
»Entomologe, kein Psychologe.«
»Trotzdem eine Idee?« Jacobsen ließ den Block sinken und sah ihn direkt an.
»Vielleicht war es ein Spaziergänger, dem hier aufgelauert wurde? Ein Streit beim Familienausflug?« Hansen zuckte mit den Schultern. »Oder jemand wollte die Leiche an einem abgelegenen Ort entsorgen und hat zufällig den Wald ausgesucht?«
»Zufällig?«, wiederholte Jacobsen mit einem seltsamen Ausdruck im Gesicht. »Ist das nicht ein bisschen dünn für einen Wissenschaftler, Herr Doktor?«
Hansen biss die Zähne zusammen. Es irritierte ihn, dass Jacobsen fast wie der Kerl von der Bundespolizei reagierte. Als würden sie ihm beide den Doktortitel vor seinem Namen irgendwie übel nehmen. Dabei hatten sie einen ähnlichen Weg hinter sich. Jacobsen stammte genau wie Hansen aus einem Umfeld, das man früher mal Arbeitermilieu genannt hatte. Auch er war die soziale Leiter hochgeklettert. Doch das Misstrauen ihrer Väter gegen alles Studierte hatte sich Jacobsen anscheinend bewahrt.
»Ist doch komisch, dass Sie erst Insekten auf Leichen untersuchen und dann plötzlich Bienen züchten«, sagte er. »Ich meine, wo Sie sich doch auf die Leichenfliegen spezialisiert haben. Und jetzt Leichenbienen. Ich versteh das nicht.« Bedächtig schüttelte er den Kopf. »Ihr Experiment können Sie jedenfalls vergessen, unser Kollege von der Bpol ist gerade dabei, die Teile wieder auszubuddeln. Wir sichern sie als Beweisstücke.«