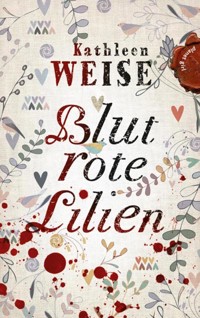13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Als der Orbiter Eurybia auf dem Jupitermond Kallisto abstürzt und die Mitglieder der Mondstation an einem unerklärlichen Fieber erkranken, steht die vierte bemannte Jupitermission kurz vor dem Scheitern. Auf der Erde wird eine Bergungsmission zusammengestellt, die herausfinden soll, was auf Kallisto geschehen ist. Doch niemand ahnt, was der eisige Mond tatsächlich verbirgt und was die drei toten Geschäftsleute auf der Erde damit zu tun haben …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 519
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Das Buch
Wir schreiben das Jahr 2104, und der lange gehegte Menschheitstraum vom Aufbruch zu den Sternen ist längst Realität geworden: Spaceports sind die neuen Flughäfen, Asteroid Mining ein international boomender Wirtschaftszweig und Astronauten die Rockstars des neuen Jahrhunderts. So auch die Crew der Raumstation Chione auf dem Jupitermond Kallisto. Doch Astronauten leben gefährlich, der dunkle Schoß des Alls verzeiht keine Fehler. Eines Tages kommt es zur Katastrophe: Vor den Augen der Chione-Crew stürzt ihr Orbiter Eurybia ab, ein Besatzungsmitglied stirbt, die Überlebenden sitzen auf Kallisto fest – ohne Möglichkeit zur Erde zurückzukehren. Die Situation spitzt sich weiter zu, als einer nach dem anderen von einem unerklärlichen Fieber und Halluzinationen geplagt wird. Die Kallisto-Mission droht zu scheitern. Währenddessen wird auf der Erde eine Bergungsmannschaft zusammengestellt, die herausfinden soll, was auf dem Jupitermond passiert ist. Niemand ahnt, dass sich in Kallistos ewigem Eis ein uraltes Geheimnis verbirgt. Und was dieses Geheimnis mit dem mysteriösen Tod dreier Geschäftsleute auf der Erde zu tun hat …
Die Autorin
Kathleen Weise, geboren 1978 in Leipzig, absolvierte ein Studium am Deutschen Literaturinstitut Leipzig mit den Schwerpunkten Prosa und Dramatik/Neue Medien. Sie lebt und arbeitet als freie Autorin und Lektorin in Leipzig und war außerdem viele Jahre ehrenamtlich für das Literaturbüro Leipzig e.V. tätig, wo sie Textwerkstätten, Schullesungen und Workshops organisierte und durchführte. Ihre Veröffentlichungen umfassen Romane für Jugendliche und Erwachsene.
KATHLEEN WEISE
ROMAN
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Abkürzungsverzeichnis, Figurenregister und Glossar finden sich im Anschluss des Romans.
Originalausgabe 03/2021
Redaktion: Catherine Beck
Copyright © 2021 Kathleen Weise
Copyright © 2021 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Das Illustrat GbR, München
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-25861-0V001www.diezukunft.de
Für meine Eltern, die Generation davor – und meine Tochter,die Generation danach.
1
im Jahr 2104, Jupitermond Kallisto, Chione-Station
Obwohl er es besser weiß, hofft Sam auf ein Wunder.
Genau wie damals, als Ida nach dem Unfall mit dem Highbus ins Koma gefallen ist. Oder als sie beim Stevinus-Aufstand auf dem Erdmond den Weltraumhafen gegen Saboteure verteidigt haben und Colin neben ihm getroffen zu Boden ging. Sam glaubt nicht an Wunder. Aber jetzt hofft er auf eins.
»Wir müssen etwas tun!«, schreit er, aber niemand bewegt sich.
Dicht gedrängt steht die Crew im mittleren der tief ins Eis eingelassenen Kokons aus Basaltfaser, dem Zentrum dieser merkwürdigen Stationsblume, die sie alle nur spöttisch das Gänseblümchen nennen.
»Was hat Mercer vor?«, fragt Laure. Vorgebeugt starrt sie auf die CommWall und versucht zu begreifen, was sie auf den Monitoren sieht. Ihre Stirn glänzt feucht von Furcht und Fieber, und immer wieder ruft sie Mercers Namen.
Doch der Pilot im Orbiter Hunderte Kilometer über ihnen reagiert nicht.
Sam blickt hinauf zum Deckenlicht des Moduls, durch das spärlich Licht fällt, aber dort ist nichts zu erkennen. Die Eurybia und Mercer befinden sich beinahe auf der anderen Hemisphäre des Jupitermonds. Nur die ohrenbetäubenden Warnsignale, die durch das Schiff schallen, sind über die Funkverbindung zu hören.
»Dieser Idiot«, flüstert Sam. Auf den Monitoren beobachtet er, wie Mercer zitternd in der Eurybia sitzt und von Dingen redet, die sie hier unten auf Kallisto weder sehen noch verstehen können. Dabei läuft dem Piloten der Schweiß übers Gesicht, und seine Augen sind rosa unterlaufen wie bei einem fiebernden Kleinkind.
»Er halluziniert«, sagt Bea. Auch sie wirkt blass und verschwitzt.
»Wir könnten den Lander startklar machen und versuchen, ihn zu erreichen«, schlägt Sam vor, aber Adrian schüttelt den Kopf.
»Niemand kann an ein Schiff andocken, dessen Flugroute er nicht berechnen kann«, sagt er, seine sonst ruhige Commander-Stimme zittert. Das Fieber steigt bei ihm stündlich.
»Was ist mit der Überbrückung von hier aus?«
Joãos Finger fliegen erfolglos über die Displays der CommWall. Sein T-Shirt ist im Rücken dunkel vom Schweiß, und nervös tritt er mit dem Ballen gegen den Hocker, auf dem er sitzt. »Mercer hat eine Blockade eingebaut«, sagt er, »die ich so schnell nicht auflösen kann, er fliegt das Schiff manuell. Das ganze System läuft auf Sparflamme, wir haben Glück, dass die Bordkamera überhaupt noch etwas zu uns überträgt.«
Laure legt ihm die Hand auf die Schulter, und sofort hört er auf, den Fuß zu bewegen. Einer nach dem anderen versuchen sie, über Funk auf Mercer einzureden, aber er scheint sie gar nicht zu hören.
Als Letzter versucht es Sam. »Mercer!«, schreit er. »Du musst den Kurs ändern! Du wirst aufschlagen.«
Keine Reaktion.
Während die Eurybia immer schneller auf Kallistos Oberfläche zurast, brüllt sich Sam heiser, bis ihm schwindlig wird und Laure sein Handgelenk packt. »Brems ab!«, ruft er weiter. Wieder und wieder, bis ihm die Stimme bricht. Laures Griff wird schmerzhaft, aber er sagt nichts dazu.
Am Ende müssen sie zusehen, wie Mercer unbeweglich auf die Frontscheibe der Eurybia starrt, hinter der Kallisto immer näher kommt. Diese schmutzige Eiskugel ist alles, was Mercer noch vor sich sieht. Dann gibt es einen Lichtblitz auf den Monitoren der Station, der sie alle nach hinten zucken lässt, und das Bild erlischt. Der Ton hält sich einen Augenblick länger.
Siebenundvierzig Sekunden nach Kontaktabbruch hört die Eurybia auf, Signale von der anderen Seite des Jupitermonds zu senden. Die letzte Anzeige geht auf Null – doch noch immer bewegt sich niemand. Mit hochgezogenen Schultern sind sie vor den Monitoren erstarrt, und Sam schnappt nach Luft, weil ihm das Atmen so schwer fällt wie nach einem Marsch über unebenes Gelände.
Die Eurybia war ihr wachsames Auge im Orbit über ihnen. Ihr Absturz lähmt sie, aber solange sich niemand bewegt und keiner spricht, steht auch die Zeit still. So lange ist Mercer noch am Leben und die Eurybia nicht zerstört.
Erst dann sitzen sie auf Kallisto fest, und Sam muss einsehen, dass das Wunder, auf das er gehofft hat, nicht geschehen ist.
2
Erde, Französisch-Guyana, l’Île du Lion Rouge
Uche liebt das Meer.
Rot-grüne Wellen, die über schroffe Ufersteine streichen. Beinahe zart. Wie die Finger einer Frau über das Gesicht eines Geliebten, kurz bevor sie sich abwendet.
Früher ist er oft im Meer geschwommen. Doch seit er die Prothesen hat, läuft er nicht mehr gern über den Sand. Er versinkt im angespülten Schlamm aus dem Dschungel, und hinterher ist es die reinste Tortur, die Prothesen wieder sauber zu kriegen.
Aber es gibt viele Dinge, die er nicht mehr so macht wie früher. Die Zehen übers Laken reiben, wenn er morgens aufwacht. Mit dem Fuß zur Musik wippen, die Fersen ans kalte Porzellan der Toilettenschüssel pressen, während er sitzt.
Er fliegt auch nicht mehr ins All.
Seit dem Bergschaden auf dem Mars ist seine Karriere im Asteroid Mining vorbei. Stattdessen verbringt er seine Tage jetzt damit zuzusehen, wie drüben vom Festland aus die Raketen im GSC starten und sich Treibstoffwolken wie Zuckerwatte aufblähen.
Viele seiner alten Kumpel sind noch dabei. Sie können sich das vorzeitige Abkehren nicht leisten, weil ihre Verträge zu schlecht sind. Wer hat schon einen Anwalt dabei, wenn er sich verpflichtet? Niemand, so ist das. Hin und wieder trifft er einen von ihnen, dann hört er sich an, wie sie über die Zustände und Umstände und Missstände klagen. Er spendiert ihnen Drinks, und gemeinsam stoßen sie auf die große Dunkelheit an, in der sie herumfliegen und die so viele von ihnen nur den Schoß nennen.
Manchmal beneidet er sie darum, dass sie noch dabei sind. Dann würde er alles dafür tun, ein weiteres Mal durch die Schwerelosigkeit zu fliegen, die Beine leicht wie Papier. Aber Uche weiß nicht recht, ob er wirklich das Fliegen vermisst oder nur sentimental ist.
Gesagt hat er das keinem, Kumpel reden nicht über Sehnsüchte, jeder vermisst irgendwas da draußen im Schoß. Geständnisse sind was fürs Bett und für den Priester. Da sind sie wie Seeleute, ein bisschen abergläubisch eben. Als könnte sich das Universum einen Spaß daraus machen, einem die Dinge wegzunehmen, an denen man hängt, wenn es nur davon hört.
Das ist natürlich Unsinn, er weiß das, aber der lange Aufenthalt im Schoß macht sie alle ein bisschen verrückt. Das ist normal. Vielleicht muss man aber auch schon ein bisschen verrückt sein, um überhaupt Spaceworker zu werden. Das wäre auch möglich.
Über solche und ähnliche Sachen denkt er nach, wenn er aufs Meer schaut und eine Mango isst.
Uche trinkt. Rum. Der ist hier gut und billig. Im Licht der Nachmittagssonne leuchtet er golden wie der Bach, an dem Uche als Kind gespielt hat. Die Dächer der Gebäude vor ihm heben sich weiß gegen einen betonfarbenen Himmel ab, und in der Ferne kann er die Pumpen hören, die dafür sorgen, dass die aufgeschüttete Insel nicht an den Rändern zerfällt. Rund um die Uhr erfüllt ihr stetiges Brummen die Luft und erinnert die Bewohner der Île du Lion Rouge daran, dass das Fundament ihrer Stadt nichts anderes ist als ein riesiger Haufen Sand mitten im Meer. Geschaffen von dem Unternehmen, für das die meisten von ihnen geflogen sind.
Seit einer halben Stunde sitzt Uche schon bei Ricki unter dem Holzdach mit der grünen Markise, vor sich ein Glas Demerara-Rum, das zweite an diesem Tag, und fährt sich hin und wieder über den frisch geschorenen Schädel, als müsste er sichergehen, dass die Haare nicht schon wieder nachgewachsen sind. Sein Zeitgefühl kommt manchmal durcheinander. Dann hält er Minuten für Stunden und Tage für Jahre. Auch das ist normal.
Nachdem er zurückgekommen ist, hat er versucht, die Locken wieder wachsen zu lassen, um sich anzupassen, um weniger so auszusehen wie von der Insel. Aber er hat einfach keine Geduld mehr dafür. Als hätten sie ihm mit den Beinen auch die Eitelkeit abgeschnitten.
Er lacht.
Es ist ja nicht so, als würden ihn die Leute gleich wieder vergessen. Sie erinnern sich an ihn, diesen großen Schwarzen mit den Händen wie Bärenpranken und dem immer etwas wackligen Gang und den viel zu weiten Schritten. Der so oft auf seine Beine schielt, als müsste er sich vergewissern, dass sie noch da sind, und wenn ja, wo. Als könnte er sie aus Versehen zu Hause liegen lassen, wenn er nicht aufpasst.
Blinzelnd sieht er nach unten. Wie Insektenbeine wirken die dunklen Prothesen gegen die Terrakottafliesen des Fußbodens, und beinahe erwartet er, mehrere von ihnen zu sehen. Sechs, oder auch acht wie bei den Spinnen, die sein Bad bevölkern.
Achille hat ihm versichert, dass diese Beine Qualitätsware seien. Er habe schon schlechtere bei anderen Spaceworkern gesehen, sagt er. Aber Uche weiß nicht, wie viel er dem Alten glauben soll, der zweimal im Jahr Urlaub in Cannes macht und alle drei Kinder auf Eliteschulen schickt. Sein Vertrauen zu Orthopädietechnikern ist nicht das größte.
Uche greift nach dem Glas. Träge genießt er die Brise aus dem Osten, die ihm über den Schädel fährt und die Stirn kühlt. Der schwarz glänzende Tausendfüßler an der Wand neben ihm wendet den Kopf und sieht Uche ausdruckslos an, während er das Hinterteil aufrichtet und draußen ein Lastwagen hupt.
Eine Larve des Bösen, denkt Uche und hebt schon die Hand, um sich zu bekreuzigen. Aber dann lässt er sie wieder sinken, weil er sich albern vorkommt, den Schrecken seiner Kindheit in die Falle zu tappen.
Das mochte er am All, no spider on the moon.
Aus den Lautsprechern dringt brasilianischer Megapop, und aus der Küche weht der Geruch von Bratfett herüber. Wer viel trinkt, wird irgendwann hungrig, und jede Kneipe, die etwas auf sich hält, bietet Pholourie an.
Träge beobachtet Uche die Leute und wie sie auf ihren Carbords und iBikes die weißen Straßen der Insel hinauf- und hinunterfahren und scharfe Schatten auf den getünchten Asphalt werfen, der das Sonnenlicht reflektiert und die Stadt vorm Hitzeschlag bewahren soll. Wer hier keine Sonnenbrille trägt, findet sich schnell mit verbrannter Netzhaut beim Arzt wieder.
Niemand scheint es eilig zu haben.
Vielleicht liegt es daran, dass sie auf dieser Insel alle Rentner vor ihrer Zeit sind. Vielleicht auch daran, dass ihnen die Gravitation zu schaffen macht. Uche versteht das, manchmal wacht er morgens auf, und die Knochen kommen ihm so unendlich schwer vor, dass er einfach liegen bleiben muss. Dann braucht er ein paar Sekunden, um sich daran zu erinnern, dass er wirklich auf der Erde ist. Erst wenn er den Arm ausstreckt und nicht gegen die Kabinenwand stößt, öffnet er die Augen und blinzelt ins Morgenlicht, das durch die getönten Scheiben fällt.
»Was starrst du schon wieder vor dich hin?«, fragt Ricki in diesem Moment, während er sich zu Uche an den Tisch setzt. Laut schabt der Stuhl über die Fliesen, und der Gliederfüßler fällt von der Wand.
Es ist noch ruhig in der Kneipe, der Nachmittag hat bereits begonnen, doch Ricki wirkt noch immer unausgeschlafen und zerknautscht. Sein São-Paulo-Dialekt kommt durch, und die rechte Gesichtshälfte ist rot vom ständigen Kratzen. Er ist auf irgendetwas allergisch, aber keiner weiß wirklich, worauf.
Uche vermutet, es liegt am Chalk, dem Ricki so zugetan ist, wenn er Feierabend hat. Es hilft ihm beim Einschlafen, behauptet er, und wenn er nicht die Statur eines Ochsen hätte, hätte sich das Zeug längst durch seine Organe gefressen. Aber der schlechte Lebenswandel bekommt dem Wirt besser als seinen Gästen das Pholourie.
Uche kann Ricki gut leiden. Der Wirt ist selbst ein paarmal zum Mond geflogen, bevor er sich von Space Rocks die Lizenz besorgt hat, auf der Insel eine Kneipe zu eröffnen. Er versteht die Spaceworker, die so eifrig seinen Rum und alles andere trinken, und das unterscheidet ihn von anderen Geschäftsleuten, die die Infrastruktur der Insel aufrechterhalten und von überall herkommen. Sein Laden ist nicht der tollste, aber darum geht es Leuten wie Uche nicht. Sie sind einfach gern unter sich; dort, wo sie nicht angestarrt werden. Die Displays an den Wänden zeigen Weltraummotive, ein bisschen kitschig, gerade genug, um der sentimentalen Stimmung gerecht zu werden, die sie zuweilen überkommt, wenn sie zu lange auf der Erde sind.
Neugierig hebt Ricki den großen Kopf und beobachtet zwei Männer, die zur Tür hereinkommen und sich umschauen. Uche hat sie noch nie gesehen. Neuankömmlinge auf der Insel, das merkt man sofort. Wahrscheinlich Franzosen, aus Metropole oder einer anderen Megacity. Sie setzen sich an einen Tisch an der Wand und laden die Getränkekarte. Dabei sehen sie sich immer wieder um und sprechen hektisch miteinander, als würde der Laden gleich schließen. Willkommen in der Provinz!
Die haben sich ihren Ruhestand auch anders vorgestellt, denkt Uche und grinst Ricki an. Alle träumen sie immer vom Alterssitz auf der tropischen Insel, und wenn sie dann da sind, verziehen sie mürrisch das Gesicht, weil das Paradies nicht klimatisiert ist.
»Stadthunde«, flüstert der Wirt, während er sich zu Uche hinüberbeugt und die Ellbogen auf dem Tisch abstützt, bis der quietscht. Es klingt nicht unfreundlich. Nur nach ein bisschen gutmütigem Spott.
Uche weiß, was er meint. Stadthunde wirken immer irgendwie nervös. Ihr Blick ist unstet, die Schultern sind hochgezogen, jederzeit bereit für einen Angriff, der nicht kommt. Zumindest nicht hier, zu dieser Uhrzeit. Viel zu heiß zum Kämpfen. Die Menschen der Insel sind nachtaktive Tiere. Als wäre ihnen die Dunkelheit des Schoßes unter die Haut gekrochen.
Vielleicht kommt die Unruhe der Stadthunde davon, dass sie den blauen Himmel nicht gewöhnt sind. In ihren Megacitys sehen sie ihn vor lauter hohen Gebäuden gar nicht mehr. Alles ist eng, die Straßen, der Blick und unweigerlich auch das Herz. Dann fliegen sie jahrelang in Blechdosen durchs All und arbeiten auf den Asteroiden untertage, da sind sie die Weite einfach nicht gewöhnt, denkt sich Uche. Jahrhundertelang eingepfercht in Asphalt und Lärm, das muss sich doch im Blut niederschlagen.
Er reibt sich übers Kinn.
Uche mag die Megacitys nicht besonders. Damals in Toulouse hat ihn der Lärm fast verrückt gemacht. Er war froh, als ihn seine Maman und Christopher nach Luxemburg auf die Space Academy geschickt haben. War ihm völlig egal, was er dort gelernt hat, einfach raus, das war das Ziel. Und vier Jahre später war er froh, als Space Rocks ihn verpflichtet hat und er zurück nach Kourou konnte, zurück in das Land, aus dem er kam.
So ist das bei ihm, er ist nicht gern allzu lange an einem Ort.
Trotzdem stellt er sich vor, dass es irgendwo da draußen einen Platz für ihn gibt, an dem er sesshaft werden kann. Eine Art Heimat findet. Nicht Macouria, wo er geboren wurde. Nicht Toulouse, wo er mit zwölf hingekommen ist. Und sicher nicht diese Insel hier, auf die Space Rocks ihn abgeschoben hat. Er will ja nicht viel, nur einfach mal zur Ruhe kommen. Im Kopf, vielleicht. Und auch im Herzen. Das ist doch nicht zu viel verlangt, findet er.
Uche sieht auf. Auf der anderen Straßenseite leuchtet ein riesiges V-Display über dem Supermarkt. Abwechselnd schweben Burger, Waschmittel und Fertiggerichte in der Luft und erinnern daran, dass es zu Hause noch Dinge zu tun gibt. Wäsche waschen, Abendessen kochen. Uche fand schon immer, dass Werbung etwas sehr Tröstliches hat.
»Ich dachte, in diesem Sommer verschwindest du endlich«, sagt Ricki und nickt seiner Kellnerin Maria zu, die sich um die Franzosen kümmern soll.
»Ich hab da noch diese Sache zu erledigen …« Uche zuckt mit den Schultern.
»Das sagst du jedes Mal.«
»Weihnachten verbringe ich an einem schönen Ort.«
»Ist doch schön hier, weiß gar nicht, was du hast.« Der Wirt winkt ab. »Alles da. Meer, Sonne, Frauen. Hier kannst du leben wie Gott in Frankreich.« Er lacht über seinen eigenen Witz.
Eigenständigkeit ist für das Land ein steter Kompromiss, erst kamen die Franzosen, dann die Goldwäscher und nun die Unternehmer aus Luxemburg. Seit Französisch-Guyana vor vierzig Jahren unabhängig geworden ist, besteht zwischen den Ländern ein angespanntes Handelsbündnis, in dem alle Beteiligten versuchen, die Vergangenheit bestmöglich zu ignorieren. Wie ehemalige Geliebte, die sich im Interesse der Kinder und Hunde zusammenraufen. Wenn Uche die Politiker darüber reden hört, kommt ihm das manchmal vor, als versuche man, ein neues Paar Schuhe zu putzen, nachdem man es das erste Mal auf der Straße getragen hat. Das wird auch nie wieder ganz sauber.
Uche spart sich die Antwort auf Rickis Bemerkung und trinkt stattdessen. Sie wissen beide, dass die Île du Lion Rouge nicht das Paradies ist, das ihnen von Space Rocks versprochen wurde. Dafür ist es hier zu heiß, zu feucht, und die Prämien aus den Verträgen decken kaum die medizinische Betreuung, die eine Spaceworkerrente so mit sich bringt. Ständig laufen sie Gefahr, dass ihnen etwas auf den Kopf fällt, sollte eine Rakete nach dem Start explodieren. Offiziell liegt die Insel nicht im Startkorridor, aber was wissen Bruchstücke schon von Berechnungen?
In zynischen Momenten kommt es Uche vor, als wäre die ganze Insel nichts anderes als eine große Lagerhalle für ausrangierte Verschleißteile. Zum Glück ist er nicht immer zynisch. Nie an Sonntagen, die sind ihm heilig.
Meistens will er einfach nur weg. Nach Norwegen vielleicht. Dort will er in den Fjorden Meersalz gewinnen. Seinen eigenen kleinen Laden aufmachen. Nichts Verrücktes. Fisch und Salz, das war schon immer eine beinahe mystische Verbindung. Dann kann er die Sache mit seiner Hüfte angehen, eventuell die Schmerzmittel reduzieren und endlich seine Verdauung und die Schlafstörungen in den Griff kriegen. Das ist wirklich nicht zu viel verlangt, findet er. Nach allem.
Darauf spart er. Dafür geht er seinen Geschäften nach. Genau wie so viele andere auf der Insel. Und er steht kurz davor, seinen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Ein Kunde noch, ein Verkauf, dann hat er es geschafft.
Er meint, was er sagt. Weihnachten wird er nicht mehr hier sein.
»Du musst mehr unter die Leute, Junge.« Ricki schüttelt den Kopf, als wäre er alt und weise und nicht nur zwei Jahre älter als Uche. »Warum kommst du nicht mal zu unseren Dame-Abenden?«
Es ist nicht das erste Mal, dass er Uche einlädt, und es wird auch nicht das letzte Mal sein. Vermutlich wäre er ein bisschen erschüttert, wenn Uche tatsächlich eines Tages vorbeikommen würde.
Aber Uche will nicht gemeinsam mit anderen in Erinnerungen schwelgen, sie erinnern sich ohnehin nie an dasselbe. Und wenn er über sein Limit trinkt, hat er am nächsten Tag manchmal Schwierigkeiten mit dem Interface der Prothesen, weil Alkohol auf die Nerven schlägt. Er ist kein netter Betrunkener, und Ricki mag es nicht, wenn man sich in seiner Kneipe prügelt. Außerdem hat Uche manchmal das Gefühl, dass die Kumpel sich in seiner Gegenwart unwohl fühlen. Nicht wegen der Prothesen, keiner von ihnen ist ganz heil, sondern weil er so viel Glück hatte. Einen Unfall wie seinen überlebt da draußen eigentlich niemand. Das ist wie ein Lottogewinn. Da fragt man sich natürlich unweigerlich, wenn man so eine Geschichte hört, ob einem das Glück genauso hold wäre. Und niemand hat gern den Verdacht, dass einem das Pech viel treuer ist.
Die Tür zur Bar öffnet sich ein weiteres Mal, und plötzlich ändert sich die Atmosphäre. Für einen Moment verstummen die Gespräche, werden Gläser nicht abgestellt. Der Tausendfüßler auf dem Boden hört auf, sich zu winden.
Uche sieht auf.
Almira steht in der Nähe des Eingangs und schaut sich nach einem Platz um. Als sie Uche erkennt, nickt sie und durchquert den Raum. Blicke folgen ihr, und auch Uche kann nicht wegsehen, während sie auf ihn zukommt.
Es liegt nicht daran, wie sie aussieht. Es ist nichts Auffälliges an ihr. Wie die meisten Spaceworker, deren Familien schon in der dritten Generation ins All fliegen, ist sie nicht besonders groß, aber kräftig. Mit schwerem Knochenbau, wie seine Maman immer gesagt hat, und dunklem Haar, das von einem Spinnwebennetz aus Grau bedeckt ist. Die Haut strahlengegerbt, ein breiter Mund und Augen so dunkel wie Schwarzerde.
Almira gehört zu den alten Hasen im Geschäft, und viele von Rickis Kunden kennen sie. Obwohl sie noch gar nicht in Rente ist, wohnt sie schon auf der Insel. Zweimal hat sie bereits einen Bonus erhalten, weil sie bei der Grubenwehr war. Solche Kumpel wie sie gibt es nicht zu Hunderten, und wer mit ihr arbeitet, kann sich glücklich schätzen.
Doch das sind alles nicht die Gründe, warum sie heute diese Reaktion hervorruft. Es sind das schlichte schwarze Band über dem hochgekrempelten blauen Hemdsärmel und die Anstecknadel am Revers. Schwarzer Schlägel und Eisen auf goldener Sonne. Das Zeichen ihrer Zunft. Sie tragen es zu vielen Anlässen, in Kombination mit dem schwarzen Band jedoch nur zu einem.
Uche bestellt ihr Rum, bevor sie den Tisch erreicht.
Er sagt nichts, schiebt nur mit dem Fuß einen Stuhl in ihre Richtung.
Ricki rückt ein wenig ab, um ihr Platz zu schaffen. »Armer Teufel«, flüstert er und nickt, während sich Almira setzt; schwerfällig, als wäre sie hundert Jahre alt.
»Enricos Jüngster, Olivier«, sagt sie. »Ein Bohrer hat sich aus der Verankerung gelöst. Er wollte das Ding stabilisieren, bevor es durch den Rückstoß ganz davontreibt, aber es hat ihn bloß mitgezogen. Die Sicherungsleinen sind gerissen.« Sie nickt Maria zu, die den Rum vor ihr abstellt und ihr dabei kurz die Schulter drückt.
Ricki gibt Anweisungen, eine Flasche zu bringen. Aufs Haus.
»Eine verdammte Schande. Ich kenne den Jungen, seit er vierzehn ist.« Sie schüttelt den Kopf, und Uche würde gern etwas sagen, um ihr die Sache zu erleichtern, aber was gibt es da schon zu sagen?
»Wie war die Gedenkfeier?«, fragt er stattdessen.
»Gut.« Sie nickt. »Sie haben ihn geliebt. Ich meine, darum geht es doch irgendwie, dass dich jemand vermisst, oder?«
Sie redet von Familie, aber das ist ein Thema, das ihm Unbehagen bereitet. Er hat keine Kinder, und er war ein schlechter Sohn. In beiden Familien, in denen er aufgewachsen ist. Auf seiner Beerdigung werden ein paar Kumpel trauern, vielleicht die eine oder andere Frau, mit der er das Bett geteilt hat, wahrscheinlich Jada. Aber sonst? Seine Maman. Wenn sie rechtzeitig davon erfährt.
»Mann, ich hasse diese Sachen.« Almira zieht am Kragen ihres Hemds, als wäre es ein Hundehalsband. Dann senkt sie den Kopf. »Ich hab den Jungen ausgenüchtert, als er seinen ersten schlimmen Pillenkater hatte, und dann treibt er einfach so davon …«
Eine irrationale Angst greift nach Uche.
Die Treibenden sind wie ein Kinderschreck. Dass sie da draußen sterben können, wissen sie alle. Die Gefahren sind vielzählig, aber die meisten von ihnen verrecken an den Spätfolgen. Hier auf der Erde. Das Davontreiben jedoch ist das, wovor sie sich alle fürchten. Es kommt in ihren Albträumen vor und den Gesprächen mit so manchem Firmenpsychologen. Meistens passiert es auf den kleineren Asteroiden, für die sich die Unternehmen weder Sicherheitsnetze noch Rettungskapseln leisten. Es ist einer der häufigsten Unfälle bei ihrer Arbeit und etwas, an das sie sich nie gewöhnen werden. Wenn einer bei vollem Bewusstsein weggeschleudert wird. Keine Chance auf Rettung. Bei Funkkontakt bis zum Ende.
Almira hebt das Glas, und sie stoßen an. Leeren die Gläser in einem Zug, und Ricki schenkt nach bis zum Rand.
Anschließend wischt sich Almira übers Gesicht und lacht verschämt, während sie sich auf der Tischplatte abstützt, als würde ein PLSS-Rucksack sie niederdrücken. »Soll ich euch ein Geheimnis verraten? Ich hab es nie gemocht, wenn meine Laure zu einem Flug aufbricht. Ich kann mich einfach nicht an das Gefühl gewöhnen, so lange von ihr getrennt zu sein.«
»Du fliegst doch selbst«, erwidert Ricki.
»Trotzdem.«
»Deine Tochter ist ziemlich gut. Der passiert da draußen nichts«, sagt Uche.
Almira nickt und leert das zweite Glas. Manchmal spielt es eben keine Rolle, ob jemand gut ist oder nicht, dumme Sachen passieren. Aber das will keine Mutter hören, wenn sie gerade den Sohn eines anderen begraben hat und die eigene Tochter im äußeren Bereich unterwegs ist.
Sie wussten immer alle, dass es das Mädchen mal zu etwas bringen würde, stur wie ihre Mutter, aber doppelt so ehrgeizig. Deshalb gehört Laure auch der vierten Kallisto-Mission an. Als Spaceworkerin hat sie mit dem Jupitermond das große Los gezogen. Vier Jahre ist sie unterwegs, danach kann sie sich ihre Missionen aussuchen und muss sich um ihre Rente keine Sorgen mehr machen. Nur ums Altwerden vielleicht.
Wem es gelingt, dauerhaft eine Station auf Kallisto zu etablieren, der kontrolliert die Wasservorräte aller zukünftigen Missionen zu den äußeren Planeten und somit die Verkehrswege in den äußeren Rand des Sonnensystems. Die Händler von heute ähneln den Händlern von gestern. Das Asteroid Mining hat vielen Ländern einen Aufschwung verschafft, denen es ohnehin schon gut ging, aber auch für gesellschaftlichen Kurswechsel in Schwellenländern gesorgt. Und alle wollen sie ein Stück vom Kuchen.
Deswegen ist Laure mit ihrer Crew jetzt dort draußen; vordergründig, um weiter nach Leben auf dem Mond Europa zu suchen, eigentlich aber, um Space Rocks Station auszubauen.
»Es sind gute Leute dabei.« Bekräftigend nickt Almira. »Für Laure ist es ein Karrieresprung, stimmt’s? Ihr wisst ja, wie sie mit den Kallisto-Missionen sind.« Sie holt tief Luft. »Ich glaube, ich werde einfach langsam zu alt für diesen Mist.«
»Du willst aufhören?« Uche ist so erstaunt, dass er die Beine anzieht und mit den Prothesen gegen Almiras Füße stößt. Er hat immer gedacht, sie ist der Typ, der auf einem Frachter stirbt. An Altersschwäche. Ihre Eltern sind schon Spaceworker gewesen, ihre Tochter ist Spaceworkerin, es steckt ihnen buchstäblich in den Genen.
»Ich will Zeit mit Laure verbringen. Kaum ist sie von einer Mission zurück, bin ich selbst unterwegs.«
»So ist das, wenn Kinder erwachsen werden. Was glaubst du, wie oft ich meine zu sehen kriege.« Ricki winkt ab. »Zweimal im Jahr, höchstens. Und die wohnen auf demselben Kontinent. Glaub mir, das ist normal.«
Zweifelnd blickt sie an ihm vorbei. Dann hebt sie die Hände und seufzt. »Außerdem spüre ich es langsam in den Knochen.«
»Dir fehlt unser schönes Fleckchen Erde, gib es nur zu«, versucht Ricki, die Stimmung zu heben, und sie quittiert es mit einem müden Lächeln, das ihr die Falten ins Gesicht treibt.
Die Falten eines Spaceworkers sind wie Baumringe, an ihnen kann man die Jahre ablesen, die einer im Schoß verbracht hat.
»Und dann?«, will Uche wissen.
»Als ich jung war, hab ich für die Verwaltung gearbeitet, vielleicht mache ich das wieder. Wenn ich nach der nächsten Mondmission aufhöre, verliere ich die letzten beiden Stufen meiner Pensionierung, aber für einen Umzug reicht’s allemal.«
Er kann sie sich nicht in einem Büro vorstellen. Vor einem strahlenden Himmel ohne Spaceworkerkluft. Noch zwanzig Jahre langweilige Tätigkeiten vor sich.
Aber er hält den Mund, so nah haben sie sich nie gestanden. Zweimal ist er mit ihr geflogen, einmal waren sie beide auf dem Mars stationiert. Sie respektieren sich. Doch für nicht erbetene Ratschläge reicht es nicht. Schon gar nicht an einem Tag wie diesem. Almira war jung, als sie das Mädchen gekriegt hat, mit sechzehn selbst noch ein halbes Kind, und dann hat sie Laure acht Jahre lang allein großgezogen, bevor sie zu ihrem ersten Raumflug aufgebrochen ist und das Mädchen für die Zeit ihrer Abwesenheit in eins der Betreuungsheime für Spaceworkerkinder gegeben hat. Vielleicht glaubt sie, es Laure schuldig zu sein. Was weiß er schon. Die Köpfe von Müttern sind seltsame Orte.
Uche stößt mit seinem Glas erneut gegen ihres. »Auf die Pensionierung.«
Sie trinken und schauen in den Himmel, der von hier unten so anders aussieht als aus dem Fenster eines Raumschiffs. Hell. Und fast freundlich.
Stumm hängen sie ihren Gedanken nach, bis das Display auf der anderen Seite der Straße zu den Nachrichten schaltet und ein Name darauf erscheint, der wie ein Schlag in den Magen ist.
Isabella Linkeln, CEO der Kurz-Mediengruppe, ist im Alter von zweiundfünfzig Jahren in Chicago verstorben. Organversagen. Der Kampf ums persönliche und berufliche Erbe hat bereits begonnen, das ist sogar eine Schlagzeile wert.
»Mhm«, macht Ricki und schnalzt mit der Zunge. »Irgendwie komisch, wenn solche Leute einfach so sterben. Man denkt doch immer, die können es sich leisten, hundertfünf zu werden.«
Uche sagt nichts dazu. Offiziell kennt er Isabella nicht. Leute wie er verkehren nicht mit Leuten wie ihr.
Dennoch.
Er weiß, dass sie mit tiefer Stimme gesprochen hat, ungewöhnlich für eine Frau. Als würde sie versuchen, mit der Stimme das Volumen zu generieren, das ihr an Statur fehlte. Sie war klein und schmal, eine Handvoll. Mit einem Rückgrat aus Titan. Wer es so weit an die Spitze schafft, erlaubt sich keine Schwächen. Er erinnert sich noch, wie er unter ihrem forschenden Blick die Arme verschränkt hat, obwohl er doppelt so breit war wie sie. Dabei ist er schon von Asteroid zu Asteroid gesprungen, mit nichts als einem Seil zwischen sich und der verschlingenden Unendlichkeit des Schoßes. Er ist kein Feigling, und es schaffen nicht mehr viele Leute, ihn zu beeindrucken, aber Isabella hat es getan.
Und nun ist sie tot.
Er steht auf, schiebt den Stuhl so heftig nach hinten, dass er beinahe umkippt, und irritiert sehen ihn die beiden anderen an. »Ich muss los«, sagt er.
»Du bist doch gerade erst gekommen.« Ricki zieht die Nase hoch. »Trink wenigstens noch deinen Rum.«
Uche kippt ihn hinunter wie Wasser und hustet einmal kräftig in die vom Schweiß feuchte Hand. Als er den ersten Schritt vom Tisch weg macht, greift Ricki nach seinem Arm.
»Weihnachten, eh?«, sagt er grinsend.
Uche nickt. Das war der Plan.
Aber Pläne ändern sich.
3
Jupitermond Kallisto, Chione-Station
Sam erinnert sich noch genau an das Gespräch mit seinen Eltern, in dessen Anschluss er sich im Büro der EASF in Leicester gemeldet hat. Daran, wie sein Vater ihn gefragt hat, ob er Ida nicht mit dem Zweisitzer von der Schule abholen wolle? Und wie er geantwortet hat, ja, so sei das angedacht. Aber dann war er zu beschäftigt damit, in Belgrave auf Gamerkämpfe zu wetten, um Ida rechtzeitig abzuholen. Es war ja nicht fest ausgemacht, also hat er ihr gesagt, sie solle den Highbus nehmen, weil er keine Zeit für sie habe. Es konnte doch niemand ahnen, dass der Bus mit einem abstürzenden Copter kollidiert.
Vierzehn Jahre ist das jetzt her, aber vergessen hat er nichts.
Genauso deutlich erinnert sich Sam jetzt an sein letztes Gespräch mit Mercer an Bord der Eurybia. Zwölf Stunden nach dem zweiten Landgang auf der von Jupiter abgewandten Hemisphäre von Europa, bei dem die Crew Bohrungen für ESA und NASA durchgeführt hat. Dafür musste der Landebahnausbau auf Kallisto für Space Rocks warten. Während sie auf die letzten Daten des IR-Spektrometers gewartet haben, saßen sich Mercer und Sam im winzigen Aufenthaltsbereich der Eurybia gegenüber, der auch als Küche diente, die Wände ein aufmunterndes Pink.
Mercer hat die Füße auf der Bank gehabt und gesagt: »Nein, Masturbieren erfordert keine Feinmotorik.« Es klang amüsiert und noch immer ein bisschen erschöpft vom Landgang, der aufgrund der Eisschollen und Double Ridges gefährlich, anstrengend und daher zeitlich stark begrenzt war.
»So wie du es anstellst, vielleicht nicht«, hat Sam ihn aufgezogen und sich darin ergangen, wie er der Zentrale vorschlagen wird, dem gängigen Feinmotoriktest der Spaceworker ein Update zu verpassen.
Gelacht haben sie über diesen Unsinn, der ihrer Erschöpfung geschuldet war, aber mittendrin ist Mercer plötzlich ernst geworden. »Manchmal frage ich mich, warum wir überhaupt hier draußen sind. Ich meine, wie viele Bohrlöcher wollen sie uns noch ins Eis brennen lassen? Uns wachsen Hörner von der Strahlung, bevor wir hier etwas finden.«
Es war nicht das erste Mal, dass er behauptet hat, es hätte sie stutzig machen sollen, dass nie jemand zweimal zu den Jupitermonden geflogen ist. Sie wussten, dass die Mission mit einem hohen Risiko verbunden ist, keiner von ihnen ist ein naiver Anfänger. Die Crew vor ihnen hat einen Mann verloren. Henderson ist während der dritten Mission bei einem Außeneinsatz auf Kallisto in eine Kraterspalte gefallen. Zu tief, um gerettet zu werden. Damals haben die Nachrichten zu Hause zynisch von einer »Bluttaufe« für den Jupitermond gesprochen.
Sam ahnte, dass Mercer an Henderson dachte, wenn er so düster vor sich hingebrütet hat.
Bevor er jedoch etwas erwidern konnte, kam Laure herein und hat ihnen mitgeteilt, dass die Crew in einer Stunde mit dem Lander zur Chione zurückkehren würde. Also hat Sam Mercer nur freundschaftlich gegen die Schulter geschlagen, um dann seine Sachen für den Abflug zu packen. Er war froh, die Eurybia verlassen zu können, denn nach zehn Tagen hatte er genug von der Einsamkeit des Orbiters und freute sich auf den menschlichen Kontakt in der Station am Boden. Selbst wenn João immer noch geglaubt hat, Spanien würde Weltmeister werden. Sams Schicht auf dem Orbiter als Wächter über die Chione war vorbei und Mercers begann, weil immer einer von ihnen an Bord der Eurybia bleiben musste.
»Wenn du wieder runterkommst, hilfst du mir mit dem Feinmotoriktest«, hat er beim Abschied zu Mercer vor der Schleuse gesagt, die zum Lander führte, und das waren seine letzten Worte an ihn. Ein alberner Scherz.
An Mercers Erwiderung kann er sich nicht mehr erinnern. Alles, was danach kam, war schon vom Fieber gezeichnet. Zu lange hat der Pilot ihnen verschwiegen, dass es ihm nach ihrer Abreise mit jedem Tag schlechter ging. Vielleicht hat Mercer geglaubt, die Medikamente würden es regeln; am Anfang haben sie ja auch noch gedacht, er sähe einfach so erschöpft aus, weil die Einsamkeit des Orbiters ihm zusetzt. Dunkle Augenringe haben sie alle, seit sie den Mars passiert haben.
Dabei fing es ganz harmlos an. Ein bisschen höhere Temperatur als die im All üblichen 38°C, ein Sausen im Ohr und Übelkeit. Sam ist der Einzige, der sich nicht angesteckt hat, deshalb haben sie zuerst vermutet, es läge an den eingelegten Pfirsichen, die sie nach ihrem Landgang auf Europa im Orbiter gegessen haben. Während er noch Daten an die Zentrale übermittelt hat, haben die anderen schon mit dem Essen begonnen. Als er dazukam, waren die Pfirsiche alle.
Nachdem Mercer das Fieber nicht mehr verleugnen konnte, hat Bea ihm genau gesagt, welche Medikamente er nehmen solle, und er hat bereitwillig genickt, weil das alles so unwichtig erschien und niemand Beas Kompetenz als Ärztin anzweifelte. Jeder wird mal krank, und jeder leidet mal an Verstopfung. Man muss das nicht dramatisieren. Auf der Erde stirbt man auch nicht an Schnupfen. Es ging Mercer besser, und sie haben alle geglaubt, dass er seine 10-Tage-Schicht an Bord des Orbiters wie geplant beenden kann.
Und dann kam das Fieber zurück.
Das war vor vier Tagen, und seitdem ist es immer schlimmer geworden, genauso wie Mercers Nachrichten an die Station im Eis unter ihm. Als sie endlich begriffen haben, dass er unter einer Psychose leidet und den Orbiter aus seiner vorgesehenen Umlaufbahn heraussteuert, war es längst zu spät. Ausgerechnet er, der erfahrenste Pilot unter ihnen, mit seiner beinahe lächerlichen Zuneigung zu allem Technischen, hat am Ende ignoriert, was die Instrumente ihm sagten und er direkt vor sich sehen konnte.
Sam macht sich deswegen Vorwürfe. Wenn er eher gemerkt hätte, was mit Mercer los ist, hätte er zur Eurybia fliegen und verhindern können, was geschehen ist. Dann müsste Loan zu Hause auf der Erde jetzt nicht Mercers Sachen aus dem Schrank nehmen und in einem zu großen Bett allein schlafen.
Aber Sam hat es nicht gemerkt.
Und deshalb ist sein Kamerad jetzt tot.
Schweigend sitzen sie sich im Versorgungsmodul der Chione gegenüber, beinahe eine Kopie seiner Erinnerung. Sam auf der einen Seite des Tisches, Laure und João auf der anderen. Nur das stetige Surren der Belüftung unterbricht die Stille, während die schwache Beleuchtung alles in ein sanftes grünes Licht taucht.
Sam wirft einen Blick zur Uhr über dem Kaffeeautomaten. Sie ist eines dieser sinnlosen Geschenke für Spaceworker, die immer genau die Uhrzeit des Orts auf der Erde anzeigen, die man vor Startbeginn einstellt. Ihre Uhr läuft auf Pariser Zeit, weil Adrians Familie schon seit hundert Jahren ihren Nachwuchs zwischen Le Havre und Lyon in die Welt presst. Dabei ist diese Uhr hier so nützlich wie ein Radio. Seit zwölf Minuten sitzen sie schweigend am Tisch.
Schließlich sagt Sam: »Wir können nichts mehr für ihn tun.«
»Wir müssen es aber versuchen!«, entgegnet Laure sofort.
»Ihr könnt Mercer nicht mehr retten, und in den Trümmern findet ihr sowieso keinen Leichnam. Wir haben dringendere Probleme.«
»Das weißt du nicht«, mischt sich João ein. »Er könnte es in eine Rettungskapsel geschafft haben.«
»Das ist doch Unsinn, und das weißt du auch. Ihr habt gesehen, wie er da im Sessel saß. Mercer ist nirgendwo mehr hingerannt.«
Laure lehnt sich zurück, atmet tief durch und spreizt die Finger auf der Tischplatte. Es ist ein merkwürdiger Tick, den Sam schon bei vielen Spaceworkern gesehen hat. Statt festem Boden unter den Füßen brauchen sie etwas Solides unter den Händen. Vielleicht, weil man sich in der Schwerelosigkeit so viel mit den Händen voranbewegt. Sie betrachtet ihn, als wäre er der Feind, und das irritiert ihn. Nach der langen Zeit des Herflugs und des Aufenthalts auf Kallisto kommt ihm inzwischen alles an ihnen wie eine Verlängerung seiner selbst vor. Die rasierten Schädel, die tätowierten Punkte im Nacken, hinter dem Ohr und an den Schläfen, damit sie immer wieder an denselben Stellen Blut abnehmen und mit Ultraschall messen können. Die dunklen Augenringe, die mit der Schlaflosigkeit einhergehen. Sam spürt den Verlust von Mercer wie eine entzündete Wunde am eigenen Körper, aber er muss trotzdem einen kühlen Kopf bewahren, das ist seine Aufgabe.
Erschöpft reibt er sich übers Gesicht. »Du hast doch gesehen, was passiert ist«, sagt er noch einmal zu Laure. »Wie soll das jemand überleben?« Seine Hand deutet auf die Mikrowelle, meint aber das, was dahinter liegt, hinter der Wand aus Basaltfaser und Eis. »Wie wollt ihr die Trümmer untersuchen, wenn ihr maximal vier Stunden raus dürft? Da seid ihr noch nicht mal an der Absturzstelle. Und die Kraterspalten sind nicht gerade Schlaglöcher. Wollt ihr, dass es euch wie Henderson geht?«
»Das ist doch eine Ausnahmesituation.« Laure wird lauter. »Der Rover hält das aus, und eine Weile sind wir da ganz gut vor der Strahlung geschützt. Wir könnten auch den Lander nehmen.«
»Kommt nicht infrage, den brauchen wir hier, falls irgendwas passiert. Wie sollen wir sonst von Kallisto runterkommen?« Er schüttelt den Kopf. »Sieh dich an, Laure. Ihr schwitzt wie die Schweine, und euer Blutdruck geht durch die Decke, die Temperatur steigt. In dem Zustand seid ihr niemandem eine Hilfe, und ich werde euch sicher nicht den Belastungen aussetzen, die mit einer Bergung einhergehen. Nicht jetzt, wenn es sowieso keine Rolle mehr spielt. João und du wartet, bis ihr wieder fit seid, bevor ihr aufbrecht.«
»Und wenn wir nicht wieder gesund werden?«
Er weicht ihrem Blick aus. »Natürlich werdet ihr das. Wir warten auf Befehle aus der Zentrale.«
»Du bist nicht der Commander.«
»Nein, aber Sicherheitschef, und ihr beide seid ein Sicherheitsrisiko, wenn ihr euch nicht bald einkriegt.«
Die Hierarchie ist klar. Adrian ist Mission Commander, aber er ist im Moment nicht in der Lage, Entscheidungen zu treffen, weil er sich die Seele aus dem Leib kotzt. Und Mercer, sein Stellvertreter, ist mit der Eurybia explodiert. Nun hat Sam das Sagen.
Laure hat die Hierarchien nie angezweifelt, selbst wenn sie wie die meisten Spaceworker auf Wissenschaftler und Soldaten ein bisschen herabblickt, weil sie sie für schwach hält, wenn es um den Schoß geht. Sie ist ehrgeizig, aber nicht dumm. Laure weiß, wie die Dinge laufen, und dass die ESA- und EASF-Leute Vorrang haben. Bisher war das kein Problem, aber seit das Fieber in der Station und auf dem Orbiter ausgebrochen ist, hat sich die Stimmung der Crew verschlechtert.
Sam rollt den Kopf von einer Seite zur anderen, erst jetzt merkt er, wie angespannt er in den letzten Minuten war. »Denkt ihr vielleicht, es macht mir Spaß, euch zu bremsen? Ich will auch zur Absturzstelle fliegen und nachsehen, was noch übrig ist. Ich versteh das. Aber es geht nicht. Das Risiko ist zu hoch, und ich brauche euch hier.« Er wirft einen Blick zur Tür. »Wir wissen nicht, wie sich die Sache noch entwickelt.«
»Du meinst, ob du dich ansteckst?«
»Das glaube ich nicht, das wäre längst passiert.«
Beinahe neidisch betrachten sie ihn, und Sam hofft, dass die Zentrale bald mit einer Idee um die Ecke kommt, wie sie sich helfen können, denn Bea gehen die Ideen aus. Nach den Pfirsichen hat sie geglaubt, dass die hohe Strahlung vielleicht irgendetwas in ihren Körpern aktiviert hat. Ein latentes Virus reaktiviert haben könnte.
»Herpes geht immer«, hat João lachend gesagt, während sie ihm Blut abnahm. Aber das war es auch nicht.
Sam ist nicht dumm. Er weiß, was ihn von den anderen Crewmitgliedern unterscheidet. Er war nicht auf Europa. Während seine Kameraden den Landgang unternommen haben, hat er oben in der Eurybia gesessen und sich gelangweilt. Eifersüchtig hat er auf diese glänzende Eiskugel geblickt, die die Projektionsfläche so vieler Träume war. Ihretwegen sind sie wieder zum Jupiter und Kallisto aufgebrochen – die vierte Mission zum vierten Mond, eine Glückszahl.
Am ersten Tag auf Kallisto hat Sam seine Initialen in eine Eisscholle gelasert und ein Bild davon nach Hause geschickt. Damit sie in den Spinney Hills stolz auf ihn sind, weil ausgerechnet er, dieser dürre Junge, der früher mit seinen Freunden zum Spaß Transportdrohnen vom Himmel geschossen hat, nun Teil eines Teams war, das vielleicht Geschichte schreibt. Die Station auf Kallisto, außerhalb des Strahlungsgürtels, ist der Ausgangspunkt für Flüge zum Mond Europa, und erneut haben sie darauf gehofft, dort Leben zu finden.
Auf Kallisto selbst sind die Eisschichten zu dick, um bis zum flüssigen Wasser hindurchzubohren, aber für Europa bestand Hoffnung. Immer verbunden mit diesem einen Wort, das wie ein geflüstertes Gebet klang – Ozean.
Witze haben sie darüber gerissen, während sie zwischen den Schichten Karten spielten. Irgendwie haben sich doch alle vorgestellt, dass man dort Delfine findet. Als wäre ein Ozean etwas, das man kennt. Als wäre irgendetwas hier draußen auch nur annähernd so wie auf der Erde.
Stattdessen nichts als Kälte, Eis und Unwirtschaftlichkeit. Europa ist eben noch nicht so weit, heißt es zu Hause. Sie sind ein paar Jahrtausende zu zeitig dran. Eine frühe Erde, die ihrem Potenzial erst noch gerecht werden muss.
Ist also genau dort etwas passiert?
Das fragt er sich.
Und die Zentrale fragt sich das auch.
Deshalb lässt sie Bea alle Proben, die die Crew von dort mitgebracht hat, noch einmal untersuchen. Doch in ihrem Zustand kommt Bea nur langsam voran. Laure hilft, aber auch sie muss immer wieder Pausen einlegen. Und Sam ist keine große Unterstützung. Er ist Soldat mit ausreichenden Ingenieur- und Navigationskenntnissen, um im Schoß von A nach B zu kommen und die passenden Ventilatoren auswechseln zu können, damit er nicht auf halber Strecke stecken bleibt. Er verträgt den Weltraum und kann gut mit Menschen, deshalb hat er es so weit geschafft. Es war nie vorgesehen, dass er herausfinden muss, was seine Kameraden tötet. Bei militärischen Operationen ist der Feind bekannt.
»Ich werde euch nicht erlauben, jetzt aufzubrechen«, sagt Sam bestimmt. »Wir werden die Absturzstelle aufsuchen, aber dafür müssen wir den Lander nehmen, sonst dauert das zu lange. Zuerst müssen die Cambots das Gelände erkunden, vorher können wir nicht landen. Außerdem gibt es vielfältige Interessen zu beachten, sonst machen sie uns zu Hause die Hölle heiß.«
Angewidert sieht Laure ihn an und verschränkt die Arme. »Das ist typisch. Wir können hier draußen ja verrecken, Hauptsache, die Interessen sind gewahrt. Du vergisst wohl, dass du genauso hier festsitzt wie wir. Die EASF und ihre Interessen helfen dir hier auch nicht, nur wir. Es ist wichtig, dass wir zusammenhalten.«
»Du musst mir keinen Vortrag über Unterstützung halten. Wenn du mal die herausquellenden Gedärme deines Kameraden in der Schwerelosigkeit eingefangen hast, weißt du, was es bedeutet, aufeinander angewiesen zu sein.«
»Fang bloß nicht mit dem Stevinus-Aufstand an«, warnt sie leise, und Sam hebt die Hände. Der Aufstand ist immer noch ein sensibles Thema zwischen Spaceworkern und der EASF.
»Ich weiß, dass ihr glaubt, Mercer im Stich zu lassen, wenn ihr ihm nicht folgt, aber Tote kann man nicht mehr retten, und der Preis für eure Loyalität ist zu hoch.«
Wütend steht Laure auf und geht zur Tür. »Ich sehe mal nach Bea und Adrian.«
Die Art, wie sie ihm den Rücken zuwendet, beunruhigt Sam.
Nach einem Moment der Stille räuspert sich João. »Wenn du meinen Rat wissen willst, dann hör auf sie. Von uns allen hat sie die meiste Erfahrung im Schoß. Laure hat einen guten Instinkt, und wenn sie der Meinung ist, dass wir etwas tun sollten, ist das vermutlich das Richtige.« Schwerfällig erhebt er sich, und Sam sieht zu ihm hoch.
»Ich vertraue Laures Instinkt, aber ich verstehe nicht, warum sie es in dieser Sache so eilig hat. Das ist keine Rettungsmission, João, es bleibt uns nur noch die Bergung. Ein überstürzter Aufbruch ohne Wissen darüber, was uns an der Absturzstelle erwartet, ist viel zu riskant.«
»Sie weiß das, Sam.«
»Warum drängt sie dann so? Auch wenn sie das nicht hören will, müssen wir die Interessen des Unternehmens und der ESA im Hinterkopf behalten. Spätestens wenn wir zur Erde zurückkehren, wird man Rechenschaft von uns verlangen.«
João winkt verärgert ab. »Und selbst in einer solchen Situation sollen wir uns weiterhin professionell verhalten, nicht wahr? Dafür wurden wir schließlich trainiert und ausgesucht. Dafür werden wir bezahlt. Ist es das, was du sagen willst? Moral gilt dabei nur wenig.«
»Tut mir leid, Mann.«
João klopft ihm auf die Schulter, sein Blick ist nicht unfreundlich. »Ruh dich aus. Ich sehe mal nach, wie weit die Cambots schon gekommen sind. Wenn es etwas Neues gibt, sage ich dir Bescheid.«
»Ihr braucht den Schlaf dringender als ich.«
»Kumpel, Schlaf ist etwas für Leute ohne Probleme.« Nach diesen Worten verschwindet auch João im Gang zum Comm-Modul, und während Sam ihm nachsieht, hat er das merkwürdige Gefühl, einem Fremden nachzublicken.
Er ahnt, wo sie den Fehler begangen haben. Sie sind unvorsichtig geworden und haben einfach nicht mehr damit gerechnet, dass etwas passiert. Seit Startbeginn lief alles hervorragend. Es gab kaum Störungen, keine größeren Ausfälle, keine brenzlige Situation beim Durchflug des Gürtels, und das Landen klappte wie nach Lehrbuch. Zu Hause wird bereits Merchandise mit ihren Gesichtern darauf designt, denn für die Daheimgebliebenen sind sie hier draußen Götter, und eine Zeit lang haben sie das selbst geglaubt. Alles schien möglich.
Aber jetzt ist Mercer tot, und Bea und Adrian schaffen es kaum noch von ihren Liegen hoch, so schlimm ist das Fieber. Aus Göttern werden Sterbliche, und als solche nagt die Angst an ihnen.
4
Luxemburg, Esch-sur-Alzette
Das ist alles eine riesige Scheiße.
»Ist er betrunken?«
»Benzos.«
»Verstehe. Rufen Sie seinen Arzt an, er soll zusehen, wie er dem Ganzen entgegenwirken kann. Wir brauchen Romain nüchtern. Und holen Sie Kaffee.«
»My special boy.«
»Yes, Mama?«
»You are God’s gift to me, sweet thing.«
»Am I?«
»Monsieur.« Langsam und ruhig tritt Annabella auf Romain zu. Ihre Aura ist ein leuchtendes Violett, das sich ausdehnt und wieder zusammenzieht. Sie beugt sich über ihn. »Wie fühlen Sie sich?«
Zerbrochen.
Der Ausbau der Kallisto-Station zu einem Weltraumhafen sollte sein Vermächtnis werden. Aber jetzt ist alles kaputt.
Stöhnend richtet sich Romain auf, bis er sitzt. Seine Mutter und Annabella blicken auf ihn herab wie zwillingshafte Sachmet-Statuen, die Arme hinter dem Rücken verschränkt, während um sie herum die Welt erzittert.
Er hat seine Mutter ewig nicht mehr gesehen, sie verlässt Oxfordshire nur noch selten. Das letzte Mal zu Weihnachten, als Geraldine und er das Chalet in Zermatt gebucht hatten. Wenn sie von der großen Insel rübergeflogen kommt, muss es schlimmer um das Unternehmen stehen, als er befürchtet hat.
»Nimmt er die oft?«, fragt sie und greift nach dem Pillenbeutel auf dem Polster neben ihm. Dabei runzelt sie die Stirn, und das Funkeln ihrer Smaragdohrringe brennt sich auf seine Retina.
»Ich bin mir nicht sicher«, antwortet Annabella, die Fabelhafte, aber die vorgeschobene Unterlippe verrät ihm, dass sie lügt. Sie kennt die Wahrheit.
Romain wird das honorieren, immerhin ist sie noch nicht lange seine Assistentin und Loyalität so eine Sache.
»Das sollten Sie aber.« Missbilligend richtet sich seine Mutter wieder auf und verschränkt die Arme.
In seinen Ohren klingt ihr Akzent hart. Seit sie nicht mehr mit seinem Vater spricht, gibt sie sich kaum noch Mühe mit ihrem Französisch.
»Reiß dich zusammen, Romain! Jetzt ist nicht der Zeitpunkt, den Kopf zu verlieren.« Sie packt ihn am Oberarm und zieht ihn in die Höhe. Für eine Frau ihres Alters und ihrer Statur hat sie erstaunlich viel Kraft. Ungeduldig schiebt sie ihn ins angrenzende Bad, als wäre er ein ungezogenes Kind.
Romain findet, dass sie übertreibt. Er ist schon lange kein Kind mehr. Seit über zwanzig Jahren im Unternehmen, seit fünf Jahren steht er an der Spitze, zwei Tage vor der Einäscherung seines Vaters hat er den ersten Milliardendeal unterschrieben. Er weiß, was von ihm erwartet wird und wie man einen Konzern regiert, dafür wurde er schließlich ausgebildet. Sein Leben lang. Auf teuren Privatschulen und Eliteuniversitäten, während der Ferien auf Luxusjachten und an den Bars der besten Hotels. Er besitzt das passende Know-how, die Gesten, den Lifestyle, die Emotionen. Alles so zugeschnitten wie seine Anzüge.
Er versucht, etwas zu sagen, aber seine Mutter unterbricht ihn.
»Daniel hat eine außerordentliche Sitzung einberufen«, sagt sie.
Romain nickt.
Auch das weiß er. Er wird sich darum kümmern. Um alles. Aber noch nicht jetzt, nicht sofort. Zuerst muss er die flammenden Bilder auf der Innenseite seines Schädels loswerden. Die Aufnahmen des abstürzenden Orbiters. Grobkörnig und verwackelt. Er muss den verzerrten Funkspruch verhallen lassen, diese Stimme eines Geists. Den Gedanken an das, was verloren ist. Die Investitionen, die jahrzehntelange Arbeit, Romains Pläne und Träume – alles umsonst.
Er weint. Was soll man auch anderes tun angesichts dieser Katastrophe?
Einen Moment lang ist er überrascht, dass er es überhaupt noch kann, weil doch auch das Weinen vor so vielen Jahren der Schere zum Opfer gefallen ist, als der Emotionsanzug für seine Persönlichkeit zugeschnitten wurde. Es muss sich wie ein Ersatzknopf irgendwo versteckt haben.
»Trink das«, sagt seine Mutter und hält ihm ein Glas entgegen, während er auf der Bank sitzt und darauf wartet, wieder Boden unter den Füßen zu spüren.
Wie in Zeitlupe greift er nach dem Wasser und hört sie schwer seufzen, bevor sie sich seinem Spiegelbild zuwendet und sagt: »You’re just like your father.«
Romain blinzelt.
I’m really not.
5
Französisch-Guyana, l’Île du Lion Rouge
Auf den Stufen vor dem Haus sitzt eines der Proctorkids. In seinem gelben T-Shirt vor der Eidotterfassade sieht es beinahe aus wie ein Chamäleon. Fünf sind es an der Zahl, das sechste ist schon unterwegs.
Uche kann sie nicht auseinanderhalten. Ständig verwechselt er ihre Namen und ihr Alter, manchmal sogar, ob es Jungen oder Mädchen sind, weil sie alle dieselben langen blonden Locken und dreckigen Füße vom Barfußlaufen haben.
Jeder im Viertel kennt die Proctorkids und ihre flinken Finger. Wenn sie in der Nähe sind, halten alle fest, wonach sie greifen können. Die Familie leidet unter chronischem Geldmangel, da muss eben jeder mithelfen. Selbst Nachbarn und Fremde, wenn sie nicht aufpassen.
Seit Richard pensioniert ist, scheint er jedes Jahr ein Kind gezeugt zu haben. Manchmal machen die Nachbarn Witze darüber, dass er auf diese Weise seinen Lebensabend finanziert, sie nennen es die Vögel-Prämie. Weil die großen Companies es gern sehen, wenn Kinder ihren Eltern ins Mining folgen. Manche behaupten, im Mining würden Steine genauso gefördert wie Kinder. Aber das ist natürlich ein bisschen zynisch, und im Grunde sind sie nur alle erstaunt, dass Richard überhaupt noch Kinder zeugen kann nach all den Jahren im All. Das verleiht der Existenz dieser Plagen beinahe eine magische Aura. Vielleicht zeigt sie deshalb niemand an.
Und wer will es dem armen Kerl schon verübeln, wenn er die Zuschüsse in Anspruch nimmt; die Antiverstrahlungstherapie frisst ihnen allen die Haare vom Kopf.
Uche nickt dem Kind auf der Treppe zu, das ganz vertieft in sein HolMag ist. Die Finger feucht glänzend vom Saft einer halb aufgegessenen Maracuja neben seinen Füßen, um die die Fliegen schwirren.
Als Uche an ihm vorbeigeht, murmelt es etwas in einem merkwürdigen Kreolisch, das außerhalb der Familie kaum jemand versteht. Das Kind wirft Uche einen kurzen Blick zu, in dem das stumme Urteil schon liegt, bevor er Uche überhaupt trifft. Das beherrschen sie ganz gut, diese Proctorkids.
Sie sind einfach seltsame kleine Kreaturen, findet Uche.
Er drückt die Fingerspitzen auf das Display neben der Tür, und mit einem leisen Summen schiebt sie sich zur Seite. Das Dämmerlicht des Treppenhauses lässt ihn fast stolpern, und blinzelnd schiebt er die Sonnenbrille nach oben.
Heute nimmt er den Fahrstuhl. Ihm tun schon wieder die Hüften weh, und die Zeiten, in denen er irgendjemandem etwas beweisen musste, sind längst vorbei. Im spiegelnden Display der Fahrstuhlkabine erkennt er sich kaum wieder. Seine Haut hat einen Rotstich, und die Flecken unter den Armen heben sich unangenehm deutlich gegen das Hellgrün des Shirts ab. Er muss sich mal wieder rasieren.
Uche kratzt sich die Wange. Eine Biene hat sich in die Kabine verirrt und stößt immer wieder gegen die Wände. Als er aussteigt, leitet er das Tier mit seiner großen Hand vorsichtig aus der Kabine. Prêtre Albert hat immer gesagt, Bienen verrichten Gottes Werk und die Moskitos das des Teufels. In manchen Nächten versteht Uche sehr gut, was der Alte meinte.
In der Wohnung ist es unerträglich stickig, die Klimaanlage ist ausgefallen. Schon zum zweiten Mal in diesem Monat, und es kann eine Weile dauern, bis das Problem behoben wird, er kennt das schon.
Der Geruch nach warmem Holz irritiert ihn, auch wenn er so typisch für die Gegend ist. Kaum ein Haus auf der Insel ist aus Stein. Eine Wohnung sieht aus wie die andere, beinahe wie Bienenwaben. Kleine Räume, damit die Statik funktioniert, und große Spiegel, um die Illusion von Weite zu erzeugen. Eine Verschwendung, findet Uche, niemand mit Klaustrophobie arbeitet als Spaceworker.
Erschöpft geht er hinüber zu dem alten Sofa mit den bunten, bestickten Kissen, die ihm Hli geschenkt hat, als sie noch geglaubt hat, sie würden bald zusammenziehen. Unter seinen Sohlen knarzen die Dielen, weil die Feuchtigkeit das Holz verzieht, und schnaufend lässt er sich auf die Polster fallen. Unter dem Tisch entdeckt er eine letzte grüne Scherbe von dem Glas, das er vor ein paar Tagen gegen die Wand geschmissen hat. Aber er hebt sie nicht auf, löst nur die Prothesen von den Interfaces unter dem Knie und stellt sie beiseite. Genervt reibt er sich die Stelle am Knie, an der das Interface mit der Haut verwächst, die Ränder sehen entzündet aus.
Uche flucht. Lang und ausgiebig, wie er es von Kalu gelernt hat, denn ältere Brüder sind ein nie versiegender Quell an Schimpfwörtern, selbst Adoptivbrüder. Danach seufzt er, nicht ganz so lang, und greift nach der Tablettenschachtel auf dem kleinen Tisch neben dem Sofa, die dort immer liegt. Ohne Wasser schluckt er zwei Pillen, lehnt sich zurück und schließt die Augen. Während sich Uche über die Hüften streicht und darauf wartet, dass die Schmerzmittel wirken, denkt er an das, was er Ricki gesagt hat. An seinen Wunsch, von hier wegzugehen.
Welche Ironie.
Im Bauch der Asteroiden konnte er es kaum erwarten, eines Tages eine Wohnung auf dieser Insel zu besitzen. Früher haben ihn die Menschenmassen in Metropole beinahe zerdrückt, jetzt kann er die immer selben Gesichter auf den Straßen der Insel kaum noch ertragen und sehnt sich fort.
Er denkt auch an Isabella, die noch vor wenigen Wochen quicklebendig war und nun unter der Erde liegt. Genauso wie Montgomery und Richter.
Bei Montgomery hat er sich nichts gedacht, als er von dessen Tod gehört hat. Was interessiert es Uche, wenn einer stirbt, mit dem er nur ein einziges Mal ein Geschäft abgewickelt hat? Bei Richter hat er dann gedacht: So ein Pech. Den mochte er irgendwie. Selbst wenn er dermaßen viel Dreck am Stecken hatte wie dieser Kerl. Manchmal werden Leute, die im großen Stil mit Koks und Pillen dealen, eben nicht alt, das bringt der Beruf so mit sich.
Aber drei sind einfach einer zu viel. Das ist wie bei den meisten Beziehungen. Das ist kein Zufall mehr. Nicht wenn alle drei einen Immunschock erlitten haben. In drei verschiedenen Ländern, auf zwei Kontinenten.
Uche öffnet die Augen.
Er hat nie ernsthaft daran gedacht, was passiert, wenn sie ihn bei der Schmuggelei erwischen. Irgendwie hat er immer geglaubt, dass ihm das Glück auch weiter hold sein würde. Hier und da ein Verkauf, nicht jedes Jahr, nicht bei jeder Gelegenheit. Ewig hat er gewartet, bevor er die Sachen von Antoines letztem Flug verkauft hat. Er war nicht gierig.
Doch jetzt hat er Angst.
Uche zieht das zusammengerollte V-Display aus dem Fach in der Sofalehne. Breitet es über den Oberschenkeln aus, bis es einrastet und steif bleibt. Im Licht der einfallenden Sonne zeigen sich seine Fingerabdrücke auf der Oberfläche. Er gibt Isabellas Namen in die Suchmaschine ein. Sein Blick huscht über die Nachrichten zu ihrem Tod. Er gibt auch die beiden anderen Namen ein. Vergleicht die Daten, das, was über die Todesursachen bekannt ist. Viel dringt jedoch nicht an die Öffentlichkeit. Man sollte meinen, dass bei diesen Leuten genauer hingesehen wird, dass jemand Fragen stellt, doch die Welt dreht sich weiter wie bisher. Die Öffentlichkeit interessiert sich nicht dafür, wie Isabella gestorben ist, sondern nur dafür, wer das beträchtliche Erbe übernimmt. Und die Familie zieht daran wie Hunde an einem Stück Fleisch.
Uche schüttelt den Kopf. Er hat nur an diese drei verkauft. Den Rest wollte er nächsten Monat abstoßen. Zwischen jedem Deal lässt er sich Zeit. Vier Monate sind vergangen, seit der Erste von ihnen gestorben ist, plötzlich und ohne Vorwarnung. Und Uche wartet darauf, dass es an seiner Tür klingelt, weil jemand festgestellt hat, dass sein Name in allen drei Kalendern auftaucht.
Aber natürlich steht sein Name nirgendwo. Warum hätten sie ihre heimlichen Treffen irgendwo vermerken sollen? Solche Sachen werden nicht schriftlich festgehalten. Drei Wochen ist es her, dass er sich mit Isabella getroffen hat. In einer Mittagspause; in einer Hotelsuite, die ohnehin für Meetings genutzt wird. Isabella hat ständig Leute gesehen, die Sachen für sie erledigen. Wen interessiert da dieser Schwarze mit den Prothesen? Vielleicht wollte der für irgendeine Wohltätigkeitsveranstaltung sammeln. Vielleicht etwas pitchen. Wer achtet schon auf Bittsteller im Beisein der wahrhaft Mächtigen?
Uche aktiviert das HolMag am Handgelenk. »Ruf Antoine an«, sagt er und wartet.
Das Bild baut sich langsam auf, doch dann wird es stabil. Antoine sitzt auf einer weiß gefliesten Terrasse, im Hintergrund laufen Leute herum, aber es ist keine Party. Vielleicht ein Arbeitstreffen. Er trägt ein neongrünes Aparaishirt, seine goldenen EarMags glänzen in der Sonne. Er sieht erholt aus.