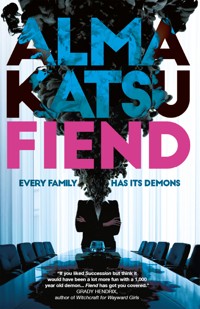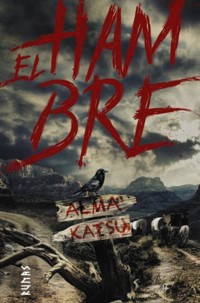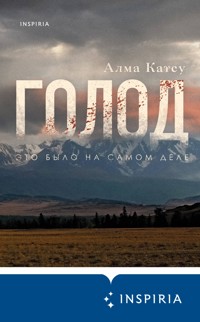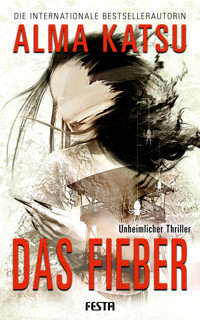
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
1944: Während der Zweite Weltkrieg tobt werden Meiko Briggs und ihre Tochter Aiko aus ihrem Haus in Seattle geholt und in eines der Internierungslager der USA gebracht. Dass Aiko in Amerika geboren wurde, spielt keine Rolle: Sie ist Japanerin und wird deshalb von der US-Regierung als Bedrohung angesehen. Mutter und Tochter versuchen die Gefangenschaft mit Würde zu überstehen. Doch als sich unter den Internierten ein tödliches Fieber ausbreitet, ändert sich alles. Jeder spürt, es geht etwas Unheimliches vor sich … Inspiriert von den japanischen Legenden über den Jorōgumo-Spinnendämon verbindet Alma Katsu die Schrecken des Übernatürlichen mit denen der japanisch-amerikanischen Internierungslager im Zweiten Weltkrieg. Publishers Weekly: »Ein starker historischer Horror-Roman ... Was Menschen einander antun, schafft einen unvergleichlichen Horror.« NPR: »Was passiert, wenn Rassismus ungehindert gedeihen darf? Eine historisch-fiktive Erzählung, die sich unglaublich aktuell anfühlt.« Booklist: »Die Geister dieser Geschichte werden die Leser noch lange verfolgen.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Aus dem Amerikanischen von Susanne Picard
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe The Fervor
erschien 2022 im Verlag G. P. Putnam’s Sons.
Copyright © 2022 by Glasstown Entertainment, LLC and Alma Katsu
Copyright © dieser Ausgabe 2023 by Festa Verlag GmbH, Leipzig
Lektorat: Joern Rauser
Titelbild: Arndt Drechsler-Zakrzewski
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-98676-043-4
www.Festa-Verlag.de
Für meine Mutter Akiko Souza – dafür, dass sie uns all ihre Kindheitserinnerungen an Japan zur Zeit des Zweiten Weltkriegs erzählte,
und für meinen Schwiegervater John Katsu,
der seine Erfahrungen mit der Internierung mit uns teilte.
Wasaburo Oishis Tagebuch
Mai 1917
Auf der Insel ist es windig und immer feucht. Hier gibt es nichts außer Steinen und Bäumen und dem Ozean, wohin man auch sieht. Es ist deprimierend. Man sollte gar nicht vermuten, dass Schikotan doch verhältnismäßig nahe am Festland liegt, bei Nemuro, und eine etwas größere Insel ist, die zusammen mit ihren Nachbarinseln so wirkt, als wäre sie von der Nordostküste Hokkaidos abgebrochen.
Wir sind erst gestern angekommen, und schon ist mir die kalte Seeluft in die Knochen gekrochen und in das Papier gesickert, auf dem ich hier schreibe. Ich hätte nicht kommen sollen, sagen mir die Einheimischen. Du hättest deine Frau und dein Kind nicht mitbringen dürfen. Es ist hier nicht sicher. Yuriko und Meiko haben sich nicht beklagt, auch wenn einem dieser Ort wohl kaum als Ferienparadies erscheint. Sie wissen um die Bedeutung dieses Aufenthalts, bei dem ich meine Studien der Höhenwinde vertiefen möchte. Immerhin habe ich dafür meine Arbeit beim Zentralen Meteorologischen Observatorium ausgesetzt. Meine Vorgesetzten dort genehmigten den Aufenthalt hier, teilten mir jedoch mit, dies sei meine letzte Chance. Sie sind nicht überzeugt, dass die Winde, die ich entdeckt habe, von irgendeiner Wichtigkeit sind. Auch andere Wissenschaftler haben mein Werk bislang ignoriert. Von meinen Veröffentlichungen hat die Welt keine Notiz genommen.
Es sei nicht zu spät, sich einem neuen Forschungsthema zu widmen. »Sie sind doch noch ein junger Mann«, teilte mir mein Mentor kurz vor der Abreise mit. »Sie finden sicher noch etwas anderes, womit Sie der Nachwelt im Gedächtnis bleiben können.«
Man wollte, dass ich keine weiteren Reisevorbereitungen treffe, um das Geld für andere Projekte zu verwenden. Aber ich weiß, dass sich meine Entdeckung eines Tages als bedeutungsvoll erweisen wird. Die Forschungen werden mein größter Beitrag für die Menschheit sein, von dieser Wahrheit bin ich zutiefst überzeugt.
Schikotan ist meine letzte Hoffnung, um zu beweisen, dass an »Wasaburos Winden« etwas dran ist.
Wir entdeckten schon bald, dass sich auf Schikotan auch eine kleine Kolonie der Ausgeschlossenen, der Verrückten und der Missgestalteten angesiedelt hat. Das sind Menschen, die in der Gesellschaft unerwünscht sind. Sie wurden hierher auf diesen einsamen Außenposten geschickt – damit man sie untersuchen und sich um sie kümmern kann. Zumindest in der Theorie. In Wirklichkeit gibt es keinen anderen Ort, an den sie gehen können. An diesen Ort werden sie geschickt, um zu sterben.
Ich bin Wissenschaftler, also wurde von mir erwartet, dass ich dem Krankenhaus einen Höflichkeitsbesuch abstatte. Aber über diese Verpflichtung hinaus bin ich auch neugierig darauf gewesen und habe gehofft, verstehen zu können, was diese Patienten einschränkt und ob das vielleicht mit dem grauenvollen Ruf dieses Ortes zusammenhängt. Ich wollte sie einfach selbst in Augenschein nehmen. Alle Patienten, die ich traf, wirkten geistesabwesend oder waren dement, viele gewalttätig. Ihre Klagen, das Heulen und ihr Rütteln an den Türen wurden vom Wind davongetragen.
Der Mann, der für sie verantwortlich war, sagte, jedem Patienten gehe es nach seiner Ankunft hier schlechter als vorher. Seiner Ansicht nach hatte das mit der Isolation zu tun, doch sicher war er sich nicht. Selbst die Wärter scheinen hier langsam, aber unweigerlich auf ihre eigene Art verrückt zu werden. Aus diesem Grund verlassen nur wenige das Krankenhaus lebend.
Aber in diesem Jahr, so sagte er mir, hätten sich die Dinge auf unerklärliche Weise noch weiter verschlechtert. Neuankömmlinge habe sehr rasch der Wahnsinn erfasst. Er hat keine Ahnung, was die Ursache dafür sein könnte. Er riet mir, meine Familie auf der Stelle wieder aufs Festland zu schicken und auch selbst nur so lange wie unbedingt nötig zu bleiben.
Die Einheimischen sagen, die Insel sei verflucht.
1
In der Nähe von Bly, Oregon
Gearhart Mountain
19. November 1944
»Himmel, Arsch und Zwirn, wirst du wohl …!«
Archie Mitchell packte den Schaltknüppel seines 1941er Nash 600 Sedan, aber die Räder drehten im Matsch dennoch durch.
Der späte Herbstregen hatte die Dairy Creek Road in etwas verwandelt, das kaum mehr als eine Mure dunklen Schlamms war, die sich den dicht mit Ponderosa-Kiefern und Wacholder bewachsenen Berghang hinabwand. Unsicherheit erfasste ihn. Sie hätten es besser wissen müssen als zu dieser Jahreszeit diese nicht ausgebauten Holzfällerwege entlangzufahren.
»Archie, die Kinder«, mahnte Elsie vom Beifahrersitz aus. Ihre Haare waren blond, die Lippen pink. Haselnussbraune Augen warfen einen scharfen Blick in den Rückspiegel. Das Spiegelbild zeigte ihr eine Ansammlung von braunen und grünen Hemden und Cordhosen, zu viele knubblige Knie und herunterrutschende Socken: Die Patzke-Kinder, Dick und Joan, und noch drei andere, Jay Gifford, Edward Engen und Sherman Shoemaker, nahmen an dem Ausflug teil, alle hatten sich die Haare zur Feier des Sonntags glatt gekämmt. Sie flüsterten und sangen in sich hinein. Auf dem hinteren Sitz zog Dick Patzke gerade seine Schwester, die schon ein Teenie war, am Pferdeschwanz.
»Stecken wir fest?«, wollte Ed wissen.
»Alles ist gleich wieder in Ordnung«, versicherte Elsie den Kindern. »Der Herr hat uns mithilfe der Natur nur eine kleine Prüfung geschickt. Das ist alles.«
Eine Prüfung der Natur. Archie lächelte. Seine Frau hatte recht. Er hätte besser auf seine Ausdrucksweise achten sollen. Kein Wunder, dass sie auf dem Simpson Bibelkolleg die Beste gewesen war – ganz im Gegensatz zu ihm. Aber aus irgendeinem Grund und trotz all seiner Fehler hatte Gott es für richtig gehalten, ihm Elsie an die Seite zu geben.
Wieder trat er aufs Gaspedal, und diesmal machte der Wagen einen Satz nach vorn. Als die Räder wieder zugriffen, rutschte ein Strom lehmgrauen Schlamms unter ihnen davon.
»Siehst du«, meinte Elsie und tätschelte sein Knie. Er versuchte, den Trost, den sie spenden wollte, auch wirklich an sich heranzulassen, doch die schlimme Vorahnung und die Nervosität, die ihm schon den ganzen Morgen auf der Brust saßen, wollten nicht verschwinden.
Aber genau deshalb waren sie ja hier. Dieser Ausflug zum Gearhart Mountain war Elsies Idee gewesen. Sie und Archie hockten schon seit Ewigkeiten drinnen, er machte sich ständig Sorgen um ihr Wohlergehen. Sie brauchten einfach einen Tapetenwechsel. Zu leicht wurde man irre, wenn man nicht ab und zu an die frische Luft kam. Für ein junges, glückliches Paar in den besten Jugendjahren war es einfach nicht gesund, immer aufeinanderzuhocken. Außerdem hatten sie gerade erst erfahren, dass die Patzkes ihren Ältesten an der Front in Übersee verloren hatten. Sicher war es in einem solchen Fall die Pflicht eines Reverends, einzuspringen und einer trauernden Familie etwas Unterstützung anzubieten. Dass ihm ein paar passionierte Angler erzählt hatten, Forellen bissen im Leonard Creek auch zu dieser Jahreszeit noch gut an, hatte dem Ganzen sicher noch einen zusätzlichen Schub gegeben.
»Mein Fischer, der nie die Hoffnung verliert!«, hatte Elsie ihn später am Abend geneckt, als sie unter dem gelben Schein ihrer zueinanderpassenden Nachttischlämpchen lagen. »Aber wäre das nicht ganz nett für die Patzke-Kinder? Ein kleiner Sonntagsausflug irgendwann? Die Patzkes sind sicher froh, in ihrer Trauer etwas allein sein zu können, glaubst du nicht? Außerdem könnte ich die Übung brauchen, wo ich doch selbst bald Mama bin.«
Sie versuchte immer, ihn aus seinen Grübeleien herauszuholen … und es gelang ihr auch. Archie rollte sich herum und drückte seiner Frau einen Kuss auf den runden, gespannten Bauch. Fünf Monate waren es jetzt, und er konnte es kaum noch erwarten. Diesmal würde alles problemlos ablaufen. Es gab keinen Grund zur Sorge. Ein gesunder Sohn war unterwegs, versicherte sich Archie angesichts des rosigen Schimmers auf den Wangen seiner Frau.
Er hatte ein Ja in ihr Nachthemd geraunt, und jetzt war aus einem ›Sonntagsausflug irgendwann‹ der Sonntagsausflug heute geworden.
Der Wald um sie herum wurde dichter, der Himmel über ihnen strahlte in paradiesischem Blau. Nur ein paar Wolkenfetzen waren von dem gestrigen Unwetter übrig geblieben. Dennoch, je weiter sie die immer steiler werdende Straße hinauffuhren, desto fester zog sich die Eisenspange um seine Brust zusammen. Er kurbelte sein Fenster herunter und sog die frische Bergluft tief ein. Es war so kalt, dass man schon den Winter darin schmecken konnte.
Und für einen Augenblick, nur ganz kurz, war er sicher, eine Schneeflocke gesehen zu haben. Ein unheimlicher Schauer überkam ihn, als wäre in einem Zimmer plötzlich eine Tür aufgerissen worden. Aber es war doch nur ein winziger Kiefernsämling, ein kleines Stück Flaum, das der Wind davontrug.
Die Kinder sangen schon wieder Kirchenlieder, als Archie den Nash auf einen schmaleren Versorgungsweg lenkte. Ohne jeden Zweifel hatte er mehr Schlaglöcher als die Dairy Creek Road, weshalb Archie schon bald einen besorgten Blick auf Elsie warf. Sie legte eine Hand auf ihren Bauch, als der Wagen über eine hervorstehende Wurzel donnerte.
Behutsam bremste er. Bis zu der verlassenen kleinen Hütte, von der ihm die Angler erzählt hatten, war es nicht mehr weit. »Vielleicht sollten wir den Rest des Weges zu Fuß gehen.«
Elsie griff nach der Halteschlaufe. »Wie wäre es, wenn ich die Kinder zum Fluss bringe? Vielleicht kommst du mit dem Wagen noch ein Stück weiter. Dann müsstest du die Picknick-Ausrüstung nicht so weit tragen.«
Wie immer hatte sie recht. »Bist du sicher, dass das für dich in Ordnung ist?«
Ihr Lächeln glich einem Sonnenstrahl und erfüllte ihn mit etwas, das noch mehr war als Liebe. Etwas, das er nicht benennen konnte, denn es würde Gott beleidigen, hätte man es getan. Er betete sie an. Er hätte sich draußen in den Schlamm gelegt und ihr als Fußmatte gedient, nur damit sie lächelte. Allein das Gefühl ihrer sanften Hände auf ihm in der Dunkelheit, diese eigenartigen kleinen Küsse, die verbotene Gedanken in ihm auslösten und ihn in Flammen aufgehen ließen. Gegen Elsie war er machtlos.
»Natürlich«, erwiderte sie jetzt. »Weißt du, manchmal musst du mich eben einfach aus den Augen lassen.« Wieder lächelte sie.
Er beobachtete, wie die Kinder aus dem Auto krabbelten – wie kleine Ziegen, denen man das Gatter geöffnet hatte.
»Ich werd den größten Fisch angeln!«, krähte einer der Jungs.
»Nein, ich …!«
»Ich werd mir einen Wal fangen!«
»Bist du blöd, in Flüssen gibt’s doch keine Wale«, schrie der erste Junge zurück. Die Stimmen erinnerten Archie an seine eigene Kindheit, in der er mit seinen Freunden manchmal von einer Brücke aus geangelt hatte. Kinder, die glücklich waren, Kinder zu sein, und einfach drauflosspielen durften. Er war damals noch keine 13 gewesen, hatte sich aber schon wie ein alter Mann gefühlt.
»Wer zuletzt am Fluss ist!«
… ist der Dumme, ergänzte Archie in Gedanken. Einige Dinge änderten sich eben nie.
Sie rannten den Pfad entlang und spornten sich dabei gegenseitig an. Elsie bildete zusammen mit dem Patzke-Mädchen das Schlusslicht. Joan Patzke war wirklich ein braves Kind, dachte Archie. So aufmerksam. Gut erzogen, wie sie war, war sie bei Elsie geblieben, damit diese Gesellschaft hatte und eine Hand, auf die sie sich stützen konnte.
Wenn nur jede Familie in der Gemeinde so freundlich wie die Patzkes wäre! Wenn alle Eltern in Bly so gut wie diese Kinder wären, dann wäre alles in Ordnung, dachte er. Und trotzdem wollte sich die Enge um seine Brust nicht lösen.
Sobald das Baby auf der Welt war, würde er wieder atmen können. Die Ärzte versicherten ihm, dass jetzt, im fünften Monat, alles in Ordnung war und man sich nun keine Sorgen mehr machen musste.
Aber das hatten sie beim letzten Mal auch gesagt.
Er parkte so dicht wie möglich am Rand des Wirtschaftswegs, aber der Nash nahm dennoch einen Großteil der Fahrbahn ein. Keiner würde an dem Auto vorbeifahren können, der Versorgungsweg war einfach zu schmal.
Als er den Kofferraum öffnete, wehte ihm der Duft von Schokolade entgegen. Elsie hatte gestern beschlossen, für das geplante Picknick eine Schokoladentorte zu backen. Die Böden hatte sie noch gestern fertig bekommen und auf dem Gitter über Nacht auskühlen lassen. Die Schokocreme hatte sie erst heute Morgen gemacht, die Butter und den Zucker mithilfe eines großen Holzlöffels mit der Hand geschlagen. Elsie backte die Schokoladentorte nur ein- oder zweimal im Jahr, allein der Gedanke daran ließ Archie das Wasser im Mund zusammenlaufen. Er hob den Korb, in dem sich die Torte befand, heraus, legte die Holzgriffe über den Unterarm und nahm mit der anderen Hand den Picknickkorb aus dem Kofferraum. Darin befanden sich Truthahnsandwiches, außerdem eine Thermoskanne mit Kaffee für die Erwachsenen und ein Krug Apfelsaft für die Kinder.
Er stellte den Korb auf den Boden, um den Kofferraumdeckel zu schließen, als noch einer dieser winzigen weißen Sämlinge auf seiner Nase landete. Er war nicht größer als eine Schneeflocke. Er fegte ihn fort, seltsam beunruhigt. Wieder dieses Gefühl: ein Wind, der ihn durchfuhr. Er schauderte und schlug den Kofferraum zu.
Eine Frau stand vor ihm.
Vor Schreck machte er einen Schritt rückwärts, doch sie blieb vollkommen reglos stehen und beobachtete ihn. Sie war jung und wunderschön, trug einen Kimono, und zwar einen kostbaren, wenn er sich nicht irrte, sah aber etwas derangiert aus. Ihr glänzendes schwarzes Haar fiel in langen Strähnen herab, die Enden ihres Obi flatterten im Wind.
Wo war sie so plötzlich hergekommen? Niemand war ihnen auf dem Versorgungsweg entgegengekommen, niemanden hatte er in den Wäldern gesehen, da war sich Archie sicher. Er hatte nämlich, um nicht wieder im Schlamm stecken zu bleiben, besonders gut auf den Weg vor sich geachtet.
Schon komisch, dass jemand in einem so ausgefallenen Aufzug durch die Wälder wanderte. Auch wenn Archie Japaner, die traditionelle Kleidung trugen, schon in Bly gesehen hatte. Vor Jahren.
Aber jetzt gab es keine Japaner mehr in der Stadt.
Das Seltsamste allerdings war der Ausdruck in ihrem Gesicht, die Art, wie sie ihn anlächelte. Durchtrieben. Hinterhältig. Angesichts dieses Lächelns blieben ihm seine Fragen im Halse stecken. Es hinderte ihn daran, etwas anderes zu tun als sie anzustarren.
Mehr von den weißen Sämlingen schwebten nun zwischen ihnen, wirbelten herum und umeinander, es wirkte spielerisch. Sie hob einen Finger und wies damit auf den Flaum. »Kumo«, sagte sie mit einer Stimme, die kaum mehr als ein Wispern war. Archie kannte das Wort nicht, war sich aber sicher, dass es das war, was sie gesagt hatte. Kumo.
Der Klang rufender Kinder riss ihn aus den Gedanken, und Archie wandte sich ab. Der kleine Edward – oder war es Sherman? – rief etwas in der Ferne. Er musste sich vergewissern, dass Elsie in Ordnung war, dass die Kinder nichts angestellt hatten.
Als er sich wieder umdrehte, war die Frau im Kimono verschwunden.
Für einen Augenblick hielt er inne. Er war verwirrt. Er sah auf die Stelle der Straße hinab, an der sie gestanden hatte, doch keine Fußspuren waren zu sehen. Der Matsch wirkte unberührt.
Ein Schauder rann ihm den Rücken hinab, gefolgt von einem kleinen schuldbewussten Zittern.
Dann brüllten die Jungen wieder los. Ihre Stimmen überschlugen sich vor Aufregung, und Archie musste sich auf sie konzentrieren.
»Was ist denn los?«, rief er, hob die beiden Körbe mit dem Picknick auf und ging auf den Waldrand zu.
»Wow!« Das war Joans Stimme.
»Liebling?« Jetzt sprach Elsie. »Wir haben etwas gefunden. Komm, sieh dir das an!«
Jetzt konnte er durch die Bäume hindurch ihre Gestalten erkennen, ebenso wie den Fluss weiter entfernt, schwarz und gewunden wie eine Schlange. Etwas Helles und Großes auf einer Lichtung, das auf dem Boden lag wie … außerweltliches Moos.
»Was ist das?«, rief Archie und lief schon.
Er konnte die Form des hellen Flecks nicht erkennen, dazu war er noch zu weit entfernt. Vielleicht ein Banner, das sich von einem Gebäude oder Lagerhaus gelöst hatte, vielleicht waren es sogar Bettlaken, die der Wind von einer Wäscheleine geweht hatte. Es wirkte verwittert, ein wenig angegraut und hatte sich ausgebreitet, was in dieser Wildnis seltsam anmutete.
»Ist das vielleicht eine Art Fallschirm?«, rief ihm Elsie über die Schulter entgegen.
Panik stach ihm wie ein Messer in die Brust. Er ließ den Kuchen- und Picknickkorb fallen. »Nichts anfassen!«
Vor ein paar Monaten war es in den Nachrichten gewesen: Irgendetwas von einem Fallschirm, der vom Himmel gefallen war und bei der Berührung der Hochspannungsleitungen eines Kraftwerks in der Nähe von Spokane Feuer gefangen hatte. Beinahe wäre das ganze Kraftwerk in Flammen aufgegangen, hätte man den Generator nicht kurzerhand vom Netz genommen. In den Nachrichten hatte es geheißen, es habe sich um einen Fallschirm gehandelt, Augenzeugen hatten aber etwas anderes berichtet. Einige fürchteten, es handele sich um eine unbekannte Kriegswaffe.
Archie würgte und blieb stehen. Irgendetwas, das im Wind dahin schwebte, war in seine Kehle geraten. Es sah wie Schnee aus, aber das konnte es nicht sein. Es war zu früh für Schnee, auch wenn es nicht das erste Mal gewesen wäre, dass es hier schon im November schneite. Vielleicht noch ein Sämling. Oder etwas ganz anderes. Asche? Er sah jetzt eine ganze Menge davon in der Luft, kleine Knäuel weißen Flaums, wie Löwenzahnsämlinge, nur kleiner. Aber im November gibt es keinen Löwenzahn. Auf einmal war er fasziniert. Er hob eine Hand, um einen der Samen einzufangen, doch der Wind wehte ihn davon.
Seine Hand schwebte noch in der Luft, als sich ein weiteres Stückchen weißen Flaums auf seine Wimpern legte. Es war dem Auge so nahe, dass er zunächst nur einen halb durchsichtigen Kreis wahrnahm. Eine Staubflocke.
Aber dann, als er sich darauf konzentrierte, bewegte es sich.
Es bewegte sich auf eine so seltsame Weise, als hätte es Arme. Diese Arme schlenkerten nach rechts und links, auf und ab. Mit eiskalter Klarheit wusste er plötzlich, um was es sich handelte.
Eine winzige, durchsichtige Spinne.
Der Schreck, der ihn durchfuhr, wurde von einem donnernden Krach unterbrochen.
Dann wurde er von einer Druckwelle erfasst und nach hinten gerissen, als wäre er von einer Kanonenkugel erfasst worden.
Archie war noch ein Junge gewesen, als auf der Farm seiner Eltern ein schrecklicher Unfall geschehen war. Sein Onkel Ronald war in einem Getreidesilo von einem Feuer eingeschlossen worden, das darin ausbrach. Es war ein Albtraum, das Innere des Silos hatte sich im Handumdrehen in einen Flammentornado verwandelt. Niemand hatte seinem Onkel zu Hilfe kommen, ihn aus dem Silo ziehen oder Wasser heranschaffen können, um das Feuer zu löschen. Er erinnerte sich an die Panik seiner Eltern, den Schock, in den das Ereignis alle versetzt hatte, auch die Farmhelfer, die herumrannten und schrien. Sie alle waren hilflos gewesen.
Es war ein schrecklicher Unfall. Damals hatten das alle gesagt.
Später, als die Nachbarn gekommen waren, um Archies Eltern zu trösten, hatte Archie, von dem alle glaubten, er läge im Bett, auf der Treppe gesessen und heimlich gelauscht. Er erinnerte sich daran, wie sein Vater darauf bestanden hatte, sein Bruder habe den Unfall selbst verschuldet. »Wahrscheinlich war er betrunken«, hatte er schon am Nachmittag bitter festgestellt. Archies Mutter hatte ihm bedeutet zu schweigen. Aber in dem Augenblick ergab das für Archie alles einen Sinn (aber vielleicht griff er hier auch nur nach Strohhalmen): Dass Onkel Ronald eines Tages einfach an die Tür geklopft hatte, ohne zu erwähnen, wo seine Frau war. Dass er auf der Couch eingeschlafen war und Archie ihn am nächsten Morgen, eingehüllt in eine Wolke von Alkohol, geweckt hatte.
»Er war ein Sünder. Und glaub mir: Die, welche sündigen, werden am Ende in den Flammen der Hölle braten«, hatte sein Vater an jenem Abend verkündet.
Grauen hatte Archie gepackt, ein Gefühl, als wäre er irgendwie verantwortlich dafür. Seine Mutter hatte das als ein Gefühl abgetan, das Christen offenbar manchmal überfällt. Du bist ebenein guter Junge. Eine anständige, christliche Seele.
Manchmal erinnerte sich Archie an diese Nacht als an den Anfang von irgendetwas. Den eines Feuers, das in ihm entflammt war. Seit Jahren versuchte er, anständig zu sein. Er widerstand Versuchungen und gab der Sünde nicht nach. Man konnte ihm nichts vorwerfen.
Doch all die Zeit über trug er ein schreckliches Geheimnis mit sich herum. Eine Schuld, die er sich nicht eingestehen konnte und im Keim ersticken wollte, sobald sie sich in ihm rührte.
Und schließlich hatte er Elsie gefunden. Sie war so tugendhaft, so rein, dass es ihm ein Leichtes war, in ihrer Gegenwart anständig und gut zu sein. Die Fehler der Vergangenheit, glaubte er, lagen nun endgültig hinter ihm.
Doch da hatte er sich geirrt.
Zitternd und bebend vor Schreck rappelte sich Archie aus dem Schlamm und den Wurzeln auf, kam schwankend auf die Beine und taumelte auf die dicke Qualmwolke zu, die vor ihm aufwallte. Es war, als hätte sich die Erde, auf der sie alle gestanden hatten, plötzlich geöffnet und als wäre ein Vulkan ausgebrochen. Er würgte Rauch brannte in seinen Augen. Wo waren sie denn alle nur?
Die bunten Gestalten, die er gerade eben noch gesehen hatte, Elsies weiße Strickjacke, das blaue Kleid des Patzke-Mädchens, das bunt karierte Hemd des Shoemaker-Jungen … das alles war aus seinem Sichtfeld verschwunden. Oder halt, nein, nicht verschwunden. Über den Boden verstreut. Wie Wäsche, die man achtlos in den Wind geworfen hatte.
Da wand sich jemand.
Jemand schrie. Kam das aus seiner eigenen Kehle?
Er rannte wieder los, stieg dabei über zwei weitere Kleiderbündel hinweg, eines, das um sich schlug und schrie, eines, das unheimlich still dalag. Aber er wäre über hundert brennende Kinder hinweggestiegen, um Elsie zu erreichen. Das war in der Tat seine größte Sünde, diese Verehrung für sie. Das war ein Stück Fegefeuer, das in ihm brannte.
Sie schrie und schlug um sich. Als wäre sie nicht menschlich.
Im nächsten Augenblick kniete er im Schlamm neben ihr. Neben dieser Kreatur, zu der seine Frau geworden war. Verwandelt von Feuer und Chaos in etwas anderes. Er riss sich die Jacke vom Leib und versuchte, die Flammen damit zu ersticken und sie am Boden festzuhalten. Lass mich dir helfen, schrie er heraus.
Aber ihr Gesicht war kein Gesicht mehr, sondern nur noch eine einzige Wunde: rot, fleischig, die Haut von den Muskeln gerissen. Ihre Lippen bewegten sich, aber er konnte nicht verstehen, was sie sagte.
Um sich herum hörte er Stöhnen. Der Schock lähmte ihn. Das alles war doch nicht wirklich.
Er war wieder eingetaucht, durch die Zeit in die Vergangenheit gereist, in die Nacht des Feuers, nur diesmal war es nicht sein Onkel, der im Zentrum des Geschehens stand und bei lebendigem Leib verbrannte, sondern Archie selbst.
Er wusste nicht, wie lange er dort schon kniete, keuchte und würgte und schrie, bis seine Kehle wund war. Wie lange er Rauch hustete und Blut, den brennenden Leib seiner Frau zu löschen versuchte, obwohl sie sich schon nicht mehr regte.
Schließlich legten sich Hände auf seine Schultern. Dunkel wurde er sich bewusst, dass es sich wohl um zwei Straßenarbeiter handelte, die die Dairy Creek Road heraufgekommen waren. Die starken Hände zerrten Archie über den Waldboden, fort von dem Explosionskrater, fort von dem immer noch brennenden Scheiterhaufen, in den der rätselhafte Fallschirm sich verwandelt hatte. Fort von den Kindern.
Fort von ihr. Seinem Leben, seiner Zukunft. Seinem Alles.
Kurz bevor er das Bewusstsein verlor, kam ihm ein Gedanke.
Das ist mein Schicksal. Meine Strafe.
Für diese schreckliche Tat, die er begangen hatte.
Er hatte geglaubt, vor ihr fliehen zu können, aber diese ganze Zeit hatte die Hölle mit weit aufgesperrtem Rachen nur auf ihn gewartet.
2
Camp Minidoka
Idaho
Der große Lkw rumpelte langsam durch die Lagertore. Die tiefen Spurrillen ließen die Karosserie wie eine schwer beladene Kuh hin und her schwanken. Meiko Briggs’ Blick blieb daran hängen, es war etwas Ungewöhnliches an diesem Lkw. Ständig kamen Lieferwagen mit allen möglichen Gütern ins Internierungslager, aber immer waren es zivile Fahrzeuge. Dieser Lkw hingegen war in einem trüben Olivgrün lackiert, auf dem man mithilfe von Schablonen überall die Aufschrift U. S. ARMY und weiße Ziffernkolonnen angebracht hatte. Über die Ladefläche hatte man eine Plane gespannt.
Als der Laster an diesem Morgen eintraf, brachte Meiko gerade ihre Tochter zur Schule. Ihr Blick folgte dem Wagen, der auf einer der selten benutzten Straßen auf eine Scheune zufuhr. Ein Schild an dieser Scheune besagte: LAGERINSASSEN IST DAS BETRETEN VERBOTEN. Die meisten Gebäude in Minidoka wurden von den Lagerinsassen benutzt, aber diese Scheune gehörte zum Territorium der Lagerverwaltung. Seit Kurzem hing auch ein Vorhängeschloss an den Toren. Wachen standen bereit, um die Gebäudetore zu schließen, sobald der Lkw im Inneren verschwunden war. Offenbar sollte niemand erfahren, was der Laster geladen hatte.
Natürlich fragte sich Meiko, was das sollte. Bisher hatte sich das Militär doch nicht um das Lager gekümmert.
Auch die Eingangstore zum Lager selbst schlossen sich nun, obwohl Meiko nicht begriff, warum das überhaupt passierte. Sie hätten genauso gut offen stehen bleiben können, und es war nicht so, als wären sie immer versperrt gewesen. Die Verfügung, aufgrund derer sie und weitere 10.000 Bewohner von Minidoka vor zwei Jahren hier interniert worden waren, würde wohl bald aufgehoben werden. In der letzten Zeit war die Freilassung der Insassen aus diesem Gefängnis das Gesprächsthema Nummer eins gewesen. Ein paar Bewohner machten sogar schon Pläne, das Lager zu verlassen. Zu voreilig, wie einige schimpften, und die meisten waren auch noch nicht so weit. Zwar verfolgten die Insassen von Camp Minidoka das Drama, das sich gerade vor dem Obersten Gerichtshof abspielte, durchaus gespannt, doch sie blieben weitgehend ruhig. Was sie in den karg eingerichteten Schlafräumen, diesen winzigen, staubigen und von Läusen verseuchten Baracken, hielt, war wirkungsvoller als die Wachen mit all ihren Gewehren.
Es war die Furcht vor dem, was hinter dem Zaun lauerte: der Hass ihrer amerikanischen Mitbürger.
Sie alle hatten schon Gerüchte über Japaner gehört, die in ihre Heimatstädte zurückgekehrt waren. Man hatte sie bedroht, ja, ihnen sogar Prügel angekündigt, wenn sie nicht fortzögen. Darüber hinaus waren viele der ehemaligen Häuser und Läden, die sie bewohnt und betrieben hatten, während ihrer Gefangenschaft einfach verkauft worden. Es gab sogar Fälle, in denen die Nachbarn, denen sie ihre Besitztümer anvertraut hatten – Nachbarn, die versprochen hatten, darauf achtzugeben, bis der Sturm sich gelegt hatte –, diese Habseligkeiten stattdessen verkauft hatten, in der Annahme, dass die rechtmäßigen Besitzer ohnehin nie zurückkehren würden.
Freunde und Bekannte hatten sich abgewandt – und dazu waren nur zwei kurze Jahre nötig gewesen. Diese Veränderung jagte so manchem einen Schauder über den Rücken.
Das Auftauchen des Armeelasters war so außergewöhnlich, dass er auch Aiko aufgefallen war. Sie beobachtete ihn mit vollem Körpereinsatz und riskierte sogar, sich auf die Zehenspitzen zu stellen, um einen eingehenderen Blick darauf werfen zu können, während er in der Scheune verschwand.
Das war kein gutes Zeichen. Ihr Kind benahm sich in der letzten Zeit zunehmend merkwürdig. Meiko hatte den Eindruck, dass es Angst vor allem hatte. Eigentlich nicht ungewöhnlich für ein Mädchen, das so viel durchgemacht hatte wie Aiko: zwei Jahre in einem Lager, das nicht viel besser war als ein Konzentrationslager, und ein Vater, der an der Front stand. Seit einiger Zeit war sie kaum mehr zurechtgekommen. Albträume, bizarre Geschichten. Sie behauptete Stimmen zu hören und Erscheinungen zu haben. »Machen Sie sich keine Sorgen, das ist bei allen Kindern so«, erklärte Mrs. Tanaka Meiko eines schönen Tages, während sie zusammen die Wäsche aufhängten. »Das ist nur eine Phase, Sie werden schon sehen.«
Meiko konnte nur hoffen, dass die Nachbarin recht hatte.
»Was gibt es denn da zu glotzen?« Die Stimme, die neben ihnen erklang, war so scharf wie ein Bajonett. Meiko zuckte zusammen, als sie den Sprecher erkannte. Man nannte ihn Wallaby oder so ähnlich; Aufseher nannten ihren Namen selbst nicht, das war eine Regel. Diesen hier mochte keiner der Insassen. Ständig machte er sich über sie lustig, zog die Augenwinkel mit den Fingern lang und nannte sie mit singender Stimme »kleine gelbe Männchen«. Er war bestimmt der Ansicht, dass die Insassen minderwertig waren, nicht bloß anders als Weiße, sondern dass ihnen tatsächlich etwas fehlte.
In ihrer Zeit in Amerika war Meiko zu dem Schluss gekommen, dass diese Ansicht purer Unsinn war. Es war nicht so, dass ihr der Glaube, eine Rasse sei allen anderen überlegen, fremd war. Das war er ganz bestimmt nicht, Japaner wurden nämlich auch in dem Glauben erzogen, sie seien bessere Menschen als andere. Aber in Japan gab es nur eine Rasse, ein Volk, da konnte man wenigstens nachvollziehen, warum es so gekommen war. Amerikaner hingegen setzten sich aus so vielen Völkern zusammen; eigentlich hätte man da glauben sollen, sie hätten sich mittlerweile aneinander gewöhnt. Wie enervierend musste es sein, ausgerechnet hier alle zu hassen, die anders waren!
Sie war allerdings zu klug, um diesem Aufseher das alles auseinanderzusetzen. »Wir gehen schon.« Sie bemerkte, dass Wachleute auch andere Insassen, die stehen geblieben waren, um dem Laster hinterherzusehen, auseinandertrieben und ihnen befahlen, sich davonzumachen.
Was den Laster noch ungewöhnlicher machte, war die Tatsache, dass es in letzter Zeit auch häufiger zu Besuchen von Regierungsmitgliedern gekommen war. Vor ein paar Wochen waren die ersten im Lager eingetroffen. Sie schienen gebildeter zu sein, sie kleideten sich besser als die Einheimischen hier in Idaho, sie drückten sich eloquenter aus. Sie fuhren nagelneue Autos zu einer Zeit, in der es schwer war, überhaupt eines zu bekommen, weil die Produktion ziviler Kraftfahrzeuge aus Kriegsgründen eingestellt worden war. Es musste einen besonderen Grund geben, dass diese Leute die Reise nach Minidoka angetreten hatten, doch dieser blieb ein Rätsel. Sie mieden die Bewohner des Lagers und wurden von der Lagerleitung darin unterstützt, die, wenn man sie danach fragte, nur verlauten ließ, dass es sich um Finanzberater handelte, die sicherstellen sollten, dass das Lager auch effizient und straff geführt wurde.
Meiko fragte sich, wie man diesen Laster wohl erklärte.
Die provisorische Schule war nicht weit von ihrer Schlafbaracke entfernt, trotzdem brachte Meiko ihre Tochter persönlich dorthin und holte sie auch wieder ab, wann immer es möglich war. In Minidoka bestand die Schule aus nicht mehr als ein paar handgezimmerten Tischen, die man in einen Stall gestellt hatte. Ein paar Lagerbewohner waren schon vor der Internierung Lehrer gewesen, aber der Hauptteil des Lehrkörpers bestand aus Insassen, die sich bereit erklärt hatten, alles zu lehren, was sie selbst noch aus ihren eigenen Schulzeiten wussten: Englisch, Mathematik, Biologie oder Chemie. Die Eltern hatten Sorge, ihre Kinder könnten den Anschluss verlieren und dass sie die hier verbrachten Jahre nie wieder würden aufholen können. Bildung war japanischen Eltern wichtig. Sie fürchteten, ihre Kinder würden nie aufs College gehen können. Dass ein unsichtbares Mal in ihre Lebensläufe gestempelt wäre und die Jahre in den Lagern eine Lücke darin wären.
Ihre Tochter hatte ihr einmal erzählt, dass sie immer allein zur Schule komme, während die meisten anderen Kinder in kleinen Gruppen ins Klassenzimmer gingen. Das hatte Meiko einen Stich ins Herz versetzt. Es gab tausend gute Gründe, warum das so war: So war ihre Tochter von Natur aus ein schüchternes Kind, aber Meiko konnte sich auch gut ein paar unfreundlichere Ursachen dafür vorstellen. Ihre Tochter war nur zur Hälfte Japanerin, wohingegen bei den meisten anderen Kindern im Lager beide Elternteile japanischer Abstammung waren. Japaner konnten ausgesprochen hochnäsig sein, was Rassereinheit betraf. Außerdem mochte Aiko die meisten Dinge nicht, die andere Kinder liebten: Comichefte und Radioshows beispielsweise. Sie war nicht auf Stars und Sternchen fixiert.
Und dann war da das unablässige Zeichnen. Selbst Meiko musste zugeben, dass Aiko Bilder malte, als wäre sie besessen. Es war schwierig, sie davon abzubringen, selbst zu den Mahlzeiten. Und die Kreaturen, die Aiko malte! Meiko wagte kaum sich vorzustellen, was sich die Lehrer wohl denken mochten. Aiko hatte mit Tieren und Feen und Prinzessinnen angefangen aus Märchen, die ihr Vater ihr am Abend zuvor vorgelesen hatte, das Übliche eben. Aber seit sie hier im Lager lebten, hatte sie angefangen, Kreaturen zu malen, von denen Meiko ihr vor dem Schlafengehen erzählt hatte. Es waren solche, von denen Meiko selbst von ihrem Vater in Japan gehört hatte.
Die Zeichnungen wurden immer furchterregender. Jeder, der sie betrachtete, fragte sich, ob diese Motive für ein Kind nicht unnatürlich waren.
Meiko ging in die Hocke, um ihrer Tochter in die Augen zu schauen. Sie zupfte Aikos verrutschten Kragen zurecht. »Viel Spaß heute. Gib dir Mühe. Und …« Sie zögerte und überlegte, ob sie den nächsten Teil wirklich aussprechen sollte. »… versuch, nicht zu viel zu zeichnen. Die Lehrer denken sonst, du hörst ihnen nicht zu.«
»Ich höre ihnen zu. Aber die Dämonen …« Aikos Stimme verebbte.
Meiko wusste, was ihre Tochter hatte sagen wollen. Aber die Dämonen wollen, dass ich auch ihnen zuhöre.
Ihre Tochter behauptete, dass ihr Dämonen folgten. Sie saßen in der Ecke des Schulzimmers und kicherten, wenn die Lehrer etwas erklärten. Sie sagten ihr, welche Lagerinsassen schlimme Dinge taten, wenn niemand hinsah, welche Kinder ihren Müttern Münzen aus dem Portemonnaie stahlen und welche Eltern abwarteten, bis alle zu Bett gegangen waren, um ihre Kinder zu züchtigen.
Die Dämonen, sagte Aiko, wüssten alles.
Mit weit aufgerissenen Augen starrte Aiko ihre Mutter an. »Mama, ich weiß, du willst nicht, dass ich über die Dämonen spreche, aber …« Sie wand sich. Sie hatte ein schlechtes Gewissen.
Sie versucht es. Sie ist wirklich ein gutes Kind. Seufzend fragte Meiko: »Na, was denn?«
»Mama, der Laster, den wir auf dem Weg zur Schule gesehen haben … Die Dämonen sagen, dass wir uns von ihm fernhalten sollen. Sie sagen, darin soll etwas ganz Schreckliches sein.«
Das war neu. Aiko hatte bisher keine Ängste gezeigt, die mit dem Lager, den Aufsehern oder den Verwaltern zu tun hatten, also mit allen, die ihr und Meikos Leben beherrschten, die aber im Großen und Ganzen die Kinder in Ruhe ließen. Glücklicherweise. Nein, Aikos Geschichten hatten sich auf die anderen Japaner und ihre sozialen Ängste beschränkt, also auf Dinge, die den Sorgen eines Kindes angemessen waren.
»Was sagen sie denn, was sich darin befindet?«, wollte Meiko wissen. Sie konnte sich nicht vorstellen, was an einer Lastwagenlieferung so ungewöhnlich sein mochte: zusätzliches Büromaterial zum Beispiel oder vollkommen alltägliche Waren. Vielleicht würde es helfen, wenn sie Aiko dazu brachte, sich ihren Ängsten zu stellen.
»Das haben sie mir nicht gesagt, nur dass wir uns davon fernhalten sollen. Dass das, was auch immer darin ist, einen sehr, sehr krank machen kann.« Ihre Stimme wurde zu einem Flüstern. »Sie sagten mir, dass schon bald etwas Schlimmes passieren wird. Sie sagten, wir würden nicht entkommen können, denn man würde uns zwingen hierzubleiben. Weil man will, dass wir hier eingeschlossen sind.«
Meiko drehte sich der Magen um. »Wer will uns denn hier einsperren?«
Aber Aikos Miene machte deutlich, wie sehr sie darum bat, dass ihre Mutter keine weiteren Fragen stellte.
Meiko spürte, wie das Blut aus ihrem Gesicht wich. Sie konnte kaum glauben, dass hier ihr Kind vor ihr stand, ihre normalerweise so fröhliche und folgsame Tochter. In Japan hatte Meikos Vater seiner Tochter Gruselgeschichten erzählt, wenn er ihr auf gutmütige Weise Angst hatte einjagen wollen. Aber dann hatte er sie gekitzelt oder etwas anderes getan, um die Spannung wieder aufzulösen, um klarzumachen, dass alles nur gespielt war.
Hier jedoch half ihr niemand bei ihrer Tochter. Nicht einmal Jamie, ihr Mann, war noch an ihrer Seite. Jamie, der normalerweise fürs Kitzeln, für die Küsse und die Sicherheitsbeteuerungen zuständig war.
In diesem Augenblick trat einer der Lehrer vor die Tür, ließ die große Silberglocke ertönen und rief die Kinder so ins Klassenzimmer. Aiko rannte zu den anderen Kindern, bevor Meiko etwas Passendes hätte einfallen können.
Der nächste Weg führte Meiko zur Küche. Sie hatte an diesem Tag eine Schicht. Sie ging zu ihrem Arbeitsplatz, wo bereits jemand einen Stapel Gemüse abgestellt hatte, den sie zu putzen und klein zu schneiden hatte. Kartoffeln, Rüben und Möhren. Der harten Prärieerde eine Ernte abzutrotzen stellte den Fähigkeiten der Landwirte unter den Lagerinsassen ein hervorragendes Zeugnis aus. Es waren Männer und Frauen, die große kommerzielle Farmen in Oregon und dem Staat Washington betrieben hatten. Es glich einem Wunder, dass sie in der Lage waren, auf den steinigen und trockenen Feldern überhaupt irgendetwas wachsen zu lassen.
»Meiko, was ist los? Du siehst ja aus, als hättest du einen Geist gesehen.« Mayumi Seiko schnitt gerade einen Rettich klein, um ihn einzulegen. Sie war die Person in der Küchenmannschaft, die am offensten sprach. Für eine Japanerin war sie erstaunlich ehrlich. Auf der anderen Seite musste sich Meiko ständig daran erinnern, dass die meisten der hier Gefangenen nisei waren, in Amerika Geborene, keine gebürtigen Japaner, also issei, wie sie selbst.
Sie ließ die Karotten in einen Eimer mit Wasser gleiten. »Ein Armeelaster ist gerade eingetroffen.« Sie erwähnte aber nicht, was Aiko darüber gesagt hatte. Ein paar der Insassen hielten ihre Tochter jetzt schon für ein wenig seltsam.
»Vielleicht haben sie Soldaten geschickt.« Patsy Otsuka schob sich eine Locke aus der Stirn. Jeden Morgen drehte sie sich die Haare auf, um wie Betty Grable auszusehen. »Oder es handelt sich um medizinisches Personal, um bei der Seuche zu helfen.«
Die Seuche. Das war der einzige Name für die Krankheit, die seit ein paar Wochen im Lager wütete. Niemand wusste, um was für eine Krankheit es sich dabei handelte, am ehesten ließ sie sich mit einer Art Grippe vergleichen oder einem Fieber. Den einen traf es schwerer, den anderen leichter, einige hatten bloß Fieber, andere sogar Schüttelfrost und Schweißausbrüche, wieder andere klagten über Kopfschmerzen, die so schlimm waren, dass sie weder Licht noch Lärm aushielten, doch es war unleugbar ansteckend. Ganze Schlafbaracken wurden über Nacht krank. Brach in einer Baracke die Krankheit aus, war es nur eine Frage von Tagen, bis die Gebäude links und rechts davon ebenfalls betroffen waren. Meist blieben die Leute mit Fieber im Bett und übergaben sich, aber die Krankheit schlug auch aufs Gemüt, ließ die Menschen aggressiv und streitsüchtig werden, ja, sogar gewalttätig. Immer wieder brachen Prügeleien unter den Insassen aus, manchmal griffen sie sogar die Aufseher an. Dann brachen Schädel unter den Schlagstöcken, Männer wurden in provisorische Arrestzellen geworfen.
Vor der Seuche hatte man keine gebraucht.
Die Leute hatten Angst vor der mysteriösen Seuche, keiner wollte sich anstecken.
Kein Wunder, dass Aiko sagte, die Dämonen hätten sie gewarnt, dass die Leute ziemlich krank werden würden. Keiner war bislang an dieser Krankheit gestorben, jedenfalls hatte Meiko nichts dergleichen gehört. Aber die Seuche war allgegenwärtig.
Die Kinder sprachen untereinander bestimmt auf ihre eigene Weise davon, sicher hatten sie eine Todesangst davor, dass ihre Eltern ihnen genommen werden könnten. Wahrscheinlich konnten sie an gar nichts anderes mehr denken.
Das arme Kind war sicherlich überwältigt und versank in Angst.
»Wenn sie medizinische Hilfe geschickt haben, dann … nun, halleluja! Das wird auch Zeit«, murmelte Hirojo Kubo. Er zerhackte gerade Hühner an einem Tisch, der im hinteren Teil der Küche stand, abseits von den anderen. Wieder knallte es dumpf, als das Hackbeil auf der dicken Holzplatte niederging. »Der Lagerarzt ist doch zu nichts nutze. Er war überhaupt keine Hilfe. Die kümmern sich nicht darum, dass wir krank werden. Wir sind doch nur Japaner.«
»Die tun so, als wäre das unser Fehler.« Das war wieder Mayumi. »Ich habe sogar eine der Wachen sagen hören: ›Was sollte man von einem Haufen schmutziger Japaner denn auch sonst erwarten?‹«
Sie alle hatten gehört, dass man Ähnliches über sie sagte, auch schon damals in Seattle, vor der Zeit hier im Lager. Dabei hätte man in den meisten japanischen Häusern vom Boden essen können.
Nicht dass die Leute draußen jemals den Begriff »Japaner« verwendet hätten. Allerdings brachte es keiner der Lagerinsassen über sich, das Wort »Japse« auszusprechen.
»Es ist ja auch nicht so, als würden die Aufseher nicht ebenfalls krank werden«, flüsterte Patsy halblaut. Sie schnitt die Rüben klein und hatte den Blick starr auf das Messer gerichtet, während sie das Gemüse in akkurate kleine Würfelchen schnitt. »Aber man schickt sie fort, sobald sich die ersten Symptome an ihnen zeigen.«
»Das geschieht, damit sich die Krankheit nicht ausbreitet.« Das war Rei Sugimoto. Sie stand etwas abseits und rieb gerade Fischfilets mit Salz ein. Rei war wie viele Japanerinnen eine ausgleichende Person. Sie sprach niemals schlecht über andere und machte immer den Eindruck, als hätte man sie dazu erzogen, stets nur das Beste von anderen zu denken.
»Ach bitte.« Mayumi rollte mit den Augen. »Wenn einer von ihnen krank wird, kümmern sie sich auch um ihn. Wenn es einen von uns erwischt: Pech gehabt.«
Meiko griff nach einem Sparschäler und begann, die Karotten zu schälen. »Ich werde mich mal bei Ken danach erkundigen. Vielleicht weiß er mehr.«
Im Raum wurde es still, und Meiko wurde bewusst, dass sie einen Fehler gemacht hatte. Ein paar Frauen warfen ihr schiefe Blicke zu. Kenzo Nishi war einer der Anführer innerhalb des Lagers, man hatte ihn zu einem der Sprecher der Gemeinschaft und zum Verbindungsmann zur Lagerverwaltung gewählt. Sie hätte behaupten können, dass es durchaus Sinn ergab, mit einer solchen Frage zu ihm zu gehen, aber alle vermuteten, dass da mehr zwischen ihr und Ken vor sich ging. Auch wenn beide verheiratet waren: Kens Frau lebte mit ihm hier in Minidoka, Meikos Ehemann Jamie war Kampfpilot an der Front im Fernen Osten.
Wenn man die wahre Natur ihrer Verbindung zu Ken geahnt hätte … Immerhin war Ken im Lager respektiert. Sie dagegen wurde schon jetzt von allen verachtet, weil sie mit einem Weißen verheiratet war. Es gab Leute, die machten einen großen Bogen um sie, wenn sie sie auch nur von Weitem erblickten. In der Kirche warf man ihr böse Blicke zu. Man nahm an, sie glaubte von sich selbst, sie sei etwas Besseres.
Wäre bekannt geworden, was wirklich zwischen ihr und Ken vorging, all diese Leute hätten sie nur noch mehr gehasst.
Am Nachmittag, als die Vorbereitungen für die Abendmahlzeit abgeschlossen waren, machte sich Meiko auf den Weg, um Aiko von der Schule abzuholen.
Es war schon spät, die Sonne sank bereits auf den Horizont zu, als sie die Straße überquerte, auf der man zu der Scheune gelangte, in der der Laster heute Morgen verschwunden war. Die Menschen bereiteten sich auf den Abend vor, viele Mitarbeiter der Lagerverwaltung waren bereits nach Hause gegangen, zu ihren Familien im nahe gelegenen Jerome. Beinahe niemand war mehr da, auch die Aufseher nicht. Die paar Leute, die jetzt noch unterwegs waren, waren in der Dämmerung nur schwer auszumachen. Meiko bezweifelte, dass man sie bemerkt hätte, hätte sie sich jetzt zu der Scheune geschlichen.
Den ganzen Nachmittag über hatte sie darüber nachgedacht, wie es ihr gelingen könnte, einen Blick auf die Ladung des Lasters zu werfen. Dann hätte sie Aiko mit einiger Überzeugung versichern können, dass ihre Dämonen sich geirrt hatten. Und dass es in der Realität gar keine Dämonen gab, dass diese nichts weiter waren als Ängste, die nur in der Fantasie ihrer Tochter existierten. Sie waren ihre Erfindung. Ja, die Lagerinsassen wurden krank, aber das war der ganz natürliche Lauf der Dinge und bedeutete nicht, dass irgendjemand sterben würde. Vielleicht würde das dem armen Mädchen helfen.
Im Augenblick war dies der einzige Trost, den sie ihrer Tochter geben konnte.
Die Tore der Scheune waren mit einem Vorhängeschloss gesichert, aber das Gebäude hatte Fenster. Sie schlich sich zu einem an der Nordseite. Zuerst spähte sie hinein, um sicherzugehen, dass sich niemand im Inneren aufhielt, aber es brannte kein Licht. Also war sie ziemlich sicher, dass die Scheune leer war. Sie versuchte, das Schiebefenster zu öffnen, es gab nach, blieb aber nach ein, zwei Zentimetern doch stecken. Sie wollte schon aufgeben, aber dann entschied sie, nicht so einfach das Handtuch zu werfen. Sie versuchte es ein zweites Mal. Wenn es sich schon so weit geöffnet hatte, dann war es wahrscheinlich gar nicht von innen verschlossen. Es klemmte nur, völlig verständlich bei dieser eisigen Kälte. Nach ein paar anstrengenden Minuten hatte sie das Fenster so weit geöffnet, dass sie sich durch den Spalt quetschen konnte.
Außer dem Laster befand sich nicht viel im Inneren der Scheune. An einer Wand waren lange Regale angebracht, auf denen sich Metallschatullen und Holzkisten stapelten. Die Holzkisten waren zugenagelt, auf die Deckel hatte man die Warnung GEFAHRGUT gepinselt. Meiko fragte sich, was sich wohl darin befand. Sprengstoff? Welche gefährlichen Güter würde man in ein Lager bringen, in dem es Kinder gab?
Die Metallschatullen waren nicht verschlossen, sondern nur mit einfachen Schnallenschlössern versehen. Sie öffnete eine Kiste und zog eine Gasmaske heraus. Gasmasken. Vielleicht war das mit dem Gift gar nicht so weit hergeholt. In einer zweiten befanden sich chirurgische Kleidung und stapelweise weiße Baumwollhandschuhe. In wieder anderen entdeckte sie Verbandsmull, Watte, Alkohol zum Desinfizieren und Äther. Hauptsächlich medizinische Ausrüstung. Vielleicht handelte es sich tatsächlich um medizinische Hilfsgüter. Aber wenn das der Fall war, warum waren die Materialien dann nicht schon längst verteilt worden? Warum hatte man keine zusätzlichen Krankensäle errichtet? Und warum schickte man Gasmasken?
Vielleicht gab es einen Grund, warum man nicht wollte, dass die Lagerinsassen erkannten, was da geliefert worden war. Einen Grund für die Wachsamkeit und die Vorhängeschlösser.
Als Nächstes wandte sie sich dem Lkw zu. Sein Kennzeichen stammte aus Kalifornien, mit weißer Farbe waren mittels Schablonen die Worte U. S. ARMY und ein paar Seriennummern auf die Seite aufgetragen worden. Der Laster selbst war staubig und sah aus, als hätte er einen langen Weg hinter sich. Die Karosserie lag ziemlich hoch über der Straße. Meiko schaffte es nicht, sich auf die Ladefläche zu ziehen, also zerrte sie eine Kiste aus einer Ecke vor die Rückseite des Lkws und kletterte dann mithilfe dieser über die Heckklappe.
In der Scheune war es ziemlich dunkel, also schlug sie die Plane so weit auf, wie sie konnte, damit etwas mehr Licht auf die Ladefläche fiel. Überraschenderweise war diese beinahe vollkommen leer, mit Ausnahme von etwas, das wie eine Plane aussah, mit der man sie ausgelegt hatte. Sie ging in die Knie, um das näher zu untersuchen. Als sie darüber strich, wusste sie sofort, dass es eigentlich keine Plane war. Es war auch keine Leinwand. Das Material erinnerte sie an etwas aus ihrer Kindheit, etwas, das sie in Japan ständig benutzt hatte: Reispapier. Nur dass es steifer und schwerer war als das Zeug, aus dem sie damals Grußkarten oder elegante Kimonos für ihre Puppen gebastelt hatte. Außerdem fühlte es sich auch gröber an. Sie hatte keine Ahnung, wozu man Papier dieser Art brauchen konnte.
Darüber hinaus war es verwittert. Sie konnte es nicht genauer in Augenschein nehmen, weil die Scheune nur wenige Fenster hatte und das Tageslicht zunehmend verschwand, aber sie erkannte durchaus, dass es den Elementen ausgesetzt gewesen war. Außerdem war es hier und da verkohlt, als hätte es Feuer gefangen. Dieses große Stück Reispapier war riesiger, als sie je eins gesehen hatte, und es hatte ganz offenbar einiges hinter sich. Sie zerbrach sich den Kopf, was um alles in der Welt damit wohl passiert sein konnte. Sie wollte schon wieder von der Ladefläche herunterklettern, als sie auf der Unterseite des Papiers etwas entdeckte, das Schrift ähnelte. Es war allerdings zu dunkel, um tatsächlich ausmachen zu können, was darauf stand, doch ihrer Ansicht nach sah es wie japanische Schriftzeichen aus. Der akkurate Druck der Zeichen erinnerte sie an offizielle Regierungsdokumente, die sie in den Papieren ihres Vaters gefunden hatte. Die Zeichen dort hatten die gleiche Form und den gleichen Raum eingenommen. Sorge stieg in Meiko auf. Das liegt nur am Anblick der Zeichen, sagte sie sich, daran, dass sie etwas sah, das sie an Japan erinnerte. Aber sie hatte auch das Gefühl, dass sie etwas vergessen hatte und als ob dieses Papier auf der Ladefläche sie daran erinnerte. Es zupfte an ihren Gedanken, wollte sich einen Weg aus ihrem Unterbewussten bahnen, aber es war kaum mehr als der Schatten einer Erinnerung.
Und das Gefühl war nicht gut. Genauso wie die Dämonen behauptet hatten.
Sie versuchte, das Gefühl abzuschütteln. Es gab keine Dämonen, nur die zerrütteten Nerven eines kleinen Mädchens.
Wenn dieses Papier der japanischen Regierung gehört hatte, wie war es dann in den Besitz des US-Militärs gelangt? Natürlich hätte es aus dem Kriegsgebiet stammen können, doch wenn es sich so verhielt, warum sollte man es dann in ein Kriegsgefangenenlager mitten in der nordamerikanischen Prärie verfrachten? Gab es an der Küste nicht über ein Dutzend Militärbasen? Es ergab doch viel mehr Sinn, es an irgendeinem sicheren Ort aufzubewahren – an einem Ort, an dem es Leute gab, die dazu ausgebildet waren, solche Dinge zu analysieren.
Widerwillig entschloss sie sich, das Rätsel in dem Laster sich selbst zu überlassen, kletterte durch das Scheunenfenster nach draußen und sprang auf den Boden. Sie wusste, sie konnte nicht länger bleiben: Aiko war bestimmt schon von der Schule zurück. Sie wollte nicht, dass ihre Tochter länger allein blieb als unbedingt notwendig.
Aiko saß bereits auf dem Bett, als sie nach Hause kam, vor sich einen aufgeschlagenen Notizblock. Glücklicherweise kam das Mädchen gut allein zurecht. Vielleicht war das ja ein Nebenprodukt ihres Daseins als Einzelkind.
»Na, wie war die Schule heute?«, fragte Meiko und hängte ihre Jacke auf. Ihre Erkundungstour durch die Scheune schob sie erst einmal beiseite.
»Gut. Wir haben Multiplizieren gelernt.« Mathematik war nicht gerade Aikos Lieblingsfach, aber sie war ganz gut darin. Überhaupt konnte sie vieles gut. Sprachen zum Beispiel: Sie hatte Japanisch gelernt, eine Sprache, die als Fremdsprache schwer zu meistern war. Und Kunst: Japanische Fantasiedämonen konnte sie zeichnen. Aiko verstand es aber auch, jedes Foto oder Gemälde aus dem Gedächtnis heraus zu kopieren. Doch so stolz Meiko auf die Talente ihrer Tochter auch war, sie wollte, dass das Mädchen sich zusammenriss. Das Zeichnen würde ihr keine Rechnung bezahlen, wenn sie einmal älter war. Meiko wollte, dass man ihre Tochter gern einstellte, dass sie in der Lage wäre, sich selbst zu erhalten und nicht auf einen Mann angewiesen zu sein, wenn es darum ging, sich ein Dach über dem Kopf leisten zu können.
So war Meiko erzogen worden. Und nun konnte man sehen, wohin das führte.
»Musst du nicht noch Hausaufgaben machen?« Es waren noch ein paar Stunden bis zum Abendessen im Speisesaal. Ein japanisches Abendessen und ein amerikanisches für die nisei-Kinder, die die seltsamen Dinge nicht essen mochten, die ihren Eltern schmeckten.
»Ich muss noch ein Kapitel für Geschichte lesen.« Amerikanische Geschichte war ironischerweise die einzige Geschichte, die in der provisorischen Schule des Lagers gelehrt wurde. Nicht die Weltgeschichte, geschweige denn – um Himmels willen – auch nur ein Wort über das Land ihrer Vorfahren, Aikos Großeltern. Das Land, mit dem wir im Krieg liegen. Meiko verdrängte den letzten Gedanken, sie war es müde, mit dieser Realität, mit der unglücklichen Wendung zu hadern, die ihr Leben genommen hatte. Als ihr Vater sie vor Jahren nach Amerika geschickt hatte, um zu heiraten, hätte sie niemals vermutet, dass ihre beiden Länder jemals gegeneinander Krieg führen würden.
»Dann fang besser jetzt damit an, solange es noch hell genug ist.« Die Beleuchtung in den Schlafbaracken reichte nicht aus, um zu lesen: Nur nackte Glühbirnen hingen von der Decke herab. Als man sie vor Jahren aus ihren Häusern geholt und in Eisenbahnwaggons und Busse gedrängt hatte, hatte natürlich niemand daran gedacht, Lampen mitzunehmen.
Meiko widmete sich ihrer Hausarbeit, während Aiko las. Hier im Lager kämpfte man unablässig mit dem Staub, den der Wind von der Prärie hereinblies. Der Staub kroch durch die Ritzen der hastig hochgezogenen Wände und legte über die gesamte Einrichtung eine Decke aus feinem, hellem Sand, deren man nicht Herr werden konnte. Doch Meiko ging methodisch vor, sie schüttelte die ordentlich zusammengelegte Kleidung aus und staubte die Regale ab, die aus Brettern und Holzbohlen zusammengezimmert waren.
Während sie putzte, fragte sie sich zum tausendsten Mal: Wie war sie hier nur gelandet? Gerade das Militär hätte sie davor schützen müssen, hierher verschickt zu werden. Man hätte doch glauben sollen, die Tatsache, dass ihr Mann als Soldat diente – sogar als Pilot, was ein wichtiger Job zu sein schien, nach dem Theater, das man darum machte –, hätte etwas zu bedeuten. Mit so wenig Würde behandelt zu werden war eine Beleidigung. Sie hatte gehört, dass die weißen Frauen der Airforce-Piloten in hübschen Häusern auf den Stützpunkten lebten. Ihr hatte man ein solches Angebot natürlich nicht gemacht. Man ließ sie nicht vergessen, dass sie weniger wert war als eine weiße Frau.
Nun, da die Verordnung 9066 aufgehoben war, hätten sie und Aiko das Lager verlassen können, vorausgesetzt es hätte sich jemand gefunden, der eine Bürgschaft für sie übernahm. Jamie wusste das, hatte aber noch nicht angeboten, seine Eltern zu bitten, das zu tun. Sie lebten irgendwo im Staat Washington. Meiko hatte noch nie ein Foto von ihnen gesehen, geschweige denn sie getroffen. Sie wusste, dass es böses Blut zwischen ihrem Mann und seinen Eltern gab. Jamie hatte sein Elternhaus verlassen, kaum dass er die High School abgeschlossen hatte, hatte mit ihr aber nie darüber gesprochen. Aiko hatte die Hoffnung, oder eher die Fantasie eines Kindes, dass ihre Großeltern sie eines Tages retten würden, dass sie plötzlich in Minidoka auftauchen, sie in die Arme nehmen und sie in ein Haus mit einem weißen Vorgartenzaun darum herum einquartieren würden. Meiko verstand, worum es dabei eigentlich ging: Das Kind sehnte sich nach Sicherheit, nach einem Ort, an dem es sich immer geborgen fühlen konnte. Aber Meiko wusste instinktiv, dass die Briggs nicht kommen würden. Sie würden ihr niemals helfen. Ironischerweise wäre Geborgenheit etwas gewesen, das ihr anderer Großvater in Japan ihr eher hätte geben können. Er hätte sich gefreut, seine Enkelin kennenzulernen, die einzige Tochter seiner einzigen Tochter. Aber da waren der Krieg und Tausende Meilen von Ozean, die sie trennten. Es war unmöglich und würde aller Wahrscheinlichkeit nach nicht passieren.
Nach dem Abendessen im Speisesaal brachte Meiko Aiko auf einem Umweg nach Hause in die Wohnbaracke. Sie gab vor, sie wolle ein wenig frische Nachtluft schnappen, aber in Wahrheit wollte sie etwas überprüfen. Und ihre Neugier befriedigen.
Langsam schlenderten sie den Pfad zum Lagertor entlang, an den Verwaltungsgebäuden vorbei, zum Wachhäuschen. Das Tor war um diese Zeit natürlich geschlossen, auch wenn die Flutlichter wie immer angeschaltet waren. Sie beleuchteten die Straße, die von der Stadt herführte, auch wenn in der Nacht niemand das Lager besuchte. Meiko nahm an, dass es sich um eine Vorsichtsmaßnahme handelte, für Notfälle, die bisher nie eingetroffen waren.
Gott sei Dank.
Aber jetzt, im hellen Licht, sah Meiko – zum ersten Mal, soweit sie sich entsinnen konnte –, dass das Tor nun zusätzlich mit Ketten gesichert war. Man hatte sie durch die Gitterstäbe geschlungen, sie bestanden aus langen Bändern von festen, dicken Stahlgliedern.
Und um das Bild zu vervollständigen, als wollte man keinen Zweifel lassen, worin der Zweck dieser Ketten bestand, waren sie mit einem großen, solide aussehenden Vorhängeschloss gesichert.
3
Ogallala, Nebraska
Fran Gurstwold erwachte im Dunkeln. Ihr war plötzlich eiskalt. Ihr Kopf schwamm, sie befand sich nicht in ihrer Wohnung. Furcht schnürte ihr mit einem Mal die Kehle zu. Die Luft fühlte sich anders an, roch nach verbrannten Blättern und Rauch. Für einen Augenblick fragte sie sich, ob man sie entführt hatte oder ob das vielleicht eine Art unheimlicher Wachtraum war.
Dann fiel ihr Blick auf Richard, der neben ihr schlief. Ein Bein lag außerhalb der Decke. Sie seufzte. Sein muskulöser Rücken hob und senkte sich. Hinter ihm stand eine offene, beinahe leere Flasche billigen Merlots, zwei leere Gläser waren im Halbdunkel daneben zu erkennen. Richtig. Lake Ogallala. Die baufällige kleine Hütte, die dem Freund eines Freundes gehörte. Weit genug von allem entfernt, sodass niemand davon erfahren musste. Weit genug entfernt, Winnie würde nichts mitbekommen.
Das erklärte die unangenehme Stille. Sie ließ sich wieder auf das klumpige Federkissen fallen und atmete durch, um ihren Pulsschlag zu beruhigen. Dabei kam nach und nach der Abend zuvor in ihr Gedächtnis zurück: das hastige Ausziehen, der Schweißfilm auf der Haut, die hungrige, beinahe panische Art, in der Richard und sie immer miteinander vögelten, als stünde die Welt kurz vor dem Untergang. Immerhin war das ja schon der Zweite Weltkrieg. Sie hatte nicht gewusst, dass die Welt mehr als einen aushalten konnte. Und vielleicht stellte sich heraus, dass das auch nicht der Fall war.
Sie hatte Kopfschmerzen, Schlaf konnte sie vergessen. Sie rollte herum, griff nach der Flanelljacke, die sie mitgebracht hatte – Richard hatte sie gewarnt, dass es am See kalt werden könnte –, und warf sie über den neuen BH, den Doppel A mit der Seidenspitze, dann fuhr sie sich mit der Hand durch ihr zerzaustes Haar.
Fran war eigentlich der Ansicht, dass sie als ziemlich hübsch galt. Nur hatte sie leider ein Gesicht, das, so hatte ein Pflegevater es früher einmal ausgedrückt, Männer dazu reizte hineinzuschlagen. Das war eins der Dinge, die man als Waise zu oft zu hören bekam. Augen, die nicht der Rede wert waren, ein breiter Kiefer, eine Oberlippe, die immer kurz davorstand, höhnisch zu lächeln. Ihr Haar war alles andere als damenhaft, eher so struppig wie das einer Ratte. Aber viel schlimmer als ihr Aussehen war ihr Verstand. Diese morbide Neugier, ständig diese Besessenheit, was Details anging. Ihre Unfähigkeit, etwas zu vergessen, egal ob gut oder schlecht. Aber besonders das Schlechte.
Und auch jetzt hatte sie ein schlechtes Gefühl im Magen. Eine Leere. Ruhelos schlich sie auf Zehenspitzen durch die still daliegende Hütte, hielt kurz bei ihrer Handtasche an, um ihre Zigaretten und das Feuerzeug herauszunehmen, und ging auf die Veranda hinaus.
Sie klopfte eine Zigarette aus dem Päckchen und zündete sie an. Hier draußen war es eiskalt, die Wärme des Holzofens reichte nicht bis hierher, auf ihren nackten Beinen hatte sich auf der Stelle eine Gänsehaut gebildet. Aber Richard mochte Zigarettenrauch nicht, weil der in der Kleidung hängen blieb und seine Frau später misstrauisch werden ließ. Dabei kamen sie nicht oft dazu, so zu tun, als wären sie ein Paar. Normalerweise trafen sie sich in einem Hotel ein paar Querstraßen von der Redaktion entfernt, aber das war ziemlich riskant. Ein- oder zweimal hatten sie sich mit dem Rücksitz seines großen Autos begnügt, eines Chevrolet Fleetline, den sich Richard 1941 gekauft hatte, kurz bevor die Produktion ziviler Fahrzeuge aus Kriegsgründen eingestellt worden war.
Bei ihr trafen sie sich nie: Er weigerte sich, in ihre Wohnung zu kommen, und das war ihr auch recht. Sie verbrachte so wenig Zeit wie möglich zu Hause, sie hasste diese ständig verstopften Abflussrohre, den immerzu in der Luft liegenden Geruch leerer Suppendosen, die auf dem Boden verstreuten Papierknäuel und Klamotten. Ihr Kater Marcel war schon verrückt geworden, weil er den ganzen Tag allein in dieser Wohnung verbringen musste. Sie hatte ein schlechtes Gewissen, weil sie ihn so oft allein ließ, aber ihr gefiel der Gedanke, dass sie beide den Wunsch nach Einsamkeit teilten.
Sie zog an der Zigarette und lehnte sich an das Geländer. Sie versuchte immer noch, den Aufruhr, den die Furcht in ihrer Brust bewirkte, zu glätten. Die Dunkelheit hier draußen war vollständig und duftete nach winterlicher Frische. Ganz anders als zu Hause, wo die Straßenlaternen brannten und die Abgase der vorbeifahrenden Autos in der Luft hingen. Die Nacht fühlte sich lebendig an und erregte sie auf eine nervöse Weise. Sie ließ den Blick über die unregelmäßige Silhouette des Waldes gleiten. Ob sie das Knacken eines Zweigs wohl hören würde, bevor es zu spät war?
Aber das war sicher nur paranoid. Der See war um diese Jahreszeit verlassen. Am Samstag waren sie eine Weile am Ufer entlangspaziert, aber der Wind über dem Wasser war bitterkalt und nach einer Viertelstunde hatten sie aufgegeben. Es war außerhalb der Saison und schwer, einen Platz zum Picknicken zu finden, zudem war Fran eine miserable Köchin. Sie ernährten sich hauptsächlich von Keksen, Käse und Salami und tranken Bier aus Flaschen, die in einem Cooler auf der Veranda standen. Die Bierflasche in der einen Hand, hatte er ihr mit der anderen eine Haarsträhne aus der Stirn gestrichen und gelacht, als sie sich über einen Widerspruch im Chicagoer Stil-Leitfaden aufgeregt hatte. Bei Einbruch der Dunkelheit hatte sie ein Stoßgebet gesprochen, dass all der Müll keine Bären anlocken möge.
Sie klopfte die Asche über das Geländer hinweg ab und nahm noch einen Zug. Ihre Gedanken sprangen in die nahe Zukunft. Die nächsten Wochen würden schwierig werden. Thanksgiving, Weihnachten, dann Silvester. Alle würden sich gegenseitig erzählen, was sie zu Weihnachten unternahmen, mit wem man die Zeit verbrachte, wohin man fuhr. Man würde darüber schimpfen, wie anstrengend die Fahrten an die Ostküste waren oder wie lästig es sei, all die Verwandten beherbergen zu müssen. Klagen dieser arroganten, taktlosen Art, wie Menschen sie so oft von sich gaben.