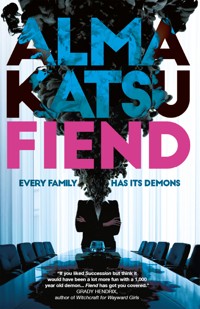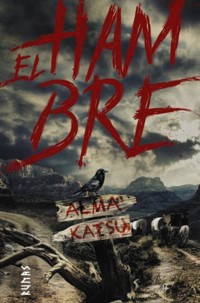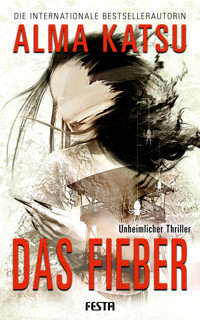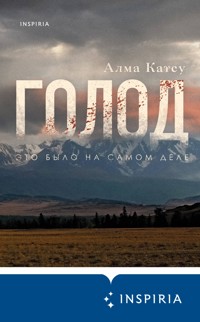5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Etwas Übernatürliches sucht die Titanic heim. Das ist die einzige Erklärung für die unheimlichen Ereignisse auf der Jungfernfahrt des Ozeandampfers. Viele der Passagiere sind überzeugt: Es ist etwas Jenseitiges an Bord. Doch bevor man mehr herausfinden kann, geschieht, wie man weiß, die wahre Katastrophe. Vier Jahre später, der Erste Weltkrieg hat begonnen, versucht Annie Hebbley, die jene schicksalhafte Nacht überlebt hat, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Sie dient als Krankenpflegerin auf dem Schwesternschiff der Titanic, der Britannic, die gerade zum Lazarettschiff umgerüstet wurde. Verfolgt von den Albträumen der ersten Reise, stößt Annie unter den Patienten auf einen bewusstlosen Soldaten. Sie erkennt den jungen Mark Fletcher. Er war ebenfalls auf der Titanic. Aber sie ist sich sicher, dass er den Untergang nicht überlebt hat ... Alma Katsu verwebt die wahren Schicksale der beiden berühmten Schiffe zu einer erschreckenden Geistergeschichte. Phänomenal. C. J. Tudor: »Durch und durch fesselnd und absolut erschreckend.« Daily Mirror: »Der Roman verknüpft Psychothriller und unheimliche Geistergeschichte zu einem wahrhaft gespenstischen Werk.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 627
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Aus dem Amerikanischen von Heiner Eden
Impressum
Die australische Originalausgabe The Deep
erschien 2020 im Verlag G. P. Putnam’s Sons.
Copyright © 2020 by Alma Katsu
Copyright © dieser Ausgabe 2024 by Festa Verlag GmbH, Leipzig
Diese Ausgabe erscheint mit Genehmigung von G. P. Putnam’s Sons,
ein Unternehmen von Penguin Random House LLC
Titelbild: @difrats
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-98676-115-8
www.Festa-Verlag.de
Dem Andenken an die Seelen gewidmet,
die den tragischen Untergängen der Titanic
und der Britannic zum Opfer gefallen sind.
Einen Moment lang fühlt sich der Sturz wie etwas ganz anderes an – wie ein flüchtiger, wilder Eindruck von Freiheit.
Doch die Oberfläche kommt zu schnell. Sie zerschellt an ihrer Haut – eine Glasscheibe – und presst ihr die Luft aus der Lunge. Aber vielleicht ist es auch sie, die zerschellt. Sie ist nicht mehr sie selbst, nicht mehr ein einzelner Mensch, sondern in Stücke geschnitten und in der Dunkelheit treibend. Das Brennen in ihrer Lunge ist unerträglich, ihr Verstand entweicht und macht Platz für den Schmerz.
Sonderbare Gedanken erreichen sie durch die Kälte: Hier gibt es keine Schönheit.
Wenigstens das ist eine unerwartete Erleichterung.
Doch der Körper will, was er will: Bitte, fleht er. Ihr Körper beginnt zu kämpfen; ihr Gesicht sucht oben nach dem spärlichen Sternenlicht, das schon so weit weg ist. Jemand sagte ihr einmal, dass die Sterne nichts weiter als Stecknadeln sind, die den dunklen Himmel hochhalten, damit er nicht auf die Erde niedersinkt und sie unter sich erstickt. Der kurze Augenblick der Gelassenheit weicht der Panik. Ein gewaltiges, unaufhaltsames Verlangen ergreift Besitz von ihr – es ist nicht das Leben, das nach ihr ruft und nach einer zweiten Chance verlangt, sondern die Liebe. Wir alle verdienen eine zweite Chance. Der Gedanke, so scheint es, steigt nicht in ihr empor, sondern fließt um sie herum, sogar noch als die Strömung sie weiter nach unten zieht und ein eisiger Nebel sich um ihren Verstand legt.
Die Oberfläche ist nun unermesslich weit über ihr, unerreichbar. Die Kälte ist überall und besteht unnachgiebig darauf, hereingelassen zu werden.
Ich kann dir noch eine Chance geben, scheint das Wasser zu sagen. Ich kann all das hier verschwinden lassen, wenn du mich nur lässt.
Es ist ein Versprechen. Die Wellen ziehen sie nicht mehr in die Tiefe, sondern halten sie fest im Arm und warten auf ihre Reaktion.
Schließlich öffnet sie den Mund. Wasser strömt herein und bildet die Antwort.
1916
18. September 1916
Zu Händen des Direktors
Morninggate Asylum, Liverpool
Sehr geehrter Herr Direktor,
ich schreibe Ihnen in der Hoffnung auf Ihre Hilfe in einer äußerst heiklen Angelegenheit.
Meine geliebte Tochter Annie verschwand vor vier Jahren unerwartet aus unserem Haus in einem Dörfchen namens Ballintoy. Seitdem suchen meine Frau und ich nach ihr. Wir wandten uns an Krankenhäuser und Genesungsheime, da unsere Tochter, als wir sie das letzte Mal sahen, sich in einem Zustand der Verzweiflung befand und an einer Verletzung litt, die womöglich schwerwiegender war, als wir es zum damaligen Zeitpunkt geglaubt hatten. Wir begannen mit den Einrichtungen in unserer Umgebung, in Belfast und Lisburn und Bangor, doch als wir sie dort nicht finden konnten, arbeiteten wir uns weiter vor und überquerten schließlich die Irische See bis nach Liverpool.
Insgesamt schrieben wir 55 Krankenhäuser an. Das Glück war nicht auf unserer Seite, doch man empfahl uns, unsere Anfragen auf solche Einrichtungen wie die Ihre auszuweiten. Seit ihrer Kindheit war Annie äußerst empfänglich für die Gefühle, über die alle Personen ihres Geschlechts verfügen. Jedoch können diese Gefühle sowohl ein Segen als auch ein Fluch sein: Eine Frau ohne diese Empfindungen wäre ein kaltes, herzloses Ding, doch ein Zuviel an Liebe ist kein Zuckerschlecken. Als ihr Vater kann ich nicht umhin, mir manchmal zu wünschen, dass es eine Möglichkeit gegeben hätte, diese Eigenschaft meiner liebsten Annie irgendwie zu zügeln.
Und so schreibe ich Ihnen, gnädiger Herr, um zu fragen, ob es in Ihrer Einrichtung vielleicht eine Frau gibt, auf die Annies Beschreibung passt. Sie würde nun 22 Jahre alt und müsste 1,65 Meter groß sein. Sie ist ein leises, schüchternes Mädchen, das eine ganze Woche verbringen kann, ohne auch nur ein Wort zu irgendwem zu sprechen.
Ich bete, dass Sie unseren Albtraum beenden und uns unsere Annie zurückgeben können. Ja, um es in einem Satz zu sagen, sie ist aus dem Zuhause, das wir ihr geboten haben, davongelaufen, doch wir vermuten, dass es lediglich ihre Angst vor einer Zurechtweisung ist, die sie noch von uns fernhält. Bitte bedenken Sie, dass wir diese Angelegenheit ohne die polizeilichen Behörden verfolgen, um Annies Privatsphäre und Würde zu wahren. Ich bete, dass wir auf Ihre Diskretion vertrauen können. Ein Mann in Ihrer Position, dessen bin ich mir sicher, begegnet einer beträchtlichen Zahl von Frauen in einer ähnlichen Lage wie die von meiner Annie.
Sie ist unsere einzige Tochter und trotz ihrer Gebrechen, ihrer Schwächen und allem, was sie womöglich getan hat, lieben wir sie von ganzem Herzen. Bitte richten Sie ihr aus, dass ihre Brüder jeden Abend für ihre Heimkehr beten und dass ihr Zimmer noch genauso aussieht, wie sie es hinterlassen hat. Wir verbleiben in der Hoffnung, sie wieder in den liebevollen Arm der Familie schließen zu dürfen.
Hochachtungsvoll
Jonathan Hebbley
Gemeinde Ballintoy, Grafschaft Antrim, Nordirland
25. September 1916
Morninggate Asylum, Liverpool
Sehr geehrter Mr. Hebbley,
am Freitag letzter Woche erhielt ich Ihren berührenden Brief Ihre Tochter Annie betreffend.
Obwohl ich durchaus Verständnis für Ihre tragische Lage habe, muss ich Ihnen leider mitteilen, dass ich Ihnen nicht behilflich sein kann.
Das Irrengesetz aus dem Jahre 1890 hat viele Veränderungen in den rechtlichen Auflagen, an die sich Einrichtungen wie das Morninggate halten müssen, mit sich gebracht. Das Gesetz hat Anstalten dazu gezwungen, bis dato ungeahnte interne Richtlinien zu erlassen, die – meiner Meinung nach – eher dazu gedacht sind, die Häuser vor unberechtigten Rechtsansprüchen zu bewahren, und nicht dafür, ihren Patienten zum Wohle zu gereichen.
Im Morninggate umfassen diese Richtlinien auch die Gewährleistung der Privatsphäre unserer Patienten.
Aus diesem Grunde muss ich Ihnen mit allem Respekt eine Antwort verweigern. Wie Sie bestimmt verstehen, geht es darum, die Betroffenen zu schützen, die oftmals schwer unter den Vorurteilen der Allgemeinheit gegenüber jenen mit Störungen der Psyche und des Verstandes zu leiden haben.
Bitte interpretieren Sie diese Antwort weder als Bestätigung noch als Verneinung der Anwesenheit Ihrer Tochter im Morninggate.
Als Leiter dieser Institution bin ich an das Gesetz gebunden.
Ergebenst
Nigel Davenport,
Leitender Arzt, Morninggate Asylum
Byshore Mews, Liverpool, England
1
Oktober 1916
Morninggate Asylum
Liverpool
Sie ist nicht verrückt.
Annie Hebbley sticht mit der Nadel in den groben Leinenstoff, der von einem weichen Grau ist wie die Federn der Tauben, die sich in den Schornsteinen der Kamine verfangen und flattern und krächzen und manchmal so wild um sich schlagen, dass sie bei ihrem vergeblichen Fluchtversuch verenden.
Sie ist nicht verrückt.
Annies Blick folgt der Nadel, die sich am Saum entlangbewegt, in den Stoff hinein und wieder heraus. Rein und raus. Rein und raus. Spitz und glänzend und so präzise.
Aber da ist etwas in ihr, das für Wahnsinn empfänglich ist.
Annie kennt inzwischen die launenhaften Gewohnheiten der Geisteskranken – die Schreianfälle, das zusammenhanglose Gebrabbel, das ungestüme Zappeln der Hände und Füße. Darin liegt, nach all den Tagen und Wochen und Jahren, ein gewisser tröstlicher Rhythmus. Aber nein, sie ist keine von ihnen. Dessen ist sie sich sicher.
So sicher wie der Herrgott und die Heilige Jungfrau, hätte ihr Vati früher vielleicht gesagt.
Einige Patientinnen sitzen über ihre Näharbeit gebeugt und erfüllen den Raum trotz des armseligen Kaminfeuers mit einer stickigen Wärme. Die Arbeit, so glaubt man, lindert Nervenleiden, und so werden den Insassen Aufgaben zugewiesen, besonders denen, die eher wegen ihrer eigenen Armut und nicht so sehr wegen einer Erkrankung des Verstandes oder des Körpers hier sind. Zwar werden die meisten Bedürftigen in Armenhäusern untergebracht, doch Annie hat herausgefunden, dass nicht wenige von ihnen stattdessen in die Irrenhäuser gebracht werden, wenn es dort leere Betten für sie gibt. Ganz zu schweigen von den sündigen Frauen.
Doch egal aus welchen Gründen sie hier im Morninggate untergebracht wurden, die meisten Frauen sind sanftmütig und beugen sich den Anweisungen der Schwestern. Doch es gibt auch ein paar, vor denen sich Annie wirklich fürchtet.
Sie macht sich klein, während sie arbeitet, um die anderen Frauen ja nicht zu berühren. So ganz kann sie den Verdacht nicht abschütteln, dass sich Wahnsinn wie eine Krankheit von einer Person zur nächsten überträgt und wie ein feiner Pilz in einer Milchflasche gärt, die zu lange in der Sonne steht – unsichtbar zuerst, doch schon bald zerstörerisch und verderbend, bis die ganze Milch sauer ist.
Annie hockt auf einem harten kleinen Schemel im Nähzimmer, ihre morgendliche Arbeit in ihrem Schoß angehäuft, doch es ist der Brief in ihrer Tasche, der sich immer wieder an ihren Gedanken reibt, ohne dass sie es will, wie ein glühendes Stück Holzkohle, das sich durch den Stoff ihres Kleids brennt. Annie erkannte die Handschrift, noch bevor sie den Namen auf dem Briefumschlag sah. Sie hat ihn bestimmt schon ein Dutzend Mal gelesen. Unter dem Mantel der Nacht, wenn niemand zusieht, küsst sie ihn wie ein Kruzifix.
Als hätte die Sünde in Annies Gedanken sie angezogen, taucht eine der Schwestern an ihrer Schulter auf. Annie fragt sich, wie lange die Schwester dort schon steht und sie betrachtet. Diese ist neu. Sie kennt Annie noch nicht – wenigstens noch nicht richtig. Sie überlassen Annie den Nachzüglern in der Belegschaft, die noch nicht gelernt haben, sich vor ihr zu fürchten.
»Annie, meine Liebe, Dr. Davenport würde dich gern sprechen. Ich werde dich zu seinem Büro begleiten.«
Annie erhebt sich von ihrem Schemel. Keine der anderen Frauen blickt von ihrer Näharbeit auf. Die Schwestern wenden den Patienten im Morninggate niemals den Rücken zu, und so schlurft Annie voran den Flur hinunter, die Gegenwart der Schwester wie ein heißer Schürhaken hinter ihr. Wenn Annie doch nur einen Augenblick lang allein wäre; dann würde sie den Brief loswerden, ihn hinter den Vorhängen verstecken oder unter den Teppichläufer schieben. Sie darf nicht zulassen, dass der Doktor ihn findet. Allein der Gedanke daran lässt ihren Körper vor Scham erschaudern.
Aber hier im Morninggate ist sie nie allein.
In dem staubigen Spiegelbild der Flurfenster sehen sie wie zwei Gespenster aus – Annie in ihrer blassen, taubengrauen Uniform, die Schwester in ihrem cremefarbenen Gewand aus einem langen Rock, einer Schürze und einer Haube. Sie kommen an einer langen Reihe aus geschlossenen Türen und verriegelten Räumen vorbei, in denen die Kranken murmeln und wehklagen.
Weswegen schreien sie? Was quält sie so sehr? Bei einigen war es der Gin. Andere wurden von ihren Ehemännern, Vätern und sogar Brüdern hergebracht, weil es ihnen nicht gefiel, wie ihre Frauen dachten und dass sie sich nicht den Mund verbieten ließen. Doch Annie meidet es, sich die Geschichten der wirklich Wahnsinnigen anzuhören. Ohne Zweifel sind sie voller Tragik, und Annie hat in ihrem Leben genug Schwermut erfahren.
Das Gebäude selbst ist groß und weitläufig. Es wurde aus einem alten Lagerhaus der East India Company, die in den 1840ern den Betrieb einstellte, in mehreren Etappen errichtet. Im Innenhof, wo die Frauen am Morgen ihre Leibesübungen verrichten, sind die Wände mit Schweiß und Speichel durchsetzt und mit dreckigen Handabdrücken und vertrockneten Blutflecken beschmiert. Zum Glück brennen die Gaslaternen nur schwach, aus Kostengründen, was dem Schmutz einen angenehm warmen Farbton verleiht.
Sie laufen an dem Flügel der Männer vorüber. Manchmal kann Annie ihre Stimmen durch die Wand hören, doch heute schweigen sie. Die Männer und Frauen sind voneinander getrennt, weil einige der Frauen an einer sonderbaren Nervenkrankheit leiden, die ihr Blut zum Kochen bringt. Diese Frauen können den Anblick eines Mannes nicht ertragen und brechen in Zuckungen aus, versuchen, ihm die Kleider vom Körper zu reißen, kauen ihre eigenen Zungen ab und sacken von Krämpfen geschüttelt in sich zusammen.
Jedenfalls wird das behauptet. Annie hat es selbst noch nie gesehen. Man erzählt sich gern Geschichten über die Patienten, besonders die weiblichen.
Doch hier ist Annie sicher vor der großen weiten Welt. Der Welt der Männer. Und das ist alles, was zählt. Die kleinen, beengten Räume sind nicht so anders als die vier winzigen Zimmer in der alten Hütte in Ballintoy, die brausende Irische See keine 20 Schritte vor ihrer Haustür. Auch hier im Innenhof ist die Luft vom Duft des Meeres erfüllt, doch selbst wenn es ganz in der Nähe ist, kann Annie es nicht sehen. Seit vier Jahren hat sie es nicht gesehen.
Das ist zur selben Zeit ein Trost und ein Fluch. An manchen Tagen erwacht sie aus Albträumen, in denen schwarzes Wasser in ihren offenen Mund strömt und ihre Lunge zu Stein gefrieren lässt. Der Ozean ist tief und unerbittlich. Familien in Ballintoy haben Väter und Brüder und Schwestern und Töchter an das Meer verloren, solange sie zurückdenken kann. Sie hat Hunderte Leichen im Wasser des Atlantiks wimmeln gesehen. Mehr Leichen, als auf dem Friedhof von Ballintoy beerdigt sind.
Und doch erwacht sie an anderen Tagen mit Putz unter ihren Fingernägeln, weil sie verzweifelt an den Wänden gekratzt hat, um herauszukommen, um zu ihm zurückzukehren. Das Blut rauscht mit den Bewegungen des Meeres durch ihre Adern. Sie lechzt danach.
Auf der anderen Seite des Innenhofs betreten sie eine kleine Eingangshalle, die zu den Privaträumen des Doktors führt. Die Schwester weist Annie an beiseitezutreten, bevor sie anklopft und dann, als sie zum Eintreten aufgefordert werden, die Tür zu Dr. Davenports Büro aufschließt. Er erhebt sich von seinem Schreibtisch und deutet auf einen Stuhl.
Nigel Davenport ist ein junger Mann. Annie mag ihn und hat schon immer das Gefühl gehabt, dass ihm das Wohlergehen seiner Patienten am Herzen liegt. Sie hat die Schwestern davon sprechen gehört, wie schwer es die Gemeinde hat, Ärzte zu finden, die der Anstalt treu bleiben. Ihre Arbeit ist entmutigend, wenn so wenige der Patienten auf ihre Behandlung ansprechen. Außerdem ist es viel einträglicher, als Hausarzt zu arbeiten, Knochen zu richten und Babys zu entbinden. Jedes Mal wenn er sie sieht, denkt er an den Vorfall mit der Taube. Das tun sie alle. Wie man sie fand, einen toten Vogel in ihrem Arm haltend und zu ihm murmelnd wie zu einem Baby.
Sie weiß, dass es kein Baby war. Es war nur ein Vogel. Das Tier war aus dem Kaminschacht gerutscht und in einer Wolke aus losen Federn auf den Herd geknallt. Ein dreckiger, rußbedeckter Vogel, und doch auf seine eigene Art wunderschön. Sie wollte ihn nur halten. Sie wollte etwas Eigenes zum Halten haben.
Er faltet die Hände und legt sie auf den Schreibtisch. Sie starrt seine langen Finger an, wie sie sich ineinander verschränken. Sie fragt sich, ob er starke Hände hat. Es ist nicht das erste Mal, dass sie sich diese Frage stellt. »Mir ist zu Ohren gekommen, dass du gestern noch einen Brief bekommen hast.«
Ihr Herz pocht in ihrer Brust.
»Es ist gegen unsere Richtlinien, uns zu sehr in die Privatangelegenheiten unserer Patienten einzumischen, Annie. Wir lesen die Briefe der Patienten nicht, so wie es in anderen Einrichtungen gemacht wird. So sind wir hier nicht.« Sein Lächeln ist freundlich, doch zwischen seinen Augenbrauen zeichnet sich ein leichtes Runzeln ab, und Annie verspürt den seltsamen Drang, mit ihrem Finger auf diese Stelle zu drücken, um sein weiches Fleisch zu glätten. Natürlich würde sie das niemals tun. Absichtliche Berührungen sind nicht erlaubt. »Hier gestehen wir es den Patienten zu, uns ihre Korrespondenz aus freien Stücken zu zeigen. Aber du verstehst schon, dass uns diese Briefe Anlass zur Sorge bereiten, habe ich recht?«
Seine Stimme ist sanft und ermutigend und erfüllt die Stille mit einer fast schon körperlichen Liebkosung. Wie ein Köder. Sie schweigt, als würde sie seine Berührung erwidern, wenn sie spräche. Vielleicht wird er sie nicht mehr drängen, wenn sie ihm nicht antwortet. Vielleicht wird sie sich in Luft auflösen, wenn sie nur leise genug ist. Dieses Spiel hat sie in den weiten Feldern und an den Klippen von Ballintoy die ganze Zeit gespielt.
Die Erinnerung daran kehrt mit einer erschreckenden Deutlichkeit zurück: das Verschwinden-Spiel. In der Regel hat es funktioniert. Ganze Tage hat sie damit zugebracht, durch die Wiesen hinter dem Haus zu streifen und sich Geschichten auszudenken, ohne auch nur einmal gesehen oder angesprochen zu werden. Ein lebendes Phantom.
Der Doktor reibt seinen Nacken an seinem hohen Stehkragen. Er hat einen guten, festen Nacken. Genau wie die Hände. Er könnte sie leicht überwältigen. Das ist wahrscheinlich Sinn und Zweck solch einer Kraft. »Vielleicht willst du ihn mir zeigen, Annie? Für deinen Seelenfrieden? Es ist nicht gut, Geheimnisse zu haben. Geheimnisse belasten nur und liegen schwer im Magen.«
Sie zittert. Sie sehnt sich danach, über ihn zu reden, und sie brennt darauf, ihn zu verstecken. »Er ist von einer Freundin.«
»Die Freundin, die mit dir an Bord des Passagierschiffes gearbeitet hat?« Er hält inne. »Violet, stimmt’s?«
Panik packt sie. »Sie arbeitet nun auf einem anderen Schiff. Sie sagt, dass man dringend nach Hilfe sucht, und sie fragt, ob ich eine neue Anstellung haben möchte.« So, nun ist es raus.
Seine dunklen Augen betrachten sie eingehend. Sie kann dem Druck seiner Erwartung kaum standhalten. Sie war noch nie gut darin, Nein zu sagen. Alles, was sie jemals wollte, war den Menschen zu gefallen. Ihrem Vater, ihrer Mutter. Ihnen allen. Gut zu sein.
So wie sie es früher einmal war.
Meine gute Annie, dem Herrgott gefallen gute Mädchen, sagte ihr Vati.
Sie greift in ihre Tasche und reicht ihm den Brief. Sie erträgt es kaum, ihm beim Lesen zuzusehen, und fühlt sich, als wäre es nicht der Brief, sondern ihr Körper, der geöffnet wurde.
Dann blickt er zu ihr hinauf, und langsam formt sein Mund ein Lächeln.
»Verstehst du es denn nicht, Annie?«
Sie knotet ihre Hände in ihrem Schoß zusammen. »Verstehen?« Sie weiß, was er als Nächstes sagen wird.
»Du weißt schon, dass du nicht wirklich krank bist, nicht wie die anderen, habe ich recht?« Er spricht die Worte sanft aus, als würde er ihre Gefühle schonen wollen. Als würde sie es nicht schon längst wissen. »Wir haben darüber diskutiert, ob es moralisch vertretbar ist, dich bei uns zu behalten, doch es hat uns widerstrebt, dich zu entlassen, weil … Nun, offen gesagt wussten wir nicht, was wir mit dir machen sollten.«
Annie hatte keine Erinnerung an ihre Vergangenheit, als sie in das Morninggate Asylum eingewiesen wurde. Sie erwachte in einem der schmalen Betten, die Arme und Beine zerschrammt, ganz zu schweigen von der scheußlich schmerzenden Verletzung an ihrem Kopf. Ein Constable hatte sie bewusstlos hinter einem Wirtshaus gefunden. Sie schien keine Prostituierte zu sein; sie trug weder die Kleidung dafür noch roch sie nach Gin.
Aber niemand wusste, wer sie war. Damals kannte Annie sich selbst kaum. Sie konnte ihnen nicht einmal ihren Namen nennen. Dem behandelnden Arzt blieb keine andere Wahl, als die gerichtliche Anordnung zur Unterbringung in der Anstalt zu unterschreiben.
Mit der Zeit kehrte ihre Erinnerung zurück. Aber nicht alles. Wenn sie versucht, sich gewisse Dinge ins Gedächtnis zu rufen, bleibt vieles hinter einem Schleier. Natürlich ist die Nacht, in der das große Schiff unterging, mit der prismatischen Perfektion von festem Eis in ihre Erinnerungen geschnitten. Es ist das davor, was sich unwirklich anfühlt. Sie erinnert sich an die beiden Männer, jeden für sich, doch manchmal fühlt es sich an, als würde ihr Verstand sie zu einem Mann – oder zu allen Männern – zusammenflechten. Und dann, noch davor: Fragmente von grünen Feldern und endlosen Predigten, skandierten Gebeten und dem heulenden Nordwind. Eine Welt, die zu unermesslich groß ist, um sie zu verstehen.
Eine schreckliche, klaffende Einsamkeit, die seit vier Jahren ihre einzige Gefährtin ist.
Bestimmt ist es besser, sie hierzubehalten, wo es sicher ist, wo die Welt und ihre Geheimnisse, Kriege und falschen Versprechungen weit weg sind, weit draußen hinter den dicken Backsteinmauern.
Dr. Davenport blickt sie noch immer mit seinem unschlüssigen Lächeln an. »Glaubst du nicht auch, Annie?«, sagt er.
»Was denn glauben?«
»Es wäre falsch, dich hierzubehalten, während der Krieg tobt. Ein Bett belegen, das für jemanden benutzt werden könnte, dem es wirklich schlecht geht. Es gibt Soldaten, die das Kriegszittern haben. In der Everton Alley wimmelt es nur so vor armen, gebrochenen Seelen, die von den Dämonen des Schlachtfelds gepeinigt werden.«
Seine Augen sind düster und völlig ruhig. Sie verharren auf ihr.
»Du musst das Büro der White-Star-Reederei anschreiben und um deine alte Stelle bitten, so wie deine Freundin es vorgeschlagen hat. Unter diesen Umständen ist es genau das Richtige.«
Sie ist wie gelähmt, nicht wegen seiner Erklärungen, sondern weil alles so schnell geschieht. Sie hat Mühe, seinen Worten zu folgen. Eine Furcht breitet sich langsam in ihrem Brustkorb aus.
»Dir geht es gut, meine Liebe. Du hast nur Angst. Das ist verständlich. Aber du wirst dich pudelwohl fühlen, sobald du deine Freundin siehst und deine Arbeit wieder aufnimmst. Dafür wird es auch Zeit, findest du nicht?«
Sie kann nicht umhin, sich zurückgewiesen, sogar fast verschmäht zu fühlen. Vier Jahre lang hat sie alles gemacht, um bleiben zu dürfen. Um ihre Geheimnisse zu bewahren. Hat sich vorgesehen, niemandem in die Quere zu kommen, nichts Falsches zu machen.
Sie war so gut.
Doch nun wird ihr dieses Leben, ihr Zuhause, die einzige Sicherheit, die sie kennt, aus den Händen gerissen, und einmal mehr ist sie gezwungen, sich dem Unbekannten zu stellen.
Es gibt kein Zurück. Sie weiß, dass sie ihm nichts verweigern kann. Nicht wenn er so gütig zu ihr war.
Er faltet den Brief und hält ihn ihr hin. Ihr Blick bleibt an seinen starken Händen hängen. Ihre Finger streifen seine, als sie ihn zurücknimmt. Verboten.
»Ich freue mich darauf, die Entlassungspapiere zu unterschreiben«, sagt der Arzt. »Meinen Glückwunsch, Miss Hebbley, zu deiner Rückkehr in die Welt.«
3. Oktober 1916
Meine liebe Annie,
ich hoffe, dieser Brief erreicht dich. Ja, ich schreibe schon wieder, obwohl ich noch nichts von dir seit meinem letzten Brief gehört habe, den ich dir über die Hauptniederlassung der White Star Line zukommen ließ. Du wirst verstehen, warum ich nicht aufhöre, dir zu schreiben. Ich bete, dass dein Zustand nicht schlimmer geworden ist. Es tat mir leid, von deiner gegenwärtigen Lage zu lesen, auch wenn du dich, deinem Brief nach zu urteilen, nicht unpässlich anhörst. Kannst du mir je vergeben, dass ich dich nach jener schrecklichen Nacht aus den Augen verloren habe? Ich hatte ja keine Ahnung, ob du überlebt oder den Tod gefunden hast. Ich fürchtete, dich niemals wiederzusehen.
Um auf die Frage einzugehen, die dir womöglich noch immer auf der Seele liegt: Ich habe keine weiteren Informationen darüber erhalten, was mit dem Baby geschehen ist. Während der kalten, beklagenswerten Nacht, die wir wartend in dem Rettungsboot verbrachten, leise zu Gott betend, dass wir verschont bleiben würden, hielt ich die Kleine eng an meine Brust gedrückt, um sie zu wärmen. Doch als wir von der Carpathia gerettet wurden, wie ich es in meinem letzten Brief schilderte, war ich gezwungen, sie der Besatzung zu übergeben. Seitdem habe ich in Erfahrung gebracht, dass sie höchstwahrscheinlich in einem Waisenhaus untergebracht wurde. Du musst darauf gefasst sein, dass sie womöglich für immer für dich und mich verloren ist.
Es tut mir so leid, Annie.
Lass mich nun meine Aufmerksamkeit auf dich richten, liebste Freundin. Es erfüllt mich mit Kummer, wenn ich daran denke, dass du hinter den Mauern einer Irrenanstalt versauern musst. Welche Art von Schwermut dich auch immer nach jener verhängnisvollen Nacht gepackt hat, du musst darüber hinwegkommen. Ich weiß, dass du es kannst. Ich erinnere mich an das Mädchen, das auf diesem verdammten Schiff ein Zimmer mit mir teilte. Ich werde niemals den Augenblick vergessen, in dem ich dich zum letzten Mal sah, als du in dieses dunkle, eisige Wasser gesprungen bist. Wir glaubten, du hättest den Verstand verloren. Doch nur du hattest das Baby in das Wasser stürzen gesehen. Nur du wusstest, dass es galt, keine Zeit zu vergeuden. Annie Hebbley ist das mutigste Mädchen, das ich je gekannt habe, lautete mein Gedanke in jener Nacht.
Aus diesem Grund weiß ich, dass du deine derzeitigen Umstände überstehen wirst, Annie. Du bist stärker, als du vielleicht glaubst.
Ich bin keine Stewardess mehr, sondern eine Krankenschwester, als Teil der Kriegsanstrengungen. Das Schiff, auf dem ich gerade diene, ist ein Zwilling zu dem, das wir beide so gut kennen. Versuche dir aber vorzustellen, dass all sein Glanz umgestaltet wurde, als wäre das Aschenbrödel in sein Leben als Küchenmädchen zurückgekehrt! Die HMHS Britannic wurde zu einem Hospitalschiff ausgebaut. Die Kronleuchter sind verschwunden, genau wie die beflockten Tapeten an den Wänden des großen Treppenaufgangs. Nun ist alles kalkweiß und mit Leinen behangen, und überall riecht es nach Desinfektionsmitteln. Alles ist antiseptisch. Der Ballsaal ist nun mit einer Reihe Operationsstationen ausgestattet, und in den Vorratskammern lagern chirurgische Instrumente. Die Abteilungen bieten Platz für Tausende Patienten. Die Schwestern und der Rest der Besatzung bewohnen viele der Kabinen der ersten Klasse, wo du und ich früher die Betten bezogen und uns um die Passagiere gekümmert haben.
Annie, die Britannic braucht noch immer dringend Krankenschwestern. Ich bitte dich noch einmal inständig, darüber nachzudenken, deine berufliche Laufbahn auf hoher See wieder aufzunehmen und mit mir zusammenzuarbeiten. Ich will dich nicht belügen: Wir sehen Verletzungen, die fast zu grausam sind, um sie ertragen zu können. Was in den Zeitungen steht, entspricht der Wahrheit: Dies ist wahrhaft der Krieg, der alle Kriege beenden wird, denn noch grausamer kann es nicht werden. Diese jungen Männer brauchen dich, Annie – um ihnen Mut zu geben und sie daran zu erinnern, was zu Hause auf sie wartet. Du wirst das beste Tonikum der Welt für sie sein.
Und wenn ich bei der Wahrheit bleiben will, wirst du auch für mich das beste Tonikum der Welt sein. Ich vermisse dich ganz schrecklich, Annie. Es gibt nur wenige Menschen, die verstehen würden, was wir zusammen durchgemacht haben. Wenige Menschen, denen ich anvertrauen könnte, dass mich jene Nacht noch immer verfolgt, dass sie mich in meinen Träumen heimsucht, monatlich, wöchentlich, und dass ich noch immer manchmal vor Angst schreiend aufwache. Wer würde schon verstehen, dass ich meinen Lebensunterhalt noch immer auf dem Wasser bestreite, dass ich mich ihm noch immer verbunden fühle, obwohl es mir gezeigt hat, zu welchen Schrecken es imstande ist.
Du, dessen bin ich mir sicher, wirst es verstehen. Ich wäre überrascht, wenn du nicht an denselben Qualen und Ängsten leidest, denn auch du bist der See verbunden. Das habe ich schon immer gespürt.
Schreib mir, Annie, und sag mir, dass du mit mir auf die Britannic kommen wirst. Ich habe schon ein Empfehlungsschreiben für dich im Büro in London hinterlegt. Wir legen am 12. November in Southampton ab. Ich bete, dass ich dich sehen werde, bevor wir in See stechen.
In tiefer Verbundenheit
Violet Jessop
2
11. November 1916
Southampton, England
HMHS Britannic
Charlie Epping ist ein Mann, der einen sauber geführten Krieg zu schätzen weiß, so wie andere eine gut gemachte Taschenuhr zu schätzen wissen.
Die Menschen verkennen oft, was einen Krieg ausmacht. Sie glauben, er wäre wüst und chaotisch. Dabei ist er ein unfassbar ausgeklügeltes, sich ständig bewegendes Gebilde aus verschlüsselten Nachrichten und Informationen, Mengen, Befehlen, Leibern, Zahlen, Material, Logistik. Diejenigen, die das Muster dahinter beherrschen, können unzählige Leben retten. Gibt es auf der ganzen Welt eine bessere Aufgabe als diese?
Er nimmt einen tiefen Zug von seiner Zigarette. Der Himmel über Southampton ist von einem wunderbaren Blau. Es ist einer dieser frischen Herbsttage, an denen ein Mann sich seines Lebens erfreut, auch wenn es in der Nacht draußen auf dem offenen Wasser bitterkalt sein wird – eiskalt sogar.
Er beugt sich vor, ein Fuß auf der Reling, um sich das Treiben unten anzusehen. Er ist auf dem Bootsdeck, nicht weit von seinem Platz im Funkraum entfernt. Von seinem Standpunkt aus, gute 30 Meter über dem Schaum der tosenden Wellen, die sich an den Pfeilern brechen, hat er eine klare Sicht auf das Gewusel der Männer auf den anderen Decks und dem Pier. Es geht zu wie in einem Ameisenhaufen; die Männer sind nicht mehr als schwarze Punkte, die emsig hin und her laufen, um das riesige Schiff für seine Abfahrt morgen bereit zu machen.
Auch er hat noch tausend Sachen zu erledigen, er und Toby Sullivan, der zweite Bordfunker: Sie müssen Tests durchführen, um sicherzustellen, dass das schicke drahtlose Marconi-Telegrafensystem ordnungsgemäß funktioniert. Die Funktechnik ist neu. Wie die meisten Marconi-Funker hatte sich Epping, gleich nachdem er dem Militär beigetreten war, freiwillig für die Schulung gemeldet. Ihm gefällt die Vorstellung, einen Beruf zu erlernen, und er sieht eine Zukunft in der Funktechnik.
An manchen Tagen haben Funker alle Hände voll zu tun, an anderen weniger. Auf See können sie nur dann Signale empfangen, wenn sie sich in Sichtweite eines anderen Schiffes befinden oder in der Nähe einer der Funkstationen sind. Die Technik ist speziell und wankelmütig. Das Wetter beeinflusst das Signal genau wie die Tageszeit. Es gibt Codes, die man sich einprägen muss, und Zahlen, die für Standardbefehle stehen. Und dann ist da noch das Morsealphabet. Epping kennt es so gut, dass er sich immer wieder dabei ertappt, wie er sogar während einer Unterhaltung Worte in Punkte und Striche übersetzt, und er könnte schwören, dass er die Federtaste des Telegrafen in seinem Schlaf klappern hört.
Er schnippt den Zigarettenstummel über die Reling, der wie ein Querstrich vor den sich wiederholenden Schaumkronen der Wellen vorüberfliegt. Sein Blick folgt der Bewegung, dann schaut er auf seine Taschenuhr: Die Morgenpost sollte mittlerweile eingetroffen sein. Befehle und Geheimdienstberichte kommen zweimal am Tag vom Südkommando in Tidworth Camp, und es ist die Aufgabe der Bordfunker, sie durchzusehen. Es wird ruhiger werden, sobald sie auf hoher See sind, doch im Augenblick haben er und Sullivan alle Mühe, Schritt zu halten.
Die Britannic wurde aus einem stolzen Ozeandampfer umgerüstet – dem edelsten, der je gebaut wurde. Wenigstens wurde ihm das so berichtet. Anders als andere Militärschiffe hat dieses richtige Treppen anstatt Leitern. Die Gänge sind breit. Es gibt zahlreiche Sichtluken. Man fühlt sich auf diesem Schiff nicht so eingeengt wie auf einem Kreuzer oder einem Schlachtschiff. Epping hat sich in den letzten Jahren so sehr an enge Verhältnisse gewöhnt, dass ihm die schiere Menge an Freiraum auf der Britannic manchmal das Gefühl gibt, als wüsste er nichts mit seinen eigenen Armen anzufangen.
Natürlich hat das Schiff eine ziemlich berüchtigte Schwester. Der Führungsstab informierte sie von Anfang an unverblümt über das Verhängnis der Titanic und versammelte die ganze Mannschaft, um all die Verbesserungen zu erläutern, die als Reaktion auf die Tragödie an der Britannic vorgenommen wurden. Der Rumpf wurde verstärkt, die Schotten bis ganz nach oben versiegelt. Dieses Schiff ist viel sicherer als das andere, wurde ihnen versichert. Kein Grund, nervös zu sein.
Und Epping ist nicht der nervöse Typ. Der darf man auch nicht sein, wenn man einen schwimmenden Festsaal hat, der zu einer Schlafstätte für die Kranken und Sterbenden umgebaut wurde: Männer, wie Flickenpuppen in Stücke gerissen, fehlende Arme und Beine, Gesichter, von Granatsplittern zerfetzt, Lungen, von Senfgas zerstört. Die Ärzte sagen, dass das Gemetzel in diesem Krieg größer ist, weil die modernen Waffen so viel todbringender sind.
Nachdem er den Postsack von seinem Haken am Pier geholt hat, kehrt Epping in den Funkraum zurück, wo Toby Sullivan auf einen Stapel Papiere neben der Telegrafenstation deutet. »Wir haben vergessen, den neuesten Stand der Besatzungsliste nach Tidworth zu senden. Kannst du das übernehmen?«
Das macht Charlie nichts aus. An der Federtaste ist er dreimal so schnell wie Toby, der das Morsealphabet noch nicht ganz auswendig kennt und immer wieder bei bestimmten Buchstaben hängen bleibt – und zwar nicht nur bei solchen, die selten benutzt werden, so wie das Q, das X und das Z, sondern auch bei denen, die nicht ganz so ungebräuchlich sind, wie das J und das V. Charlie nimmt vor dem Besatzungsbuch Platz, sucht die Namen derjenigen heraus, die seit dem letzten Bericht an Bord gekommen sind, und hakt sie mit einem Bleistift ab. Für jedes Besatzungsmitglied müssen sie eine Reihe von Informationen übermitteln: Name, letzte Arbeitsstelle, Alter, Wohnort, nächste Angehörige.
Dann tippt er die Einleitung: Von der HMHSBritannic an das Südkommando, Tidworth Camp … Punkt Punkt Punkt Punkt, Strich Strich …
Er fährt mit dem Finger über die Seiten des Besatzungsbuchs und findet den ersten Eintrag: Edgar Donnington, Uxbridge Shoring, Alter: 34, Ickenham, Mrs. Agnes Donnington (Ehefrau).
Dann zum nächsten.
Annie Hebbley.Titanic …
Er hält inne. Eine Überlebende. Er nimmt sich vor, mehr herauszufinden. Das Mädchen muss entweder unglaublich zäh oder ein echter Glückspilz sein, um mit dem Leben davongekommen zu sein – vielleicht ist sie beides. Er kann nur erahnen, welche Geschichten sie zu erzählen hat.
Er macht weiter und tippt den Rest ihrer Daten ein. Alter: 22, Liverpool. Bei den nächsten Angehörigen tippt er schnell … Punkt Strich Punkt Pause Punkt …
Keine.
3
12. November 1916
Southampton, England
HMHS Britannic
Es ist nicht schwer, so, wie Annie am Dock steht und in die funkelnde Morgensonne blinzelt, sich eine Welt ohne Vergangenheit und nur mit einer Zukunft vorzustellen. Vor ihr erhebt sich die große Britannic und dahinter das offene Meer.
Nun, da sie hier ist, spürt sie eine aufkeimende Entschlossenheit in sich – eine Dringlichkeit. Es war richtig herzukommen.
Während des ganzen Weges vom Morninggate hierher hatte sie sich erschöpft und wie entblößt gefühlt. Die vielen Menschen überall hatten sie zermürbt. Kutscher und Wirte, Polizisten und Schuhputzer und Straßenhändler. Dr. Davenport hatte zwei Schwestern angewiesen, sie vor der Reise ein paarmal in die Stadt zu begleiten, damit sie sich an die Menschenmassen und den Lärm gewöhnte. Doch seitdem war das Leben eine einzige riesige Flutwelle gewesen, die über sie hereinbrach: der Zug nach London, dann zur Waterloo Station, um den nächsten Zug nach Southampton und zum großen Hafen zu erwischen. Zuerst war es alles fast zu viel gewesen, und sie musste im Zug die Augen schließen und die kleine Handtasche mit dem Kordelzug fest an ihre Brust drücken, weil sie fürchtete, sie könnte sie verlieren – sie könnte sich selbst verlieren. Diese Furcht war wie ein angeketteter Hund, schaurig und gemein und immer gefährlich nahe, an seiner Leine zerrend und die Zähne fletschend.
Als sie London erreichte und die erste Etappe ihrer Reise geschafft war, hatte sie sich schließlich an die stete Bewegung unter ihren Füßen und die Nähe von so vielen fremden Körpern gewöhnt, genau wie an die fremdartigen Stimmen und Gerüche und Anblicke, auch wenn sich alles noch immer wie ein Spinnennetz auf ihrer Haut anfühlte.
Auch wenn sie erwartete, überall, wohin sie blickte, ein bekanntes Gesicht zu sehen, und glaubte, Mark entdeckt zu haben – das dichte schwarze Haar und das stattlich geschnittene Gesicht, der wissende Blick.
Auch wenn es jedes Mal ein Fremder war und nicht er, verspürte sie einen Schmerz, der wie eine alte Wunde in ihrer Brust aufbrach.
Auch im Morninggate hatte sie oft geglaubt, ihn zu sehen, unter den anderen Patienten oder auf dem Gehweg vor den Mauern spazierend. Aber nun weiß sie, dass es nur ihre Fantasie ist, die ihr einen Streich spielt. Mark starb vor vier Jahren in dem eisig kalten, dunklen Wasser des Nordatlantiks.
Bei ihrer Ankunft in Southampton wird sie wieder von Empfindungen übermannt. Sie erinnert sich an dieses Gefühl – irgendwie – vom ersten Mal, als sie ihren Dienst auf der Titanic antrat. Damals war sie in einem Taumel gewesen, ein Kind im Geiste und dem Alter nach, das aus Ballintoy geflohen war. Damals war es, als hätte eine unsichtbare Hand sie geleitet – ein Schutzengel? Sie hatte instinktiv gewusst, in welchen Zug sie einsteigen musste und welche Straße zum Büro der White Star Line führte. Sonderbare Männer hatten der verloren aussehenden jungen Frau ihre Hilfe angeboten, und es war ihr Schutzengel gewesen, der ihr sagte, welcher ihr den richtigen Weg zeigen würde und welcher sie in eine einsame Gasse locken wollte.
Es war kein Vertrauen und auch keine Intuition – sie hatte weder das eine noch das andere –, sondern etwas anderes, das herbeigeeilt kam, um sie zu führen.
Der Mann im Büro der White Star Line ist einer der Guten, einer, dessen Blick nicht urteilt und dessen Händedruck nicht länger als nötig anhält. Er begleitet sie zum Schiff und besteht darauf, ihre Tasche zu tragen, was sie etwas verlegen macht, weil sie so leicht ist. Darin befinden sich nur ein paar wenige persönliche Habseligkeiten: eine Haarbürste, die sie im Morninggate bekommen hat; einige Haarspangen und Dinge, die sie im Tausch für Gefälligkeiten von anderen Patienten erhalten hat; und natürlich die Brosche, ein kostbares Stück, das viel wertvoller als der Rest ist und das Annie seit ihren Tagen auf der Titanic aufbewahrt hat.
Der Offizier glaubt zweifellos, dass sie ein verarmtes Mädchen sein muss, so wenig, wie sie dabeihat. Sie kann ihm nicht erklären, dass sie nichts weiter als ihre graue Leinenuniform aus dem Morninggate hat, dass das Kleid, der Hut und die Schuhe, die sie trägt, aus einem Stapel alter Klamotten stammen, die dem Krankenhaus gespendet worden waren, und dass das Geld für die Zugfahrkarten und ihre Mahlzeiten aus Dr. Davenports eigener Tasche kam. Sie spielt nun eine andere Art des Verschwinden-Spiels, eine, in der sie Kleider einer Frau von anderer Statur und aus einer anderen Zeit trägt. Eine, in der sie sich unter all diesen Menschen bewegt, als wäre sie eine von ihnen, auch wenn sie insgeheim weiß, dass sie keine von ihnen ist, dass sie außen vor ist, irgendwie. Dass sie noch immer allein ist.
Der Weg über die Docks bringt sie zurück zu ihrem ersten Tag auf der Titanic. Die Menschenmassen, das Chaos. Überall Körper, die scheinbar in verschiedene Richtungen hasten. Gassen, die von mit Frachtgut und Gepäck beladenen Fuhrwerken verstopft sind. Kutschen für die wohlhabenden Passagiere, die sich durch die Massen schieben; Kutscher, die schreien müssen, um in dem Tumult gehört zu werden; Pferde, die nervös schnauben. Annie hebt ihren Rock ein wenig, damit sie nicht auf ihre Füße schauen muss und den Mann von der White Star Line, der immer wieder in der Menge verschwindet, nicht aus den Augen verliert.
»Dort ist sie«, sagt er, als sie sich einem Pier nähern. Er reicht ihr ein Stück Papier. »Geben Sie das dem Ersten Offizier.« Er stellt die Tasche vor ihren Füßen ab. Dann geht er.
Annie legt eine Hand auf ihren Hut, als sie hinaufblickt, immer höher, zu den vier riesigen Schornsteinen des Schiffes, die wie die Türme einer Burg aussehen. Die Britannic ist das Ebenbild ihrer Schwester, der Titanic – von dem Anstrich einmal abgesehen, der sie als Lazarettschiff kenntlich machen soll. Ein wohlbekanntes Prickeln packt sie von Kopf bis Fuß, und eine Welle aus Erinnerungen an das erste Schiff stürzt auf sie ein. In jeder Hinsicht ein schwimmender Palast: der gewaltige Treppenaufgang, die wunderschön hergerichteten Esszimmer, die piekfeinen Kabinen. Natürlich erinnert sie sich am lebhaftesten an die Passagiere in den zwölf Kabinen der ersten Klasse, für die sie als Stewardess verantwortlich war. Sie waren reich, einige sogar berühmt. Besonders erinnert sie sich an die Amerikaner mit ihren merkwürdigen Akzenten und sonderbaren Manieren. So geradeheraus, so zudringlich, so entfesselt. Doch dann fällt ihr ein, dass viele von ihnen tot sind, und sie reißt sich zusammen.
Nein. Jetzt ist nicht die Zeit zu trauern. Wenn sie nur lange genug zurückblickt, weiß sie, was geschehen wird: wie sich die schwarzen Strömungen noch einmal über ihrem Kopf schließen und sie in die Tiefe ziehen. Wie die Trauer und der Verlust und der Schrecken zu viel werden.
Im Augenblick muss sie einen klaren Kopf bewahren und den Ersten Offizier finden und sich an die Arbeit machen. Immerhin hat sie noch eine Aufgabe zu erfüllen.
Irgendwo dort draußen ist noch immer das Kind. Marks Kind.
Sie läuft die Landungsbrücke hinauf. Alle tragen Uniform, ohne Ausnahme, und es sind richtige Uniformen, nicht die Tracht der White Star Line, die sie gewöhnt war. Die Männer tragen triste olivgrüne Baumwolle, die Schwestern geschwungene blaue Röcke und Umhänge über den Schultern, der Kälte wegen, und ihre Gesichter sind von Kopftüchern eingerahmt. Jeder ist geschäftig und darauf konzentriert zu tun, was ihm aufgetragen wurde. Niemand schenkt ihr Beachtung.
Drinnen ist es sogar noch anders. Es fällt ihr schwer, sich vorzustellen, dass dieses Schiff früher auch nur die geringste Ähnlichkeit mit der Titanic hatte. So viel hat sich verändert, wie eine Frau kurz nach der Entbindung – zerzaust und blass und ausdruckslos.
Es sieht aus wie in jedem anderen Krankenhaus. Wenn man nicht gerade an einem Bullauge oder einer Tür steht, wüsste man nicht einmal, dass man auf einem Schiff ist. Alles, was die Titanic so strahlend und atemberaubend gemacht hat, wurde entfernt. Hier gibt es keine Liegestühle oder Kartentische, keine Kristallleuchter und Korbstühle. Alles ist antiseptisch und einförmig. Reihenweise Pritschen für die Patienten und mit Verbrauchsgütern befüllte Schränke. Und überall: emsiges Treiben. Schwestern haben ein Auge auf die Männer, die auf die Krankentragen verladen werden, Pfleger tragen sie zu den Krankenwagen, die unten am Pier bereitstehen, um dann mit leeren Bahren für die nächste Fuhre zurückzukehren. Einige Patienten schleppen sich zu Fuß weiter – die Arme in Schlingen, die Köpfe verbunden, begleitet von Schwestern oder Pflegern. Es herrscht genauso viel Trubel wie am Tag des Bordgangs der Titanic. Annie erinnert sich an das Gedränge auf der Landungsbrücke an jenem Tag und holt unterbewusst tief Luft. So viele Menschen. Es hatte sich angefühlt, als würde sie von einer riesigen Welle erfasst und hinuntergezogen werden.
Aber das hier sind keine Gäste, nur Überlebende, und jeder von ihnen verbirgt eine Geschichte unter seinen Bandagen – Wunden, Schmerzen, Bilder von Granatsplittern, Explosionen und Schrecken, die sie unmöglich erfassen kann. Sie alle sind halb tot.
Und das umtriebige Personal hat sich verpflichtet, sich um sie zu kümmern und sie entweder zurück in unsere Welt zu führen oder in die Welt dahinter. Eine ganz andere Art der Reise.
Weiter vorn beratschlagen sich zwei Männer mit einem ernst dreinblickenden Mann in einer knackigen Uniform – wahrscheinlich ein Offizier. Sie nähert sich ihnen mit dem Blatt Papier in ihrer ausgestreckten Hand. »Bitte entschuldigen Sie, aber kann einer von Ihnen mir vielleicht helfen, den Ersten Offizier zu finden? Mir wurde gesagt, dass ich mich bei ihm melden soll.«
Das Trio hält inne und sieht sie an. Der Große mustert sie von oben nach unten mit dem missbilligenden Blick eines Lehrers, reißt ihr das Papier aus der Hand und überfliegt es. »Hier steht, dass Sie eine neue Stationsschwester sind, ja? Eine gewisse Miss Hebbley? Sie wollen sich zum Dienst melden?«
»Ja, das stimmt.«
»Schwestern liegen in der Verantwortung der Oberin. Epping«, sagt er und reicht das Blatt Papier einem der beiden anderen Männer, einem mageren Burschen mit strohblondem Haar, »bringen Sie Miss Hebbley zu Schwester Merrick, ja? Sie kann schließlich nicht allein über die Decks laufen, nicht wahr?«
Sie folgt Epping wie durch einen Nebel, als er ihre Tasche genommen hat und sie durch Gänge führt, die ihr zur selben Zeit bekannt und völlig fremd erscheinen. Er schlängelt sich mühelos durch den Verkehr und blickt immer wieder über seine Schulter nach ihr. Ein strahlendes, aber schiefes Lächeln huscht über sein Gesicht wie Sonnenschein auf dem Wasser. »Wir haben erst vor ein paar Tagen angelegt, darum ist hier so viel los. Wir müssen über tausend Patienten entladen, und wir brechen bald wieder auf.«
»Sind Sie ein Pfleger?«
»Nee. Ich bin einer der Funker.« Er streckt seine Hand aus. »Charlie Epping.«
Sie schüttelt seine Hand, die nicht groß, aber auch nicht klein ist. Sein Griff ist warm, aber förmlich. Seine Bewegungen sind präzise. »Annie Hebbley«, sagt sie. Ihre Stimme ist leise, während sie sich berühren. »Darf ich Ihnen ein Geheimnis anvertrauen, Mr. Epping? Ich habe keine Ahnung von der Krankenpflege.« Sie weiß nicht so recht, warum sie ihm das erzählt, nur dass das Licht in seinem Grinsen ihr ein Gefühl der Sicherheit gibt. Vielleicht nicht der Sicherheit, sondern nicht unsichtbar zu sein.
Und außerdem sagt sie nicht ganz die Wahrheit. Sie hat die letzten vier Jahre damit zugebracht, Krankenschwestern bei der Arbeit zuzusehen, und weiß alles, was sie tun und sagen. Sie glaubt, dass sie leicht als Schwester durchgehen würde. Sie hat oft das Gefühl, ihr Leben lang als irgendetwas durchgegangen zu sein.
Sie weiß nicht so recht, auf welche Antwort sie gehofft hat, doch er zuckt einfach nur mit den Schultern. »Das kriegen Sie schon beigebracht. Sie bekommen eine Oberschwester zugeteilt, die Ihnen das Wichtigste zeigt. Das haben Sie im Handumdrehen raus.«
Mittlerweile hat er sie bis zum großen Treppenaufgang geführt, der, was sie sehr freut, nicht abgebaut und mit etwas ersetzt wurde, das schlichter ist. Er wirkt eigenartig, findet sie, ohne die schönen beflockten Tapeten und die flauschigen Teppiche auf den Stufen und mit den Soldaten und Schwestern, die statt der Damen in ihren feinen Seidenkleidern und den Männern im Abendanzug vorüberhasten, und doch kommt er ihr bekannt vor.
»Daran erinnere ich mich«, sagt sie und berührt das geschnitzte Geländer.
Er wirft ihr einen skeptischen Blick zu. »Waren Sie schon einmal hier? Das stand nicht in den Unterlagen.«
Eine Schamesröte erwärmt ihre Wangen. »Nicht auf diesem Schiff, nein. Aber auf der Titanic. Ich schätze, dass Sie mich nun für einen echten Unglücksraben halten.«
»Überhaupt nicht! Jetzt erinnere ich mich an Ihren Eintrag. Sie müssen Miss Violet Jessop kennen …«
»Sie war es, die mich ermutigt hat hierherzukommen. Früher waren wir gut befreundet.«
Epping lächelt breit. »Sie ist wie meine große Schwester. Lassen Sie mich Ihnen Schwester Merrick vorstellen, und dann suchen wir nach Violet.«
Da ist etwas an seinem Großmut, seiner Freundlichkeit, das ihr ein Gefühl von Schwere und Traurigkeit bereitet. Er ist lebensfroh, wie aus einer anderen Dimension, wie jemand, der die Reibungen der Welt nicht auf dieselbe Art und Weise wie sie erlebt. Seine Finger betasten die Ränder der Zigarette, die er in seiner Hand herumdreht, und alles, was ihr dazu einfällt, ist Leichtigkeit. So etwas hat sie noch nie gekannt. Sie ist vielmehr wie die Zigarette selbst, von der Hand zum Mund zur Erde herumgereicht, ausgesaugt und dann vergessen.
Vielleicht ist sie auch der Rauch, in die Luft geblasen und von den aufeinandertreffenden Lippen unsichtbar gemacht.
Als sie Schwester Merrick gefunden haben, wird schnell deutlich, dass es kein ausgedehntes Wiedersehen mit Violet geben wird, wenigstens vorerst nicht. Die Frau blickt an ihrer langen Nase hinunter auf Annie. »Danke, Epping, dass Sie sie zu mir gebracht haben, aber das wäre dann alles. Ich bin mir sicher, dass Sie woanders gebraucht werden.« Augenscheinlich will sie nicht, dass er sich in ihrem Zuständigkeitsbereich aufhält, und so tippt er mit dem Finger an seine Mütze, huscht davon und lässt Annie mit dieser stattlichen Frau allein.
Sie wendet sich Annie zu und blickt noch einmal zu ihr hinunter. Schwester Merrick ist groß und stämmig, ihre Schürze spannt sich über ihre herabhängenden Brüste. »Alles der Reihe nach. Wir werden Ihnen eine Uniform besorgen und Sie in einer der Kabinen unterbringen. Dann können Sie mit dem Dienst beginnen.«
»Ma’am?« Annie ist schon zum Umfallen müde. In der Pension ist sie um sechs Uhr aufgestanden, um zu packen und den Zug rechtzeitig zu erwischen.
Die Schwester wirft ihr einen vernichtenden Blick zu. »Sie kommen ohne jede Erfahrung als Krankenschwester zu uns, Miss Hebbley. Schon in ein paar Tagen werden wir in einem Kriegsgebiet sein und frische Patienten aufnehmen. Sie müssen eine Menge lernen und dürfen keine Zeit verschwenden.« Sie ruft eine andere Schwester herbei, eine junge Frau mit freundlichen Augen. »Suchen Sie ihr einen Schlafplatz, und sobald sie eine richtige Uniform trägt, bringen Sie sie wieder her.«
Der Name der jungen Schwester ist Hazel, ein Mädchen aus London, dessen Liebster auf dem Kontinent kämpft. Sie hat schon eine Fahrt mit der Britannic mitgemacht, erzählt sie Annie fröhlich, als sie sie zum Quartiermeister wegen einer Uniform begleitet und sie dann zu den Mannschaftsquartieren auf den Unterdecks führt. »Die Arbeit ist schwer und lang, aber auch sehr erfüllend«, spricht Hazel durch die Tür, während Annie in ihre Schwesternuniform schlüpft. »Schwester Merrick ist gar nicht so schrecklich, wenn man sie erst einmal kennt, aber es zahlt sich aus, sich gut mit ihr zu stellen.«
Annie wünscht sich nichts sehnlicher, als sich auf ihre Pritsche zu legen und eine Weile lang von dem hektischen Treiben und dem Lärm zu verschnaufen, doch sie folgt Hazel gehorsam zurück zu den Stationen. Für die nächsten paar Stunden ist sie Hazels Schatten. Die junge Schwester zeigt Annie, wo die Vorräte sind, wo sie Decken für die Patienten findet, wenn sie frieren, und Wasser, wenn sie durstig sind. Die Verwundeten warten ungeduldig darauf, vom Schiff gebracht zu werden, doch es gibt nur eine begrenzte Zahl von Krankenwagen. Sie stellen sich den beiden Schwestern in den Weg, immer und immer wieder, und verlangen, entlassen zu werden. »Sie müssen warten, bis der Beamte mit Ihren Entlassungspapieren kommt. Sie sind beim Militär, da muss alles seine Ordnung haben«, sagt Hazel zu einem Mann, der damit droht, das Schiff zu verlassen. »Wenn Sie sich unerlaubt entfernen, wird man die Polizei auf Sie ansetzen.«
Ihre wichtigste Aufgabe, das erkennt Annie schnell, ist ihnen zuzuhören, wenn sie reden wollen. Zuerst verstört sie der Anblick der Verwundeten. Schließlich ist es das erste Mal, dass sie Männer sieht, die so schlimm verletzt sind, und einige sind sogar auf aberwitzige Weise entstellt. Es gibt Männer ganz ohne Gliedmaßen und solche, denen das halbe Gesicht weggeschossen wurde. Männer, die um jeden Atemzug kämpfen, weil ihre Lunge vom Gas beschädigt ist, und Männer, die wissen, dass sie nicht mehr lange zu leben haben. Männer, die in einem leisen, pausenlosen Geschwafel zu sich selbst sprechen. Nun, das macht ihr nicht viel aus, denn solche Leute hat sie schon im Morninggate gesehen. Nach ein paar Stunden, in denen sie den Männern zuhört, während sie ihre Bandagen wechselt und ihre Laken herrichtet, Wasser holt und Bettpfannen leert, verliert sie ihre Angst vor ihnen. Ihre Arbeit, so stellt sie fest, ist überraschend befriedigend. Es ist schön, zur Abwechslung auf der anderen Seite zu sein, Hilfe zu geben, anstatt sie zu bekommen. Die Männer, die sie kennenlernt, sind mutlos und verängstigt, weil sie nicht wissen, was sie erwartet. Sie sind verwundet und werden in den meisten Fällen für immer beeinträchtigt bleiben. Ihre Zukunft steht plötzlich auf dem Spiel. Werden sie jemals wieder arbeiten können, oder werden sie für immer eine Last für ihre Familien sein? Werden ihre Liebsten sie immer noch lieben? Einige erzählen ihr von ihren Familien und – ein paar Glückliche – von den Frauen, die zu Hause auf sie warten. Den Traurigen möchte sie sagen: Sie glauben, dass Sie alles verloren haben, doch Sie haben mehr Glück, als Ihnen bewusst ist. Sie sind hier, stimmt’s? Auf diesem prachtvollen Schiff? Sie fragt sich, was diese Männer sagen würden, wenn sie wüssten, dass Annie vor nur wenigen Tagen selbst noch eine Patientin war. Vielleicht würde sie diese Tatsache anspornen, doch Annie glaubt es nicht. Sie fürchtet, dass die Männer sie verurteilen und sich vielleicht sogar vor ihr ängstigen würden, so wie das Personal im Morninggate.
Fast erzählt sie es einem Mann mit großen, traurigen Augen. Er liegt auf seiner Pritsche und starrt geradewegs zur Decke hinauf. Er ist nicht so jung wie viele der Infanteristen, vielleicht Anfang 30. Er reibt sich über den Schenkel, wo sein Bein endet. »Als was soll ich bloß arbeiten, wenn ich wieder nach Hause komme? Ich kann meiner Maisie nicht zur Last fallen«, sagt er.
Annie weiß, dass es ihre Aufgabe ist, für seine Frau zu sprechen. »Das ist das Letzte, woran sie gerade denkt«, sagt sie, während sie sein Kissen aufschüttelt. »Sie wird dankbar sein, dass Sie leben und bei ihr sind, glauben Sie mir.«
Er massiert sein Bein. »Sie kennen meine Maisie nicht.«
»Aber ich bin eine Frau, oder nicht? Ich weiß, wie Frauen fühlen, und ich sage Ihnen, Ihre Maisie will nur, dass Sie wieder nach Hause kommen.« Sie verspürt einen nur allzu vertrauten dumpfen Schmerz in ihrer Brust. Sie wünschte, es gäbe jemanden auf dieser großen, weiten Welt, der so für sie empfinden würde.
Nach vier Stunden auf der Krankenstation ist sich Annie nicht sicher, ob sie den ungeduldigen jungen Soldaten nicht die Landungsbrücke hinunter folgen würde, wenn sie die Gelegenheit dazu bekäme. In einer Ecke findet sie einen Stuhl. Sie setzt sich mit dem Rücken zu der Menschenschar und drückt sich ein Glas Wasser an die Stirn. Ihre Füße pochen, die Welt dreht sich.
Annie will sich gerade wieder erheben – sicher, dass sie vor Schmerzen aufschreien wird –, als Hazel zu ihr herübereilt. »Komm schnell, du wirst gebraucht«, sagt sie und zerrt an Annies Ärmel.
Annie sieht sofort, dass es ein Problem gibt, als sie die Station betreten. Ein Tumult in der Mitte des Bettenmeeres. Ein Mann schreit und schlägt um sich, um den Pfleger loszuwerden, der versucht, ihn festzuhalten. Sogar von der anderen Seite des Raums sieht Annie, dass überall Blut ist. Ein Meer aus Rot. Einen Moment lang gerät Annie vor Ekel ins Taumeln.
Hazel verpasst ihr einen kleinen Schubs. »Hilf Gerald. Ich werde einen Arzt holen.«
Annie sieht erst, als sie an seinem Bett ist, was geschehen ist: Der Mann hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Er hat den Verband von seiner frischen Amputation gerissen und die Nähte geöffnet. Es sieht aus, als hätte er sich auch mit einem groben Schnitt die Kehle durchtrennt, doch Annie ist sich nicht sicher, wie er das gemacht hat. Sie starrt ihn an, zu überwältigt, um etwas tun zu können. Gerald, der von dem Blut des Mannes durchnässte Pfleger, drückt ihn auf die Matratze, kann aber nichts anderes machen. Er blickt Annie mit großen Augen an. »Wenn’s beliebt? Versuchen Sie, die Blutung zu stoppen. Beeilung!« Der Blutverlust ist stark, der Mann verliert unter Geralds Gewicht schon das Bewusstsein.
Blut erblüht unter den Bandagen, rot in der Mitte, schwarz an den Rändern. Annie weiß nicht, was sie tun soll. Sie blickt sich einen Moment lang um, dann entdeckt sie die Strümpfe des Mannes auf dem Boden. Sie macht sich ans Werk, fast ohne darüber nachzudenken: Sie hebt einen Strumpf auf, wickelt ihn wie einen Druckverband um den Oberschenkel des Mannes und zieht den Knoten so fest zu, wie sie nur kann. Den anderen legt sie um seinen Hals, aber nicht so eng, dass es ihm den Atem abschnürt. Sie reißt das Laken in Streifen und verbindet damit seine Kehle wie bei einer Mumie. Schließlich erschlafft der Mann und bleibt regungslos liegen, und Gerald kann zum Vorratsschrank rennen, um einen richtigen Druckverband und frische Bandagen zu holen. Sie beugt sich über den bewusstlosen Mann und versorgt ihn eilig, bis Gerald zurückkehrt.
Und dann erst bemerkt sie, dass sie das Gesicht des Patienten kennt. Vor ein paar Stunden hat sie sich mit diesem Mann unterhalten. Es ist der mit den traurigen Augen. Der Name seiner Frau ist Maisie. Vor dem Krieg war er Dachdecker. Wie soll er mit nur einem Bein seiner Arbeit nachgehen? Er würde niemals die Leiter rauf- und runterkommen. Was er denn nun tun solle, hatte er gesagt, für einen anderen Beruf sei er zu alt.
Hazel kommt mit einem Arzt herbei. Sie blicken Annie in ihrer blutverschmierten Uniform einen Moment lang schief an, bevor sie sich um den Patienten kümmern. Der Arzt blafft Hazel und dem Pfleger Anweisungen zu. Es geht zu wie bei einem Zugunglück. Sie kommt aus den Trümmern gekrochen. Ihr Moment ist vorüber, und Annie kann nur noch wie benommen davontaumeln. Dies ist alles ihre Schuld. Hat sie vielleicht etwas überhört, als sie vorhin mit ihm sprach? Sie wird das Gefühl nicht los, dass sie hätte merken müssen, was er vorhat. Hätte spüren müssen, dass ihm der Lebenswille verloren geht wie eine Änderung des Luftdrucks.
Wie durch ein Wunder findet Violet Jessop sie in dem Gang, durch den sie wie im Delirium schwankt. »Du kannst hier draußen nicht mit Blut bedeckt herumstehen«, sagt sie so aufgekratzt und pflichtbewusst, wie sie es auf der Titanic gewesen war – als hätten sie seitdem Seite an Seite gearbeitet, anstatt all die Zeit voneinander getrennt gewesen zu sein. Sie packt Annie beim Arm, und Annie, zu schwach und überfordert, widersetzt sich ihr kaum. Nach einigem Hin und Her – Annie kann sich nicht an den Weg zu ihrer Kabine erinnern, obwohl der Grundriss des Schiffes derselbe wie der von der Titanic ist – finden sie Annies Zimmer. Violet setzt sich auf das Bett, während Annie ihre Hände und ihr Gesicht schrubbt und sich wieder ihr abgelegtes Kleid anzieht.
»Es tut mir leid, dass du das durchmachen musstest, und so schnell«, sagt Violet, während sie Annies dichtes Haar ausschüttelt, als würde sie sie von der Last des Tages befreien können. Sie nimmt eine Bürste und kämmt Annie, die wie ein Schulmädchen auf ihrem Stuhl hockt. Wie betäubt. »Ich wünschte, ich könnte dir sagen, dass es nicht immer so ist, aber zur Wahrheit gehört, dass es manchmal brutal ist. Die Ärzte sagen, dass sie noch nie schlimmere Kriegsverletzungen als hier gesehen haben. Was diesen armen Männern widerfährt, bricht einem das Herz.«
»Eine Stunde vorher habe ich noch mit ihm gesprochen.«
»Du darfst dir deswegen keine Vorwürfe machen.« Violet steckt Annies dichtes Haar zusammen. »Wenn jemand Schuld hat, dann Schwester Merrick. Sie hätte dir an deinem ersten Tag nicht so viel zumuten dürfen. Komm, wir besorgen dir eine warme Mahlzeit – hast du heute überhaupt schon etwas gegessen? –, und dann ab ins Bett mit dir.«
Nach dem Abendessen macht sich Violet auf den Weg, um ihre Schicht anzutreten, und Annie schlendert hinaus auf die Promenade, um ein bisschen frische Luft zu schnappen, bevor sie sich schlafen legt. Sie blickt über das stetig steigende und fallende Wasser. Sie dreht ihr Gesicht in den Wind und erinnert sich, wie es ist, draußen auf dem Meer zu sein, sich immer vorwärtszubewegen, auf ein unsichtbares Ziel zu – auf ein Ufer, oder auf die Vorstellung eines Ufers.
»Na, wen sehe ich denn da! Sagen Sie, wie war Ihr erster Tag?« Charlie Epping steht plötzlich neben ihr an der Reling, eine selbst gedrehte Zigarette zwischen seinen Lippen. Der Wind zieht den Rauch über ihr Gesicht.
»Es ist … alles ein bisschen viel.« Sie schafft es nicht, ihm in die Augen zu schauen.
»Am Anfang ist es immer schlimm. Das wird besser.« Er zieht noch einmal an seiner Zigarette. »Sie sind ein zähes Mädchen, Sie werden es schon überleben. Woher ich das weiß? Weil Sie die Titanic überlebt haben. Warum erzählen Sie mir nicht, wie es war? Violet spricht nicht gern darüber.«
»Würde es Ihnen keine Angst machen?«
Eine Wolke aus Rauch wabert über ihren Köpfen. »Nee. Ich schätze, da Sie’s überlebt haben, werden wir, wenn diesem alten Mädchen etwas zustößt, es auch überleben.«
Was weiß sie noch von ihrer Zeit auf der Titanic? Alles, was sie tun muss, ist die Augen zu schließen, und schon kehrt es zu ihr zurück. Die Säle und das Gewusel und der Lärm. Die Ängste und das Geflüster und die Geheimnisse. Das verborgene Verlangen. Die Wellen, die gegen die Seiten des Bootes schlagen, so weit unter Deck, dass ihr Schaum wie eine Sinnestäuschung aussieht und nicht wie die tödliche Kälte, die sie in Wahrheit waren. Der Fall. Die Schreie. Die Dunkelheit der Nacht und die kleinen Leuchtsignale, die nutzlos auf und ab wippen, bis sie eins nach dem anderen erlöschen.
Sie wählt eine unbedenkliche Erinnerung, eine, die ihn nicht erschrecken wird. »Vor allem weiß ich noch, wie kalt das Wasser war.« Instinktiv streicht sie sich über die Oberarme, als würde sie diese Phantomkälte wegreiben können.
»Violet erzählte, Sie sind hineingesprungen, um ein Baby zu retten.«
Sie spürt einen dumpfen Schlag auf der Innenseite ihrer Schädeldecke, als würde ein Klöppel eine Glocke erklingen lassen. »Ja … das stimmt. Das habe ich getan.« Wie konnte sie das nur vergessen?
»Dann sind Sie eine Heldin, Miss Hebbley«, sagt er mit einem Lachen.
Und doch verschafft ihr die Erinnerung daran ein Gefühl von Kälte und Leere. Sie fühlt sich überhaupt nicht wie eine Heldin. Und sie erinnert sich an nichts von dem, was danach geschehen ist.
Noch einmal blickt sie über die Reling, hinunter zu den Wellen, die gegen die Seite des Schiffes schlagen. Dunkles grüngraues Wasser, Schaumkronen wie weiße Rüschen. Der Wind zupft ein paar Strähnen aus ihrem Haar und bläst sie ihr in die Augen … Und noch einmal spürt sie, wie sie von dem Wasser umschlossen wird, wie sie ihm nachgibt, wie sie von einer Macht gerufen wird, von der sie nichts weiß, die sie aber sofort erkennt. Wie eine Stimme, die ihr zuruft, nach Hause zu kommen.