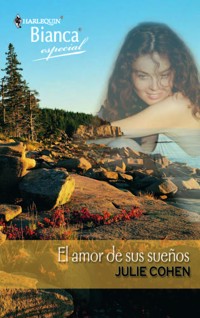5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diana Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es ist ein Morgen wie jeder andere, als Robbie neben seiner schlafenden Frau Emily erwacht. Wie immer steht er vor ihr auf und kocht Kaffee. Doch an diesem Morgen schreibt er einen Brief und tut damit etwas, was Emily das Herz brechen wird. Robbie weiß: Er muss diesen Preis bezahlen, um ihre Liebe zu schützen. Denn niemand darf erfahren, welches Geheimnis Emily und er seit fünf Jahrzehnten hüten …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Zum Roman
Es ist ein Morgen wie jeder andere, als Robbie neben seiner schlafenden Frau Emily erwacht. Wie immer steht er vor ihr auf und kocht Kaffee. Doch an diesem Morgen schreibt er einen Brief und tut damit etwas, was Emily das Herz brechen wird. Robbie weiß: Er muss diesen Preis bezahlen, um ihre Liebe zu schützen. Denn niemand darf erfahren, welches Geheimnis Emily und er seit fünf Jahrzehnten hüten …
»Ein glänzend geschriebener Roman über zwei Leben und eine große Liebe.« The Independent
»Mutig und wunderschön.« The Irish Times
Zur Autorin
Julie Cohen wurde in Maine, USA, geboren und verbrachte ihre Kindheit zwischen Büchern in der Bibliothek. Sie studierte Literatur an der Brown und der Cambridge University, und wenn sie nicht gerade an ihren Romanen arbeitet, leitet sie Schreibworkshops. Sie lebt mit ihrer Familie und ihrem Hund in Berkshire, England. Am Ende dieses E-Books finden Sie ein Interview mit der Autorin.
Julie Cohen
Das
geheime
Glück
Roman
Aus dem Englischen
von Babette Schröder
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe 01/2019
Copyright © 2017 by Julie Cohen
Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel Together bei Orion Books, an imprint of The Orion Book Group Ltd, London
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2018 by Diana Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Heiko Arntz
Umschlaggestaltung: t. mutzenbach design, München, nach der Originalcovergestaltung von © studiohelen.co.uk
Satz: Leingärtner, Nabburg
Alle Rechte vorbehalten
e-ISBN 978-3-641-22849-1V001
www.diana-verlag.de
Besuchen Sie uns auch auf www.herzenszeilen.de
Für Teresa
und
für Harriet
»Es ist, kurz gesagt, Musik, die weder Ende noch Anfang achtet, Musik ohne wirklichen Höhepunkt und ohne wirkliche Auflösung, Musik, die – wie es von den Liebenden bei Baudelaire heißt – ›sanft ruht auf des ungebundenen Windes Schwingen‹.«
Glenn Gould über Bachs Goldberg-Variationen, 1956
TEIL EINS
2016
1
SEPTEMBER 2016
CLYDE BAY, MAINE
Als Robbie erwachte, war es draußen noch dunkel. Sie hatten bei offenen Fenstern geschlafen, und er hörte, wie die Wellen an die Felsen schlugen. Das Geräusch war immer da, weshalb er es kaum noch wahrnahm, doch an jenem Morgen hörte er es. Ebenso wie Emilys Atemzüge. Einen Moment blieb er im Bett liegen, lauschte auf ihren Atem und das Meer, stetig und vertraut, als ob beides ewig so weitergehen müsste.
Emily hatte den Po an seine Hüften gekuschelt und ihre Füße um seine geschlungen. Meist drehte er sich morgens auf die Seite und legte den Arm um ihre Taille, dann schmiegte sie sich im Schlaf an ihn, und sie blieben eine Weile so liegen. So lange, dass er noch die Wärme ihres Körpers an seinem spürte, wenn er schließlich aufstand und sie schlafend im Bett zurückließ und ihn der Duft ihres Haars bei seinem üblichen Morgenprogramm begleitete.
Wenn alles so bliebe, wie es war, und sie so weitermachten wie bisher, würde sich diese eine Sache niemals ändern, da war er sich sicher. Nicht der Rhythmus ihres Schlafes und nicht die Art, wie sie sich berührten. So hatten sie seit ihrer ersten gemeinsamen Nacht vor vierundfünfzig Jahren zusammen geschlafen, und seither bereute er jede einzelne Nacht, die sie nicht im selben Bett verbrachten. Robbie wusste, dass sich sein Körper selbst dann noch an Emily erinnern würde, wenn er so lange lebte, dass sein Kopf sie irgendwann vergessen hatte.
Allein für diese Momente der Berührung lohnte es sich zu leben. Ihm selbst hätte das gereicht. Aber er musste an Emily denken.
Seit jenem Tag vor über fünfzig Jahren, an dem er sie kennenlernte, hatte er alles immer nur für Emily getan, und dies war das Letzte, das er für sie tun musste. Jetzt, solange er es noch konnte.
Robbie löste sich von Emily, ohne sie aufzuwecken, und setzte sich auf die Bettkante. Er war jetzt achtzig Jahre alt und körperlich in ziemlich guter Verfassung – abgesehen von einer alten Oberschenkelverletzung, die sich bei Regenwetter meldete. Auch im Spiegel machte er dieser Tage noch halbwegs eine gute Figur, obwohl sein Haar inzwischen fast völlig ergraut war und er die ledrige, alterslose Haut eines Mannes besaß, der sich Zeit seines Lebens überwiegend draußen aufgehalten hat. Vermutlich würde sein Körper es noch zehn, fünfzehn Jahre machen. Salzluft konserviert, sagte man, wenn von alten Seeleuten die Rede war.
Ohne groß nachzudenken zog er sich im Halbdunkel an, so wie fast jeden Morgen, außer an manchen Sonntagen. Dann ging er die Treppe hinunter. Er ließ die Hand über das Geländer gleiten, das er selbst aus einem einzigen Stück Eichenholz geschnitzt hatte. 1986 war das gewesen – Adam war damals zehn.
Neuerdings testete er sich an Daten wie diesen und wiederholte sie, um sie, wenn möglich, nicht zu vergessen. 2003 haben Adam und Shelley geheiratet. 1977 sind wir nach Clyde Bay gezogen. Emily lernte ich 1962 kennen. Ich wurde 1936 geboren, während der Wirtschaftskrise. In Pension gegangen bin ich 19… Nein, ich war siebzig, oder war ich … Wo war ich stehen geblieben?
Robbie sah auf. Er stand in der Küche. Die Schränke hatte er selbst gebaut. Er füllte den Kessel, um Kaffee zu kochen. Jeden Morgen tat er dasselbe, während Emily oben schlief. Bald würde Adam gähnend von oben herunterkommen, um Zeitungen auszutragen, bevor er zur Schule ging.
Ein Hund stupste ihn am Bein an. »Eine Minute noch, Bella«, sagte er munter und blickte nach unten, doch es war nicht Bella. Dieser Hund hatte einen weißen Fleck auf der Brust, und Bella war ganz schwarz, es war … es war Bellas Sohn, es war …
Ein anderer Hund gähnte geräuschvoll und erhob sich mit steifen Gliedern von seinem Kissen in der Ecke der Küche, ein schwarzer Hund mit etwas Grau an der Schnauze und einem weißen Fleck auf der Brust. Robbie sah von dem alten zum jungen Hund, und der junge stupste seine Hand an, wedelte mit dem Schwanz und hieß Rocco. Plötzlich fiel es ihm wieder ein. Das hier war Rocco und der alte sein Vater Tybalt, und Bella war Tybalts Mutter gewesen und schon seit dreizehn Jahren tot.
Robbies Hand zitterte, als er die Tür öffnete, um die beiden Hunde hinauszulassen.
Es war wie der Nebel auf See, der still aus dem Nichts kam und einen so vollständig einhüllte, dass man gar nichts mehr sah, nicht einmal die eigenen Segel. In einem solchen Nebel konnte man nur mithilfe der Instrumente navigieren, nicht mehr auf Sicht. Doch in diesem Nebel versagten die Instrumente. Man segelte in Gewässern, die man kannte wie seine Westentasche, und konnte nicht sagen, wo man sich befand. Man konnte auf einen Felsen auflaufen, dem man schon eine Million Mal ausgewichen war, den man kannte wie einen alten Freund. Oder einen völlig falschen Kurs nehmen und nie wieder zurückfinden.
Er kümmerte sich nicht mehr um den Kaffee, nahm sich ein Stück Papier und einen Stift, setzte sich an den Küchentisch und schrieb Emily den Brief, den er nun schon seit Tagen in seinem Kopf formulierte. Er schrieb schnell, bevor der Nebel zurückkam und ihn aufhielt. Die Formulierungen waren nicht so gewandt, wie es ihm lieb gewesen wäre. So vieles blieb unausgesprochen. Andererseits hatte er Emily immer gesagt, dass er kein Poet war.
Ich liebe dich, schloss er. Du bist mein Anfang und mein Ende, Emily, und jeder Tag dazwischen.
Und das war eigentlich auch schon alles, was er sagen wollte. Das fasste alles zusammen.
Sorgsam faltete er das Papier und schrieb Emily auf die Außenseite. Mit dem Brief in der Hand trat er durch die Küchentür in den Garten, wo ihn die Hunde schwanzwedelnd und hechelnd begrüßten.
Es war das Dämmerlicht vorm Sonnenaufgang. Tybalt und Rocco folgten ihm bei seinem Gang um das Haus, das er für Emily und sich gebaut hatte. Er überprüfte die Fenster, die Stufen zur Veranda, die Türen und die Schindelwände, dann blickte er zum Dach mit den drei Giebeln hinauf und zum Schornstein. Den Sommer hatte er mit Reparaturen verbracht. Um für den heutigen Tag vorzusorgen.
Jetzt gab es nichts mehr zu tun. Alles war gut in Schuss. Der Winter war zwar noch fern, aber Emily würde sich keine Sorgen machen müssen. Danach würde Adam ihr helfen. Vielleicht kam auch William zurück und packte mit an.
Vor den Zedernholzschindeln an der Seite des Hauses wuchs ein Wildrosenstrauch. Letzten Monat hatte er noch von zahlreichen Blüten geleuchtet, nun waren nur noch wenige übrig, die das Ende des Sommers erwarteten. Er pflückte eine Rose vom Strauch, vorsichtig, wegen der Dornen. Sie war rosa und im Innern gelb, mit zarten, ebenmäßigen Blütenblättern.
Er pfiff nach den Hunden, und sie folgten ihm zurück ins Haus. Er schüttete ihnen etwas Futter in die Schalen und wechselte das Wasser in ihren Trinkschüsseln. Dann streichelte er ihnen über die Köpfe und kraulte sie hinter den Ohren.
Danach ging er mit dem Brief und der Rose in Händen die Treppe zum Schlafzimmer hinauf.
Emily schlief noch, sie hatte sich nicht bewegt. Er schaute auf sie hinab. In ihrem Haar glänzten Fäden aus Silber und Sonne, ihre Haut war im Schlaf entspannt. Sie war das Mädchen, das er 1962 kennengelernt hatte, das Mädchen, bei dem er dachte, er hätte sein ganzes Leben auf sie gewartet. Er überlegte, sie zu wecken, um noch einmal ihre Augen zu sehen. Sie hatten dieselbe Farbe wie das Meer, als er es 1952 zum ersten Mal gesehen hatte, ein Blauton, wie er ihn sich bis dahin nicht einmal hatte vorstellen können.
Doch wenn er sie weckte, um zum letzten Mal ihre Augen zu sehen, würde es nicht das letzte Mal sein, denn sie ließe ihn niemals gehen.
Und wenn er es immer wieder verschob, würde ihn eines Tages der Nebel für immer umgeben. Er kam unbemerkt, doch dann war er plötzlich überall. Gerade konnte man noch klar sehen, im nächsten Moment war man blind – mehr als blind, denn man wusste nicht einmal mehr, wie es war, sehen zu können.
Er legte den Brief neben das Wasserglas auf ihren Nachttisch. Wenn sie aufwachte, würde er das Erste sein, was sie sah. Auf den Brief legte er die Wildrose. Dann beugte er sich hinunter und küsste sie zärtlich auf die Wange. Er füllte seine Lungen mit ihrem Duft.
»Ich hätte dich niemals vergessen«, flüsterte er, leiser als das Meer draußen.
Dann richtete er sich auf und ließ sie schlafend zurück. Er hatte es sich schwer vorgestellt, aber einst war es ihm noch schwerer gefallen, von ihr fortzugehen. Als sie sich zum ersten Mal voneinander verabschiedet hatten.
Diesmal war es leichter. Denn nun lagen so viele gute Jahre hinter ihnen. Jedes einzelne der gemeinsamen Jahre war gut, war es wert gewesen, durch und durch.
Robbie verließ das Haus durch die Vordertür, damit er die Hunde nicht noch einmal sehen musste. Er ging die Verandastufen hinunter und weiter die abschüssige Einfahrt bis ans Ende des Hofes. Dann überquerte er die Straße und betrat auf der anderen Seite den schmalen Trampelpfad durchs Gestrüpp. Die Zweige streiften seine Hose. Er folgte dem Pfad hinunter, bis er schließlich die Bucht erreichte. Grauer Maine-Granit, fast schon ins Schwarze spielend. Wenn man genau hinsah, glitzerten kleine Glimmerkörner darin wie Diamanten.
Er zog Schuhe und Strümpfe aus und stellte sie auf einem hohen Gesteinsbrocken ab, wo die Gischt nicht hinkam. Daneben zusammengefaltet Hemd und Hose. Barfuß trat er auf den äußersten Felsen, der feucht war von den Wellen und glitschig vom Seegras.
Er hatte sich vorgestellt, dass es heute vielleicht neblig sein würde, doch das war es nicht. Es herrschte klare Sicht, und die Sonne ging auf. Goldtöne und Rosa, ähnlich wie die Farben der Heckenrose, die er bei Emily zurückgelassen hatte. Es würde ein schöner Tag werden, einer jener Tage, an denen man Monhegan Island am Horizont sehen konnte. Hummerkörbe lugten aus dem Wasser, blau, weiß und rot. Er wusste, wem sie gehörten und wann sie mit ihren Booten kamen, um sie hochzuziehen. Das dauerte noch eine Weile.
Ihm blieb genug Zeit.
Er sprang. Sein Körper machte kaum ein Geräusch, als er in die Wellen eintauchte.
Er war schon immer ein guter Schwimmer gewesen. Es fiel ihm leicht. Er sei ein halber Fisch, pflegte Emily zu sagen. Er schnitt durch die Wellen. Obwohl der Sommer viel Zeit gehabt hatte, das Wasser zu erwärmen, war es so kalt, dass es einem den Atem raubte. Doch wenn man immer in Bewegung blieb, ging es. Eine Zeit lang jedenfalls. Bis einen irgendwann die Strömung erfasste. Die Trümmer eines Bootes, das in Marshall Point, eine Viertelmeile nördlich von hier, auf Grund gelaufen war, hatte man irgendwann im fernen Neufundland entdeckt.
Er schwamm weiter und hielt den Blick auf den Horizont gerichtet. Es dauerte lange, bis er erschöpft war. So lange, dass er noch sah, wie vor ihm die Sonne aus dem Wasser aufstieg, ein warmes Licht, das über das Meer bis zu ihm hin strahlte. Es würde auch ins Fenster des Zimmers scheinen, in dem Emily schlief, und ihr Haar und ihre Wangen streicheln.
Robbie schwamm immer weiter, bis er nicht mehr konnte, dann ließ er sich vom Wasser forttragen, zu etwas, das größer war als er, unendlich viel größer als die Erinnerung.
2
JULI 2016
CLYDE BAY, MAINE
Die Torte war aufgegessen, der Eistee getrunken. Emily saß in der Nachmittagssonne am Picknicktisch in ihrem Garten und hielt Robbies Hand. Vom Meer wehte eine Brise herüber und verhinderte, dass es zu heiß wurde.
»Mit einer Torte hatte ich nicht gerechnet«, sagte sie zu Adam und Shelley, »aber sie war köstlich. Vielen Dank.«
»Wir konnten doch an eurem Hochzeitstag nicht nur mit Eiscreme ankommen«, antwortete ihr Sohn. »Dreiundvierzig Jahre sind schließlich kein Pappenstiel.«
»Nur noch sieben Jahre, dann habt ihr fünfzig geschafft«, bemerkte Shelley, ihre Schwiegertochter.
Robbie drückte unter dem Tisch ihre Hand. Francie, die mit vier ihr jüngstes Enkelkind war, wischte sich einen Klacks Buttercreme von der Wange und fragte: »Was ist denn ein Hochzeitentag?«
»Hochzeitstag. Da feiert man den Tag, an dem zwei Leute geheiratet haben«, erklärte ihr Vater Adam. Francie hatte Adams blondes Haar und Shelleys dunkle Augen und Sommersprossen. Die beiden älteren, Chloe und Bryan, waren richtige Rotschöpfe, als Einzige in der Familie. Manchmal witzelte Adam über rezessive Gene und den Postboten, was immer damit endete, dass Shelley ihn im Spaß boxte.
Rocco ließ einen Ball vor Bryans Füße fallen, und schon sprang der Junge auf und schleuderte ihn über den Rasen, damit der Labrador ihn jagen konnte. Tybalt, der ältere Hund, lag hechelnd im Schatten eines Baumes. Chloe, die es mit zwölf Jahren vorzog, bei den Erwachsenen zu bleiben, malte mit verschüttetem Eistee Gesichter auf den Tisch und fragte: »Wo sind deine Hochzeitsfotos, Oma? Ich habe noch nie dein Hochzeitskleid gesehen.«
Emily lächelte. »Das liegt daran, dass ich keins hatte. Wir sind durchgebrannt, dein Großvater und ich.«
»Weil ich von Natur aus romantisch bin«, erklärte Robbie. »Ich habe deine Großmutter im Sturm erobert, und sie hat keine Ruhe gegeben, bis ich ihr den Ring an den Finger gesteckt habe.«
»Nach meiner Erinnerung warst du derjenige, der darauf bestand, mir einen Ring überzustreifen.« Sie berührte ihn mit dem Daumen, golden, in der Form zweier verschränkter Hände.
»Darf ich ihn sehen?«, fragte Chloe, und Emily drehte ihn sich vom Finger. Es war nicht einfach, mit dem Alter waren ihre Knöchel geschwollen. Sie ließ den Ring in Chloes erwartungsvoll vorgestreckte Hand fallen und sah ihrer Enkelin dabei zu, wie sie ihn drehte und bewunderte. »Er sieht aus, als ob er kein Ende hätte«, sagte sie. »Die eine Hand verwandelt sich in die andere, und sie halten sich gegenseitig fest.«
»Genau deshalb habe ich ihn ausgesucht«, sagte Robbie. Er ließ ihn sich von Chloe geben und reichte ihn Emily, die ihn nahm und lächelnd wieder überstreifte.
»War es Liebe auf den ersten Blick?«
Chloe interessierte sich sehr für das Thema Liebe auf den ersten Blick, das wusste Emily. Das Mädchen verschlang ein Buch nach dem anderen mit Liebesgeschichten über junge Erwachsene, von denen die meisten mit schrecklichen Krankheiten, beängstigenden Zukunftsvisionen oder Vampiren zu tun hatten. Auf Empfehlung ihrer Enkelin hatte Emily selbst ein paar davon gelesen und sie sehr genossen.
»Auf den ersten Blick, absolut«, sagte Robbie. »In der Sekunde, in der ich eure Großmutter sah, wusste ich sofort, dass sie die Einzige für mich ist. Und dir ging es nicht anders, oder, Emily?«
»Ich habe bemerkt, dass du sehr gut aussiehst. Dass ich sofort an die Ehe gedacht habe, kann ich nicht sagen.«
»Du dachtest, dass ich der attraktivste Mann bin, den du jemals gesehen hast«, korrigierte Robbie.
»Ja.« Sie lächelte und blickte auf sein silbergraues, volles Haar. Da waren immer noch dieses Funkeln in seinen dunklen Augen und dieser heitere, selbstbewusste Zug um seinen Mund. »Der attraktivste Mann, den ich jemals gesehen hatte. Und auch so überzeugt von sich wie keiner sonst.«
»Aus gutem Grund.«
»Aus sehr gutem Grund.«
»Wo seid ihr gewesen?«, fragte Chloe.
»In einem Bahnhof«, antwortete Robbie. »Ich entdeckte sie auf der anderen Seite einer sehr vollen Halle.«
Emily drückte wieder kurz seine Hand. »Nein, Schatz«, sagte sie. »Es war in einem Flughafen.«
Er blinzelte sie an. Ganz kurz huschte ein Schatten über sein Gesicht, so schnell, dass nur sie es bemerkte. »Ach ja, stimmt. Ein Flughafen, 1972.«
»In Florida«, sagte Adam, »wo ich geboren wurde. Eines Tages müssen wir noch mal hinfliegen. Ich kann mich an gar nichts mehr erinnern.«
»Nach Disneyland«, schlug Francie sofort vor und kletterte zu ihrem Vater auf den Schoß.
»Vielleicht.« Er küsste ihren blonden Scheitel. »Wir könnten auch nach England fliegen, wo eure Großmutter geboren wurde.«
»Dann seid ihr also durchgebrannt und von England nach Amerika gezogen?«, hakte Chloe nach. »Und du hattest kein Kleid und keine Blumen oder so was?«
»Wir sind einfach gemeinsam in den Sonnenuntergang gesegelt«, sagte Emily.
»In demselben Boot, das ihr jetzt habt?«
»Damals war es ein anderes Boot.«
»Damals hast du nasse Füße gekriegt«, bemerkte Robbie. »Aber ich habe dich gerettet.«
»Wir haben uns gegenseitig gerettet«, korrigierte Emily. »Und seitdem haben wir uns nicht mehr getrennt, außer dann und wann vielleicht für ein, zwei Nächte.«
»Das ist so romantisch«, seufzte Chloe.
Emily musste schlucken, als sie aus der Ferne der Jahre das Echo einer anderen Zwölfjährigen hörte. Sie hatte dunkle Haare, keine roten. Genau dasselbe hätte Polly damals auch gesagt. Sie warf einen kurzen Seitenblick zu Robbie, um zu sehen, ob er es auch bemerkt hatte, doch er lächelte nur seine Enkelin an.
»Eigentlich«, sagte Emily, »sind Romanzen ganz schön anstrengend. Das alltägliche Leben gefällt mir viel besser.«
»Mir nicht«, erwiderte Chloe.
»Die Geschichte deiner Eltern ist genauso romantisch«, erklärte Robbie. »Sie haben sich an einem Fotokopierer kennengelernt.«
»Dein Vater«, sagte Shelley, »war nie auf den Kurs in amerikanischer Geschichte vorbereitet und kam regelmäßig früher zur Schule, um Arbeitsblätter zu kopieren – immer dann, wenn ich Gedichte für den Leistungskurs Englisch fotokopieren wollte.«
»Sie hat ein halbes Semester gebraucht, bis sie gemerkt hat, dass das Absicht war«, sagte Adam.
»Bäh«, bemerkte Chloe. »In einer Schule passiert doch nie etwas Romantisches.«
Emily sah, wie Adam und Shelley einen Blick wechselten – die Komplizenschaft verheirateter Paare, die ohne Worte kommunizierten.
Der achtjährige Bryan kam keuchend angelaufen. »Opa, Rocco möchte schwimmen. Darf ich mit ihm gehen?«
»Hier nicht«, sagte Adam. »Vor dem Haus ist die Strömung zu stark.«
Robbie stand auf. »Ich bringe euch runter zur Bucht«, schlug er vor. »Unten am Pier kannst du so viele Bälle für ihn werfen, wie du willst. Ihr werdet nicht alle ins Dinghy passen, aber ich borge mir bei Little Sterling eine Barkasse und fahre euch hin, wenn ihr wollt. Magst du mitkommen, William?«
»Ich bin Francie«, sagte Francie.
»Aber natürlich. Magst du mitkommen, Francie?«
Das kleine Mädchen hüpfte vom Schoß ihres Vaters und legte ihre Hand in die ihres Großvaters. »Darf ich beim Laden ein Eis haben?«
»Du hattest gerade ein Eis«, gab Shelley zurück, doch Robbie zwinkerte dem kleinen Mädchen zu und sagte: »Schhh, sag deiner Mutter nichts davon.«
»Ich komme auch mit«, erklärte Chloe. »Mama, leihst du mir dein Handy?«
Shelley rollte die Augen, gab es ihr jedoch.
»Kommst du mit, Em?«, fragte Robbie. »Ich kaufe dir auch ein Eis. Für meinen Schatz das größte Eis, das du jemals gesehen hast.«
»Adam begleitet dich, oder, Adam?« Adam nickte, und Emily küsste Robbie auf die Wange. »Ich bleibe hier und kümmere mich um den Abwasch. Trockne die Hunde und die Kinder ab, bevor du sie wieder ins Haus lässt.«
Er küsste sie, und sie sah ihm hinterher, wie er sich in Begleitung ihres Sohnes und umringt von Enkelkindern und Hunden entfernte. Abgesehen von seinem grauen Haar könnte er immer noch der Mann sein, den sie vor so vielen Jahren kennengelernt hatte. Damals hätten sie sich nicht vorstellen können, wie alles kommen würde.
Er hatte »William« zu Francie gesagt.
Die beiden Frauen räumten in der Küche den Geschirrspüler ein. Sie arbeiteten entspannt Hand in Hand. Einige von Emilys Freundinnen hatten Probleme mit ihren Schwiegertöchtern, doch Emily wusste, dass sie das große Los gezogen hatte. Shelley erzählte von ihren Plänen für das kommende verlängerte Wochenende unmittelbar vor dem 4. Juli. Sie wollten mit den Kindern nach Rangeley fahren, wo Shelleys Familie ein Ferienhaus am See hatte, und ein paar Wochen dort oben bleiben, damit die Kinder mit ihren Cousins spielen und Shelley ihre umfangreiche Familie sehen konnte. »Das ist das Schönste am Lehrerberuf«, sagte sie, während sie die Tortenreste einpackte. »Die Sommerferien.«
»Ich glaube dir kein Wort«, erwiderte Emily. »Du liebst deine Schüler.«
»Kommt doch mit. Du und Robbie, ihr wärt herzlich willkommen, und wir haben ein zusätzliches Zimmer für euch. Ihr könnt die Hunde mitnehmen, denen wird der See gefallen. Mein Bruder hat ein kleines Segelboot und kann nicht einmal segeln.«
»Hört sich gut an. Ich muss Robbie fragen. Er hat diesen Sommer eine Menge am Haus zu tun.«
»Adam sagt, offensichtlich hat er sechs Projekte auf einmal am Start. Und dabei hat Robbie ihm als Kind immer eingeschärft, dass er erst eine Arbeit beenden soll, bevor er die nächste beginnt.«
»Ach ja?«, sagte Emily vage. »Na ja, er wird wohl eine Menge zu reparieren haben. Es war ein harter Winter. Hast du eigentlich in letzter Zeit etwas von William gehört? Er hat seit einem Monat nichts mehr von sich hören lassen.«
»Letzte Woche hat er eine E-Mail mit ein paar Fotos von den Kindern geschickt. Ich schick sie dir, falls du sie nicht bekommen hast.« Shelley öffnete die Kühlschranktür, um die Milch zurückzustellen, und zögerte. »Nanu. Was ist das denn?«
»Was?«
Shelley holte etwas aus dem Kühlschrank und hielt es hoch. Es war Robbies Geldbörse.
»Ohne die wird er Probleme kriegen, wenn er Eis kaufen will«, sagte Shelley und fing an zu lachen.
Emily wandte sich schnell ab und wieder dem Abwasch zu, damit ihre Schwiegertochter ihr Gesicht nicht sah. »Bestimmt hat eins der Kinder sie dort hineingelegt, um ihm einen Streich zu spielen«, sagte sie mit tonloser Stimme und spülte ein Glas. Doch sie wusste, dass es keines der Kinder gewesen war.
In der Ferne explodierten Feuerwerksraketen über Clyde Bay, etwa eine Viertelmeile von ihrem Haus entfernt. Ein paar Jahre hatten sie es vom Boot aus betrachtet, denn dann sahen sie die Lichter am Strand und die Reflexionen des Feuerwerks auf dem Wasser. In diesem Jahr waren die Kinder zu spät in Gang gekommen und Emily zu erschöpft gewesen, um das Boot vom Liegeplatz fortzubewegen. Das war das größte Problem beim Älterwerden: die schwindenden Kräfte. Und so schön dieser Nachmittag gewesen war, er war auch anstrengend. Sie hatte ständig Robbie im Auge behalten müssen und gleichzeitig auch Adam und Shelley, um zu sehen, ob sie etwas bemerkten.
Am frühen Abend hatte William angerufen und ihnen alles Gute zum Hochzeitstag gewünscht. Bei ihm in Alaska war es erst drei Uhr nachmittags. Er rief sie auf dem Handy und nicht über das Festnetz an, und an der Art, wie Adam und Shelley sich ansahen, als Emily ans Telefon ging, merkte sie, dass ihm einer der beiden eine SMS geschickt hatte, damit er sich meldete. Sie tat, als wüsste sie es nicht, als sie mit ihm plauderte, ihm von der Torte erzählte, vom Sonnenschein und dass die Hunde und die Kinder den halben Strand mit ins Haus geschleppt hatten. Williams Lachen, das fast einen Kontinent entfernt war, klang wie das von Robbie.
»Dein Vater würde gerne mit dir reden«, hatte sie gesagt und Robbie das Handy gereicht. »Es ist William.«
Sie beobachtete, wie Robbie das Telefon nahm. »Hallo, mein Sohn. Ja, danke. Alles gut da drüben? Gut, gut.« Dann herrschte Schweigen, und Emily versuchte zu hören, ob William am anderen Ende etwas sagte.
»Du willst bestimmt mit deinem Bruder sprechen.« Robbie hatte das Gerät an Adam weitergereicht. Emily hatte wie üblich geseufzt.
Vom Gästezimmer aus, das ihnen als Büro diente, konnte Emily durch das Fenster jetzt bunte Blitze sehen, das eigentliche Feuerwerk aber nicht. In einen Bademantel gehüllt saß sie am Schreibtisch und ging ihre E-Mails durch. Shelley hatte ihr, wie versprochen, Williams E-Mail weitergeleitet, sobald sie nach Hause gekommen war. Emily öffnete sie und betrachtete erfreut die Fotos von Williams beiden Kindern. Es war schwer für ihn, sich das Sorgerecht mit ihrer Mutter zu teilen, doch er lebte nur ein paar Meilen von ihnen entfernt und sah sie fast jeden Tag.
Das Mädchen, Brianna, sah ganz aus wie William, als er Kind gewesen war: die Zahnlücke, das dunkle Haar, selbst ihre Frisur war dem Haarschnitt sehr ähnlich, den William in den Siebzigerjahren getragen hatte. Brianna und ihr älterer Bruder John posierten mit Angelruten in den Händen vor den Pinien an einem See. Alaska war Maine sehr ähnlich, obwohl William behauptete, dass es dort sogar noch mehr Mücken gab. Emily wollte gerade nach Robbie rufen, damit er kam und sich die Bilder anschaute, als sie bemerkte, dass sie noch eine andere E-Mail erhalten hatte, von jemandem namens Lucy Knight. In der Betreffzeile stand Christopher.
Liebe Emily,
ich hoffe, es macht dir nichts aus, wenn ich dir aus heiterem Himmel einfach so eine E-Mail schreibe. Ich dachte, du würdest vermutlich wissen wollen, dass Christopher letzten Monat gestorben ist. Ich wünschte, ich hätte es dir schon früher mitgeteilt, aber seit er nicht mehr ist, brauche ich irgendwie für alles viel länger. Er hat nicht gelitten, er ist ganz plötzlich im Bett an einem Herzinfarkt gestorben. Als ich aufwachte, war er schon tot.
Ich weiß, wir sind uns, von dem einen Mal abgesehen, niemals begegnet, aber Christopher hat oft von dir gesprochen, als Kollegin und als Freundin. Die Zeit in Südamerika war für ihn die glücklichste seines Lebens – auch wenn er es nie so direkt ausgesprochen hat, weil er, wie du weißt, immer sehr zurückhaltend war. Die produktivste Zeit seines Lebens hat er sie jedenfalls immer genannt, eine Zeit, in der er wirklich Gutes getan hat. Er war ein guter Mann, und ich hatte das große Glück, dass ich ihn haben durfte. Ich vermisse ihn sehr.
Mit freundlichen Grüßen
Lucy Norris Knight
Sie schlug die Hand vor den Mund. Christopher.
»Liebling?« Robbie kam herein und legte die Hand auf ihre Stuhllehne. »Kommst du ins Bett?«
»Ich … ich habe mir gerade ein Foto von Brianna und John angesehen, und dann habe ich das hier bekommen. Es geht um Christopher.« Sie drehte den Stuhl so, dass Robbie über ihre Schulter hinweg die E-Mail lesen konnte.
»Oh Em, das tut mir leid.« Er zog einen zweiten Stuhl heran und legte ihr den Arm um die Schultern.
Ihr standen Tränen in den Augen. »Manchmal denke ich an ihn. Ich habe mich oft gefragt, wie er … Aber ich habe nicht gefragt. Ich weiß nicht, woher Lucy meine E-Mail-Adresse hat. Lucy ist seine Frau. Sie muss sie sich von irgendwem besorgt haben.«
»Polly?«
»Das bezweifle ich. Ich glaube nicht, dass Polly sie kennt. Vielleicht hat sie sie einfach im Internet gefunden.«
»Vielleicht hatte Christopher sie.«
»Er hat mir nie gemailt. Das letzte Mal habe ich ihn bei der Beerdigung meiner Mutter gesehen.« Sie schüttelte den Kopf. »Wenn ich jetzt an ihn denke, sehe ich ihn so vor mir, wie ich ihn in Cambridge gekannt habe. Ich kann ihn mir nicht als alten Mann vorstellen, nicht einmal so, wie er war, als wir … als wir zusammen in Bolivien waren. Ich sehe ihn als dünnen Kerl vor mir mit dieser adretten Frisur und der Hornbrille, die er damals trug. Seitdem ist ein ganzes Leben vergangen. Ist das nicht komisch?«
»Er war dein bester Freund.«
»Ja, das war er sehr, sehr lange. Bis du kamst.« Sie legte ihre Handfläche an Robbies Wange, er drehte sein Gesicht hinein und küsste sie.
»Tut mir leid«, sagte er. »Das ist eine traurige Nachricht.«
»Ich kannte ihn so gut. Ich wusste einmal alles über ihn.« Sie scrollte bis ans Ende der E-Mail, aber da stand nichts mehr. Nur die Information über Christophers Tod und die freundlichen Worte seiner Frau, die ihr nicht hätte schreiben müssen, es aber trotzdem getan hatte.
»Er wusste es«, sagte sie. »Er wusste … dass …«
Robbie zog leicht die Brauen zusammen. »Er wusste es?«
»Ich habe es ihm einmal gesagt. Aber er konnte es sich auch fast denken. Da waren wir noch in Cambridge und haben unsere Examina geschrieben. Wir haben nur einmal darüber geredet, und er hat es nie wieder angesprochen. Nicht einmal, als du und ich … Als ich ihn verlassen habe.«
»Glaubst du, er hat es seiner Frau erzählt?«
»Ich glaube nicht. Christopher war ein Gentleman. Ich habe ihm gesagt, es soll ein Geheimnis bleiben, und er hat sich daran gehalten. Er war ein anständiger Mensch.«
Robbie blickte ihr tief in die Augen. »Das heißt«, sagte er langsam, »dass es jetzt keinen anderen mehr gibt, der es weiß.«
Sie nickte.
»Polly auch nicht?«, fragte er.
»Ich weiß nicht einmal, ob Polly noch lebt. Aber ich glaube, sie wusste es nicht. Sie wollte es gar nicht wissen. Und was ist mit Marie?«
»Ich habe es ihr nie erzählt.«
»Also weiß es sonst niemand.«
»Nur du und ich«, sagte Robbie. »Wir sind die einzigen noch lebenden Menschen, die es wissen.«
»Ja«, bestätigte sie. »Ja. Nur du und ich.«
»Dann sind wir frei«, erwiderte er. »Endlich sind wir frei.«
3
Als Emily aufwachte, war Robbie nicht mehr da. Sie streckte den Arm aus und berührte sein Kissen. Es war noch warm, und da war noch der Abdruck seines Kopfes. Die Sonne war aufgegangen und schien durch ihr Schlafzimmerfenster.
Als sie nach Maine gezogen waren, konnten sie sich nur deshalb etwas an der Küste leisten, weil das Haus auf dem dazugehörigen Grundstück nahezu verfallen war: ein kastenartiges viktorianisches Bauernhaus, mit verwitterten Außenwänden, morschen Bodendielen und Löchern im Dach. Robbie hatte das Haus so umfassend renoviert, dass man es kaum noch wiedererkannte. Es besaß drei Giebel und war mit Zedernschindeln verkleidet. Zum Meer hin hatte es eine große Veranda. Fenster und Türen waren weiß gestrichen, und an der Seite gab es eine Werkstattgarage. Doch manchmal, wenn Emily am Haus hinaufblickte, sah sie dort das Gespenst jenes alten Gebäudes aus dem neunzehnten Jahrhundert stehen.
Ursprünglich lag das große Schlafzimmer auf der Rückseite des Hauses, am Wald, doch Robbie hatte es nach vorne verlegt. Er wollte den Ozean hören, wenn sie schliefen, und er wollte sehen, wie die Sonne aufging.
Tatsächlich war er meistens schon vor Sonnenaufgang wach.
Emily lächelte und lauschte, ob sie ihn irgendwo im Haus hören konnte. Manchmal pfiff er, wenn er von Raum zu Raum ging. Wenn er Musik hörte, dann immer Rockmusik, doch wenn er pfiff, war es Bach. Sie vermutete, dass es ihm nicht einmal bewusst war. Sein Pfeifen war wie ein Band, das jahrelang all die anderen Geräusche zusammengehalten hatte, das Kratzen der Hundekrallen auf dem Fußboden, die Schritte der Kinder in ihren Zimmern, das Radio in der Garage und das beständige Rauschen des Meeres.
Heute Morgen hörte sie ihn nicht, aber sie lauschte weiter.
Das Telefon klingelte. Sie ließ es ein paarmal läuten, wartete, ob Robbie unten an den Apparat ging, denn um diese Uhrzeit war es gewiss für ihn, nicht für sie. Als er nicht abhob, nahm sie den Hörer vom Zweitgerät, das auf seinem Nachttisch stand.
»Doktor Brandon?«
Sie erkannte die Stimme sofort. Den Québecer Akzent hatte er nie ganz ablegen können. »Guten Morgen, Pierre.«
»Ob Sie wohl mal kurz zur Anlegestelle herunterkommen könnten? Es ist nichts Schlimmes passiert, wir freuen uns immer, Bob zu sehen, aber …«
Sie setzte sich kerzengerade im Bett auf. »Was hat er angestellt? Geht es ihm gut?«
»Oh, Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Es geht ihm gut. Aber vielleicht sollten Sie doch lieber kommen.«
Sie zog sich schnell an und verließ das Haus. Sie nahm ihren Wagen. Dabei fiel ihr auf, dass Robbies Truck weg war.
Pierre hatte den Namen der Werft nicht geändert, als er sie Robbie abgekauft hatte, als dieser sich zur Ruhe setzen wollte. Auf dem Schild stand noch immer blau auf weiß: Brandon’s Boatyard. Es sah so aus, als hätte Pierre es kürzlich neu gestrichen. Als sie dort eintraf, wartete Pierre am Eingang von einer der Hallen auf sie, neben ihm Little Sterling, beide mit Einweg-Kaffeebechern in Händen. Pierre war klein und drahtig. Seine Vorfahren waren Waldarbeiter gewesen. Little Sterling war trotz seines Namens ein wahrer Hüne und von Haus aus Hummerfischer. Gemeinsam wirkten die beiden wie Laurel und Hardy, heute Morgen konnte Emily jedoch absolut nichts Komisches an ihnen finden.
»Er war schon da, als ich heute Morgen hergekommen bin«, erklärte Pierre. »Und seither arbeitet er pausenlos, will keinen Kaffee und nichts. Er meint, er müsse die Ketsch bis zum Wochenende fertig bekommen. Die hat aber überhaupt keinen Termin, ist schließlich gestern erst reingekommen.«
Sie sahen alle zu Robbie, der auf der Rampe, die ins Wasser führte, an einem Boot arbeitete. Er kehrte ihnen den Rücken zu.
»Wusste er …« Sie schluckte. »Wusste er, wer Sie sind?«
»O ja, das wusste er. Er hat gesagt, ich würde die Lehrzeit niemals überstehen, wenn ich den ganzen Tag nur Kaffee trinke.«
»Ist mit ihm alles in Ordnung, Doc?«, erkundigte sich Little Sterling.
»Ja, alles bestens«, sagte sie mit Bestimmtheit und ging zur Slipanlage hinunter. Ihre Schritte auf dem hölzernen Steg kündigten ihr Kommen an. Robbie blickte von dem Boot mit dem weißen Rumpf auf und lächelte sie an.
An dem Lächeln konnte sie sehen, dass er sie erkannte. Erst als sie die Erleichterung spürte, merkte sie, wie groß ihre Angst gewesen war.
»Robbie? Geht es dir gut, Liebling?«
Er legte seine Drahtbürste ab. »Ging mir nie besser.«
»Warum bist du hier?«
»Ich arbeite an dieser Ketsch. Sie ist …« Er brachte den Satz nicht zu Ende und sah für einen Moment verwirrt aus.
»Das ist nicht mehr deine Werft«, sagte sie sanft und berührte ihn am Handgelenk. »Du hast sie an Pierre verkauft, erinnerst du dich?«
»Pierre?«
»Pierre L’Allier. Als du in Pension gegangen bist, hast du gesagt, dass sie bei ihm in guten Händen sein wird. Du hast ihm einen sehr guten Preis gemacht.«
»Oh. O ja, stimmt. Ich habe mich schön über den Tisch ziehen lassen.« Robbie ließ den Blick über die Boote in der Slipanlage und auf dem Vorplatz schweifen und über die weiß gestrichene Reparaturhalle. Pierre und Little Sterling waren im Gebäude verschwunden, vermutlich, damit sie unter vier Augen reden konnten.
»Warum bin ich hier?«, fragte er Emily.
Es zog ihr das Herz zusammen. »Weißt du das nicht mehr?«
»Vielleicht wollte ich ein bisschen an den Goldberg-Variationen arbeiten?« Er blickte sich wieder um. »Aber sie ist am Liegeplatz, oder nicht?«
»Wir könnten heute damit segeln.«
Robbie nickte, er wirkte erleichtert. »Das wäre schön. Lass mich noch das Werkzeug wegpacken.«
»Ich frage Pierre, ob wir sein Dinghy nehmen können, um zum Liegeplatz zu fahren, dann müssen wir nicht in die Stadt.« Sie küsste ihn auf die Stirn und ging danach in die Reparaturhalle. Pierre und Little Sterling standen an einer mobilen Hebeanlage und redeten leise miteinander. Als sie hereinkam, blickten sie auf.
»Alles okay«, sagte sie. »Danke, dass Sie mich angerufen haben. Wir wollen zum Segelboot fahren. Ob Sie uns wohl Ihr Dinghy borgen könnten?«
»Der Vierte wird sie hinbringen«, sagte Little Sterling. »Rufen Sie ihn einfach an, wenn Sie wieder zurückwollen.« Er zog sein Handy aus der Hosentasche. »Als ich Bob heute Morgen gesehen habe, hätte ich schwören können, er denkt, dass er noch hier arbeitet.«
»Es ist alles in Ordnung«, schaltete sich Pierre rasch ein. »Er ist jederzeit willkommen. Für mich ist das immer noch sein Laden hier. Er hat ihn aus dem Nichts aufgebaut.«
Emily nickte und schluckte, sie versuchte das unangenehme Schamgefühl zu ignorieren, das in ihrem Magen brannte.
Der Vierte – sein richtiger Name lautete Sterling Ames, der Vierte – war Little Sterlings Sohn, der seinerseits der Dritte mit diesem Namen war. Er fuhr das Motordinghy mit der unbeschwerten Sicherheit eines Menschen, der seit der Kindheit Boote gelenkt hatte, dicht an die Slipanlage heran. Robbie kletterte hinein und half Emily. Er hatte immer noch diesen Ausdruck im Gesicht – fast hilflos, als ob er verzweifelt versuchte, sich einen Reim auf alles zu machen.
Dieser Ausdruck passte überhaupt nicht zu ihm. Robbie hatte in seinem Leben immer alles gemeistert. Mit dieser Miene wirkte er fast wie ein Fremder.
Ihre Schaluppe lag bei einer privaten Liegestelle in der Bucht von Clyde Bay. Der Vierte fuhr sie dorthin, ohne erst zu fragen, wohin sie wollten. Die Leute hier kannten die Boote der anderen so gut wie deren Kinder. Emily beobachtete Robbies Miene, als sie sich ihrem Boot näherten, und sah, wie der Ausdruck von Verlorenheit in seinem Gesicht allmählich Freude wich. Er hatte dieses Boot mit eigenen Händen gebaut – es geschmirgelt, den Mast aufgesetzt, das Teakholz lackiert, das Deck weiß und den Rumpf dunkelgrün gestrichen. Den Namen am Bug hatte er eigenhändig aufgemalt. In diesem Boot steckten unzählige Wochenenden, hier wurden Zeit und Erinnerungen sichtbar.
»Ein schönes Boot«, sagte Robbie.
»Paps sagt, in ganz Maine gibt es keine bessere Holzschaluppe«, bemerkte der Vierte.
»Und da hat er wohl recht«, antwortete Emily. »Sie braucht viel Pflege, aber sie ist es wert.«
»Wie eine Frau«, sagte Robbie, und sie lächelte und drückte seine Hand.
»Was ich immer schon mal fragen wollte«, erkundigte sich der Vierte. »Ist Goldberg Ihr Mädchenname, Doc? Haben Sie sie deshalb Goldberg-Variationen genannt?«
»Nein«, erwiderte Robbie. »Es ist ein …« Er schnippte mit den Fingern. »Goldberg ist ein …«
»Es ist ein Musikstück«, sprang Emily ihm zur Seite. »Von Bach. Es ist eine Arie mit einer Reihe von Variationen. Am Ende wird die Arie wiederholt. Es ist eine Art Kreis.«
»Genau«, bestätigte Robbie und streckte den Arm nach der Heckreling aus. »Ich wusste doch, dass es mir wieder einfällt.«
»Hast du mit ihm darüber gesprochen?«, fragte Sarah. Sie und Emily saßen am Küchentisch beim Mittagessen. Mittwochs aßen sie meistens gemeinsam zu Mittag, manchmal auswärts, manchmal bei sich zu Hause. Heute war Sarah dran. Sie hatte Hähnchensalat und Eiskaffee gemacht. Ihre älteste Tochter Dottie sollte später aus Clyde Bays Gemischtwarenladen, in dem sie arbeitete, einen Pekannusskuchen mitbringen.
»Nein. Noch nicht.«
»Ist das an sich nicht etwas seltsam?«
»Aber«, Emily rührte in ihrem Kaffee, »es gibt eine Menge, worüber wir nicht sprechen.«
»Ihr beide redet doch ständig. Ihr unterhaltet euch die ganze Zeit.«
»Ja, aber es gibt Dinge … Wir kennen uns jetzt schon so lange und sind immer zusammen gewesen. Es gibt Dinge, über die wir nicht zu reden brauchen, weil wir es wissen.«
»Jetzt verstehe ich, warum meine Ehen nie gehalten haben«, scherzte Sarah. »Ich stelle immer Fragen. Wo warst du letzte Nacht? Wie viel Bier hast du getrunken? Wann bist du nach Hause gekommen? Was ist das für ein Parfüm?«
Emily lachte. Eigentlich war es erstaunlich, dass sie sich so gut verstanden. Sie waren völlig verschieden und hatten gänzlich unterschiedliche Lebensläufe. Zwischen ihnen lagen fast dreißig Jahre. Emily war pensionierte Fachärztin für Geburtshilfe, Sarah arbeitete als Kassiererin im Supermarkt oben in Thomaston. Sarah war eine echte Maine-Pflanze, Emily selbst nach vierzig Jahren immer noch das, was man hier eine »Zugezogene« nannte. Sie waren rein zufällig Freundinnen geworden, erst im Laufe der Jahre hatten sich ihre Wurzeln miteinander verflochten. Eine Zeit lang war Sarah sogar Emilys Schwiegertochter gewesen, aber das hatte nicht lange gehalten.
Sarah war der einzige Mensch, mit dem sie darüber reden konnte. Ihrer Familie verschwieg sie es, zumindest so lange, bis es wirklich etwas gab, um das man sich Sorgen machen musste.
»Die Leute merken es«, sagte sie. »Pierre und Little Sterling. Nach dem, was neulich in der Werft passiert ist. Und Joyce von der Apotheke hat erzählt, dass er an einem Tag zweimal gekommen ist, um meine Medikamente abzuholen.«
»So ist das in Kleinstädten. Die Leute bekommen alles mit. Aber sie passen auch auf einen auf.«
»Robbie ist ein stolzer Mann. Er war nie von anderen abhängig. Wenn er das Gefühl hätte, dass die Leute Mitleid mit ihm haben …«
Sie brachte den Satz nicht zu Ende.
»Oder dass sie Mitleid mit dir haben?«, fragte Sarah. »Hast du darüber auch schon mal nachgedacht?«
»Unsinn. Mit mir hat das nichts zu tun.«
»Ich kenne dich gut genug, Em. Und ich weiß, dass du Menschen gern hilfst. So kennt man dich in der Stadt und Umgebung. Wie vielen Babys hast du hier auf die Welt geholfen?«
»Ungefähr achtzig Prozent der Menschen zwischen vierzig und zehn. Es gibt hier so einige Familien, da habe ich beide Elternteile abgenabelt.«
»Bei Dottie warst du auch dabei. Ich wünschte, du könntest ihr auch bei der Geburt ihres Babys helfen. Es kann bei ihr jeden Moment losgehen.«
Emily lächelte. »Ich bin in Rente.«
»Robbie hat den Menschen auch geholfen. Er hat Arbeitsplätze geschaffen, hat den Leuten die Boote repariert. Das hat er alles für William getan. Ich weiß, dass er auch für Leute gearbeitet hat, die ihn nicht bezahlen konnten. Nachdem Hurrikan ›Sandy‹ hier durchgezogen ist, hat er sich am Wiederaufbau beteiligt. Du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn die Leute es merken und vielleicht helfen möchten.«
Es war lange her, dass Sarah zum ersten Mal Hilfe von Emily angenommen hatte. Emily hatte sich angeboten. Im Laufe der Jahre hatten sie einander viele Gefälligkeiten erwiesen. Aber Sarah wusste von nichts. Sie wusste nicht, warum sich Robbie und sie so in ihrer Zweisamkeit eingerichtet hatten und eine verschworene Gemeinschaft bildeten. Jetzt war niemand mehr da, der davon wusste, nur noch Robbie und sie selbst.
»Mein Vater«, sagte Emily, »war der Arzt im Ort. Jeder respektierte ihn. Früher oder später hat er jedem im Dorf einmal geholfen. Ich wollte immer so sein wie er.«
»Und was war, als er selbst einmal Hilfe brauchte? Irgendwann wird es bei ihm auch mal so weit gewesen sein, nehme ich an.«
»Ich – weiß es nicht. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir schon den Kontakt verloren.«
Sarah berührte über den Tisch hinweg Emilys Hand. »Niemand hat Schuld. Es ist eine Krankheit. Genau das hast du mir doch immer erzählt, als du mir damals geholfen hast.«
»Wir wissen nicht einmal, ob es überhaupt eine Krankheit ist.«
»Und wenn?«
»In dem Fall würden wir tun, was wir immer tun. Wir stehen es gemeinsam durch, Robbie und ich.«
Sarah stand auf und stellte die Schüssel mit Hühnersalat auf den Tisch, dann füllte sie ihnen noch etwas auf die Teller. »Wie geht es Adam und den Kindern?«
»Denen geht es prächtig, wie immer.«
»Und William?«
»Der kommt klar. Du weißt ja, wie er ist. Er und Robbie sind sich viel zu ähnlich, um miteinander zu reden. Aber er ruft mich an, und er hält mit Adam Kontakt.«
»Ist bei uns genauso. Letzte Woche hat er Dottie zum Geburtstag angerufen. Mit mir hat er kein Wort gewechselt.«
»Das tut mir leid, Sarah.«
Sarah zuckte mit den Schultern. »Er ist ihr ein besserer Vater, als es ihr richtiger Vater war. Wie geht es seinen Kindern?«
»Er hat ein paar Fotos geschickt.« Sie holte ihr Handy heraus und zeigte Sarah die Bilder von Brianna und John.
»Brianna ist ihrem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten«, stellte Sarah fest.
»Ja, die Brandon-Gene sind stark. Adam kommt mehr nach mir.« Das sagte sie ganz automatisch.
»Ist er wieder mit ihrer Mutter zusammen?«
Emily schüttelte den Kopf. »Die Vaterrolle macht ihn glücklicher als die des Ehemannes. Aber das weißt du ja.«
»Das Wichtigste ist die Familie«, sagte Sarah. »Aber auch Freunde können Familie sein. Das habe ich damals von dir gelernt. Und ihr werdet euch von uns allen helfen lassen. Uns allen, denen ihr geholfen habt. Denn so ist das nun mal, wenn man irgendwo hingehört. Und ihr gehört hierher, ob es euch gefällt oder nicht.«
»Ich weiß«, sagte Emily. Und obwohl Sarah eine so gute Freundin war, fügte Emily nicht hinzu, dass gerade dies zu den Dingen gehörte, die ihr am meisten Sorgen bereiteten. Denn auch irgendwo dazuzugehören war etwas Zerbrechliches.
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, dachte Robbie. Hatten sich Verhaltensweisen erst einmal eingeschlichen, wurde man sie nicht mehr los. Sie führten ein Eigenleben. Es war wie ein Sturmwind, der einen mit sich fortriss.
Es ging jetzt schon seit Monaten so, vielleicht sogar schon seit Jahren. Da war ein Nebel, der einen Teil seines Lebens verhüllte, jeden Tag einen anderen Bereich. Er breitete sich ohne Vorwarnung aus und stürzte Robbie in heillose Verwirrung. Emily wusste, dass er es wusste, wie er wusste, dass sie es wusste – und doch hatte keiner von beiden etwas gesagt.
So hatten sie es im Grunde immer gehandhabt – nicht gleich am Anfang, aber später, als sie feststellten, dass ihre Liebe nur dann Bestand haben konnte, wenn sie über bestimmte Dinge schwiegen.
Freitags war er immer fürs Abendessen zuständig. Normalerweise machte er ein Chili-Gericht oder bestellte telefonisch eine Pizza. An diesem Abend tat er weder das eine noch das andere. Er wartete, bis es sechs Uhr war, dann ging er hinaus in den Garten, wo Emily Unkraut jätete. Sie trug einen Strohhut mit einer breiten Krempe, der sie vor der Sonne schützte. Er hockte sich neben sie ins Gras.
»Oh«, sagte sie überrascht. »Hilfst du mir?«
Sie hatte einen angenehmen Tonfall: Sie freute sich, ihn zu sehen, sie liebte ihn, und sie war noch immer dieselbe. Doch in ihrem Blick lag leichte Besorgnis. Denn inzwischen war jede Abweichung von der Gewohnheit ein Grund zur Sorge. Die Variationen bedeuteten, dass etwas nicht stimmte.
»Es ist Freitag«, sagte er, »aber ich habe nichts zu essen gekocht. Weißt du, warum ich das sage?«
»Damit ich weiß, dass wir Pizza essen werden?«
»Damit du weißt, dass ich weiß, welcher Tag ist und wie spät es ist. Denn ich weiß das nicht immer, habe ich recht?«
Sie erwiderte nichts.
»Das ist etwas, worüber wir reden müssen. Es wird nicht weggehen, wenn wir es ignorieren.«
»Nichts geht weg«, sagte sie.
»Hast du Angst, Liebling?«
Sie nickte, und er legte ihr den Arm um die Schultern.
4
AUGUST 2016
PORTLAND, MAINE
Das Krankenhaus in Portland war größer und renommierter als das Pen-Bay-Hospital, in dem Emily so viele Jahre beschäftigt gewesen war, doch sie kannte ein, zwei der Leute, die dort arbeiteten. Wenn sie nach Portland runterfuhr, verabredete sie sich manchmal mit ihnen zum Mittagessen oder auf einen Kaffee.
Heute saß sie zusammen mit Robbie zwischen anderen Patienten und ihren Familien im Wartezimmer und wartete auf den Termin beim Neurologen. Während ihrer Zeit im Krankenhaus hatte sie vorwiegend mit schwangeren Frauen und jungen Müttern zu tun gehabt, und es war etwas erschütternd, so viele ältere Menschen in diesem Wartezimmer versammelt zu sehen – erschütternder noch, sich einzugestehen, dass sie und Robbie ebenfalls alt geworden waren.
»Ich sehe uns noch als junges Liebespaar«, flüsterte ihr Robbie ins Ohr. »Für mich siehst du immer noch so aus wie damals, als wir uns kennengelernt haben. Soll das etwa heißen, ich habe Gedächtnisprobleme?«
Er hatte gute und schlechte Tage. Heute war ein guter Tag. Er hatte sich fertig gemacht, die Hunde versorgt, über ihre gemeinsamen Freunde geredet, darüber gescherzt, wohin sie gingen, und debattiert, in welchem Restaurant im alten Hafen sie nach dem Termin zu Mittag essen sollten. Er ließ sie ans Steuer, aber das war normal, wenn sie Emilys Auto benutzten. Er verlegte diesmal weder seine Schlüssel noch seine Geldbörse und vergaß auch nicht, die Schuhe zuzubinden.
Emily hatte sich Sorgen gemacht, weil es ein guter Tag war: Wenn nun der Neurologe die Symptome nicht erkannte, die ihr aufgefallen waren?
Doch sie hätte sich auch gesorgt, wenn es ein schlechter Tag gewesen wäre.
Er nannte es Nebel. An der Küste von Maine war Nebel etwas Alltägliches. Warme Südwinde trafen auf kühles Wasser und sorgten für Kondensation. Weiter im Landesinneren konnte ein klarer blauer Sommertag sein, doch sobald man sich der Küste auf eine Meile näherte, umwaberte einen der Nebel. Es gab Jahre, in denen im Sommer an jedem einzelnen Tag Nebel herrschte. Dann konnte sie in ihrem Haus aus dem Fenster sehen und sich vorstellen, in einer Wolke zu schweben.
»Das ist kein Gedächtnisproblem«, erwiderte sie flüsternd. »Das nennt man romantische Ader.«
Der Neurologe Dr. Calvin war auf eine beruhigende Weise gealtert. Auf dem Kopf hatte er kein einziges Haar mehr, dafür waren seine Augenbrauen umso buschiger. Emily hatte sich natürlich schlaugemacht und wusste, was zu erwarten war. Sie hatte Robbie gefragt, ob sie ihm die Tests erklären sollte, doch das wollte er nicht.
Welches Datum ist heute? Welcher Wochentag ist heute? Welche Jahreszeit? In welchem Bundesstaat befinden wir uns? In welcher Stadt? In welchem Gebäude sind wir? Welches Stockwerk ist das hier? Ich werde Ihnen drei Gegenstände nennen und möchte, dass Sie sie wiederholen: Straße, Banane, Hammer. Und jetzt zählen Sie bitte für mich rückwärts ab hundert in Siebenerschritten.
Sie saß auf dem zusätzlichen Stuhl und sah und hörte dem Arzt und dem Mann zu, den sie fast ihr ganzes Leben lang geliebt hatte. Sie hörte sich an, welche Antworten er gab. Sie sah, wie er versuchte, eine einfache Uhr zu zeichnen.
Es war ein guter Tag. Ein richtig guter Tag – heute.
Doch als er zeichnete, beschlich sie Panik – ein Gefühl, so kalt und heimtückisch wie Nebel.
5
Hinterher gingen sie nicht zum Mittagessen in das Restaurant, das sie sich ausgesucht hatten. Sie mussten keine Worte wechseln, um zu wissen, dass sie sich einig waren. Emily fuhr sie an der Küste entlang nach Clyde Bay zurück. Dort gingen sie jedoch nicht nach Hause, sondern parkten stattdessen in der Stadt. Sie nahmen das Dinghy, fuhren damit zum Boot hinaus, kletterten wortlos an Bord und machten es klar zum Segeln.
Das hatten sie so viele Male zusammen getan. Jedem oblagen spezielle Aufgaben, die ihre Körper ganz mechanisch ausführten. Es war wie ein Musikstück, die Noten waren jedes Mal dieselben, auch wenn sich jede Aufführung ein wenig von der anderen unterschied. Ein Muster, das von alleine ablief.
Falls sie sich dazu entschieden, konnten sie die neuen Informationen, die sie erhalten hatten, totschweigen. Er wusste, dass sie das konnten. Sie hatten schon ganz andere Dinge totgeschwiegen.
Die Bucht war ruhig, und als Emily an der Leine stand, um sie zu lösen, startete er den Motor, um schneller aufs offene Meer zu gelangen. Normalerweise zog er es vor, gleich ab der Anlegestelle zu segeln. Wenn sie gewollt hätten, wäre das bei dem leichten Wind heute möglich gewesen. Doch der Motor machte Lärm, und so ließ sich das Gespräch noch etwas länger hinauszögern.
Als sie den Marschall-Leuchtturm hinter sich gelassen hatten, schaltete er den Motor aus, und gemeinsam zogen sie das Großsegel hoch. Danach setzte Emily das Focksegel. Es war ihr Boot, er hatte es für sie gebaut. Eine Siebeneinhalb-Meter-Schaluppe, klein genug, um gut allein damit fertigzuwerden, groß genug, dass sie auf ihren Touren darauf übernachten konnten. Aber sie hatte sich einen Namen für das Boot ausgedacht, der ihnen beiden etwas bedeutete, und aus Gewohnheit übernahm er für gewöhnlich die Ruderpinne, wenn sie zusammen waren.
Diesmal machte er ihr ein Zeichen, es zu übernehmen. Er setzte sich ins Cockpit, auf die Bank an der Seite, auf der Emily normalerweise saß.
»Also«, sagte er, als sie in Fahrt gekommen waren und man nichts anderes mehr hörte als das Knattern des Segels und die Schreie der Möwen. »Sag mir, was du davon hältst, Doc.«
»Ich bin Ärztin für Geburtshilfe, keine Neurologin«, sagte sie und hielt den Blick auf den Horizont gerichtet.
»Aber du weißt trotzdem Bescheid, oder?«
»Du weißt es auch.« In ihrer Stimme lag so viel Schmerz, dass er versucht war, von dem Thema abzulassen und von etwas anderem zu reden. Doch dafür waren sie nicht aufs Meer hinausgefahren. An den Ort, an dem sie beide wirklich ganz allein miteinander waren.
»Ich möchte deine Meinung hören. Der Arzt kann offensichtlich noch nichts sagen. Erst in einer Woche wieder.«
»Er will erst das Ergebnis der Bluttests abwarten.«
»Aber die brauchen wir nicht, stimmt’s?«
»Die Tests, die er mit dir gemacht hat, haben gezeigt, dass dein Kurzzeitgedächtnis eingeschränkt ist. Du hast eine leichte Aphasie. Das sind Wortfindungsstörungen und Wortverständnisprobleme – und gewisse psychomotorische Beeinträchtigungen.«
»Diese verdammte Uhr! Meine Zeichnung war ziemlicher Mist, oder?«
Sie nickte.
Vorher hatte er eigentlich keine Angst gehabt, doch jetzt kam es ihm vor, als würde ihn etwas Kaltes berühren. Denn als er die Uhr gezeichnet hatte, war es ihm zunächst so vorgekommen, als sei sie ganz in Ordnung gewesen. Mehr oder weniger.
»Bei den Tests gab es keine Anzeichen für einen Schlaganfall«, erklärte Emily. »Und die Sache hat sich langsam entwickelt, nicht plötzlich. Es könnte auch Vitaminmangel sein oder eine Infektion.«
»Aber das glaubst du nicht.«
»Nein, ich glaube, es ist wahrscheinlich Alzheimer.«
Sie war tapfer. Ihre Stimme zitterte kein bisschen, als sie es aussprach. Er merkte, dass er stolz auf sie war.
»Ich glaube, wir sollten besser kreuzen«, sagte er, »wenn wir der Moskitoinsel ausweichen wollen.«
Hier draußen war der Wind stärker. Robbie sicherte das Hauptsegel und lehnte sich seitlich gegen das Cockpit, das fast in einem Fünfundvierzig-Grad-Winkel geneigt war.
»Also, womit muss ich rechnen«, sagte er schließlich. »Alzheimer arbeitet rückwärts, oder nicht? Löscht zuerst die jüngsten Erinnerungen?«
»Ich glaube nicht, dass es so systematisch verläuft«, sagte sie. »Ich glaube, die Krankheit nimmt sich einfach, was sie will.«
»Aber grundsätzlich gilt, je frischer die Erinnerungen sind, desto schneller sind sie wieder weg. So wie bei Perry. Bevor er ins Heim kam, saß er immer im Laden und behauptete, es sei 1953.«
»Du kommst nicht ins Heim«, sagte Emily. »Du wirst zu Hause bei mir bleiben. Wir werden auch weiterhin so zusammenleben, wie wir es immer getan haben, ganz egal, was passiert.«
»Ich möchte aber nicht, dass du dich um mich kümmern musst, Emily.«
»Tja, Pech. Denn genau das werde ich tun.« Sie sagte es in einem leidenschaftlichen Ton, und auch dafür war er stolz auf sie. »Ich werde mich um dich kümmern, und du wirst dich um mich kümmern, solange wir leben. Denn darum geht es schließlich in der Ehe.«
Er sah auf das vorbeiströmende Wasser. »Aber damit ist es noch nicht getan, und das weißt du.«
»Was ist damit nicht getan?«
»Was ist denn, wenn ich irgendwann denke, es ist 1962?«
»1962 war ein schönes Jahr.«
»Du weißt, wie ich es meine.«
Sie schwieg einen Moment. Schließlich sagte sie: »Das wirst du schon nicht.«
»Höchstwahrscheinlich doch, Emily. Und wenn es erst so weit ist, wird es mir nichts mehr ausmachen. Aber dir wird es sehr viel ausmachen, nicht wahr?«
»Wir sind zu schnell. Kannst du etwas lose geben?«
Er lockerte die Leine, die das Großsegel hielt.
»Es braucht doch keine Rolle zu spielen«, fuhr er fort. »Wir sind jetzt schon so lange in Maine. Wir haben hier unsere Familie gegründet, haben hier gearbeitet. Hier kennen uns alle nur so, wie wir jetzt sind. Sie verurteilen uns nicht. Und alle, die es tun könnten, sind verstorben.«
»Wir haben gesagt, dass wir nie darüber reden.«
»Die Dinge haben sich geändert. Wir können die Leute einweihen, und zwar so, dass wir dabei die Kontrolle behalten. Dann könnten wir es schaffen – gemeinsam –, solange ich noch … solange ich noch ich selbst bin.«
»Was ist mit Adam?«
»Adam hat seine Familie. Er ist glücklich. Er könnte damit umgehen. Er würde es verstehen.«
»Nein, das möchte ich ihm nicht zumuten. Adam ist immer so unbekümmert und zuversichtlich. Er ist in dieser Hinsicht wie du.« Er ist so, wie du einmal warst. Das behielt sie für sich. »Wenn man es ihm jetzt sagt, würde ihn das womöglich in eine Sinnkrise stürzen.«
»Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß, dass du es nicht willst, aber denk doch noch einmal darüber nach. Dann hätten wir keine Geheimnisse mehr. Dann gäbe es nichts mehr, vor dem wir noch Angst haben müssten. Wir wären frei.«
»Du hast gesagt, wir sind bereits frei. Nach Christophers Tod.«
»Wenn jeder Bescheid wüsste, wäre das nicht befreiender, als wenn es keiner weiß?«
Sie antwortete nicht. Er drängte sie nicht. Er kannte sie gut genug, um sicher zu sein, dass sie verstanden hatte, was er wollte.
Sie hatten kein bestimmtes Ziel. Sie segelten, wohin der Wind sie trug. Wenn Robbie ehrlich war, segelte er so immer am liebsten. Ohne Ziel, ohne Plan, kreuz und quer, je nach Wind mal schnell, mal langsam. So war es auch, als sie das erste Mal gemeinsam gesegelt waren, als Emily Backbord noch nicht von Steuerbord unterscheiden konnte. Damals, 1962. Auf See flossen all ihre gemeinsam verbrachten Jahre zusammen und wurden eins, und ihre Liebe war noch immer so frisch wie an jenem Tag, als sie sich kennenlernten.
Er schaute auf und wunderte sich, dass sie schon wieder an der Moskitoinsel vorbeikamen und sich auf dem Rückweg nach Clyde Bay befanden. Er erkannte die Orientierungspunkte, die Häuser rund um den Gemischtwarenladen, den städtischen Pier, das große weiße Haus an der Landzunge, in dem die Sommergäste wohnten. Er hatte gar nicht an … Worüber hatten sie gerade gesprochen? Es ging um ein Problem. Irgendetwas Besorgniserregendes.
»Alles klar mit dir?«, fragte Emily, und er nickte.
»Ich verstehe, worauf du hinauswillst, Robbie«, sagte sie. »Aber ich kann es nicht. Das kann ich Adam nicht antun.«
Er runzelte die Stirn. Fast hätte er sie gefragt: Was kannst du Adam nicht antun?, als er die Barkasse entdeckte, die auf sie zusteuerte. »Da ist Little Sterling«, sagte er.
Little Sterling winkte ihnen mit seinem muskulösen Arm. Emily änderte den Kurs und fuhr ihm entgegen.
»Doc!«, rief er, sobald sie in Hörweite waren. »Sie würden uns einen großen Gefallen tun, wenn Sie sofort mit an Land kommen.«
»Was ist denn los?«, fragte Robbie.
»Dottie Philbrick ist im Laden und bekommt gleich ihr Baby. Wir warten auf den Krankenwagen, aber es dauert noch.«
Robbie übernahm das Ruder. Emily kletterte über den Bordrand in die Barkasse. »Wir treffen uns da!«, rief sie ihm noch zu, dann hielt Little Sterling bereits auf den städtischen Pier zu.
»Ihr überlasst dem Kerl, der alles vergisst, die Verantwortung für das Boot?«, murmelte Robbie, ohne beunruhigt zu sein.