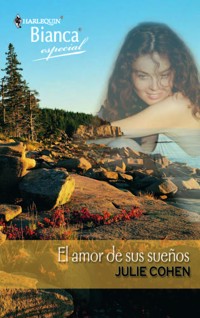4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diana Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Louise und Louis haben alles gemeinsam, bis auf eines: ihr Geschlecht. Beide wachsen zu willensstarken jungen Menschen heran, verlieben sich, träumen davon, Romane zu schreiben – und verlieren in einer dramatischen Nacht viel zu früh das Vertrauen ins Leben. Dreizehn Jahre später können beide nicht mehr vor der Vergangenheit davonlaufen und kehren in die Heimat zurück. Was denkt und fühlt Louise, was Louis? Wie verlaufen zwei Wege, die mit nur einem Unterschied beginnen? Einfühlsam erkundet Julie Cohen in ihrem vielschichtigen Roman, wie das Geschlecht unser Leben und unsere Identität bestimmt.
Wunderschöne Ausstattung – edles Naturpapier, hochwertig mit Goldfolie veredelt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 441
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Zum Roman
Louise und Louis haben alles gemeinsam, bis auf eines: ihr Geschlecht. Beide wachsen zu willensstarken jungen Menschen heran, verlieben sich, träumen davon, Romane zu schreiben – und verlieren in einer dramatischen Nacht viel zu früh das Vertrauen ins Leben. Dreizehn Jahre später können beide nicht mehr vor der Vergangenheit davonlaufen und kehren in die Heimat zurück. Was denkt und fühlt Louise, was Louis? Wie verlaufen zwei Wege, die mit nur einem Unterschied beginnen? Einfühlsam erkundet Julie Cohen in ihrem vielschichtigen Roman, wie das Geschlecht unser Leben und unsere Identität bestimmt.
»Sensibel erkundet Julie Cohen, wie gesellschaftliche Erwartungen unser Leben beeinflussen.« The Independent
»Einfach brillant, ein kluger Roman, der Spaß macht.« Marian Keyes
Zur Autorin
Julie Cohen wurde in Maine, USA, geboren und verbrachte ihre Kindheit zwischen Büchern in der Bibliothek. Sie studierte Literatur an der Brown und der Cambridge University, und wenn sie nicht gerade an ihren Romanen arbeitet, leitet sie Schreibworkshops. Sie lebt mit ihrer Familie und ihrem Hund in Berkshire, England.
Julie Cohen
Aus dem Englischen von
Babette Schröder
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Zitatnachweise:
Virginia Woolf, Orlando. Eine Biographie.
Aus dem Englischen von Melanie Walz.
© Insel Verlag Berlin 2012
Naomi Alderman, Die Gabe. Aus dem Englischen von Sabine Thiele.
© Wilhelm Heyne Verlag München 2018
Deutsche Erstausgabe 02/2020
Copyright © 2019 by Julie Cohen
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel
Louis & Louise bei Orion Books,
an imprint of The Orion Book Group Ltd, London
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2020
by Diana Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Heiko Arntz
Umschlaggestaltung: t. mutzenbach design, München
Covermotive: © Shutterstock/MicroOne,
Anastasia Lembrik, Sunward Art
Satz: Leingärtner, Nabburg
Alle Rechte vorbehalten
e-ISBN 978-3-641-25233-5V001
www.diana-verlag.de
Für meine Mutter
Für meinen Vater
Für meinen Bruder
»Orlando war zu einer Frau geworden – das lässt sich nicht leugnen. Doch in jeder anderen Hinsicht war Orlando genau derselbe geblieben. Der Geschlechtswandel veränderte zwar beider Zukunft, doch er hatte keinerlei Auswirkungen auf ihre Identität. Ihre Gesichter blieben, wie die Porträts beweisen, gewissermaßen austauschbar.«
Virginia Woolf, Orlando
»Das Geschlecht ist ein Hütchenspiel. Was ist ein Mann? Das, was eine Frau nicht ist. Was ist eine Frau? Das, was ein Mann nicht ist. Tipp darauf, und es ist hohl. Schau unter die Hütchen: nichts.«
Naomi Alderman, Die Gabe
Daddys Mädchen
1978
Louise Dawn Alder wurde am 8. September 1978 als Tochter von Peggy und Irving Alder in Casablanca, Maine, geboren.
Peggy befand sich zwei Wochen über dem errechneten Geburtstermin, und es war heiß. Der August hatte sich geweigert, dem Herbst Platz zu machen. Noch verfärbten sich die Blätter nicht. Das Gras war gelb und verdorrt. Peggy stapfte durchs Haus, schwitzte ihr Schwangerschaftskleid durch, trank ein Glas Eistee mit Zitrone nach dem anderen und stieß mit dem Bauch gegen Möbel und Türrahmen.
»Ich will es hinter mir haben«, stöhnte sie, als sie mit ihrer besten Freundin Mary Phelps telefonierte, die vor einem halben Jahr Zwillinge zur Welt gebracht hatte.
»Das willst du nicht«, sagte Mary. Im Hintergrund schrie Allie oder Benny. »Behalte das Baby im Bauch, solange es geht. Zumindest kannst du schlafen, solange es noch nicht auf der Welt ist.«
Doch Peggy konnte nicht schlafen. Sie musste ungefähr einmal in der Stunde auf die Toilette, und wenn sie im Bett neben sich Irvings tiefe Atemzüge hörte, war ihr immer zu warm, und die Gedanken in ihrem erschöpften Hirn hörten nicht auf zu rasen. Hatten sie die Krippe richtig aufgebaut? Würde sie eine schlechte Mutter sein? Hatte sie die richtigen Dinge in die Tasche fürs Krankenhaus gepackt? Und wenn mit dem Baby etwas nicht stimmte?
»Es ist mir sogar egal, wenn es wehtut«, erklärte sie Mary.
»Das ist dir nicht egal«, prophezeite ihr Mary. »Bitte um alle Medikamente.«
Wie Peggy wusste, bedauerte Mary sehr, dass Benny bei der Geburt der Zwillinge zu schnell auf die Welt gekommen war, weshalb keine Zeit blieb, sie noch mit Medikamenten zu versorgen. Und obwohl Allie erst eine Stunde später gekommen war, fand der Arzt, Mary habe es beim ersten Baby so gut gemacht, dass sie beim zweiten auch nichts einnehmen müsse.
»Ich habe Angst«, flüsterte Peggy, obwohl Irving bei der Arbeit war und niemand sie hören konnte. Fest wickelte sie die Telefonschnur um ihre Finger. »Vielleicht ist es noch nicht auf der Welt, weil etwas mit ihm nicht stimmt.«
»Tritt es dich?«, fragte Mary, dann sprach sie mit ihrem Baby. »Ach, Allie, Schluss jetzt. Du saugst mich ja aus, lass noch etwas für deinen Bruder übrig.«
»Ja.« Wobei … wann hatte es das letzte Mal getreten? Die Stöße von innen waren so normal geworden, dass Peggy sie kaum noch bemerkte – es sei denn, ein kleiner Fuß klemmte hinter einer Rippe und ließ sie vor Schmerz um Atem ringen. Sie legte die Hand auf ihren runden Bauch und erhielt zur Antwort einen dumpfen Stoß.
»Ja, jetzt gerade«, sagte sie erleichtert.
»Na, dann ist alles in Ordnung. Wetten, dass es ein Mädchen ist?«
»Ich glaube, es ist ein Junge.«
»Nein. Jungs sind pflegeleicht. Sieh dir den kleinen Benny an – einfach mustergültig. Seine Schwester hingegen hat Koliken und einen Windelausschlag, außerdem kann sie nicht aufhören zu essen … Jetzt ist dein Bruder dran, du kleiner Nimmersatt.«
Ihre Worte stimmten Peggy zuversichtlicher. Neben all jenen Ängsten, die sie nachts wachhielten, gab es eine, die noch nicht einmal Sinn ergab: Würde sie nach der Geburt noch sie selbst sein? Als könnte die Geburt sie ihrer Persönlichkeit berauben, als könnte das Stillen ihre Gedanken und Gefühle zum Versiegen bringen.
Doch Mary war ganz so wie immer. Sarkastisch und direkt, aber mit einem großen Herzen. Die Zwillinge hatten ihre Persönlichkeit eher verstärkt, nicht geschwächt.
»Ich denke immer, Irving hätte den Wagen früher zur Wartung bringen sollen. Den Werkstatttermin morgen hat er vor Monaten ausgemacht. Er dachte, das Baby wäre dann schon auf der Welt, aber es ist noch nicht da. Und wenn es losgeht, während das Auto in der Werkstatt ist? Wie komme ich dann ins Krankenhaus?«
»Dann fahre ich dich«, sagte Mary so prompt, dass sie nicht darüber nachgedacht haben konnte.
»Aber du hast doch Benny und Allie.«
»Die passen ins Auto. Außerdem muss Donnie irgendwann lernen, auf sie aufzupassen. Er ist ihr Vater, und er rührt keinen verdammten Finger. Weißt du, wie viele Windeln er in den sechs Monaten gewechselt hat, die sie auf der Welt sind? Exakt null. Derweil stecke ich jeden Tag bis zum Ellbogen in Babykacke. Wenn ich endlich mal zum Schlafen komme, träume ich schon davon. Und wenn ich nicht von Babykacke träume, träume ich von einem Martini. Beefeater und Wermut auf Eis mit einer Zitronenspirale. Weißt du noch, wie wir die gemacht haben?«
Peggy hörte, wie am anderen Ende der Leitung ein Feuerzeug schnipste und Mary einen tiefen Zug von einer Zigarette nahm. Sie erinnerte sich an die Martinis auf Marys Brautparty, oben am Morocco Pond. Sie hatten ausgeklügelte Drinks gemixt und versucht, Rauchringe zu blasen. Erwachsene, die am Ort ihrer Kindheit verlegen versuchten, sich wie Erwachsene zu benehmen.
Und jetzt war Mary Mutter, und Peggy würde es auch bald sein. Peggy dachte an eiskalten Gin und Zitronenöl. Wie sie im Bikini am Strand gelegen hatten, auf dem flachen Bauch ein kühles Glas, von dem Kondenswasser herabperlte. Bei der Aussicht zu heiraten, ihr eigenes Haus und Ehemänner zu haben, waren sie beide ein bisschen aufgeregt gewesen. Damals war es ihnen fast unglaublich und wundervoll erschienen.
Jetzt wusste Peggy nicht, ob sie schon bereit war, erwachsen zu sein.
Stöhnend erhob sie sich vom Küchenstuhl, ging zum Fenster und schob die geblümten Baumwollvorhänge zur Seite, die sie, kurz nachdem sie das Haus gekauft hatten, selbst genäht hatte. Oder vielmehr, nachdem Irvings Eltern das Haus für sie gekauft hatten. Sie besaßen einen großen Garten, in dem Irving den Rasen mähte und das Unkraut jätete. Er hatte bereits einen Platz für eine Schaukel ausgewählt.
Ihr Baby war das erste Enkelkind in der Familie. Solange Peggy nur Irvings Freundin gewesen war, hatten sich Irvings Eltern, Vi und David, ihr gegenüber stets distanziert verhalten – sie fanden, sie sei nicht gut genug für ihren Sohn. Kaum hatten sie jedoch geheiratet und ihnen von der Schwangerschaft erzählt, waren sie ganz aus dem Häuschen und schenkten Peggy alle Aufmerksamkeit der Welt.
Irving freute sich darauf, Vater zu werden. Er stürzte sich rückhaltlos in das Unterfangen, konnte kaum die Hände von Peggys Bauch lassen und schien sie attraktiver als je zuvor zu finden. »Ich liebe es, wenn du schwanger bist«, raunte er ihr ständig zu. »Ich wünschte, du wärst immer schwanger.«
Doch Peggy war nicht sonderlich gern schwanger. In den ersten drei Monaten hatte sie sich permanent übergeben müssen, dann bekam sie Akne, außerdem schmerzten ihre Brüste. Und sie war aufgegangen wie ein Hefeteig, und draußen war es schrecklich heiß geworden. Was, wenn sie nach diesem keine weiteren Kinder mehr haben wollte? Würde Irving sie dann immer noch lieben? Fände er sie überhaupt noch attraktiv, nachdem das Baby auf der Welt war?
Sie hatten geheiratet, weil sie schwanger war. Natürlich wollten sie es sowieso, doch aufgrund der Schwangerschaft konnte Irving es sich nicht mehr anders überlegen. Es war zwar nicht ihre Absicht gewesen, doch … Sie waren nach Portland durchgebrannt, um in der Stadt zu heiraten, und flitterten im kalten April zwei Tage an der Küste. Nicht ganz die opulente katholische Hochzeit, die Peggys Mutter erwartet, oder die aufwändige Feier, die Vi Alder sich vorgestellt hatte.
»Mary …«, begann sie zögernd, nicht sicher, wie sie es formulieren sollte. Aber Mary war der einzige Mensch, mit dem sie reden konnte, die Einzige, die nicht so tat, als wäre Muttersein ein Spaziergang. »Wünschst du dir manchmal …«
Sie merkte, wie etwas Warmes ihre Beine hinunterlief, als hätte sie sich eingenässt. Als Peggy nach unten blickte, sah sie eine kleine Pfütze auf dem Linoleumboden.
»Was soll ich mir wünschen?«, fragte Mary am anderen Ende.
»Ich glaube, meine Fruchtblase ist gerade geplatzt.«
Schweigen, das Knistern einer Zigarette, Einatmen. Mit beiden Händen umklammerte Peggy den Hörer und starrte auf die sich ausbreitende Pfütze. Einen Moment hatte sie vollkommen vergessen, was nun zu tun war. Dass sie auflegen und Irving in der Papierfabrik anrufen musste, damit er sie abholte und ins Krankenhaus brachte.
»Ich habe mich geirrt«, sagte Mary schließlich. »Es ist doch kein Mädchen, es ist ein Junge. Nur ein Junge würde ein Gespräch unterbrechen, wenn es gerade interessant wird.«
Nach neunzehn Stunden Wehen war es Peggy gleichgültig, ob sie eine gute Mutter sein würde oder nicht. Der Geburtshelfer weigerte sich, eine Epiduralanästhesie bei ihr vorzunehmen, weil sie die Wehen unterdrücke und ihr von dem Luftgasgemisch nur übel werde.
Peggy lag flach auf dem Rücken, die Füße auf Stützen, und durchlitt mit geballten Fäusten, zusammengebissenen Zähnen und schweißnassem Haar die bislang schlimmste Wehe. In den ersten Stunden hatte sie trotz der Schmerzen und der langen Warterei eine Art Hochgefühl empfunden. Sie lief über die Flure der Geburtsstation und hörte die Schreie anderer Mütter und Babys. Irving durfte sie begleiten und ihre Hand halten.
Als sich die Wehen verstärkten, brachte man sie in einen ruhigen Raum und verbannte Irving ins Wartezimmer, wo er Kaffee trinken und auf und ab laufen konnte. Inzwischen litt Peggy starke Schmerzen und war froh, dass Irving nicht dabei war. Er war um ihr Wohlergehen bemüht, und es strengte sie an, um seinetwillen so zu tun, als wäre sie nicht erschöpft, als hätte sie keine Angst und keine Schmerzen. Jetzt wollte sie es nur noch hinter sich bringen. Und dann wollte sie sich unter der kühlen Decke eines frisch bezogenen Bettes zusammenrollen und schlafen, schlafen, schlafen, bis jemand sie weckte und ihr ein sauberes, wunderschönes Baby in einem strahlend weißen Frotteetuch überreichte.
Jetzt dachte Peggy allerdings nicht mehr daran, wie es sein würde, wenn sie es hinter sich hatte. Die Zukunft existierte nicht mehr. Sie, Peggy Grenier Alder, einst »Miss Western Maine«, existierte nicht mehr. Sie war nur noch ein Körper, den es in einer Welt aus Schmerz, Gestank und Pressen zerriss. Die Worte des Geburtshelfers und der Schwester verschwammen zu einem bloßen Rauschen in ihren Ohren. Sie hätte sich genauso gut in einem mittelalterlichen Kerker befinden können, mit den Füßen an eine Streckbank gefesselt, anstatt in einem High-Tech-Krankenhaus.
»Es kommt, da ist der Kopf!«, rief die Schwester aufgeregt, und Peggy dachte: Gott sei Dank, und dann dachte sie nichts mehr. Sie hielt die Augen geschlossen, sah nur noch weiß und rot und presste.
»Jetzt haben wir es gleich«, erklärte der Geburtshelfer, der nur für den Endspurt erschienen war. »Da ist Ihr Baby. Noch einmal pressen! Noch einmal! Braves Mädchen.«
»Ich kann nicht«, stöhnte Peggy, doch sie ergriff die Hand der Schwester, presste trotzdem und spürte, wie etwas aus ihr herausglitt und fortgenommen wurde. Sie riss die Augen auf.
»Es ist ein Mädchen«, verkündete der Geburtshelfer.
»Das hätte ich Ihnen gleich sagen können«, bemerkte die Schwester. »Hat sie zwei Wochen warten lassen. Wie eine Prinzessin, stimmt’s?«
»Immer zu spät«, sagte der Geburtshelfer, »genau wie meine Frau.«
Das Baby begann zu weinen.
»Auf die müssen Sie aufpassen«, warnte die Schwester und hob das Baby hoch. Peggy musterte es mit leidenschaftlichen Blicken. »Die wird Ihnen noch auf der Nase herumtanzen.«
»Sie wird ihren Daddy um den kleinen Finger wickeln«, sagte der Arzt, der sich bereits auf die Nachgeburt konzentrierte.
Peggy streckte die Hände nach ihrer Tochter aus, und die Schwester legte ihr das Baby in die Arme. Und trotz all der Angst, trotz all der Schmerzen und des Schweißes würde sie diesen Moment für den Rest ihres Lebens nicht mehr vergessen. Dieses winzige, zusammengekrümmte, gerötete Wesen mit Augenschlitzen und klauenartigen Händen – ihre Tochter.
Noch nie hatte sie irgendwen oder irgendetwas so sehr geliebt wie ihr Kind in diesem Moment. Es war ein Teil von ihr, ein Mädchen wie sie, das eines Tages erschöpft und verschwitzt die Arme ausstrecken würde, um ihr eigenes Kind in den Arm zu nehmen.
Peggy merkte kaum, wie der Geburtshelfer ging und die Schwester aufräumte. Sie war nur damit beschäftigt, dieses kleine Wesen zu betrachten. Zehn Fingernägel, alle hauchdünn. Augen mit Wimpern. Falls es ein Mädchen war, wollten sie es Dawn nennen, Morgendämmerung. Weil das Baby den Beginn ihres neuen Lebens markierte. Doch im Moment dachte Peggy überhaupt nicht an einen Namen. Sie dachte nur: Das habe ich gemacht. Dieses kleine Wesen.
Doch dann sagte die Schwester: »Ich hole den Vater«, und Peggy nahm ihre Umgebung wieder wahr.
»Noch nicht«, bat sie. »So darf er mich nicht sehen. Ich sehe furchtbar aus.«
»Glauben Sie mir, er wird nur Augen für sein Mädchen haben.«
»Können Sie mir den Schminkbeutel aus der Reisetasche reichen? Und die Bürste?«
Die Schwester – wuschelige Haare zu einem Dutt zusammengebunden, ungeschminkt, auf den Wangen geplatzte Äderchen, die Peggy erst jetzt auffielen – verdrehte die Augen. Sie wühlte in der Tasche, zog einen geblümten Schminkbeutel und eine rosa Haarbürste heraus und reichte sie Peggy, die wegen des Babys keine Hand frei hatte. Die Schwester, die das ganz offensichtlich nicht zum ersten Mal erlebte, nahm ihr das Baby ab und legte es in das bereitstehende Kinderbettchen. Derweil klappte Peggy den Taschenspiegel auf und sah, welchen Anblick sie bot. So bekommst du nie einen Mann, hörte sie die Stimme ihrer Mutter.
Zum Glück war sie darin geübt, mit wenigen Handgriffen das Beste aus sich zu machen. Ein Jahr lang war sie jeden Morgen vor Irving aufgewacht und hatte sich in einem schlecht beleuchteten Badezimmer geschminkt. Bei ihrem Haar war nicht viel zu machen, doch sie bürstete die Knoten aus und strich es sich aus dem Gesicht, dann trug sie rasch Puder und Rouge sowie ein paar sorgfältige Striche Mascara auf. Zum Schluss noch rosa Lippenstift und schon sah sie aus wie eine rosige, frischgebackene Mommy aus dem Good Housekeeping-Magazin. Oder doch zumindest fast.
»Okay«, sagte sie. Sie zog die Decke über die untere Körperhälfte. Ihr Bauch war kaum kleiner als gestern, aber vielleicht achtete Irving nicht darauf.
Peggy nahm das Baby wieder in Empfang. Sie hatte schon Marys Zwillinge im Arm gehalten, doch ihr eigenes Baby fühlte sich anders an. Als Irving ins Zimmer kam, lächelte sie zu ihm hoch. Eine moderne Madonna mit Kind.
Er sah sie nicht einmal an. Sofort hing sein Blick an dem Baby. Eilig durchquerte er den Raum, trat neben sie und blickte auf das Kind hinunter.
Plötzlich sah Peggy das Baby mit den Augen eines Außenstehenden. Faltige Handgelenke, eine knubbelige Nase, spärliche Haare, die am Kopf klebten – ein zusammengekrümmtes, kleines puterrotes Ding. Es war hässlich, ihre Tochter war hässlich, und Peggy war hässlich. Dieses kleine Mädchen hatte sie all ihrer Schönheit beraubt, und in jenem Moment war sich Peggy sicher, dass Irving angewidert den Raum verlassen und nie wieder zurückkehren würde.
»Sie ist wunderschön«, sagte Irving.
Und auf einmal sah Peggy, dass er recht hatte, und ein wunderbares Gefühl der Erleichterung breitete sich in ihrem Körper aus. Das Baby war wunderschön. So sahen alle Babys aus: zerknautscht und gerötet. Sie hatte nichts falsch gemacht.
»Sie sieht aus wie du«, stellte Irving fest.
»Findest du?«, fragte Peggy zweifelnd. »Ich denke nicht, dass sie mir ähnlich sieht. Sie sieht eher aus wie du.«
»Vielleicht ein bisschen.«
Irving streckte die Arme aus, um das Baby zu nehmen, und Peggy reichte es ihm mit dem Gefühl, ein wunderbares Geschenk zu übergeben. Sobald das Baby in den Armen seines Vaters lag, wand es sich, blinzelte und legte die weiche Stirn in Falten, und da sah Peggy, mit wem es Ähnlichkeit hatte.
»Das Gemälde«, sagte sie. Und es stimmte: In diesem Moment sah ihre Tochter, die noch nicht einmal eine Stunde alt war, genauso aus wie Louis Alder, Irvings berühmter Ururgroßvater – der Gründer der Casablanca Paper Company. In Irvings Elternhaus hing am oberen Treppenabsatz ein Porträt von ihm.
Irving lachte laut auf, woraufhin sich die Augen des Babys weiteten. »Louis! Ja, sie sieht aus wie Louis Alder. Das arme Ding.« Er hob seine Tochter hoch und stupste sie mit der Nase an. »Ein neuer kleiner Lou.«
Das Baby gab ein leises Quieken von sich.
»Sie erkennt ihren Daddy«, bemerkte Peggy.
»Daddys Mädchen«, sagte Irving, legte das Baby in seine Armbeuge und wiegte es. Er wirkte wie dafür geschaffen – anders als Peggy, die sich mit dem Baby im Arm zwar glücklich, aber auch ziemlich unbeholfen fühlte.
»Wir könnten sie Lou nennen«, schlug Peggy vor.
»Lou ist kein Mädchenname.«
»Aber Louise.«
»Wir wollten sie Dawn nennen, wenn es ein Mädchen wird.«
»Louise Dawn.«
Irving blickte von dem Baby zu Peggy, und auf seinem Gesicht lag Verwunderung. »Ich glaube, das würde Dad sehr freuen.«
Peggy hörte, was er nicht sagte, was ihm vielleicht auch noch nie in den Sinn gekommen war. Sie hörte: Meine Eltern mochten dich nie, und sie werden sich ärgern, weil du nur ein Mädchen geboren hast, das den Namen Alder nicht weitergeben kann. Sie hörte, wie Vi Alder nach ihrer Rückkehr von ihrer heimlichen Hochzeit mit verkniffener Miene gesagt hatte: Willkommen in der Familie. Sie hörte ihre eigene Mutter sagen: Du solltest diesen Mann dazu bringen, dich zu heiraten, denn so einen wie Irving Adler bekommst du nicht noch mal. Er mag jetzt noch nicht reich sein, aber eines Tages wird er es sein.
»Louise Dawn«, sagte Peggy. »Unbedingt.«
Mummys Junge
1978
»Hey, Irv, ist das Baby schon da?«
Irving blieb mitten im Pausenraum stehen. Donnie Phelps, Mike Beaulieu, Ed Venskis und Brian Theriault saßen zusammen am Tisch, auf dem Brotpapier und Cola-Dosen verstreut waren. Einen Moment fühlte er sich auf die Casablanca Highschool zurückversetzt, ein hagerer Teenager und notorischer Bücherwurm, der sich einem Tisch voller Sportler gegenübersah. Donnie, Mike und Brian waren alle in seiner Klasse gewesen, Ed war zwei Jahre älter. Es gab eine Zeit, da war er mit gesenktem Kopf an ihnen vorbeigehuscht, in der Hoffnung, dass sie ihn nicht bemerkten.
Jetzt lagen die Dinge natürlich anders. Er blieb stehen und lächelte. »Noch nicht«, sagte er zu Donnie. »Peggy dreht allmählich durch.«
»Wann sollte es kommen?«, erkundigte sich Ed. Wie die anderen drei trug er ein kariertes Flanellhemd über einem T-Shirt, obwohl es draußen sechsundzwanzig Grad waren. Alle vier hatten Baseballkappen auf dem Kopf: Mike und Donnie eine von den Red Sox, Brian eine von der Casablanca Paper Company mit dem grünen CPC-Kiefern-Logo, und Ed hatte eine neue Kappe, auf der Drauf geschissen stand.
Offiziell waren Anzüglichkeiten dieser Art im Unternehmen nicht erlaubt, doch an die Regel schien sich niemand zu halten. Irving blickte auf Eds Kinn anstatt auf die Mütze und sagte: »Vor zwei Wochen. Sie leidet ziemlich unter der Hitze.«
»Du musst doch die Wände hochgehen«, sagte Brian. »Bei BJ war Nat eine Woche überfällig. Sie wurde immer grantiger. Ich musste auf dem Sofa schlafen.«
»Du schläfst immer noch auf dem Sofa«, warf Mike ein und stieß ihn mit dem Ellbogen an. »Nat nervt dein Schnarchen.«
»Deine Frau stört das wohl nicht.«
Irving stand ein bisschen unsicher daneben und lächelte halbherzig. Er war nicht der Chef dieser Männer. Noch war er Chef von niemandem, obwohl ihn manche so behandelten. Auf jeden Fall bedienten sie die Maschinen, und er arbeitete in der Technik. Doch er war auch nicht ihr Kollege. Donnies Frau Mary war Peggys beste Freundin, wodurch er Donnie ziemlich häufig außerhalb der Arbeit sah: bei Grillpartys, am Morocco Pond. Und einmal bei einem missglückten Abendessen, nachdem sie frisch in ihr Haus gezogen waren. Damals hatte Peggy den Schmorbraten anbrennen lassen, und Mary hatte zu viel Wein getrunken. Bei diesen Gelegenheiten plauderten die Frauen, wie sie es seit ihrem fünften Lebensjahr taten, und Irving stand unbeholfen neben Donnie, beide mit einer Dose Budweiser in der Hand, und überlegte, was er sagen konnte. Nachdem sie die Themen Red Sox oder Patriots und Celtics oder Bruins abgehandelt hatten, gab es nicht mehr viel zu sagen. In der Schule hatten sie nie miteinander geredet, sodass sie auch keine Erinnerungen teilten. Und auch bei der Arbeit kannten sie nicht dieselben Leute.
Wie viel einfacher wäre es, wenn sie nicht um der Frauen willen so tun müssten, als würden sie sich mögen. Wenn Irving sagen könnte: »Ich weiß, unsere Frauen mögen sich, aber du hast danebengestanden, als dein Freund Duane Roy mich verprügelt hat, weil ich für ihn eine ›Brillenschlange‹ war. Auch wenn du dich nicht mehr daran erinnerst, ich habe es nicht vergessen.«
Doch mit Peggy ging das nicht. Peggy wollte, dass sich alle gut verstanden und Freunde waren. Also studierte er Peggy zuliebe vor ihren Treffen den Sportteil, damit er etwas zu sagen hatte.
Zumindest hatte Donnie Irving in der Schule nicht selbst schikaniert. Es war ihm nur gleichgültig gewesen. Oder es hatte ihn genervt, dass er vor dem Footballtraining auf seinen Freund warten musste, damit der einen Nerd verprügeln konnte.
Doch bald schon würden sie etwas gemeinsam haben. Sie würden beide Väter sein. Ihre Kinder konnten zusammen aufwachsen, zusammen spielen. Irving mochte Donnies Zwillinge Allison und Benedict, und auch wenn er nicht wusste, worüber er sich mit ihrem Vater unterhalten sollte, konnte er mit den Babys stundenlang irgendwelchen Unsinn plappern.
Allerdings schien Donnie die Kinder meistens zu ignorieren, und so würden sie sich vermutlich nicht über die ersten Worte und das Zahnen austauschen.
Die Plastikdose mit dem Pausenbrot, die er heute Morgen gepackt hatte, fühlte sich fettig in seinen Fingern an. Donnie und Konsorten brachten ihre Brote offenbar nicht in Plastikdosen mit. Dem Müll auf dem Tisch nach zu urteilen, benutzten sie Butterbrottüten und Frischhaltefolie. Irvings Vater war mittags immer nach Hause gekommen, um ein richtiges Essen zu sich zu nehmen, und das tat er auch heute noch. »Ich verstehe nicht, warum Peggy nicht für dich kocht«, sagte Irvings Mutter ständig, und Irving erwiderte dann: »Ach, ich habe nichts gegen Brot. Normalerweise arbeite ich sowieso die Pause durch.«
Er wünschte, er hätte auch heute durchgearbeitet. Es war durchaus nicht unangenehm, bei irgendwelchen Berechnungen zu sitzen, mit einer Hand zu tippen und in der anderen das Brot. Aber als er jetzt vor den Männern stand, hätte er ebenso gut die Brotdose mit dem Fred-Feuerstein-Motiv in der Hand halten können.
»Wie auch immer«, sagte er, weil es ihm unhöflich vorkam, einfach wegzugehen, »irgendwann wird das Baby schon kommen.«
»Setz dich.« Donnie deutete mit dem Kopf auf einen freien Stuhl. »Du machst mich nervös, wenn du da so rumstehst.«
Irving setzte sich.
»Wisst ihr, wie man die Babys am besten rausbekommt?«, fragte Brian. »So, wie man sie auch reinbekommen hat.«
»Bei Mary hat es funktioniert«, sagte Donnie. Er biss von seinem Weißbrot mit Schinken ab und redete kauend weiter. »Vielleicht sind die Zwillinge deshalb drei Wochen zu früh gekommen.«
Irving merkte, wie er rot wurde. »Nun ja, ich …«
»Das dürfte dir bei Peggy doch nicht schwerfallen, oder?«, sagte Mike. »Ich weiß noch, wie sie Schönheitskönigin war. Dass sie ausgerechnet dich ranlässt. Das hätte ich nie gedacht.«
Irving errötete noch mehr, diesmal vor Wut, doch alle grinsten, und es war doch schließlich nur freundschaftlich gemeint, oder? Sie waren nicht mehr auf der Highschool, und er war nicht mehr der kleine magere Trottel mit der Fred-Feuerstein-Brotdose. Er hatte einen Abschluss in Elektrotechnik, eine Ehefrau, und bald würde er ein Kind haben. Diese Kerle klopften nur Sprüche. Sie waren Kollegen, Ehemänner und Väter, und sie kannten sich schon ihr ganzes Leben lang. Ein paar blöde Sprüche musste er doch aushalten können …
Irving sah in die Runde, lächelte tapfer. »Ich habe mein ganzes Leben darauf gewartet, Vater zu werden«, sagte er. »Da kann ich auch noch ein bisschen länger warten.«
Alle lachten, und er zuckte vor Schreck leicht zusammen.
Sie lachen dich nicht aus, sagte er sich. Warum sollten sie?
Und doch taten sie es. Er wusste es genau so sicher wie vor zehn Jahren. Er war erwachsen geworden, auf der Hochschule gewesen – keine geringere als das MIT –, er hatte ein schönes Mädchen geheiratet und wurde Vater. Er hatte sich verändert, doch in Casablanca änderte sich niemals etwas.
Er packte sein Brot aus: Erdnussbutter und Früchtegelee. Er hatte es sich selbst geschmiert. Peggy war in ihrem Zustand kaum noch in der Lage, sich zu rühren, deswegen bestand er nicht darauf, dass sie ihm das Frühstück machte. Außerdem hatte er nichts gegen Erdnussbutter und Früchtegelee. Beim Essen war er nicht wählerisch. Und Peggy war nicht gerade die weltbeste Köchin. Kein Vergleich mit seiner Mutter … doch schließlich hatte er Peggy nicht wegen ihrer Kochkünste geheiratet.
Er dachte daran, wie sie heute Morgen im Bett gelegen hatte – im weißen Schwangerschaftsslip und einem seiner weißen Unterhemden, das sich straff über ihren Bauch spannte. Noch immer faszinierte es Irving, wie unterschiedlich ihre Körper waren. Peggy war so klein und zierlich. Er bestaunte immer wieder aufs Neue ihre zarten Handgelenke und Füße, den schlanken Hals. Oft nahm er ihre Hand in seine, nur um den Größenunterschied zu betrachten. Er war kein Mann von besonders imposanter Statur, doch neben ihr fühlte er sich wie ein großer Beschützer.
Heute Morgen hatte sie ihm den Rücken zugewandt, und wenn er nicht gewusst hätte, dass sie schwanger und zwei Wochen überfällig war, hätte er es nicht geahnt. Er hatte sich an sie gekuschelt, den Arm um ihre Taille gelegt und das T-Shirt nach oben geschoben, sodass er die Hand auf ihren nackten Bauch legen konnte. Manchmal, wenn er das tat, spürte er, wie das Baby trat, doch nicht heute Morgen. Heute Morgen spürte er nur Peggys leicht feuchte, warme Haut. Er vergrub das Gesicht in ihrem Haar, spürte, wie sie atmete, roch den Schweiß an ihrem Nacken und hätte gern die Hand über ihren gewölbten Bauch nach oben zu ihren von der Schwangerschaft geschwollenen Brüsten gleiten lassen. Doch Peggy hatte ihm in den letzten Wochen klargemacht, dass sie sich wie ein Walfisch fühlte und kein bisschen sexy.
Sie hatte es mit einem merkwürdigen Gesichtsausdruck gesagt, als ob es ihr seltsam vorkäme, dass er sie auch als Schwangere noch attraktiv fand. Vermutlich war es seltsam, dachte Irving. Er hatte keine Ahnung, ob andere Männer ihren schwangeren Frauen gegenüber ebenso empfanden.
Wie gern hätte er jemanden gefragt. Aber wen? Er musterte die Männer, die mit ihm am Tisch saßen, dann blickte er wieder auf sein Brot.
Irving hatte noch nie gehört, dass ein Mann einen anderen um einen Rat zum Thema Sex gebeten oder gefragt hatte, ob etwas normal sei. Männer machten Witze über Sex, so wie Donnie gerade eben. Sie witzelten unablässig darüber, aber Irving machte nicht mit. Er wollte nicht über schmierigem Butterbrotpapier über sein Intimleben sprechen und es auf eine Stufe mit Baseball stellen.
Er war sich ziemlich sicher, dass Frauen ständig darüber redeten. Peggy und Mary hörten oft abrupt zu sprechen auf, wenn er ins Zimmer kam.
»Mr. Alder!«
Melanie aus dem Büro stand in der Tür zum Pausenraum. Irving blickte sich nach seinem Vater um, der niemals hierherkam. Der Pausenraum war den Arbeitern vorbehalten. Doch Melanie kam auf ihn zu.
»Mr. Alder«, sagte sie. »Ihre Frau hat angerufen. Sie ist auf dem Weg ins Krankenhaus. Das Baby kommt!«
Die essenden Männer jubelten und pfiffen.
»Alles klar, Mann!«
»Gut gemacht, Irv!«
Mike Beaulieu schlug ihm auf die Schulter.
Irving ließ sein Brot auf dem Tisch zurück. Als er durch den Raum ging, klopften ihm weiter Hände auf den Rücken. Sein Magen war in Aufruhr, seine Haut kalt. Doch er hatte keine Angst. Er kam sich erwachsen vor und stark, als könnte er alles schaffen.
Er fühlte sich wie ein Mann.
Es war dermaßen heiß, dass der Schwefelgeruch von der Fabrik sogar bis in das Wartezimmer des Krankenhauses drang. Er konnte Peggy nicht hören. Sie war durch zwei Türen, einen Flur und diverse weiß gekleidete Schwestern von ihm getrennt, die keine Väter in den Kreißsaal ließen.
In Zeichentrickfilmen liefen werdende Väter nervös und gestresst auf und ab, während ihre Frauen entbanden. Für den großen Moment hielten sie Zigarren und Sekt bereit sowie einen großen Blumenstrauß.
Irving hatte sich die Lewiston Daily Sun geschnappt. Es war die einzige Zeitung, die es im Krankenhausladen gab. Er rauchte nicht und trank so gut wie nie – abgesehen von einer gelegentlichen Dose Bud. Und er hatte noch nie dazu geneigt, auf und ab zu laufen. Er hatte Peggy einen Blumenstrauß kaufen wollen, den größten, den er finden konnte, doch im Krankenhausladen gab es keine Blumen. Also erstand er stattdessen einen Teddybären und wartete.
Er saß auf dem Plastikstuhl unterhalb des Fensters. Ungefähr einmal in der Stunde ging er hinaus und rief mit dem Münztelefon Peggys und seine Eltern an, um ihnen zu berichten, dass das Baby noch nicht da war. Und nein, sie sollten nicht kommen, er werde sie wieder anrufen. Zweimal musste er in den Krankenhausladen zurückkehren, um Geld zum Telefonieren zu wechseln. Er kaufte eine Menge ein, weil der Laden um fünf Uhr zumachte – Kartoffelchips, einen Snickers-Riegel und eine Cola, dabei war er gar nicht hungrig. Außerdem kam seine Mutter gegen sechs Uhr mit ein paar Broten vorbei. (Hühnersalat und Schinkenpastete. Erdnussbutter war unter ihrer Würde.)
Vom Geruch einmal abgesehen, hätte dieser beigefarbene Raum überall auf der Welt sein können. Irving könnte in New York, Paris oder Vancouver warten. Er könnte eine Brücke in Südamerika bauen oder einen Damm in Kalifornien. Das Warten war überall dasselbe.
Er könnte eins der dutzenden Leben führen, die er sich einmal ausgemalt hatte. Einen der Träume leben, die er so entschieden verwirklichen wollte, bis er Peggy Grenier in ihrem kleinen Bikini am Morocco Pond begegnet war. Anstatt ihn zu ignorieren, sah sie zu ihm hoch und lächelte – und er verliebte sich sofort bis über beide Ohren in sie und fragte sie auf der Stelle, ob sie mit ihm ausgehen wollte. Es war das Mutigste, was er je in seinem Leben getan hatte.
Seit seinem siebten Lebensjahr wollte Irving Alder Casablanca verlassen. Er wollte der Fabrik entkommen, die nach faulen Eiern roch, den donnernden Lastern, die den Papierbrei transportierten, den primitiven Rüpeln mit ihren Baseballkappen, den schneereichen Wintern, die jedes Haus zu einer einsamen Insel machten. Er dachte, dass er an einem anderen Ort mutig sein könnte, selbstsicher. Dass man ihn schätzen würde. Dass man in ihm nicht nur den strebsamen Sohn von David Alder und offenkundigen Erben der Casablanca Paper Company sehen würde.
Am MIT hatte er schließlich Gleichgesinnte getroffen, junge Leute, die gern über Mathematik, Physik und Computer sprachen, die neugierig auf die Welt waren. Die wissen wollten, wie sie funktionierte, die mehr wollten als nur eine gut bezahlte Stelle, um sich ein Haus, einen Truck und irgendwann einen Altersruhesitz in Florida leisten zu können.
Doch dann war er im Sommer nach Hause gekommen, und Peggy Grenier sagte zu, dass sie mit ihm ins Kino gehen wolle. Und von jenem Moment an gab es für Irving keinen einzigen Traum mehr, in dem sie nicht vorkam. Er bewarb sich auf Stellen in Kalifornien und wollte gerade zu einem Bewerbungsgespräch fliegen, als sie schwanger wurde. Und wie konnte er von ihr erwarten, dass sie quer durchs Land zog, fort von ihrer Familie und ihren Freunden, wenn sie ein Baby bekam?
In Casablanca zu bleiben, den Job in der Fabrik anzunehmen, den sein Vater ihm anbot, weniger als eine Meile von seinen Eltern entfernt zu wohnen – all das schien ihm ein vergleichsweise geringer Preis für Peggy und das zu erwartende Baby zu sein.
Gegen zwei Uhr morgens legte sich Irving quer über drei zusammengeschobene Stühle und schlief ein. Es war ein seltsamer Halbschlaf, wie früher manchmal beim Lernen in der Bibliothek. Er träumte, dass er das Wartezimmer verließ, den Flur hinunterging, ein Heer Schwestern beiseiteschob und in den Kreißsaal stürzte, wo er Peggy schweißnass und mit schmerzverzerrtem Gesicht vorfand. »Lass mich das Baby zur Welt bringen«, sagte er im Traum, legte sich neben sie und öffnete die Arme. »Ich übernehme das. Du kannst dich jetzt ausruhen.« Er stellte die Füße auf die Stützen (in seinem Traum hatte er Schuhe an, braune Hush Puppies) und presste.
»Mr. Alder«, sagte die Schwester, und Irving öffnete die Augen. Er rappelte sich hoch und setzte sich auf.
»Was ist?«
»Sie haben einen Sohn.«
Einen Sohn. Ein Kind. Einen Sohn.
»Darf ich ihn sehen?«
»Natürlich.« Die Schwester führte ihn den Korridor hinunter und öffnete ihm die Tür, und da waren sie: Peggy wiegte ihren Sohn in den Armen. Die natürlichste Sache der Welt.
Am liebsten hätte Irving geweint. Geschrien, gelacht und getanzt. Mit federnden Schritten ging er zum Bett.
»Er ist wunderschön«, sagte er.
Er betrachtete die kleinen Finger, die kleinen Zehen. Die Falte zwischen den rauchgrauen Augen, den Schmollmund.
Wir haben dieses Wesen geschaffen, dachte Irving erstaunt. Diesen kleinen Menschen.
»Es ist ein Junge«, sagte Peggy. »Wir haben einen Sohn.«
Er streckte die Arme aus, und Peggy reichte ihm das Baby. Es war fest, real. Es krümmte sich in seinen Armen und knautschte das Gesicht, und Peggy lachte neben ihm.
»O mein Gott«, sagte sie. »Er sieht aus wie das Gemälde im Haus deiner Eltern.«
Irving lachte. Er fühlte sich benommen, als wäre die Welt zersprungen und hätte sich um einen einzigen Punkt neu formiert, um dieses Kind in seinen Armen. »Kleiner Louis Alder«, sagte er.
»Wir … wir könnten ihn Lou nennen«, schlug Peggy zaghaft vor. »Wenn du willst.«
»Nach meinem Ururgroßvater, dem Papier-Magnaten? Das scheint mir ein sehr großer Name für so ein kleines Baby zu sein.«
»Na, auf jeden Fall besser als Irving.«
Er riss den Blick von dem Baby los und schaute zu seiner Frau. Sie sah erschöpft aus, aber wunderschön, und sie lächelte ihn an.
Jetzt waren sie eine Familie, dachte er. Eine echte Familie.
»Würde das deinen Eltern nicht gefallen?«, fragte sie. »Wenn wir ihn nach Louis Alder benennen? Wir könnten ihn sogar Louis David, nach deinem Dad, nennen.«
Am Ende zögerte sie ein wenig, als sei sie unsicher, als wüsste sie nicht, ob es ihm gefallen würde, dass sie den Familiennamen weitertragen wollte.
Ein überwältigendes Gefühl von Liebe durchströmte ihn, und Irving stellte fest, dass dieser Moment mit seiner Frau und seinem Sohn unübertrefflich war – ganz gleich, was er sich einst erträumt hatte. Noch nie hatte er sich so sehr nach Casablanca gehörig gefühlt wie in diesem Moment, in dieser Gegenwart, die unweigerlich mit der Vergangenheit verbunden war – mit den Generationen seiner Familie an diesem Ort.
Es war Zeit, die Träume von einem Leben an einem anderen Ort zu begraben. Ihre Zukunft fand genau hier statt. Der Beweis war dieser kleine Junge in seinen Armen.
»Louis David«, sagte er. »Willkommen in Casablanca.«
Louis & Louise
1978–1982
In jenem Moment, bei der Geburt, sind Louis und Louise ein- und dieselbe Person in zwei verschiedenen Leben. Sie unterscheiden sich nur durch das Geschlecht, das der Arzt bekannt gibt, und durch ein »e« am Ende ihres Namens. Ihre Genitalien sind verschieden, ihre Gesichter jedoch gleich – und in den meisten Momenten sehen sie eher aus wie Irving als wie sein Ururgroßvater, doch sie haben auch etwas von Peggy, insbesondere wenn sie schlafen. Wenn Peggy und ihr Baby zusammen einschlafen, Louis und Louise mit dem Kopf an der nackten Brust der Mutter, sind ihre friedlich geschlossenen Augen und die entspannten Münder identisch.
Louis und Louise sind keine Zwillinge – nicht wie Marys zweieiige Zwillinge Allie und Benny, die wir mit der Zeit noch besser kennenlernen werden. Peggy und Irving Alder haben nur ein Kind. Peggy, die gleich beim ersten Mal schwanger wurde, wird kein weiteres Kind austragen. Louis und Louise sind bei der Zeugung eine Eizelle und ein Spermium. Nur dass das Spermium in der einen Version des Lebens ein X-Chromosom trägt und in der anderen ein Y-Chromosom. Spermium und Eizelle treffen aufeinander und beginnen, sich zu teilen und zu wachsen.
Beim Fötus ist Lous Geschlecht zunächst nicht zu erkennen. Ab der siebten Schwangerschaftswoche entwickeln sich die Genitalien. Da man das Baby bei einer unkomplizierten Schwangerschaft im Jahr 1978 in Peggys Bauch nicht sieht, könnte es jedes Geschlecht haben. Und so vieles andere an Louis und Louise sieht man auch nicht, obwohl es schon feststeht: die Augen- und Haarfarbe, das Lächeln, die Kurzsichtigkeit, das Muttermal auf dem Schenkel, die Veranlagung zu Heuschnupfen, die künftige Vorliebe für salziges Essen und Science-Fiction, das stete Schlagen des Herzens.
Doch als Lou geboren wird, sehen alle zuerst das biologische Geschlecht. Es ist das Erste, wonach jeder fragt. Die Grundlage jeder einzelnen Entscheidung, die über diesen kleinen Menschen getroffen wird, bevor er die Macht besitzt, eigene Entscheidungen zu treffen.
Im Augenblick der Geburt, noch vor dem ersten Atemzug und dem ersten Schrei, ist Lou Alder ein Geflecht aus den Träumen ihrer/seiner Eltern.
Doch diese Träume unterscheiden sich je nachdem, ob es sich um einen Sohn oder eine Tochter handelt.
Louise wird in Rosa gekleidet mit nach Hause genommen. (Ihr Haar ist knallrot, was sich schrecklich beißt.) Louis wird in Blau gekleidet, was sich besser mit dem roten Haar verträgt. Die Großeltern kommen mit Geschenken: mit Puppen oder mit Teddys, mit Kleidern oder mit einem winzigen Baseballhandschuh. Man stelle sich vor, wie sie in Peggys und Irvings neuem Haus im Wohnzimmer sitzen, Tee trinken und versuchen, um des Babys willen miteinander ins Gespräch zu kommen. David Alder trägt trotz der anhaltenden Hitze Anzug und Krawatte, Bob Grenier Arbeitshose und ein kariertes Hemd, das so neu ist, dass man noch die Falten aus der Verpackung sieht. Vi Alder trägt ein Twinset und Perlen, Yvette Grenier ihre beste Polyesterhose und eine ärmellose Bluse. Sie sind alle aus Casablanca, dort geboren und aufgewachsen, doch sie könnten genauso gut von unterschiedlichen Planeten stammen. Bob Greniers Vater war aus Québec ausgewandert, um für die Papierfabrik von Casablanca Holz zu schlagen, und Bob arbeitet seit seinem siebzehnten Lebensjahr in der Fabrik an Maschine zwei. David Alders Vater hatte die Fabrik von seinem Vater George geerbt, dessen Vater – der aus Pennsylvania stammende Louis Alder – sie im Jahr 1862 gegründet hatte. Yvette ist die Tochter eines Waldarbeiters, und Vis Vater dagegen besaß eine Reihe von Schuhgeschäften in Western Maine, bis er sie an seinen Sohn verkaufte und sich in Key West zur Ruhe setzte. Yvette bemerkt, dass Vi beim Teetrinken den kleinen Finger abspreizt, als hielte sie sich für die Königin von England. Und Vi muss sich stark beherrschen, wenn sich Bobs Raucherhusten meldet, er einen großen Klumpen in sein Taschentuch würgt und ohne sich die Hände zu waschen anschließend das Baby aus der Wiege nimmt. Peggys Eltern geben mehr für die Geschenke aus, als sie sich leisten können, und dennoch wirken sie schäbig und billig neben den Geschenken von Irvings Eltern, die diese bei Macy’s in Portland erstanden haben.
Für beide Paare ist Lou das erste Enkelkind. Vielleicht liefert ihnen das Kind ein Gesprächsthema. Vielleicht haben sie durch Lou jetzt etwas gemeinsam, vielleicht lässt das Kind die Kluft zwischen Unternehmer und Angestelltem, zwischen Schreibtischmensch und Arbeiter, zwischen Katholik und Protestant ein für allemal verschwinden.
Die Großeltern geben sich größte Mühe mit den Puppen und dem Baseballhandschuh, mit den Kleidern und Bären, und was sie da verschenken, sind eigentlich ihre eigene Geschichte und ihre eigene beschränkte Sicht der Dinge. So engen sie unablässig die unendlichen Träume des Kindes ein.
Doch das tun alle. Es geschieht aus Liebe. Wir möchten, dass unsere Kinder in der Welt leben, die wir kennen. Dass sie sich einfügen und tun, was von ihnen erwartet wird, weil man nur so glücklich wird. Man kann nicht von allem träumen. Man muss von dem träumen, was möglich ist. Louis Alder wird eine Mehrheitsbeteiligung an der Casablanca Paper Company erben, was für seine Großeltern mütterlicherseits, die immer noch die Hypothek für ihr kleines Häuschen abbezahlen, einen fast unvorstellbaren Reichtum darstellt. Louise Alder … nun, bei ihr ist es nicht so einfach, doch schließlich sind es die Siebziger, fast die Achtziger – Feminismus ist kein Schimpfwort mehr, warum also sollte eine Frau nicht eines Tages eine Fabrik leiten? Und vielleicht bekommt sie noch einen Bruder, oder sie heiratet und bringt einen weiteren Erben zur Welt, auch wenn er einen anderen Nachnamen tragen wird.
Noch versteht Lou nichts von alledem. Lous Welt besteht aus Milch und Wärme, aus vertrauten Stimmen und sanften Berührungen, verwischten Farben und schemenhaften Gesichtern, dem nassen Mus einer vollen Windel und dem Wohlgefühl an einer Brust. Lou ist ein hungriges Baby. Wenn Irving es nimmt, versucht es, auch an ihm zu saugen.
Das Lieblingsspielzeug, sowohl von Louise als auch von Louis, ist ein kleines Stoff-Hühnchen, das weder rosa noch blau, sondern gelb und rot ist. Das erste Wort ist »Hü«, was »Hühnchen« bedeutet.
Hü wird geknuddelt und mit Begeisterung in den Mund gesteckt. Trotz regelmäßiger Aufenthalte in Peggys hochmoderner Waschmaschine wird das Hühnchen immer grauer und schmuddeliger. Lou, ob in Rosa oder Blau, lernt laufen, aber am liebsten rennen die zwei. Und klettern. Sie überwinden das Gitter vom Kinderbett und Peggys Treppenschutz. Einmal lässt Peggy Lou draußen auf dem Rasen allein, um ans Telefon zu gehen. Keine fünf Minuten. Doch als sie zurückkommt, ist das Kind hinten im Garten auf einen großen Felsen geklettert. Dort sitzt es quietschfidel und droht jeden Moment herunterzufallen und sich den Kopf aufzuschlagen.
»Dieser Junge schafft alles«, sagt Grandma Alder.
»Mit diesem Mädchen wirst du noch Schwierigkeiten bekommen, wenn es erst in die Pubertät kommt«, warnt Mémère Grenier.
Mit drei Jahren lernt Lou zu pfeifen. Ein echter Pfiff mit geschürzten Lippen und aus voller Lunge. Laut wie ein Matrose. Jeden Abend bringen Louis und Louise Hü ins Bett. Sie helfen Peggy die Wände im Haus zu streichen und arbeiten mit einem kleinen Pinsel an der ihrer Mutter. Vier Tage später finden sie einen roten Buntstift und malen ihre Familie auf die frisch geweißte Wand: drei runde Kleckse, Mummy, Daddy und Lou.
Louis und Louise wünschen sich einen kleinen Bruder oder eine kleine Schwester, doch es kommt kein Geschwisterchen. Manchmal hören sie die Eltern nachts in der Küche flüstern, verstehen die Worte jedoch nicht.
Und es gibt noch andere Worte, die sie nicht verstehen. Worte wie »niedlich« oder »stark«. Wie »süß« oder »schlau«. »Mädchen« oder »Junge«, »Heulsuse« oder »Rabauke«. Sie beschließen, kein Rosa oder Blau zu mögen, und lassen sich von ihrer Mutter nur noch in Rot, Gelb oder Violett kleiden, was sich heftig mit den roten Haaren beißt. Wenn sie können, klettern sie noch immer auf Felsen und Bäume. Doch nur Louis kuschelt jetzt noch nachts mit Hü, und wenn Louise pfeift, pfeift sie eine Melodie.
Louise
2010
Es ist zehn nach drei am Nachmittag. Lou sitzt am Pult und sieht die letzten Aufsätze ihrer Schüler durch. Die Sonne scheint durch die vergitterten Fenster der Brooklyn Middle School, an der sie seit sechs Jahren unterrichtet. Mein Sommerabenteuer lautete die Überschrift des Aufsatzes, doch einige Kinder haben ihren Geschichten eigene Titel gegeben.
Mein Kampf mit den Riesen-Weltraumameisen
Wie ich Brooklyn abgefackelt habe
Sommerschule in Hogwarts
Sie hätte die Aufsätze benoten und gleich zurückgeben sollen, dann hätten die Kinder sie mit nach Hause nehmen können. Doch sie wollte sie in Ruhe lesen und das Ende des Schuljahres noch ein wenig hinauszögern. Sie mag diese Klasse, die 8G, und wahrscheinlich wollten die Kinder die Aufsätze ohnehin nicht zurückhaben. Sie haben Wichtigeres im Kopf als Englisch-Hausaufgaben. Sie sind auf dem Weg zu ihren wahren Sommerabenteuern, und anschließend gehen sie auf die Highschool.
Dieser Sommer wird der beste Sommer überhaubt. Denn in diesem Sommer wird sich Justin Bieber in mich verlieben. Ich erzäle euch, wie es dazu kommt. Als Erstes beschreibe ich euch, wie ich aussehe: Ich habe langes rabenschwarzes Haar mit blauen und violetten Stränen, und meine Augen sind groß und himmelblau. Ich trage immer schwarze Overknie-Stiefel und Spitzenkleider mit Rissen, und alle sagen, ich bin voll schön, aber ich weiß gar nicht, wie schön ich bin. Eines Tages wachte ich auf und meine Mom sagte, Sydny, du hast einen Brief. Und als ich ihn öffnete, stand da, ich habe eine Reise nach Los Angeles gewonnen, und ich war voll aufgeregt, weil Justin dort lebt. OMG, werde ich ihn endlich kennlernen!?!?!?!?
Lou lächelt. Jeder Aufsatz, den Akia Hassan in diesem Schuljahr verfasst hat, handelt davon, dass Justin Bieber sich in sie verliebt, ganz gleich, wie das eigentliche Thema gelautet hat. Für gewöhnlich sind die Aufsätze nicht sehr schlüssig, und Lou hat sich vergeblich bemüht, Akia dazu zu bringen, häufiger ihre Rechtschreibung zu überprüfen und nicht ständig »OMG« zu verwenden. In gewisser Weise bewundert sie jedoch, wie unbeirrt die Achtklässlerin ihrem Idol die Treue hält, schließlich lautet die Überschrift des Aufsatzes: »Welche kleinen Schritte wir alle unternehmen können, um die Erderwärmung zu reduzieren«.
Sie blättert zur letzten Seite, um nachzusehen, wie viele Kinder Akia alias Sydny und Justin in ihrer wundervollen, glücklichen Ehe haben werden (die Zahl variiert zwischen eins und sechs). Anstelle des normalerweise mit Herzchen verzierten Worts Ende, das Akia sonst auf die letzte schreibt, steht dort: Ich werde Justin Bieber niemals heiraten, aber vielen Dank, dass ich das ganze Jahr so tun durfte. Sie werden mir fehlen, Ms. A!
Lou blinzelt ein paar Tränen fort.
Sie hasst den letzten Schultag. Alle Schüler sind so fröhlich, und selbst die engagiertesten unter den Lehrerkollegen freuen sich auf sechs Wochen Ferien. Doch für Lou bedeutet der Tag, dass sie die kleine Welt, in der sie die letzten zehn Monate gelebt hat, verlassen muss. Kein Abenteuer, sondern ein Verlust.
Sie seufzt und holt eine rosafarbene Aktenmappe aus der Schreibtischschublade. Am Ende wird sie diese Aufsätze mit all den anderen unter ihrem Bett lagern. Dana wird sie damit aufziehen, und Lou wird sagen: »Das verstehst du erst, wenn du erwachsen bist«, doch tief im Inneren hofft sie, dass Dana es niemals verstehen wird. Dass es Dana deutlich leichter fallen wird, nach vorn zu schauen, loszulassen. Und dass Dana es deutlich seltener nötig haben wird loszulassen.
»Lou?«
»Dad?«, antwortet sie sofort, noch ehe sie aufsieht, obwohl ihr Vater noch nie zuvor in ihrer Schule gewesen ist und obwohl sie ihn seit dem Tag nach Weihnachten nicht mehr gesehen hat.
Ihr Vater steht im Türrahmen. Das sieht sie nicht nur, das sagt ihr auch das Gefühl in ihrer Brust. Eine Mischung aus Glück und schlechtem Gewissen.
»Hallo«, sagt sie und steht auf. »Was tust du hier?«
Er trägt noch immer dieselben kurzärmeligen weißen Button-up-Hemden, in denen sie ihn schon ihr ganzes Leben lang kennt, aber er hat eine neue Brille. Zumindest glaubt sie, dass die Brille neu ist. Oder nicht?
»Ich wollte dich besuchen«, sagt er und kommt näher.
Lou tritt hinter ihrem Pult hervor und umarmt ihn. Woraufhin er sie fest in die Arme schließt. Sie ist ein paar Zentimeter größer als er, was sie immer wieder überrascht.
»Bist du hergeflogen?«
»Gefahren.«
»Du bist sechs Stunden Auto gefahren, nur um mich zu besuchen?«
Irving zuckt die schmalen Schultern. »Du bist mein kleines Mädchen. Und außerdem fahre ich gern Auto.« Er lässt die Hand auf ihrem Ellbogen ruhen, als wollte er den Kontakt noch nicht lösen. »Ich dachte, man würde mich nicht in das Gebäude lassen und ich müsste draußen auf dich warten. Die haben Metalldetektoren! In einer Schule! Das haben wir in Casablanca nicht.«
»Ja, stimmt.« Als er ihre Heimatstadt erwähnt, weicht Lou zurück. Sein Arm sinkt herab. »Aber man hat dich reingelassen?«
»Ich habe denen erzählt, dass ich dein Dad bin. Offensichtlich sehe ich harmlos genug aus.«
Du bist harmlos, denkt sie und muss ihn unwillkürlich noch einmal umarmen. »Was tust du hier?«
»Ich muss etwas mit dir besprechen. Persönlich.«
»Was?«
Diesmal lässt er sie zuerst los. Er geht zu ihrem Pult und mustert die Stapel mit den Aufsätzen. »Sieht aus, als hättest du die Ferien über eine Menge zu tun.«
»Nur die Kinder haben Ferien, nicht die Lehrer.«
»Ich habe mich immer gefragt, wie deine Schule wohl aussieht.«
Sie folgt seinem Blick durch das Klassenzimmer. Seit fünf Jahren unterrichtet sie nun in diesem Raum, aber einiges fällt ihr erst jetzt auf, als sie es mit den Augen ihres Vaters sieht. Wie klein der Raum ist. Dass die Farbe von den Wänden blättert. Die Gitter vor den Fenstern. Der Verkehrslärm von draußen, die Musik und das Geschrei. All der Lärm von Brooklyn, der trotz der rasselnden alten Klimaanlage zu hören ist.
Wie fremd das auf ihren Dad wirken muss, der die Grundschule in einem weiß gestrichenen Holzhaus am Pennacook River besucht hat, mit einem großen umzäunten Spielplatz, in dessen Mitte ein großer Findling lag. Die Kinder kletterten auf ihn rauf, um dort oben ihre Pausenbrote zu essen. Pettingill Primary. Bis zur dritten Klasse war Lou ebenfalls auf diese Schule gegangen, dann wurde in einem modernen Gebäude die neue Grundschule von Casablanca eröffnet.
»Auf den Raum achte ich gar nicht«, sagt sie, als müsse sie die Schule verteidigen. Oder rechtfertigt sie sich selbst? Ihr Leben? »Die Kinder machen ihn interessant.«
»Das glaube ich dir.« Er streicht mit dem Finger über die Tischplatte eines Schülerpults. Jemand hat Ich ™ Omar hineingekratzt und das Herz rot ausgemalt.
»Das Umfeld ist anders«, erklärt sie, »aber die Kinder sind auch nicht anders als ich in ihrem Alter. Wahrscheinlich auch nicht anders als du früher.«
»Wo ist Dana?«, fragt er. »Hat sie jetzt nicht auch Schulschluss?«
»Sie hatte um halb drei Schluss.«
»Wo ist sie dann? Kommt sie her, um auf dich zu warten?«
»Nein, sie hat Fußballtraining, und dann fährt sie mit dem Bus nach Hause. Sie hat einen Wohnungsschlüssel, falls ich nach ihr komme.«
Sie sagt es trotzig, weil sie weiß, was ihre Mutter davon halten würde, dass ein zwölfjähriges Mädchen mit dem Bus allein durch Brooklyn fährt. Ganz zu schweigen von dem Umstand, dass sie sie allein in der Wohnung lässt, aber Irving blinzelt nur hinter seinen Brillengläsern und sagt: »Ach, dann ist sie also da, wenn wir kommen?«
»Ihr Training geht bis halb fünf. Wahrscheinlich werden wir also vor ihr zu Hause sein.«
Ihr Vater zieht die Nase kraus, als müsse er niesen. Schließlich sagt er: »Ich freu mich, sie zu sehen. Sie ist bestimmt gewachsen. Das ist auf Bildern schwer zu erkennen.«
»Jedes Mal, wenn ich sie ansehe, kommt es mir vor, als wäre sie wieder einen Zentimeter größer geworden. Sie hat einen gesunden Appetit.«
»Genau wie du früher.« Er nimmt die Brille ab, um sie zu putzen, und Lou bemerkt, dass er nicht verändert aussieht, weil er eine neue Brille hat. Sein Haar ist ganz und gar grau geworden. Über Weihnachten war noch ein ziemlich großer Teil braun, doch kaum ein halbes Jahr später ist alles silbern und weiß.
Von Maine nach Brooklyn fährt man sieben Stunden mit dem Auto. Noch länger, wenn man in Connecticut in einen Stau gerät, und in Connecticut ist immer irgendwo ein Stau.
»Ist alles in Ordnung, Dad?«, fragt sie.
»Mir geht es gut.«
»Das ist eine ziemlich lange Reise, um mit mir über meine Arbeit mit den Schülern zu reden.«
»Nun, natürlich wollte ich dich und Dana sehen. Die Schule ist nur das I-Tüpfelchen.«
Die Stühle stehen umgedreht auf den Pulten, wie schwarze Antennen ragen die Beine in die Luft. Lou nimmt einen herunter und setzt sich darauf. »Erzähl mir, was los ist, Dad. Warum bist du hergefahren, ohne mir vorher Bescheid zu sagen? Warum kommst du zur Schule anstatt zu meiner Wohnung? Ich meine, selbstverständlich bist du willkommen, aber so etwas machst du sonst nicht. Wir sind keine Familie, die sich gegenseitig spontan besucht.«