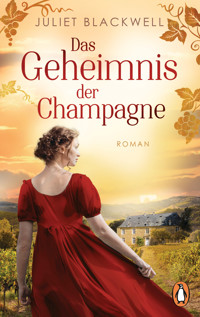
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine dramatische Liebesgesgeschichte, die sanft geschwungenen Hügel der Champagne und eine Frau, die wieder Hoffnung schöpft.
Sanft geschwungene Hügel bis zum Horizont, herrschaftliche Weingüter, das Rauschen der Reben im Wind ... Doch die junge Amerikanerin Rosalyn hat für die Schönheit der Champagne nichts übrig. Nach einem Schicksalsschlag wollte sie nie wieder nach Frankreich reisen, aber ihr Chef, ein Winzer, bestand auf diese Geschäftsreise. Dann fallen Rosalyn alte Liebesbriefe in die Hände, voller Sehnsucht und Gefühl. Zum ersten Mal seit Langem berührt etwas ihr Herz, und Rosalyn kommt einer dramatischen Liebesgeschichte auf die Spur, die vor mehr als einem Jahrhundert in den Kellergewölben der Champagne begann…
Champagne, 1914: Der Krieg wütet, und wie viele andere Frauen sucht die junge Französin Lucie Zuflucht in den unterirdischen Weinkellern des Champagnerhauses Pommery. Dort kümmert sie sich um Verwundete, Waisenkinder und wartet bange auf die Briefe ihres Verlobten, der an der Front um sein Leben kämpft ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 540
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Sanft geschwungene Hügel bis zum Horizont, herrschaftliche Weingüter, das Rauschen der Reben im Wind … Doch die junge Amerikanerin Rosalyn hat für die Schönheit der Champagne nichts übrig. Nach einem Schicksalsschlag wollte sie nie wieder nach Frankreich reisen, aber ihr Chef, ein Winzer, bestand auf diese Geschäftsreise. Dann fallen Rosalyn alte Liebesbriefe in die Hände, voller Sehnsucht und Gefühl. Zum ersten Mal seit Langem berührt etwas ihr Herz, und Rosalyn kommt einer dramatischen Liebesgeschichte auf die Spur, die vor mehr als einem Jahrhundert in den Kellergewölben der Champagne begann …
Champagne, 1914: Der Krieg wütet, und wie viele andere Frauen sucht die junge Französin Lucie Zuflucht in den unterirdischen Weinkellern des Champagnerhauses Pommery. Dort kümmert sie sich um Verwundete, Waisenkinder und wartet bange auf die Briefe ihres Verlobten, der an der Front um sein Leben kämpft …
Juliet Blackwell lebt in Kalifornien, wo sie auch aufgewachsen ist. Nach ihrem Studium arbeitete sie unter anderem in Frankreich, verliebte sich in das Land und ließ sich von der wunderschönen Umgebung zu ihren Romanen Das Karussell der verlorenen Träume und Das Geheimnis der Champagne inspirieren.
Das Geheimnis der Champagne in der Presse:
»Der Charme von alten Liebesbriefen, verbunden mit dem Geheimnis altehrwürdiger Champagnerkeller ergeben einen Pageturner, der einen in den Bann schlägt.« Publishers Weekly
Außerdem von Juliet Blackwell lieferbar:
Das Karussell der verlorenen Träume
Juliet Blackwell
Roman
Aus dem Englischen von Veronika Dünninger
Die Originalausgabe erschien 2020
unter dem Titel The Vineyards of Champagne
bei Berkley, New York 2020.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung.Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2020 by Julie Goodson-Lawes
Copyright © 2023 der deutschsprachigen Ausgabe by Penguin Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.
This edition published in arrangement with Berkley, an imprint of Penguin Publishing Group,
a division of Penguin Random House LLC.
Redaktion: Sigrun Zühlke
Covergestaltung: www.buerosued.de
Covermotiv: Arcangel Images, Abigail Miles, www.buerosued.de
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-24611-2V001
www.penguin-verlag.de
Für Sergio
Als ich dich verlor, verlor ich meine Sonne und meinen Mond.
Mögest du für immer scheinen, mein Diamant am Himmel.
Als ich dich verlor, verlor ich meine Sonne und meinen Mond
Und all die Sterne, die meine einsame Nacht segneten.
* * *
Ich verlor das Schlüsselwort, mein Schatz, den Faden,
Der sich durchs Labyrinth des Lebens zieht,
Als ich dich verlor.
WINIFREDLETTS
Einleitung
Lucie
Reims, Frankreich
1916
Das Klappern der Stricknadeln meiner Mutter ist das Metronom, das die Minuten, Stunden, Monate misst, die wir in den ständig kalten, düsteren Kellern verbringen. Das Geräusch hallt von den Kreidewänden wider.
Wenn der Granatbeschuss für eine Weile innehält, wagen es die Kräftigeren unter uns, in die Welt über der Erde hinauszuschlüpfen. Die Sonne auf unseren Gesichtern zu spüren, die Luft – egal wie rauchgeschwängert, sie ist immer noch besser als die schale Luft in den Kellern – tief einzuatmen und die Verwundeten zu versorgen. Wir durchkämmen die verkohlten Ruinen unserer einst schönen Stadt nach allem, was von Nutzen sein könnte: eine unzerbrochene Teetasse, ein Kinderspielzeug, zerrissene Decken oder Pullover, die für ihre Wolle aufgetrennt werden können.
Die Hände meiner Mutter waren früher weich von einem Leben in Behaglichkeit. Jetzt reißen dieselben Hände alte, unförmige Pullover mit einer Habgier an sich, die mich verblüfft. Sie trennen das Garn auf, wickeln es zu einem Strang, weichen es in Wasser ein, um die Kräuselung der Maschen zu glätten, färben es manchmal sogar: hellgelb mit Zwiebelhäuten oder gräulich-violett mit Resten von Traubenmost.
Früher lehrte mich meine Mutter, mit geschlossenen Knien zu sitzen, mich anmutig zu bewegen und wann ich lächeln soll. Für diese Fähigkeiten ist in den Kellern kein Platz. Hier habe ich eine andere Lektion von meiner Mutter gelernt: Garn bleibt grundsätzlich unverändert, ganz gleich, in welchem Muster es verstrickt wurde. Es bleibt Wolle. Es mag versengt, liegen gelassen, einem Leichnam abgenommen worden sein. Es mag vollständig aufgetrennt sein, ein verschlungenes, verknotetes Rattennest aus Fasern. Aber es kann gereinigt und entwirrt und wieder zusammengestrickt werden. Es kann eine neue Gestalt annehmen. Die Form mag anders sein, aber die Wolle bleibt grundsätzlich dieselbe.
Der menschliche Geist will nicht sterben; er ist etwas sehr Widerstandsfähiges.
In jenem ersten Kriegsjahr, ohne kräftige junge Männer, ohne die Hilfe anständiger Pferde oder landwirtschaftlicher Geräte, während deutsche Kugeln und Granaten von den Hügeln herunterprasselten, entschieden wir uns, die Ernte einzubringen. In jenem ersten Jahr, im zweiten und auch in dem danach. Jeden September, wenn die Hitze des Sommers der Kühle des Herbstes zu weichen beginnt, wenn der Kellermeister erklärt, dass die Frucht den Höhepunkt ihrer Süße erreicht hat, wagen wir uns im Schutz der Dunkelheit hinaus, um die Trauben zu lesen. Wir schleppen sie unter die Erde, fangen ihren Saft ein und lagern die Flaschen zum Reifen in den kühlen, feuchten Kellern.
Wir bringen die Ernte ein, in dem Wissen, dass unser geliebter Champagner erst trinkbar sein wird, wenn der Krieg längst vorbei ist. Ein Siegesjahrgang, der zur Feier des Kriegsendes genossen werden soll.
Frauen. Kinder. Die Alten.
Wir bringen die Ernte ein.
Wir machen den Wein.
Kapitel 1
Rosalyn
Napa, Kalifornien
Gegenwart
»Es gibt ein ziemlich großes Problem bei deinem kleinen Plan«, sagte Rosalyn und klopfte auf das Dossier, das Hugh vor ihr auf den Schreibtisch geworfen hatte. Der Reiseroute zufolge war sie auf einen Air-France-Flug gebucht, der am Tag nach Weihnachten von San Francisco nach Paris ging. Sie sollte ein paar Nächte in Paris bleiben, dann einen Mietwagen abholen, der auf ihren Namen reserviert war, und in die Champagne weiterreisen, eine knapp zweistündige Fahrt nach Nordosten.
»Was denn für ein Problem? Ich habe es selbst gebucht.« Hugh nickte und zwinkerte ihr übertrieben zu. »Erste Klasse – das ist das Ticket. Verstehst du? Das Ticket?«
»Aber ich mag Frankreich nicht. Oder die Franzosen. Oder Champagner, um genau zu sein.«
»Willst du damit sagen, du magst la Champagne nicht, die Region in Frankreich«, fragte Hugh, »oder le champagne, den perlenden Nektar, der auf der ganzen Welt gefeiert wird?«
»Beides, wie du sehr wohl weißt. Mag’s einfach nicht.«
Hughs einzige Reaktion auf ihren Unmut war ein breites Lächeln. Rosalyns Boss war ein Bär von einem Mann, der das beengte Weinbau- und Importbüro, das sich in der entzückend renovierten Garage seines weitläufigen Weinguts im Napa Valley befand, noch kleiner wirken ließ. Mit weit über einem Meter achtzig hatte der Mann, der ironischerweise Hugh Small hieß, den gut gepolsterten Körperbau eines Mannes, der oft Gäste bewirtete und seine eigenen hervorragenden Kochkünste – und Weine – ein bisschen zu sehr genoss. Sein braunes Haar mit den ersten grauen Strähnen war wild und zerzaust, und seine Kleidung so nachlässig, dass man ihn, wäre er nicht so bekannt gewesen im Tal, vielleicht für einen der Landstreicher hätte halten können, die zwischen den Weinreben kampierten und an den Highways von Napa und Sonoma entlangzogen, um die Reste aus den Flaschen zu trinken, die gut betuchte Touristen auf ihren Weinverkostungstouren auf den Picknicktischen zurückließen.
Zehn Jahre zuvor hatte Hugh sich mit dem Kauf eines Weingutes in Napa einen lebenslangen Traum erfüllt. Er hatte rasch begriffen, wie hart es war, sich im Weinbau einen Namen zu machen, und erweiterte sein Geschäft daher bald um den Import und Verkauf ausgewählter Jahrgänge aus Frankreich und Spanien über seine Firma »Small Fortune Wines«.
Hughs Lieblingswitz: »Wie macht man im Weingeschäft ein kleines Vermögen? Man fängt mit einem großen Vermögen an.«
Heute prangte in Hughs hellblauem Pullover über seinem Herzen ein Mottenloch. Rosalyn starrte darauf, während sie darüber nachgrübelte, was dieses Loch ihr sagen wollte. Hugh hatte mehr als genug Herz für sie beide.
»Im Ernst, Hugh«, beharrte Rosalyn, bemüht, die vage Panik unter Verschluss zu halten, die irgendwo tief in ihr köchelte. »Ich weiß, die meisten Leute würden die Gelegenheit beim Schopf packen, auf Firmenkosten in die Champagne zu fahren, aber ich reise wirklich nicht gern. Bist du sicher, dass du mich dafür brauchst?«
Er nickte. »Andy ist noch immer im Krankenhaus bei seiner Frau und ihrem Frühchen; er kann jetzt unmöglich wegfahren.«
»Könntest du nicht fahren? Ich könnte hierbleiben und das Büro führen.«
»Ich brauche einen Weinvertreter in Frankreich«, antwortete er. »Und du bist eine Weinvertreterin.«
»Mehr schlecht als recht.«
»Und du sprichst Französisch.«
»Mehr schlecht als recht.«
»Und du hast einen Gaumen. Besser als meiner. Außerdem«, fuhr Hugh fort, während er einen Stapel Post durchsah und mehrere Umschläge in den Papierkorb warf, »ist es regelrecht peinlich, dass du noch nie in Frankreich warst. Welcher Weinvertreter, der etwas auf sich hält, war denn noch nie in Frankreich?«
»Ich war in Frankreich.«
»Ein einziges Mal. Und wenn ich mich nicht irre, bist du damals nach Paris gefahren, was ungefähr so typisch für Frankreich ist wie New York City für die Vereinigten Staaten. Und gib’s zu: Du hast deine Zeit dort genossen.«
Schneeflocken, die auf ihren Schals glitzerten, während sie unter dem Laternenpfahl an der Ecke Rue des Abbesses und Rue Lepic standen. Beschwipst von Wein und After-Dinner-Cognac. Kichernd, während sie zusahen, wie ein Mann lautlos die schneebedeckten Kopfsteingassen des Montmartre hinunterschlitterte, und ihr Atem in hauchzarten Wolken aufstieg und sich mit der eisigen Luft vermischte.
»Das ist unser Lachen«, sagte Rosalyn und hob ihre behandschuhte Hand, als wollte sie die Schwaden einfangen. »Komm zurück!«
Dash nahm ihre Hand, wärmte sie in seinen beiden und küsste sie dann. »Davon wird es noch jede Menge mehr geben, Rosie. Ein Leben voller Lachen für meine schöne Braut. Versprochen.«
Dash hatte nicht Wort gehalten.
»Natürlich habe ich es genossen«, erwiderte Rosalyn, als ihr bewusst wurde, dass Hugh sie noch immer ansah und auf eine Antwort wartete. »Es war meine Hochzeitsreise. Das war etwas anderes.«
»Dash ist oft nach Frankreich gefahren«, hob Hugh hervor. »Er hat es geliebt.«
Rosalyn verspürte den üblichen scharfen Stich in der Magengegend bei der Erwähnung ihres Ehemanns. Dennoch war sie dankbar, dass Hugh nie zögerte, ihn laut auszusprechen. Es dämpfte jedes Mal den Schmerz, wenn auch nur ein klein wenig, wenn jemand über Dash redete, als wäre alles ganz normal; als würden sie seinen Geist heraufbeschwören, sein Wesen in diese Welt einladen. Die meisten Leute versuchten, jede Erwähnung seines Namens zu vermeiden, oder gaben sich zerknirscht, als wäre ihnen irgendetwas Ungeschicktes und Peinliches passiert, wenn sie ihn zur Sprache brachten.
»Mir gefällt es genau hier«, beharrte Rosalyn und starrte aus dem Fenster auf die verschlungenen Weinreben, die sich über die wogenden Hügel erstreckten, ihre leicht gewellten Linien nur hier und da von einer Eiche unterbrochen. Der Anblick der parallelen Reihen war tröstlich, als hätte ein Zen-Meister einen riesigen Rechen durch Sand gezogen. »Ich wage zu behaupten, dass mir niemand einen schöneren Ort als Napa nennen kann.«
»Es spricht nichts dagegen, für eine Weile hier Zuflucht zu suchen, Rosalyn.« Hugh dämpfte seine Stimme, und ihre sanfte Aufrichtigkeit ging ihr gegen den Strich. »Aber das ist kein Lebensplan. Wenn du dich entscheidest, dich in Napa niederzulassen, sollte es genau das sein: eine Entscheidung. Kein Versuch, dich vor dem Leben zu verkriechen.«
Rosalyns Augen brannten; Übelkeit stieg in ihrer Kehle hoch. Eine Hand spielte mit dem silbernen Medaillon, das um ihren Hals hing, während die andere nach den Reiseunterlagen griff. Sie tat, als würde sie die Route studieren, in der Hoffnung, sich abzulenken, die Tränen aufzuhalten, die beginnende Panik zu unterdrücken.
Atme, rief sie sich in Erinnerung. Zehn langsame, tiefe Atemzüge …
»Wie du sehen kannst«, fuhr Hugh fort, wobei seine Stimme wieder zu ihrem fröhlichen Ton zurückfand, und zeigte auf ein paar Punkte, die in fetter Schrift hervorgehoben waren, »wirst du Small Fortune Wines auf dem Festival von Saint Vincent, dem Schutzheiligen der Winzer, vertreten, das am zweiundzwanzigsten Januar stattfindet. Bis dahin wirst du dich mit Winzern treffen, Nettigkeiten austauschen, die Keller besichtigen …«
»Als ob ich in meinem Leben noch mehr Weinkeller sehen müsste.«
»Du musst in deinem Leben noch mehr Weinkeller sehen, Rosalyn«, beharrte Hugh. »Die Champagnerkeller sind anders als alle, die du bisher gesehen hast; allein unter Reims gibt es zweihundert Kilometer an crayères. Eine ganze Stadt, unter der Erde. Wusstest du, dass die Franzosen während des Ersten Weltkriegs ganze Schulen und Geschäfte in die Keller verlegt haben?«
»Faszinierend«, erwiderte Rosalyn. »Aber ist das der Grund, weshalb du mich dort hinschicken willst? Um ein Weinfestival zu besuchen und ein paar Keller zu besichtigen? Das klingt für mich nicht sehr kosteneffektiv.«
»Nein, nein, nein, du wirst auch ein paar neue, kleinere Erzeuger unter Vertrag nehmen. Das ist die Grundlage meiner Vision.«
»Deiner … wie bitte?«
Hugh erwiderte ihr Lächeln. »Meiner Vision, die Leute davon zu überzeugen, Champagner nicht als Luxus zu verstehen, sondern einfach ein Glas zu ihrer Vorspeise zu trinken, wie es in Frankreich üblich ist. Die Amerikaner setzen Champagner mit den großen, teuren Häusern gleich, Moët & Chandon oder Taittinger. Ich will, dass du ein paar der kleineren Häuser ausfindig machst und unter Vertrag nimmst – die, die kein Vermögen für ihren Wein verlangen. Schritt eins besteht darin, unsere Zusammenarbeit mit Gaspard Blé zu bestätigen – du wirst auf seinem Weingut wohnen. Ich kenne Blé seit Jahren, aber ich habe gehört, dass auch Bottle Rocket jemanden zu dem Festival schickt. Ich würde Blé nur ungern an die Konkurrenz verlieren.«
Bottle Rocket war der böse Wolf, Hughs größter Konkurrent um die Erzeugnisse familiengeführter französischer Weingüter.
Rosalyn nickte. Natürlich würde sie hinfliegen, um Small Fortune Wines in der Champagne zu vertreten. Sie konnte Hugh nichts abschlagen, sie stand zu tief in seiner Schuld. Außerdem … Vielleicht lag er tatsächlich richtig. Vielleicht war ein Tempowechsel genau das, was sie brauchte, um aus dem Trudeln herauszukommen. Alles andere hatte bisher nicht funktioniert.
»Und, wie geht’s Andy? Und seiner Frau?«, fiel Rosalyn etwas verspätet ein zu fragen. »Ist das Baby schon von der Intensivstation gekommen?«
»Mutter und Kind sind wohlauf«, antwortete Hugh. »Ich habe ihnen gestern einen Geschenkkorb gebracht, habe die Karte von uns allen unterzeichnet.«
»Das war nett von dir.« Rosalyn wand sich innerlich. Früher war sie diejenige gewesen, die die Geschenke kaufte, die Karten schickte, Freunde im Krankenhaus besuchte. Die alte Rosalyn dachte an andere Leute, organisierte spontane Partys, vergaß nie den Geburtstag einer Freundin. Noch eine unerwartete Demütigung der Trauer: Sie hatte sie egozentrisch gemacht.
»Das war kein Problem – eine nette Ausrede, um Babysachen zu kaufen«, erwiderte Hugh. »Diese kleinen Anziehsachen sind einfach so winzig! Kaum zu glauben, dass ein Mensch in dieser Größe daherkommen kann, oder? Wusstest du, dass sie komplett mit klitzekleinen Fingernägeln auf die Welt kommen?«
Rosalyn lächelte über seinen staunenden Ton. »Davon habe ich gehört.«
»Wie auch immer, Andy ist nicht froh darüber, dass er diese Reise verpasst – so viel steht fest.«
»Das glaube ich gern. Ich werde ihn anrufen, bevor ich abfliege.«
Hugh legte den Kopf schief und sah Rosalyn eindringlich an. »Mach das Beste aus dieser Sache, Rosie. Im Ernst. Manchmal kann eine Reise frischen Wind ins Leben bringen, einem die Augen für neue Möglichkeiten öffnen.«
»Ich bin eben erst aus Paso Robles zurückgekommen, schon vergessen?«
»Paso hat seinen Charme, aber es ist kein Vergleich zum ländlichen Frankreich.«
»Und doch hat Paso Robles 7-Elevens, die, entgegen ihrem Namen, rund um die Uhr geöffnet sind. Das ist ein wahres Geschenk an die Menschheit, wenn du mich fragst.«
»Die Champagne ist das Ticket, Rosie. Dash hat sie geliebt – und ich habe das Gefühl, du wirst das auch tun.«
Kapitel 2
Zum Teufel mit Hugh.
Die Anschnallzeichen im Flugzeug waren noch nicht erloschen, als die Frau neben Rosalyn in einer konfettiartigen Explosion einen Ordner voller Papiere fallen ließ und einen Schwall Flüche ausstieß, sodass die Kurzzeitgäste der gedämpften Erste-Klasse-Kabine die Köpfe drehten, um sie anzustarren. Selbst die perfekt frisierten, stets gefassten Air-France-Flugbegleiterinnen hielten inne.
»Lassen Sie mich Ihnen helfen«, sagte Rosalyn und beugte sich gegen den straffen Gurt vor, um die vergilbten Papiere einzusammeln, die zu ihren Füßen verstreut lagen.
»Oh, Gott – ja, bitte. Mit diesem verdammten Gips kann ich mich kaum bewegen.« Die Frau zeigte auf ihr ausgestrecktes Bein, das in einem riesigen Gips steckte, fröhlich verziert mit bunten Schnörkeln und ineinandergreifenden Paisleymustern, von kindlichen Händen mit Filzstiften gemalt. Sie war hochgewachsen, vermutlich in den Fünfzigern, mit einem wasserstoffblonden Igelschnitt und sprach mit einem unüberhörbaren Akzent, den Rosalyn nicht ganz einordnen konnte: er klang britisch, aber nicht ganz. »Die Kleinen auf der Kinderstation haben ihn für mich verziert. Nicht schlecht, was?«
»Sehr hübsch.«
»Ich bin übrigens Emma Kinsley, aus Coonawarra. Kennen Sie das zufällig?«
»Leider nein.«
»Hätte mich auch gewundert. Australien. Eine winzige Stadt, wirklich, irgendwo zwischen Adelaide und Melbourne. Und Sie?«
»Rosalyn Acosta. Freut mich, Sie kennenzulernen.«
»Gott, ich bin ein solcher Klotz«, sagte Emma, während sie zusah, wie Rosalyn alle Papiere einsammelte, die sie erreichen konnte, ohne sich abzuschnallen.
»Klotz?«
»Tollpatsch, sollte ich wohl besser sagen. Sehen Sie sich das an: Die Geschichte liegt zu unseren Füßen verstreut. Darin liegt eine Metapher, meinen Sie nicht auch, Rosalyn?«
Die Papiere schienen eine Sammlung handgeschriebener Briefe zu sein, vergilbt vom Alter. Manche steckten noch immer in Umschlägen, andere waren lose, die meisten waren auf Französisch verfasst, ein paar Seiten auf Englisch. Aber Rosalyn achtete kaum auf die Korrespondenz. Stattdessen sank ihre Stimmung bei dem Gedanken, die nächsten rund zehn Stunden in erzwungener Gesellschaft einer schwatzhaften Sitznachbarin zu verbringen.
Ich hätte das Erste-Klasse-Ticket gegen eine leere Reihe in der Touristenklasse tauschen sollen, um etwas Privatsphäre zu haben, dachte Rosalyn.
Nicht, dass Emma irgendetwas besonders Abstoßendes an sich gehabt hätte. Rosalyn war nur einfach nicht nach Plaudern zumute. Mit niemandem. Nicht ein bisschen. Vielleicht nie. Jeder andere in meiner Situation würde sich freuen, rief sich Rosalyn zum tausendsten Mal in Erinnerung. Wie jeder, von Rosalyns Mutter bis hin zu ihrem Postboten, bemerkt hatte, klang eine Reise in die Champagne auf Firmenkosten inklusive aller Spesen – dazu noch ein paar Tage in Paris, nichts Geringeres als das – wie ein wahr gewordener Traum.
Aber in letzter Zeit waren Rosalyn Geschichten von Einsiedlern durch den Kopf gegangen: Emily Dickinson und Emily Brontë, J.D. Salinger und Henry Thoreau; diverse Eremiten in der Geschichte etlicher Religionen – es gab eine Reihe eremitischer Heiliger im Christentum, das wusste sie, auch wenn sie keine Namen damit verbinden konnte. Rosalyn wollte sich gewiss nicht anmaßen, den Heiligen in irgendeiner Weise nachzueifern, aber sie wäre dennoch jederzeit gewillt gewesen, ein Gelübde abzulegen, wenn das bedeutete, dass sie sich irgendwo in strenger klösterlicher Stille verkriechen könnte. Keine Fragen, keine Kommentare, keine Ratschläge.
Und doch saß sie jetzt hier.
»Also, sagen Sie mir«, fuhr Emma fort, während Rosalyn ihr den letzten der Briefe überreichte, die sie einsammeln konnte, »was führt Sie nach Frankreich, Rosalyn? Geschäft oder Vergnügen?«
»Ich … Ich bin auf Geschäftsreise«, antwortete Rosalyn.
Das Flugzeug erreichte seine Reiseflughöhe, die Anschnallzeichen erloschen mit einem Signalton, und eine Flugbegleiterin kam, sammelte rasch die restlichen zu Boden gefallenen Papiere ein und legte sie in einem unordentlichen Stapel auf Emmas Tablett.
»Was für Geschäfte?«
»Ich arbeite für einen Weinimporteur mit Sitz im Napa Valley. Ich fahre in die Champagne, um …«
»Nein!«
»Entschuldigung?«
»Ich fahre auch in die Champagne!«
»Oh. Na so was!«
»Das ist ja ein Zufall! Vielleicht sollten wir das Flugzeug kapern und es ein bisschen näher an unserem Ziel zur Landung zwingen. Hassen Sie es nicht auch, nach einem langen Flug zu landen und dann nochmal stundenlang fahren zu müssen, und das auch noch mit Jetlag? Wie kommen Sie dorthin?«
»Für mich ist ein Mietwagen reserviert.«
»Sie sollten bei mir mitfahren! Ich werde von einem Fahrer abgeholt: einem sehr großen, dunklen, gut aussehenden Mann – nicht dass mir so etwas wichtig wäre. Aber die Champagne ist nicht besonders groß. Ich bin sicher, wir könnten Sie problemlos irgendwo absetzen.«
Das ist ein Albtraum, dachte Rosalyn. Aber dann nahm sie sich zusammen: kein Albtraum, nicht wirklich, nicht im Vergleich zu so vielem. Trotzdem, es machte sie verlegen. Aber wie Dash immer zu sagen pflegte: »Verlegenheit hat noch niemanden umgebracht.«
»Ich will Ihnen keine Umstände machen«, begann Rosalyn. »Ich …«
»Unsinn. Sie fahren bei mir mit, und ich setze Sie ab.« Emma begann, kopfschüttelnd und vor sich hin murmelnd die Briefe durchzublättern. »Sehen Sie sich nur dieses Durcheinander an. Ich hatte die alle nach Datum geordnet, und jetzt muss ich noch mal ganz von vorn anfangen. So ein Ärger! Also, wohin genau müssen Sie?«
»Ein kleiner Ort namens Cochet, aber …«
»Cochet? Großer Gott, was gibt es denn in Cochet?«
»Ein, ähm, Winzer hat mir angeboten, sein gîte zu nutzen.«
Gîtes waren Ferienunterkünfte – manchmal ein kleines Cottage, manchmal ein Zimmer in einem Haus. Winzer in Frankreich hielten oft Unterkünfte für Käufer bereit, die zu Besuch kamen, oder vermieteten sie an Touristen, um sich etwas dazuzuverdienen. Das hatten sie schon getan, lange bevor Airbnb auf den Plan getreten war.
»Sagen Sie mir, dass wir nicht von Blé Champagne reden, von Gaspard Blé.«
»Doch, genau dem. Sie kennen ihn?«
»Ha! Blé ist ein … Wie soll ich sagen? Ein Geschäftspartner von mir. Nehmen Sie sich bloß in Acht vor dem. Gaspard sieht sich gern als Frauenheld, wenn Sie wissen, was ich meine.«
»Ist er wirklich so schlimm?«
»Eigentlich nicht.« Emma fuhr mit einer Hand durch die Luft und kicherte. »Er ist charmant. Ein bisschen ein Lebemann alter Schule.«
»Woher kennen Sie ihn?«
»Ich investiere seit einer Weile in der Region. Gaspard und ich kennen uns schon lange … hatten sogar mal eine kurze Affäre, wenn ich mich recht erinnere.«
Rosalyns Augenbrauen hoben sich verblüfft.
»Ein bisschen Neandertaler-Energie im Schlafzimmer kann hin und wieder Spaß machen.« Emma schenkte ihr ein wissendes Lächeln. »Jedenfalls, ich mache mir Sorgen um Sie! In diesem kleinen Ort gibt es absolut nichts. Einen einzigen kleinen Laden, das ist alles. Nicht einmal eine boulangerie, und wer hat denn je von einem französischen Dorf ohne eine boulangerie gehört? Es ist nicht einmal besonders charmant – die meisten der älteren Gebäude wurden während der Kriege zerstört. In der Champagne werden Sie in der Regel nicht die entzückenden mittelalterlichen Dörfer finden, die für den Süden Frankreichs typisch sind.«
»Ich bin nicht auf der Suche nach charmanten Dörfern. Ich bin auf Geschäftsreise.«
»Hm.« Emma starrte sie einen langen Moment an. Rosalyn empfand ihren durchdringenden Blick als beunruhigend. Intelligenz schimmerte in Emmas dunklen Augen, und ein überdurchschnittliches Wahrnehmungsvermögen, das ihre beiläufigen Worte Lügen strafte. »Und, was genau haben Sie da vor?«
»Ich soll für meinen Boss, Hugh Small von Small Fortune Wines, ein paar Kontakte knüpfen.«
»Oh! Wissen Sie, mit wem Sie reden sollten? Comtois Père et Fils. Kennen Sie die?«
»Ich kenne noch niemanden.«
»Jerôme Comtois ist jetzt der fils – der Sohn – von Comtois Père et Fils. Französisch durch und durch, aber ich glaube, er spricht gut Englisch, dem Himmel sei Dank. Um genau zu sein, war er früher Professor für englische Literatur an der Sorbonne.«
»Und jetzt baut er Wein an?«
Emma nickte. »Lange Geschichte, zu der ein Herumtreiber von einem älteren Bruder gehört, der das Familienunternehmen übernehmen sollte, aber stattdessen abgehauen ist, um sich in Thailand am Strand ein leichtes Leben zu machen. So habe ich es zumindest gehört. Die ganze Geschichte war ein Riesenschlamassel, weil der Vater das Geschäft heruntergewirtschaftet hatte. Aber da es seit Generationen im Besitz der Familie ist, fühlte sich Jerôme verpflichtet, einzuspringen und zu übernehmen, als sein Bruder die Familie im Stich ließ. Seine damalige Frau – übrigens auch eine Amerikanerin – mochte das Landleben nicht und kehrte nach Paris zurück. Gerüchten zufolge hatte sie sowieso schon eine Affäre mit dem älteren Bruder, was mich nicht im Geringsten wundern würde, aber von mir haben Sie das nicht gehört. Ich will keinen Klatsch verbreiten.«
Rosalyn wurde bewusst, dass ihr der Mund offen stand, während sie gebannt zuhörte. Verlegen machte sie ihn wieder zu. »Ist er … Kennen Sie ihn gut?«, fragte sie.
»Wen?«
»Jerôme Comtois?«
»Oh, nein, bin dem Mann nie begegnet.«
»Dann …?«
»Sie fragen sich, was seine Geschichte mit mir zu tun hat? Die Sache ist die, er hat diese Sammlung von Gerätschaften zur Weinherstellung geerbt, die seine Eltern, Großeltern und Urgroßeltern im Laufe der Jahre erworben hatten – nach allem, was ich gehört habe, befinden sich in diesen Kellern antike Weinkelter und alte Korken, eine Million Dinge. Ich zögere, es ein Museum zu nennen, aber so steht es auf dem Schild – auch wenn Jerôme das Schild, als ich das letzte Mal nachgesehen habe, abgenommen hatte. Angeblich gibt es dort auch eine alte Bibliothek, die randvoll mit Büchern und Dokumenten ist, darunter ein paar Dinge, die nach den Kriegen gerettet wurden. Ich habe Kontakt zu einem historischen Archiv in Reims aufgenommen, und der Archivar schlug mir vor, einen Blick in die Comtois-Sammlung zu werfen. Ich habe versucht, von Jerôme die Erlaubnis zu bekommen, den Ort zu durchforsten, aber bis jetzt ohne Erfolg.«
»Warum wollen Sie sich denn dort umsehen?«
»Wegen dieser Briefe.« Sie hielt den unordentlichen Stapel hoch und seufzte theatralisch auf. »Ich hatte alles schon nach Datum geordnet.«
Allmählich wurde Rosalyns Neugier auf Emmas verschlungene Geschichte geweckt. »Von wem sind diese Briefe denn?«
»Einem französischen Soldaten im Ersten Weltkrieg namens Émile Legrand. Seine Familie hatte einen Bauernhof außerhalb von Reims, das, wie Sie sicher wissen, die Hauptstadt der Champagne ist.«
Rosalyn fiel auf, dass Emma Reims französisch aussprach.
»Es ist der Briefwechsel zwischen Legrand und meiner Großtante Doris, die in Australien lebte«, fuhr Emma fort. »Doris war eine echte Frankophile. Soweit ich gehört habe, hat sie ihre Hochzeitsreise nach Paris gemacht und ist dann, nach dem Krieg, wieder nach Frankreich gereist. Aber sie hat nie durchblicken lassen, dass sie noch ein geheimes Leben hatte. Diese kleine Schlawinerin.«
»Vielleicht war es eine heimliche Romanze.«
»Vielleicht, aber ich nehme es eigentlich nicht an. Ich habe mich noch nicht durch viele dieser Briefe durchgekämpft – es sind buchstäblich Hunderte. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass es da eine romantische Beziehung gab, obwohl Doris sehr viel älter als Émile war. Aber trotzdem, auch wenn die Franzosen nichts gegen die Ältere-Frau/Jüngerer-Mann-Dynamik haben – ihren gallischen Herzen sei Dank –, glaube ich doch, dass es eher eine simple Brieffreundschaft war.«
»Wie sind die beiden denn Brieffreunde geworden?«
»Haben Sie je von den marraines de guerre gehört?«
Rosalyn schüttelte den Kopf. Bevor Emma zu einer Erklärung ausholen konnte, blieb die Flugbegleiterin bei ihrer Sitzreihe stehen und bot ihnen Champagner an.
»Ah! Fantastique! Merci.« Emma nahm mit einer schwungvollen Armbewegung dankbar ein Glas entgegen. »Ich schwöre, ich war kurz vor dem Verdursten.«
Rosalyn nahm das ihr angebotene Glas, stellte es auf dem Tablett vor sich ab und sah dann zu, wie die winzigen Perlen in der goldgelben Flüssigkeit aufstiegen. Sie wünschte, sie würde Champagner mögen. Sie wünschte, sie könnte den aufmerksamen Erste-Klasse-Service genießen. Vor allem wünschte sie, sie wäre irgendwo anders. Irgendjemand anders.
»Also, haben Sie schon davon gehört?«, fragte Emma.
»Entschuldigung – von wem?«
»Den marraines de guerre? Aus dem Ersten Weltkrieg.«
Rosalyn schüttelte wieder den Kopf. »Ich weiß nicht viel über den Ersten Weltkrieg, nur dass es der Krieg war, der alle Kriege beenden sollte.«
»Ja, wir haben gesehen, wie gut das geklappt hat. Aber Sie befinden sich in guter Gesellschaft. Der Erste Weltkrieg wurde von genau dem Krieg in den Schatten gestellt, den er verhindern sollte. In den Filmen geht es immer nur um den Zweiten Weltkrieg, nie um den Ersten …« Emma brach ab, als würde sie über die Bedeutung ihrer eigenen Worte nachgrübeln, dann nahm sie einen kräftigen Schluck von ihrem Champagner. »Macht Sinn, wenn man darüber nachdenkt. Nazis. Perfekte filmische Bösewichter.«
»Also … marraine bedeutet ›Patin‹, richtig?«
»Ganz genau. Sie waren die ›Kriegspatinnen‹. Klingt auf Französisch irgendwie besser. Sie sprechen Französisch?«
»Ein bisschen. Ich habe es auf dem College studiert und noch mal gebüffelt, um mich auf diese Reise vorzubereiten, aber es ist ziemlich eingerostet.«
»Ich finde, der Schlüssel, es gut zu sprechen, liegt darin, reichlich Champagner zu trinken.« Emma warf einen Blick auf Rosalyns nicht angerührtes Glas und hielt ihres hoch: »Auf den Champagner!«
Widerstrebend erhob Rosalyn ihr Glas, und sie stießen an.
Dashs letztes Silvester, der Trick mit dem Gewitter im Glas am Pool im Tonga Room des Fairmont Hotel, alle hatten gelacht. Dash war die Stimmungskanone der Party gewesen, wie immer, und schloss spontan Freundschaft mit den Dinnergästen an den Nachbartischen. Er hatte für die Nacht eine Luxus-Suite gebucht. Keine Kosten gescheut für seine Liebe, seine Braut, sein Mädchen.
Rosalyn nahm an, dass die Leute in der Economy ihren Schampus aus Plastikbechern tranken – falls ihnen überhaupt Champagner serviert wurde. Auf einmal widerstrebte ihr die förmlich elegante Kühle des Erste-Klasse-Glases. Sei nicht albern, Rosie, schalt sie sich. Es ist nur ein Glas. Sie nahm einen Schluck. Der Wein schmeckte sauer, die Perlen schockierten ihre Zunge, kitzelten ihre Nase, ärgerten sie.
Nein. Eindeutig kein Champagnerfan.
»Also«, fuhr Emma fort, offenbar ohne etwas von Rosalyns Mangel an Begeisterung zu bemerken, »die marraines de guerre schrieben den Soldaten an der Front, um sie bei Laune zu halten. Die Soldaten waren junge Männer aus ganz Frankreich. Manchmal hatten sie keine Angehörigen, die ihnen schrieben, und manchmal war der Postverkehr von ihren Heimatorten unterbrochen. Daher sprangen die marraines ein, schrieben den Jungen und schickten ihnen gelegentlich Carepakete mit Socken und Gebäck. Die Idee dahinter war, dass die persönliche Verbindung zu Leuten in der Heimat den Kampfgeist stärken und den Männern in Erinnerung rufen würde, wofür sie kämpften.«
»Oh, das ist …« – Rosalyn suchte nach den richtigen Worten – »… das ist wirklich entzückend, aber irgendwie auch tragisch.«
»Wollen Sie etwas Witziges hören? Damals wurde das Programm kritisiert – viele Leute hielten es für unmoralisch.«
»Tatsächlich? Aber es klingt doch sehr unschuldig, wenn Sie mich fragen. Ich meine, sie waren Brieffreunde, was sollte da schon passieren?«
»Unterschätzen Sie nie die Fähigkeit mancher Leute, sich vor etwas Neuem zu fürchten«, sagte Emma. »Viele der marraines waren alleinstehend, und Kritiker behaupteten, die unverheirateten jungen Damen würden die jungen Männer, denen sie schrieben, zu unschicklichem Denken und Benehmen ermuntern. Wie das funktionieren sollte, wurde nicht genauer ausgeführt, aber der Krieg brachte tatsächlich viele Veränderungen und eine Lockerung der gesellschaftlichen Konventionen mit sich. Trotzdem, wenn man bedenkt, wie viele der Soldaten nicht lebend oder zumindest unversehrt aus dem Krieg zurückkehrten, nehme ich an, die Kritik war weitgehend müßig.«
Die Flugbegleiterin kam, um ihre Essensbestellungen aufzunehmen. Rosalyn reichte ihr ihre fast volle Champagnerflöte und bat um ein Glas Rotwein, was die Flugbegleiterin mit einem leichten Hochziehen der Augenbrauen quittierte.
Rosalyn spürte Emmas Blick auf sich. Sie überlegte, ob sie die Unterhaltung beenden sollte, indem sie behauptete, sie müsse sich ihren Französisch-Podcast anhören, aber das Abendessen würde bald serviert werden, und sie wollte nicht unhöflich sein.
Außerdem hatte das Thema ihre Neugier geweckt.
»Das heißt, Ihre Tante war eine marraine de guerre?«, fragte Rosalyn.
»Ja. Sie ist in Australien geboren und aufgewachsen, aber ihre Mutter stammte aus Frankreich. Doris war sehr vermögend, mit patriotischen Gefühlen sowohl für Frankreich als auch für Australien, das an der Seite Englands in den Krieg eingetreten war. Ich habe sie nie kennengelernt – um genau zu sein, war sie meine Urgroßtante, nehme ich an, die Schwester meines Urgroßvaters –, aber der Familienlegende zufolge war sie eine willensstarke Frau, eine wohlhabende Witwe, die es gewohnt war, sich durchzusetzen. Sie hatte selbst keine Kinder, daher war das vielleicht ihre Art, mütterliche Zuneigung zu zeigen. Wie auch immer sie es geschafft hat, sie und Émile haben ihren Briefwechsel jedenfalls den ganzen Krieg hindurch aufrechterhalten.«
»Mir ist aufgefallen, dass einer der Briefe auf Englisch verfasst war.«
»Als sie ursprünglich mit dem Briefwechsel begann, brachte Doris ihre Gedanken zunächst auf Englisch zu Papier, bevor sie sie ins Französische übersetzte. Aber ich nehme an, dass sie in ihrem Französisch im Laufe der Zeit immer sicherer wurde und irgendwann aufhörte, englische Entwürfe zu verfassen; falls sie es weiterhin getan hat, konnte ich sie jedenfalls nicht finden. Émile erwähnte, er würde Doris’ Briefe als Bündel in seinem Tornister bei sich tragen und sie jedes Mal, wenn er nach Reims zurückkehrte, an einem sicheren Ort verstauen. Ich hoffe, sie vielleicht finden zu können.«
»Daher also Ihr Interesse an der Comtois-Sammlung?«
Emma nickte. »Es ziemlich unwahrscheinlich, ich weiß, und diese Generation ist längst nicht mehr am Leben, aber ich hoffe, dass es in dem Museum vielleicht irgendeinen Hinweis auf diese Briefe gibt. Ich bin keine Historikerin, aber meinen Sie nicht, diese Geschichte wäre Stoff für ein faszinierendes Buch, mit beiden Seiten des Briefwechsels?«
»Das wäre sie bestimmt. Aber haben Sie nicht gesagt, Jerôme Comtois hätte sein Museum geschlossen?«
Emmas Miene wurde nachdenklich. »Ich hoffe, dass er nur etwas störrisch ist. Er ist ein bisschen kauzig, mag keine Touristen. Andererseits wurde ihm das Familienunternehmen aufgebürdet, das heißt, vielleicht taut er mit der Zeit noch ein bisschen auf.«
»Das ist also der Grund, weshalb Sie in die Champagne fahren? Um die Briefe Ihrer Tante zu finden?«
Emma fuhr mit einer Hand durch die Luft. Breit und ein wenig knochig, war es eine Hand, die eher harte Arbeit als Maniküren gewohnt schien. »Nein, ich sehe mir ein paar Weingüter an, in die ich investiert habe.«
»Champagner-Weingüter? Ich bin beeindruckt.«
Sie zuckte die Schultern. »Klingt schicker, als es tatsächlich ist. Wie Sie sicher wissen, sind Weingüter im Grunde nur landwirtschaftliche Betriebe. Und es liegt mir im Blut. Ich bin in Australien in der Weinbranche aufgewachsen. Sie sind aus Kalifornien?«
»Woher wussten Sie das?«
»Sie haben Napa erwähnt. Außerdem, der Akzent.«
»Wir Kalifornier behaupten gern, wir hätten keinen Akzent.«
Emmas Lachen war laut und kräftig, eine wilde Party. »Jeder hat einen Akzent. Also, Sie werden in der Champagne doch sicher nicht nur arbeiten? Vielleicht einen Liebhaber treffen?«
Ein stechender Schmerz, tief in ihrem Bauch. Wie sie die Stufen zur Basilique du Sacré-Cœur hochstiegen, Hand in Hand an Künstlergalerien vorbeischlenderten, den Montmartre-Friedhof durchstreiften. Sich vorstellten, wie Picasso und Degas, Toulouse-Lautrec und Renoir durch die dieselben Kopfsteingassen gegangen waren, die jetzt von Touristen überlaufen waren. Fröstelnd, während sie im Park Eis aßen, weil trotz der Eiseskälte das Eis einfach zu gut war, um ihm zu widerstehen. Dash kaufte eine silberne Halskette in einem winzigen, verlassen aussehenden Juwelierladen, der in einem Innenhof versteckt lag; das handgearbeitete Medaillon hing an einem feinen Kettchen. Er legte es ihr um den Hals, und sie spürte seine geschickten Finger warm an ihrer Haut. Von diesem Augenblick an hatte sie das Medaillon nie wieder abgelegt.
Die schiere Romantik, sich sicher und geborgen zu fühlen, verliebt in den Mann, der eben erst ihr Ehemann geworden war. Sie hatte sich so stolz gefühlt, so lebendig.
Sie war so jung gewesen.
Wieder spürte Rosalyn Emmas Blick, der sie musterte, und sie zwang sich, zu ihrer Unterhaltung zurückzukehren. Das hier war ein klassisches Anzeichen eines »Trauerhirns«, ein häufiges Gesprächsthema in ihrer Selbsthilfegruppe. Sie sprang von einem Thema zum nächsten, hatte Schwierigkeiten, einem Gedankengang zu folgen, verlor leicht den Gesprächsfaden. Im Laufe der Zeit war es schwächer geworden, aber es war immer noch da, lauerte an den Rändern ihres Bewusstseins und reckte sein hässliches Haupt, vor allem, wenn sie sich gestresst fühlte oder müde war.
»Nein, nur geschäftlich«, antwortete Rosalyn. »Ich werde mich mit ein paar Champagnerherstellern treffen und Small Fortune Wines beim Festival von Saint Vincent vertreten.«
»Oh, das ist ja toll! Ich bin auch bei dem Festival, das wird ein Riesenspaß!«
»Ganz bestimmt«, sagte Rosalyn und nahm mit einem dankbaren Seufzer ihr Glas Rotwein von der Flugbegleiterin entgegen.
»Aber Sie freuen sich nicht darauf.« Es war eine Feststellung, keine Frage.
»Das ist es nicht, nicht wirklich. Ich bin nur einfach kein Partymensch.«
»Introvertiert, ja?«
»So ähnlich.«
Emmas dunkle Augenbrauen hoben sich. »Und doch sind Sie in der Weinbranche?«
Rosalyn kicherte ironisch. »Sieht so aus.«
Emma lächelte, und ihre Augen blickten forschend in Rosalyns Gesicht. Nach einem langen Moment fragte sie: »Waren Sie schon immer introvertiert? Oder erst, seit Ihnen das Herz gebrochen wurde?«
Rosalyn stockte der Atem in der Kehle. Als sie sprach, war ihre Stimme angespannt. »Entschuldigung?«
»Es steht Ihnen ins Gesicht geschrieben, Sie armes Ding.«
Auf einmal hatte Rosalyn das Gefühl zu ertrinken. Ihre Augen brannten und füllten sich mit Tränen. Sie schalt sich – nicht jetzt, nicht jetzt, nicht jetzt – und wünschte sich zurück nach Hause, in ihr kleines Haus auf dem Weingut, wo sie sich verstecken könnte, sich auf den kalten Fliesen des Badezimmerbodens zusammenrollen und in eines von Dashs alten T-Shirts schluchzen könnte, auch wenn sein Geruch schon lange nicht mehr darin hing.
Sie nahm einen kräftigen Schluck von ihrem Wein und schluckte zweimal, womit sie gegen jede Etikette verstieß, nach denen man nur in kleinen, anmutigen Schlückchen nippen sollte, um den vollen Geschmack zu kosten.
Zehn lange, langsame Atemzüge.
Rosalyn verspürte einen Schwall der Dankbarkeit, als die ältere Frau ihre Aufmerksamkeit wieder den Briefen zuwandte. Es wäre alles nur noch schlimmer geworden, wenn Emma einen Arm ausgestreckt hätte, um ihre Schulter zu tätscheln oder ihre Hand zu ergreifen, und sie gefragt hätte, was denn los sei – oder, noch schlimmer, sich dafür zu entschuldigen, dass sie sie zum Weinen gebracht hatte. Dabei fühlte Rosalyn sich jedes Mal, als müsste sie sich dafür entschuldigen, dass sie ihrem Gegenüber überhaupt erst ein schlechtes Gewissen gemacht hatte. C. S. Lewis hatte geschrieben, dass sich Trauer zu einem großen Teil wie Angst anfühle: das Flattern im Magen, das wiederholte Schlucken, der Drang zu fliehen. All das traf zu, aber für Rosalyn war es noch so viel mehr. Trotzdem, auf eine seltsame Art half ihr die Trauer selbst, zurechtzukommen, indem sie alles dämpfte, sodass Rosalyn nur selten die Energie aufbringen konnte, darüber nachzugrübeln, was sie alles verloren hatte.
Nicht nur Dash, sondern das Leben, das sie zusammen gehabt hatten. Die Zukunft, von der sie geträumt hatten. Selbst ihre Vergangenheit.
Rosalyn hatte die Person verloren, die mit Dash nach Paris gefahren war.
Sie hatte keine Ahnung, wer sie jetzt noch war.
Kapitel 3
»Es wird eine Ewigkeit dauern, die wieder zu ordnen«, murmelte Emma, während sie die zusammengefalteten Seiten eines der Briefe aufblätterte. »Hören Sie sich das an: ›26. April 1916. Lucie sagt, der blinden Frau muss die hübscheste Teetasse zugedacht werden, denn wer verstünde Schönheit besser als die, die ihr Augenlicht verloren haben?‹ Ist das nicht rührend? Nach seinem eigenen Bekunden war Émile Legrand kein Mann von Bildung, aber wenn Sie mich fragen, hatte er die Seele eines Dichters.«
»Sie erwähnten, dass er ein Bauernjunge war«, sagte Rosalyn, dankbar für die Ablenkung. »Ich wundere mich, dass er so belesen war.«
»Émile ist faszinierend. Ich frage mich, ob er persönlich ebenso charmant war oder ob er nur so gut mit dem geschriebenen Wort umgehen konnte. Er hat zwei oder drei Briefe pro Woche an Doris geschrieben. Sie müssen ein wichtiges Ventil für ihn gewesen sein, ihm geholfen haben, die Schützengräben zu überleben.«
»Wer ist denn diese Lucie, die er erwähnt?«
»Mademoiselle Lucie Maréchal. Sie lebte in den Kellern unter der Stadt Reims.«
»Und warum war sie in den Kellern?«
»Während des Krieges wurde Reims von der deutschen Armee belagert, die die Stadt jahrelang unter Beschuss nahm. Ungefähr neunzig Prozent der Gebäude wurden zerstört und Tausende von Zivilisten getötet. Viele Bewohner suchten Zuflucht in den Kellern unter den Champagnerhäusern. Waren Sie noch nie in Reims?«
Rosalyn schüttelte den Kopf. »Nur in Paris.« Der Laternenpfahl an der Ecke, der Schneeflocken abschüttelte. »Ein Leben voller Lachen für meine schöne Braut. Versprochen.« »Und, was haben Sie mit den Briefen vor?«
»Im Moment bin ich nur neugierig zu sehen, wie viele ich finden kann. Meine Großmutter hat mir, als ich klein war, oft Geschichten von Doris erzählt, und aus irgendeinem Grund habe ich mich ihr immer besonders verbunden gefühlt. Ich werde versuchen, einen Historiker oder irgendjemanden zu finden, der ein Buch über die Geschichte der beiden schreibt.«
»Warum schreiben Sie es nicht selbst?«
Emma lächelte. »Literatur – ganz zu schweigen von Organisation – ist nicht gerade meine Stärke. Und es wird viel Arbeit erfordern, alles übersetzen zu lassen. Aber ich dachte, wenn ich schon mal in der Champagne bin, sollte ich dort die Archive durchforsten. Und ich habe meine Fühler zu ein paar Leuten ausgestreckt, die mir gestatten werden, ihre Dachböden zu durchstöbern; außerdem könnte es in der Gegend immer noch ein paar Legrands geben. Es ist weit hergeholt, ich weiß, aber in Frankreich gibt es viele uralte Familiensitze, die über Generationen weitervererbt werden, und da diese Leute nie irgendetwas wegwerfen, ist es gut möglich, dass in irgendeiner Ecke eines staubigen Dachbodens noch irgendetwas versteckt ist. Vielleicht sogar ein paar Fotos, können Sie sich das vorstellen? Es würde meiner Mutter die Welt bedeuten, wenn ich sie finden könnte. Sie hat eine Schwäche für die Familiengeschichte.«
»Ihre Mutter ist noch am Leben?«, fragte Rosalyn.
Emma nickte mit leicht geschürzten Lippen, sagte aber nichts.
»Hat … Hat Émile den Krieg überlebt?«, fragte Rosalyn, auf einmal sicher, dass sie die Antwort wusste.
Emma zögerte. »Ich weiß es nicht. Ich habe keine offizielle Mitteilung des Kriegsministeriums oder so gefunden. Aber wie ich bereits sagte, ich bin noch nicht bis zum letzten Brief vorgedrungen. Ich bin mir nicht einmal sicher, wo er ist. Ich habe angefangen, sie zu ordnen, aber sie sind nicht leicht zu entziffern, mit dieser stilisierten Handschrift und der verblassenden Tinte, ganz zu schweigen von der Zensur.«
»Mir ist aufgefallen, dass hier und da Teile der Briefe herausgeschnitten oder geschwärzt wurden.«
»O ja. Die Kriegskorrespondenz unterlag ›Anastasias Schere‹. Die poilus durften niemandem sagen, wo sie waren oder wohin sie unterwegs waren. Alles, was auch nur einen Hinweis auf ihren Standort oder ihr Ziel gab, wurde zensiert. Ab und zu schlüpften ein paar der Briefe durch die Maschen der Zensur, aber das war nur selten der Fall.«
»Entschuldigung – wer waren denn die poilus?«
»Die französischen Soldaten – die einfachen Jungen, nicht die Offiziere.«
»Heißt poilu nicht …?«
»›Behaart‹«, bestätigte Emma mit einem Nicken. »Da sie oft Tage oder Wochen oder sogar Monate am Stück in den Schützengräben lebten, konnten sie sich nur schwer rasieren oder die Haare schneiden lassen, daher gingen die Soldaten dazu über, ihre Haare als eine Art Ehrenabzeichen zu tragen. Behaart zu sein, galt als Zeichen von Männlichkeit, von Tapferkeit und Mut.«
Inzwischen hatte Rosalyn einen Teil des Stapels vor sich liegen und versuchte, die losen Seiten ihren Umschlägen zuzuordnen. Sie sortierte die Militärumschläge nach dem Datum, das auf die Vorderseite gestempelt war, oder, wenn der Stempel zu schwach zu lesen war, nach dem Datum, das in den Briefen stand. Es war seltsam beruhigend, Geschichte in den Händen zu halten. Sie stellte sich vor, wie die Worte in schlammigen Schützengräben auf dem brüchigen vergilbten Papier sorgfältig niedergeschrieben wurden, und dachte an die Wahrscheinlichkeit, dass Émile nie von der Front nach Hause zurückgekehrt war. An den Schmerz seiner Angehörigen, als sie die Nachricht erhielten.
Es war zutiefst verstörend, das Unglück anderer Leute als tröstlich zu empfinden. Jedes Mal, wenn sie einen Friedhof entdeckte, hielt Rosalyn an und schlenderte darüber, suchte auf den Grabsteinen begierig nach Hinweisen auf junge Männer, die in der Blüte ihres Lebens dahingerafft worden waren. Es war keine Schadenfreude – diesen Schmerz würde sie niemals einem anderen Menschen wünschen –, sondern eher das Erkennen einer anderen leidgeprüften Seele. Eine seltsame, unergründliche Verwandtschaft.
Sie war nicht die Einzige. Andere hatten weitaus Schlimmeres überlebt.
Manche zum Beispiel waren gezwungen gewesen, in Kellern zu leben, um dem Höllenfeuer zu entkommen, das auf ihre Stadt herunterprasselte.
»Jedenfalls, ich hatte eigentlich vor, mich mit meinen Winzern und Weingutsmanagern zu treffen und dann ein bisschen auf Dachböden herumzuschnüffeln.« Emma zeigte auf ihren Gips, schüttelte den Kopf und stieß einen Seufzer aus, der einer Märtyrerin würdig gewesen wäre. »Aber dieser Plan ist jetzt geplatzt. Alte französische Häuser sind nicht unbedingt behindertengerecht gebaut.«
»Das tut mir leid. Was ist denn mit Ihrem Bein passiert?«
»Eine unglückliche Begegnung mit einem Taxi in der Bush Street, genau vor dem Tor zu Chinatown. Hab mir eine verdammt gute Jeans ruiniert. Aber ich nehme an, es hätte schlimmer kommen können.«
Rosalyn nickte und wandte ihre Aufmerksamkeit wieder den Briefen zu. Emma hatte recht. Sie waren nicht leicht zu lesen, aber mithilfe des Wörterbuchs in ihrem Handy konnte sie einige Zeilen entschlüsseln: »Die Luft ist schwer von Bomben, Granaten und Minenwerfern. Letztere sind eine Art teuflisches Spielzeug. Ihre Explosionen fühlen sich an wie zehn Erdbeben auf einmal.«
»Faszinierend, nicht wahr?«, fragte Emma.
»Das sind sie.« Zweifellos. Es war nicht nur der Inhalt, der Rosalyn fesselte. Es war die gespenstische Gegenwart der Hand, die ein Jahrhundert zuvor über das Papier geglitten war, die fortdauernden Geschichten von Leben, die längst erloschen waren. Ein greifbares Überbleibsel der Vergangenheit.
Die brüchigen Briefe hinterließen winzige braune und gelbe Staubkörner auf ihrem Tablett und ihren Fingerkuppen. Spuren eines längst vergangenen Lebens.
»Aber die Briefe zeichnen kein sehr schönes Bild, oder?«, bemerkte Rosalyn, während sie versuchte, eine Schilderung des Lebens an der Front zu entziffern. »Ein Haufen behaarter Männer, die in schlammigen Schützengräben leben – können Sie sich den Geruch vorstellen?«
Emma lachte wieder dieses ungestüme Lachen. »Angenehmer Körpergeruch war wahrscheinlich die geringste ihrer Sorgen.«
»Aber eines wüsste ich doch gern«, fuhr Rosalyn fort. »Wenn das alles so schlimm war, wie konnte es dann sein, dass Post zu und von den Truppen zugestellt wurde?«
»Die französische Regierung hatte die Postzustellung zur Priorität erklärt. Die meisten Kampfhandlungen fanden an der Westfront statt, nahe den französischen Grenzen zu Deutschland und Belgien. Aber die Soldaten kamen aus ganz Frankreich. Es war ein entsetzlicher Krieg, mit einer tragisch hohen Zahl von Opfern. Damit die poilus für la patrie ihr Leben riskierten – und akzeptierten, dass sie dabei verwundet werden oder sogar sterben könnten –, musste man ihre Verbindung zu den Menschen in der Heimat aufrechterhalten. Aber das war nicht immer möglich. Reims beispielsweise war so abgeschnitten von der Außenwelt, dass einige der Geschäfte, die noch geöffnet hatten, ihre eigene Währung anstelle von Banknoten ausgaben. Ich bezweifle, dass es überhaupt Postverkehr von und nach dort gab.«
»Ich frage mich, was aus Lucie geworden ist. Ihre Geschichte könnte ein sehr interessanter Teil Ihres Buchs werden.«
Emma nickte. »Ich hoffe zu sehen, ob ich irgendwelche Nachfahren von Lucie Maréchal in der Gegend ausfindig machen kann. Émiles Briefe zeichnen ein sehr lebendiges Porträt von ihr. Wie ich bereits sagte, es ist anzunehmen, dass Émile – zusammen mit eineinhalb Millionen anderen – ums Leben gekommen ist, aber falls nicht, könnte ich vielleicht auch seine Nachfahren finden.«
Es schien wirklich sehr unwahrscheinlich, dachte Rosalyn. Trotzdem, auch wenn der Erste Weltkrieg wie längst vergangene Geschichte wirken mochte, war er doch erst ein paar Generationen her. Es war durchaus vorstellbar, dass Briefe und andere Dokumente noch immer irgendwo in Familienalben oder auf Dachböden schlummerten. Rosalyn hatte alte Schulunterlagen und andere Überbleibsel im Zuhause ihrer Kindheit zurückgelassen, die aufbewahrt worden waren, bis ihre Mutter kürzlich umgezogen war. Möglich war es.
Die Flugbegleiterinnen begannen mit dem Dinnerservice, und Rosalyn war enttäuscht, als Emma die Briefe wieder in ihren ungeeigneten Ordner stopfte. Das Essen war köstlich – völlig anders als das Flugzeugessen, über das sich die Leute früher gern beklagten, als es auf den meisten Flügen noch kostenlose Mahlzeiten gab. Rosalyn musste zugeben, dass die Franzosen wussten, wie man mit dem Flugzeug reiste – zumindest in der ersten Klasse.
Rosalyn war bei ihrem dritten Glas Wein, als Emma auf einmal sagte: »Hey! Sie hätten nicht zufällig Lust, für mich auf die Jagd zu gehen? Natürlich gegen Bezahlung – ich bin sehr vermögend.«
»Oh … Danke, aber ich habe schon einen Job.«
»Aber Sie mögen ihn nicht.«
Rosalyn stieß ein verblüfftes, keuchendes Lachen aus.
»Klingt die Jagd nach alten Briefen nicht interessanter als das, was Sie tun sollen?«
»Na ja, schon, aber es gibt auch …« Eine Schuld zu begleichen, eine Schuld, die nie beglichen werden konnte. Hugh hatte so viel für sie getan. »Ich bin nur für ein paar Wochen in Frankreich und muss meiner Verpflichtung gegenüber meinem Boss nachkommen.«
»Damit kann ich leben. Buchen Sie einfach Ihren Rückflug um und bleiben Sie ein paar Wochen länger. Ich werde sicherstellen, dass es sich für Sie lohnt.«
»Ich glaube, das möchte ich wirklich nicht. Aber danke für das Angebot.«
Emma zuckte die Schultern und wischte den letzten Rest Soße auf ihrem Teller mit einem Brötchen auf. »Einen Versuch war es wert. Ich nehme an, ich könnte nach einem Einheimischen suchen, den ich bestechen könnte. Es ist nur so, Sie sprechen Englisch, Gott sei Dank. Französisch zu sprechen, ist so anstrengend. Und ich mag Sie. Ich glaube, wir sind auf einer Wellenlänge.«
Rosalyn sah sie verblüfft an. Emma war so offen, so sichtlich bestrebt, das Leben in all seinen Dimensionen anzunehmen. Rosalyn war genau das Gegenteil: eine Pappfigur, die sich als Mensch verkleidete.
Emma beugte sich leicht zu ihr herüber. »Ich will nicht sagen, dass wir uns ähnlich sind, Rosalyn. Ich glaube, dass Sie mich verstehen. Und das nicht nur, weil wir beide englische Muttersprachler sind – ich habe ein Jahr an der Sorbonne studiert und spreche ganz passabel Französisch, aber das heißt nicht, dass die Franzosen und ich einander verstehen würden. Dieses Volk ist ein seltsamer Haufen, nicht wahr? Fabelhaft, aber seltsam. Zum Beispiel, dass sie dich wie eine Aussätzige behandeln, wenn du eine Tüte Chips als Hauptmahlzeit essen willst. Zu den Amerikanern hingegen verspüre ich eine gewisse Verwandtschaft. Hat vielleicht was mit der britischen Kolonialzeit zu tun – ihr Amerikaner habt mit uns Aussies viel gemeinsam.«
»Mag sein«, meinte Rosalyn lächelnd.
»Eure Einstellung zum Rauchen hingegen …« Sie brach ab und steckte sich ein Nikotin-Kaugummi in den Mund. »Ich fasse es nicht, dass wir im Flugzeug nicht mehr rauchen dürfen. Gibt es denn gar keine Zivilisation mehr? Wussten Sie, dass die Franzosen so antiautoritär eingestellt sind, dass die Raucherquote tatsächlich gestiegen ist, nachdem das Rauchen in öffentlichen Gebäuden verboten wurde? Außerdem drängeln sie sich in Schlangen vor. Ihr Amerikaner hingegen, ihr seid in dieser Hinsicht viel zu puritanisch.«
»Was das Vordrängeln oder das Rauchen angeht?«
»Beides, aber ich meinte das Rauchen.«
»Ich bin mir nicht sicher, ob wir das den Puritanern anlasten können. Ich glaube, es hat eher was mit Lungenkrebs zu tun.«
Emma tat ihren Einwand mit einer Handbewegung ab. »Unterschätzen Sie nie Ihre Geschichte des Puritanismus. Zum Beispiel, wie besessen ihr Yankees vom Sex seid, aber wie schnell ihr angesichts von Nacktheit ausflippt.«
»Wir sind ein Rätsel, das stimmt«, murmelte Rosalyn, dann leerte sie den letzten Rest ihres Weins und wünschte, sie hätte noch mehr davon. Sie hatte nicht das Bedürfnis, sich in einen Kampf der Kulturen zu stürzen, und wollte auch nicht den Franzosen – oder, in diesem Fall, den Australiern – gegenüber alle Amerikaner repräsentieren. Waren wir denn nicht alle Individuen? Und außerdem … Rosalyn fühlte sich im Moment nicht imstande, überhaupt irgendjemanden zu repräsentieren, schon gar nicht eine ganze Nation. Sie fühlte sich wie ein in Luftpolsterfolie verpackter Weihnachtbaumschmuck, allzu leicht zerbrechlich.
Nach dem Essen beseitigten die Flugbegleiterinnen rasch alle Spuren ihrer Mahlzeit, und der Kapitän dimmte die Lichter.
»Na dann«, sagte Emma und nahm sich Ohrstöpsel und eine Schlafmaske aus der Tasche an dem Sitz vor ihr. »In Frankreich ist es neun Stunden später als in Kalifornien, was heißt, dass die Leute dort jetzt schlafen, daher sollten wir das wohl besser auch tun.« Sie schluckte eine Pille, dann hielt sie das Fläschchen Rosalyn hin. »Wollen Sie auch eine?«
»Oh, nein, danke.«
»Wie Sie meinen. Bonne nuit, Rosalyn. Wir sehen uns in Paris.«
Kapitel 4
Rosalyn schloss die Augen in der Hoffnung, etwas Ruhe zu finden, aber sie gab den Versuch rasch auf. Es fiel ihr schon schwer genug, in ihrem eigenen Bett zu schlafen, geschweige denn in der Öffentlichkeit.
Sie las eine Weile einen Roman, aber obwohl der Bestseller – die wahre Geschichte des Kampfs einer mutigen Frau gegen die Gewalt und Korruption an einer innerstädtischen Schule – alle Zutaten für einen Hollywood-Blockbuster hatte, konnte er sie nicht fesseln. Dann scrollte sie die In-Flight-Filmauswahl durch, aber die Geschichten erschienen ihr banal: die Komödien kindisch, die Dramen belanglos.
Schließlich zog Rosalyn Emmas knallgelben Ordner mit Briefen sanft zu ihrem Tablett herüber. Sie spähte hinein und nahm behutsam einen dicken Militärumschlag in die Hand. Er war stockfleckig, und der Geruch erinnerte Rosalyn an ein Antiquariat.
Ihr ging der Gedanke durch den Kopf, dass es in der ersten Klasse vermutlich nicht üblich war, modrige alte Briefe durchzusehen. Wie aufs Stichwort warf der gut gekleidete Mann auf der anderen Seite des Gangs einen Blick auf sie und blähte die vornehmen Nasenflügel. Rosalyn ignorierte ihn.
Das vergilbte Papier raschelte, als sie es aus dem Umschlag zog. Die Handschrift war dieselbe wie zuvor, mit diesen typisch französischen aufrechten Buchstaben.
Rosalyn holte ihren Laptop heraus und begann den Brief zu übersetzen, aber es gab Wörter, die sie nicht finden konnte – wahrscheinlich Namen von Waffen oder andere kriegsbezogene Begriffe. Stellenweise war die Tinte verblasst und die stilisierte Schreibschrift schwer zu entziffern. Und da außerdem immer wieder einmal ein Satz herausgeschnitten oder geschwärzt war, kam sie nur schleppend voran.
Trotzdem schaffte sie ein paar Absätze.
Lucie erzählt mir, eines Morgens, als die Bombardierung wieder begann, die Uhr gerade neun schlug, aber keine Gelegenheit bekam, zu Ende zu schlagen … Eine xxx schlug durch die Wand und begrub alles unter Staub und Putzbrocken … Das Klirren von zerbrechendem Glas … Der Schock der Erschütterung ist so schwer zu beschreiben; er gibt einem das Gefühl, verletzt zu sein, selbst wenn man unversehrt geblieben ist.
Rosalyn überflog die zerfledderten Seiten, während sie angestrengt versuchte, die Sprache zu verstehen. Sie stellte sich eine längst vergangene, vom Krieg zerrissene Welt vor, bis ihre Augen schwer wurden und sie schließlich einschlief.
Sie träumte von dem Medizinschränkchen.
Während sie auf der aquamarinblauen Badematte vor dem offenen Schränkchen kniete, fragte sich Rosalyn, ob die Medikamente darin ausreichen würden, um sie zu töten.
Sie fühlte sich seltsam losgelöst von der Frage, und noch mehr von ihren Schlussfolgerungen. Als Dash gestorben war, war Rosalyn zerbrochen. Irgendetwas tief in ihr war zerborsten, zerschellt, zu spitzen, stechenden Scherben zersplittert. Sie war ein zersprungener Spiegel. Sie war sieben Jahre Unglück.
Ohne Unglück hätte ich gar kein Glück.
Die Worte des alten Songs gingen Rosalyn durch den Kopf, gesäuselt in Dashs rauchiger Stimme. Er war kein Morgenmensch gewesen, aber wenn sie ihm seinen Raum ließ, summte er spätestens, wenn er aus der Dusche auftauchte, vor sich hin, sang zusammenhangslose Zeilen alter und neuer Songs, hauptsächlich Blues, und lachte über die Absurdität der Texte, denn wie er an ihrem Hochzeitstag erklärt hatte – einer extravaganten Feier, im Freien zwischen den Weinreben –, hielt Dash sich selbst für den glücklichsten Mann der Welt.
Seine Medikamente standen ordentlich aufgereiht im Regal: bernsteinfarbene Ampullen und Fläschchen und Folienstreifen mit Schmerzmitteln, die jeden Cent gekostet hatten, den sie besaßen, und noch einiges mehr. Alle mit dem Namen des Mannes versehen, den Rosalyn vor sechs Jahren geheiratet und vor zweieinhalb Jahren verloren hatte und noch immer liebte: Dashiell Anthony Acosta.
Zum Essen einnehmen. Nicht zerkleinern oder kauen. Nach Bedarf einnehmen.
Was, wenn sie sie zerkleinerte und kaute, sich auf nüchternen Magen ein paar Handvoll in den Mund steckte, nach Bedarf? Sie könnte sie mit einer schönen Flasche Napa Cabernet hinunterspülen, wie Dash es sich zum Ende hin selbst überlegt hatte, als er versuchte, seinen achtunddreißigsten Geburtstag zu feiern – in dem Wissen, dass es sein letzter sein würde –, aber zu krank war, um irgendetwas bei sich zu behalten. Gut zu wissen: Rosalyn sollte vor den anderen Pillen eine gegen Übelkeit nehmen.
Das war, was man lernte, wenn man dem eigenen Ehemann dabei zusah, wie er verzweifelt versuchte zu überleben, mörderische Krebszellen durch Chemotherapie und Bestrahlung, Operation und Medikamente, Gebete und schiere Willenskraft zu zerstören. Nicht dass es letztendlich auf irgendetwas von alledem ankam.
Siebenundneunzig Tage – länger dauerte es nicht.
Siebenundneunzig Tage von der Diagnose bis zum Tod.
Kapitel 5
Als sie in Paris landeten, tauschten Emma und Rosalyn ihre Visitenkarten aus.
»Wir sehen uns bestimmt bei der Gepäckausgabe oder Passkontrolle oder Zollabfertigung wieder«, sagte Emma. Sie drängte Rosalyn, schon vorzugehen, während sie auf eine Flugbegleiterin mit einem Rollstuhl wartete. »Zu meinem Bedauern muss ich sagen, dass keine von uns beiden sehr schnell aus diesem Flughafen herauskommen wird.«
Rosalyn ging von Bord und in den Terminal. Auf einer Toilette kämmte sie sich die Haare und spritzte sich etwas Wasser ins Gesicht. Im Spiegel über dem Waschbecken riskierte sie einen Blick auf sich – und bereute es prompt. Nicht dass man nach einem Transatlantikflug, nicht einmal in der ersten Klasse, besonders gut aussehen konnte. Aber trotzdem.
Das Gesicht, das zu ihr zurückstarrte, war ausgezehrt und bleich, mit dunklen Ringen unter den sherryfarbenen Augen. Ihre Mutter wäre entsetzt gewesen, aber andererseits war das nichts Neues. Die alte Rosalyn hätte sich für eine Flugreise hübsch gemacht, sie hätte ein Make-up-Täschchen zur Hand gehabt. Die Rosalyn von heute trug kein Make-up, um das Schlimmste zu kaschieren. Ihre dunkelbraunen Haare waren zottelig und mussten dringend geschnitten werden; sie hätte sich vor dieser Reise darum kümmern sollen, aber die Vorstellung, in einem Frisierstuhl festzusitzen, während eine schwatzhafte Coiffeurin an ihr herumpuzzelte, war zu viel für sie gewesen.
Jetzt wünschte sie, sie hätte sich dazu durchgerungen. Irgendwie fühlte es sich in Frankreich noch schlimmer an, so ungepflegt auszusehen – unter Parisern, die auf der ganzen Welt für ihren guten Stil bekannt waren. Die Frauen an den Spiegeln neben ihr waren gut frisiert und elegant, hinreißend trotz des strengen Neonlichts. Rosalyn hoffte, dass die Maßstäbe draußen auf dem Land, in der Champagne, vielleicht etwas lockerer waren.
Sie schlief fast im Stehen ein, während sie stumpf mit glasigem Blick vor sich hin starrend in der inzwischen angewachsenen Schlange für die Passkontrolle anstand. Später, an der Gepäckausgabe, entdeckte sie Emma.
»Du kannst es dir immer noch anders überlegen«, sagte Emma, während sie ihren Begleiter anwies, ihre vielen Taschen vom Gepäckband zu hieven. »Willst du bei mir mitfahren?«
»Ich bin dir wirklich dankbar für das Angebot, aber ich brauche meinen eigenen Wagen. Ich werde durch die ganze Region fahren und Weingüter besuchen. Und für die ersten paar Tage bin ich sowieso in ein Hotel in Paris gebucht.«
»Na ja, gegen Paris kann ich schlecht was sagen. Aber die Champagne ist klein«, meinte Emma. »Ich werde in Épernay wohnen, das ein ganzes Stück entfernt von Cochet ist, aber ich bin sicher, unsere Wege werden sich wieder kreuzen. Wenn nicht, melde dich bei mir. Ganz ehrlich, ich würde mich über die Gesellschaft freuen. Allein schon, um mich beim Abendessen auf Englisch unterhalten zu können.«
Rosalyn bedankte sich bei ihr. Einerseits hatte sie den Kopf nicht frei für irgendwelche neuen »Freunde«. Andererseits drehte sich im Weingeschäft, wie Hugh ihr ständig einzuhämmern versuchte, alles darum, Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. Sie sollte sich wirklich nach einer Verkostung von Emmas Weinen erkundigen, falls sie noch nicht auf dem amerikanischen Markt vertreten waren. Und … sie würde sehr gern herausfinden, was aus diesen Briefen geworden war.
»Es hat mich wirklich gefreut, dich kennenzulernen«, sagte Rosalyn.
Emma schwieg einen Moment und fixierte Rosalyn mit diesem beunruhigend starren Blick. »Ich versuche ja immer, keine unerwünschten Ratschläge zu erteilen, Rosalyn, aber glaub mir, wenn ich sage: Du schaffst das schon. Das Leben ist nicht leicht, und es ist mit Sicherheit nicht fair. Aber wir sind Überlebenskünstler, du und ich. Setz einfach weiter einen Fuß vor den anderen.«
Rosalyn sah zu, wie Emma, der Rollstuhl und ihr Begleiter von der Menge verschluckt wurden, die um die laufenden Gepäckbänder herumwuselte. Ein zweiter Mann trabte hinter ihnen her, einen Kofferkuli schiebend, auf dem sich Emmas zusammenpassende Gepäckstücke türmten.
Wenn sie sich innerlich nicht so leer gefühlt hätte, hätte Rosalyn schwören können, dass sie Verlust empfand.
Fast so, als hätte sie ihre einzige Freundin in Frankreich verloren.
Setz einfach weiter einen Fuß vor den anderen.
Emmas Abschiedsworte hallten in Rosalyns Kopf wider, während sie durch den Zoll ging und schließlich aus dem Hauptterminal trat, um den Taxistand zu finden.
Ihre Großmutter hatte ihr bei Dashs Trauerfeier dasselbe gesagt, und es war tatsächlich ein hilfreicher Ratschlag, insofern Ratschläge hilfreich sein konnten. Weitaus besser als das »Eines Tages wirst du jemand anders kennenlernen« oder das stets beliebte »Er ist jetzt an einem besseren Ort; wenigstens leidet er keine Schmerzen mehr«. Oder erst recht das besonders schmerzliche: »Ein Jammer, dass ihr keine Kinder hattet, die dich an ihn erinnern.«
In den vergangenen zwei Jahren hatte Rosalyn einen Fuß vor den anderen gesetzt, wie ein tapferer Soldat, der in den Krieg zog.





























