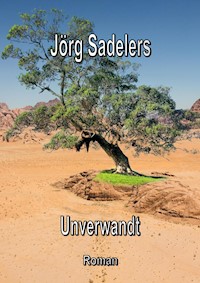4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
An einem Apriltag des Jahres neunzehnhundertsechsundvierzig begann die Existenz eines Menschen, dessen Leben sich in seinem Verlauf als reich an atemberaubenden und wechselvollen Wendungen erweisen sollte und der in seiner beruflichen Laufbahn in Areale und Regionen vorstieß, die jemandem seines Bildungsgrades im Allgemeinen verwehrt blieben und in denen er sich doch erfolgreich behauptete und bewährte. Wer diese Entwicklung verfolgen und dem Verlauf dieses Lebens in einigen Details nachspüren möchte, dem sei das Studium dieses Werkes ans Herz gelegt und er wird nicht selten erstaunt sein über die Aspekte und Blickwinkel, die sich der gefälligen Betrachtung darbieten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Jörg Sadelers
Das Gesetz
Roman
© Jörg Sadelers 2023
Schimmelbuschstr. 20
40699 Erkrath
Vorwort
Werte Leserin, werter Leser,
Sie haben eine Entscheidung von einer gewissen Tragweite für ihre Freizeitgestaltung getroffen, eine Entscheidung, die von einer heutzutage nicht mehr selbstverständlichen Hingabe- und Opferbereitschaft zeugt, da sie demjenigen, der sie trifft, abverlangt, sich einzulassen auf ein Gedankenmodell, das jemand entworfen hat in einer reinen bildhaften sprachlichen Umschreibung, zumeist ohne jede Unterstützung durch Illustrationen oder Tondokumente, eine traditionelle Form der Vermittlung von Gedankengut wie man sich ihrer nicht mehr selbstredend bedient in einer Zeit, die über so vielfältige Medienübertragungsformen verfügt, dass diese klassische Weise des noch dazu etwas einseitigen Flusses der Übertragung fast altbacken und altmodisch anmuten muss. Zudem scheint das alleinige Medium der Übertragung, in diesem Falle die deutsche Sprache, in einer Art Krise, vielleicht sogar Existenzkrise befindlich. Die Zeit der großen Erzähler und Wort- und Wendungschöpfer scheint lange vorbei und vergangen, kaum jemand bedient sich heutzutage noch ihrer Mittel, oder vermag überhaupt noch, sich ihrer Mittel in vollem erschöpfenden Umfang zu bedienen, weil die Zeit so viele andersartige und abweichende Verlustierungsmöglichkeiten geschaffen hat, dass eine Hinwendung zur reinen sprachlichen Schriftform aus der Mode gekommen scheint und sich infolgedessen der Geist nicht mehr an mühsam wirkendem Literaturstudium schult und so auch naturgemäß der Variantenreichtum, die Wortvielfalt Einbußen erleidet und die Formulierungssicherheit nicht mehr unter allen Umständen gegeben ist. Zwar hat man versucht, von gestaltender politischer Seite, dem schwindenden Vermögen auch im regelkonformen Umgang mit der deutschen Sprache vorzubauen und eine Reform der Rechtschreibung erstritten, doch bleibt das Kompromisswerk unvollständig, unvollendet und angefochten, weshalb viele, die sich professioneller Weise mit der Sprache auseinander zu setzen haben, graduelle selbstbestimmte Abweichungen zur Wirkung gebracht haben, oftmals als Hausorthographien tituliert, in denen die Neuregelungen der Reform aufgeweicht oder aber vollständig ignoriert werden. Eine Vielzahl der in ihrem alltäglichen Umgang bei der Verfassung von Texten mit den Neufassungen Konfrontierten aber, die schlicht folgsam den jetzt vorgegebenen Regeln entsprechen wollen, verharren wegen der gesetzten Veränderungen verwirrt und irritiert und wissen nicht mehr vor und zurück und bleiben dauerhaft orientierungslos ob der eingeschlagenen Wege, so dass statt Erleichterung, Vereinfachung und Komfortgewinn im Gebrauch der Schriftsprache eher Ratlosigkeit und Verunsicherung Platz greifen und der tatsächliche Nutzen und Sinn der Reformen auf Dauer zweifelhaft bleibt.
Aber was verliere ich mich in Nebensächlichkeiten, gibt es doch Wichtigeres an den Anfang dieses Werkes zu stellen und dem geneigten Leser oder der geneigten Leserin einordnende, zielführende Worte mit auf den Weg zu geben, die den Umgang mit diesem umfangreicheren Schriftstück erleichtern oder vielleicht erst ermöglichen sollten. Um einer anfänglichen Irritation vorzubeugen, sollen deshalb hier einige Erläuterungen der Hintergründe dieses Buches erfolgen. Dieses Buch befasst sich in seiner zentralen Perspektive mit einer Art Biographie oder besser, stellt einen biographischen Roman dar, einen mehr oder weniger chronologisch nachgespürten Lebenslauf der Person des Oscar Muscher, dessen Werdegang in den anschließenden Kapiteln über die Jahrzehnte weiterverfolgt werden kann, wenn auch der Handlungsstrang nicht als durchgehend kohärent, sondern eher als episodenhaft, ja fast fragmentarisch und vermeintlich unzusammenhängend angesehen werden muss, wobei sicherlich festzuhalten ist, dass alles demselben Geist verpflichtet ist, derselben Sache dient und damit den gleichen Atem verströmt. Selbstverständlich, und nicht weiter ungewöhnlich, handelt es sich bei unserem Protagonisten um eine fiktive Figur, sowie dementsprechend die gesamte Handlung und alle darin in Erscheinung tretenden Personen letztlich fiktiv sind. Doch damit, und vielleicht sonderbarerweise, nicht genug, und deshalb auch dieser erläuternde Hinweis darauf, auch die Schauplätze der Handlung sind fiktiv, sprich, es gibt keine der Wirklichkeit entlehnten bekannten Orte, kein bekanntes Staatsgebilde, keine namhaft bekannte Lokalität und keinen bekannten Platz, sowie, darüber noch hinausgehend, keine bekannten Organisationen, Parteien und Vereinigungen, keine industriellen Güter mit ihren eingeführten Handelsnamen etwa. Es wird also eine komplett neue, gewissermaßen virtuelle Welt konstruiert, die zunächst scheinbar und vordergründig mit der real existierenden nichts zu tun hat, da alles anders benannt ist, aber in Wirklichkeit befindet man sich wohl doch eher in einer Art abgekupferten Parallelwelt, die einem fast als 'identisch' anmutet, ja man sich verwundert die Augen reiben mag, wie verwandt diese Sphäre der originalen ist, denn die Mechanismen gleichen sich und auch ansonsten scheint alles wie üblich platziert und man bewegt sich in einer vertrauten und gewohnten Lebenssphäre, die sich in ihrer Ausstattung und ihren Merkmalen nicht von der unsren, der wirklichen, unterscheidet, somit alles normalen Gesetzmäßigkeiten folgt und standardmäßig und gewöhnlich verläuft, weshalb vielfach auf die Kraft der Assoziation und automatischen Ergänzung vertraut wird und deshalb gar nicht alles und jedes umfangreich und detailliert beschrieben, - die Welt in ihren Verhältnissen gewissermaßen neu erklärt wird, wie es bei dieser Konstruktion eigentlich notwendig erschiene, sondern häufig nur einige lakonische Einschübe, in Form von Halbsätzen, auftreten, anhand derer der Konsument oder die Konsumentin dieser Seiten sich seinen oder ihren Reim darauf machen möge.
So viel nur zur Einleitung und in der Hoffnung, den Einstieg in das Leseerlebnis reibungsloser zu gestalten.
Fünfzigerjahre:
I.
Es war ein freundlicher, wenn auch etwas dunstiger Aprilmorgen im Jahre neunzehnhundertsechsundvierzig. In Oberschwarzenaurach, einem kleinen Dorf in Tallage am Flüsschen Meder, schlug es sieben Uhr. Die Windungen des schmalen Flusses mäanderten durch das enge Tal und das Wasser gluckerte und gurgelte leise dabei, während es über Fels, Sand und Schotter dahinglitt, dem Meer in weiter Ferne entgegenstrebend. Über den mit Holzzäunen umfriedeten Weiden waberte der Nebel dicht und hüllte alles weichzeichnend ein und benetzte die Wiesen mit fein perlendem Tau. Die Rinder, noch nicht lange in diesem Jahr auf der Weide, schauten sanft und unerschütterlich, mit ihrem stoischen Kuhaugenblick, in die vom Nebel verschleierte Landschaft, manche lagen noch flach und breit, andere grasten bereits, den Kopf weit herabgesenkt, in der schwachen Frühlingssonne dieses Morgens.
Im Hause Muscher, einem kleinen, verwinkelten, weiß getünchten Fachwerkhaus aus dem sechzehnten Jahrhundert, fanden sich alle Bewohner und Besucher versammelt in dem kleinen Schlafzimmer, das, wie alle Räume des Hauses, knapp bemessen war, so dass kaum alle Anwesenden Platz darin hatten. Ein freudiges Ereignis war der Grund für ihre Versammlung, die Niederkunft eines neuen Erdenbürgers, eines Jungen, der mit Namen Oscar heißen sollte. So war es im Voraus beschlossen worden, für den Fall, dass der Neuankömmling männlich sein sollte, was in diesen Zeiten ja noch niemand vorher sagen konnte. Reibungslos und glatt, ohne irgendwelche Erschwernisse verlief die Geburt, trieb den Beteiligten keine Schweißperlen auf die Stirn, wegen etwaiger Komplikationen oder Behinderungen. Widerstandslos und unerbittlich vorwärts strebend glitt der Säugling durch den Weltenkanal seiner schwer und angestrengt rhythmisch atmenden Mutter, die bereits die zweite Geburt durchlebte und wohl auch deshalb gestaltete sich alles so erfreulich und komplikationslos. Wenig Geschrei gab er von sich, der kleine Oscar, nachdem er von der Hebamme einen dazu ermutigenden Klaps auf sein Hinterteil bekommen hatte, aber er schien auf den ersten Blick wohlgeraten und vollkommen gesund. Stolz und mit sichtbarer Erleichterung über den erfolgreichen Verlauf hielt der frischgebackene Vater den von der Amme in weiße Baumwolltücher gewickelten, krebsroten, einen etwas angestrengten bis weinerlichen Gesichtsausdruck verbreitenden Säugling in den Armen. Die erschöpfte Mutter lag mit seligem Lächeln auf ihrer zerwühlten Bettstatt, die Arme unter der Brust gekreuzt und rundum zufrieden mit dem Ergebnis. Und kaum ward er herumgereicht und von allen bewundert, wurde er in der vorbereiteten Wiege, mit einem filigranen Gatter aus gedrechselten Holzstäben, die neben dem elterlichen Bette stand, abgelegt und schlief alsbald friedlich ein.
Wer hätte dem kleinen Oscar Muscher an der Wiege gesungen, was aus ihm einst werden sollte? Niemand konnte das erahnen, was sich hier, im Laufe eines wechselvollen, ja oftmals atemberaubenden Lebens anbahnte und doch war hierfür jetzt der Grundstein gelegt. Und weit und verwunden war er gewesen, bislang, der Weg, den die kleine Familie genommen hatte. Führte über tausende Kilometer der Reise, aus dem fernen Murmarn, im östlichen Teil des Kontinentes Turdopa, bis in die hiesige Ortschaft, tief eingebettet gelegen im von wechselvoller jüngster Geschichte gezeichneten Frommanien, war befrachtet mit Ängsten und Hoffnungen, die ihren Ursprung vornehmlich in eben den einschneidenden Ereignissen der jüngeren Zeit hatten, die sich alle drehten um den zentralen, den dominierenden Faktor der Zeitgeschichte, den „großen Krieg“, wie er allgemein im Volksmund genannt wurde.
Zur „Flucht“ also war man förmlich genötigt, weil die territorialen Veränderungen, die Neufestsetzung von Landesgrenzen und Hoheitsgebieten, begründet im, für Frommanien als Hauptbeteiligten, negativen Ausgang des großen Krieges, dazu führten, dass weite Teile der frommanischstämmigen Bevölkerung sich nicht mit der neuen staatlichen Macht und den daraus erwarteten Verhältnissen, den Verlust von liebgewonnen Werten und Kultur und auch materiellem Wohlstand fürchtend, arrangieren konnten, sondern ihrerseits lieber das Weite suchten und sich schweren Herzens aus ihrer alten Heimat absetzten, in der Hoffnung durch das Streben zu neuen Ufern, ihr Glück zu finden. So hatte auch die kleine Familie Muscher, wie so viele damals der gleichen ethnischen Zugehörigkeit, die wenigen Habseligkeiten zusammengepackt, die notwendig, schier unentbehrlich und transportfähig erschienen, und sich, alles andere für immer zurücklassend, auf eine lange und strapaziöse Reise gemacht, die in diesem Teil von Frommanien endete, der, an seiner wirtschaftlichen Stärke gemessen, einer der vielversprechendsten war und die Zuzöglinge sicher mit Arbeit versorgte und damit zuverlässig und auch in Zukunft ernähren können sollte.
Und an Arbeit mangelte es seinerzeit wahrhaftig nicht, war vielmehr eine unglaubliche Kraftanstrengung aller Bevölkerungsteile nötig, angesichts des verlorenen Krieges, in dem weite Landstriche von Frommanien, und gerade besonders und ausgesprochen die industriell souveränsten, von den gegnerischen Kriegsparteien gnadenlos zerstört und förmlich dem Erdboden gleichgemacht wurden, so dass hier ein fast vollständiger Neubeginn von Nöten war und alles aus den einzig verbliebenen Trümmern, von Grund auf, wieder errichtet und aufgebaut werden musste und in Erinnerung an diese Zusammenhänge las Oscars Vater seinem Sprössling, als er ihn alt und verständnissinnig genug dachte, eine besonders denkwürdige Niederschrift seines frommanischen Cousins vor, der diese, nachdem einige Jahre seit Kriegsende verstrichen, zu seiner eigenen Klarheit und Selbstfindung aus der Erinnerung heraus verfasst hatte:
Heimkehr
„Als ich, nachdem der große Krieg zu Ende gefochten, unser Untergang vollständig und ich aus kurzer Kriegsgefangenschaft entlassen war, in meine Heimatstadt zurückkehrte, fand ich sie in einem Zustand vor, den man sich kläglicher kaum vorstellen konnte. Der Tag, an dem ich eintraf, war ein trockener Vorsommertag, wochenlang hatte es bereits keinen Niederschlag mehr gegeben und der mehlige Staub aus den Schutthaufen der zerbombten Gebäude wirbelte, vom Wind getrieben, durch die asphaltierten und gepflasterten Straßen der Stadt. Vom Bahnhof aus lenkte ich, noch in meine schäbige und verdreckte Uniform gekleidet und ohne weitere Habseligkeiten, meine Schritte in Richtung meines Geburtshauses, ohne zu wissen, was mich dort erwarten würde, aber der Zustand der Hallen und Häuser, der sich mir bereits durch das Waggonfenster meines Zugabteils präsentierte, während der Zug in die Stadt einrollte, verhieß nichts Gutes und schraubte meine Erwartungen herunter. Was war mit meinen Liebsten geschehen? Wie hatten sie den Bombenterror überstanden? Falls sie ihn überstanden hatten. Ich wusste es nicht, eine Verbindung bestand nicht mehr und ich würde mich überraschen lassen müssen und musste das Schlimmste befürchten. Die Straßen waren nicht sehr bevölkert und die wenigen Passanten, die mir begegneten, waren in ihrer Äußerlichkeit nicht eben in einem besseren Zustand als ich selbst, was schon einiges heißen mochte. Aber kein Wunder, wenn man sich umschaute. Kein Stein stand mehr auf dem anderen, kaum ein Gebäude, eigentlich musste man sagen, 'kein' Gebäude befand sich noch in seinem ursprünglichen unbeschadeten Vorkriegszustand. Vereinzelte Reste von Häuserwänden ragten noch, völlig sinnentleert, weil ihrer eigentlichen stützenden Funktion enthoben, in den wolkenfreien Himmel. Fenster, ihrer Glasscheiben beraubt, und zersplitterte Türen wiesen darin in nicht mehr vorhandene Räumlichkeiten. Hohnvoll musste einem anmuten, wenn als einzige Häuserwand die straßenzugewandte Seite stehen geblieben war, mit der Haupteingangstüre und den daneben angebrachten Klingelschildern, die, wie in einer lädierten Filmkulisse, ins Nichts führte. Als ich in die Straße einbog, in der unser Wohnhaus gestanden hatte, schlug mein Herz unwillkürlich schneller, beschleunigte sich mein Puls rasend. Seitlich zur Fahrbahn waren einstmals erhabene Linden gepflanzt, die die Straße im Sommer beschatteten und ihr viel Licht raubten. Doch von den würdevollen Bäumen mit ihren sich einstmals majestätisch im Wind wiegenden Kronen war schier nichts übrig geblieben. Stümpfe, oder aber klägliche Gerippe, der einer verheerenden Feuersbrunst zum Opfer gefallenen Bäume, standen noch als beschämende Erinnerung an vorheriges üppiges Pflanzenwachstum. Und auch die Linde, die schräg vor dem Eingang zu unserem Haus stand, wies diesen entwürdigenden Zustand auf, wie auch natürlich - was hätte ich anderes erwarten sollen? - ich unser Haus selbst zerbombt vorfand. Seufzend und in aufrichtiger Trauer über diesen ernüchternden Umstand stellte ich mich vor der Ruine des einstmals stolzen vierstöckigen Gebäudes aus der Epoche des Jugendstils mit in die Hüften gestemmten Fäusten auf. So eine Schande und deutlich Derberes dachte ich, und ein Passant, der gerade vorbei kam, mir aber nicht persönlich bekannt war, aber meine persönlichen Gedanken wohl instinktiv nachfühlen konnte, klopfte mir ermunternd auf die Schultern, dass sich der dort abgelagerte Dreck in Form einer staubigen grauen Wolke ablöste, die um meine Augen schwebte, und sagte mitfühlend: ‘Ja, da bleibt keiner verschont.‘, und ich konnte nur bestätigend nicken, während meine Gedanken sich nun insbesondere um das Schicksal meiner engsten Angehörigen rankten, über deren Verbleib ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht das Geringste wusste. Was mochte nur aus ihnen geworden sein? Waren sie am Ende begraben unter diesem riesigen Haufen Schutt, aus dem, während ich davor rätselnd verharrte, immer wieder vom Wind verwirbelte Staubschwaden aufstiegen. Wurden ihre Glieder zermalmt, ihre Eingeweide zerquetscht und ihre Köpfe zerschmettert von der einstürzenden Gewalt auseinander gerissener und durcheinander gewürfelter Trümmerteile, von Ziegelbrocken und Fensterstürzen, oder hatten sie doch noch rechtzeitig Zuflucht gefunden in einem in der Nähe gelegenen Schutzbunker oder wie auch immer gearteten sicheren Unterstand. Ich konnte nur spekulieren und wusste nicht, insbesondere angesichts der hier vorliegenden Situation, da ich auch überhaupt niemanden sah, der mir irgendwie bekannt oder aus Vorkriegszeiten vertraut erschien, wohin mich wenden. Aber, ich mache es kurz, meine Mutter und meine Schwester blieben verschollen, nie wieder habe ich von ihnen gehört, niemand wusste über ihren Verbleib oder konnte Auskunft über ihr Schicksal geben. Das Grundstück, auf dem unser Haus stand, habe ich schließlich veräußert und bin für einige Jahre ins Umland gezogen, zu Verwandten mütterlicherseits, bis ich meine berufliche Ausbildung, die ich kriegsbedingt unterbrechen musste, abgeschlossen hatte und mich auf eigene Füße stellen konnte.“
II.
Ungefähr zur gleichen Zeit, als sie eines Sonntags gemeinschaftlich im Wohnzimmer beisammen saßen, offenbarte sein Vater Oscar eigene, schwere Beklemmungen aus dieser Zeit, die er noch nicht vollends bewältigt und verarbeitet hatte und die ihn immer noch, nach so vielen Jahren, umtrieben.
In der Schulbank
Vater Muscher setzte sich, etwas ächzend, neben seinen Sohn auf die Couch, den verstaubten kleinen Karton, den er soeben erst über die ausziehbare Klappleiter vom Speicher herunter geholt hatte, auf den Knien haltend. Unter vorsichtigem Wackeln löste er den staubigen Deckel und ergriff einen ungeregelt und unsortiert im Karton liegenden Stapel von Schwarz-Weiß-Fotografien mit ausgefranstem Rand. Langsam und bedächtig begann er den Stapel durchzusehen, jede einzelne Fotografie anhebend und, zur Betrachtung, nach vorne haltend, bis er die gesuchte Fotografie gefunden hatte, was er mit einem freudigen 'Ah'-Ausruf begleitete. „Das ist das Bild, auf dem sie alle drauf sind.“ sprach er und tippte mit dem Nagel des gestreckten Zeigefingers mehrfach auf den dünnen Bildkarton, was einen pochenden, hohlen Klang ergab. Oscar krümmte interessiert den Oberkörper um einen besseren Blick auf das etwas ausgebleichte aber noch durchaus scharf und detailliert alles abbildende Foto zu erhaschen. „Hier rechts, in der zweiten Reihe sitzend, das bin ich.“ führte sein Vater aus und reichte Oscar die Fotografie herüber. Der übernahm, behutsam und beinahe ehrfurchtsvoll, die Jahrzehnte alte, von individuellen Erinnerungen wertvoll bereicherte, gewissermaßen beschwerte Fotografie. Sofort erkannte er, dass er sie schon gesehen hatte, wenn auch vor langer Zeit, weshalb er sich nicht mehr in Einzelheiten erinnerte, wen sie abbildete und welche Geschichte etwa hinter jenen, den dort Abgebildeten, steckte. Sie zeigte beinahe erwachsene Schüler, überwiegend diszipliniert gerade und aufrecht sitzend, die Hände auf der Tischplatte ruhend, in ihrem Klassenzimmer, den Blick auf den nur mit seiner linken Körperhälfte noch von hinten erkenntlichen Lehrer gerichtet. Das Mobiliar des Klassenzimmers bestand aus mit dem offenkundig aus Holzdielen bestehenden Fußboden fest verbundenen Bänken und Tischen, wie es in den dreißiger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts in diesen Landen weit verbreitet war und worauf man wohl nur schwerlich eine bequeme Sitzposition fand. „Und du bist nun der Letzte, der noch übrig ist?“ fragte Oscar mit schwerer, mangels Mundfeuchte am Gaumen anhaftender Zunge. Sein Vater seufzte leise, nickte mit fest zusammengepressten Lippen und schwieg dabei für einen Augenblick, der Oscar Muscher, in seinem Bedürfnis nach verbalem Austausch, beinahe endlos lang erschien. Schließlich nahm sein Vater ihm die Fotografie, die er noch unschlüssig in den Händen hielt, wieder ab und blickte, wehmütig die Augen zusammenkneifend, auf das kleine, fast quadratische Abbild von Zuständen vergangener Zeiten, die unwiederbringlich verloren waren, wie es diese momenthaften Darstellungen des Augenblicks so mit sich brachten. „Einen, von diesen, hast du ja noch selbst kennengelernt, alle anderen sind schon gegangen, abberufen worden, Jahre bevor du das Licht der Welt erblickt hast. Damals, in der finstersten Zeit unserer Geschichte, - und wenige nur, so wie ich und der kleine Pummel hier, in der dritten Reihe, waren vom Glück begünstigt und sind nochmal, verdienter- weniger als unverdientermaßen, davongekommen mit dem eigenen Leben, waren gewissermaßen neu geboren und konnten fortsetzen, was anderen verwehrt wurde.“ „Ich erinnere mich, dass du früher schon häufiger von den dramatischen Verlusten gesprochen hast, die du an Freunden und Gesinnungsgenossen, in deinen jungen Jahren, zu verzeichnen hattest - immer meintest, es habe dich besonders hart getroffen, wenngleich du auch stets einräumtest, dass in diesen Tagen alle schwer einstecken mussten - kaum einer ungeschoren davon kam.“ sagte Oscar und dehnte durch sein nachfolgendes Schweigen die vorherrschende Stille aus. Sein Vater seufzte erneut, hustete keuchend und tippte mit dem Zeigefinger auf eine Stelle des Bildes, wobei nur ungefähr anzunehmen war, wen er eigentlich herauspicken wollte, denn die Fingerkuppe war deutlich breiter als einzelne der abgebildeten Figuren. „Nimm Gustav hier.“ sagte er und blickte versonnen über das Bild hinweg in die imaginäre Ferne des Wohnraums, in dem sie sich befanden, als fixiere er irgendein Objekt in großer Distanz. „Er war der erste von uns, der eingezogen wurde, er war zweimal sitzengeblieben und musste gleich nach dem Abschluss des Schuljahres seinen Dienst antreten, noch vor dem Ausbruch des großen Krieges, von dem er dann überrascht wurde, wie wir alle.“ Oscar versuchte die gemeinte Person unter dem Finger zu erkennen. Vergeblich. Aber er offenbarte seine Unkenntnis dem Vater gegenüber nicht, fragte nicht detailversessen nach, wen er genau meine, da es ihm gar nicht von Belang erschien. „Ja, Gustav, gerne erinnere ich mich seiner. Er war ein Hallodri, ein rechter Schelm, wie er im Buche steht. Nahm nichts sonderlich ernst oder für bare Münze. An jeglichem Lernen, an Wissensbildung, völlig desinteressiert, aber ein Kumpan, auf den man immer zählen konnte, in welcher Not auch immer. Ich, so wie jeder andere auf der Schule, habe ihn jederzeit abschreiben lassen, ganz gleich bei welcher Klassenarbeit. Nötig war es immer, aber geholfen hat es oft trotzdem nicht viel, wie man an dem Umstand, dass er zwei Ehrenrunden drehen musste, erkennen kann. Ständig war er zum Feixen aufgelegt, konnte sämtliche Lehrer treffgenau imitieren, was von großem Unterhaltungswert war und ihn sehr beliebt bei allen Klassenkameraden machte, ihn aber bei der Lehrerschaft, die um sein zweifelhaftes Talent wusste, das auf ihre Kosten ging, nicht eben in besserem Lichte erscheinen ließ, zumal seine schülerischen Leistungen wackelig und fraglich in jeder Hinsicht waren. Einzig unser Klassenlehrer, Herr Schulte, brachte wohl ein gewisses Mitgefühl mit ihm auf, weil an sich ein guter, sensibler Charakter, der auch den zwischenmenschlichen Komponenten des Lebens die ihnen gebührende Aufmerksamkeit erwies und so Gustavs Eingebundenheit in den Klassenverbund respektierte und den leider in seiner Essenz vergeblichen Versuch unternahm, ihn zu besseren schulischen Leistungen zu animieren. Damit gescheitert, zeigte er dennoch Größe und nahm die Abweisung seiner Gutwilligkeit und seines Entgegenkommens nicht übel, ja bewies noch den anscheinend unzerrüttlichen Frohsinn, darüber zu scherzen und den schicksalhaften Abgrund, in den sich Gustav ritt, mit Galgenhumor zu bedenken.“ So sprach Oscars Vater und schien momentelang vollständig in Gedanken verloren. „Ja, der Gustav.“ wiederholte er abermals und wog die Fotografie versonnen in der Hand und ein schwermütiges Lächeln umspielte seine Mundwinkel, als erinnere er sich gerade einer ganz fernen, sich vor, nach menschlichen Maßstäben, sehr langer Zeit ereignenden Begebenheit, die ihn, trotz ihres sagenhaften Alters und ihrer lang andauernden Bekanntheit, in der Gegenwart erneut zum Schmunzeln brachte. „Er hat es wirklich nicht leicht getroffen. Einer seiner Kriegskameraden, Schüler einer unserer Parallelklassen, der damals fast zeitgleich mit ihm verwundet wurde, berichtete mir von seinem Schicksal, anlässlich eines Heimaturlaubes, der zugleich sein letzter in diesem Kriege war. Sie lagen seinerzeit beide zusammen in einem Zelt auf dem Hauptverbandsplatz ihrer Division.“ - Nur Gustav, so ging die Geschichte, leider Gottes mit der bedenklicheren Verletzung. Ein Wunder, dass er es mit seiner Verwundung überhaupt bis dorthin geschafft hatte, denn er war Opfer eines Bauchschusses, ein Umstand, der im Allgemeinen von solcher Ernsthaftigkeit war, dass die davon Betroffenen von zwar gutwilligen und hilfreichen, aber auch gnadenlos realitätsverhafteten Sanitätsbediensteten schnell als aussichtslos lebensbedrohlich Verletzte aufgegeben und gar nicht erst weiter transportiert wurden. Da Gustav aber, trotz aller Ernsthaftigkeit seines Zustandes, länger bei Bewusstsein und am Leben blieb, als es solchen Kandidaten gemeinhin eingeräumt wurde, entschied ein wohlmeinender Stabsarzt, ihn zum nahegelegenen Hauptverbandsplatz transportieren zu lassen, zumal wohl akut auch noch freie Transportkapazität zur Verfügung stand. Jedoch erwies sich dieser pragmatische Umstand, der zunächst ein besonders glücklicher und Hoffnung erzeugender war, als zu isoliert, ja alleinstehend, wie sich auf dem Gelände des Hauptverbandsplatzes für Gustav zeigte. Denn, dort angekommen, sonderbarerweise immer noch bei Bewusstsein, traf er zunächst - wie erfreulich - auf den bekannten Schulgenossen, wurde aber zugleich von den diensttuenden Sanitätsoffizieren als pessimistischer Fall eingestuft, unter der teils unverhohlen geäußerten Verwunderung darüber, dass er überhaupt lebend hier angelangt sei. So konnten sich die beiden Bekannten nur kurz und hastig austauschen, um sogleich wieder getrennt zu werden, der eine zu den aussichtsreichen, und hoffnungsfrohen Fällen, die einer lebenserhaltenden Operation entgegen sahen und der andere zu den Hoffnungslosen, Aufgegebenen, für die nichts mehr zu tun sei oder auch mangels Kapazität, begrenzter Ressourcen nichts mehr getan werden konnte. So wurde Gustav in ein Zelt verfrachtet, in dem mehrere schwerst Getroffene vor sich hin dämmerten, deren Schicksal besiegelt schien. Gustav, über die Endgültigkeit seines Zustandes dagegen in einem - vielleicht - berechtigten, gründlichen Zweifel aber doch zu schwach und angegriffen, um sich der handelnden, ihm nicht wohlmeinend genug seienden Verfügungsgewalt irgendwie entgegen zu stellen, war dem Geschehen also ausgeliefert. An einer schräg hinunter laufenden, grauen Zeltbahn, gegen die der Regen prasselte, lag er auf einer Bahre und kämpfte mit seinem inneren Schmerz, der ihn aufzuzehren drohte. Es war bereits Nacht, als ein Arzt mit einer Gasleuchte das Zelt betrat, nach den Verwundeten zu sehen. Er führte eine große Tasche mit sich, die offenkundig mit Medikamenten, insbesondere schmerzstillender Art gefüllt war. Als er sich zu Gustav herunterbeugte und seine rechte Hand um seinen Hals legte, den Puls zu erfühlen, schien er überrascht über die lebhafte Reaktion in Gustavs Körper, da er von den hier in diesem Zelt Untergebrachten nicht mehr viele Lebenszeichen erwartete. Er hob die Leuchte und sah in Gustavs Gesicht, das fahl und eingefallen wirkte. „Hören sie mich?“ fragte er Gustav und Gustav nickte schwach und würgte ein „Ja“ hervor. Der Arzt hob vorsichtig die Decke über Gustavs Körper an und untersuchte allein mit den Augen seinen Verband. „Bauchschuss?“ fragte er und Gustav nickte erneut. „Die Blutung scheint gestillt. Haben sie starke Schmerzen?“ Gustav nickte. „Ist die Wunde älter als zwölf Stunden?“ wollte der Arzt weiter wissen. Gustav schüttelte den Kopf. „Wie viel Stunden ist es ungefähr her?“ „Sieben“ sagte Gustav. Der Arzt wirkte betroffen und schien Gustavs Blick zu suchen, der aber sah nur stoisch geradeaus. „Wenn wir nur mehr Personal hätten und nicht nur den einen Operationsraum. So müssen wir die weniger kritischen Fälle, die erfolgversprechendsten vorziehen, gegenüber denen, die fraglich sind - ein Gebot der Vernunft, wenn man davon im Krieg sprechen kann.“ Er seufzte und klappte den Deckel seiner Tasche auf. „Das Morphium wird langsam knapp, aber ich kann ihnen noch eine Kapsel in die Wange injizieren. Das sollte den Schmerz vorübergehend lindern. Mehr kann ich leider im Moment nicht tun.“ Er zog die Spritze auf und stach mit der Kanüle in Gustavs Wange, was dieser kaum bemerkte. „Sollten sie in drei Stunden noch unter uns weilen, bestünde noch ein kleines Fünkchen Hoffnung, aber nur ein ganz kleines, dass wir sie noch operieren könnten.“ Resigniert klappte er seine Tasche zu und ging und mit seiner Gaslampe verschwand jedes Licht aus dem Zelt. Gustav fühlte alsbald die Wirkung des Morphiums einsetzen und geriet in einen Zustand des Dämmerschlafes, doch die Schmerzen meldeten sich nach einiger Zeit zurück, wie es schien, heftiger denn je. Fieber kam auf und ein heftiges Zittern befiel ihn. Dann, ungefähr zwei Stunden nach der Visite des Arztes, schied er, unbemerkt von irgendjemandem in dem Zelt, dahin. So endete also die Geschichte von Gustav und sein Vater gab sie so genau und getreu wieder, wie sie ihm zugetragen worden war, doch Oscars Vater wusste noch mehr Trauriges aus der dunklen Vergangenheit zu berichten. „Das hier ist Hermann.“, sagte er und tippte erneut mit dem Zeigefinger auf eine Stelle des Bildes, ohne dass man streng genommen genau hätte feststellen können, wer gemeint war. „Du siehst ja übrigens, wir waren nur Jungens. Die Zeit der Koedukation kam ja erst nach dem Krieg.“ fügte er hinzu. „Hermann jedenfalls, wurde zu den Fallschirmjägern eingezogen, was gut passte, denn er war der sportlich Durchtrainierteste von uns allen. Bei der Eroberung von Kreto in Siechenland gehörte er zur vordersten Front der Truppe. Als einer der ersten Soldaten sprang er, in völliger Dunkelheit, aus der Maschine um in einen Gewehrkugelhagel hinein zu gleiten. Nicht viele überstanden das und auch Hermann war keiner der Glücklichen, die ungeschoren davon kamen. Doch, Glück im Unglück, er wurde von einem Maschinengewehrprojektil im Knie getroffen. Das Gelenk ward zertrümmert und er musste, schon unter höllischen Schmerzen, mit dem gesunden Bein landen, so gut als möglich. Der Krieg, jedenfalls, schien für ihn, mit seiner ersten Kampfhandlung überhaupt, schon wieder beendet, als Kriegsversehrter freilich, unter dem schmerzlichen Verlust eines Beines. Aber, wie sollte es anders kommen, das war noch nicht das Ende vom Lied. Zuhause angekommen und in Rekonvaleszenz befindlich, wurde das Krankenhaus, in dem er untergebracht war, bei einem Bombenangriff zerstört und er mit, da es nicht rechtzeitig vollständig evakuiert werden konnte. Oder nimm hier, Siegfried, in der dritten Reihe links sitzend.“ Der alte Herr rückte unruhig auf seiner Sitzgelegenheit hin und her und hielt wieder den Zeigefinger auf eine bestimmte Stelle der Fotografie. „Er war an der Ostfront stationiert, machte zunächst den ganzen Fortschritt, die enormen, förmlich berauschenden Geländegewinne des ersten Jahres mit und frohlockte schon in seinen Feldpostbriefen, der frommanische Angriff sei unaufhaltsam, nicht zu bremsen. Da kamen die ersten Rückschläge und der Fortschritt ward gestoppt, doch noch zum Halten gebracht und eine qualvolle, zäh umkämpfte Rückwärtsbewegung setzte ein, deren brutale Härte er als einfacher, wenn auch motorisierter Infanterist Tag für Tag zu spüren bekam. Doch er hielt durch, verteidigte verbissen sein Leben, bis ins letzte Kriegsjahr. Räumlich der Heimat schon wieder sehr nahe gekommen, wurde er von den Granatensplittern eines Geschosses der feindlichen Artillerie, in einem Granatentrichter liegend, voll getroffen und förmlich in Stücke zerfetzt. Sie haben ihn nicht mehr einsammeln können, sein Körper existierte als solches gar nicht mehr, nicht mal seine Marke haben sie gefunden, berichtete einer seiner Kameraden, der, in einem benachbarten Trichter liegend, sein Glück kaum fassend, davongekommen war und den kriegerischen Wahnsinn bis zu seinem bitteren Ende durchstand.“ Hier schöpfte Vater Muscher Atem und rieb mit der flachen Hand über die Stirn und die kurzzeitig geschlossenen Augen, das detaillierte Erinnern vergangener Geschehnisse strengte ihn an und ermüdete ihn zusehends, aber dennoch fuhr er fort, um zu einem Abschluss zu kommen. „Als einziger Arthur hier, der kleine Dicke, in der letzten Reihe, in der Mitte, überlebte wenigstens den Krieg, wenn auch nicht sehr lange. Anfangs wegen seiner Körperfülle und anderer gesundheitlicher Beeinträchtigungen zurückgestellt, dachte er, schon frohlockend, er könne sich drücken, musste sich aber dann, als die Luft dünner wurde und die Reserven herangezogen und eingebunden werden wollten, doch noch berücksichtigt und in den militärischen Dienst einberufen und zur Panzertruppe versetzt sehen. Dort diente er als Richtschütze das letzte Kriegsjahr an der Westfront und konnte dem Vormarsch der alliierten Mächte nicht helfen, Einhalt zu gebieten. Zweimal abgeschossen und mit buchstäblich nackter Haut unter Beschuss aus dem brennenden und qualmenden Panzerwrack ausgebootet, war er dem Tod knapp von der Schippe gesprungen und rettete sich glücklich ins Zivilleben, um dann, drei Jahre später nur, durch einen Autounfall ums Leben zu kommen, den heute jeder, nach den deutlichen Fortschritten der automobilen Sicherheitstechnik, überleben würde, aber damals waren nun mal andere Zeiten.“ Erschöpft, vom langen Reden, ließ er die Hand, die das Bild hielt, auf das rechte Knie sinken und neigte den Kopf mit dem vorgeschobenen Kinn auf das Brustbein. „Und nun scheint auch endlich meine Zeit gekommen und ich, der ich so viele Jahre mehr noch aufeinander häufen konnte, so viele Jahre mehr erfahren und erleben durfte, als es meinen damaligen Altersgenossen und Mitschülern vergönnt war, die so viel früher abberufen wurden, in so jungen Jahren schon das Zeitliche segnen mussten, mit brachialer äußerer Gewalt, weil nicht irgendwie biologisch oder medizinisch bestimmt, muss schließlich auch, wie der Volksmund sagt, den Löffel abgeben. Aber es fällt nicht so schwer, nach einem reichen, einem reichhaltigen Leben. Eines jeden Zeit wird kommen, so wie jetzt, von Krankheit bestimmt, meine.“
III.
Zwar stellten die vormals verfeindeten Parteien, nach der beinahe völligen Vernichtung der frommanischen Wirtschaftskraft und der Errichtung eines demokratischen Staatswesens - im Gegensatz zu der mit dem Krieg untergegangenen Autokratie - weitreichende Hilfe zum Wiederaufbau, unter tatkräftiger Beaufsichtigung und Leitung, zur Verfügung, doch blieb natürlich die Hauptlast dieser Arbeit an dem ebenfalls kriegsbedingt geschrumpften, dem vor allem in seinem männlichen Bestandteil, durch millionenfachen Aderlass, empfindlich dezimierten Volkskörper, hängen, weshalb, nicht zuletzt aufgrund der hier notwendigen, ungewöhnlichen Tatkraft, dieser Wehleid freien, klaglosen Aufbauleistung, rückblickend, in folgenden Jahren, immer mit großem Respekt begegnet und diese Leistung als Grundstein des neu geschaffenen Staatswesen und seiner darin prosperierenden Wirtschaft gewürdigt wurde.
Oscar Muschers Eltern trugen den ihrigen Teil bei, zu diesem Kraftakt, suchten dabei ihren Sprösslingen bewusst zu machen und ständig vor Augen zu führen, wie ihre Emigration ihr Schicksal positiv beeinflusst hatte und in welchen gottgesegneten Verhältnissen sie, im Gegensatz zu den in ihrer alten, zurückgelassenen Heimat Verbliebenen, nun leben durften und welche großartigen Chancen sich ihnen hierdurch eröffneten. Dieses immer im Hinterkopf behaltend und sich seiner besonderen Stellung gewiss, wuchs der kleine Oscar Muscher in seinem frommanischen Exil auf und gedieh, vollkommen integriert und in jeder Hinsicht einbezogen, prächtig.
Schwer zu sagen, was schließlich die ausschlaggebende Ursache für die ihn später so dominierende, so vorwärtstreibende und motivierende gesellschaftspolitische Haltung war, aber neben der im jugendlichen Alter betriebenen Auseinandersetzung mit sozialen Schriften von teils brisanter politischer Sprengkraft behielt sicherlich das elterliche Emigrantendasein immer großen Einfluss und auch gerade die Herkunft aus einem Land aus dem östlichen Teil des Kontinentes Turdopa, das damals infolge der politischen Neuordnung, als Ergebnis des großen Krieges, zum Mündelstaat eines übermächtigen, sozialistischen Partnerlandes, Huwankos, der zweiten Weltmacht, nach dem westlichen Mamika, wurde. Klarheit verschafft hier nur der gnadenlos fokussierende Blick, wie der durch eine schmale Brille, nur im Zentrum scharf, damit aufklärend und enthüllend, aber nach außen hin das Umliegende nebulös und bis ins Ungewisse verschleiernd.
Doch zunächst wollen wir noch etwas verweilen in der Schilderung der Kindheit, sowie der Jugendzeit unseres Protagonisten, nicht zuletzt auch um ihn näher kennenzulernen, ihn an seiner Wurzel zu packen, seine Motive und Beweggründe besser verstehen zu können, denn allzu oft mag es einem widerfahren, dass man in der Bewertung eines Menschen fehl greift, ihm Unrecht tut, mit seiner eigenen Einschätzung seines Verhaltens, weil einem tiefere Einblicke verwehrt waren und man, in Erkenntnis dieser Sachverhalte, anders urteilen würde, geurteilt hätte, man impulsiv zurückfährt, nachdem man diese Einblicke erhält, und fast sprichwörtlich entschuldigend und hastig aussprechen mag: „Das habe ich nicht gewusst.“ oder auch „Das ist mir so neu und ändert natürlich alles.“. Dergleichen sollte uns nicht widerfahren, weshalb wir den biografischen Einblick soweit und soviel als nötig vertiefen wollen, um nicht in die Verlegenheit des aufgeschreckten, impulsiven Zurückzuckens vor Handlungen und Ereignissen im Lebensverlauf der zentralen Person dieses Schriftstückes zu geraten. Manches Mal kann es allerdings auch geschehen, entgegen der hier soeben plausibel gemachten Verfahrensweise, dass man gerade vor dem Hintergrund des detaillierten Wissens über biografische oder persönliche Umstände eines Menschen ins Rätseln oder Grübeln gerät, eben deshalb weil man glaubt, jemanden gut zu kennen und daher persönlich einschätzen zu können, wie es, im hier vorliegenden Fall, bei den Eltern von Oscar Muscher wohl der Fall gewesen sein könnte, die hier vor den Kopf gestoßen wurden, ein übers andere Mal, besonders in der jugendlichen Sturm- und Drangzeit ihres geliebten Kindes und sich fragen mussten, warum dies oder jenes geschehen sei, habe man doch alles Förderliche getan und versucht, um, nach allen zur Verfügung stehenden Kräften, den Jungen auf den richtigen Weg zu bringen. Aber so kann es eben geschehen und von unangenehmen Überraschungen bleibt man niemals verschont, wie es auch Oscar erging, als er in seiner frühen Jugendzeit einen Nachmittag bei seinen damaligen Schulfreunden, den Görgens, verbrachte, wo er nachfolgendes Bemerkenswerte, im Türrahmen des Wohnzimmers der Görgens stehend, beobachten konnte.
Am Fenstersims
Das Haus der Görgens stand direkt an der Straße, bildete eine geschlossene Front mit den Nachbarhäusern, nur ein schmaler, gepflasterter Bürgersteig lag zwischen der Fassade und der Straße. Das Erdgeschoss befand sich ebenerdig genau auf Höhe der Straße, so dass man von außen, auf dem Trottoir stehend, einen bequemen, direkten Blick durch die Fenster ins Innere erhielt. Die Straße war eine Sackgasse, die wenige Meter hinter dem Haus der Görgens endete, mit einer überwachten Einfahrt in eine Kaserne daran anschließend.
Dort in der Kaserne gab es, neben, naturgemäß, allem militärischen Personal, auch einige zivile Beschäftigte. Zu ihnen gehörte auch die junge und bezaubernde Frau Müller, die dort in einer Schreibstube tätig war. Und sie war es insbesondere, die den drei Söhnen der Görgens, noch im Teenager-Alter befindlich, ins Auge gefallen war und ihre jugendlich geprägte, noch recht unerwachsene, sich allmählich erst entwickelnde männliche Neugier weckte.
Den drei Söhnen, die, rare eineiige Drillinge wie sie es waren und dem geistigen Vermögen nach gewiss nicht zu den Hellsten gehörend, viel müßige Zeit hatten, nachmittags, nach ihrem pflichtgemäßen Schulbesuch, das Geschehen auf der nur schwach belebten Straße vor dem Haus zu beobachten. So wussten sie inzwischen natürlich ganz genau, wann Frau Müller Feierabend hatte und sie über den gepflasterten Bürgersteig nach Hause stöckelte, genau an den Erdgeschossfenstern des Hauses der Görgens vorbei. Im Sommer hielt Frau Görgens, die in Haushaltstätigkeiten umtriebige Mutter der Drillinge, die Fenster des im Erdgeschoss liegenden Wohnzimmers zumeist ganztägig geöffnet, vorwiegend auch weil die Luft in dem etwas muffigen Altbau bei geschlossenen Fenstern, gerade im Sommer, nicht die beste war. Wenn dann der Zeitpunkt, zu dem Frau Müller Feierabend hatte, näher rückte, das mochte so zwischen sechzehn und siebzehn Uhr der Fall sein, fanden sich die Drillinge gemeinsam am zur Straße gelegenen Fenster des Wohnzimmers ein und hockten sich hinter den Fenstersims, in Deckung.
Und es dauerte dann nicht mehr lange bis Frau Müller nahte. Frau Müller war schlank aber üppig, von runden Formen, mit wallendem, langem blonden Haar, das aber meistens zu einem strengen Zopf gebunden war und trug auf der zierlichen, stupsigen Nase ein stark gerahmtes Brillengestell, vor ihren leuchtenden wasserblauen Augen. Gekleidet war sie im Sommer zumeist mit einem kurzen, glatten Baumwollrock und mit einer ebenfalls glatten, seidig schimmernden Bluse darüber. Ihre Beine waren zart umhüllt von feinen Nylonstrümpfen und die Füße steckten in zierlichen, oft recht bunt ausfallenden, spitz zulaufenden Lederpumps. Am rechten Arm hielt sie eine geräumige Handtasche für alle notwendigen und erdenklichen Utensilien des täglichen Bedarfs.
Auf dem Weg von der Arbeit nach Hause schritt sie vorbei an den Wachen der Kaserne, die oftmals spaßeshalber vor ihr salutierten und ihr, dienstliche Vorschriften missachtend, irgendwelche belanglosen Nettigkeiten hinterherriefen, durch das geöffnete Tor auf die Straße, an der das Haus der Görgens lag.
Schon etliche Meter bevor sie das Wohnzimmerfenster erreichte, hinter dem sich die Drillinge abgeduckt aufhielten, konnten sie, vorsichtig über den unteren Rand des Fensterrahmen schielend, sie kommen sehen, ihren runden Lauf, mit sanft und geschmeidig hin und her schwingenden Hüften beobachten, den harten Klang ihrer auf das Pflaster aufsetzenden Stöckelschuhe vernehmen, der sich unerbittlich näherte.
Dann hielten sie sich aufgeregt am Arm gefasst, boxten sich in die Seite und wackelten mit dem ganzen Körper aufgeregt auf und nieder.
„Sie kommt! - Sie kommt!“ riefen sie sich, ganz überflüssigerweise den offensichtlichen Umstand kommentierend, gegenseitig zu und kauerten weiter angespannt hinter der Hauswand. Natürlich wusste Frau Müller, dass sie, die drei gleichgesichtigen Jugendlichen, dort hinter dem Fenstersims lauerten und sie abpassten, denn richtig heimlich, unauffällig und unbemerkbar war ihr Verhalten ja eigentlich nicht, wie sie, durch den Fensterrahmen und die Hauswand nicht vollständig verdeckt, ausharrten und sie mit stierendem, aufgeheiztem Blick verfolgten.
Ging sie dann auf Höhe des geöffneten Fensters vorbei, ohne die drei, nur halb Versteckten eines Blickes zu würdigen, konnte sie manchmal aber nicht an sich halten und erlaubte sich einen kleinen Scherz mit den drei an sich völlig harmlosen Wegelagerern, indem sie plötzlich den Kopf zur Seite wandte, ihre Brille mit der linken Hand etwas anhob und ihnen ein kurzes, sie in ihrer nur vermeintlichen Heimlichkeit entlarvendes „Buh!“ zurief, das sie auch plötzlich und überrascht zurückzucken und vom Fenstersims zurückfahren ließ, im ersten Moment zumindest, denn kaum war sie weiter gegangen und ihrem Blick entschwunden, entbrannte auch schon ein Streit darüber, wem der spöttische gemeinte Zuruf gegolten haben mag und jeder der drei Unterschiedslosen reklamierte für sich: „Zu mir hat sie Buh gesagt!“ - „Nein, nicht zu dir, zu mir hat sie Buh gesagt!“. Ein Streit, der noch einige Moment andauern mochte, bis er schließlich, in der Sache unentschieden, im Sande verlief und Oscar, der das alles, im Türrahmen des Wohnzimmers stehend, verblüfft beobachtet und bestaunt hatte, fühlte wie ihm Mutter Görgens von hinten eine Hand auf die Schulter legte und hörte sie fragen: „Na, möchtest du mal unsere eisgekühlte Himbeerbrause probieren?“ und da es ein warmer Sommertag war, willigte er begeistert ein und er und die Drillinge fanden sich gemeinsam am Küchentisch ein, worauf eine Bowleschüssel mit der sprudelnden Brause darin platziert war.
IV.
Dabei verlief Oscars Jugendzeit ansonsten in kleinbürgerlich wohlgeordneten und vorgezeichneten Bahnen, er schloss leicht Freundschaften, fand immer und reichlich Verbündete und in der Schule fiel er nicht weiter auf, nicht im negativen, nicht im positiven Sinne, erreichte aber wohl die gymnasiale Unterstufe und Mittelstufe, was, so sollte man meinen, auf eine gewisse Begabung und hinreichendes Interesse für Kultur und Wissenschaft schließen ließ, und gerade auch die sprachlichen Fähigkeiten zeigten sich wohl entwickelt, was sich im alltäglichen Schulbetrieb als nützlich und vorteilsbringend herausstellte, wie man an dem folgenden Beispiel erkennen mochte.
Herausgearbeitet
Mit dreißig Schülern ungefähr saßen sie im Chemiesaal. Vor den beiden Tafeln, die senkrecht, hoch und runter, verschoben werden konnten stand ein massiver, rot-braun gefliester Arbeitstisch, auf dem die Experimente ausgeführt wurden. Jetzt befanden sich darauf nur ein einfacher gläserner Standzylinder, eine Flasche Brom und ein Glasteller. Von der Eingangstüre bis in das eine Ende des Saales erstreckten sich die Sitzreihen, die treppenartig in die Höhe wanderten, bis zur letzten Reihe, die sich schon knapp unterhalb der Decke befand. Zu viert konnte man rechts und links des Mittelganges sitzen, wobei auf jeder Seite, mittig auf den Tischen, Gasanschlüsse hervorragten und ein rechteckiges Waschbecken wölbte sich in die Tiefe. Auf der gegenüber der Türe liegenden Seite war die großflächige Fensterfront eingelassen, die von der Decke fast bis zum Boden reichte und, auf diese Weise, reichlich Tageslicht in den Raum hineinließ. Oscar und seine Clique saßen in der letzten Reihe mit größtmöglichem Abstand zur Tafel. Als Lehrer Golotzki den Saal, fast zeitgleich mit dem Gong, betrat, herrschte noch allgemeines Stimmengewirr, das nur allmählich abebbte, während der Lehrer seine Position vor der Tafel einnahm und unternehmungslustig auf seine Schülerschar blickte. Herr Golotzki war schlank von Figur und wies, obwohl erst Mitte zwanzig - er hatte also vor nicht allzu langer Zeit sein Referendariat erst beendet – schütteres, fein blondes, kurz geschnittenes Haar auf. Er trug eine ausgebeulte braune Cordhose, dazu ein graues Sakko über einem kleinkarierten Kunstfaserhemd und beige, gesteppte Lederschuhe mit elastischen Gummisohlen, die auf dem Linoleumboden des Chemiesaales quietschende Geräusche verursachten, wenn er während des Unterrichts auf und ab ging. „So, guten Morgen“, eröffnete er seine Stunde. Einige Schüler erwiderten den Gruß, während andere, die noch in Gespräche über zumeist schulferne Themen vertieft waren, diese beendeten und sich, mehr oder weniger aufmerksam, der Lehrperson zuwandten, die ernste Anstalten machte nun den Unterricht zu beginnen. „Wir wollen uns heute mit einem Phänomen beschäftigen, das in der Natur auftritt und von großer Bedeutung ist, in der Natur im Allgemeinen wie in der Wissenschaft von der Chemie im Besonderen. Um dieses Phänomen zu demonstrieren, sauge ich hier mit der Pipette etwas Flüssigkeit aus der Flasche, in diesem Falle handelt es sich um das Element Brom, und gebe diese Flüssigkeit auf den Glasteller über den ich dann kopfüber den Standzylinder stülpe.“ Und er tat, wie gesprochen und stellte sich neben sein Experiment und hielt ein weißes Blatt Papier hinter den kopfüber aufgestellten Standzylinder, damit man die Geschehnisse in seinem Inneren besser beobachten konnte. In der Schülerschar raunte es und man schaute interessiert nach vorne, um zu entdecken was in dem Glaszylinder vor sich ging. Dort vorne aber gab es, so die Meinung der meisten der Zuschauer, die sich dies auch in achselzuckender Ratlosigkeit gegenseitig zu verstehen gaben, wenig Spektakuläres zu sehen. Diese Reaktionen konnten den jungen Lehrer nicht in Überraschung versetzen, vielmehr hatte er sie geradezu erwartet. Er lächelte zuversichtlich und forderte den in der ersten Reihe sitzenden Tobias auf: „Tobias, beschreibe doch du mal, was du siehst.“ Tobias war ein mittelmäßiger, ein überaus durchschnittlicher Schüler, stromlinienförmig, selten zu Opposition oder Kritik geneigt und nun eifrig bedacht, dem an ihn gerichteten Wunsch zu genügen, ihm voll zu entsprechen. „Ich sehe eigentlich nur,“ so begann er „dass sich in dem Glaszylinder braune Schwaden ausbreiten, der braune Nebel von unten nach oben steigt.“ „Aha,“ sagte Herr Golotzki in einem Tonfall als sei er sehr erstaunt, als stelle die Beschreibung etwas gänzlich Unerwartetes dar und er ging bei diesem 'Aha' leicht federnd elastisch in die Knie, hob den rechten Arm, zeigte mit diesem hin und her schwankenden Arm auf Tobias und schaute aufgeregt von links nach rechts in die Reihen und sprach: „Danke Tobias, das reicht und ist natürlich völlig richtig.“, und: „Aber ist das so selbstverständlich?“ fragte er und legte den Zeigefinger der rechten Hand quer über die Lippen, als wolle er seinen Schülern bedeuten, zu schweigen, wobei er ja in Wirklichkeit das Gegenteil erhoffte. Um dies deutlicher zu untermalen, wiederholte er: „Ist denn das so selbstverständlich?“, und: „Wenn ja, dann wüsstet ihr ja alle schon, woran das liegt.“ schloss er schelmisch. Oscar hatte bis dahin, zusammengesunken in seinem Stuhl hängend und desinteressiert, gedanklich mit anderem beschäftigt, in der letzten Reihe gesessen und fühlte sich nun herausgefordert, einen stimmlichen Beitrag zu leisten. Er meldete sich, sowie gleichzeitig einige andere Schüler, fest damit rechnend, dass er von Herrn Golotzki dran genommen würde, wie so häufig, wenn er sich meldete, denn der Lehrer und Oscar rieben sich gerne aneinander, sowie Oscar aufgrund seiner konstanten und notorischen Quertreiber- und Oppositionellenhaltung sich gewissermaßen am ganzen Lehrkörper rieb, wofür er aber von allen Seiten, geschätzt ward, vielleicht am meisten sogar von der Pädagogenseite selbst. Und tatsächlich kokettierte Herr Golotzki kurz damit, wenn auch mit Blicken nur, jemand anderen aufzurufen, um dann doch auf die letzte Reihe zu verweisen und mit einem zugleich fest und freundlich ausgesprochen „Oscar“ diesem das Wort zu erteilen. „Wenn Wasser in einem Topf erhitzt wird, kann man ja dasselbe beobachten, mal abgesehen davon, dass der Dampf dann nicht braun, sondern weiß ist. Wahrscheinlich stehen dieselben Kräfte dahinter.“ sagte Oscar lapidar. Der Lehrer ging erneut schwungvoll in die Knie und hob, wie von der Aussage schwer ergriffen, den rechten Zeigefinger, gerade ausgestreckt, senkrecht in die Luft und sagte wieder und es klang diesmal fast atemlos und als könne er es selbst nicht fassen: „Aha“, und: „Aber hier haben wir keine Heizplatte oder eine ähnliche Erhitzungsvorrichtung. Nicht wahr?“ fügte er, scheinbar unschuldig und naiv einwendend, hinzu, und wiederum relativierend: „Was nicht bedeuten muss, dass du grundsätzlich unrecht hast, Oscar, beziehungsweise in dem, was du sagst, nicht mehr als ein Funken Wahrheit steckt, wenngleich Wasser, in diesem Sinne, einen besonderen Fall darstellt.“ Oscar, gleichermaßen bestätigt wie angefochten, saß zunächst weiter, nicht um Rat und Hilfe wissend, versunken auf seinem unbequemen Holzstuhl. Da meldete sich seine neben ihm sitzende, intime Freundin Ulrike, die ansonsten im Chemieunterricht wenig beizutragen wusste, aber Oscars Zurücksetzung nicht auf sich beruhen lassen konnte, und durfte sogleich, auf eine Geste Herrn Golotzkis, das Wort ergreifen. „Vermutlich wohnt der braunen Flüssigkeit, ich habe vergessen was es ist.“ - „Brom“ schob der Lehrer ein. - „Also gut, Brom. Diesem Brom also wohnt mehr Energie inne als dem Wasser oder auch die Flüssigkeit hat weniger Zusammenhalt, weshalb prinzipiell dieselben Kräfte das Verdunsten der Flüssigkeiten, denn so bezeichnet man es wohl im allgemeinen Sprachgebrauch, bewirken.“ sagte Ulrike. Hier stand offenkundig ein drittes „Aha“ im Raum und Herr Golotzki versank augenblicklich ein drittes Mal in die Knie, nur um dann umso elanvoller wieder emporzuschnellen und ein - sehr überrascht über die Meinungsäußerung einer Person, die er sonst in seinem Unterricht kaum verbal in Erscheinung treten sah - „Ich bin erstaunt, Ulrike.“ hervorzubringen und die Augenbrauen hochzuziehen und die rechte Hand geöffnet wiegend hin und her zu bewegen. „In deiner Aussage sind, wenn auch sublim, einige richtige Ansätze enthalten, die aber noch einer kleinen Ausarbeitung bedürfen.“ so schloss er und fügte hinzu: „Als bekannt, bei eurem Wissensstand, setze ich nun voraus, die Zusammenhänge über die Veränderung der Aggregatzustände bei Stoffen, bestehend aus Elementen oder auch molekularen Verbindungen, durch das Hinzufügen oder Entziehen von Energie in thermischer Form auf die selbigen in, im wesentlichen, drei Zustände, nämlich fest, flüssig und gasförmig. Was waren nun die ursächlichen Zusammenhänge für die Entwicklung dieser verschiedenen Aggregatzustände? Du erinnerst dich vielleicht, Ulrike?“ Die Angesprochene zog einen Mundwinkel herab und sagte schnippisch: „Ich erinnere mich nicht genau aber...“ sie stockte, weil Oscar sie am Ärmel zog und sich zur Seite beugte und ihr etwas ins Ohr flüsterte. „...Ah, ich erinnere mich wieder.“ äußerte sie dann und: „Es hat mit den Molekül- oder auch Atombewegungen zu tun, die durch die Wärme angeregt werden und so den Zusammenhalt, beziehungsweise die Art des Zusammenhalts in einem Stoff bewirken und damit bestimmen, ob sich der Stoff in einem festen oder aber flüssigen Aggregatzustand befindet.“ Da musste Herr Golotzki lachen und sagte: „So hab' ich's am liebsten, aber ich habe für euch ja sowieso schon eine Art Gemeinschaftsnote ausgelobt, für euch vier hier,“ und er beschrieb einen Kreis mit seiner rechten Hand, „die liegt so bei einer schwachen Drei, im Moment, wobei du, Ulrike, dich wahrscheinlich über Wert verkaufst, denn dich würde ich wohl auf eine gute Vier einstufen, während Oscar hier unter Wert wegkommt, dem würde ich ansonsten eher eine glatte Zwei zutrauen.“ Oscar zog hörbar Luft durch die Zähne und versetzte: „Warum dann nicht gleich uns alle auf eine glatte Zwei. Das entspräche doch eher der effektiven, subsumierten Gesamtleistung.“ Darauf musste der Lehrer erneut auflachen und konnte nur unter japsendem Luftholen antworten: „Nein, das kann ich leider nicht tun. Das wäre nicht zu verantworten und ungerecht euren Mitschülern gegenüber.“ und er bestätigte so das manchmal vorgebrachte Vorurteil, dass gemeinschaftlich erzeugte Leistung, in ihrer Summe, durchschnittlicher eingestuft wird, als hervorragende Leistungen, die von einzelnen Personen erbracht werden, obwohl ja oft erst in der Gemeinschaft die wahren Höchstleistungen erreicht werden können, da sich hier das Wissen und die Intelligenz der Individuen addieren und überhaupt erst Ergebnisse möglich sind, die sonst gar nicht zu erreichen sind. Eine Erkenntnis, der sich auch Oscar insbesondere stets verpflichtet fühlte, weshalb man ihn von Anbeginn an, als ausgesprochenen, ja als reinen Teamplayer bezeichnen konnte, der genau wusste, was er nur mit und nicht ohne seine Mitmenschen schaffen konnte, was bestimmend und bezeichnend blieb für sein gesamtes Leben.
V.
Oscar vermochte sich besonders für frommanisch stämmige schöngeistige wie auch politisch didaktische Literatur zu begeistern, was als eine der fundamentalen Grundlagen für den späteren Verlauf seines Lebensweges anzusehen war. So konnte er sich speziell für die Werke eines frommanischen Schriftsteller begeistern, der seinerzeit im Frommanisch-Unterricht gelesen wurde und der durch seine vorwiegend auch tiefenpsychologisch zu analysierende Kunstform tiefen Eindruck bei Oscar Muscher hinterließ und ihn weit über den Unterricht hinaus beschäftigte.
Eines Tages, zu dieser Zeit, er hatte die fragliche Literatur, den Folianten an der letzten Lesestelle gespreizt, auf dem Nachttisch neben seiner Bettstatt liegen, wachte er auf und fühlte sich seltsam hart und steif, als habe er gar keine weiche Haut, als umgebe ihn kein geschmeidiges, kontraktionsfähiges Fleisch und er vermeinte mehr Gliedmaßen zu spüren als er eigentlich zu haben gewohnt war, genauer sechs an der Zahl. Auch hatte sein Gesichtssinn sich dramatisch verändert, denn er sah jetzt rundum, gleichzeitig nach vorne, wie hinten und zur Seite, er hatte einen wahrhaftigen Panoramablick und sah alles in bestechender Schärfe und in Farbnuancen, die ihm bislang nicht bekannt waren. Doch was war auf seinem Rücken? - Zwei harte, lange, flächige und durchsichtige Ausstülpungen erstreckten sich fast senkrecht in die Luft, vibrierten leise mit jedem Atemzug seiner Tracheen-Kanäle. Zaghaft versuchte Oscar, ob er sie bewegen, kontrollieren könne und tatsächlich begannen sie sofort brummend hin und her zu schwingen und er hob leicht ab von seiner Bettstatt, geriet in einen Zustand der Schwerelosigkeit, des in alle drei Richtungen des Raumes frei Beweglichen.