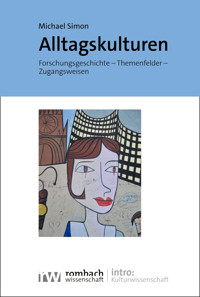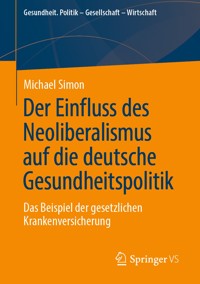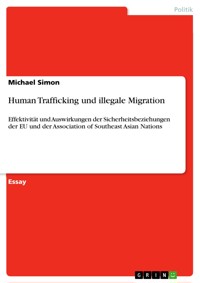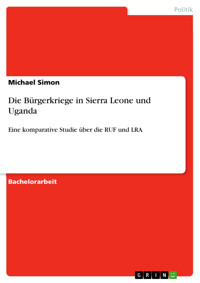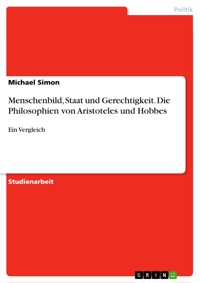32,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe, vorm. Verlag Hans Huber
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das Referenzwerk zum deutschen Gesundheitssystem! Das deutsche Gesundheitswesen ist hochkomplex und für Außenstehende nur schwer durchschaubar. Sogar Experten haben Schwierigkeiten, die Struktur und Funktionsweise der verschiedenen Teilsysteme und Versorgungsbereiche insgesamt zu überblicken. Durch die zahlreichen Gesundheitsreformen wird es zudem immer schwieriger, den Überblick zu behalten. Dies ist nicht nur für Patienten und Leistungserbringer ein Problem, sondern auch für Lehre und Studium zu Themen des Gesundheitssystems und der Gesundheitspolitik. Dieses Referenzwerk leistet einen Beitrag zu mehr Transparenz des deutschen Gesundheitswesens und bietet eine allgemein verständliche Einführung in die gegenwärtige Struktur und Funktionsweise des deutschen Gesundheitssystems und seiner wichtigsten Teilsysteme. Neu in der 7., aktualisierten Auflage: Alle bis Anfang 2021 in Kraft getretenen relevanten Änderungen gesetzlicher Grundlagen (wurden eingearbeitet und die umfangreichen Datentabellen und Abbildungen entsprechend aktualisiert. Das Buch eignet sich insbesondere als Basis-Einführung aber auch als Nachschlagewerk für erfahrene Akteure im Gesundheitswesen und in der Gesundheitspolitik. Das deutsche Gesundheitswesen ist hochkomplex und für Außenstehende nur schwer durchschaubar. Sogar Experten haben Schwierigkeiten, die Struktur und Funktionsweise der verschiedenen Teilsysteme und Versorgungsbereiche insgesamt zu überblicken. Durch die zahlreichen Gesundheitsreformen wird es zudem immer schwieriger, den Überblick zu behalten. Dies ist nicht nur für Patienten und Leistungserbringer ein Problem, sondern auch für Lehre und Studium zu Themen des Gesundheitssystems und der Gesundheitspolitik. Dieses Referenzwerk leistet einen Beitrag zu mehr Transparenz des deutschen Gesundheitswesens und bietet eine allgemein verständliche Einführung in die gegenwärtige Struktur und Funktionsweise des deutschen Gesundheitssystems und seiner wichtigsten Teilsysteme. Neu in der 7., aktualisierten Auflage: Alle bis Anfang 2021 in Kraft getretenen relevanten Änderungen gesetzlicher Grundlagen (wurden eingearbeitet und die umfangreichen Datentabellen und Abbildungen entsprechend aktualisiert. Das Buch eignet sich insbesondere als Basis-Einführung aber auch als Nachschlagewerk für erfahrene Akteure im Gesundheitswesen und in der Gesundheitspolitik.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 701
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Michael Simon
Das Gesundheitssystem in Deutschland
Eine Einführung in Struktur und Funktionsweise
7., überarbeitete und erweiterte Auflage
Das Gesundheitssystem in Deutschland
Michael Simon
Wissenschaftlicher Beirat Programmbereich Gesundheit
Ansgar Gerhardus, Bremen; Klaus Hurrelmann, Berlin; Petra Kolip, Bielefeld; Milo Puhan, Zürich; Doris Schaeffer, Bielefeld
Prof. Dr. Michael Simon
Hochschule Hannover
Fakultät V – Diakonie, Gesundheit und Soziales
Blumhardtstr. 2
30625 Hannover
Deutschland
E-Mail: [email protected]
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autoren bzw. den Herausgebern große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autoren bzw. Herausgeber und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Anregungen und Zuschriften bitte an:
Hogrefe AG
Lektorat Gesundheit
Länggass-Strasse 76
3012 Bern
Schweiz
Tel. +41 31 300 45 00
www.hogrefe.ch
Lektorat: Susanne Ristea
Bearbeitung: Thomas Koch-Albrecht, Münchwald/Hunsrück
Herstellung: Daniel Berger
Umschlag: Claude Borer, Riehen
Satz: punktgenau GmbH, Bühl
Format: EPUB
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden.
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Audiodateien.
Anmerkung:
Sofern der Printausgabe eine CD-ROM beigefügt ist, sind die Materialien/Arbeitsblätter, die sich darauf befinden, bereits Bestandteil dieses E-Books.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur 7. Auflage
Vorwort zur ersten Auflage
1 Die historische Entwicklung des deutschen Gesundheitssystems
1.1 Mittelalterliche und frühkapitalistische Wurzeln
1.2 Das deutsche Kaiserreich
1.3 Die Weimarer Republik
1.4 Die nationalsozialistische Diktatur
1.5 Das Gesundheitswesen der früheren BRD
1.5.1 Reorganisation und Wiederaufbau
1.5.2 Ausbau des Sozialstaates
1.5.3 Phase der „Kostendämpfungspolitik“
1.5.4 Zusammenfassung
1.6 Das Gesundheitswesen der DDR
1.6.1 Sozialversicherung
1.6.2 Ambulante Versorgung
1.6.3 Stationäre Krankenversorgung
1.6.4 Zusammenfassung
1.7 Das Gesundheitswesen im vereinten Deutschland
1.7.1 Gesundheitspolitische Entscheidungen 1990 bis 1998
1.7.2 Gesundheitspolitische Entscheidungen 1998 bis 2005
1.7.3 Gesundheitspolitische Entscheidungen 2005 bis 2009
1.7.4 Gesundheitspolitische Entscheidungen 2009 bis 2013
1.7.5 Gesundheitspolitische Entscheidungen 2013 bis 2017
1.7.6 Gesundheitspolitische Entscheidungen 2017 bis 2020
2 Grundprinzipien der sozialen Sicherung im Krankheitsfall
2.1 Sozialstaatsgebot
2.2 Solidarprinzip
2.3 Leistungsfähigkeitsprinzip
2.4 Bedarfsdeckungsprinzip
2.5 Subsidiaritätsprinzip
2.6 Sachleistungsprinzip
2.7 Versicherungspflicht
2.8 Selbstverwaltung
3 Grundstrukturen und Basisdaten des Gesundheitssystems
3.1 Grundstrukturen des deutschen Gesundheitssystems
3.1.1 Regulierung
3.1.2 Finanzierung
3.1.3 Leistungserbringung
3.1.4 Zusammenspiel von Regulierung, Finanzierung und Leistungserbringung
3.2 Basisdaten des deutschen Gesundheitssystems
3.2.1 Einrichtungen und Beschäftigte
3.2.2 Höhe und Zusammensetzung der Gesundheitsausgaben
3.2.3 Ausgabenentwicklung
4 Die Krankenversicherung
4.1 Gesetzliche Krankenversicherung
4.1.1 Organisationsstruktur
4.1.2 Aufgaben
4.1.3 Versicherte
4.1.4 Leistungen
4.1.5 Finanzierung
4.1.6 Gesundheitsfonds und Risikostrukturausgleich
4.1.7 Ausgaben
4.1.8 Finanzierungsprobleme der gesetzlichen Krankenversicherung
4.2 Private Krankenversicherung
4.2.1 Private Versicherungsunternehmen und staatliche Regulierung
4.2.2 Versicherungspflicht und Versicherte
4.2.3 Zugang zum Versicherungsschutz
4.2.4 Versicherungsleistungen
4.2.5 Grundsätze der Prämienkalkulation
4.2.6 Alterungsrückstellungen in der PKV
4.2.7 Standardtarif – Basistarif – Notlagentarif
4.2.8 Finanzergebnisse der PKV
4.3 Gesetzliche und private Krankenversicherung: eine Gegenüberstellung zentraler Merkmale
5 Die ambulante ärztliche Versorgung
5.1 Strukturmerkmale
5.2 Basisdaten
5.3 Organisation
5.3.1 Ärztekammern
5.3.2 Kassenärztliche Vereinigung
5.3.3 Vertragsärzte
5.4 Vergütungssystem
5.4.1 Gesamtverträge und Gesamtvergütung
5.4.2 Einheitlicher Bewertungsmaßstab
5.4.3 Honorarverteilung
5.4.4 Von der Einzelleistungsabrechnung bis zum Honorarbescheid
5.4.5 Vergütung privatärztlicher Leistungen
5.5 Zusammenfassung: Das System der ambulanten ärztlichen Versorgung
6 Die Arzneimittelversorgung
6.1 Strukturmerkmale
6.2 Basisdaten
6.3 Organisation
6.3.1 Herstellung
6.3.2 Zulassung
6.3.3 Vertrieb und Handel
6.4 Das System der Preisbildung
6.4.1 Vom Herstellerpreis zum Apothekenabgabepreis
6.4.2 Das Festbetragssystem
6.4.3 Das AMNOG-System
6.4.4 Arzneimittelrabattverträge
6.5 Arzneimittelversorgung der PKV-Versicherten
6.6 Zusammenfassung: Das System der Arzneimittelversorgung
7 Die Krankenhausversorgung
7.1 Strukturmerkmale
7.2 Basisdaten
7.2.1 Krankenhäuser und Betten
7.2.2 Leistungen
7.2.3 Personal
7.2.4 Ausgaben
7.3 Organisation
7.3.1 Krankenhausbehandlung
7.3.2 Krankenhausplanung
7.4 Finanzierung
7.4.1 Investitionsförderung
7.4.2 Finanzierung der laufenden Betriebskosten
7.4.3 Das DRG-System
7.4.4 Fallgruppensystem
7.4.5 Zweistufiges System zur Festlegung der Vergütungshöhe
7.4.6 Budget- und Pflegesatzverhandlungen
7.4.7 Gemeinsame Selbstverwaltung
7.5 Versorgung von Privatpatienten
7.6 Zusammenfassung: Das System der stationären Krankenversorgung
8 Die Pflegeversicherung
8.1 Grundlegende Prinzipien und Strukturmerkmale der sozialen Pflegeversicherung
8.2 Leistungen
8.2.1 Pflegebedürftigkeit und Pflegegrade
8.2.2 Leistungskatalog
8.3 Basisdaten
8.3.1 Pflegebedürftigkeit, Leistungsempfänger und Leistungen der sozialen Pflegeversicherung
8.3.2 Einnahmen und Ausgaben der sozialen Pflegeversicherung
8.4 Private Pflegeversicherung
8.4.1 Private Pflegepflichtversicherung
8.4.2 Private Pflegezusatzversicherung
8.4.3 Basisdaten der privaten Pflegeversicherung
9 Die ambulante Pflege
9.1 Strukturmerkmale
9.2 Basisdaten
9.3 Organisation
9.4 Finanzierung
9.4.1 Häusliche Krankenpflege nach § 37 SGB V
9.4.2 Außerklinische Intensivpflege
9.4.3 Vergütungssystem der sozialen Pflegeversicherung
9.4.4 Investitionsförderung
9.5 Zusammenfassung: Das System der ambulanten Pflege
10 Die stationäre Pflege
10.1 Strukturmerkmale
10.2 Basisdaten
10.3 Organisation
10.4 Finanzierung
10.5 Zusammenfassung: Das System der stationären Pflege
Literatur
Über den Autor
Sachwortverzeichnis
|9|Vorwort zur 7. Auflage
Die sechste Auflage dieses Buches erschien Anfang 2017 und bezog den Stand der Gesetzgebung bis Ende 2016 ein. Die Arbeiten an der siebten Auflage wurden Ende Februar 2021 abgeschlossen und beziehen den Stand der Rechtsvorschriften vom 31. Dezember 2020 ein. In den vier Jahren seit Erscheinen der sechsten Auflage hat sich in der Gesundheitspolitik und im Gesundheitswesen viel ereignet, allerdings gab es keine grundlegenden Änderungen und insofern blieb auch die Struktur des Buches unverändert.
Die letzten vier Jahre weisen jedoch einige relevante Besonderheiten auf, die hier kurz angesprochen werden sollen. Die erste Besonderheit ist ein deutlich verzögerter Beginn der Arbeit der neuen Bundesregierung. Aufgrund erheblicher Schwierigkeiten bei der Findung einer neuen Regierungskoalition konnte die neue Bundesregierung ihre Arbeit erst Mitte März 2018 und somit erst ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl vom September 2017 beginnen.
Seitdem war die Regierungskoalition allerdings ausgesprochen produktiv bei der Verabschiedung gesundheitspolitisch relevanter Gesetze. Gleiches gilt für die vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) erlassenen Verordnungen. Auf seiner Internetseite listete das BMG Anfang 2021 insgesamt fast 30 Gesetze und mehr als 60 Verordnungen auf, die Neuregelungen für das Gesundheitswesen enthalten und in der Zeit vom März 2018 bis Ende Dezember 2020 beschlossen oder erlassen wurden.
Insofern erschien es dringend geboten, das vorliegende Lehrbuch dem Stand der Rechtsvorschriften anzupassen. Zudem war es nach vier Jahren auch angebracht, die Datentabellen zu aktualisieren, um neuere Strukturentwicklungen berücksichtigen zu können.
Die hohe Zahl neuer Rechtsvorschriften steht zu einem erheblichen Teil auch im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, die im Frühjahr 2020 Deutschland erreichte. Die vorliegende Neuauflage lässt diese Neuregelungen jedoch unberücksichtigt. Dafür waren vor allem die folgenden Gründe ausschlaggebend. Bei einem Großteil der Rechtsvorschriften, mit denen auf die Pandemie reagiert wurde, handelte es sich um Regelungen, die zeitlich befristet wurden und zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Buches bereits wieder außer Kraft getreten sind. Soweit es sich um Regelungen handelt, die – beispielsweise mit Blick auf zukünftige Pandemien – dauerhaft gelten, sind diese Neuregelungen in der Regel zu spezifisch, um sie in eine allgemein gehaltene Einführung in das Thema Gesundheitssystem aufzunehmen. Insgesamt betrachtet, haben die als Reaktion auf die Corona-Pandemie beschlossenen Gesetze und Verordnungen die Grundstrukturen des deutschen Gesundheitssystems nicht verändert.
Die sowohl in der Öffentlichkeit als auch der Gesundheitspolitik diskutierte Frage, ob und in welchem Maße das deutsche Gesundheitssystem ausreichend auf die Herausforderungen ei|10|ner Pandemie vorbereitet und den damit verbundenen Herausforderungen gewachsen war oder ist, soll und kann in diesem Lehrbuch nicht erörtert werden, so wichtig sie auch ist. Diese Frage angemessen beantworten zu können, würde den Rahmen sprengen, der hierfür in diesem Buch verfügbar wäre. Eine nur oberflächliche und sich mit Allgemeinplätzen begnügende Antwort würde der Relevanz der Frage nicht gerecht werden.
Da wohl damit zu rechnen ist, dass die Corona-Pandemie nicht die letzte ihrer Art gewesen sein wird, erscheint es dringend geboten, nach dem – hoffentlich bald – eintretenden Ende dieser Pandemie, eine gründliche und umfassende Aufarbeitung der Erfahrungen vorzunehmen, um im Gesundheitswesen zukünftig besser als bisher auf Pandemien und Epidemien vorbereitet zu sein.
Eine solche Aufarbeitung und notwendige Diskussion sollte auch vor Fragen der grundsätzlichen Ausgestaltung des deutschen Gesundheitswesens nicht Halt machen. Zwar handelte es sich bei der Corona-Pandemie um eine Ausnahmesituation, die Bewältigung von Ausnahmesituationen und besonders hohen Belastungen in Krisenzeiten kann jedoch umso besser gelingen, je besser das Gesundheitswesen im „Normalzustand“ funktioniert und die „normalen“ Belastungen bewältigen kann. Viele der in der Corona-Pandemie zutage getretenen Probleme im Gesundheitswesen standen – und das wurde auch bereits vielfach in der medialen und politischen Diskussion thematisiert – in einem engen Zusammenhang zu strukturellen und funktionalen Mängeln, die bereits im Normalzustand Probleme bereitet haben. Exemplarisch sei hier auf die seit Langem bekannte unzureichende personelle und sachliche Ausstattung des öffentlichen Gesundheitsdienstes (Gesundheitsämter) und die in vielen Kliniken ebenfalls seit Langem unzureichende Personalbesetzung im Pflegedienst von Intensivstationen verwiesen.
Insofern sollte die Corona-Pandemie auch als Anlass genommen werden, die Strukturen und Funktionsweisen des bestehenden Gesundheitssystems auf den Prüfstand zu stellen, nicht nur im Hinblick auf zukünftige Pandemien, sondern vor allem auch im Hinblick auf die Frage, ob das gegenwärtige Gesundheitssystem den „Normalzustand“ in einer Art und Weise bewältigt, die den berechtigten Erwartungen der Bevölkerung entspricht.
Zur sechsten Auflage erreichten mich einige Hinweise für die Überarbeitung des Buches, für die ich mich an dieser Stelle bedanken möchte bei Lars Frohn, Christian Koster, Tilmann Sick, Evelyn Siegert und Achim Sohns.
Auch für diese Neuauflage gilt, dass ich für Rückmeldungen jeglicher Art, insbesondere für Hinweise auf Mängel in der Darstellung oder sachliche Fehler, dankbar bin (E-Mail: [email protected]).
Hannover, im März 2021
Michael Simon
|11|Vorwort zur ersten Auflage
Gesundheit ist in der subjektiven und öffentlichen Wahrnehmung ein hohes, wenn nicht sogar das höchste menschliche Gut. Dem gesellschaftlichen Teilsystem, das sich mit der Erhaltung und Wiederherstellung von Gesundheit, dem Erkennen, Heilen oder Lindern von Krankheit und Leiden beschäftigt, gilt von daher auch eine hohe gesellschaftliche Aufmerksamkeit. Dennoch aber ist und bleibt es für viele ein „Buch mit sieben Siegeln“, das sich – wenn überhaupt – nur wenigen Experten erschließt. Um als Patient das Gesundheitssystem zu nutzen, reichen in der Regel gewisse Grundkenntnisse aus, die man als Mitglied einer Gesellschaft im Verlauf des Hineinwachsens in diese Gesellschaft quasi „nebenbei“ erwirbt. Wer jedoch im Gesundheitssystem Verantwortung für Patienten übernimmt oder an leitender Stelle im Gesundheitswesen tätig sein will, von dem wird zu Recht erwartet, dass er über mehr als nur Alltagswissen zur Struktur und Funktionsweise des Gesundheitswesens verfügt. Es reicht auch zunehmend nicht mehr aus, sich nur in dem Bereich des Gesundheitssystems auszukennen, in dem man tätig ist. An die Einrichtungen und Beschäftigten des Gesundheitssystems wird zunehmend die Anforderung gestellt, die gegenwärtige Fragmentierung und das häufig isolierte Nebeneinander der verschiedenen Versorgungsinstitutionen zu überwinden, um mit dem Ziel einer stärkeren Patientenorientierung Versorgungsabläufe sektor-, institutions- und einrichtungsübergreifend zu organisieren. Verbesserte Kooperation und Koordination im Gesundheitswesen erfordert aber vor allem auch verbessertes Wissen über die Strukturen und Funktionsweise nicht nur des eigenen, sondern auch der anderen Bereiche. Wer die Struktur- und Funktionslogik des anderen Teilsystems kennt, kann die Handlungslogik seiner Interaktionspartner des anderen Teilsystems auch besser verstehen.
Steigende Anforderungen an das Wissen über die Struktur und Funktionsweise des deutschen Gesundheitssystems sind aber nicht nur in Bezug auf die Beschäftigten des Gesundheitssystems zu verzeichnen. Auch Politik und Medien sind damit konfrontiert bzw. müssen sich dieser Anforderung stellen. Wer in der Gesundheitspolitik aktiv ist, sei es innerhalb einer Partei in gesundheitspolitischen Arbeitskreisen oder als gesundheitspolitisch engagierter Abgeordneter eines Kommunal- oder Landesparlaments oder des Bundestages, wird ohne Kenntnisse der Struktur und Funktionsweise des Gesundheitssystems nicht kompetent mitdiskutieren und sachadäquate Entscheidungen treffen können. Wer das Gesundheitssystem politisch umgestalten will, muss zunächst einmal wissen, wie es gegenwärtig funktioniert.
Und für die Medien gilt Ähnliches. Wer über Ereignisse und Entwicklungen im Gesundheitswesen kompetent berichten will, braucht Wissen über Hintergründe und Zusammenhänge des jeweiligen Teilsystems, aber auch des Gesundheitssystems insgesamt. Auch eine kompe|12|tente Berichterstattung über aktuelle gesundheitspolitische Debatten und Entscheidungen kommt ohne Hintergrundwissen über das Gesundheitssystem nicht aus. Sowohl Politiker als auch Journalisten stehen aber häufig vor dem Problem, dass es schwierig ist, interessenunabhängige Informationen zu erhalten. Nicht nur der Rückgriff auf Verbandsinformationen ist problematisch, in der Berichterstattung über gesundheitspolitische Debatten können auch Informationen von Ministerien und Politikern interessengeleitet sein. Zudem steht der interessierte Nichtexperte häufig vor dem Problem, dass – wenn Informationen gefunden wurden – diese häufig Vorwissen voraussetzen und Fachbegriffe enthalten und dadurch für Laien letztlich nur begrenzt verständlich sind.
Auch verschiedene Wissenschaftsdisziplinen, die sich mit dem Gegenstand „Gesundheitssystem“ beschäftigen, sind auf eine systematische und fundierte Darstellung des Gegenstandes und seiner Teilaspekte angewiesen, nicht nur, um sie für die Lehre zu nutzen, sondern auch um darauf aufbauend empirische Forschungsprojekte richtig konzipieren und Theorien gegenstandsangemessen entwickeln zu können. Dies betrifft insbesondere die Gesundheitswissenschaften, Gesundheitsökonomie, Politikwissenschaft und Soziologie.
Es bedarf also für zahlreiche Akteure in diesem Feld einer unabhängigen und zuverlässigen Quelle, die zudem möglichst schnell und ohne größeren Suchaufwand in allgemeinverständlicher Sprache und ohne Vorwissen vorauszusetzen Grundkenntnisse über die Struktur und Funktionsweise des deutschen Gesundheitssystems und seiner Teilsysteme bietet. Das vorliegende Buch versucht diesen Bedarf zu decken, indem es sowohl systematische Einführung ist, aber auch als Nachschlagewerk genutzt werden kann. In erster Linie ist es jedoch als systematische Einführung in das deutsche Gesundheitssystem konzipiert.
Es beginnt darum mit einem historischen Rückblick auf die Entstehungsgeschichte des deutschen Gesundheitswesens, dessen Wurzeln bis zu den mittelalterlichen Handwerkerzünften und Hospitälern zurückverfolgt werden. Für die Zeit zwischen 1945 und 1989 erfolgt eine getrennte Darstellung des Gesundheitssystems der alten BRD und der DDR. Darin unterscheidet sich diese Einführung von den übrigen gängigen Einführungen und Lehrbüchern zum Gesundheitswesen, die sich leider in der Regel auf eine Darstellung der alten BRD beschränken.
An die Darstellung der historischen Entwicklung schließen sich je ein Kapitel zu den Grundprinzipien der sozialen Sicherung im Krankheitsfall und den Grundstrukturen des deutschen Gesundheitssystems an. Das deutsche Gesundheitssystem wird getragen von grundlegenden Überzeugungen, die über Jahrhunderte entstanden sind und auch die zahlreichen Gesundheitsreformen bislang weitgehend unbeschadet überstanden haben. Diese Grundprinzipien bilden das normative Fundament sowohl des deutschen Gesundheitswesens als auch weiter Teile der deutschen Gesundheitspolitik. Ähnlich wie die Grundprinzipien das normative Fundament bilden, geben die Grundstrukturen eine Art Grundgerüst oder Bauplan für die verschiedenen Teilsysteme vor. Natürlich ist nicht jedes Teilsystem identisch strukturiert, allein schon aufgrund der unterschiedlichen Aufgabenstellungen und Ressourcen, wohl aber lassen sich allgemeine Konstruktionselemente zum Teil in allen, zumindest aber in den meisten Teilsystemen wiederfinden.
Die Darstellung der Teilsysteme des deutschen Gesundheitssystems beschränkt sich auf die wichtigsten Bereiche: die Kranken- und Pflegeversicherung, die ambulante ärztliche Versorgung, die Arzneimittelversorgung, die Krankenhausversorgung sowie die ambulante und die stationäre Pflege. Der Aufbau der einzelnen Kapitel folgt einer gleichen Systematik, vor allem um Komplexität zu reduzieren und gemeinsame Grundstrukturen der Teilsysteme deutlicher werden zu lassen. Am Schluss der jeweiligen Kapitel erfolgt jeweils eine kurze Zusammenfassung. Die Zusammenfassungen sol|13|len das Vorhergehende in geraffter Form wiederholen, sie sollen aber auch Lesern, die das Buch nur selektiv nutzen wollen und nur an einem kurzen Einblick interessiert sind, die Möglichkeit bieten, sich in kurzer Form und relativ schnell einen Einblick in das jeweilige Teilsystem zu verschaffen. Wer also nur ein Teilsystem vertiefend studieren will und von den anderen nur ungefähres Wissen braucht, kann hierzu die jeweiligen Zusammenfassungen nutzen.
Zwar ist das vorliegende Buch primär als systematische Einführung konzipiert, es kann aber auch als Nachschlagewerk zur schnellen und selektiven Recherche einzelner Themen oder Begriffe genutzt werden. Hierzu befindet sich am Ende des Buches ein umfangreiches Schlagwortverzeichnis, in das alle zentralen Begriffe aufgenommen wurden. Zum schnellen Auffinden der Begriffe und besseren Orientierung beim selektiven Nachlesen sind die Schlagworte sowie alle zentralen Begriffe im laufenden Text durch Fettdruck hervorgehoben. Gegenüber einem typischen Schlagwörterbuch bietet dieser Aufbau den Vorteil, dass der System- und Sinnzusammenhang der recherchierten Schlagwörter durch die Einbettung in den laufenden Text erkennbar wird.
Ein zentrales Anliegen des vorliegenden Buches ist es, eine allgemeinverständliche Einführung in das deutsche Gesundheitssystem zu bieten, die keine Vorkenntnisse erfordert. Zugleich soll die Einführung aber natürlich sachlich richtig sein und nicht durch zu starke Vereinfachung in die Irre führen. Das setzt einer vereinfachenden Darstellung gelegentlich Grenzen, da die Nichterwähnung von Ausnahmen, Besonderheiten oder Einschränkungen einer Rechtsvorschrift leicht zu einem falschen Bild führen kann. Da der Gegenstand „Gesundheitssystem“ mittlerweile außerordentlich komplex ist, kann und darf die Sprache das eine oder andere Mal nicht in dem Maße vereinfachen, wie dies für eine Einführung wünschenswert wäre, die sich vor allem an Nichteingeweihte und Nichtexperten richtet. Es bleibt in diesen Fällen nur die Bitte um Verständnis, dass im Zweifelsfall der sachlichen Richtigkeit Vorrang eingeräumt werden muss.
Als Basisjahr für die verwendeten Daten wurde überwiegend das Jahr 2000 gewählt. Dies hat zunächst einmal den Grund, dass amtliche und verlässliche Daten über das deutsche Gesundheitssystem immer erst mit einer gewissen Verzögerung vorliegen. Zudem werden die relevanten Daten nicht für alle Teilsysteme mit der gleichen zeitlichen Verzögerung veröffentlicht. Für einige Bereiche geht es schneller, für andere dauert es länger. Das Jahr 2000 bot gegenüber einem neueren Basisjahr den Vorteil, dass für alle Bereiche amtliche Daten vorlagen und somit eine Art Querschnittsdarstellung möglich war. Wer an neueren Daten interessiert ist, wird in den Literaturhinweisen am Schluss der jeweiligen Kapitel Hinweise auf Datenquellen finden, die solche neueren Daten bieten.
Die Beschreibung des Gesundheitssystems erfolgt auf dem Gesetzesstand von Anfang 2004 und bezieht folglich die Neuregelungen des GKV-Modernisierungsgesetzes mit ein. Es ist aber damit zu rechnen, dass die Darstellung in Teilbereichen bereits nach relativ kurzer Zeit durch erneute Gesundheitsreformen überholt sein wird. Dabei handelt es sich um ein grundsätzliches Problem der Beschreibung des deutschen Gesundheitswesens, vor dem jede Darstellung steht. Grundsätzliche Veränderungen durch eine weitere große Gesundheitsreform dürften in den nächsten Jahren allerdings nicht zu erwarten sein, da die Zeit bis zur nächsten Bundestagswahl im Oktober 2006 hierfür zu kurz ist. Große Gesundheitsreformen wurden in der Vergangenheit vor allem wegen des damit verbundenen Risikos des Ansehensverlustes der Regierungsparteien in der Regel in der ersten Hälfte der Legislaturperiode verabschiedet. Nach der Bundestagswahl 2006 ist allerdings mit einer erneuten großen Gesundheitsreform zu rechnen, sowohl die Regierungskoalition als auch die großen Oppositionsparteien haben ein solches Vorhaben bereits angekündigt. Erfahrungsgemäß dürfte diese Reform im Laufe des |14|Jahres 2007 verhandelt und beschlossen werden und zum 1.1.2008 in Kraft treten. Wer in der Zwischenzeit den jeweils aktuellen Stand der Rechtsvorschriften für einen Teilbereich erfahren will, dem sei eine entsprechenden Internetseite des Bundesministeriums für Gesundheit und Soziale Sicherung empfohlen, auf der das gesamte Sozialrecht auf dem jeweils aktuellsten Stand online nachgeschlagen werden kann1. Zum Schluss sei noch darauf hingewiesen, dass das Buch lediglich eine Einführung in Strukturen und Funktionsweisen geben soll und keine fundierten Analysen zu Problembereichen oder eine Bewertung des deutschen Gesundheitssystems beziehungsweise einzelner Teilsysteme. Das soll aber keineswegs bedeuten, dass es nicht zahlreiche und auch grundlegende Probleme, Mängel und Defizite des deutschen Gesundheitssystems gibt. Zu den Problemen und Defiziten des deut-schen Gesundheitssystems gibt es mittlerweile eine Fülle an Literatur und Diskussionsbeiträgen. Die qualifiziertesten Bestandsaufnahmen und Analysen bieten die in zweijährigem Abstand erscheinenden Gutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (früher: Sachverständigenrat der Konzertierten Aktion im Gesundheitswesen). Unter ihnen ist insbesondere das mehrbändige Gutachten 2000/2001 zu empfehlen und darunter wiederum der vierteilige Band III zum Thema „Über-, Unter- und Fehlversorgung“.
Es mangelt darum m. E. nicht an Problemanalysen und gesundheitspolitischen Diskussionsbeiträgen, wohl aber an fundierten und zugleich allgemeinverständlichen Darstellungen der Struktur und Funktionsweise des Gesundheitssystems insgesamt und seiner wichtigsten Teilbereiche. Das vorliegende Buch kann hoffentlich hierzu einen hilfreichen Beitrag leisten.
Für die sehr hilfreichen Informationen und Hinweise zur ambulanten und stationären Pflege möchte ich an dieser Stelle Ursula Ebel, Elke Meyer und Ulrich Czeczelski danken.
Hannover, im September 2004
Michael Simon
http://www.bmgs.bund.de/download/gesetze_web/gesetze.htm (Stand: Sept. 2004)
|15|1 Die historische Entwicklung des deutschen Gesundheitssystems
Das deutsche Gesundheitssystem ist in seinen Grundzügen das Ergebnis einer über viele Jahrhunderte andauernden Entwicklung. Die Geschichte zentraler Institutionen wie beispielsweise der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) oder der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) reicht nicht nur bis zu deren formaler Gründung als Körperschaften des öffentlichen Rechts im Jahr 1883 (GKV) beziehungsweise 1931 (KV), sondern weit darüber hinaus.
Erst die Beschäftigung mit der historischen Entwicklung macht nachvollziehbar, „daß die Grundzüge und Eigenarten des deutschen Systems – wie immer man diese auswählt und gewichtet – in starkem Maße eine historische Bedingtheit aufweisen. Fast immer wird man auf die Frage „Warum?“ historisch rekurrieren müssen“ (Zöllner, 1981 , S. 56; ähnlich auch Stolleis, 2003, S. 1). Die Betrachtung der Entwicklung nicht nur der letzten Jahrzehnte, sondern über mehrere Jahrhunderte, zeigt die sukzessive Entwicklung und Entstehung eines Systems der sozialen Sicherung im Krankheitsfall, die getragen wurde und wird von tief in der Geschichte und Kultur verwurzelten sozialpolitischen Grundüberzeugungen.
Die Beschäftigung mit der historischen Entwicklung des deutschen Gesundheitssystems kann auch das Verständnis dafür fördern, dass grundlegende Strukturveränderungen offensichtlich nur sehr schwer durchzusetzen sind. Auch heute noch gilt für die alte Bundesrepublik und das vereinte Deutschland: „Herausragendes Charakteristikum des deutschen Gesundheitswesens in historischer Perspektive ist die hohe Strukturkontinuität über politische Regimewechsel hinweg“ (Alber, 1992; S. 19). Die vielfache Klage über eine Reformresistenz des bundesdeutschen Gesundheitswesens basiert jedoch in der Regel auf einer Betrachtung lediglich der letzten zwei bis drei Jahrzehnte. Was sind aber 20 bis 30 Jahre angesichts einer Strukturentwicklung, die mindestens 500 bis 1000 Jahre zurückreicht?
Der Befund einer hohen Strukturkontinuität kann allerdings nur Geltung für die alte Bundesrepublik Deutschland beanspruchen, nicht jedoch für das ostdeutsche Gesundheitswesen. Es wurde innerhalb von vier Jahrzehnten zwei radikalen Systemumwandlungen unterworfen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde auf dem Gebiet der ehemaligen DDR das Gesundheitswesen auf ein rein staatliches System nach sowjetischem Vorbild umgestellt, und nach der deutschen Einheit im Jahr 1990 wurde dieses staatliche Gesundheitssystem erneut radikal umgestaltet, um es dem westdeutschen System anzupassen.
Die folgenden Ausführungen zur historischen Entwicklung können und sollen nur einen kursorischen Überblick bieten. Sie konzentrieren sich vor allem auf die Entwicklung grundlegender Systemelemente und sozialpolitischer Grundüberzeugungen. Für eine vertiefende Beschäftigung mit der historischen Entwicklung sei auf Standardwerke zur deutschen Sozialge|16|schichte verwiesen (u. a. Frerich & Frey, 1996a, 1996b, 1996c; Sachße & Tennstedt, 1988, 1992, 1998).
1.1 Mittelalterliche und frühkapitalistische Wurzeln
Die Hauptstränge der Wurzeln des deutschen Gesundheitssystems lassen sich mindestens bis zum Mittelalter zurückverfolgen. Mehrere der für das deutsche System auch heute noch typischen Merkmale waren bereits in der mittelalterlichen Gesellschaft angelegt. In erster Linie war dies die Verwurzelung grundlegender Überzeugungen in der christlichen Religion, die den Gläubigen soziale Solidarität mit Kranken und Bedürftigen als Gebot auferlegt. Allerdings spielte bei der Mildtätigkeit und Pflege der Armen der Gedanke an das eigene Seelenheil als Investition auf das „Jenseits“ eine bedeutende Rolle.
Tragende Institutionen der Krankenversorgung waren im Mittelalter zunächst kirchliche Hospitäler, deren Entstehung bis in die Frühphase des Christentums zurückgeht. Sie zeichneten sich unter anderem dadurch aus, dass fremden und nicht ortsansässigen Armen und Kranken Unterkunft und Pflege gewährt wurde. Im Jahr 398 n. Chr. hatte das Konzil zu Karthago die Bischöfe zur Errichtung entsprechender Herbergen in ihren Diözesen verpflichtet (Rohde, 1974). Bis ins hohe Mittelalter hinein wurden daraufhin vielfach Häuser für Hilfebedürftige im Schatten der Kathedralen am Sitz des Bischofs eingerichtet (Jetter, 1973).
Christliche Hospitäler waren in ihren Anfängen keineswegs Krankenhäuser in unserem heutigen Sinn, sondern in erster Linie Armenpflegehäuser, die primär der Unterkunft, Verpflegung und vor allem seelsorgerischen Betreuung Kranker dienten (Jetter, 1973). Da Gesundheit und Krankheit als im Wesentlichen außerhalb des menschlichen Verfügungsbereiches liegend angesehen wurden, stand die Gewährung geistlichen Beistands bis zum Ausgang des Mittelalters im Vordergrund. Welche Bedeutung diesem beigemessen wurde, kann unter anderem daran abgelesen werden, dass Hospitäler noch bis weit ins späte Mittelalter hinein in der Regel große Hallen waren, die so gebaut wurden, dass möglichst alle Kranken von ihrem Lager aus einen zentral gelegenen Altar sehen und den mehrmals täglich durchgeführten Messen folgen konnten.
Eine wesentliche Rolle für die Krankenversorgung spielten im Mittelalter die Klöster. Sie unterhielten häufig Abteilungen für die Pflege Kranker, in der Regel getrennt nach ihrem sozialen Status. So sah der Plan des Klosters Sankt Gallen, das als Idealplan eines Klosters dieser Epoche gelten kann, beispielsweise eine Abteilung zur Pflege kranker Mönche vor („Infirmarium“), ein „Hospitale Pauperum“ für Arme und durchreisende Pilger und ein „Hospitium“ für wohlhabende Reisende (Jetter, 1986). Waren sie nicht auf Reisen, so ließen sich Wohlhabende von Ärzten zu Hause versorgen, denn Hospitäler waren überwiegend „trostlose Stätten, zu deren Inanspruchnahme wirklich nur die äußerste Not und Hilflosigkeit oder (im Falle der Aussätzigen) der Isolierzwang veranlassen konnte“ (Rohde, 1974, S. 73).
Neben der Kirche nahmen sich auch weltliche Orden der Krankenversorgung an, so beispielsweise der Johanniterorden. Anlässlich der Kreuzzüge gegründet, um erkrankte Pilger und Kreuzritter im „Heiligen Land“ zu pflegen, verlagerten die Johanniter ihre Aktivitäten nach der Vertreibung aus Palästina nach Europa und unterhielten zeitweilig bis zu insgesamt 4000 Ordensniederlassungen.
Mitte des 15. Jahrhunderts nahmen die kirchlichen Fürsorgeaktivitäten – bedingt durch den gesellschaftlichen Wandel, die Reformation und die damit vielfach verbundene Schließung katholischer Einrichtungen – allerdings deutlich ab. Die Krankenversorgung verlagerte sich in den folgenden Jahrhunderten zunehmend auf städtische Versorgungsinstitutionen (Frerich & Frey, 1996a; Jetter, 1973, 1986). Bereits ab dem 13. und 14. Jahrhundert hatten sich die |17|Städte zunehmend zu eigenständigen politischen Akteuren entwickelt, die sich der Macht der Könige und Fürsten entzogen und in ihren Mauern eine neue, bürgerliche Gesellschaft aufbauten, zu der nach ihrem Selbstverständnis auch eine öffentliche Verantwortung für die Versorgung Kranker gehörte. Im Zentrum des öffentlichen Gesundheitswesens standen städtische Spitäler, häufig von einzelnen Bürgern gestiftet. Einige Städte stellten auch eigene Stadtärzte zur Versorgung ihrer Bürger ein (Jetter, 1973).
Damit hatten sich bereits im ausgehenden Mittelalter in Bezug auf die Trägerschaft von Einrichtungen Grundstrukturen herausgebildet, die heute noch das deutsche Gesundheitssystem prägen. Vor allem Kirchen und Wohlfahrtsverbände – zusammengefasst als „freigemeinnützige Träger“ – sowie öffentliche Träger betreiben den überwiegenden Teil der Krankenhäuser.
Zwei weitere wesentliche Strukturmerkmale des deutschen Gesundheitswesens haben ihre Wurzeln ebenfalls in der mittelalterlichen Gesellschaft: zum einen die heute noch in wichtigen Bereichen anzutreffende berufsständische Organisation und zum anderen die Institution der gesetzlichen Krankenversicherung.
Die in vielen Bereichen des heutigen Gesundheitssystems noch anzutreffende berufsständische Prägung und Organisation hat ihre Wurzeln in den mittelalterlichen Zünften und Gesellenbruderschaften und der aus ihnen entstandenen genossenschaftlichen Selbsthilfe (Frerich & Frey, 1996a; Schewe, 2000; Peters, 1974). In Gilden und Zünften schlossen sich die Kaufleute und selbstständigen Handwerker mittelalterlicher Städte zusammen, zum einen um ihre politischen Interessen wirkungsvoller vertreten zu können, zum anderen aber auch, um die Konkurrenz untereinander einzudämmen und den Zunftmitgliedern eine ausreichende wirtschaftliche Existenz zu sichern. Die Zünfte erhielten häufig einen rechtlichen Status, der dem heutiger Körperschaften des öffentlichen Rechts vergleichbar ist. Sie nahmen hoheitliche Funktionen der Regulierung ihres Berufsstandes und der Qualitätskontrolle wahr. Zu den Merkmalen des Zunftwesens gehörte auch die Zwangsmitgliedschaft, da ohne Mitgliedschaft in der Zunft eine Ausübung des entsprechenden Handwerks in der jeweiligen Stadt nicht erlaubt war.
Neben diesen Funktionen waren sie auch Institutionen der sozialen Sicherung, die sich zumeist jedoch auf die gegenseitige Unterstützung der in ihnen zusammengeschlossenen Kaufleute oder Handwerksmeister beschränkte (Schewe, 2000). Neben diese Art von Zünften traten in einigen Berufszweigen auch solche, die für Lohnabhängige geöffnet waren oder einen zweistufigen Mitgliedsstatus vorsahen, bei dem von den Mitgliedern eines minderen Status ein geringerer Beitrag verlangt, ihnen aber auch nicht die vollen Rechte eingeräumt wurden (Sachße & Tennstedt, 1998).
All diese Merkmale des Zunftwesens prägen heute noch das deutsche Gesundheitswesen, da zentrale Institutionen nach dem Modell der Handwerkerzunft organisiert sind. Das bedeutendste Beispiel hierfür sind die Kassenärztlichen Vereinigungen, die sowohl berufständischer Interessenverband als auch Körperschaft des öffentlichen Rechts und mittelbare Staatsverwaltung sind.
Auch die Wurzeln der gesetzlichen Krankenversicherung reichen bis zu den mittelalterlichen Zünften. Mit Ausnahme der allgemeinen Ortskrankenkassen waren die übrigen Krankenkassen bis 1996 in dem Sinne zunftmäßig organisiert, dass sie lediglich Arbeitnehmern bestimmter Wirtschaftszweige (z. B. Knappschaft, Seekrankenkasse, Innungskrankenkassen), Berufsgruppen (Angestelltenkrankenkassen) oder eines bestimmten Unternehmens (Betriebskrankenkassen) offenstanden.
Die gesetzlich vorgegebene Öffnung der Ersatzkassen zum 1. Januar 1996 machte diese Grenzen zwar durchlässiger, am Grundsatz einer zunftmäßig-berufsständischen Gliederung wurde jedoch festgehalten. Dies war vielfach |18|bereits an den Namen erkennbar (z. B. IKK für Innungskrankenkasse, DAK für Deutsche Angestelltenkrankenkasse, KKH für Kaufmännische Krankenkasse Halle, TK für Techniker Krankenkasse). Nach der gesetzlichen Öffnung der Ersatzkassen haben sich in den letzten 25 Jahren zunehmend mehr Betriebs- und Innungskrankenkassen durch Satzungsbeschluss geöffnet, und durch Gesetz wurden mittlerweile auch noch verbliebene geschlossene RVO-Kassen geöffnet (Knappschaft, See-Krankenkasse etc.). Kassenartenübergreifende Zusammenschlüsse von Einzelkassen trugen ebenfalls ihren Teil dazu bei, dass die überlieferte zunftmäßig-berufsständische Gliederung in der GKV mittlerweile fast vollständig überwunden ist.
Die gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland hat ihre Wurzeln in erster Linie aber aus einem anderen Grund im mittelalterlichen Zunftwesen. Bis ins 12./13. Jahrhundert hinein war die Tätigkeit als Handwerksgeselle nur eine Durchgangsphase auf dem Weg zum Meister und einer eigenen Werkstatt. Mit dem Ausbau der Städte und der Entwicklung des Handwerks wurde die Tätigkeit als Geselle jedoch zunehmend zu einem lebenslangen sozialen Status (Schewe, 2000; Peters, 1974).
Zunächst war es noch üblich und vielfach durch die Zunftordnungen vorgegeben, dass Lehrlinge und Gesellen im Haushalt des Meisters wohnten und vom Meister versorgt werden mussten, auch im Falle von Krankheit. Durch die quantitative Entwicklung des Handwerks ergab sich jedoch die Notwendigkeit einer eigenständigen, von einzelnen Meistern unabhängigen sozialen Sicherung. Diese Funktion nahmen Gesellenbruderschaften wahr. Sie können als Ursprünge der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland gelten (Frerich & Frey, 1996a; Schewe, 2000).
Die Gesellen eines Handwerkszweiges zahlten einen Teil ihres Lohnes („Büchsenpfennig“ o. Ä.) in eine gemeinsame Kasse („Büchse“ oder „Gesellenlade“ o. Ä.) ein, und aus dieser Kasse erhielten die Mitglieder der Gesellenbruderschaft im Falle von Krankheit oder Pflegebedürftigkeit finanzielle Unterstützung. Dazu gehörte vor allem eine Lohnfortzahlung, die je nach Satzung über mehrere Wochen gewährt wurde.
Die gegenseitige, genossenschaftliche Unterstützung bei Krankheit schloss teilweise auch unmittelbare Hilfestellung ein, beispielsweise eine in der Satzung allen Mitgliedern als Pflicht auferlegte Betreuung kranker Mitglieder bei Nacht (Schewe, 2000).
Mit dem Ausbau des städtischen Spitalwesens ging zudem einher, dass Zünfte und Gesellenverbände Belegrechte für eine bestimmte Zahl Betten in Hospitälern kauften, damit ihre Mitglieder dort versorgt werden konnten. Diese Praxis hielt sich noch bis ins 19. Jahrhundert und lief erst nach Einführung der gesetzlichen Krankenversicherung aus (Labisch & Spree, 2001).
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass im Mittelalter bereits die Grundlage gleich mehrerer institutioneller Merkmale der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland gelegt wurde:
Anbindung an ein Arbeitsverhältnis: Die soziale Sicherung für den Krankheitsfall erfolgte auf Basis eines Arbeitsverhältnisses.
Versicherungspflicht: Da es einen Zunftzwang für die betreffenden Handwerker gab, existierte im Grunde bereits eine Art Versicherungspflicht. Die Zusammenschlüsse der Gesellen erfolgten allerdings freiwillig, wenngleich wohl davon ausgegangen werden kann, dass aufgrund des Fehlens einer anderen sozialen Sicherung im Krankheitsfall der überwiegende Teil der Gesellen diesen Organisationen beitrat.
Beitragsfinanzierung: Die Finanzierung der sozialen Leistungen erfolgte über Beiträge der Mitglieder einer Zunft oder Gesellenbruderschaft. Die Beiträge waren einkommensbezogen oder für alle Mitglieder gleich hoch.
|19|Familienversicherung: Zum Leistungskatalog der Zünfte gehörten häufig auch Leistungen für Ehefrauen und Kinder. Im Falle der Zünfte waren allerdings in der Regel nur die Familienangehörigen der Meister einbezogen.
Selbstverwaltung: Die Zünfte und Gesellenbruderschaften regelten ihre Angelegenheiten selbst, insbesondere die Ausgestaltung ihrer Leistungen und die Höhe der Beiträge.
Gegen Ende des Mittelalters setzte ein Zerfall der Zünfte ein und Gesellenbruderschaften entwickelten sich zunehmend zu gewerkschaftlichen Kampfverbänden, deren Hauptzweck sich auf die Durchsetzung von Lohnforderungen und tarifvertraglichen Kollektivvereinbarungen verlagerte (Frerich & Frey, 1996a). Die Entwicklung fabrikmäßiger Produktionsweisen führte zur Entstehung einer neuen Schicht von Lohnabhängigen, den Manufakturarbeitern, die außerhalb jeglicher Zunftordnung standen und insofern auch nicht durch deren Sozialleistungen abgesichert wurden. Zwar entstanden in größeren Manufakturen zum Teil betriebliche Sterbe-, Witwen- und Waisenkassen, der weitaus größte Teil der Arbeiter war jedoch nicht oder nur vollkommen unzureichend sozial abgesichert.
Die Regulierung der sozialen Sicherung im Krankheitsfall wurde ab dem 17. und 18. Jahrhundert zunehmend von den Landesfürsten wahrgenommen, die die Autonomie der Zünfte einschränkten und von Zunft- und Handwerksordnungen auch Vorschriften für Leistungen im Krankheitsfall verlangten. Diese Regelungen schlossen zumeist auch die Manufakturen mit ein. Leitmodell war aber weiterhin die mittelalterliche Zunft und Gesellenlade mit ihren Leistungen der sozialen Sicherung für Meister und Gesellen.
Die bekannteste und umfassendste Regelung des Handwerkswesens und der Manufakturarbeit erfolgte durch das Preußische Allgemeine Landrecht von 1794 („Allgemeines Landrecht für die preußischen Staaten“). Von besonderer Bedeutung ist das Preußische Landrecht nicht nur wegen seiner für die damalige Zeit relativ weitgehenden Vorschriften über die Gewährung sozialer Leistungen, sondern vor allem auch wegen der darin enthaltenen grundsätzlichen Anerkennung einer staatlichen Verantwortung für die Versorgung Bedürftiger (Frerich & Frey, 1996a; Zöllner, 1981; Stolleis, 2003). Allerdings war diese Anerkennung einer Verantwortung absolutistischer Herrscher eng verbunden mit dem Interesse der Herrschaftssicherung und basierte auf einem paternalistisch-obrigkeitsstaatlichen Wertefundament.
In Bezug auf die soziale Sicherung im Krankheitsfall verpflichtete das Preußische Landrecht die Meister und Zünfte sowie Fabrikherren grundsätzlich zur Fürsorge für ihre Gesellen und Arbeiter, was im Krankheitsfall für Handwerksgesellen unter anderem die Gewährung von Kur (Heilbehandlung) und Verpflegung einschloss. Die Kosten hierfür hatte die Gesellenlade oder Gewerkekasse zu tragen. War sie dazu nicht in der Lage, hatte die Kommune für die Finanzierung aufzukommen. Natürlich waren die Leistungen insgesamt weit entfernt von dem, was heute Standard der sozialen Sicherung in Deutschland ist. In Teilbereichen wie dem Bergbau wurden allerdings bereits Leistungen gewährt, die über den damaligen Standard hinausreichten und deutliche Parallelen zum heutigen Leistungsrecht erkennen lassen.
Bereits im Mittelalter war im Bergbau eine freie Arbeiterschaft entstanden, die sich in sogenannten Knappschaften zusammenschloss. Deren Kassen für die soziale Sicherung wurden häufig aus Beiträgen sowohl der Knappen als auch der Bergwerkseigentümer finanziert und teilweise auch gemeinsam verwaltet (Schewe, 2000; Peters, 1974). Im 17. Jahrhundert wurde der Bergbau insbesondere in Sachsen und Preußen zunehmend der direkten Regulierung und Kontrolle des Staates unterworfen, was auch Auswirkungen auf die soziale Sicherung im Krankheitsfall hatte.
So wurde im sächsischen Erzbergbau teilweise bereits Mitte des 17. Jahrhunderts Bergar|20|beitern, die unter Tage verunglückt oder dauerhaft arbeitsunfähig geworden waren, ein Gnadenlohn und ihren Witwen und Waisen eine Art Rente (Almosen) gezahlt (Frerich & Frey, 1996a). Es gab eine Lohnfortzahlung bei Arbeitsunfällen für die Dauer von vier und teilweise auch acht Wochen, die auch die Zahlung der ärztlichen Behandlung einschloss. Finanziert wurden die Leistungen durch die Krankenkassen der Bergleute („Revierkassen“), in die sowohl Bergleute (Knappen) als auch Grubenbesitzer Beiträge zu entrichten hatten. Zu den Leistungen der knappschaftlichen Krankenversicherung zählte unter anderem auch die Finanzierung von Begräbniskosten, einem Vorläufer des Sterbegeldes der gesetzlichen Krankenversicherung.
Insgesamt galt die soziale Sicherung der Bergleute Sozialpolitikern des 19. Jahrhunderts als vorbildlich, und so gingen ihre wichtigsten Regelungen auch in die Grundzüge der späteren gesetzlichen Krankenversicherung ein. Beispielsweise gab das preußische Knappschaftsgesetz von 1854 für den Bergbau die obligatorische Errichtung von Knappschaften mit weitgehender Selbstverwaltung, eine Versicherungspflicht für alle Bergleute, Beitragspflicht für Bergleute und Arbeitgeber, freie Krankenbehandlung und Zahlung eines Krankenlohnes im Krankheitsfall vor (Stolleis, 2003).
Die Sonderstellung der sozialen Sicherung im Bergbau hat auch Eingang in das System der gesetzlichen Krankenversicherung gefunden und wird in Teilbereichen bis heute bewahrt. So gab es bis vor wenigen Jahren eine eigene gesetzliche Krankenkasse nur für die Beschäftigten in Bergbauunternehmen, die knappschaftliche Krankenversicherung. Sie war von der ab 1996 geltenden Öffnung von Krankenkassen für alle abhängig Beschäftigten zunächst ausgenommen und wurde erst vor wenigen Jahren allgemein geöffnet. Auch bei der Leistungserbringung nahm die Knappschaft eine Sonderstellung ein, da sie beispielsweise eigene Versorgungseinrichtungen betreiben konnte und ihren Mitgliedern auch Leistungen gewährte, die über das in der gesetzlichen Krankenversicherung übliche Maß hinausgingen.
Vor dem Hintergrund tief greifender gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Veränderungen richtete sich das Augenmerk staatlicher Sozialpolitik im ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhundert verstärkt auf die Ausweitung des Krankenversicherungsschutzes insbesondere der Arbeiter, Dienstboten und wandernden Handwerksgesellen (Frerich & Frey, 1996a; Sachße &Tennstedt, 1998). In verschiedenen deutschen Ländern wurde in Handwerks- und Gewerbeordnungen die Gründung freiwilliger Unterstützungs- und Hilfskassen gestattet und teilweise auch den Gemeinden die Möglichkeit eingeräumt, durch Ortsstatut solche Kassen einzurichten und Gewerbetreibende und Lohnabhängige zum Beitritt und zur Zahlung von Beiträgen zu verpflichten (Lampert & Althammer, 2004).
Die durch Verordnung der Gemeinden entstandenen Zwangshilfskassen waren häufig nicht nur für eine Berufsgruppe zuständig, sondern offen sowohl für Gesellen und Arbeiter als auch für selbstständige kleinere Gewerbetreibende. Bei ihnen handelte es sich im Grunde um die Vorläufer der heute noch existierenden Kassenart, derAllgemeinen Ortskrankenkasse (AOK). Bis zur gesetzlichen Öffnung der Ersatzkassen im Jahr 1996 waren die Ortskrankenkassen die einzige für alle Berufsgruppen zugängliche Kassenart. Noch bis vor einigen Jahren waren sie zudem auch die Primärkasse, bei der die Kommunen unversicherte Sozialhilfeempfänger versicherten.
Einzelne Länder oder Städte, wie beispielsweise Hamburg, gingen im 19. Jahrhundert sogar so weit, dass sie für alle ortsansässigen Arbeiter eine Beitrittspflicht zu einer Krankenkasse verfügten und den Arbeitgebern die Verantwortung für die Einhaltung dieser Versicherungs- und Beitragspflicht übertrugen. Letzteres ist heute noch konstitutionelles Merkmal des Systems der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland.
|21|Neben den berufsgruppenbezogenen und kommunalen Hilfs- und Unterstützungskassen entstanden in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die erstenBetriebskrankenkassen. Teilweise waren Gemeinden von den Landesherren ermächtigt, größere Fabriken zur Errichtung einer betrieblichen Unterstützungskasse zu verpflichten, teilweise entstanden sie aber auch auf Eigeninitiative einzelner Unternehmer. Bekanntestes Beispiel hierfür dürfte die 1836 gegründete Betriebskrankenkasse der Firma Krupp sein. Erfolgte die Versicherung der Arbeiter zunächst noch auf freiwilliger Basis, so verpflichtete Krupp seine Arbeiter 1855 zum Beitritt und übernahm 50 Prozent der Beitragszahlung (Frerich & Frey, 1996a).
Der Arbeitgeberbeitrag zur Krankenversicherung war aber keineswegs eine Errungenschaft des 19. Jahrhunderts. Hinter dieser Beteiligung, die bereits in früheren Zeiten von den Landesherren in Handwerks- und Gewerbeordnungen vorgegeben wurde, steht eine tief verwurzelte Grundüberzeugung, nach der es zu den Pflichten eines Handwerksmeisters, Dienstherren, Manufaktur- oder Bergwerkseigentümers gehört, für seine kranken und in Not befindlichen Untergebenen und Anvertrauten zu sorgen (Zöllner, 1981). Schloss es in früheren Jahrhunderten auch die direkte Gewährung von Unterkunft und Verpflegung und Zahlung von Arztkosten ein, so wurde diese Verpflichtung mit Einführung der gesetzlichen Krankenversicherung in den gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitgeberbeitrag umgewandelt.
Auch die Hilfskassen des 19. Jahrhunderts wurden – ähnlich wie ihre Vorläufer im mittelalterlichen Zunftwesen – überwiegend in Selbstverwaltung geleitet. Handelte es sich um freiwillige, insbesondere berufsständisch organisierte Unterstützungskassen, lag die Selbstverwaltung allein in den Händen der Mitglieder, da sie auch allein für die Beiträge aufkamen. Handelte es sich um betriebliche Kassen, in die der Fabrikherr ebenfalls Beitragszahlungen entrichtete, war der Arbeitgeber an der Verwaltung beteiligt. Dieser Grundsatz prägt noch heute die gesetzliche Krankenversicherung.
1.2 Das deutsche Kaiserreich
Die sozialpolitischen Interventionen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts brachten nur Teilen der abhängig Beschäftigten eine gewisse soziale Absicherung im Krankheitsfall, ohne das Verarmungsrisiko als Folge von schwerer oder andauernder Krankheit wirklich zu beseitigen. So war 1874 von den ca. 8 Mio. Arbeitern lediglich ein Viertel in einer der rund 10 000 Unterstützungskassen versichert, wobei es sich zumeist um Ortskrankenkassen oder Betriebskrankenkassen handelte (Zöllner, 1981).
Mitte des Jahrhunderts verschärften sich die sozialen Gegensätze und Spannungen, was in Deutschland zum Erstarken der politischen Arbeiterbewegung und schließlich zur Gründung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins im Jahr 1863 und sechs Jahre später der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei führte. In ihrer politischen Arbeit konnte sich die Sozialdemokratie insbesondere in Zeiten der Repression auch auf die Organisationen der Hilfskassen stützen, die – durchaus in der Tradition ihrer Vorläufer, der Gesellenladen – nicht selten zugleich politische Zusammenschlüsse waren bzw. sozialpolitische Zielsetzungen verfolgten (Deppe, 1987; Zöllner, 1981).
Die Sozialpolitik des 1871 gegründeten Deutschen Kaiserreiches verfolgte darum zwei Ziele: Zum einen sollte die erstarkte politische Arbeiterbewegung unterdrückt werden, um der Umsturzgefahr zu begegnen, und zum anderen sollte die Arbeiterschaft durch Sozialreformen an das Kaiserreich gebunden werden (Frerich & Frey, 1996a; Zöllner, 1981).
In einem ersten Schritt wurden 1878 aus Anlass zweier missglückter Attentate auf den Kaiser durch das Sozialistengesetz („Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie“) alle sozialdemokratischen |22|und kommunistischen Vereine sowie Versammlungen und Zeitungen verboten.
In einem zweiten Schritt kündigte Kaiser Wilhelm I 1881 in einerkaiserlichen Botschaft drei Gesetzesinitiativen zur Verbesserung der sozialen Lage der Arbeiterschaft an: ein Gesetz zur Absicherung bei Betriebsunfällen, eines zum Krankenkassenwesen und eines zur Sicherung im Alter und bei Invalidität. Begründet wurden die Initiativen in der kaiserlichen Botschaft mit der Überzeugung, „dass die Heilung der sozialen Schäden nicht ausschließlich im Wege der Repression sozialdemokratischer Ausschreitungen, sondern gleichmäßig auf dem Weg der positiven Förderung des Wohles der Arbeiter zu suchen sein werde“.
Vorrangiges Ziel der Bismarck’schen Sozialpolitik war, das bringt die kaiserliche Botschaft sehr deutlich zum Ausdruck, die Sicherung des inneren Friedens und Erhaltung der Monarchie. Dennoch aber kann dies die überragende Bedeutung der Gesetzesinitiativen nicht schmälern. Mit der Bismarck’schen Sozialgesetzgebung wurde nicht nur der Grundstock des noch heute bestehenden Systems der sozialen Sicherung in Deutschland gelegt, sondern auch ein Modell geschaffen, an dem sich in den folgenden Jahrzehnten mehrere andere und nicht nur europäische Staaten orientierten. Nach teilweise heftigen Kontroversen innerhalb und außerhalb des Reichstages wurde 1883 die gesetzliche Krankenversicherung2, 1884 die gesetzliche Unfallversicherung3 und 1889 die gesetzliche Rentenversicherung4 geschaffen.
Hintergrund
Auszug aus der Kaiserlichen Botschaft
Verlesen zur Eröffnung der 5. Legislaturperiode des Reichstags am 17.11.1881: „Schon der sozialen im Februar d. J. haben wir Unsere Überzeugung aussprechen lassen, dass die Heilung Schäden nicht ausschließlich im Wege der Repression sozialdemokratischer Ausschreitungen, sondern gleichmäßig auf dem Wege der positiven Förderung des Wohles der Arbeiter zu suchen sein werde. Wir halten es für Unsere Kaiserliche Pflicht, dem Reichstag diese Aufgabe von Neuem ans Herz zu legen, und würden Wir mit umso größerer Befriedigung auf alle Erfolge, mit denen Gott unsere Regierung sichtlich gesegnet hat, zurückblicken, wenn es Uns gelänge, dereinst das Bewußtsein mitzunehmen, dem Vaterlande neue und dauernde Bürgschaften seines inneren Friedens und den Hilfebedürftigen größere Sicherheit und Ergiebigkeit des Beistandes, auf den sie Anspruch haben, zu hinterlassen. In Unseren darauf gerichteten Bestrebungen sind Wir der Zustimmung aller verbündeten Regierungen gewiß und vertrauen auf die Unterstützung des Reichstages ohne Unterschiede der Parteistellungen.
In diesem Sinne wird zunächst der von den verbündeten Regierungen in der vorigen Session vorgeleg1te Entwurf eines Gesetzes über die Versicherung der Arbeiter gegen Betriebsunfälle mit Rücksicht auf die im Reichstage stattgehabten Verhandlungen über denselben einer Umarbeitung unterzogen, um die erneute Berathung desselben vorzubereiten. Ergänzend wird ihm eine Vorlage zur Seite treten, welche sich eine gleichmäßige Organisation des gewerblichen Krankenkassenwesens zur Aufgabe stellt. Aber auch diejenigen, welche durch Alter oder Invalidität erwerbsunfähig werden, haben der Gesamtheit gegenüber begründeten Anspruch auf ein höheres Maß staatlicher Fürsorge, als ihnen bisher hat zu Theil werden können.
Für diese Fürsorge die rechten Mittel und Wege zu finden, ist eine schwierige, aber auch eine der höchsten Aufgaben jedes Gemeinwesens, welches auf den sittlichen Fundamenten des christlichen Volkslebens steht. Der engere Anschluß an die realen Kräfte dieses Volkslebens und das Zusammenfassen der letzten in der Form kooperativer |23|Genossenschaftenunter staatlichem Schutz und staatlicher Förderung werden, wie Wir hoffen, die Lösung auch Aufgaben möglich machen, denen die Staatsgewalt allein in gleichem Umfange nicht gewachsen sein würde. Immerhin aber wird auch auf diesem Wege das Ziel nicht ohne die Aufwendung erheblicher Mittel zu erreichen sein“ (zit. n. Frerich & Frey, 1996a, S. 91–93).
Das Krankenversicherungsgesetz von 1883 (KVG), Gründungsakt der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland, verfügte eine allgemeine Versicherungspflicht vor allem für gewerbliche Arbeiter (zu den wichtigsten Inhalten des Gesetzes vgl. Frerich & Frey, 1996a; Peters, 1974). Dem lag die Auffassung zugrunde, dass andere, besser gestellte und verdienende Berufe für ihre soziale Sicherung selbst sorgen können. Dementsprechend gab es auch keine Versicherungspflichtgrenze, bis zu der sich abhängig Beschäftigte versichern mussten, sondern eine Grenze für die „Versicherungsberechtigung“.
In den Primärkassen der gesetzlichen Krankenversicherung versichern konnte sich nur, wer diese Einkommensgrenze nicht überschritt. Zu den Primärkassen – später auch RVO-Kassen5 genannt – zählten die Orts-, Innungs- und Betriebskrankenkassen sowie die knappschaftliche Krankenversicherung und die Seekrankenkasse. Für die Arbeiter wurde eine Kassenzugehörigkeit aufgrund des Arbeitsplatzes bestimmt. Sofern für ihren Arbeitsplatz eine Betriebs- oder Innungskrankenkasse oder eine Knappschaftskasse bestand, wurden sie dieser zugewiesen. Existierte keine arbeitsplatzbezogene Kasse, so fungierten eine Ortskrankenkasse oder eine von der Gemeinde gegründete Gemeinde-Krankenkasse als „Auffangkassen“.
Die Beiträge für die gesetzliche Krankenversicherung wurden zu zwei Dritteln von den versicherten Mitgliedern und zu einem Drittel von den Arbeitgebern getragen. Entsprechend ihrem Beitragssatzanteil waren beide Gruppen auch in der Selbstverwaltung der Ortskassen vertreten: die Versicherten mit zwei Dritteln der Stimmen und die Arbeitgeber mit einem Drittel.
Angestelltenberufe waren zunächst von der Versicherungspflicht befreit und konnten sich in einer der weiter bestehenden, vom Staat zugelassenen freien Hilfskassen versichern, mussten dort allerdings für den Beitragssatz allein aufkommen. Entsprechend der Beitragstragung wurden die Hilfskassen und späteren Ersatzkassen allein von Vertretern der Mitglieder verwaltet, ohne Beteiligung der Arbeitgeber.
Schrittweise wurde die gesetzliche Versicherungspflicht auch auf Angestelltenberufe ausgeweitet, und im Rahmen der Kodifizierung des Sozialrechts in der Reichsversicherungsordnung (RVO) von 1911 erhielten zugelassene Hilfskassen schließlich den offiziellen Status von Ersatzkassen und durften diesen Zusatz auch im Namen tragen, sofern sie bestimmte im Gesetz definierte Voraussetzungen erfüllten (Bach & Moser, 2002).
Ersatzkassen waren weiterhin zumeist in der privaten Rechtsform eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit (VVaG) organisiert und insofern auch noch nicht Teil der gesetzlichen Krankenversicherung, sondern boten substitutiven Krankenversicherungsschutz. Erst im Jahr 1937 wurden die Ersatzkassen zu Körperschaften des öffentlichen Rechts und zugleich erfolgte eine strikte Trennung in Ersatzkassen für Arbeiter und für Angestellte (Peters, 1974).
Die nicht zu Ersatzkassen umgewandelten freien Hilfskassen waren Ausgangspunkt eines Großteils der heutigen privaten Krankenversicherungsunternehmen, vor allem derjenigen, die als „Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit“ (VVaG) verfasst sind (Bach & Moser, 2002).
Zu den wichtigsten Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung gehörte die freie |24|ärztliche Behandlung, Arzneimittelversorgung, Heil- und Hilfsmittelversorgung sowie Krankenhausbehandlung, die Zahlung eines Krankengeldes ab dem 4. Tag der Arbeitsunfähigkeit in Höhe von 50 Prozent des ortsüblichen Tagelohnes, eine Wöchnerinnenunterstützung sowie ein gesetzlich festgelegtes Sterbegeld. Über die allen Kassen gesetzlich vorgegebenen Leistungen hinaus konnten Krankenkassen durch Satzungsbeschluss zusätzliche, sogenannte Satzungsleistungen gewähren, beispielsweise ein höheres Krankengeld oder Sterbegeld.
Für die Gewährung der medizinischen Leistungen galt das Sachleistungsprinzip, die Kassen übernahmen die gesamten Kosten und erstatteten sie den Leistungserbringern auf direktem Weg. Die Leistungsdauer war im Gesetz allerdings auf 13 Wochen begrenzt, konnte jedoch im Rahmen der Satzungsleistungen von der einzelnen Kasse verlängert werden.
Eine Familienversicherung, also die Einbeziehung der Familienangehörigen in den Versicherungsschutz, war noch nicht Teil des gesetzlichen Leistungskataloges, sondern musste als Satzungsleistung von der Selbstverwaltung der jeweiligen Kasse beschlossen werden. Von dieser Möglichkeit machten bis Ende des 19. Jahrhunderts zahlreiche Kassen Gebrauch, sodass zur Jahrhundertwende für rund die Hälfte aller versicherten Arbeitnehmer eine Familienversicherung bestand, weit überwiegend ohne Erhebung eines zusätzlichen Beitrages (Frerich & Frey, 1996a).
Die zunächst nur auf die gewerblichen Arbeiter beschränkte Versicherungspflicht wurde schrittweise auch auf andere Wirtschaftszweige und Berufe ausgedehnt. So wurden 1885 das Transportgewerbe und die Staatsbetriebe einbezogen und 1892 die Handlungsgehilfen (die heutigen Angestellten). Zwar verdoppelte sich dadurch der Anteil der krankenversicherten Arbeitnehmer gegenüber den Anfängen der gesetzlichen Krankenversicherung, dennoch aber waren 1911 lediglich ca. 18 Prozent der Bevölkerung in ca. 2000 Krankenkassen versichert.
Hintergrund
Kein Zusammenhang zwischen Beitragshöhe und Leistungen
In der gesetzlichen Krankenversicherung bestand von Anfang an kein Zusammenhang zwischen Beitragshöhe und Art oder Umfang der Leistungen. Das für private Versicherungen typische „Äquivalenzprinzip“, nach dem sich der Beitrag nach der Art und dem Umfang der Versicherungsleistungen richtet, fand somit keine Anwendung. Die Beiträge der Krankenkassen wurden in Abhängigkeit vom Lohn und somit nach dem für das Steuerrecht maßgeblichen Leistungsfähigkeitsprinzip bemessen.
Dies galt auch für die Höhe des Krankengeldes. Es entspricht insofern nicht den historischen Tatsachen, wenn in Teilen vor allem der gesundheitsökonomischen Literatur behauptet wird, in den Anfängen der GKV habe auch dort das Äquivalenzprinzip gegolten, da sich die Höhe des Krankengeldes nach der Höhe des Beitrags gerichtet habe. § 6 des Krankenversicherungsgesetzes von 1883 schrieb ausdrücklich vor, Krankengeld sei „in Höhe der Hälfte des ortsüblichen Tagelohnes gewöhnlicher Tagearbeiter“ zu zahlen. Die Höhe des Krankengeldes war somit für alle GKV-Mitglieder eines Ortes einheitlich.
Dieser Punkt ist für die gegenwärtige und zukünftige gesundheitspolitische Diskussion insofern von Bedeutung, als die zitierte Behauptung einigen Akteuren der wissenschaftlichen Politikberatung zur Legitimierung der Forderung nach Einführung des Äquivalenzprinzips in die GKV dient. Da es sich um das zentrale Prinzip der privaten Versicherungswirtschaft handelt, zielt diese Forderung letztlich auf die Umwandlung der Krankenkassen in private Versicherungsunternehmen und somit auf die Abschaffung der GKV. Insofern erscheint der Hinweis auf die tatsächlichen Regelungen an dieser Stelle angebracht.
Ein weiterer Schritt zur Ausweitung der Versicherungspflicht erfolgte im Rahmen der Zu|25|sammenfassung der Rechtsvorschriften von Kranken-, Unfall- und Rentenversicherung in der Reichsversicherungsordnung (RVO) von 1911. Nach der Ausweitung der Versicherungspflicht auf land- und forstwirtschaftliche Arbeiter, Dienstboten und unständige Arbeiter (Tagelöhner) sowie das Wander- und Hausgewerbe war im Jahr 1913 ein Viertel der Bevölkerung in einer Krankenkasse versichert.
Die Gründung der gesetzlichen Krankenversicherung verbesserte nicht nur den Versicherungsschutz der Arbeitnehmer, sondern wirkte sich auch auf die Entwicklung des Gesundheitswesens positiv aus, vor allem weil sie die Einnahmen der Ärzte und Krankenhäuser auf eine breitere und verlässlichere Grundlage stellte.
Im Bereich der Krankenhausversorgung führte die Gründung der gesetzlichen Krankenversicherung und Ausweitung der Versicherungspflicht zu einem Ausbau der Versorgungskapazitäten (Jetter, 1973; Labisch & Spree, 2001). Da die Wurzeln der Krankenhäuser im mittelalterlichen Hospitalwesen und in der Armenfürsorge lagen und Hospitäler, die vor allem Arme und Bedürftige versorgten, keine Chance hatten, ihre Kosten von diesen vergütet zu erhalten, mussten sie sich zumeist aus Spenden oder öffentlichen Zuwendungen finanzieren. Um dem Risiko der Kostenunterdeckung zu begegnen, waren in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bereits in einigen Regionen Krankenhäuser dazu übergegangen, sogenannte Abonnementverträge oder Krankenhausversicherungen für Gesellen, Dienstboten und Arbeitsgehilfen anzubieten. Gegen die Entrichtung eines Beitrages erhielt die Gesellenvereinigung ein Belegrecht für eine bestimmte Zahl Betten oder der Dienstherr das Recht, seine Dienstboten im Krankheitsfall vom Krankenhaus versorgen und behandeln zu lassen. Für das Krankenhaus bot diese Konstruktion den Vorteil kontinuierlicher und halbwegs kalkulierbarer Einnahmen.
Insgesamt blieb die wirtschaftliche Situation der Krankenhäuser im 19. Jahrhundert jedoch ausgesprochen prekär, und sie waren weiterhin auf die Wohltätigkeit Einzelner und öffentliche Zuwendungen angewiesen. Erst die Einführung der gesetzlichen Krankenversicherung brachte die Wende, da nun ein vertraglich abgesicherter Kostenträger auch für die Behandlungskosten der unteren sozialen Schichten aufkam. In der Folge der Bismarck’schen Sozialgesetzgebung stieg dementsprechend die Zahl der Krankenhausbetten von 24,5 pro 10 000 Einwohner im Jahr 1877 auf 69,0 im Jahr 1913 (Frerich & Frey, 1996a).
Im Bereich der ambulanten ärztlichen Versorgung entwickelte sich Ende des 19. Jahrhunderts jedoch ein tief greifender Konflikt zwischen Krankenkassen und organisierter Ärzteschaft (Deppe, 1987; Zöllner, 1981). Die Krankenkassen hatten 1892 das Recht erhalten, in ihrer Satzung die Zahl der erforderlichen Ärzte für definierte Versorgungsbezirke festzulegen und mit Ärzten Einzeldienstverträge abzuschließen. Dem jeweiligen Arzt sicherte die einzelne Kasse im Gegenzug für die Behandlung der Versicherten die Vergütung der erbrachten Leistungen zu. Dieses System verbesserte die Einnahmesituation der niedergelassenen Ärzte und führte zu einem deutlichen Anstieg der Niederlassungen. Innerhalb weniger Jahre verdoppelte sich die Zahl der Ärzte von knapp 16 000 im Jahr 1885 auf ca. 32 000 im Jahr 1909.
Da mit der Zeit aber die Nachfrage der Kassen geringer war als die Zahl der niedergelassenen Ärzte, blieben zunehmend mehr Ärzte von der Versorgung der GKV-Versicherten ausgeschlossen. Daraus resultierten Auseinandersetzungen, die schließlich zur Gründung des ersten gewerkschaftlichen Kampfverbandes von Ärzten im Jahr 1900 führten („Verband der Ärzte Deutschlands“, Vorläufer des heutigen Hartmannbundes). Vor dem Hintergrund der zunehmend schärfer werdenden Auseinandersetzungen mit den Krankenkassen stieg seine Mitgliederzahl innerhalb weniger Jahre steil an, von knapp 700 im Jahr 1901 bis auf über 25 000 im Jahr 1913.
Zentrale Forderungen der Ärzteschaft waren die Zulassung aller Ärzte für die Behandlung |26|von GKV-Versicherten und die Ersetzung des Systems der Einzeldienstverträge durch ein System von Kollektivverträgen zwischen der organisierten Ärzteschaft und den Krankenkassen. Wurden die Auseinandersetzungen zunächst regional geführt, beispielsweise mit einem Leipziger Ärztestreik im Jahr 1905, so verlagerten sie sich schließlich auf die nationale Ebene und erreichten mit der Ankündigung und Vorbereitung eines ärztlichen Generalstreiks für das gesamte Reich ihren Höhepunkt.
Unter Vermittlung hoher Regierungsbeamter wurde schließlich Ende 1913 zwischen Krankenkassen und Ärzten das „Berliner Abkommen“ geschlossen (Käsbauer, 2015). Darin erreichte die Ärzteschaft, dass die Kassen nicht mehr allein über die Zulassung von Ärzten für die Behandlung von GKV-Versicherten entscheiden konnten und die Auswahl unter gleichberechtigter Mitwirkung der Kassenärzte zu erfolgen hatte. Es wurde gemeinsam eine Verhältniszahl für die Zulassung von Ärzten festgelegt (1 Arzt je 1350 Versicherte) und der Abschluss von Einzelverträgen bedurfte zukünftig der Zustimmung eines zu gleichen Teilen von Krankenkassen und Ärztevertretern besetzten Vertragsausschusses.
Mit dem Berliner Abkommen wurden wichtige Grundlagen des Systems der vertragsärztlichen Versorgung in Deutschland gelegt, die auch heute noch Gültigkeit haben (Verhältniszahlen für die Bedarfsplanung, gemeinsame Selbstverwaltung von Ärzten und Krankenkassen).
1.3 Die Weimarer Republik
Nach dem Zusammenbruch der Monarchie und dem Ende des Ersten Weltkrieges folgte die Weimarer Republik bei der Ausgestaltung und Weiterentwicklung der sozialen Sicherung im Krankheitsfall dem durch die Bismarck’sche Sozialgesetzgebung vorgegebenen Weg. In Artikel 161 der Weimarer Verfassung war die Gestaltung der Sozialversicherung ausdrücklich zur Aufgabe des neuen demokratisch verfassten Staates erklärt worden.
Durch Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit und Inflation verschlechterte sich in den ersten Jahren nach dem Krieg die wirtschaftliche Situation weiter Teile der Bevölkerung und insbesondere auch der vormals „Bessergestellten“. Um dem gestiegenen Bedarf an sozialer Absicherung im Krankheitsfall zu entsprechen, wurde der Kreis der Pflichtversicherten unter anderem auf Beschäftigte in öffentlichen Körperschaften, Hausgewerbetreibende sowie verschiedene Angestelltengruppen im sozialen Bereich ausgeweitet (Frerich & Frey, 1996a; Stolleis, 2003).
Im Rahmen der Schaffung einer Arbeitslosenversicherung als viertem Zweig des Sozialversicherungssystems wurden 1927 auch die Arbeitslosen in den Schutz der gesetzlichen Krankenversicherung einbezogen. Gegen Ende der Weimarer Republik war die gesetzliche Krankenversicherung schließlich soweit ausgebaut, dass sie fast die Funktion einer Volksversicherung erfüllte (Stolleis, 2003).
Im Jahr 1923 lief das auf zehn Jahre befristete Berliner Abkommen aus. Eine erneute Einigung zwischen Ärzteschaft und Krankenkassen auf dem Verhandlungsweg war nicht möglich. Es kam zu einem Ärztestreik, auf den Krankenkassen mit der Errichtung kasseneigener Ambulatorien zur Versorgung ihrer Versicherten reagierten (Deppe, 1987; Zöllner, 1981).
Um die Situation zu befrieden, griff die Regierung ein und übernahm die Regulierung auf dem Verordnungsweg. Durch eine Verordnung vom 30. Oktober 19236 wurden die wesentlichen Inhalte des Berliner Abkommens in staatliches Recht übernommen und das System der kassenärztlichen Versorgung durch einen Ausbau der gemeinsamen Selbstverwaltung weiterentwickelt (Peters, 1974; Stolleis, 2003).
Es wurde ein gemeinsam von Ärzten und Krankenkassen zu besetzender Reichsausschuss für Ärzte und Krankenkassen gebil|27|det, der mit rechtsetzender Befugnis ausgestattet war und vor allem die Aufgabe hatte, Richtlinien für die Arztverträge und die Zulassung von Ärzten zu erarbeiten. Für die Schlichtung von Streitigkeiten wurden paritätisch besetzte Schiedsämter geschaffen. Damit waren zwei weitere charakteristische Merkmale des deutschen Gesundheitssystems entstanden.
Aus dem Reichsausschuss wurde in den 1950er-Jahren der „Bundesausschuss für Ärzte und Krankenkassen“, der 2004 in den „Gemeinsamen Bundesausschuss“ umgewandelt wurde. Der Gemeinsame Bundesausschuss nimmt eine zentrale Position im GKV-System ein, nicht zuletzt weil er über die Konkretisierung und Weiterentwicklung des Leistungsrechts unterhalb der Ebene der Gesetzgebung entscheidet. Die Institution des Schiedsamtes lebt in den an zahlreichen Stellen des deutschen Gesundheitswesens arbeitenden Schiedsstellen weiter, die als zentrales Instrument der Konfliktregulierung und des Interessenausgleichs dienen.
Nach erneuten Auseinandersetzungen zwischen Ärzteschaft und Krankenkassen wurde in den Jahren 1930–1932 das System der kassenärztlichen Versorgung in mehreren Verordnungen weiter reguliert und erreichte nach einer Notverordnung im Jahr 19327 schließlich die Organisationsform, die auch heute noch weitgehend gilt (Peters, 1974; Stolleis, 2003).
Das bis dahin geltende System von Einzeldienstverträgen zwischen Krankenkassen und Ärzten wurde durch ein Kollektivvertragssystem ersetzt und es wurde die Institution der auf Landesebene zu bildenden Kassenärztlichen Vereinigung geschaffen. Verhandlungspartner der Krankenkassen war nicht mehr der als zivilrechtlicher Verein organisierte Hartmannbund, sondern die als Körperschaft des öffentlichen Rechts verfasste Kassenärztliche Vereinigung (KV). Sie hatte nicht nur die Aufgabe, die Interessen der Ärzte gegenüber den Krankenkassen zu vertreten, sondern auch nach innen in die Ärzteschaft hinein zu agieren und staatliche Aufsichtsfunktionen wahrzunehmen. Ärzte, die an der Kassenärztlichen Versorgung teilnehmen wollten, mussten Mitglied der KV werden und erhielten dafür den Anspruch auf Mitwirkung an der ambulanten Behandlung von Versicherten und Vergütung ihrer Leistungen.
Die Kassenärztlichen Vereinigungen wurden alleiniger Vertragspartner der Krankenkassen und schlossen mit ihnen Gesamtverträge für die Vergütung aller ärztlichen Leistungen ihres Bezirks ab. Die einzelne Kasse zahlte ihren Anteil an der Gesamtvergütung in Form einer Kopfpauschale für jeden Versicherten an die Kassenärztliche Vereinigung, und war damit von allen Vergütungsforderungen des einzelnen Arztes freigestellt. Es war Aufgabe der Kassenärztlichen Vereinigung, die Gesamtvergütung an die einzelnen Kassenärzte zu verteilen. Der Vergütungsanspruch des einzelnen Arztes richtete sich somit nicht an die Kassen, sondern an die KV.
Im Gegenzug für dieses Monopol wurde den Kassenärztlichen Vereinigungen der Sicherstellungsauftrag für die ambulante ärztliche Versorgung der Kassenpatienten übertragen. Sie sind seitdem für eine ausreichende ambulante ärztliche Versorgung verantwortlich und tragen den Kassen gegenüber die Gewähr für eine wirtschaftliche Verwendung der Mittel. Die Regelung der Zulassung von Kassenärzten ging auf die Kassenärztlichen Vereinigungen über und die Versicherten erhielten die freie Arztwahl unter allen zugelassenen Kassenärzten.
1.4 Die nationalsozialistische Diktatur
Ab Anfang 1933 wurde innerhalb weniger Monate die nationalsozialistische Diktatur errichtet. Was vielfach als „Machtergreifung“ bezeichnet wurde und wird, war jedoch eine weitgehend legale „Machtübergabe“, organisiert und unter|28|stützt von konservativen oder rechtsgerichteten Teilen der politischen Klasse. Die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler erfolgte mit Unterstützung der rechtsgerichteten Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) und der konservativen Zentrumspartei und die wichtigsten Rechtsgrundlagen für die Diktatur wurden durch Notverordnung des Reichspräsidenten Hindenburg geschaffen oder mit Zustimmung der konservativen Parteien im Reichstag beschlossen8. Zentrale Meilensteine bei der Errichtung der NS-Diktatur waren die Einschränkung der Presse- und Versammlungsfreiheit durch eine Notverordnung vom 4. Februar 1933 und vor allem das Ermächtigungsgesetz vom 24. März 1933. Durch das Ermächtigungsgesetz wurde die Regierung ermächtigt, Gesetze ohne Zustimmung des Reichstages zu erlassen, auch solche, die im Widerspruch zur Verfassung standen. Damit waren die maßgeblichen Rechtsgrundlagen für den Ausnahmezustand geschaffen. Noch im selben Jahr wurden die Gewerkschaften zerschlagen und wurde die SPD verboten. Die verbliebenen bürgerlich-konservativen Parteien wurden zur Selbstauflösung gezwungen und Mitte 1933 wurde der Einparteienstaat proklamiert.
Die ersten gesundheitspolitischen Maßnahmen der NS-Regierung dienten der Ausschaltung politischer Gegner bei den Trägern der Sozialversicherung. Auf Grundlage zweier, im April und Mai 1933 erlassener Gesetze9 wurden zunächst Tausende jüdischer, sozialdemokratischer und gewerkschaftlich engagierter Angestellter der Krankenkassen entlassen und die freiwerdenden Stellen mit Mitgliedern der NSDAP besetzt (Stolleis, 2003). Nach der „Säuberung“ der Krankenkassen wurde 1934 deren Selbstverwaltung beseitigt. Durch ein sogenanntes Aufbaugesetz10 wurden die bisherigen Selbstverwaltungsgremien abgeschafft. Die Leitung der Krankenkassen wurde entsprechend dem „Führerprinzip“ einzelnen, von der zuständigen Aufsichtsbehörde eingesetzten Personen übertragen, bei denen es sich in der Regel um „verdiente Parteigenossen“ handelte.
Die Spitzenverbände der organisierten Ärzteschaft vollzogen bereits kurz nach der Machtübernahme eine freiwillige „Gleichschaltung“ mit dem NS-Regime (Deppe, 1987). Mitte 1933 wurden „nicht arische“ und kommunistische Ärzte von der kassenärztlichen Versorgung ausgeschlossen und 1938 wurde jüdischen Ärzten schließlich auch die Approbation entzogen.
Die Parteiprogrammatik der NSDAP hatte eigentlich die Abschaffung der gegliederten Sozialversicherung und Schaffung einer Einheitsversicherung vorgesehen. Dies hätte allerdings für zahlreiche Parteimitglieder den Verlust ihrer soeben neu übernommenen Stellen in der Sozialversicherung bedeutet. Zudem war die NS-Regierung mangels eigener Fachkompetenz auf den Sachverstand der Beamten des Reichsarbeitsministeriums angewiesen, bei denen es sich weit überwiegend um Befürworter des gegliederten Systems Bismarck’scher Tradition handelte. Vor diesem Hintergrund wurde das Ziel einer Einheitsversicherung nicht weiter verfolgt (Stolleis, 2003), sondern das übernommene System weiterentwickelt und in Teilbereichen ausgebaut.
1937 wurden die Ersatzkassen, die immer noch in der Tradition der Hilfskassen standen und Krankenversicherungsschutz nur subsidiär zur gesetzlichen Krankenversicherung gewährten, in Körperschaften des öffentlichen Rechts umgewandelt und zu Trägern der gesetzlichen Krankenversicherung (Peters, 1974). Damit ver|29|bunden erfolgte eine strikte Trennung in Ersatzkassen für Angestellte und Ersatzkassen für Arbeiter. Die bestehenden Verbände der Krankenkassen (Reichskassenverbände) wurden ebenfalls in Körperschaften des öffentlichen Rechts umgewandelt und in Reichsverbände umbenannt.
In der NS-Zeit wurde der Kreis der Pflichtversicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung erweitert. 1938 wurden eine Reihe von Selbstständigen, wie beispielsweise selbstständige Lehrer, Artisten etc., in die Sozialversicherung aufgenommen, und 1941 erfolgte die Schaffung einer Krankenversicherung der Rentner (KVdR)11. Bis 1941 waren Rentenempfänger der gesetzlichen Rentenversicherung nicht automatisch Mitglied der gesetzlichen Krankenversicherung. Wollten sie nach dem Ausscheiden aus der Erwerbstätigkeit weiterhin Mitglied der GKV bleiben, so war dies nur im Rahmen einer freiwilligen Mitgliedschaft möglich (Solcher, 1975).
Die gegenüber den Beiträgen der Pflichtmitglieder höheren Beiträge für freiwillige Mitglieder konnten allerdings nur wenige Rentner aufbringen, und so war der überwiegende Teil der Rentner ohne soziale Absicherung im Krankheitsfall (ebd.). Durch die Neuregelung wurden alle Bezieher von Renten der gesetzlichen Rentenversicherung Mitglied der GKV und somit auch ihre Angehörigen (v. a. Ehegatten) im Rahmen der Familienversicherung in den Schutz der GKV einbezogen. Die Durchführung der KVdR gehörte zu den Aufgaben der Krankenkassen, die dafür von der Rentenversicherung einen Pauschalbetrag je versicherten Rentner erhielten (Frerich & Frey, 1996a; Solcher, 1975).
Wie bereits erwähnt, war die Weiterführung der Traditionslinie der Bismarck’schen Sozialversicherung nicht Ausdruck einer konzeptionell geschlossenen nationalsozialistischen Sozialpolitik, sondern in erster Linie Ergebnis der personellen Kontinuität im Beamtenapparat des Reichsarbeitsministeriums (Stolleis, 2003). Mangels eigener Fachleute beschäftigte die NS-Regierung die zuständigen Fachbeamten der vorherigen Regierungen weiter, sofern sie nicht wegen ihrer politischen Überzeugungen oder als „nicht arisch“ entlassen wurden.
Der verbrecherische Charakter der nationalsozialistischen Diktatur zeigte sich im Gesundheitswesen nicht nur bei der Entlassung und Verfolgung jüdischer und politisch andersdenkender Beschäftigter im Gesundheitswesen, sondern insbesondere bei der Misshandlung und Ermordung behinderter Menschen, im Nazi-Jargon als „lebensunwertes Leben“ bezeichnet. Mit dem „