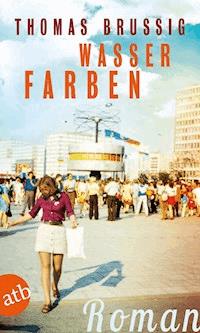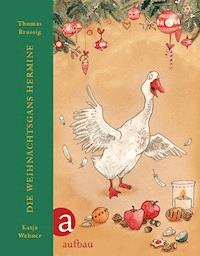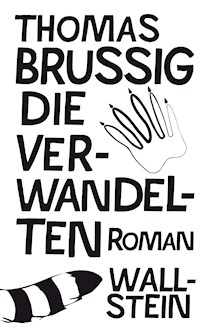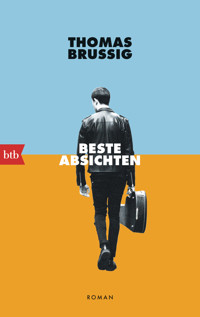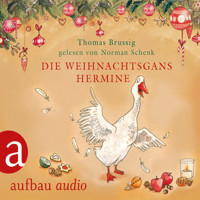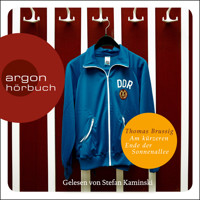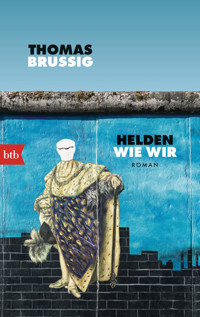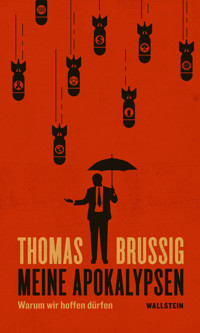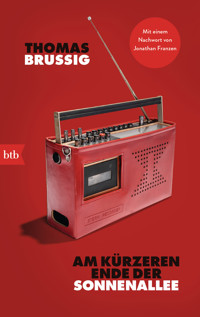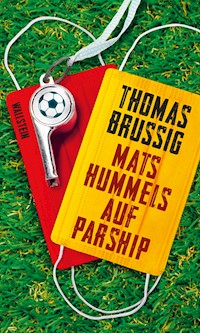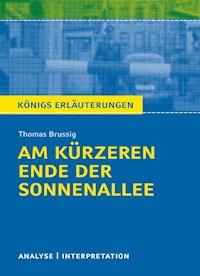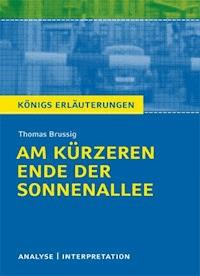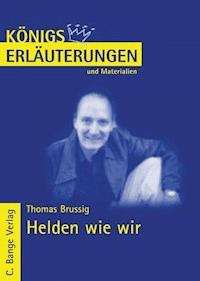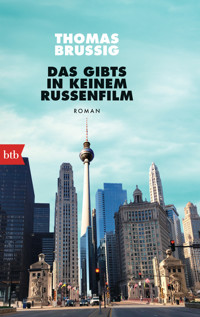
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein zutiefst komisches und wahnwitzig ernsthaftes Spiel über eine DDR, in der die Mauer bis heute nicht gefallen ist - von Spiegel-Bestsellerautor Thomas Brussig.
1991 erscheint in der DDR der erste Roman von Thomas Brussig. Auf einer Lesung lässt er sich zu einer pathetischen Rede hinreißen: Solange es nicht alle können, wird auch er keine Reise in den Westen unternehmen! Solange nicht jeder eines haben kann, wird auch er kein Telefon haben! Und, weil erst drei Versprechen magisch binden: Solange es verboten ist, will auch er niemals ›Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins‹ lesen! Das macht ihn schlagartig berühmt. In den folgenden Jahren wird er, der eigentlich ein kleiner Feigling ist, für einen Dissidenten gehalten, er soll Olympiabotschafter für Berlin werden, knutscht im Harz unter Eiffeltürmen aus Holz, findet sich in eine Stasi-Affäre verwickelt und beeinflusst mit seinem Schreiben und seiner Guerilla-Statistik die öffentliche Meinung im Osten wie im Westen. Doch die DDR hält sich – bis heute.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
1991 erscheint in der DDR der erste Roman von Thomas Brussig. Auf einer Lesung lässt er sich zu einer pathetischen Rede hinreißen: Solange es nicht alle können, wird auch er keine Reise in den Westen unternehmen! Solange nicht jeder eines haben kann, wird auch er kein Telefon haben! Und, weil erst drei Versprechen magisch binden: Solange es verboten ist, will auch er niemals ›Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins‹ lesen! Das macht ihn schlagartig berühmt. In den folgenden Jahren wird er, der eigentlich ein kleiner Feigling ist, für einen Dissidenten gehalten, er soll Olympiabotschafter für Berlin werden, knutscht im Harz unter Eiffeltürmen aus Holz, findet sich in eine Stasi-Affäre verwickelt und beeinflusst mit seinem Schreiben und seiner Guerilla-Statistik die öffentliche Meinung im Osten wie im Westen. Doch die DDR hält sich – bis heute.
THOMAS BRUSSIG, 1964 in Berlin geboren, hatte 1995 seinen Durchbruch mit »Helden wie wir«. Es folgten u. a. »Am kürzeren Ende der Sonnenallee« (1999), »Wie es leuchtet« (2004) und »Das gibts in keinem Russenfilm« (2015). Seine Werke wurden in über 30 Sprachen übersetzt. Thomas Brussig ist der einzige lebende deutsche Schriftsteller, der mit einem seiner literarischen Werke wie auch mit einem Kinofilm und einem Bühnenwerk ein Millionenpublikum erreichte.
Thomas Brussig
Das gibts in keinem Russenfilm
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Ausgabe Mai 2024
btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Copyright © 2015 Thomas Brussig
Covergestaltung: buxdesign | Ruth Botzenhardt unter Verwendung eines Motivs von Kathrin Brussig (Chicago Skyline) und Freepic
cb · Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-31004-2V001
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/penguinbuecher
Dies ist ein Roman. Zahlreiche Romanfiguren sind mit den Namen realer Menschen bezeichnet. Die Äußerungen und Taten der Romanfiguren mit den bekannt klingenden Namen sind meines Wissens Erfindungen des Autors. Anders gesagt: Wenn Du, lieber Leser, Dich beim Lesen hin und wieder fragst »Hat derundder etwa wirklich ...?«, dann möge in Deinem Kopf als Echo mit meiner Stimme die Antwort erschallen »Nö, dis hab ich mir bloß ausgedacht.«
VORWORT
oder Die Erinnerung ist eine olle Kommode
(2014)
Wer nicht ertragen will, daß ein Leben vom Zufall gestaltet wird, kann sich gleich die Kugel geben. Du kommst mit dem Rad von der Arbeit, willst über die Baustelle abkürzen, übersiehst einen Nagel, hast nen Platten und mußt am nächsten Tag die S-Bahn nehmen, wo du einen alten Bekannten triffst, der dir sagt, in seiner Firma suche man gerade jemanden. Du bewirbst dich, wirst genommen und triffst die Frau deines Lebens. Hättest du den Nagel gesehen und wärest ihm mit einer winzigen Armbewegung ausgewichen, dann wärest du nicht nur einem Nagel, sondern zugleich dem Job, der Frau, drei Kindern und sieben Enkelkindern ausgewichen. Das Leben ist mit Zufällen gespickt, doch wir schreiben Lebensläufe.
Meine Erinnerungen sind wie der Inhalt einer alten Kommode, die Jahrzehnte auf dem Dachboden stand. Da gibt es Stücke, die nehme ich gern wieder in die Hand, anderes streift nur der Blick, und es verbleibt unberührt in der Schublade. Dann gibt es das gut verschnürte Päckchen, von dem ich genau weiß, was sich in ihm befindet, weshalb ich es auch nicht öffne. Hinterher ist die Unordnung sowieso größer, wie meistens, wenn ich »mal Ordnung schaffen« will.
Und weil ich eine Schwäche fürs Beschriften, Ordnen, Katalogisieren habe, kann ich sofort die Schublade ›20. August 1991‹ aufziehen. Dich, lieber Leser, interessiert sowieso nur diese eine Episode, »die mit dem Versprechen« – so wie dich bei Van Gogh auch nur eine Geschichte interessiert, »die mit dem Ohr«.
Ich erinnere mich nur noch selten an jenen 20. August 1991, an dem ich mein »babylonisches Versprechen« abgab. Aber jetzt, vor der Kommode mit meinen Erinnerungen, kann ich nicht widerstehen, dieses Erinnerungsstück herauszunehmen.
In jenen Wochen war vieles neu und aufregend. Ich trat in das erträumte Leben eines Schriftstellers ein, wurde fotografiert, sprach in Mikrophone, redete mit den Westmedien. Ich war auf »Experiment« gestimmt, auf »Wie lebt es sich so?«, auf »Wie fühlt sich das an?« »Wie ist es, mit einem Saal von sechshundert Leuten zu spielen, ihm Jubel, Gelächter, Applaus zu entlocken?« (Mein babylonisches Versprechen hatte auch mit Übermut zu tun.) Noch ein Jahr zuvor hätte ich selbst dort unten im Babylon sitzen und einem anderen Schriftsteller zuhören können. Eben war ich noch mit allen gleich, jetzt war ich es nicht mehr. Jetzt war ich es, der auf der Bühne saß. Diese Veränderung ängstigte mich. Und als ich nach meinen Privilegien als Schriftsteller gefragt wurde, rief ich: »Ich verspreche heute, daß ich erst in den Westen fahren werde, wenn jeder in den Westen fahren kann! Ich verspreche ...« Hier mußte ich unterbrechen, weil alle schrien und johlten. »Ich verspreche, daß ich erst dann ein Telefon haben werde, wenn jeder ein Telefon haben kann!« Hier schrien die Leute wieder, so daß ich Zeit gewann, um mir ein weiteres Versprechen zu überlegen und auf die magische Zahl Drei zu kommen. »Und ich verspreche, daß ich erst dann ›Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins‹ lesen werde, wenn jeder sie lesen kann.« Warum ausgerechnet dieses Buch? Ich hätte auch ›Der Archipel Gulag‹ sagen können, aber es waren schließlich Frauen im Saal, oder ›1984‹, doch den Orwell kannte ich schon, und ein Versprechen abzugeben, das schon gebrochen ist, wenn es über die Lippen kommt, also bitte, bin ich Politiker?
Ich ahnte nicht, daß mir dieser Moment ein Markenzeichen verschafft. Wie naiv war ich eigentlich? Immerhin war das Westfernsehen dabei. So wurde ich zu dem, der ich am wenigsten werden wollte, nämlich zu einem Schriftsteller, der nicht durch seine Bücher bekannt wurde, sondern durch seine Taten, genauer: seine Un-Taten, nämlich nicht zu westreisen, nicht zu telefonieren und ein bestimmtes Buch nicht zu lesen.
Mein Vater, der am liebsten Biographien liest, gab mir einen Tip, als ich ihm von meinem Vorhaben erzählte. »Was ist das Leben? Situationen wie diese: Du stehst im Fahrstuhl, jemand steigt ein, drückt die Sieben. Ihr wechselt kein Wort miteinander, und der Jemand steigt in der Siebten aus. Schreibst du darüber? Natürlich nicht. Es sei denn, der Jemand war Einstein. Dann muß das rein.«
Aber ich war nie mit Einstein im Fahrstuhl, und ich werde sowieso immer nur »der mit dem Versprechen« bleiben. Und als der werde ich in meinen Erinnerungen kramen, wie es sich mit diesem Versprechen gelebt hat.
Es war ein Junge und sie nannten ihn Thomas
(1964–1987)
Vom Tag meiner Geburt habe ich klare Vorstellungen. Wir befinden uns in einer Zeit, als Straßenränder eine einzige Parklücke waren, als Telefone noch klingelten und Scheuerlappen mit bloßen Händen ausgewrungen wurden. In der Berliner Esmarchstraße lag am Morgen des 19. Dezember 1964 der erste Schnee. Meine Oma, die jeden Helene-Weigel-Ähnlichkeitswettbewerb gewonnen hätte, ging kettenrauchend (Salem rot) durch die Zimmer ihrer Altbauwohnung und schaute abwechselnd auf das leere Kinderbettchen im Zimmer meiner Eltern und auf das schwarze Telefon aus Bakelit. Ihr Sohn Maximilian, der einen lebenslangen, aber letztlich vergeblichen Kampf gegen seinen Spitznamen Mäxchen führte, rüstete sich für die Babyfotowelle, indem er in seiner Dunkelkammer die Chemikalien immer wieder neu sortierte. Seine Verlobte Renate machte das, was sie immer machte, wenn sie nahe daran war, die Nerven zu verlieren: Sie ging in die Küche und wuchs über sich hinaus. So kurz vor Weihnachten war wildes Drauflosgebacke nicht mal anstößig. Und dann gab es noch die Haushaltshilfe, eine herzensgute Nachbarin aus dem Nebenhaus, welche durch unablässiges Keine-Panik!-Es-wird-schon-schiefgehen!-Gequassel glaubte, zur Beruhigung beizutragen.
Dann klingelte das Telefon. Mein Onkel, der den weitesten Weg hatte, meine Oma, die schon über sechzig war, und meine Tante, die erst den Schneebesen fallen lassen mußte, eilten zum Telefon. Ein offenes Rennen, nur die Haushaltshilfe, die im Wischeimer-Geschepper das Klingeln überhörte, war chancenlos. Es gab Rempeleien, die am letzten Türrahmen zu erbitterten Positionskämpfen ausarteten, bevor die teigverschmierte Hand meiner Tante als erstes zum Hörer griff. Am anderen Ende war mein Vater, welcher die Geburt eines Thomas vermeldete. Thomas war damals groß in Mode, neben Andreas, Frank, Martin und Ralf. Auch Michael, Matthias und Stefan wurden gern vergeben – letzterer an meinen Bruder, der vier Jahre später kam. Aber diesmal war es ein Thomas.
Drei Tage später kam mein Liebmütterlein nach Hause – ohne mich. »Ja, wo isser denn, unser kleiner Fratz?« »Könn wir ihn mal sehen?« – »Nö, ich mußt ihn dalassen«, sagte mein Liebmütterlein. Tatsächlich wurde sie nach Hause geschickt, Weihnachten feiern, während ich auf Betreiben der resoluten Oberschwester Marianne nicht entlassen wurde, wegen Untergewicht. »Was solln denn die Leute von unserm Krankenhaus halten, wenn wir so n Magerfleisch entlassen? Der Junge braucht n bißchen Speck auf die Rippen, das sieht doch nicht aus!«
Der Junge bekam aber kein Speck auf die Rippen. Noch zu meinem ersten Geburtstag lieferte die Waage so verstörende Ergebnisse, daß ich mit gelben Früchten gefüttert werden sollte, sogenannten »Bananen«. Die Kinderärztin stellte jede Woche ein Rezept über »3 Bananen« aus und schickte meinen Vater zu einem ominösen Stand in der Berliner Markthalle, dessen Schaufensterscheiben mit Zeitungspapier blind gemacht waren. Mein Vater klopfte an die Scheibe. Die öffnete sich einen Spalt. Eine Hand kam zum Vorschein. Mein Vater, der sich wie in einem Agentenfilm fühlte, übergab wortlos das Rezept und einen Stoffbeutel – und eine Minute später erhielt er den Beutel gefüllt zurück. Es gelang ihm nie, einen Blick darauf zu erhaschen, was sonst noch hinter diesen Scheiben gelagert wurde, aber zweifellos waren es Geschichten wie diese, die dazu führten, daß man sich »in der Republik« erzählte, »die Berliner« bekämen »es vorn und hinten reingeschoben«, gar »alles in den Arsch geblasen«.
Meine erste Erinnerung: Wars, daß mir Herr Schiffling aus dem Parterre zeigte, wie er seine Beinprothese ab- und anschnallt? Oder die fünf Katzenbabies bei unserer Nachbarin, deren Minka gejungt hatte? Oder wie mich das Drogeristenpaar Pfeifahrer, das »selber keine Kinder« hatte, hinter die Ladentheke holte, und mir, wenn ein Kunde seinen Wunsch mitteilte, zeigte, welche Schublade ihres wandfüllenden Apothekenschrankes ich aufziehen sollte? Daß mich die Opernsängerin Keumich vom ersten Stock zuschauen ließ, wie ihr Flügel gestimmt wurde, oder daß mich einmal sogar ein paar Grünpfleger auf der Ladefläche ihrer Ameise mitnahmen? Nein, das war erst später, nämlich an dem Tag, als wir umzogen – aus dem Bötzowviertel in Prenzlauer Berg direkt an den Alexanderplatz in die Rathausstraße 7, den Fernsehturm vor dem Fenster. Es war so was wie der Sechser im Lotto. Meine Eltern bekamen nach sechs Jahren Ehe, kurz vor meiner Einschulung, eine eigene Wohnung. Einen Fahrstuhl gab es und sogar einen Müllschlucker! Alles war so toll, daß ich gar nicht darum herumkam, mir vorzustellen, wie die Rathausstraße wohl entworfen wurde: Sieben Männer mit Schlips, Parteiabzeichen und Bauarbeiterhelmen sitzen an einem Tisch, eine Frau führt Protokoll. Einer sagt: »Genossen, was wissen wir über die Bedürfnisse unserer Menschen?« Ein anderer sagt: »Wir wissen alles darüber«, worauf der erste sagt: »Ich höre.« Dann sagt einer: »Unsere Werktätigen möchten zum Feierabend gesellig miteinander Bowling spielen«, worauf der erste sagt: »Dann bauen wir ihnen eine, nein, zwölf Bowlingbahnen.« Ein anderer sagt: »Unsere Menschen möchten sich auch knusprig gegrilltes Hähnchenfleisch einverleiben«, und der erste notiert sich »Broilerbar bauen«. Dann sagt auch die Protokollführerin etwas, nämlich »Daß auch unsere Frauen mal mit ihren Männern bummeln möchten«, worauf sich die Runde darauf einigt, daß so ein bummelndes Paar vor einer Schmuckvitrine ausrechnen sollte, nach wieviel Nachtschicht-Zulagen an die brilliantbesetzten Ohrstecker zu denken ist. Schließlich redet die ganze Runde durcheinander, die Protokollführerin kommt kaum noch hinterher. Nostalgische Witwen sollen im »Café Rendezvous« plauschen und in der Espressobar sollen alte Bekannte, die sich zufällig in den Passagen treffen, einen Kaffee trinken können. Und dann sind sie aufgestanden und haben die Rathausstraße gebaut, mit Mode-, Schuh- und Delikatessläden, mit einer Weinstube, einem Musikalien- und einem Sportgeschäft, mit Broilerbar, Juwelier, Kaffeehaus, Post, Arztpraxen, Bowlingbahn, Espressobar, und und und. Hier funktioniert die DDR so, wie sie mal gemeint war: Als Bedürfnis- und Beglückungsanstalt für jedermann. Ohne allgemeine Morgengymnastik, aber mit umsonst Zentralheizung. Die Megaphone, die an die Laternen geschraubt waren, quäkten nur am 1. Mai und zum Republikgeburtstag. Dazwischen schwiegen sie.
Gerade mein Vater war sehr stolz auf die Wohnung. Jeder Besucher wurde von ihm ans Fenster gebeten, um erst einmal, am besten bei einem Cognac, das Panorama zu bewundern. Was wir jeden Tag vom Fenster aus sehen konnten, wurde in den Läden als Ansichtskarten verkauft: Fernsehturm, Neptunbrunnen, Bahnhof Alexanderplatz, Weltzeituhr, Centrum Warenhaus, Hotel Stadt Berlin. Und diese Karten wurden in die ganze Welt verschickt, nach Warschau, Prag und sogar nach Moskau! Darauf Prost! (Und dann kam die Flasche wieder in den Schrank.)
Der neue Nachbar allerdings war ein verkniffener Aktentaschenträger. Anstatt »Ja« sagte er »Nu«. Andere Nachbarn gaben obskure Behörden als ihre Arbeitsstätte an, und es kam selten vor, daß ich in fremde Wohnungen gelassen wurde. Mein Vater hingegen ging in einen »Betrieb«, da gab es »Kollegen« und »Stahlträger«. Pünktlich um zehn nach halb fünf kam er nach Hause, legte sich mit dem ›Neuen Deutschland‹ aufs Sofa, und zehn Minuten später war er eingeschlafen. Mein Bruder und ich wußten nie, ob das geschah, weil die Arbeit so anstrengend oder die Zeitung so langweilig war.
Unter uns wohnte ein Sattlermeister mit seiner Frau. Obwohl in seiner Wohnung Parties stattfanden, bei der kreischende barbusige Frauen am Fenster gesichtet wurden, war er zu uns Kindern immer nur mürrisch. Als der ›Eulenspiegel‹ über einen hochnäsigen »Sattlermeister Peter P.« berichtete, waren sich meine Eltern sicher, daß damit er gemeint war. Einmal wartete ich im Erdgeschoß mit meinem Vater auf den Fahrstuhl, gemeinsam mit einem der vielen Aktentaschenträger des Hauses. Daß ein Fahrstuhl kam, hörten wir am Gesang, der sich über den Fahrstuhlschacht näherte. Zu einer Melodie, die ich Jahre später als den Uriah-Heep-Song ›Lady in Black‹ wiedererkannte, sang jemand: »Nur fünfzehn Meter im Quadrat/Minenfeld und Stacheldraht/jetzt weißt du, wo ich wohne/ich wohne in der Zone.« Als ein unglaublich dramatisches »Ah-a-ha-ahaha-aaha – Aaaah-a-ha-aahaha« erscholl, öffnete sich die Fahrstuhltür, und heraus kam der unter uns wohnende Sattlermeister, der sofort verstummte und das Weite suchte. Im Fahrstuhl fragte der Aktentaschenträger meinen Vater: »Wissen Sie, wer das war?«, und mein Vater sagte, ohne mit der Wimper zu zucken: »Sicher nur n Besoffner, der mal wissen wollte, wies hier aussieht.«
Ich fand das nicht schlimm, daß mein Vater schwindelte, denn ich hatte schon mal eine Erwachsene aus unserem Haus beim Schwindeln erwischt, nämlich Ilka Lux. Sie war Schlagersängerin, unbeschreiblich blond und trug sogar im November Sonnenbrille. Einmal kam sie im Radio: »Reitersmann,/halt deinen Schimmel an,/du siehst es mir doch an,/daß ich nicht mehr laufen kann.« Von wegen! Wenn sie vom Fahrstuhl zu ihrer Wohnung ging, konnte ich sie den langen Gang hinuntergehen sehen, mit weißen Stilettos und Minirock. Aber zugegeben: Als ein Reitersmann würde ich meinen Schimmel für sie anhalten und ihr in den Sattel helfen.
Bald wurde ein weiterer Nachbar berühmt, Herr Hagen. Er wurde berühmt, hausberühmt, als der – geschiedene – Vater von Nina Hagen. Ein Gentleman, ruhig, freundlich, graumelierte, aber volle und auf lässig frisierte Haare. Würdige, niemals angestrengte Haltung. Immer wie aus dem Ei gepellt. Wenn sich George Clooney sein Image bei jemandem abgeguckt hat, dann bei ihm. Nina sah ich einmal in der Rathausstraße 7. Auch sie trug Sonnenbrille, aber ich erkannte sie trotzdem. Sie suchte an den Briefkästen nach dem Namen Hagen, und weil die Numerierung der 126 Wohnungen unseres Hauses gewöhnungsbedürftig war, sagte ich, daß ich sie bringe. Mir entging nicht, wie aufgeregt sie war. Sie nahm die Brille ab, setzte sie wieder auf und zupfte sich im Fahrstuhl ständig die Kleidung zurecht. Ihr Vater war allerdings nicht da, und sie fragte mich, was man hier macht, wenn jemand nicht da ist. Ich sagte, man setzt sich auf die Treppe und wartet, und weil sie unschlüssig war, setzte ich mich, um ihr vorzumachen, daß die Treppen sauber sind. Sie setzte sich neben mich, und dann erzählte sie mir alles über ihren Vater – was sie von ihrer Mutter über ihn wusste, warum ihre Eltern sich getrennt hatten, warum sie ihn so lange nicht gesehen hat und warum sie ihn jetzt aber sehen wollte. Ich wollte von ihr lieber Geschichten hören, wie es ist, wenn man berühmt ist und ins Fernsehen kommt, aber sie sagte, daß das mit ihrem Vater wichtiger ist, viel wichtiger als dieses ganze »Berühmtheitstrallala«. Ich mußte ihr allerdings versprechen, daß ich alles für mich behalte, so lange sie lebt, auch für den Fall, daß sie zwischendurch weltberühmt wird, »wat ick durchaus vorhab, meen Freundchen«. Für mich war sie schon in jenem Moment so berühmt, daß es nicht noch mehr gebraucht hätte. Gerade erst war sie mit »Du hast den Farbfilm vergessen« im ›Kessel Buntes‹ aufgetreten! Wir saßen zwei Stunden auf der Treppe, ohne daß Ninas Vater kam, und dann brachte ich Nina wieder zum Fahrstuhl. – Natürlich habe ich mir diese Szene nur ausgedacht, aber jedesmal, wenn ich Ninas Vater sah, sprang meine Phantasie an und feilte weiter an der Szene, in der mir Nina Hagen in meinem Haus, der Rathausstraße 7, in die Arme läuft.
Bis zum Schulbeginn war die einzige stressige Forderung »Aufessen!«, aber nachdem ich eingeschult worden war, schloß ich mit einem neuen Wort ausführlich Bekanntschaft: »Orntlich«. Ich sollte orntlich sitzen, orntlich schreiben, meine Sachen orntlich halten, orntlich in der Reihe gehen und auch ein orntliches »Hoppi« haben. Altstoffsammeln ging als solches durch. Zu Beginn des Nachmittags beratschlagte ich mit meinen Freunden, ob wir die Neubauten oder aber die Altbauten jenseits des S-Bahn-Bogens abgrasen wollen. In den Neubauten war nicht nur die Zeitungsausbeute größer, weil das in den Neubauten häufig gelesene ›Neues Deutschland‹ großformatiger und demzufolge schwerer war als die in den Altbauten verbreitete »Berliner Zeitung«, es wurde unter den Aktentaschen- und Schlipsträgern der Neubauten auch heimlich gesoffen, was sich in einer höheren Ausbeute an leeren Schnaps- und Weinflaschen niederschlug. Allerdings war in den Altbauten die nächste Altstoff-Annahmestelle immer gleich um die Ecke, während die Entscheidung für die altstoffmäßig ergiebigeren Neubauten immer eine erbärmliche Schlepperei am Ende des Nachmittags bedeutete. Um meine Freunde aufzumuntern, behauptete ich, daß uns das Altstoffsammeln schneller aus dem Sozialismus in den Kommunismus bringt. »Um wie viel schneller?« lautete die logische Frage von Sandro Hüppenlenk, und ich überlegte. Ich wollte meine Autorität nicht durch eine unglaubwürdige Antwort aufs Spiel setzen, also sagte ich: »Um zehn Minuten. Für jedes Mal Altstoffe sammeln kommt der Kommunismus zehn Minuten eher.« Für Sandro Hüppenlenk lag der Fall klar: »Den ganzen Nachmittag versauen, für zehn Minuten? Das lohnt nicht.« Zumal der Sozialismus nun auch nicht so schrecklich war, daß wir ihn auf Teufel komm raus hinter uns lassen wollten. Auch die anderen, und schließlich sogar ich fanden, daß es egal ist, ob der Kommunismus zehn Minuten früher oder später kommt, da er doch, wie uns versprochen war, irgendwann sowieso kommt.
So wandten wir uns von der Altstoffsammelei ab und gaben uns einem neuen, viel aufregenderen Betätigungsfeld hin: den unterirdischen Verliesen der innerstädtischen Kirchenruinen. Wir fanden vergessene, von jungen Birken zugewachsene Eingänge und krochen mit Taschenlampen durch enge Gänge. Ich hatte nie Angst steckenzubleiben, denn ich war nach wie vor sehr dünn. In der Parochialkirche stießen wir auf unterirdische Gruften, und in den offenen Sarkophagen lagen tatsächlich – Menschenknochen. Leider jedoch nicht als astreines Skelett, sondern als Knochen-Grabbelkiste: massenweise Rippen und Wirbel, hier und da auch mal Arm- oder Beinknochen, doch nie ein richtiger Schädel. Ich nahm immer ein paar Knochen mit; man kann ja nie wissen, wofür sie mal gut sind. Als uns der Küster der Parochialkirche erwischte, mahnte er uns, daß unsere Umtriebe eine »Störung der Totenruhe« darstellten. Das verwirrte, weil wir das Totsein für etwas absolut Fühlloses hielten, bei dem natürlich eine »Störung« völlig ausgeschlossen ist; wenn ich tot wäre, würde ich mir nichts mehr wünschen, als beim Totsein gestört zu werden. Es war das erste Mal, daß ich mit religiöser Rhetorik in Berührung kam, und ich war fasziniert, wie souverän scheinbar Gegensätzliches in einen Zusammenhang gestellt wird. Zugleich war die Vorstellung, Tote in ihrer Ruhe zu stören, einigermaßen gruslig – und mein Interesse an der Unterwelt war schlagartig zu Ende.
Dafür fing ich, inspiriert durch mein Liebmütterlein, mit dem Lesen an. Sie hatte ständig ein dickes Buch in Reichweite, und diese Bücher kamen mir spanisch vor. Eigentlich unvorstellbar, daß sich über einen einzigen Menschen namens Anna Karenina so viel sagen ließ. ›Nackt unter Wölfen‹ stellte ich mir als ein Erlebnis vor, das nach wenigen Minuten beendet sein dürfte. Bücher waren ein Mysterium, wenn auch ein anregendes. Ich las alles, was mir zwischen die Finger kam: Gebundene Bücher, Paperbacks, Jahrbücher und Enzyklopädien. Ich las im Stehen, im Sitzen und im Liegen, im Bus, auf der Rolltreppe und natürlich auch mit der Taschenlampe unter der Bettdecke. Ich las heimlich im Unterricht, indem ich mein Buch mit einem Lehrbuch tarnte. Am besten war es, wenn ich krank war – dann konnte ich den ganzen Tag lesen. Mark Twains ›Tom Sawyer und Huckleberry Finn‹ las ich dreimal, wie auch Wolfgang Schreyers ›Großgarage Südwest‹ oder Erich Kästners ›Emil und die Detektive‹. Bei ›Mohr und die Raben von London‹ kam ich nur bis zur Hälfte, und von vielen Groschenheften las ich fünfmal die erste Seite, ohne darüber hinauszukommen. Jules Verne fand ich klasse, nur leider zeichnete er die Deutschen durchgehend negativ. Alexander Wolkows ›Der schlaue Urfin und seine Holzsoldaten‹ las ich an einem Tag, für Strittmatters ›Tinko‹ brauchte ich ein Vierteljahr. Ich las Gunter Prodöhls fünfbändige ›Kriminalfälle ohne Beispiel‹, Liselotte Welskoph-Heinrichs sechsbändige ›Söhne der Großen Bärin‹, Stanisław Lems ›Unbesiegbaren‹, B. Travens ›Schatz in der Sierra Madre‹, Walentin Katajews ›Es blinkt ein einsam Segel‹, Harriet Beecher Stowes ›Onkel Toms Hütte‹, Jack Londons ›Lockendes Gold‹. Ich las Fantasy und Reportagen, insbesondere über Archäologie, da ich doch selbst schon Knochenfunde vermelden konnte. Ich las Bücher über Nazijäger, Goldsucher, Präsidenten und Ballonfahrer, über Freiheitskämpfer und Bergsteiger, über Märtyrer und Erfinder, über Ausreißer und Kapitäne. Am liebsten aber las ich Bücher über Ernst Thälmann. Das Vergnügen, das vertiefende Lektüre bietet – hier war es mir erstmals vergönnt. Mit ›Teddy und seine Freunde‹ ging es los, später kamen ›Rot Front, Teddy‹ und ›Als Thälmann noch ein Junge war‹ hinzu sowie ›Buttje Pieter und sein Held‹, ›Dann werde ich ein Kranich sein‹, ›Thälmann ist niemals gefallen‹, sowie die ›Erinnerungen an meinen Vater‹ von Irma Thälmann. Aus diesen Büchern lernte ich, wie Thälmann den ärmeren Kindern seine dicke Wurststulle überließ oder ihnen Karussellfahrten spendierte. Wie fleißig er bis tief in die Nacht Bücher las und wie gern sich schmächtige Arbeiterkinder auf seinen breiten Hafenarbeiter-Schultern tragen ließen. Wie er, als ihn die Faschisten eingekerkert hatten, dem Häftling, der in der Nebenzelle schmachtete, mit Klopfzeichen Zuversicht spendete.
Irgendwann kam ich in ein Alter, in dem mich meine Eltern nicht mehr rausschickten, wenn sie aufs Westfernsehen umschalteten, und mich mitgucken ließen, zum Beispiel, wenn ›Der große Preis‹ lief. Eine unglaubliche Sendung: Drei Kandidaten traten gegeneinander an, jeder ein Experte für ein Wissensgebiet. Jemand wußte alles über die Alpen, der nächste wußte alles über Kaiser Wilhelm oder Charlie Chaplin oder den Tower von London. Für jede richtige Antwort gab es Geld. In der ersten Runde mußten die Kandidaten ihr Spezialwissen bei einer Plauderei mit dem Moderator unter Beweis stellen, in der zweiten Runde ging es um Allgemeinbildung, aber in der dritten Runde wurde jeder Kandidat in eine Art Raumkapsel eingeschlossen, bekam Kopfhörer und mußte binnen einer Minute eine dreiteilige Frage zu seinem Spezialgebiet beantworten, wodurch er das angesammelte Geld entweder verdoppelte – oder komplett verlor. Manche Kandidaten waren nach der Sendung um zwei-, oder drei-, sogar um viertausend Westmark reicher.
Im Westfernsehen kamen natürlich auch Nachrichten, und die zeigten eines Tages das Bild von einem, der meinen Büchern entsprungen sein könnte: Gitarre, hochgekrempelte Ärmel und einen Schnauzbart, der bis zu den Kniekehlen zu gehen schien. Seine schwarzen Haare und dunklen Augen ließen ihn wie einen Husaren wirken, und sein Name war eine Versammlung so ernsthafter Begriffe wie »Wolf«, »Bier« und »Mann«. In den Nachrichten war er, weil ihn die DDR »ausgebürgert« hatte. Er hatte in der DDR gelebt, war in den Westen gefahren und durfte von dort nicht mehr zurück, weil er, wie ich von meinen Eltern erfuhr, »Sachen über die DDR gesagt hat«.
Sachen über die DDR zu sagen, das taten auch meine Eltern. Und wie oft hatten sie mir eingeschärft: Erzähl das nicht in der Schule. Was also tun, wenn auch wir eines Tages ausgebürgert werden? Wenn wir im Westen auf der Straße stehen, umgeben von Arbeitslosigkeit, Kriminalität und Drogensucht, und den Gewinn beim ›Großen Preis‹ dringend brauchen? Dies vor Augen befaßte ich mich noch intensiver mit Ernst Thälmann, dem einzigen Thema, bei dem ich mich sattelfest fühlte. Ich wußte nicht nur, wodurch Ernst Thälmann so mutig wurde. (Weil er als Kind eine vergessene Axt nachts aus dem Wald holen mußte.) Sondern auch, was mit seinem Hochzeitshemd geschah. (Er zerriß es zu Verbänden, um damit Verwundete des Hamburger Aufstands zu versorgen.) Ich kannte sogar den besten Thälmann-Witz. (»Das ist mein voller Ernst«, sagte Frau Thälmann, als es auf der Treppe polterte.) Unzählige Male stellte ich mir vor, wie sich die Raumkapsel schließt und mir über Kopfhörer die schwierigsten, entlegensten Thälmann-Fragen gestellt werden, und ich sie alle beantworte.
Natürlich ahnte ich damals schon, daß einem das Leben nie den Gefallen tut, die in der Phantasie erzeugten Szenen nachzuspielen. Das Leben schien mich, den großen Thälmannkenner, sogar verhöhnen zu wollen. Denn einmal sollte das Westfernsehen unsere Klasse beim Gang durch eine Ausstellung im gerade eröffneten Palast der Republik begleiten. Das Thema jener Ausstellung war – ich konnte mein Glück kaum fassen! – Ernst Thälmann. Der Gang durch die Ausstellung wurde selbstverständlich geprobt, in Gegenwart wichtiger Genossen. Es lief phantastisch. Ich wußte alles. Doch nach der Probe wurde mir mitgeteilt, daß ich, wenn das Westfernsehen kommt, nicht dabei sein werde. Ich war nämlich immer noch so dünn, daß die Genossen fürchteten, das Westfernsehen könnte mich als den blassen Jungen ins Bild setzen, der nur deshalb sein knochiges Ärmchen reckt, weil es dafür Bananen gibt.
In der Schule kam ich mühelos mit. Nach der Zehnten konnte ich eine Berufsausbildung mit Abitur machen. Ich entschied mich für den »Baufacharbeiter«, weil ich darin eine Chance auf die Erfahrung körperlicher Arbeit sah. Denn später wollte ich zur Kriminalpolizei.
Als zukünftiger Kriminalist allerdings sollte ich »an die Polizeiarbeit herangeführt« werden, indem ich ein »Freiwilliger Helfer der Volkspolizei« wurde, was so ziemlich das Uncoolste war, was von einem langhaarigen Jugendlichen, der ich inzwischen war, verlangt werden konnte.
Mein erster Einsatz war spätabends an einem Dienstag im April. Ich bekam im Polizeipräsidium eine rote Armbinde mit einem aufgenähten Polizeistern und eine Aufgabe: Ich sollte mit Bodo Hoppe auf Streife gehen. Bodo Hoppe war ein »erfahrener freiwilliger Helfer«; er sollte mich in das freiwillige Helfertum einweisen. Ich kannte Bodo Hoppe noch von der Schule, er war gutmütig und tapsig, und er hatte das Kunststück fertiggebracht, in zehn Schuljahren zweimal sitzenzubleiben. Er hatte ein fliehendes Kinn, und wenn er mit den Gedanken nicht bei der Sache war, stellte er die Füße nach innen. Er irritierte mit seiner Angewohnheit, die Leute beim Reden unwillkürlich anzufassen. Zudem war er unglaublich kameradschaftlich, bot immer seine Hilfe an und war regelrecht dankbar, wenn man sie annahm. Als einmal mein Fahrrad einen Platten hatte, schlug er sich den halben Nachmittag um die Ohren, um mir das passende Ventil zu besorgen. Weil sich seine Persönlichkeit auf die einfache Formel »schlichtes Gemüt, aber ein gutes Herz« bringen ließ, wurde er nie verspottet, und wenn doch, fand sich sofort jemand, der den Spötter dermaßen zusammenstauchte, daß der nie wieder Bodo Hoppe zum Ziel von Hohn und Spott machte.
Bodo Hoppe hatte, wie ich an jenem Aprilabend erlebte, die Angewohnheit, die letzten Silben eines Satzes mehr durch die Nase herauszuschniefen, als über die Lippen zu bringen. Er redete während unseres Streifenganges unaufhörlich. Er führte einen Dackel an der Leine mit sich, und ich beneidete ihn, Bodo Hoppe, für die Fähigkeit, einen Redefluß aus Belanglosigkeiten fließen zu lassen, auf daß nie eine verlegene Pause entsteht. Was für treue Tiere Hunde doch sind, daß sie rennen können bis zum Umfallen, und selbst wenn sie völlig erschöpft sind, rennen sie wieder los, wenn Herrchen es verlangt. So ging das die ganze Zeit, nur daß er trotz seines Redeflusses eine sagenhafte Aufmerksamkeit zeigte. Alle paar Schritte schlug er gegen ein Schild, das er, nachdem es prompt herunterfiel, provisorisch befestigte. Oder ihm fiel eine erloschene Laterne auf, gegen die er leicht mit seinem Schuh klopfte, worauf die tatsächlich wieder leuchtete. Oder er sagte mittendrin: »Ach, der hat sein Auto vergessen, zuzumachen«, öffnete eine Autotür und drückte den Verriegelungszapfen herunter. Er kickte ein Holzstück, aus dem ein Nagel ragte, von der Straße und lehnte ein halboffenes Fenster im Hochparterre an. Ein Portemonnaie fand er selber, das andere fand sein Dackel. Ich lief neben Bodo Hoppe her und kam mir vor, als führte er mich durch einen Parcours, der zuvor von ihm präpariert worden war, um mich zu beeindrucken. Nichts schien ihm zu entgehen. Er hatte einen genialen Blick, er war der geborene Streifenpolizist. Zwei Stunden dauerte unsere Tour. Wir gingen durch die Rosa-Luxemburg-Straße, die Rochstraße, die Spandauer Straße, die Münz-, Weinmeister- und Rosenthaler Straße, die Pieck- und die Mollstraße, und ich hoffte, daß mich bloß keiner sieht, mit der Armbinde und mit Bodo Hoppe.
Bei meinem zweiten und letzten Einsatz war diese Hoffnung von vornherein perdu. Denn ich sollte den ABV begleiten, und der stellte sich wie auf den Präsentierteller in den Eingang der Rathausstraße 7. Es war während des Nationalen Jugendfestivals 1984. Zigtausende Jugendliche waren in Berlin. Die Rathausstraße war blau. Doch im Strom der blauen Hemden kam ein bunter Punkt langsam näher. Es war eine wallende Blondine, ungefähr so alt wie ich, mit Batikklamotten, einer bunten Flicken-Umhängetasche, Schnürsandalen, Unmengen von Ketten und Armreifen. Eine, die als »tierisch bluesmäßige Lola« bezeichnet wurde. Als sie sich uns näherte, machte der ABV einen Schritt auf sie zu und versperrte ihr den Weg. »Ausweis.« Sie hieß Carola und war aus Rostock. Den Ausweis auf unangenehm abschätzige Art durchblätternd fragte er sie, was sie denn hier wolle. Da mußte Carola laut lachen und sagte mit norddeutschem Akzent: »Na, hier ist doch Jugendfestival!« Mir war diese Szene unglaublich peinlich.
Am selben Abend ging ich auf den Alexanderplatz, wo nach dem Ende des offiziellen Programms ein paar Ausgelassene im Springbrunnen planschten. Auf den Betonrändern der Blumenrabatten saßen Gitarrenspieler, und an der Weltzeituhr blies jemand Trompetenmelodien in die laue Nacht. Ich blieb bei einer kleinen Theatertruppe stehen, die Grimms Märchen spielte. Es gab einen Erzähler, der sich zum Mitspielen Leute aus dem Publikum herauspickte. Bei ›Frau Holle‹ gab ich den Apfelbaum. Ich wollte den apfelbaumigsten Apfelbaum der Theatergeschichte geben. Immer noch dünn, wollte ich mit langen Armen und dünnen Fingern ein üppiges Ast- und Blattwerk herstellen, und auch Anspielungen auf den ›Apfeltraum‹ von Renft wollte ich bieten, indem ich eben den Apfelbaum darzustellen gedachte, unter welchem der Sänger jenes Liedes lag und schlief. Nach dem Ende der Vorführung, bevor wir uns in alle Winde zerstreuten, ging der Märchenerzähler mit einem Hut herum. Das Geld wanderte in ein Köfferchen, das der Aufkleber ›Vertrauen wagen‹ zierte – das Motto des letzten Kirchentages.
Als ich eine halbe Stunde später das Menschengewühl des Alexanderplatzes verließ, nahmen mich zwei Männer von hinten in die Zange: »Kommsemitbleimseruhigsiewerdenzugeführt.« Mein Ausweis wurde einkassiert und ich zum Innenhof des Alexanderhauses gebracht. Dort stand ein LKW – und auf der Ladefläche saß die Theatertruppe: die Gold- und die Pechmarie, der Brunnen, der Ofen, natürlich auch Frau Holle und der Erzähler. Nur der linke Torbogen fehlte. Aber den brachten sie auch noch, und damit waren wir vollzählig. Unser Delikt bestand darin, daß wir ohne Sammelgenehmigung öffentlich Geld gesammelt hatten. Der Ober-Verhafter und Ober-Ermahner sagte, er sei von der Kriminalpolizei. Wir bekamen unsere Ausweise zurück und wurden einzeln, im Abstand von zwei, drei Minuten, entlassen.
Am Dienstag darauf, bei der nächsten Sprechstunde des ABV, gab ich meine rote Armbinde mit dem Polizeistern zurück und teilte mit, daß ich nicht zur Kriminalpolizei gehen werde.
Vermutlich wäre aus mir nur die Inspirationsquelle für eine Kriminalkomödie geworden. Denn in jenen Monaten wurde mir eine Schwäche bewußt, die sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte verschlimmerte: Ich kann mir keine Gesichter merken. Einen Kriminalist, der sich keine Gesichter merken kann – dafür legt man doch gern sein Geld an der Kinokasse hin. Nur für mich ist es furchtbar. Ich habe schon Verwandte gesiezt. Ich habe mich umständlich Leuten vorgestellt, die drei Wochen zuvor bei mir übernachtet haben. Ich habe die Frau meines Lebens bei unserer ersten Begegnung gebeten, beim nächsten Mal dieselben Ohrringe zu tragen – um nicht etwa eine andere Frau für die zu halten, mit der ich verabredet bin.
Das erste Mal wurde mir meine Gesichtsblindheit nach einem Zoff um eine Art Visum für einen Ungarn-Urlaub bewußt. Bei Antragstellung wurde eine Frist von zwei bis drei Wochen genannt; unerklärlich lange für einen Zettel mit ein bißchen Getipptem, Stempel und Unterschrift. Bei der Sachbearbeiterin handelte es sich um die Mutter meiner Mitschülerin Ruth Schmelzer, was mir jedoch nicht bewußt war. Wenige Tage später saß ich mit Ruth und ihrer Mutter bei der Zehnte-Klasse-Abschlußfeier stundenlang an einem gemeinsamen Tisch und erzählte dabei auch von meinen beruflichen Plänen. Ich erkannte sie nicht als Meldestellen-Mitarbeiterin, und als ich das Visum nach zwei Wochen bei ihr abholen wollte, erkannte ich sie nicht als die Frau, mit der ich auf der Abschlußfeier stundenlang an einem Tisch gesessen hatte. Das Visum war noch nicht fertig, und ich veranstaltete deswegen einen Riesenzirkus, Eingabe, Chef sprechen, so was. Als ich mein Visum nach einer Stunde dann doch bekam und die Unterschrift Schmelzer sah, fragte ich sie, versöhnlich gestimmt, ob sie etwa mit meiner Mitschülerin Ruth verwandt sei. Worauf sie sagte: »Donnerwetter! Da kann sich die Welt auf einen großen Kriminalisten freuen.«
Wie alle meine Mitschüler sollte auch ich am 1. November den Wehrdienst beginnen. Ich war für die Bereitschaftspolizei gemustert, was mit meiner Bewerbung für die Kriminalpolizei zu tun hatte, wollte dem Wehrdienst aber erst mal entgehen. Ich fühlte mich so unfertig, in keiner Weise bereit, für anderthalb Jahre in diese rohe, grobe Männerwelt einzutreten. Ich hatte keine Freundin. Statt dessen las ich Bücher. Zu allem Überfluß war ich Abstinenzler, rauchte nicht und trank keinen Tropfen. Ich war eine einzige Angriffsfläche, und wenn ich an meine Zukunft dachte, packte mich die blanke Panik. Mir fielen all die talentierten, fröhlichen Jungs ein, Söhne von Freundinnen meines Liebmütterleins, die irgendwann vom vorgezeichneten Weg abkamen und wahlweise im Gefängnis, der Psychiatrie oder auf dem Friedhof landeten, nach einem sinnlosen Verkehrsunfall, einer sinnlosen Schlägerei, einer sinnlosen Mutprobe. Als so einen sah ich mich enden, und ich wußte mir keinen Rat.
Ich war zwölf oder dreizehn, als ich einen Film sah, in dem eine rehäugige, zarte Lehrerin ein muskelmäßig vorzüglich ausgestattetes Mannsbild, das leider immer nur Mist baute, mit bedeutungsvollem Timbre fragte: »Kannst du dein Leben gestalten?« Welch schöne Vorstellung, daß sich zwischen Wiege und Bahre etwas »gestalten« läßt! Was ich bis dahin getan hatte, war alles andere, als mein Leben zu gestalten. Mit meinen Freunden fuhr ich ins Umland von Berlin, auf der Suche nach verfallenen Gutshäusern, die wir ausbauen und zu einem Leben in einer Kommune nutzen wollten. Oder wir fuhren sonstwohin, nur um festzustellen, daß da auch nichts ist, und gleich wieder umzukehren. Wir waren in Dessau und Anklam, in Cottbus und Halle. Wir fuhren nach Eisenhüttenstadt, um herauszufinden, ob das wirklich so war, wie es hieß, und in Eisenhüttenstadt gingen wir in ein Kino, um herauszufinden, ob auch der Film »Die blinde schwertschwingende Frau« so war, wie er hieß. Dann hörten wir, daß Jena ein heißes Pflaster ist – da wird man schon nach zehn Minuten verhaftet, wenn man zu dritt aufm Marktplatz steht. Mann, das wärs! Also auf nach Jena. Wir waren sogar zu viert, und abends um sechs stellten wir uns auf den Marktplatz. Wir hatten alle lange Haare, und wer wie ich keinen Hirschbeutel besaß, der hatte sich extra einen geliehen. Nach einer halben Stunde waren wir immer noch nicht verhaftet, aber wir froren. Also setzten wir uns in eine Gaststätte, tranken einen Tee und versuchten herauszufinden, warum wir nicht verhaftet wurden. Wir fragten die Kellnerin, ob es in Jena vielleicht noch einen Marktplatz gibt. Sie sagte nein. Ich zeigte aus dem Fenster und fragte, ob das der Marktplatz ist, auf dem man immer verhaftet wird, und die Kellnerin sagte, das mit der Verhafterei, das war vielleicht so vor fünf Jahren, wir kämen zu spät. Das Problem war uns vertraut. Dann war in Wittenberg ein Kirchentag. Wir fuhren auch dahin, um zu sehen, ob da wirklich, wie der Buschfunk meldete, ein leibhaftiger Schmied ein leibhaftiges Schwert in einen leibhaftigen Pflug umschmiedet. Die Massen strömten, als würden sich die Beatles wiedervereinigen. Sogar das Westfernsehen war da. Der Schmied trug eine riesige Lederschürze. Die Funken stoben, es machte plingplingplingpling, und wir wußten, daß, egal wie lange es noch plingplingpling macht, wir bald bei der Armee sein würden.
Nach meinem letzten Tag als Lehrling nahm ich meinen Jahresurlaub, und danach begann ich als Pförtner im Berliner Naturkundemuseum. Außerdem zog ich bei meinen Eltern aus; eine Freundin meines Liebmütterleins, die das Zusammenleben mit ihrem neuen Freund ausprobieren wollte, überließ mir bis auf Widerruf ihre Wohnung im Prenzlauer Berg. Drei Wochen vor dem 1. November meldete ich mich wieder polizeilich bei meinen Eltern in Berlin-Mitte an, um so dem Einberufungsbescheid zu entgehen. Aber da hatte ich mich verrechnet – der Einberufungsbescheid wurde mir persönlich durch den ABV in der Wohnung meiner Eltern übergeben, am 26. Oktober 1984.
Was die Armeezeit anrichtete, das sehe ich beim Vergleich der Vorher-Nachher-Bilder. Auf den Fotos vom letzten Schultag waren wir lachende, strahlende Helden. Wir hatten helle Gesichter und einen ansteckenden Optimismus. Wir sprühten vor Charme und vor Lebensfreude. Wir hatten es, das Elixier. Aber beim ersten Klassentreffen, nach der Armeezeit, da leuchtete nichts mehr. Irgend etwas war zerbrochen. Das Elixier war uns genommen. Wir saßen da, waren stumpf und gewöhnlich geworden, und verfügten nur noch über die Ausstrahlung enttäuschter Männer.
Im Ozean von Scheiße
(1. November 1984–29. April 1986)
Meine Armeezeit begann in der Fröbelstraße, auf dem Hof des Rates des Stadtbezirks Berlin-Prenzlauer Berg. Junge Männer mit Reisetaschen standen wie Teilnehmer eines Wettbewerbs um den deprimierendsten Gesichtsausdruck herum. Wer eine Freundin hatte, knutschte in einer Ecke, und »Halt die Ohren steif!« schien die gängige Abschiedsformel zu sein. Mein Vater, der mich in unserem Škoda gebracht hatte, erkühnte sich, einen der Uniformierten auf dem Hof nach meiner zukünftigen Postadresse zu fragen. »Die wernse noch früh jenuch erfahren«, war die Antwort. Mein Vater hatte eine mir unverständliche, ja verhaßte Faszination für Militärisches, aber in diesem Moment tat er mir leid wie ein Fan, der für sein Idol die Bühne erklimmt und dann nur verspottet wird. Und ich hatte ihn nun das erste Mal erlebt, den legendären »rauhen Ton«. Nur echt mit Uniform.
Namen wurden verlesen, Einberufungsbescheide und Personalausweise eingesammelt. Dann kam ein LKW, der uns zum Bahnhof bringen sollte, von wo aus es mit der Bahn weiter nach Leipzig ging. Es gab unter den Rekruten zwei Fraktionen: Die eine zeigte Lustlosigkeit, die andere Eifer. Ich hoffte auf eine dritte Fraktion, die alles ins Lächerliche zieht, und als vor der heruntergeklappten Ladebordwand der Befehl »Aufsitzen« kam, wieherte ich gleich mal – aber als mir die Blicke der anderen Rekruten bedeuteten, daß man hier nichts komisch finden wolle, schlug ich mich der Fraktion der Lustlosen zu.
In Leipzig wurde ich mit zwei Dutzend anderen Rekruten aussortiert. Wir hätten die Ehre, unseren Wehrdienst in der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik, in Berlin, zu leisten. Dazu mußten wir abermals auf einen LKW steigen, der uns nach Basdorf in die Nähe von Berlin fuhr. Als wir dort ankamen, war es längst wieder dunkel. Unterwegs rätselten wir, wieso gerade uns diese Ehre zuteil wurde. Die wenigsten von uns waren in der Partei oder Abiturienten, Sport-Asse oder Menschen mit hervorstechenden Begabungen. Wir fanden schließlich heraus, daß wir für etwas ausgewählt wurden, was wir nicht hatten: keine Westverwandten, keine Vorstrafen und keine Ausreiseanträge.
Bei der Armee laufen einem die seltsamsten Typen über den Weg. Da gab es einen Zugführer, der jeden Morgen eine ganze Schüssel mit rohen Zwiebeln fraß, sich aber zugleich immer etwas neidisch und alle Offensichtlichkeit vermeidend bei den verheirateten Rekruten erkundigte, wie die es angestellt hatten, eine Frau fürs Leben kennenzulernen. Dann gab es einen Kompaniechef, der Holger Bismark hieß und ein rotlackierter Faschist war. Er wollte, daß wir, wenn wir uns melden, nicht wie in der Schule die Hand heben, er wollte den Hitlergruß sehen, allerdings mit geballter Faust. Dieser Kompaniechef hatte auch die Befugnis, Decknamen für den Funkverkehr bei Manövern zu vergeben, und er gab sich den Decknamen »Everest«, während er seine drei Zugführer nicht etwa »Nanga Parbat«, »Machu Picchu« und »Matterhorn« nannte, auch nicht »Pik Lenin«, »Pik Stalin« und »Pik Kommunismus«, sondern ihnen die kümmerlichen Decknamen »Tank Eins«, »Tank Zwo« und »Tank Drei« zuwies. Dann gab es es einen Gruppenführer, der immer, wenn er UvD war, nach dem Weckpfiff den Eingang zum Kompanieklo versperrte; aus unerfindlichen Gründen wollte er, daß die Kompanie mit voller Blase die zwanzig Minuten Frühsport verrichtet. Als ein Rekrut sich deswegen beschwerte, wies der Gruppenführer auf mich und rief: »Nehmse sich ein Beispiel an dem Genossen Brussig und wichsense nicht so viel! Dann hamse auch ne Morgenlatte, und die Blase drückt nicht so. Stimmts, Genosse Brussig?« Und ich antwortete: »Jawohl, Genosse Unteroffizier!«
Das war alles so seltsam wie ein verrückter Traum, und ich dachte, das mußt du aufschreiben, sonst glaubt das keiner, sonst glaubst du das hinterher nicht mal selbst. Und so begann ich, ein Tagebuch zu führen, was streng verboten war. Wir Rekruten wurden schon am ersten Tag über die Geheimhaltungsvorschriften belehrt, und eine der allerersten Regeln war: Kein Tagebuch.
Doch ich fing noch am gleichen Tag damit an. Ich wollte alles beschreiben, worüber ich mich wunderte. Das ging damit los, wie wir genannt wurden. Wir wurden von den Vorgesetzten nie mit unserem Vornamen genannt, der Vorname wurde durch die Bezeichnung »Genosse« ersetzt. Ich war Thomas, und dann gab es auf der Stube noch einen Michael, einen Jens, einen Robert und einen Timo, aber wir liefen alle unter »Genosse« – obwohl keiner von uns Genosse war. Die Vorgesetzten konnten unseren Vornamen auch mit unserem Dienstgrad ersetzen, aber der war auch bei allen gleich und klang erbärmlich, denn bei der Bereitschaftspolizei waren wir »Anwärter«, während die Rekruten bei der Armee immerhin »Soldaten« waren, was eine gängige Bezeichnung war. Ich hörte also entweder auf »Genosse Brussig« oder auf »Anwärter Brussig«. Nur ein Rekrut wurde von unserem faschistischen Kompaniechef niemals »Genosse« oder »Anwärter« gerufen. Dieser Rekrut hieß Heidler, und wenn der Kompaniechef seinen Namen rief, was er gern und oft und laut tat, dann ließ er es wie die Zusammenziehung von »Heil Hitler!« klingen, und auch das beschrieb ich in meinem Tagebuch. Wie auch die seltsame, »Weihnachtsfeier« genannte Zusammenkunft auf dem Kompanieflur, wo wir Heiligabend 1984 an einem langen Tisch saßen und uns der Kompaniechef, sentimental gestimmt, auf die Melodie des ›Cats‹-Hits ›Memories‹ singen ließ: »Angriff/Ist die beste Verteidjung/Wenn der Gegner uns angreift/Greifen selber wir an.«
Als mein Tagebuch schon halbvoll war, ließ uns der Kompaniechef antreten und sprach über die Zunahme von Kameradendiebstählen, ein Wort, das ich nicht kennen wollte, weil es ein Naziwort war. Ich kannte Fahrraddiebstähle, Autodiebstähle – und als der Kompaniechef abschließend fragte, ob es noch Fragen gäbe, machte ich den Hitlergruß mit Faust und fragte, welche Kameraden denn gestohlen wurden, denn mir käme die Kompanie noch vollzählig vor. Als mir am Tag darauf mein Schrankschlüssel aus der Tasche fiel und ich mich umdrehte, um ihn aufzuheben, hatte schon ein Gruppenführer auf den Schlüssel getreten – nicht der Gruppenführer, der mich ob meiner Morgenlatte als leuchtendes Beispiel hingestellt hatte, sondern ein Gruppenführer, der deshalb in mein Tagebuch kam, weil er bei einem Einsatz auf dem Berliner Weihnachtsmarkt aus Spaß wehrlose Menschen in geschlossenen Räumen verprügelt hatte; arme Alkis, die trotz Berlinverbot nach Berlin gekommen waren. Dessen Stiefel also stand auf meinem Schlüsselbund, und er hob den Schlüssel triumphierend in die Höhe, meinte, das sei »Verleitung zum Kameradendiebstahl«, denn jetzt könne jeder ganz einfach ... Und mit diesen Worten ging er in meine Stube, an meinen Schrank, der »Spind« hieß, damit die Armseligkeit dieses Möbels auch verbal unübersehbar ist, und er sagte, ich könne von Glück reden, daß er den Schlüssel gefunden habe, denn wenn ihn ein anderer gefunden hätte, dann könnte der jetzt einfach meinen Schrank öffnen und an mein persönliches Fach gehen, darin einfach herumschnüffeln. Und als ob er nicht der wäre, der den Schlüssel genommen hatte, sondern eben der andere, der ihn hätte finden können, öffnete er meinen Schrank, ging an mein persönliches Fach und schnüffelte darin herum – wobei ihm natürlich gleich das Tagebuch in die Hände fiel. Ich dachte, der wird es doch gleich wieder zurücklegen, denn was im persönlichen Fach liegt, ist tabu, ist unantastbar, aber er tastete es sehr wohl an, er schlug es auf, rief »Aha!« und nahm es mit. Na ja, dachte ich, der wird es meinem Zugführer geben, der es vernichten und mir eine Strafe wegen eines Verstoßes gegen die Geheimhaltungsverordnung geben wird – aber lesen wird es der Zugführer nicht, denn das weiß doch jeder Mensch, wie unanständig es ist, fremde Tagebücher zu lesen. Zwei Stunden später jedoch – so lange etwa, wie es gedauert haben dürfte, mein Tagebuch zu lesen – ließ der Zugführer die Kompanie antreten, in seiner Hand mein Tagebuch. Er holte mich vor die Truppe, und ich dachte, aha, er hat es also doch gelesen, aber er wird daraus doch nicht vor der ganzen Kompanie vorlesen, so was macht man einfach nicht, und das weiß auch dieser Zugführer – dann schlug er das Tagebuch auf. Der tut nur so, dachte ich, was er jetzt vorliest, das denkt der sich auf die Schnelle aus, kein Mensch bringt etwas so Ekelhaftes fertig, vor einer angetretenen Truppe aus einem Tagebuch vorzulesen. Doch was er vortrug, kam mir bekannt vor, denn ich hatte es selbst geschrieben, und so mußte ich erkennen, daß er eben all das tat, was ich ihm nicht zutrauen wollte. Und während er las, wußte ich: Jetzt bin ich wirklich in der Armee angekommen. Das ist dieser Ozean von Scheiße, den ich erwartet habe. Und in dem ich nicht untergehen darf, komme, was da wolle.
Der Zugführer ließ die Truppe wegtreten, versammelte aber seinen Zug gleich darauf in einem Schulungsraum und hielt eine scharfe Rede. Was alles nicht läuft. Wer sich alles frisch machen könne, wenn nicht. Ausgangssperre. Weitere Verschärfung von. Ab sofort. Und wenns dazu noch Fragen gäbe, dann sollten die jetzt gestellt werden. Ich machte den Hitlergruß mit Faust und fragte, ob er denn mein Tagebuch zur Gänze gelesen hätte. Er bejahte. Unsicherheit, Verwunderung lag in seiner Stimme. Ich fragte ihn, ob er sich nicht schäme. Die Unteroffiziere faßten sich an den Kopf, dem Zugführer verschlug es die Sprache, die Wachtmeister verfolgten die Szene mit atemloser Spannung. Der Zugführer sagte schließlich: »Dieses Tagebuch wird noch mancher lesen, unter anderem der Militärstaatsanwalt.«
Wenn ich mich beim Kramen in meinen Erinnerungen dieser Tagebuch-Episode widme, dann finde ich es einigermaßen seltsam, daß ich mich damals wie berauscht fühlte. Natürlich war es furchtbar, daß die mein Tagebuch hatten. Aber ich hatte keine Angst. Ich war der Jüngere, der Unerfahrenere, der Rangniedere – na und? Denn was stand in ›Meister und Margarita‹, jenem Buch, das ich gerade ausgelesen hatte? Alles wird gut. Darauf ruht die Welt.
Allerdings war ich erst mal »Mode«, wie man das bei der Armee nennt. Ich erhielt den Befehl, einen eisigen Januarvormittag lang einen Hocker zu bewachen, der, nur damit ich ihn bewachen konnte, vor das Kompaniegebäude gestellt wurde. Wir hatten Impfungen bekommen, die leider sagenhaft wirksam waren; die Hoffnung, auf die Krankenstation einrücken zu können, erfüllte sich nicht. Wenigstens war das Kloputzen nicht so demütigend, wie es gedacht war. Wer daran Vergnügen findet, aus einem fremden Tagebuch vorzulesen, der hat auch Freude daran, jemanden bis zu den Ellenbogen ins Klo eintauchen zu lassen. Aber wie war das mit dem Militärstaatsanwalt gemeint? Ich war in einer Kompanie, die eine Vorzeigeeinheit war und die in der Zeitung zum »Kampf um den Bestentitel« aufrief. Den gab es aber nur, wenn keine einzige Disziplinarstrafe verhängt wurde. Komme ich vor den Militärstaatsanwalt, ist der Bestentitel futsch. Sollte meine Bestrafung dem Kompaniechef so viel wert sein? Wohl kaum. Dann aber wurde meine Versetzung in einen ausgemachten Sauhaufen angekündigt – in einem Sauhaufen könnte mich ein Militärstaatsanwalt anklagen, ohne daß ein Bestentitel dafür geopfert wird.
Woran merkt man, daß man älter wird? Zwei Jahre zuvor war ich extra nach Jena gefahren, um das Abenteuer einer Verhaftung zu erleben – aber jetzt wollte ich um keinen Preis hinter Gitter. Am Montagabend erfuhr ich, daß ich am Freitagmorgen nach Leipzig versetzt werde. Meine Ausrüstung mit Ausnahme der Waffe würde ich in eine Armeeplane wickeln, um das Ganze dann wie einen Sack wegzuschleppen.
Nun gab es aber ein großes Röhrenradio auf unserer Stube. Es gehörte meinem Liebmütterlein, und da sie es von ihrem ersten Lohn gekauft hatte, hatte dieses Radio einen nostalgischen Wert. Es hatte eine Tastatur für die unterschiedlichen Wellenbereiche und es hatte – oh, Kommode der Erinnerungen! – ein magisches Auge. Aber es war zu groß und zu schwer, um es noch zusätzlich zur gesamten Ausrüstung mitzunehmen. Deshalb erhielt ich den Befehl, meine Eltern anzurufen, um »die Verbringung des Radioapparates in die elterliche Wohnung in die Wege zu leiten«. Das Telefon in der Schreibstube durfte ich zur Ausführung des Befehls nicht benutzen, also nahm ich die einzige Telefonzelle der Kaserne; nach dem Abendessen bildete sich dort immer eine kleine Schlange. Und da ich seit dem Auffinden des Tagebuches keine einzige freie Minute gehabt hatte, wußten meine Eltern nichts von meinen Schwierigkeiten – und ich erzählte ihnen am Telefon alles, auch davon, daß ein Militärstaatsanwalt eingeschaltet war. Nun stand aber in der Warteschlange jemand hinter mir, der die ganze Geschichte hörte, und als ich die Telefonzelle verließ, sagte derjenige, ich solle auf ihn warten. – Nach seinem Telefonat wanderte er mit mir außer Hörweite und gab mir den Rat, in das Haus 13, erste Tür links zu gehen und mit dem Herrn dort zu besprechen, wie ich meine »Scharte wieder auswetzen« könne.
Der Herr im Haus 13, erste Tür links, hatte mich vor Wochen schon einmal zu sich rufen lassen, mir einen Platz in einem Sessel angeboten, mir seinen Dienstausweis gezeigt und mich darüber informiert, daß die Staatssicherheit in allen Kasernen Mitarbeiter hätte, die, um nicht so aufzufallen, die ortsübliche Uniform tragen. Er und seine Genossen seien in den Kasernen, um Militärputsche zu verhindern. Oder die Moral und Kampfkraft aus nächster Nähe zu beobachten. Er goß mir auch Tee ein, Pickwick Orange, aus dem Delikat. Ich sagte ihm, daß ich zwar einen Faschisten als Kompaniechef, aber keine Putschvorbereitungen mitbekommen hätte, aber daß er doch mal die Ordonnanzen im Offizierscasino befragen solle; Staatsstreiche würden doch immer bei einer guten Zigarre, einem Cognac und nach zweiundzwanzig Uhr besprochen. Meine Hinweise fand er nicht interessant genug, um mich wiedersehen zu wollen, aber nun riet mir meine Telefonzellen-Zufallsbekanntschaft, daß ich den Kontakt suche. Was es bedeutet, einen Stasi-Offizier zu fragen, wie ich meine Scharte wieder auswetzen könne, wußte ich, und ich hatte nur eine einzige Nacht zum Nachdenken Zeit, eine Nacht, in der man mich, wie schon in den Nächten zuvor, kaum schlafen ließ, denn ich war ja Mode.
Wenn ich vor einen Militärstaatsanwalt komme, »wird es teuer«, wie hartgesottene Knastologen sagen, das war mir klar, denn auch in dem Sauhaufen könnten mich Kompaniechef oder Kommandeur für zwei oder drei Monate in den Armeeknast schicken, doch wenn sich der Militärstaatsanwalt mit mir befassen solle, dann nur, weil es mehr als drei Monate werden sollen. Ein Stasi-Zuträger wollte ich jedoch auch nicht werden. Zumindest kein richtiger.
Die Wahl zwischen echtem und nicht so echtem Zuträger schien ich zu haben, während die Wahl zwischen echtem und nicht so echtem Knast nicht bestand. Also entschied ich mich, ins Haus 13, erste Tür links zu gehen und zu fragen, wie ich meine Scharte wieder auswetzen könnte. Feststand, wenn ich dazu verpflichtet werde, alles zu erzählen, was ich so sehe oder höre, dann werde ich eben dafür sorgen, daß ich nichts sehe oder höre, notfalls dadurch, indem ich meine Freizeit in Häkelkursen verbringe. Und weil auch mir das Wort »Verjährung« nicht ganz unbekannt war, wußte ich, daß ich meine Scharte nicht auf ewig auszuwetzen hätte.
Das Gespräch im Haus 13 war kurz. Der Stasi-Mann in der Polizeiuniform sagte, er kenne den Fall wie auch das Tagebuch. Aber ihn interessiere die Geschichte nicht weiter – auch nicht den Militärstaatsanwalt.
Ja, kann man so viel Glück haben, dachte ich, als ich das Haus 13 verließ. Warum? Ich weiß es nicht. Bulgakow kannte sich aus.
Ansonsten nahm ich mir selbst den lächerlichen Schwur ab, nie, niemals wieder in so eine Lage zu geraten. Nie wieder will ich mich aus Angst einem Stasi-Offizier anbieten müssen.
Der Rest des Wehrdienstes ist schnell erzählt: Ich kam zurück in die Leipziger Kaserne, von wo aus ich an meinem ersten Tag nach Basdorf geschickt worden war. Auf dem Flur, in den Zimmern: gähnende Leere. Nur ein Häuflein Innendienst-Kranker verlor sich in den Räumen. Man spielte Skat und Klammern. Die Kompanie war zu einem vierteljährlichen Arbeitseinsatz in die Rüstungsindustrie abkommandiert, ins Sprengstoffwerk Schönebeck. Ich setzte mich zu den Innendienstkranken und machte den Kiebitz. Als ein Offizier den Raum betrat, gab es kein zackiges »Achtung!«; der Geber blickte nur mal kurz hoch. Der Offizier war mein neuer Zugführer. Er holte mich zu sich, um mir nach dem Prinzip erstens, zweitens, drittens die einfachen Spielregeln in seinem Zug zu erläutern. Drei Wochen später kam die Kompanie aus dem Sprengstoffwerk zurück. Ich machte keine Probleme mehr.
Die Langeweile trieb viele dazu, auf Briefwechsel-Annoncen zu antworten. Nachmittagelang saßen sie über Briefen, beratschlagten sich, tüftelten an Formulierungen, dank denen sie als humorvoll, kinderlieb, romantisch, großzügig, treu, verständnisvoll und als regelmäßige Nutzer von Seife und Zahnbürste rüberkamen. Sie erhielten nie eine Antwort, obwohl sie ein Briefmarkenheftchen nach dem anderen verbrauchten. Einmal entwarf ich eine dreiseitige Parodie auf so einen Annoncenbrief, mit Sätzen wie »Meine Gesichtspickel unterscheiden sich von den Pickeln, mit denen ich sonst übersät bin, was Dir aber nicht auffallen wird, denn ob meines Mundgeruchs (finde selbst heraus, ob faulig oder stechend) wirst Du das nicht so leicht untersuchen können«. Als ich den Brief vorlas, wälzte sich mein Stubenältester ungelogen vor Lachen auf dem Boden. Dann antwortete auch ich einmal auf eine Briefwechsel-Annonce, wobei mir die Profis gleich sagten, daß es aussichtslos wäre, denn die Betreffende habe sich als »gutaussehend« beschrieben, was maximalen Ansturm und geringste Gewinnchancen bedeutete. Ich bekam aber doch eine Antwort; die Gutaussehende schrieb mir, daß ihr von den 345 Zuschriften meine am besten gefallen habe. Auf der Stube wurde ich angestarrt wie ein Außerirdischer. Die