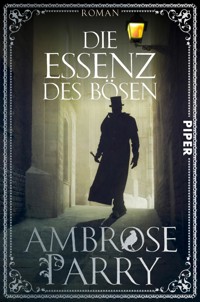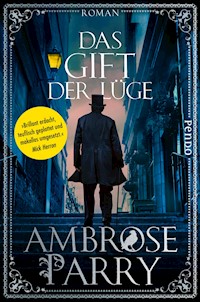
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Mord und Medizin im historischen Edinburgh – der zweite Band der düsteren, atmosphärischen und genial erzählten Krimi-Reihe
Eine Kette unerklärlicher Todesfälle erschüttert das viktorianische Edinburgh. Will Raven und Sarah Fisher sind wieder im Einsatz und jagen durch einen historischen Krimi der Extraklasse.
Das goldene Zeitalter der modernen Medizin begann unter den schummrigen Gaslaternen des viktorianischen Edinburghs. Hier wirkte etwa James Simpson, der Vater der modernen Anästhesie. Doch während helle Köpfe zum Wohl der Menschheit forschten, waren in den Schatten oft düstere Kräfte am Werk. Denn der einzige Unterschied zwischen Gift und Medizin ist die Dosierung …
In der heiß erwarteten Fortsetzung von »Die Tinktur des Todes« müssen der junge Arzt Will Raven und das kluge Hausmädchen Sarah Fisher einer unerklärlichen Todesserie auf die Spur kommen, die sich schnell als diabolisches Werk eines Serienmörders entpuppt. In den Gassen Edinburghs entspinnt sich eine packende und mitunter schaurige Jagd gegen die Zeit.
Der Kriminalroman »Das Gift der Lüge« versteht es meisterhaft, das historische Edinburgh vor dem Hintergrund bestens recherchierter Medizingeschichte auferstehen zu lassen. Und er liefert mit seinem Ermittler-Duo ein längst überfälliges Update für Fans von Sherlock Holmes.
Gefeierte Spannung über das Gift der Lüge – Gänsehaut und Schreckmomente inklusive
Ambrose Parry ist das Pseudonym des preisgekrönten Krimi-Autors Christopher Brookmyre und seiner Frau, der promovierten Anästhesistin Marisa Haetzman. Brookmyres Feder und Haetzmans Fachwissen sind die perfekten Zutaten für eine Krimi-Serie, die Sie nicht loslassen wird!
Sherlock Holmes trifft Jack the Ripper – und die Jagd geht weiter!
Die »Morde von Edinburgh«-Reihe fügt dem viktorianischen Historienroman ein neues, schauriges Kapitel hinzu, das sich vor den großen Vorbildern des Genres nicht verstecken muss. Denn mit den sympathischen Protagonisten Will Raven und Sarah Fisher hat Ambrose Parry ein neues Powerpaar erschaffen, dem seine Fans in jedes Abenteuer folgen.
»Ein meisterhaft geschriebener, höchst lesenswerter Kriminalroman, eine glaubwürdige, auf Fakten basierende Handlung, die auf hervorragenden Recherchen beruht, mit einer Menge zusätzlicher Spannung und Nervenkitzel.« Crime Review
»Herausragend.« Publishers Weekly
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.pendo.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Das Gift der Lüge« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Aus dem Englischen von Hannes Meyer
Für Jack
Das Zitat in Kapitel 38 stammt aus:
Mary Wollstonecraft, Ein Plädoyer für die Rechte der Frau. Aus dem Englischen von Irmgard Hölscher, Verlag Hermann Böhlaus Nachfolger, Weimar 1999.
© Christopher Brookmyre and Marisa Haetzman 2019
Titel der englischen Originalausgabe:
»The Art of Dying«, Canongate, Edinburgh 2019
Published by arrangement with Canongate Books Ltd, 14 High Street, Edinburgh EH1 1TE
© der deutschsprachigen Ausgabe:
Pendo Verlag in der Piper Verlag GmbH, München 2021
Redaktion: Kerstin Kubitz
Covergestaltung: U1berlin / Patrizia Di Stefano
Covermotiv: Stephen Mulcahey / Trevillion Images; Getty Images (quantum_orange; filo)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Cover & Impressum
Prolog
1849
Berlin
Kapitel 1
Kapitel 2
Edinburgh
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Epilog
Historische Anmerkung
Danksagung
Prolog
Es gibt in diesem Reich keine Frau, die nicht weiß, was Furcht bedeutet. Nicht einmal jene, die über uns herrscht, denn sie wurde nicht als Königin geboren. Sie kam als Mädchen zur Welt, und deshalb weiß ich, dass auch sie die Furcht und Hilflosigkeit derer kennt, die dem Manne unterworfen sind. Denn jede Frau wird sich zuweilen ihrer Schwäche Männern gegenüber bewusst, deren größere Macht nicht allein auf physischen Gegebenheiten beruht.
Schon viele Männer hatten Macht über mich. Es waren keine großen Männer. Oft waren es nicht einmal starke. Denn in dieser Welt braucht ein Mann weder Größe noch Kraft, um den Schwachen und Hilflosen seinen Willen aufzuzwingen. Oder zumindest jenen, die man hat glauben machen, sie seien schwach und hilflos.
Im Laufe meines Lebens habe ich so einiges über Heimtücke und Täuschung erfahren, doch der feigste Trick von allen ist gewiss der, einer Person wider besseres Wissen einzureden, sie sei machtlos.
Deshalb ist es für uns lebenswichtig, die Furcht zu überwinden; jede Frau muss sich ihrer Macht bewusst werden und sie nutzen. Doch dies kann nur behutsam geschehen. Ohne Einschüchterung. Ohne offene Drohung. Es ist das Schicksal großer Frauen, dass die Welt unsere Namen nicht kennenlernen wird – dass wir nicht den gebührenden Beifall für unsere Leistungen erhalten, auch wenn sie jene der Männer übertreffen.
Wir müssen unsere Macht im Stillen ausüben. Zwar dürfen wir nach Einbruch der Dämmerung nicht allein das Haus verlassen, doch spreche ich nicht von der Tageszeit, wenn ich sage, wir müssen im Zwielicht wirken. Ich meine vielmehr die Zwischenräume, die Orte zwischen Dunkelheit und Licht, die toten Winkel im Blickfeld der Männer.
Sie möchten wissen, wie ich mein Werk vollbringen konnte, wie ich so viele Leben nehmen konnte, ohne den geringsten Verdacht zu erregen. Die Antwort liegt in Ihnen selbst. Denn wem meine Gegenwart nicht beachtenswert erscheint, für den bin ich unsichtbar.
1849
Berlin
Kapitel 1
Er spürte warmes Blut auf dem Gesicht. Er sah Blut auf Stahl, auf Stoff, an den Wänden und auf dem Boden. Aber wichtiger war, dass das Blut in seiner Brust noch pulsierte.
Will Raven verschnaufte und stützte sich ab. Seine Angreifer verschwanden im Dunkel der verwinkelten Gasse, doch das Geräusch ihrer Schuhe auf dem Pflaster nahm er nach dem lauten Schuss nur gedämpft wahr. Der leichte Wind trug süße Gerüche herüber, eine Konditorei buk schon für den Verkauf am Morgen. Die laue Abendluft hatte ihn unachtsam werden lassen. In Edinburgh wäre er des Nachts niemals so sorglos daherflaniert, denn selbst nach ausgiebigem Ale-Genuss mahnte ihn dort stets die nüchterne Wachsamkeit, was hinter der nächsten Ecke lauern könnte. Hier in Preußen aber hatte sich seine Vorsicht von der fremden Umgebung ablenken lassen.
Sie waren überfallen worden, während sie die Königsstraße entlanggingen, eine Prachtstraße, die vom Alexanderplatz über die Spree zum Königlichen Schloss führte. Das Schloss in der Mitte der Stadt erinnerte ihn daran, woher er kam, und zugleich, wie weit er von dort entfernt war. Mit seiner auffälligen grünen Kuppel und seiner präzisen Geometrie hätte es kaum in einem schrofferen Gegensatz zu der kargen Garnisonsburg auf dem erloschenen Vulkan am Ende der High Street zu Hause stehen können. Aber auch hier kreuzten düstere, schmale Gassen die breitesten Boulevards; und anscheinend lauerte in solchen Gassen auf der ganzen Welt das Gleiche.
Drei maskierte Männer hatten in den Schatten gewartet und sich ihnen in den Weg gestellt. Einer von ihnen verlangte Geld. Sein Deutsch hatte einen seltsamen Akzent, aber die Forderung war unmissverständlich. Doch einer seiner Kumpane hatte anscheinend beschlossen, dass es leichter wäre, die Leichen zu fleddern. Er hatte eine Pistole gezogen, und dann war alles ganz schnell gegangen.
Das Blatt hatte sich mit einem Messerstreich gewendet; auf solch ein Ergebnis wäre jeder Chirurg stolz gewesen. Dieser Gedanke zog im Augenblick der Erleichterung vorüber, bevor Raven eine neue Angst packte – nämlich die davor, dass er es noch teuer würde bezahlen müssen, dass er dem Schicksal ein Schnippchen geschlagen hatte.
Raven wurde oft von der Ahnung heimgesucht, dass er in just solch einer dunklen, schäbigen Gasse eines gewaltsamen Todes sterben würde. Diese Sorge ging auf eine kalte, nasse Nacht 1847, zwei Jahre zuvor, in Edinburgh zurück, als er sich seinem Ende nahe gewähnt hatte. Zwar hatte er überlebt, doch die Bilder ließen ihn seither nicht mehr los; weniger aus Angst vor dem Tod als vielmehr davor, dass er aus seinem Leben nichts gemacht hatte. Er sorgte sich, dass er für ein solches Ende bestimmt war; dass seine hehren Ziele nichts als Luftschlösser waren und dass er im tiefsten Inneren einfach ein Mann war, der nur als Leiche in einer Gasse enden konnte.
Er drehte sich um, und sein Blick wanderte zu der Einmündung in die große Straße zurück. Im Schimmer einer Straßenlaterne sah er Henry zusammengesackt an der Mauer lehnen. Es schien, als würde der Knall noch immer zwischen den Häusern widerhallen, aber in Wahrheit fand dies nur noch zwischen seinen eigenen Schädelwänden statt. Seine Erinnerung an die letzten Momente war unklar. Er erinnerte sich an das wohlbekannte Krachen von Faust auf Knochen, an Henry, der, vom Schlag herumgeworfen, mit dem Kopf an die Wand prallte. Eine Pistole; Ravens Hechtsprung, um den Arm wegzustoßen, der sie hielt. Ein Schuss. Dann waren die Angreifer fortgelaufen, und Raven hatte die Verfolgung aufgenommen.
Raven eilte zu seinem gestürzten Freund und hockte sich vor ihn. Er hob Henrys Kinn an, um das blutüberströmte Gesicht zu begutachten. Die Augen waren glücklicherweise geöffnet, auch wenn der Blick nicht die gewohnte Schärfe zeigte.
»Wo sind sie?«, fragte Henry.
»Davongerannt. Bist du verletzt? Du hast Blut im Gesicht.«
»Du ebenso. Bei mir ist es nur eine Platzwunde. Am Kopf bluten die immer übermäßig stark. Aber ich muss mir beim Sturz das Bein angestoßen haben. Es tut mehr weh. Was ist mit den Damen?«
Raven schaute die Königsstraße hinunter und erspähte Liselotte und Gabriela an einem Brunnen auf dem Schlossplatz. Als sie überfallen worden waren, hatte er gebrüllt, sie sollten laufen, aber weit waren sie nicht gekommen. Solche Sachen waren immer schneller vorbei als gedacht. Was einem Beteiligten wie ein langwieriger Kampf erscheint, ist für den bloßen Beobachter meist eine Sache weniger Augenblicke. Die Frauen waren stehen geblieben und schauten nun zurück nach der Stelle, an der Henry gestürzt war.
Raven versuchte, ihm aufzuhelfen, aber Henry heulte auf.
»Himmel!«
Sie schauten beide nach unten und sahen es auf Henrys Oberschenkel dunkel schimmern. Instinktiv tastete Raven nach der Stelle, und Henry heulte noch einmal auf, nun aber doppelt so laut.
»Der Schuss hat dich getroffen.«
Henrys Gesicht war nun ebenso verwirrt wie schmerzverzerrt.
»Wie konnte er mich denn vorn in den Oberschenkel treffen? Ich hatte den Rücken zu ihm und schlug mit dem Gesicht an die Mauer, als er den Abzug drückte.«
»Ein unglücklicher Querschläger«, erwiderte Raven in dem Bewusstsein, dass es auch viel schlimmer hätte kommen können. Er war sich sicher, dass der Feigling mit der Pistole auf Gabriela gezielt hatte, als er ihn am Arm erwischte.
Liselotte und Gabriela waren mittlerweile herbeigeeilt, um zu helfen. Besorgnis stand ihnen im Gesicht.
»Wir haben den Schuss gehört«, sagte Gabriela. »Wer von euch wurde getroffen?«
Raven schaute sie fragend an, denn für ihn war die Antwort offensichtlich: der, der blutete. Dann berührte er sein Gesicht. Es war voller Blutspritzer, ebenso wie der Ärmel seines rechten Armes.
»Das ist Henrys Blut«, sagte er. Das war weder die ganze Wahrheit noch vollends gelogen. »Er wurde ins Bein getroffen.«
»Wir müssen ihn zu einem Chirurgen schaffen«, sagte Liselotte in dringlichem Ton.
»Ich bin selbst Chirurg«, erinnerte Henry sie. »Bringt mich einfach zurück nach Schloss Wolfburg, dann kann ich die Wunde selbst in Augenschein nehmen.«
Raven riss sich den blutbesudelten Ärmel vom Hemd und verband damit straff Henrys Oberschenkel, um die Blutung zu stillen. Auf beiden Seiten gestützt konnte Henry voranhumpeln. Ihre Wohnungen in der Jägerstraße waren ohnehin nicht fern.
Sie waren auf dem Weg dorthin gewesen, als sie überfallen wurden. Vielleicht hatte man sie für wohlhabende Reisende aus Übersee gehalten. Falls dem so war, wollte Raven es als Kompliment betrachten, dass die Gauner ihn als derart vornehm wahrgenommen hatten, denn wenn Henry und er auch tatsächlich von jenseits der Nordsee kamen, waren sie doch weiß Gott nicht reich. Nach einem Aufenthalt in Leipzig famulierten sie nun seit zwei Monaten an der Charité. Davor hatten sie sich bereits in London, Paris und Wien aufgehalten.
Raven öffnete die Tür zu dem gemeinsamen Flur der beiden Wohnungen und entzündete die Lampen, während Liselotte und Gabriela Henry hineinhalfen.
»Ins Schlafzimmer mit ihm«, verfügte Liselotte.
»Mit vertrautem Nachdruck geäußerte Worte«, neckte Raven sie.
Liselotte schnaubte. Sie kannte die beiden nun schon lange genug, um nichts Besseres zu erwarten.
Eigentlich war Raven kaum nach Scherzen zumute, aber er wollte dafür sorgen, dass sich die Stimmung seines Freundes nicht zu sehr verfinsterte.
»Nein«, widersprach Henry. »Hier ist das Licht besser. Und ich muss aufrecht sitzen können.«
Sie brachten ihn zum Sofa am Wohnzimmerkamin.
»Alle Lampen herbei!«
Henry stöhnte zum Steinerweichen, als Raven ihm die Hose auszog, und der Schmerz schien ihn zu übermannen. Zunächst hatten ihn der Schock und die Aufregung etwas gedämpft, aber nun blieb Henry diese Gnade versagt.
Er untersuchte die Wunde und betastete sie behutsam. Dann sah er Raven an, der ihm die Lampe hielt.
»Die Kugel ist nicht durchgeschlagen. Sie sitzt auch nicht tief, aber sie ist noch drinnen.«
Er keuchte bei jedem Wort. Er schwitzte. Raven wusste, was bevorstand; hatte es gewusst, seit sie die Wunde entdeckt hatten.
»Ich fürchte, ich muss dich bitten, mir die Ehre zu erweisen, alter Freund«, sagte Henry.
»Ah, aber worauf beharrt dein hochverehrter Professor Syme immer wieder? Entbindungsärzte sollten gefälligst keine Operationen durchführen.«
»Und was kontert stets dein geschätzter Professor Simpson? Wir sind doch alle Absolventen des Royal College of Surgeons, nicht wahr?«
»Nun denn. Wie es scheint, habe ich keine Wahl.«
Henry lehnte sich auf dem Sofa zurück, legte den Kopf ab und ächzte von Neuem.
»Was denn? Ich habe doch noch gar nicht angefangen.«
»Mir ist gerade eingefallen, dass ich mein Operationsbesteck im Krankenhaus liegen lassen habe. Hast du deine Sachen hier?«
Raven überspielte seine Gefühle mit einem Grinsen und klopfte sich auf die Manteltasche, wo er sein Messer hatte.
»Und vor allem: Hast du Chloroform da?«
»Nein. Du wirst es eben aushalten müssen.«
Raven benutzte die gleichen Worte wie einst Henry, als er Ravens Wange hatte nähen müssen. Dabei hob er die Hand an die Narbe, um Henry daran zu erinnern. Dieser wirkte vollends entmutigt.
»Ein Scherz«, sagte Raven. »Gabriela, holst du mir bitte die Tasche aus meinem Zimmer?«
»Danke«, erwiderte Henry. »Mir geht es weniger um den Schmerz als darum, dein wüstes Schlachtwerk an meinem Bein nicht mitansehen zu müssen.«
»Ach, sei keine Mimose! Du hast doch noch eins.«
Raven zog das Messer aus der Tasche. Henrys Augen suchten sofort die Klinge, und ihm fiel auf, dass sie voller Blut war. Raven hoffte, dass er sich in seinem Zustand nicht die Frage nach dessen Herkunft stellte.
»Ich muss doch hoffen, dass du das Ding vorher abwäschst. Denk an Semmelweis.«
Henry bezog sich auf einen Arzt, den er in Wien kennengelernt hatte. Semmelweis hatte einen Aufsatz veröffentlicht, in dem er der weitaus höheren Müttersterblichkeit in Gebärabteilungen nachging, die mit Medizinstudenten besetzt waren, im Vergleich zu jenen, in denen Hebammen arbeiteten. Er postulierte, diese gehe darauf zurück, dass die Studenten unmittelbar aus dem Sektionsraum traten, ohne sich die Hände zu waschen, sodass die Wöchnerinnen mit faulen Stoffen in Berührung kamen. Nachdem er aber dafür sorgte, dass die Studenten sich die Hände mit Chlorwasser wuschen, sank die Sterberate. Dennoch fiel es Semmelweis schwer, seine Kollegen von dieser Entdeckung zu überzeugen, und er machte seiner Enttäuschung bei jedem Luft, der ihm zuhörte. Henry hatte stets ein offenes Ohr für ihn gehabt.
Raven hatte bei diesem Thema allerdings keine Aufklärung nötig. Simpson lehrte seine Studenten schon seit Jahren, dass das Kindbettfieber über den Arzt oder die Hebamme von einer Patientin zur nächsten übertragen wurde.
Er ließ Liselotte einige Krüge mit Wasser füllen und Laken für den Verband zerreißen. Währenddessen bereitete Raven das Chloroform vor und bat Gabriela, genau auf Henry zu achten und ihm nötigenfalls eine weitere Dosis zu verabreichen, solange er an Henrys Bein arbeitete.
Raven drehte aus einem kleinen Stück Musselin einen Trichter und kippte die Flasche behutsam, sodass kleine Tropfen der Flüssigkeit auf den Stoff fielen. Er musste daran denken, dass Dr. Simpsons Entdeckung ihm auf seinen Reisen stets vorausgeeilt war. Das Chloroform hatte die Chirurgie verändert und fand an immer mehr Orten Anwendung. In London hatte er John Snow über die Bedeutung der präzise vorgenommenen Dosierung und der Überwachung ihrer Wirkung dozieren hören. Dann hatte Raven ihn seinen Verdampfungsapparat vorführen sehen, den er zu diesem Zwecke erfunden hatte. Doch an diesem Abend in Berlin musste Raven sich auf eine ungeschulte Assistentin verlassen, die die Flüssigkeit bei schlechtem Licht auf den Stoff träufelte, während sie alle mehr oder weniger betrunken waren.
»Es müssen kleine Tröpfchen sein«, erklärte er Gabriela. »Damit er nicht zu viel einatmet.«
»Gerade wäre mir das lieber als zu wenig.«
Raven hielt Henry den Trichter über das Gesicht.
»Und gib acht, dass es nicht an seine Haut kommt. Es ist bei Berührung schädlich und hinterlässt arge Spuren.«
»Ganz so wie du«, erwiderte Henry spitz. Er war überzeugt von Ravens Talent, Ärger anzuziehen.
»Es geht nicht auf meine Kappe, dass diese Männer über uns hergefallen sind.«
»Und doch erlebe ich gerade wieder einmal ausgerechnet in deiner Gesellschaft das blutige Nachspiel eines Überfalls.«
»Vielleicht bist ja auch du derjenige, der zu oft das Schicksal herausfordert, und hast bloß das Glück, dass ich dir jederzeit treu zur Seite springe. Hast du es schon einmal so betrachtet?«
»Nie im Leben. Dafür habe ich aber schon oft gesagt, dass du mich noch ins Grab bringst.«
Raven versuchte, sich zu erinnern.
»Das hast du noch nie gesagt.«
»Nein«, gab Henry zu, »aber sicher schon oft gedacht. Also beweise mir jetzt bitte das Gegenteil. Und vergiss nicht, das Messer abzuwaschen.«
Raven träufelte noch mehr Chloroform auf den Stoff und ließ Gabriela den Trichter halten, während er Wasser über die Klinge goss. Er sah, wie sich das Blut löste und vom Stahl in die bereitgestellte Schale rann.
Er dachte an etwas, was Gabriela von ihrem früheren Zuhause in Madrid erzählt hatte. Sie war an einem Ort namens Lavapies aufgewachsen. Der befand sich am Fuße eines Hügels, wohin seit Jahrhunderten das Regenwasser der Stadt durch sorgfältig gepflegte Rinnen abfloss. Dort wusch man sich die Füße, daher der Name.
Unglücklicherweise konnte Wasser allein nicht alles fortwaschen.
Raven sammelte sich und hoffte, dass der Wein seine Nerven gestärkt, seiner Hand aber nicht die Ruhe genommen hatte. Behutsam berührte er den Bereich rund um die Wunde. Da Henry sich nicht regte, sah er dessen Bewusstlosigkeit als bestätigt an und konnte nach der harten Beule tasten, in der die Kugel festsaß.
Auf seine Anweisung hin ließ Liselotte vorsichtig Wasser aus einem Lappen über die Stelle laufen, um sie vom Blut zu reinigen, während Raven einen kleinen Schnitt setzte. Glücklicherweise hatte der Schuss keine größeren Blutgefäße getroffen, auch wenn er der Oberschenkelschlagader gefährlich nahe gekommen war. Diesmal hatte etwa ein Zentimeter den Unterschied zwischen Leben und Tod ausgemacht.
Raven zog die Kugel mit der Kornzange heraus. Er wollte sie schon entsorgen, doch dann fiel ihm ein, dass Henry sie vielleicht gern als Andenken behalten würde.
Mit konzentrierter Miene träufelte Liselotte weiteres Wasser auf die Wunde.
Das Blut und das Wasser tränkten den Sofastoff unter Henry, während Raven mit der Naht begann. Er wollte sich nicht ausmalen, was Herr Wolfburg, ihr Furcht einflößender Vermieter, zu den Flecken sagen würde.
Bald darauf kam Henry zu sich, blinzelte und ächzte. Gabriela stand mit dem Chloroform bereit und schaute Raven an, aber Henry war bereits wach genug, um abzuwinken.
»Vielen Dank, meine Liebe, aber es drängt mich, Ravens Werk zu begutachten.« Er verzog das Gesicht. »Mein Gott, das sieht ja aus wie ein geschundener Fußball.«
Dann grinste er Raven zu.
»Ich scherze. Saubere Arbeit, alter Freund. Ich danke dir. Und nun hoffe ich, du nimmst es mir nicht übel, wenn ich nach deinem schweißtreibenden Einsatz wieder in die Bewusstlosigkeit zurücksinke, wozu nun aber kein Chloroform mehr vonnöten ist. Sollte sich herausstellen, dass ich am Morgen noch lebe, sorge bitte dafür, dass man mich vor acht Uhr weckt. Denn um neun hält Langenbeck eine Vorlesung über Amputationen auf dem Schlachtfeld, die ich nicht verpassen möchte.«
Kapitel 2
»Das war sehr mutig von dir«, sagte Gabriela. Es waren die ersten Worte, die sie miteinander wechselten, nachdem sie übereinander hergefallen waren.
Wohlig müde, doch dem Schlafe fern, lagen sie in Ravens Bett. Liselotte war an Henrys Seite geblieben und kümmerte sich um ihn, wenn auch auf andere Art und Weise, als sie es vielleicht noch Stunden zuvor vorgehabt hatte. Bei Raven und Gabriela aber hatte die durchgestandene Gefahr ein unerwartetes Verlangen entfacht; Todesangst, in Leidenschaft verwandelt.
Raven kannte sie seit einigen Wochen, nachdem man sie ihm bei einem Abendessen im Hause des Prosektors der Charité, Dr. Virchow, vorgestellt hatte. Dieser leitete zwar die dortige Pathologie, war aber am Gebiet der Geburtshilfe interessiert und damit auch an Raven, der, wenn auch selbst von niederem Range, als Famulus des berühmten Professor Simpson gearbeitet hatte. Alle wollten mehr über den großen Mann und seine außerordentliche Entdeckung erfahren. Gabriela war eine Freundin von Rose Mayer, Virchows Gattin in spe. Sie hatte an Ravens Ausführungen über das Chloroform wenig Interesse gezeigt, dann aber aufmerksam gelauscht, als er von seinem Treffen mit den Edinburgher Pionieren der Photographie, David Octavius Hill und dem später verstorbenen Robert Adamson, erzählte.
Gabriela war eine zierliche Frau mit dunklen Augen und dunklem Haar, die Locken beiläufig hochgebunden, dabei stets in Gefahr, wieder hervorzuwallen. Raven stach jedes Mal der Kontrast zu den Frauen zu Hause ins Auge, deren Haar immer so straff gezurrt, deren Haut so blass war. Und nicht nur deren Äußeres war so viel strenger. Gabriela war fünfzehn Jahre älter als er, Schriftstellerin, Künstlerin und gelegentliches Modell und hatte vor Jahren ihre wohlhabende Familie in Aufruhr versetzt, als sie ihren adligen Ehemann verließ. Sie war keine Frau, die sich von Konventionen binden ließ, was Raven einerseits zu ihr hinzog, ihn andererseits aber auch argwöhnisch machte. Sie wussten beide, dass ihre Beziehung nicht von Dauer sein konnte – ihre Vergänglichkeit machte zweifellos einen Teil des Reizes aus. Sonst hätte keiner von beiden den anderen als geeigneten Gefährten in Erwägung gezogen.
Raven betrachtete sie im Licht der Kerzen, die sie rund um das Bett in wachsverkrusteten Flaschen aufgestellt hatte.
»Es war nicht meine erste Operation, auch wenn der Chirurgie nicht mein vornehmliches Interesse gilt. Mutig war Henry, der mir den Eingriff zugetraut hat.«
»Nein, ich meine, wie du die Männer in die Flucht geschlagen hast, die uns ausrauben wollten. Sie waren zu dritt, und du hast dich ihnen allein entgegengestellt, und zwar in dem Wissen, dass einer von ihnen eine Pistole hatte.«
Vernahm er da einen Unterton in ihren Worten? Vorsichtig war er bei Gabriela auch deshalb, weil er fürchtete, mit ihrer Erfahrung und Klugheit könnte sie alles durchschauen, was er zu verbergen suchte.
»Ich habe darauf gesetzt, dass ihm die Zeit zum Nachladen fehlte.«
»Eine kühne Wette.«
Raven wandte den Blick ab, damit sein Gesicht ihr nicht verriet, dass er falsch gewettet hatte. Stattdessen schlug er einen neckischen Ton an.
»Ich hätte ihnen ja Geld gegeben, hätten wir noch welches gehabt. Nachdem wir es aber alles vertrunken hatten, schien ein Gegenangriff der einzige Ausweg. Ich konnte nicht davon ausgehen, dass sie sich mit unseren aufrichtigen Entschuldigungen an Geldes statt hätten vertrösten lassen.«
»Nichtsdestoweniger ist ein Kampf drei gegen einen kein redlicher Wettstreit, und doch bist du nicht davor zurückgeschreckt.«
»Es war nicht meine erste Prügelei, falls du darauf hinauswillst. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass jene, die den Schwachen und Arglosen auflauern, sich einem wahren Kampf nicht immer gewachsen fühlen.«
»Auch dabei hast du hoch gewettet.«
Raven schwieg. Sein Blick suchte den Brief, der an seinem Bett lag und den er noch immer nicht beantwortet hatte. Dr. George Keith verließ die Queen Street 52, um gemeinsam mit seinem Bruder Thomas eine eigene Praxis zu eröffnen, und Professor Simpson bot Raven die Stelle als sein neuer Assistent an. Er hatte nun seine Ausbildung abgeschlossen, war kein Famulus mehr und hatte im Laufe seines Jahres im Ausland seinen medizinischen Horizont in einer Art und Weise erweitert, wie er es in solch einer kurzen Zeitspanne nicht für möglich gehalten hätte.
Und doch.
Er dachte an Henry, der ihm oft einen »krankhaften Jähzorn« vorwarf. Außerdem hallten ihm im Kopf die Worte seiner Mutter wider, mal im Scherz gesprochen, mal im Ernst.
Du hast den Teufel in dir.
Raven hegte die Hoffnung, dass dies überwunden war. Schon seit Langem war er nicht mehr an derartiger Gewalt beteiligt gewesen, gewiss nicht, seit er Edinburgh verlassen hatte, und er glaubte, seine Natur gezähmt zu haben. Nun fragte er sich aber, ob sich nur keine Gelegenheit geboten hatte. An diesem Abend hatte sich der Teufel in ihm nur allzu bereitwillig wecken lassen, er war also nicht tot, sondern hatte bloß geschlummert. Und dort in der Gasse hatte ein Mann dafür bezahlt, dass er dessen Schlaf gestört hatte.
Gabriela legte ihm eine Hand auf die Schulter.
»Hast du mich vergessen?«, fragte sie.
»Tut mir leid. Meine Gedanken sind abgeschweift. Ich musste an Henry denken.«
Sie lachte. »Du warst mit den Gedanken weiter weg als bloß im Nebenzimmer. Verkauf mich nicht für dumm, Raven. Ich kenne dich. Wann immer wir uns lieben, bist du hinterher nicht mehr hier.«
Leugnen war aussichtslos. Erst recht vor ihr.
»Du bist an einem fernen Ort, bei einer anderen. Und ich frage mich schon lange, bei wem.«
Er hätte gern erklärt, dass die Angelegenheit komplexer war, aber er wollte sie nicht ermutigen, weiter nachzubohren. Sie war älter als er, weiser als er, und er befürchtete, dass er nur wenig vor ihr verbergen konnte. Allerdings fragte er sich, warum er das überhaupt wünschte.
Raven dachte an die Männer, die Gabriela gewiss vor ihm gehabt hatte. Er war aber weder eifersüchtig noch missbilligend. Vielmehr fragte er sich, welche Version ihrer selbst sie jedem von ihnen gezeigt hatte. Er versuchte, sich die verschiedenen Leben auszumalen, die sie gekreuzt hatte, die verschiedenen Personen, die sie gewesen war.
»Gabriela, du hast an vielen Orten gelebt, Gewohntes aufgegeben und von Neuem angefangen. Ist es möglich, jemand anders zu werden, sich selbst neu zu erschaffen? Oder hat man doch immer den Menschen bei sich, der man wirklich ist?«
Gabriela fuhr ihm mit einem Finger über die Brust.
»Ich glaube, du solltest dir eher die Frage stellen, wer du werden möchtest. Weißt du das denn?«
»Ich möchte ein erfolgreicher Arzt werden. Geachtet von meinen Kollegen und gefragt bei den Patienten.«
»Warum solltest du dich dazu neu erfinden müssen? Genau darauf arbeitest du doch schon lange hin.«
»Richtig, aber in Edinburgh sind der Anspruch und die Erwartungen so hoch, dass ich fürchte, ich könnte mich irgendwie verraten. In der Stadt ist der gute Ruf alles.«
Gabriela zog eine Augenbraue hoch und blickte ihn durchdringend an.
»Du sprichst vor einer Frau wie mir von gutem Ruf? Hättest du auch nur die geringste Ahnung von der Verachtung, mit der ich mich …«
»Aber deshalb frage ich ja. Kann man wirklich zu dem Menschen werden, den die Welt erwartet? Oder muss man immerfort eine Maske tragen, um seine unvollkommene Natur zu verbergen?«
Gabriela dachte eine Weile nach, bevor sie antwortete.
»Wenn man eine Maske lange genug trägt, passt sie einem irgendwann wie angegossen. Allerdings läuft man dann auch Gefahr, den Menschen dahinter zu verlieren.«
Das schien Raven kein zu hoher Preis.
»Ich bin in London, Paris, Wien, Leipzig und nun Berlin gewesen. Ich habe an exzellenten Instituten studiert, von großen Männern gelernt. Ich müsste mich wohl wie verwandelt fühlen, doch in vieler Hinsicht habe ich mich überhaupt nicht verändert, fürchte ich. Je mehr ich lerne, je mehr ich von der Welt erfahre, glaubte ich, desto größer würde ich als Mann werden. Ich glaubte, ich könnte Selbstgewissheit erlangen. Aber stattdessen erscheint es mir, als würde die Welt immer größer und als könnte ich niemals genug wachsen, um ihr gerecht zu werden.«
Gabriela nickte und betrachtete ihn mit einem mitfühlenden Blick, der ihm Trost bot, ihm aber zugleich das Gefühl gab, ein Kind zu sein.
»Ich vermute, du bist nun weit genug gereist, Will Raven. Solltest du dich verloren haben, gibt es nur einen Ort, an dem du dich wiederfinden kannst.«
Edinburgh
Kapitel 3
Das Wartezimmer war so voll wie eh und je, die Patienten balgten sich um die Stühle, die dem Kamin am nächsten standen. Es war noch früh, und Sarah ging davon aus, dass die Menge bald überquellen würde bis hinaus auf den Flur und die Treppe. Der chaotischen Natur der häuslichen Umstände zum Trotze liebte Sarah die Queen Street 52 noch immer, und sie war fest entschlossen, dass ihre neue Stellung nichts an ihrer Rolle hier änderte, wie sie sie verstand. Sie fühlte sich an diesem Ort verwurzelt, an ihn gebunden.
Es war viel mehr als ein Haus oder das Heim einer Familie. Es war ein Ort der Gelehrsamkeit. Es bot Gelegenheit, sich ein Wissen der Medizin anzueignen und auch zu lernen, wie man es am besten anwandte, wie man die Leidenden versorgte. Hierher kamen Arm und Reich gleichermaßen, aber nur von Letzteren wurde eine Bezahlung erwartet. Und ungeachtet der jeweiligen pekuniären Lage galt für jeden Patienten dasselbe: Wer litt, wurde behandelt. Die Vielfalt der vorgestellten Krankheiten bedeutete, dass die Sprechstunde der beste Hörsaal war, denn es gab jeden Tag etwas Neues zu lernen. Oft glaubte sie, dass die ihr hier bei der Arbeit gebotenen Gelegenheiten jene weit überstiegen, die den Medizinstudenten an der Universität zuteilwurden.
Sie war zwar kein Hausmädchen mehr, aber an manchen Tagen kam sie sich dennoch wie eine Dienerin vor. Wenn es kalt war wie an diesem Morgen, rief Dr. Simpson gern nach Tee und Haferbrei für die Patienten im Wartezimmer. Viele reisten von weit her an und waren bei ihrer Ankunft hungrig und durchgefroren. Diese Arbeit hätte ihr wohl mehr zu schaffen gemacht, hätte nicht Mrs Simpson selbst neben ihr die Patienten bedient.
An anderen Tagen aber fühlte sie sich eher wie eine Krankenschwester oder Assistentin und an manchen gar beinahe wie ein Familienmitglied. Sie half oft mit den Kindern, und besonders Jamie war ihr ans Herz gewachsen. Er neigte zu Ekzemen; immer wieder quälte ihn ein juckender Ausschlag, und oft trug man ihr auf, ihn zu baden und die entzündeten Stellen mit Olivenöl einzureiben. Trotzdem war er ein liebes Kind; ruhiger als seine ungestümen großen Brüder.
Sarah hörte jemanden in die Hände klatschen.
»Auf geht’s. Schicken Sie mir doch bitte den Nächsten herein.«
Sie führte eine ältere Dame den Flur entlang zu Dr. Simpsons Behandlungszimmer. Er wartete an der Tür und versuchte vergeblich, sich ein Gähnen zu verkneifen. »Gestern Abend musste ich eine holprige Fahrt in einer Kutsche ohne Federung durchstehen«, erklärte er. »Ich bin dann zwar in eine andere gestiegen, in der es mir aber kaum besser erging, deshalb komme ich mir heute vor wie grün und blau geprügelt.«
Sarah ging wieder ins Wartezimmer, um die leeren Tassen und Schalen vom Morgenmahl aufzuräumen. Sie trug das voll beladene Tablett über den Flur, umschiffte David und Walter, die sich aus Regenschirmen Beduinenzelte gebaut hatten, und Glen, den Hund, der wie immer vor dem Garderobenständer bereitlag, sollte sein Herrchen das Haus verlassen wollen. Als sie in die Küche kam, schrubbte Lizzie gerade den Haferbreitopf, und Mrs Lindsay schnitt auf dem Küchentisch Gemüse.
»Dann ist er wohl fertig mit der Speisung der Fünftausend«, sagte Mrs Lyndsay. Sarah war sich nie ganz sicher, ob die Köchin Dr. Simpsons Großzügigkeit guthieß. Sie war religiös im herkömmlichen Sinne – eine Anhängerin der Free Church und regelmäßige Kirchgängerin –, aber ob sie es deshalb auch befürwortete, wie das Haus für die Armen Edinburghs geöffnet wurde, war nicht ersichtlich.
»Ich glaube, das ist fürs Erste alles.«
Sarah brachte das Tablett zur Spüle. Lizzie schaute auf und lächelte ihr schmal zu. Dr. Simpson hatte sie aus dem Lock Hospital gerettet, sie war eine von Dr. Simpsons Waisen – wie Sarah selbst eine gewesen war, wenn auch glücklicherweise nicht unter demselben Umständen. Lizzie war ein gefallenes Mädchen gewesen – wie Mrs Lyndsay es ausdrückte –, und auch wenn sie von ihrem venerischen Leiden hatte befreit werden können, bedurfte ihre Seele noch der Heilung. Als probates Mittel dafür hatte man harte Arbeit auserkoren, weshalb das arme Mädchen für zwei schuften musste.
»Der Herr Doktor sollte lieber mal auf seine Brieftasche aufpassen«, sagte Mrs Lyndsay. Sarah wollte gerade erwidern, dass das Geld im Hause nicht unbedingt knapp schien, als die Köchin sie heranwinkte. Sie flüsterte ihr zu: »In der letzten Zeit geht einiges verloren. Unstimmigkeiten in den Wirtschaftsbüchern. Mrs Simpson macht sich schon Sorgen.«
»Vielleicht ein schlichter Fehler?«, sagte Sarah, aber Mrs Lyndsays Ton verriet, dass sie von finsteren Machenschaften ausging.
»Hat denn schon jemand in den Fensterrahmen nachgesehen?«, fügte Sarah hinzu, eine Anspielung darauf, dass Dr. Simpson einmal einen klappernden Schieberahmen mit einem gefalteten Zehnpfundschein zum Verstummen gebracht hatte.
Mrs Lyndsay lächelte nicht, sondern schaute zu Lizzie hinüber, deren Arme noch bis zu den Ellenbogen im heißen Wasser steckten. »Ich habe ja meinen eigenen Verdacht«, murmelte sie.
Auf dem Rückweg zum Wartezimmer wurde Sarah von Dr. Simpson in seinen Behandlungsraum gerufen, wo er gerade mit der Untersuchung der älteren Dame fertig war, einer Witwe namens Mrs Combe. Er half ihr auf einen Stuhl und setzte sich auf den Hocker neben ihr, denn er war lieber auf Augenhöhe der Patienten, wenn er mit ihnen über ihr Leiden sprach. Er erhob sich nicht gern über andere, erst recht nicht, wenn er schlechte Neuigkeiten zu übermitteln hatte.
»Dr. Simpson, setzen Sie sich doch nicht auf so einen unwürdigen Schemel«, schalt Mrs Combe, offensichtlich wenig beeindruckt von seiner Geste. »Das schickt sich für einen Mann Ihres Standes nicht.«
»Ich verdiene nichts Besseres, denn Ihr Leiden verblüfft mich«, erwiderte der Doktor und schüttelte den Kopf.
»Sie sehen müde aus«, sagte Mrs Combe, die sich vom Fehlen einer Diagnose nicht aus der Ruhe bringen ließ und sich anscheinend eher Sorgen um ihren Arzt machte.
»Nun, ich war letzte Nacht in einem Zimmer im sechsten Stock am Cowgate und versuchte, eine arme Frau zu retten, die von ihrem Mann schlimm zugerichtet worden war. Ich hatte zufällig die Polizei getroffen, und man bat mich, nach dem Opfer zu sehen. Sie wird überleben, glaube ich.«
Dr. Simpson fuhr sich mit der Hand durchs zerzauste Haar, stand dann mühselig auf und massierte sich im Kreuz. »Bitte verzeihen Sie«, sagte er. »Der Ischias.«
Er ging an den Schreibtisch und schrieb ein Rezept, während Sarah eine wunde Stelle am Schienbein der Patientin verband. »Auch wenn ich derzeit keine Diagnose stellen kann, so hoffe ich, dass dies hier Ihre Symptome etwas lindert«, sagte er.
Die Dame begann, in ihrer kleinen Tasche zu wühlen. Dr. Simpson legte ihr die Hand auf den Arm.
»Stecken Sie Ihr Geld wieder ein. Ich nehme kein Honorar«, sagte er. »Ich habe nichts getan. Es steht mir nicht zu.«
Sarah fragte sich, ob man ihn von dem Loch in den Haushaltsfinanzen in Kenntnis gesetzt hatte, und vor allem, ob er wusste, wer dafür verantwortlich war. Die alte Dame erhob sich und ging zur Tür.
»Schauen Sie, dass Sie sich etwas ausruhen, Dr. Simpson«, sagte sie. »In dieser Stadt verlassen sich so viele auf Sie – da dürfen Sie uns nicht einfach krank werden.«
»Ich danke Ihnen für Ihre Sorge«, erwiderte er. »Unter anderen Umständen müsste ich Ihren guten Rat in den Wind schlagen, aber zu meiner Freude kann ich sagen, dass ich Ersatz für Dr. Keith gefunden habe. Ich habe einen neuen Assistenten eingestellt.«
Sarah hielt inne. Das war auch ihr neu.
»Und um wen handelt es sich bei diesem neuen Assistenten?«, fragte die Dame. »Kennen wir ihn?«
»Möglicherweise schon. Er war vor gar nicht langer Zeit mein Famulus.«
Sarah ließ den Verband fallen, den sie gerade säuberlich aufgewickelt hatte, und er rollte sich quer über den Boden ab.
»Sein Name ist Will Raven.«
Kapitel 4
Als Raven aus der Kutsche stieg und seine Koffer hinunter auf das Trottoir hob, schlug ihm ein beißender Wind ins Gesicht. Spätherbst in Edinburgh. Er erlaubte sich ein Grinsen über diese kühle Umarmung, wie der Willkommensgruß eines Verwandten, der einen Groll hegte. Die Kälte erschien ihm aber nicht mehr ganz so schneidend, wie sie es früher einmal gewesen war. Der Wind, der vom Firth of Forth kam, hatte für ihn immer etwas Grausames gehabt. Das war allerdings, bevor er erlebte, welche Böen über die Donau peitschten.
Die vertrauten Anblicke und Gerüche der Stadt taten ihm gut. Erst als er sich zur Rückkehr durchgerungen hatte, hatte er gemerkt, wie sehr er Edinburgh vermisste, und falls ihm noch Zweifel an der Weisheit seiner Entscheidung geblieben waren, wurden sie wie Nebel fortgeblasen, als sein Blick auf die Tür der Queen Street 52 fiel.
Seine allererste Ankunft hier hatte er noch lebhaft vor Augen. Er war ungebührlich spät angekommen, in verschlissenen, speckigen Kleidern und mit einer frisch genähten Wunde mitten im Gesicht. Wie aus Reflex hob er die Hand an die linke Wange und fuhr mit dem Zeigefinger die Narbe nach. Er musste an den Verantwortlichen denken, verdrängte dessen hässliche Visage aber schnell wieder. Man sagte, ein gut gelebtes Leben sei die beste Rache, und gewiss hatten sich sein Schicksal und das des Angreifers in letzter Zeit wunderbar weit voneinander entfernt. Raven hatte jene Welt hinter sich gelassen, während der andere sicher noch dort feststeckte, wenn er denn überhaupt noch lebte.
Ungeachtet seiner Narbe war er zuversichtlich, dass sich sein Äußeres bedeutend verbessert hatte, seit er sich zum ersten Mal in diesem Hause vorgestellt hatte. Seine Garderobe wie auch seine Reisen hatten sich weitgehend aus den unfreiwilligen Zuschüssen eines anderen Herrn und vormaligen Besuchers dieses Hauses finanziert, der für solchen Luxus an seinem Ziel keine Verwendung hatte. Ravens Kleider waren neu, maßgeschneidert, und seine Stiefel waren auf Hochglanz poliert. Er fragte sich, ob man ihn derart verwandelt überhaupt wiedererkennen würde.
Als Raven die Queen Street 52 zum ersten Mal gesehen hatte, hatte sie ihm einen Weg zu Wohlstand und Ruhm mittels aristokratischer Patienten und prächtiger Honorare verheißen. Aber Professor Simpson hatte ihm gezeigt, was es wirklich bedeutete, Arzt zu sein. Dieses Haus und seine Bewohner hatten ihn als Menschen wachsen lassen und vor sich selbst gerettet. Nun, da er zurückgekehrt war, wollte er ihnen allen zeigen, was er aus sich gemacht hatte.
Er blieb an der Stufe stehen und malte sich aus, was sich drinnen wohl verändert hatte; sicher war nicht alles so geblieben, wie er es zurückgelassen hatte. Mit wohligem Schaudern erinnerte er sich an das Wirrwarr ungezähmten Menschentums, das hinter dieser Tür oft vorzufinden war. Vom Dachboden bis in den Keller trug das Gebäude den Stempel seines Herrn. Es war ein warmer, fröhlicher, geschäftiger, herausfordernder und inspirierender Ort; aber es konnte dort auch chaotisch sein, wirr, hektisch, schwierig, ja ganz und gar überwältigend. Tiere liefen wild herum, Kinder noch wilder, Patienten quollen aus den Wartezimmern, das Personal hetzte hin und her, um die Gäste zu bewirten, die der Professor aus dem Augenblick heraus eingeladen hatte, und irgendwie war es inmitten all dessen zu einer Entdeckung gekommen, die die Welt verändert hatte.
Er klingelte und fragte sich, wer wohl öffnen, welche Gesichter er gleich vor sich haben würde. Jarvis fiel ihm ein, Simpsons Respekt gebietender Butler, dessen Höflichkeit Raven gegenüber nur umso besser ausdrückte, wie gern er einen Haderlumpen wie ihn auf die Straße setzen würde. Er dachte an Mrs Simpson, die durchgängig Trauer trug wegen der kleinen Kinder, die sie verloren hatte, und sich aufopferungsvoll um die überlebenden kümmerte. Er dachte an ihre unverheiratete Schwester Mina, der das vermeintlich glückliche Ende ihrer langen Gattensuche das Herz gebrochen hatte. Aber vor allem dachte er an Simpsons Hausmädchen Sarah Fisher.
Ihr Bild hatte er auf seinen Reisen am häufigsten vor seinem inneren Auge heraufbeschwören wollen – ihre blasse Haut, ihr honigfarbenes Haar, ihre sanfte Berührung, als sie ihre selbst angerührte Salbe auf seine Wunde aufgetragen hatte. Er erinnerte sich noch an ihren Duft – Lavendel und frische Wäsche –, an ihre Haltung, an ihr Lächeln. Ebenso fiel ihm ihre Verachtung ein, ihr scharfer Verstand und ihre Neigung, sich um Kopf und Kragen zu reden, wenn sie eine Ungerechtigkeit nicht hinnehmen wollte. Aber seine stärkste Erinnerung galt ihren Küssen, dem Rausch der Gefühle, den er noch nie zuvor bei einer Frau erfahren hatte und auch seither nicht wieder.
Er schüttelte den Kopf, um sich von den Gedanken zu befreien. Solche Erinnerungen waren das vergangene Jahr über Trost und Qual zugleich gewesen. Der Zufall hatte sie zusammengeführt, aber infolge der geltenden Anstandsregeln wäre es für sie beide von Schaden gewesen, hätten sie sich auf eine Beziehung eingelassen, welcher Art auch immer. Seit seiner Abreise hatten sie keinerlei Verbindung gehalten. Absichtlich nicht. Während seiner Zeit in Paris und auch später in Wien hatte er ihr Briefe geschrieben, aber er hatte sie nie abgeschickt. Er war Doktor der Medizin. Sie war ein Hausmädchen. Alles, was über ein berufliches Miteinander hinausging, wäre ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Welche Zukunft hätten sie gehabt? Keine, die er sich ausmalen konnte. Das hatte er ihr vor seiner Abreise zu erklären versucht, aber sie hatte diese Wirklichkeit nicht anerkennen können; bis zum Letzten war sie eigensinnig und streitbar geblieben.
Er war davon ausgegangen, dass die Zeit der Trennung sein Verlangen nach ihr mildern würde, und es hatte auf seinen Reisen tatsächlich Episoden gegeben, während derer sie ihm zeitlich und örtlich so fern schien, wie sie es war; ein geschätzter Schritt in seinem Leben, von dem er sich aber immer weiter entfernte. Doch nun, als er dort an der Schwelle stand, wurde ihm sein erhöhter Puls bewusst, die Erregung seines Körpers, die seinen Verstand Lügen strafte.
Es war mehr als bloße Erregung – es war Sehnsucht. Und je näher er dem Wiedersehen kam, desto stärker wurde das Gefühl.
Deshalb war er etwas verwundert, als nicht Sarah die Tür öffnete, sondern eine andere junge Frau.
»Kann ich Ihnen helfen, Sir?«, fragte sie und spähte unter ihrer Haube hervor.
»Ja. Ich bin Dr. Will Raven, der neue Assistent des Professors.«
Ravens Stolz darauf, dass er sich nun so vorstellen konnte, verbarg seine Enttäuschung ein wenig. Das Mädchen trat zur Seite und ließ ihn eintreten. Er reichte ihr Hut und Handschuhe.
»Sehr wohl, Sir. Man sagte mir, dass Sie erwartet werden.«
»Sie sind neu hier, nicht wahr?«, sagte er und schaute an ihr vorbei den Flur entlang auf der Suche nach bekannteren Gesichtern.
»Bin nun schon fast einen Monat hier, Sir.«
»Ist der Professor zu Hause?«
»Nein, Sir.«
»Mrs Simpson?«
»Mrs Simpson und die Kinder besuchen jemanden.«
»Und Miss Grindlay?«
»Die ist bei ihrem Vater in Liverpool.«
Raven musste wieder an Mina und ihre enttäuschten Heiratspläne denken. Er hatte gehofft, dass sie mittlerweile einen geeigneten Lebensgefährten gefunden hätte, aber manches sollte einfach nicht sein, wie er nur zu gut wusste. Er spähte wieder den Flur entlang. Es war unheimlich still. Er hielt es nicht mehr aus.
»Wo ist denn Miss Fisher?«, fragte er.
»Miss Fisher, Sir?«
»Ja, sie ist ein Hausmädchen hier. Oder war es«, ergänzte er. Vor seiner Abreise hatte Sarah eine irgendwie geartete Beförderung erhalten, und er war sich unsicher, wie er ihre neue Stellung benennen sollte.
»Es gibt hier neben mir noch ein Hausmädchen, Sir, aber sie heißt nicht Fisher.«
Sie starrte ihn ausdruckslos an, und Raven seufzte. Das Mädchen hatte offensichtlich Sarahs Stelle übernommen, war aber ganz und gar kein Ersatz für sie.
Er lächelte ihr wohlwollend zu.
»Vielleicht kennen Sie sie ja einfach als Sarah.«
Eine Erkenntnis huschte ihr wie ein Schatten über das Gesicht.
»Ach. Sie meinen wohl die Miss Fisher von früher, Sir.«
Von früher? Raven packte die Angst, sein enttäuschtes Herz pochte wieder, und ihm drehte sich der Magen um. Was war mit Sarah geschehen? War sie tot? Man hätte ihn doch sicher unterrichtet, wenn ihr etwas Schlimmes zugestoßen wäre. Dann fielen ihm all seine nicht versandten Briefe ein. Vielleicht war einfach niemand darauf gekommen, ihm eine Mitteilung zu machen. Schließlich hatten sie ja sehr darauf geachtet, ihre Verbindung geheim zu halten.
Seine Hände waren feucht geworden. In diesem Augenblick kam alles zurück, und er verstand, dass seine Gefühle bei Weitem nicht verblasst, sondern durch Zeit und Ferne nur unterdrückt worden waren. Dann sah er, dass das Mädchen lächelte.
»Sie ist nicht mehr Miss Fisher, Sir. Sie ist jetzt Mrs Banks.«
Kapitel 5
Sarah war aufgestanden und hatte angefangen, Teetassen und Untertassen auf ein Tablett zu stellen, als sich eine Hand auf ihren Arm legte.
»Sarah. Das ist nicht nötig. Läute doch nach Mrs Sullivan.«
»Natürlich. Die Gewohnheit«, erwiderte sie und lächelte ihm verlegen zu.
Es war schon das zweite Mal an diesem Morgen, dass sie ihren neuerdings höheren Status vergaß. Wenigstens war das erste Mal unbemerkt geblieben. Sie hatte ihr gemeinsames Bett gemacht, und als es ihr bewusst wurde, war sie ohnehin schon halb fertig, also sah sie keinen Grund, das Werk unvollendet zu lassen.
Sie wachte noch immer früh auf und konnte sich nur schwer daran gewöhnen, dass sie nicht sofort aufspringen und eine endlose Reihe von Aufgaben erledigen musste.
Sarah setzte sich wieder und schaute aus dem Fenster. Sie war mit den Gedanken woanders, und sie wusste auch, wo.
»Ist alles gut, mein Schatz?«, fragte Archie.
»Ja, sehr gut«, erwiderte sie, auch wenn sie wusste, dass sie ihr Unbehagen nicht verbergen konnte. Archie sah ihr ihre Stimmungen stets sehr genau an, eine der vielen Qualitäten, die sie an ihm schätzte.
»Du wirkst bloß etwas unruhig. Bist du mit den Gedanken vielleicht schon in der Queen Street?«
Sarah fühlte sich entlarvt, verstand dann aber, was er meinte. Sie bewohnten nun zwar Zimmer in der Albany Street, doch sie begab sich weiterhin jeden Tag in die Queen Street. Sie war eine Spezialistin in der Verabreichung von Chloroform geworden und hatte sich dadurch unentbehrlich gemacht. Dr. Simpson prüfte den Stoff derzeit als Mittel gegen verschiedenste Leiden, von Menstruationskrämpfen bis zu Gallenkoliken. Die Arbeit mit dem Professor hatte sie nicht aufgeben wollen, und zum Teil daraus ging ihre Übereinkunft hervor.
»Ja. Ich muss an die Patientin denken, die heute kommt. Dr. Simpson hat mich vorgewarnt, dass es wahrscheinlich eine schwierige Sprechstunde wird.«
Sarahs Worte klangen ihr selbst hohl. Das mit der Patientin stimmte zwar, aber natürlich verbarg sie damit nur den wahren Grund, aus dem sie mit den Gedanken schon in der Queen Street war.
Raven.
Er sollte heute wiederkommen und war sicher schon da, wenn sie am Nachmittag zur Arbeit erschien.
Sie hatte schon lange kaum noch einen Gedanken auf ihn verwendet. Warum auch, bei allem, was aus ihrem Leben geworden war? Aber seit sie erfahren hatte, dass er die Stelle von Dr. Keith übernehmen würde, war ihr seine Rückkehr nicht mehr aus dem Kopf gegangen.
Warum das so war, wusste sie nicht so recht. Vielleicht war ihre Erinnerung nicht wegen Raven selbst so lebhaft, sondern wegen allem, wofür er stand – für die Zeit Dr. Simpsons großer Entdeckung, aber auch all der anderen damaligen Geschehnisse. Sie war große Risiken eingegangen, als sie an Ravens Seite mörderische Täuschungen und Verbrechen enthüllt hatte. Stehen Menschen gemeinsam bedrohliche Situationen durch, verwechseln sie möglicherweise die aufkommenden starken Gemütsbewegungen mit Gefühlen füreinander.
Auch wenn das alles noch nicht einmal zwei Jahre her war, erschien es ihr doch wie eine völlig andere Zeit. So vieles hatte sich geändert. Damals war sie doch noch ein Mädchen gewesen. Jetzt war sie eine Frau. Jetzt war sie verheiratet. Jetzt hatte sie Archie. Wenn es auch Raven gewesen war, der sie mit in die Gefahr hineingezogen und zu der Erkenntnis gezwungen hatte, wozu sie fähig war, war doch Archie der Mann, der ihr Leben wahrhaftig verwandelt hatte.
Sie sah ihren Gatten an, Dr. Archibald Banks, der in einem Sessel am Fenster saß und vor der Titelseite des Scotsman die Augen zusammenkniff. Er hatte zwar eine Lesebrille, setzte sie aber nur selten auf. Er sagte, damit sehe er aus wie ein alter Mann, da war er empfindlich, was auch mit dem Altersunterschied zwischen ihnen zusammenhing. Er war sechsunddreißig Jahre alt, man konnte ihn aber für deutlich jünger halten. Sarah hoffte, dass seine Jugendlichkeit ihm zugutekommen würde.
Sie hatte ihn kennengelernt, als er in die Queen Street kam, um sich mit den medizinischen Größen Edinburghs zu besprechen. Er kannte Dr. Simpson noch aus den gemeinsamen Studienzeiten, und die beiden waren Freunde geblieben. Er war gut aussehend, lebendig, eloquent, belesen und hatte sich als Mediziner fasziniert gezeigt von Sarahs Rolle und der Tatsache, dass es keine Bezeichnung für ihre Stellung mit all den Einsatzbereichen gab. Ihre wissenschaftliche Neugierde und ihre Entschlossenheit, sich zu bilden, verwunderten ihn nicht im Geringsten. Bei ihrem ersten längeren Gespräch hatte er zugehört, als könnte er etwas von ihr lernen. Ihr fiel kein anderer Mann ein, der das jemals getan hätte.
Er war ein wohlhabender Mann aus gutem Hause, und dennoch hatte er keine Skrupel, sich mit ihr sehen zu lassen. Wenn das Wetter es zuließ, gingen sie oft in den Queen Street Gardens spazieren und unterhielten sich über so vielfältige Angelegenheiten wie das aktuelle Zeitgeschehen und die Inhalte medizinischer Zeitschriften. Sie besuchten gemeinsam öffentliche Vorträge in den Assembly Rooms über alles Erdenkliche, von der Philosophie bis zur Phrenologie. Sie tauschten Romane aus und diskutierten nach dem Lesen angeregt darüber.
Unwillkürlich verglich sie seine Haltung mit der von Will Raven. Dieser war sogleich auf Distanz gegangen, als ihre Beziehung zu etwas Tieferem hätte werden können. Auf einmal war er zu beschäftigt gewesen, und seine Doktorarbeit hatte Vorrang vor ihr genommen. Und je näher das Ende seiner Studien rückte, desto unangenehmer schien ihm die Kluft des gesellschaftlichen Standes zwischen ihnen beiden. Er hatte keinen Zweifel daran gelassen, dass ihre Beziehung seiner Überzeugung nach hinderlich, unmöglich und leichtsinnig war.
Dann war er gen Festland abgereist, und seitdem hatte sie nichts mehr von ihm gehört.
Archie dagegen schien es nicht zu kümmern, wie man ihre Verbindung sah. Vom Geschwätz der Leute ließ sich ein Mann mit seiner Einstellung nicht einschüchtern. »Das Leben ist zu kurz, um sich wegen Belanglosigkeiten wie den Meinungen anderer von seinen Zielen ablenken zu lassen«, sagte er. »Eine wahre Gelegenheit ist von flüchtiger Natur und muss ergriffen werden, bevor sie einem entwischt.«
Das Leben ist zu kurz. Welch kluger Grundsatz.
Und doch kam es überraschend, als Archie ihr einen Heiratsantrag machte. Auch wenn nur noch ein immer kleinerer Teil ihrer Pflichten denen eines Dienstmädchens entsprach, wurde sie doch noch als ein solches betrachtet. Eine Freundschaft mit solch einer Frau war eine Sache, aber sie zu heiraten eine ganz andere.
Archie hatte seine Sicht der Dinge deutlich dargelegt: »Ich muss mich nicht mehr darum sorgen, ob ich wegen meines Verhaltens oder meiner Überzeugungen jemandes Unterstützung verliere. Ich kann wahrhaftig auf eine Art und Weise leben, wie es den wenigsten jemals möglich ist.«
Und am bedeutendsten war seine Zusicherung, dass er nicht von ihr erwartete, ihre lieb gewonnene Arbeit in der Queen Street aufzugeben. Anders als andere betrachtete er es nicht als sinnlos, dass sie ihr Wissen auf einem Gebiet ausweitete, von dem sie praktisch ausgeschlossen war. Unter diesen Umständen hatte sie sein großzügiges Angebot kaum ausschlagen können.
Da Sarahs Eltern nicht mehr lebten, hatte Dr. Simpson die Rolle des Brautvaters übernommen, und als Archie ihr vor dem Altar das Jawort gab, waren jegliche verbliebenen Gefühle für Dr. Simpsons einstigen Famulus bei ihr vergessen.
Während Ravens Abwesenheit war es ihr leichtgefallen, nicht an ihn zu denken, aber würde nun der Umkehrschluss gelten?
Das Rascheln von Archies Zeitung holte sie zurück in die Gegenwart, in der noch das Geschirr vom Frühstück auf dem Tisch stand. Sarah beugte sich schon wieder vor, um es abzuräumen, als sie sich besann und doch nach der Glocke griff.
»Meine Güte«, sagte Archie und strich die Seite vor sich glatt. »Innerhalb von zwei Wochen sind vier Mitglieder derselben Familie erkrankt und verstorben. Scheußlich. Es gibt doch immer einen armen Tropf, den es noch schlimmer trifft.«
»Waren sie denn sehr alt?«, fragte Sarah, die immer noch gegen den Drang ankämpfte, das Tablett selbst hinunter in die Küche zu tragen.
»Die Älteste war beinahe sechzig, aber auch ihr Sohn, seine Frau und deren gemeinsame Tochter sind gestorben, obwohl sie vorher bei guter Gesundheit waren.«
Sarah schaute mit plötzlicher Sorge auf.
»Was war denn die Ursache? Nicht etwa wieder die Cholera?«
Seit dem jüngsten Ausbruch herrschte große Furcht vor einer Rückkehr der Krankheit.
»Die Cholera wird nicht erwähnt. Angeblich sind alle eines natürlichen Todes gestorben.«
»Wo ist es denn geschehen? In der Old Town?«
Sarah musste an das Elend denken, das sie dort gesehen hatte, die überfüllten und schmutzigen Häuser dieses Stadtteils, unter deren bedauernswerten Bewohnern jegliche Seuchen ungehindert wüten konnten.
»Nein, in Trinity. Ein schönes Haus mit Blick auf den Forth, wie es heißt.« Archie schaute sie an und grinste. »Wer wohl der glückliche Erbe ist? Auf jeden Fall sollte man einmal seine Taschen nach Arsen durchsuchen.«
Sarah lachte, auch wenn ihr Instinkt sie immer noch zur Vorsicht gemahnte, sich damit keine Missbilligung zuzuziehen. Wessen Missbilligung das in diesem Fall sein sollte, hätte sie nicht sagen können – der Reflex war ein weiteres Überbleibsel ihrer Jahre als Hausmädchen. Archie war sich dessen bewusst, deshalb genoss er ihre Reaktion auf seine Bemerkung besonders.
Archie selbst lachte trotz allem bei jeder Gelegenheit. Das war einer der Gründe, warum er sich so gut mit Simpson verstand.
Er faltete die Zeitung, legte sie auf den Tisch und nahm das Monthly Journal of Medical Science in die Hand. Sarah war aufgefallen, dass er nur noch selten länger mit seiner Aufmerksamkeit bei einer Sache verweilen konnte, seit er geringe Dosen Morphium gegen die Schmerzen im Hals nahm.
Er blätterte um und seufzte. »Ach Gott. Noch ein Brief.«
»Nicht schon wieder der Matratzendisput?«
»Leider schon.«
»Wer ist es denn diesmal?«
»Professor Miller. Es ist unfassbar. Solche Streitereien kann die Medizin nun wirklich nicht gebrauchen. Und die Seiten einer medizinischen Zeitschrift sind ganz und gar nicht der rechte Ort, um solche kleinlichen, persönlichen Fehden auszutragen. Das sollten die Herren besser wissen.«
»Dabei sind es kaum mehr als Gerüchte. Welche Beweise haben sie denn für ihre Anschuldigungen?«
»Der Polsterer, Mr Hardie, hat wohl bestätigt, dass die Matratze der Patientin blutbefleckt war.«
»Das ist kaum überzeugend. Wenn sie behaupten, sie sei verblutet, müssten sie die Blutmenge belegen, nicht das bloße Vorhandensein von Blut. Ich glaube, das in dieser Angelegenheit entscheidende Organ ist die Leber. Nämlich die dieser feinen Herren, denen offensichtlich eine Laus über selbige gelaufen ist.«
Archie nickte mit einem Lächeln, das ihr das Herz wärmte. Es war so schön, wenn sie ihm eine Freude bereiten konnte. Wie sie einander Freude bereiteten. Doch wie immer, wenn sie sich dieses Glückes bewusst wurde, überkam sie auch die gewohnte Schwermut.
Sie fragte sich, wie viel Zeit ihnen miteinander bleiben würde. Vielleicht fragten sich das alle Eheleute von Zeit zu Zeit. Doch nicht jeden Tag.
Kapitel 6
Falls mir ein Fehler unterlaufen ist, dann der, vier Mitglieder derselben Familie zu töten.
Im Nachhinein verstehe ich, wie auffällig das gewesen sein mag. Vielleicht hatte ich mich von meinen Gelüsten blenden lassen, aber zu meiner Verteidigung kann ich sagen, dass auch solch eine Tragödie nicht unbedingt Aufsehen erregen musste. Es kommt immer wieder vor, dass mehrere Angehörige desselben Haushaltes sterben. Die letzte Epidemie raffte in der Stadt ganze Familien hin.
Aber vielleicht ist eine gewisse Nachlässigkeit unausweichlich, wenn die eigenen Taten so lange unbemerkt bleiben.
Jahrelang hat schlichtweg niemand glauben wollen, dass eine Frau zu so etwas fähig sein könnte. Sie ist die gute Fee des Hauses, die sich um die Familie kümmert. Die Leute konnten sich nicht vorstellen, dass ich ihre Lieben tötete, weil sie es sich nicht gestatteten. Denn wo würde es unsere Gesellschaft hinführen, wenn Frauen sich ihrer zugewiesenen Rolle widersetzten und sich ihrer vermeintlich sanften Natur entledigten?
Aber man möge bitte nicht den Fehler machen, mich für gleichgültig, gefühllos oder liebesunfähig zu halten. Nein, ich bin keine Mutter. Aber ich weiß, was es heißt, für ein Kind zu sorgen, denn schon viele wurden meiner Obhut anvertraut, zuletzt die kleine Eleanor. Ich verstand, dass sie in ihrer Zerbrechlichkeit, ihrer Verletzlichkeit umso kostbarer war. Ich verstand die Hoffnung, die sie für ihre Eltern verkörperte, die Essenz ihrer selbst, die sie in den Zügen der Kleinen wiedererkannten. Ich wusste genau, wie viel sie ihnen bedeutete. Wie sonst hätte ich ein solches Machtgefühl ableiten, solchen Stolz daraus ziehen können, als ich sie ihnen nahm?
Niemand kennt den Wert eines Lebens, der nicht selbst eines beendet hat. Und nichts gleicht dem Auslöschen eines so jungen Lebens, eines Kindes, das die Ungeheuerlichkeit des Geschehens nicht begreifen kann, das nicht ahnt, was es alles verlieren wird.
Die kleine Eleanor war mir ans Herz gewachsen. Wem wäre es anders ergangen? Sie war so ein Schatz. Ich habe immer noch den Schimmer ihrer Augen vor mir, ihre Lebhaftigkeit, die Freude, die ihre Neugierde und Verschmitztheit ihren Eltern bereitete. Sie war ein kluges Mädchen mit starkem Willen und ausgeprägtem Gespür. Auf ihre eigene, ahnungslose Weise hat sie sich gegen mich gewehrt. Doch ihre Eltern wurden meine Verbündeten, nicht ihre, als sie die Kleine drängten, mir zu gehorchen.
»Du musst deine Medizin nehmen«, beharrten sie.
»Die mag ich nicht«, widersprach Eleanor dann. »Und Mary auch nicht.«
»Sie will nur helfen, dass es dir wieder besser geht.«
Aber das wollte ich nicht.
Für mich ist das Leid anderer wie ein guter Wein, und das bedeutet nicht allein, dass ich es genieße; ich koste seine vielfältigen Aromen und Texturen, die dezenten Noten, die eine Sorte von der anderen unterscheiden. Der Kummer ihrer Eltern bot ein mächtiges Schauspiel, als Eleanor starb. Möglicherweise wäre es Ihnen unerträglich gewesen, vielleicht könnte man gar sagen, dass es eine Gnade meinerseits war, ihrem Leid bald ein Ende zu setzen.
Ich tötete ihre Mutter und bald darauf ihren Vater. Als Letzte tötete ich die Matriarchin des Hauses, Eleanors Großmutter. Ich wollte sie die Verheerung sehen lassen, bevor auch sie dahingerafft wurde. Sie musste leiden. Menschen wie sie kannte ich schon. Doch alles zu seiner Zeit.
Ich fürchte niemandes Urteil. Möglicherweise wünschen Sie, mich zu verstehen, und das ist ganz in meinem Sinne. Aber dazu müssen Sie zunächst wissen, dass Sie überhaupt nichts verstehen werden, wenn Sie mich für ein Scheusal, für eine Bestie halten.
Zweifellos haben Sie Gemälde der Hölle gesehen und sind vor den geifernden Fratzen der Dämonen erschrocken, welche die Verdammten quälen. Doch wie viel furchterregender ist die Erkenntnis, dass ein wahrer Dämon ein freundliches Gesicht hat.
Schaue ich mir solche Gemälde an, sehe ich nur Personifikationen von Bosheit und Grausamkeit, als stünden sie für sich selbst. Doch verschweigen sie stets, woher solche Bosheit und Grausamkeit kommen. Denn eines weiß ich: Jeder wahre Dämon war einst ein Kind, das Furcht und Leid erlebt hat.
Jeder wahre Dämon hat die Grausamkeit und Bosheit von einem anderen lernen müssen.
Kapitel 7
Raven hörte nichts als das Ticken der Uhr, während er in Dr. Simpsons Büro auf dem Sessel am Feuer saß und sich auf unbehagliche Weise einsam fühlte. Er konnte sich nicht daran erinnern, dass das Haus früher je so still gewesen wäre. Es schien ihm leer, nicht bloß der vertrauten Menschen beraubt, sondern auch so viel anderem. Nichts war mehr, wie er es sich vorgestellt hatte, aber sein Gefühl der Isolation beruhte nicht allein auf der Abwesenheit der Familie.
Sarah war verheiratet.
Die Worte des Hausmädchens hallten ihm immerfort im Kopf wider: Sie ist nicht mehr Miss Fisher, Sir. Sie ist jetzt Mrs Banks. Er hatte sie sofort verstanden, und doch war ihm das Gesagte unbegreiflich.
Jarvis hatte ihn zu seinem neuen Zimmer geführt und ihm geholfen, seinen Koffer die Treppe hinaufzuwuchten. Der Butler hatte angemerkt, Raven sehe »nun weniger wie ein Haderlump aus als bei Ihrem ersten Besuch in unserem Hause«. Das war nun nicht gerade ein großzügiges Kompliment, aber ein wärmeres Willkommen hatte es nicht gegeben.
Ravens neues Zimmer war größer und vornehmer als das alte, in dem er als Famulus gewohnt hatte. Und doch sehnte er sich auch nach dessen Vertrautheit, aber womöglich wünschte er sich nur, alles wäre wie früher.
Raven hatte seine Sachen ausgepackt, um sich die Zeit zu vertreiben, wobei er jedes Mal innehielt, wenn er die Haustür hörte, um nach Dr. Simpsons schallender Stimme zu horchen. Bisher war aber nichts geschehen. Das Fenster bot einen Blick auf die Queen Street Gardens, und er spähte jedes Mal hinaus, wenn er Hufgetrappel hörte, weil er hoffte, den Brougham des Professors zu sehen.
Schließlich war er nach unten gegangen und hatte Jarvis gefragt, wann denn mit dem Professor zu rechnen sei.
»Jeden Augenblick«, versicherte ihm der Butler und führte ihn in Dr. Simpsons Büro. Raven erkannte den Ton wieder. Es war derselbe, dessen Jarvis sich auch bei ungeduldigen Patienten und anderen Besuchern bediente. »Jeden Augenblick« wurde zu beinahe einer Stunde, und Raven war vom ewigen Ticken der Uhr schon schläfrig geworden, als ihn das Rumpeln einer haltenden Kutsche aufschrecken ließ. Er stand auf, als er die Haustür hörte, und Augenblicke später rauschte auch schon Dr. Simpson herein und erfüllte das Haus augenblicklich mit seiner Gegenwart.
»Will Raven! Welche Freude, Sie wiederzusehen. Und just zur rechten Zeit. Wir haben eine interessante Patientin zu behandeln. Eine junge Frau mit bedenklicher Bauchauftreibung.«
Raven lächelte vor Erleichterung, dass sich manches offensichtlich nicht geändert hatte. Er musste an seinen ersten Tag in der Queen Street denken, als man ihm nicht einmal eine Tasse Tee angeboten hatte, bevor er mit dem Professor in die Kutsche springen und zu einem dringenden Entbindungsfall hatte fahren müssen.