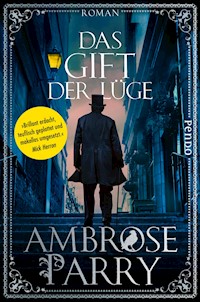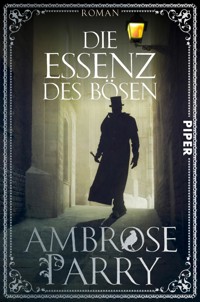
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Mord und Medizin in Edinburgh - der dritte historische Kiminalroman von Ambrose Parry der Morde in Edinburgh-Reihe 1850: Ein grausamer Fund erschüttert Edinburgh und sogar den sonst so abgebrühten Will Raven. Dann bittet ihn auch noch ein ehemaliger Widersacher um Hilfe, der fälschlicherweise eines Giftmords beschuldigt wird. Will geht dem Grund dieser sich überschlagenden Ereignisse auf die Spur, doch dafür benötigt er ausgerechnet die Hilfe von Sarah Fisher. Die beiden wollten nicht nur getrennte Wege gehen, Sarah ist zudem fest entschlossen, Medizin zu studieren. Dennoch ermitteln die beiden erneut gemeinsam und entdecken, dass nicht mal Reichtum und Status Schutz bieten vor den Abgründen Edinburghs … »Parrys viktorianisches Edinburgh wird auf eindringliche Weise lebendig – als Welt des Schmerzes.« Val McDermid Ambrose Parry ist das Pseudonym des preisgekrönten Krimi-Autors Christopher Brookmyre und seiner Frau, der promovierten Anästhesistin Marisa Haetzman. Brookmyres Feder und Haetzmans Fachwissen sind die perfekten Zutaten für eine Krimi-Serie, die Sie nicht loslassen wird! Sherlock Holmes trifft Jack the Ripper – und die Jagd geht weiter! Die »Morde von Edinburgh«-Reihe fügt dem viktorianischen Historienroman ein neues, schauriges Kapitel hinzu, das sich vor den großen Vorbildern des Genres nicht verstecken muss. Denn mit den sympathischen Protagonisten Will Raven und Sarah Fisher hat Ambrose Parry ein neues Powerpaar erschaffen, dem seine Fans in jedes Abenteuer folgen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für unsere Eltern
Grace und Jack, Alicia und Gerry
© Christopher Brookmyre and Marisa Haetzman 2021
»A Corruption of Blood«, Canongate, Edinburgh 2021
© Piper Verlag GmbH, München 2023
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: u1 berlin / Patrizia Di Stefano
Covermotiv: Mark Owen / Arcangel Images
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
1850
Edinburgh
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Historischer Hinweis
Danksagung
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
1850
Edinburgh
Kapitel 1
Ein Buch ist bereits geschrieben, ehe die Leserin oder der Leser den ersten Blick auf die Seite wirft. Die erzählte Geschichte schafft die Illusion eines ungewissen Ausganges und zahlloser Möglichkeiten, doch in Wahrheit sind alle Geschehnisse vorherbestimmt und folgen einer geordneten Reihung, die sich nicht verändern, sondern bloß betrachten lässt. War dies auch bei einem Menschenleben so? War unser Schicksal entschieden, noch ehe wir schreiend auf die Welt geholt wurden – diktiert durch Herkunft und Umstände, durch all das, was unsere Vorfahren uns geben konnten oder nicht, und durch das, zu dessen Weitergabe sie unwissentlich gezwungen waren?
Dies waren die Gedanken von Dr. Will Raven, während er eine marode Treppe in Leith emporstieg. Die Umgebung verhieß nichts Gutes für das Kind, zu dessen Geburt man ihn gerufen hatte. Ebenso fragte er sich, was in seinem eigenen Blut verborgen lag – eine stete Sorge – und was daraus folgen könnte, sollte er eines Tages selbst ein Kind zeugen.
Die gesuchte Adresse lag in der Old Sugarhouse Close, einem baufälligen Gebäude neben der Kerzenfabrik. Die Luft war schwer vom Talggeruch, vom speckigen Gestank geschmolzenen Eingeweidefetts. Auch andere, rohere Noten waren wahrzunehmen, denn auch die Fleisch-, Geflügel- und Fischmärkte befanden sich in unmittelbarer Nähe. Die Düfte des Letzteren lagen stets in der Brise, denn so nah am Hafen war das Fischaroma allgegenwärtig wie das Schreien der Möwen.
Raven fand die richtige Tür und wollte gerade klopfen, als er es schreien hörte. Er hielt inne. Es klang nicht nach den Qualen einer Frau in den Wehen, sondern nach dem herzhaften Brüllen eines gesunden Neugeborenen.
Er seufzte. Es war ein weiter Weg hinaus nach Leith gewesen. So etwas kam natürlich vor. Uti veniebam natus: bei meiner Ankunft bereits geboren. Das war ein recht häufiger Eintrag im Fallbuch für die Hausbesuche. Der Professor sagte gern, so sei auch ihm der örtliche Hausarzt erspart geblieben. Und dann musste er stets geschäftig weitereilen.
Raven klopfte. Er hörte hastige Schritte, dann ging die Tür auf, und vor ihm stand eine grauhaarige Frau mit dem nackten Kind auf dem Arm, die Haut noch voller Blut und Käseschmiere.
Raven hielt seine verschlissene Ledertasche empor, um sich auszuweisen.
»Ich brauche wohl nicht mehr zu fragen, ob ich hier richtig bin – ich bin wegen Mrs Corrigan da.«
»Haben sich ja Zeit gelassen«, sagte die Frau.
Er nahm an, dass es sich um die örtliche Hebamme handelte. Die Frauen dieser Zunft duldeten meist nur ungern das Eindringen eines Arztes in ihr Revier. Des neunmalklugen Accoucheurs mit seiner Zange.
Er lächelte, beschwichtigend, wie er hoffte.
»Dr. Raven. Zu Diensten.«
Die Frau versperrte ihm noch einen Moment den Weg, bevor sie schließlich doch beiseitetrat. Ein kurzer Flur führte zu zwei geschlossenen Türen.
»Wo ist die Mutter?«, fragte er.
Sie nickte in Richtung eines der Zimmer. »Da drinnen. Die Nachgeburt muss sich noch lösen.«
»Wie lang ist die Geburt her?«
»Eine Weile.«
»Könnten Sie vielleicht die ungefähre Zeit einschätzen?«
»Nicht lang her.«
»Gab es eine Blutung?«
Sie sah ihn schief an. »Wenn ein Kind zur Welt kommt, gibt es immer ein bisschen Blut.«
»Ich meine eine starke Blutung. Schwallartig.«
»Wenn das so wäre, würde ich wohl kaum hier stehen und mit Ihnen plaudern.«
Ihm fiel eine Seekarte an der Wand auf.
»Der Vater ist Seemann?«, fragte er.
Die Frau schaute finster und deutete ein Nicken an, vielleicht wollte sie durchscheinen lassen, dass dies in Leith keine allzu raffinierte Folgerung war.
»Er ist auf See.«
»Wann kommt er wieder?«
Sie verdrehte die Augen. »Die Frage ist eher, ob als wann, würde ich sagen.« Sie sprach leiser. »Die Mutter heißt Miss Corrigan«, ergänzte sie spitz.
Raven öffnete die Tür und betrat eine kleine Kammer mit einem Bett und sonst nicht viel. Es war ein vertrauter Anblick: ein Haushalt, der kaum das Essen für einen weiteren Mund zusammenbekommen würde.
Schon oft hatte er Tiraden von Kirchenmännern und Politikern gehört über die Armen, die Kinder kriegten, die sie weder ernähren noch kleiden konnten. Derartige Empörung wucherte auf dem fruchtbaren Boden der Unwissenheit.
Die Luft war feucht und drückend. Über dem Bett gab es ein kleines Fenster, aber um es zu öffnen, hätte man über die Patientin hinwegsteigen müssen. Ein dünnes Laken bedeckte sie, und ihr Bauch zeichnete sich immer noch als erhabene Wölbung ab. Der Anblick gefiel Raven nicht. Der Uterus hätte sich in der Zwischenzeit schon weiter zusammenziehen sollen.
Er stellte seine Tasche ab. Miss Corrigan hatte die Augen geschlossen, aber ihr Gesicht war von guter Farbe, und ihr Atem ging regelmäßig. Raven nahm sanft ihre Hand und fühlte den Puls. Schnell, aber kräftig. Derart versichert sprach er ihren Namen und stellte sich vor. Sie öffnete die Augen. Er erklärte, was er nun tun werde. Sie nickte.
Raven zog die Jacke aus, krempelte die Ärmel hoch und legte behutsam die Hände auf den gewölbten Unterleib. Unter den Augen der alten Frau holte er das Stethoskop aus der Tasche und horchte. Er spürte, wie der Uterus sich verhärtete und wieder entspannte. Zuletzt untersuchte er den Geburtskanal und den Muttermund.
Das Kind war mittlerweile getröstet, und im Zimmer war es still.
Die alte Frau schnaubte. »Machen Sie das zum ersten Mal? Wissen Sie überhaupt, wonach Sie suchen müssen? Es ist wie ein Stück altes Seil. Ziehen Sie daran, dann kommt die Nachgeburt schon.«
Raven sah sie an und zog die Augenbrauen hoch.
»Wahrscheinlich wäre es besser, wenn ich zunächst das andere Kind hole«, sagte er.
Die Geburt der Zwillingsschwester verlief ohne weitere Vorkommnisse, und Raven bedurfte keiner Hilfe beim Hervorholen der Nachgeburt. Allzu lang staunte die alte Frau nicht darüber, was sie übersehen hatte, fand vielmehr bald wieder zurück zu ihrer vorherigen Haltung und beobachtete Raven mit Argusaugen.
Aber ihre Überraschung war nichts gegen die der Mutter. Diese schien überwältigt und geradezu entsetzt von der Ankunft des unerwarteten Kindes. Für Menschen von bescheidenen Mitteln waren Kinder zuweilen Segen und Fluch zugleich. Zwar konnten sie arbeiten und zum Einkommen der Familie beitragen, sofern sie die frühe Kindheit überlebt hatten, doch wie sollte die Mutter zwei auf einmal ernähren, während ihre eigene Arbeitskraft stark gemindert war, solange sie sich um die beiden kümmern musste? Wenn das Leben der beiden Mädchen so begann, wie sollte es dann weitergehen, fragte Raven sich.
In solchen Momenten tröstete er sich mit dem Gedanken an Simpsons eigene bescheidene Herkunft als siebter Sohn eines Bäckers in Bathgate. Niemand hatte die Wahl, was er erbte, in welches Haus er geboren wurde und was ihn dort erwartete: Reichtum oder Armut, Liebe oder Grausamkeit, Hege oder Verwahrlosung. Aber Simpson hatte bewiesen, dass das Schicksal eines Menschen nicht von seinen Ausgangsbedingungen vorherbestimmt war.
In Ravens Augen galt auch, was als die andere Seite der Medaille bezeichnet werden mochte. Wurde man wohlhabend geboren, war es nicht mehr besonders schwer, seine Spuren zu hinterlassen, und entsprechend sollten auch die Leistungen eines Menschen bewertet werden, doch dieser Standpunkt erfreute sich bei den Reichen keiner großen Beliebtheit. Mit einem Lächeln erinnerte er sich an den Kommentar seines Freundes Henry über einen vornehmen Kommilitonen, der Menschen »von niedriger Geburt« allzu gern für ihr Schicksal selbst verantwortlich machte: »Er kann sich ein hartes Urteil erlauben, schließlich hat er seine Eltern mit Bedacht gewählt.«
Als Raven wieder hinaus in die Old Sugarhouse Close trat, stand die Frühsommersonne bereits so hoch, dass ihre Strahlen ihn zwischen den Häusern fanden. Er umfasste seine Taschenuhr, denn die Menschen drängten sich enger, je näher er der Leith Shore kam. Hier verrichteten oftmals geschickte Hände ihr Werk, auf die jeder Chirurg hätte neidisch sein können. Die Uhr war das einzig Wertvolle, was sein Vater ihm hinterlassen hatte, doch ein Erbe konnte er sie kaum nennen.
Mit jedem Schritt wurde die Menge dichter, während er die Tolbooth Wynd entlangkam, was vermuten ließ, dass vor Kurzem ein Schiff angelegt hatte. Das hatte bedenkliche Konsequenzen für seine Aussicht, ein freies Hansom Cab zu finden. Er würde wohl laufen müssen. Das Wetter war zwar durchaus angenehm, aber die Zeit arbeitete gegen ihn. Wegen Ravens Ausflug nach Leith musste sein neuer Kollege Dr. Morris der Morgensprechstunde nun allein Herr werden.
Während er überschlug, wie schnell er die Strecke zu Fuß zurücklegen könnte und wie große Feindseligkeit ihm aufgrund des Verzuges in der Queen Street entgegenschlagen würde, fiel ihm ein Grüppchen auf, das sich an einem ruhigeren Bereich des Kais versammelt hatte. Die Leute blickten über die Kante ins Wasser. Ein Mann in ihrer Mitte holte mit einer Angelrute etwas herauf.
Es war eine Art Päckchen. Die Rute bog sich, als er es anhob, und Wasser lief heraus.
»Es sieht schwer aus«, sagte jemand, als es behutsam auf den Boden gesenkt wurde.
»Tja, voller Sovereigns wird’s wohl nicht sein, falls du das gehofft hast«, erwiderte der Angler.
»Weißt du doch erst, wenn du reinguckst.«
Der Erste schnaubte und schüttelte den Kopf. »Wenn’s oben schwimmt und nicht sofort auf den Grund des Forth sinkt, dann kann ich dir sagen, dass es nicht voller Goldmünzen ist.«
Sie standen da und starrten das Päckchen an. Niemand machte Anstalten, es zu öffnen.
»Stinkt ein bisschen«, sagte eine Frauenstimme.
»Du stehst ja auch im Windschatten vom alten Geordie«, kam die Antwort, und vereinzeltes Lachen schallte aus der Menge zurück. Der genannte Alte verfluchte seinen Beschuldiger wortreich, was für weiteres Gelächter sorgte, und immer noch schien niemand gewillt, sich dem geborgenen Gegenstand zu nähern, geschweige denn ihn zu öffnen.
»Lassen Sie mich sehen«, sagte Raven und hielt seine Tasche empor. »Ich bin Arzt.«
Als Mediziner war er es gewohnt, in einer Lage die Zügel zu ergreifen und sich der Dinge anzunehmen, die anderen unappetitlich erschienen. Die Schaulustigen traten bereitwillig beiseite.
Als er sich nach vorn gearbeitet hatte, stieg auch ihm der Geruch aus dem Päckchen in die Nase, und er verstand das Zögern der Leute. Er kniete sich daneben, holte ein Messer aus der Tasche und schnitt die Schnur auf. Durch die Menge ging ein lautes Keuchen, als er das Packpapier zur Seite schlug und eine winzige Hand zum Vorschein kam. Widerwillig öffnete er das Päckchen weiter, bis Kopf und Rumpf eines Säuglings zutage lagen – ein Menschenkind, eingewickelt und fortgeworfen.
Der Angler schniefte und wischte sich die Nase am Ärmel ab. »Hab ja gesagt, es ist kein Gold«, sagte er.
Eine Welle des Mitleids ergriff Raven. Als Geburtshelfer hatte er eigentlich schon genug kleine Leichen gesehen, als dass ihm der Anblick eines weiteren toten Säuglings noch allzu sehr zusetzte. Er hatte sie gehalten, während sie noch warm waren, und gewusst, dass ihnen kein einziger Atemzug über die Lippen kommen würde, während die Mütter noch hoffnungsvoll zusahen. Doch diesmal ging es ihm nahe. Vielleicht lag es an der Zerbrechlichkeit der Zwillinge, bei deren Entbindung er am Morgen geholfen hatte. Er hatte sich um ihren Lebensanfang gesorgt, aber das hier erinnerte ihn daran, dass es für manche überhaupt keinen Anfang gab.
Kapitel 2
Ravens Rückkehr in die Queen Street verzögerte sich, weil er auf die Polizei warten musste. Die meisten Schaulustigen waren gegangen, und er hatte sich einen Platz knapp außer Riechweite des Päckchens gesucht. Da er sich nicht mit einer Unterhaltung ablenken konnte, leisteten ihm nur seine Gedanken Gesellschaft. Er kehrte zu einer früheren Sorge zurück und zu dem Grund, warum diese so drängend erschien.
Er hatte die Frau gefunden, die er heiraten wollte.
Raven war selbst überrascht von der Kraft seiner Gefühle für sie, Gefühle, die er eine Weile unterdrückt hatte, weil er geglaubt hatte, man würde sie beide nicht als geeignetes Paar betrachten. Doch zuletzt war er fest entschlossen, jegliches Hindernis zu überwinden, das ihm im Wege liegen mochte, und er hatte sich gestattet, eine Eheschließung ernstlich in Betracht zu ziehen. Endlich war in Reichweite, wonach er sich lange gesehnt hatte. Sie war eine Frau mit dem Wissen und der Erfahrung, um ihm in seinem Berufsleben beizustehen, ihm bei der Führung seiner eigenen Praxis zu helfen, und dazu würde sie auch bereit sein. Sie würde sich nicht mit der Rolle der Gattin und Mutter abfinden. Nichtsdestoweniger wusste er, dass sie gewiss auch dies zu sein wünschte, und obwohl Raven ebenfalls Kinder wollte, sorgte er sich doch, was er an diese weitergeben würde. Denn jeden Tag fürchtete er sich davor, was man an ihn weitergegeben hatte.
Du hast den Teufel in dir, hatte seine Mutter ihm oftmals gesagt. Anfangs im Scherz, später in Angst. Denn sie wussten beide, woher dieser Teufel stammte – wessen Blut durch Ravens Adern floss.
Du bist nichts als ein nutzloses Maul an meinem Tisch, hatte sein Vater ihm nur zu gern gesagt, eine gierige Hand in meiner Tasche. Und meist blieb es nicht bei Vorwürfen allein. Zuweilen wünschte Raven, sein Vater könnte sehen, was aus ihm geworden war – ein Arzt, Assistent des berühmten Dr. James Young Simpson. Doch häufiger war er dankbar, dass ihm dieser Mann nie wieder unter die Augen kommen würde.
Wäre sein Vater von seiner bisherigen Laufbahn beeindruckt gewesen? Ein Studium der Medizin an der University of Edinburgh, weitere Bildung an einigen der größten medizinischen Institutionen Europas und nun Assistent des Mannes, der mit seiner Entdeckung der anästhetischen Eigenschaften des Chloroforms die Welt verändert hatte? Zweifellos hätte sein Vater jede einzelne dieser Leistungen zu verunglimpfen gewusst. Ein verbitterter, enttäuschter Mann, der sich vom Erfolg seines Sohnes bedroht gefühlt hätte.
Raven wusste, dass seine Lage durchaus beeindruckend klingen mochte, doch lag dies vor allem daran, dass das Strahlen des großen Dr. Simpson auch einen gewissen Schimmer auf ihn abfallen ließ. Das Tagesgeschäft war weit weniger glanzvoll. Simpson arbeitete mit Aristokraten, Königsfamilien gar – seine Patienten reisten aus aller Welt an und mieteten sich in vornehmen Hotels an der Princes Street ein, wo sie Tage oder Wochen auf einen Termin warteten. Ravens Alltag dagegen war ein Hausbesuch in Leith, wo er eine Frau von bedauernswerten Zwillingen entband, nur um kurz darauf am Kai bei einem toten Säugling zu wachen.
Nach einiger Zeit kamen zwei einfache Polizisten zu ihm, denen man aufgetragen hatte, die kleine Leiche auf die Wache an der High Street zu schaffen, wo sie der Polizeichirurg untersuchen sollte. Raven gab seine Aussage ab, was einiger Zeit bedurfte, da der betreffende Polizist nur quälend langsam mitschrieb. Raven schätzte ihn als einen Burschen von der Sorte ein, die beim Lesen die Lippen mitbewegt.
»Wann wird die Leichenschau etwa stattfinden?«, fragte Raven.
Der Polizist zuckte mit den Schultern, während er weiterkritzelte und in höchster Konzentration die Zungenspitze zwischen den Zähnen hervorstreckte.
Raven schaute zu dessen Kollegen hinüber, der um das Päckchen am Kai herumschlich. Er hielt hinter dem Rücken die eine Hand mit der anderen, als traute er sich nicht, das Bündel anzufassen, falls es sich als gefährlich herausstellte.
»Hoch zu McLevy, oder?«, sagte er.
Bei dem Namen allein erstarrte Raven. Das war eine weitverbreitete Reaktion, die besagten McLevy durchaus erfreute. Sein Ruf verbreitete Angst und Schrecken auf den Straßen der Stadt, außer natürlich unter den feineren Herrschaften Edinburghs, die sich recht sicher sein konnten, niemals die Hand des Detectives am Schlafittchen spüren zu müssen.
Raven ahnte, dass McLevy sich dieser grausamen Entdeckung persönlich annehmen würde, da er eine solche Angelegenheit gewiss nicht an einen seiner Untergebenen delegieren wollte. Nichtsdestoweniger wollte Raven selbst der Leichenschau gern beiwohnen, da nun seine Neugierde geweckt war. Bedauerlicherweise kannte er den Polizeichirurgen Dr. Struthers noch nicht persönlich, doch sein alter Freund Henry Littlejohn war nun Assistenzpathologe an der Infirmary und unterstützte jenen gelegentlich. Raven war sich sicher, dass Henry ihn vorstellen würde, wenn er freundlich darum bat.
Verschwitzt kam Raven an der Queen Street 52 an, nachdem er in der mittlerweile wärmeren Sonne zurückgeeilt war. Als er durch die Haustür hastete, stolperte er fast über die Taschen, die sich im Flur stapelten.
Ihm ging das Herz auf, weil er glaubte, Sarah wäre zurückgekehrt, auch wenn ihr letzter Brief eine Verlängerung ihrer Reisen angedeutet hatte – London, Paris und schließlich Bad Gräfenberg. Dann sah er Jarvis, Dr. Simpsons Butler und Faktotum, eine der Taschen in Dr. Simpsons Büro tragen. Ihm fiel ein, dass Dr. Simpson auf dem Land gewesen war, um den Erben eines großen Anwesens auf die Welt zu holen. Zweifellos füllte sich nun die Speisekammer mit einigen Geschenken zusätzlich zum bedeutenden Honorar des Professors – die Freigebigkeit eines Lairds voller Dankbarkeit für die sichere Geburt seines Kindes. Die Verheißung von Wildpasteten zum Abendessen half, die Gedanken an tote Kinder und feindselige Detectives zu vertreiben.
Lizzie, das Hausmädchen, tauchte neben ihm auf und nahm ihm Mantel und Hut ab. Mit einem Schnaufen gab sie das Kleidungsstück an Christina weiter, das neue Mädchen, das ihr zur Seite stand. Christina war noch nicht lang im Haus, war aber ebenso pflichtbewusst wie duldsam, ganz im Gegensatz zu ihrer oftmals brodelnden und gelegentlich Furcht einflößenden Kollegin. Ein fröhliches Gemüt hatte Christina allerdings nicht. Über dem Mädchen schien ein Schleier ewiger Melancholie zu liegen, der sich in der Zusammenarbeit mit Lizzie wohl auch nicht ohne Weiteres heben würde.
Lizzie zeigte auf den Matschfleck, der den Mantel verunzierte und entstanden war, als Raven sich am Kai niedergekniet hatte, um das Päckchen zu untersuchen.
»Das musst du ausbürsten«, sagte sie zu Christina. »Dr. Raven neigt dazu, so einiges an Schmutz von seinen Runden mit heimzubringen. Manchmal habe ich sogar seinen Mantel draußen mit dem Teppichklopfer bearbeiten müssen.« Sie warf Raven einen gestrengen Blick zu, als forderte sie ihn heraus, zu widersprechen.
»Was würde ich nur ohne Sie tun, Lizzie?«, erwiderte Raven. Er hatte die Erfahrung gemacht, dass sich ein Streit mit Lizzie selten lohnte.
Sie schnaubte und wandte sich um, wobei sie mit Simpsons Gepäck zusammenstieß.
»Ich weiß ja nicht, warum er sich überhaupt die Mühe des Auspackens macht«, sagte sie. »Ende der Woche reist der Professor doch schon wieder ab.«
»Tatsächlich?«
»Nach London.«
Raven hatte den Überblick verloren. Es war eine unmögliche Aufgabe, der Termine des Professors Herr zu bleiben. Simpson hatte einmal einen Sekretär angestellt, der Ordnung in seine Angelegenheiten bringen sollte, aber das war nicht gut ausgegangen.
»London«, wiederholte Christina. »Da würde ich auch gern mit.«
Lizzie schnaubte erneut. »Dass du und ich jemals weit über die Vororte Edinburghs hinauskommen, ist nur wahrscheinlich, wenn wir in eine Strafkolonie geschickt werden.«
Im Falle von Lizzie selbst schien das durchaus vorstellbar, dachte Raven. Er sah nun wieder das neue Mädchen an, das den Blick auf ihre Schuhe gesenkt hatte und vermutlich bereute, überhaupt gesprochen zu haben. Sie war noch zu jung, sich ihre bescheidenen Hoffnungen ersticken zu lassen, doch wie wahrscheinlich war es, dass sie es im Leben zu viel mehr brachte als zu alledem hier?
Raven hatte gerade begonnen, den Briefstapel auf dem Flurtischchen durchzusehen, als Hugh Morris den Kopf aus seinem Behandlungszimmer steckte. Auch Dr. Morris war ein Neuzugang in der Queen Street. Er war ein anständiger Kerl, aber von der leisen, emsigen Art; wenn er nicht arbeitete, las er, schrieb Aufsätze oder führte in seinem Zimmer Experimente durch. Aus Feierlichkeiten und Plaudereien machte er sich nicht viel. Raven dagegen sah etwas heitere Ablenkung als notwendig an, wenn man Tag für Tag mit Kranken und Sterbenden zu tun hatte.
»Ein schwieriger Fall?«, fragte Morris, um durchblicken zu lassen, dass ihm Ravens langes Fortbleiben nicht entgangen war.
»Fälle, wie sich herausstellte. Zwillinge an der ersten Adresse, beide gesund und munter zur Welt gekommen, doch ein anderer Säugling hatte weniger Glück. Er trieb in Leith im Wasser, als er gefunden wurde.«
Dr. Morris machte kurz große Augen. »Und die Mutter?«
»Wird derzeit von McLevy gesucht.«
»Wie überaus unangenehm. Ich wünschte, ich könnte eine Ruhepause anbieten, aber …«
Raven nickte. Noch immer standen Patientengrüppchen vor der Tür des Wartezimmers, aus dem halblaute Gespräche drangen.
Raven ging in sein Behandlungszimmer und rief seinen ersten Fall des Tages auf, der sich als eine ältere Dame mit zahllosen Beschwerden über den Zustand der Straßen und das Verhalten der jungen Leute herausstellte.
»Sie zeigen einfach keinen angemessenen Respekt mehr den Älteren gegenüber«, grummelte sie, während sie sich wie zur Unterstreichung dieser Aussage mit ihrem ausladenden Gesäß auf der Behandlungsliege niederließ. »Ich musste eine Ewigkeit warten, bis mir im Wartezimmer jemand einen Stuhl anbot.«
Raven lauschte ihren Klagen so aufmerksam wie möglich, bevor er das Gespräch wieder auf medizinische Angelegenheiten lenkte. Er wusste, dass ein offenes Ohr manchmal die beste Medizin war, dass Einsamkeit und Isolation die Beschwerden eines Patienten verstärken konnten, was allerdings kein Gebiet war, das er zu seinen Stärken gezählt hätte. Während er sich um Konzentration bemühte, konnte er Simpsons Stimme im Kopf hören: Einem Arzt ohne Mitgefühl fehlt eines der wirkmächtigsten Werkzeuge der Behandlung und Heilung. Er beherrscht seine Kunst nicht in vollem Umfang und kann sie nicht in diesem ausüben, wenn er leichtsinnig den wunderbaren Einfluss des Geistes auf den Körper vernachlässigt oder gar leugnet.
Simpson wiederholte diesen Glaubenssatz so oft, dass Raven ihn mühelos abrufen konnte. Prinzipiell stimmte er ihm zu, doch seine Anwendung erschien ihm zuweilen schwierig.
Endlich konnte er der Frau den Grund ihres Besuches entlocken, die maßgeblichen Fragen stellen und die verkrustete, schuppige Läsion untersuchen, die sich mit einigen Unterbrechungen vom Unterarm bis zur Schulter erstreckte. Er schrieb ein Rezept, bevor er mit einem gewissen Stolz auf seine Geduld und Willensstärke an dem am stärksten betroffenen Bereich zunächst eine Wundauflage und dann einen Verband anlegte.
Mit einem Lächeln überreichte er der Frau das Rezept. Ersteres erwiderte sie nicht, denn sie war offensichtlich weniger beeindruckt von seiner Leistung als er selbst.
»Wann kommt Sarah denn wieder?«, fragte sie trocken. »Ich lasse mich lieber von ihr versorgen. Als Dame ist einem wohler, wenn man ebenfalls von einer Dame behandelt wird.«
»Vielleicht sollte Sarah sich dann um eine medizinische Approbation bemühen«, erwiderte Raven.
Die Dame beäugte Ravens Handwerk missbilligend, und er musste selbst zugeben, dass es nicht ganz so sauber aussah wie bei Sarah.
»Ja, vielleicht sollte sie das.«
Während die Frau zum Ausgang stapfte, wurde Raven sich bewusst, dass sie nicht als Einzige Sarah vermisste. Sie war nun schon einen Monat fort, und ohne sie war das Haus nicht dasselbe.
Oder war es einfach so, dass er ohne sie nicht derselbe war? Ja, auch das musste er sich eingestehen.
Es hatte eine Zeit gegeben, da hatte er Sarah zur Frau nehmen wollen, aber er war zu zaghaft vorgegangen, bis es schließlich zu spät war. In dieser Hinsicht hatte er sich als ihrer unwürdig erwiesen. Durch Feigheit hatte er seine Chance vertan, da er sich gesorgt hatte, es könnte seinem Fortkommen schaden, wenn er ein Hausmädchen heiratete. Erst der Schmerz, sie zu verlieren, brachte ihm die Erkenntnis, was sie ihm wahrlich bedeutete – zum ersten Mal, als sie einen anderen heiratete, und zum zweiten Mal, als sie dem Tode nahekam.
Während ihrer Genesung hatte er seine Pläne geschmiedet. Er wollte sie zunächst bitten, ihm beim Aufbau seiner eigenen Praxis zu helfen; dann, nach einiger Zeit, wenn ihrer Witwenschaft pietätvoll Rechnung getragen war, würde er ihr einen Antrag machen. Doch am Tage selbst, als er ihr sein Angebot unterbreiten wollte, kehrte sie von einem Besuch am Grabe ihres Gatten zurück und berichtete ihm, sie wolle in die Fußstapfen von Elizabeth Blackwell treten, der ersten Frau, die jemals eine medizinische Approbation erlangt hatte.
Da erfuhr er seine wahre Erleuchtung. Sarahs Umstände hatten sich grundlegend verändert. Sie war nun eine Witwe und verfügte über die Mittel ihres verstorbenen Ehemannes. Physisch wie metaphorisch brach sie zu einer Entdeckungsreise auf, bei der sie ihren Platz in einer Welt zu finden suchte, die ihr auf einmal viel größer geworden war.
Raven verstand, dass er ihr sein Angebot nicht mehr unterbreiten durfte – und dabei fürchtete er nicht etwa, dass sie es ablehnen, sondern dass sie es annehmen würde. Er konnte ihr ein gutes Leben geben, ein weit besseres, als sie es sich wenige Jahre zuvor noch hätte erträumen können, und womöglich hätte sie sich damit zufriedengegeben, doch sie verdiente Besseres. Sarah wollte mehr sein, als man es einer Frau für gewöhnlich gestattete, und wenn er sie wirklich schätzte, dann durfte er nicht der Mann sein, der dem im Wege stand.
Seine Selbstlosigkeit war ihm nur ein geringer Trost, während er sie ihre Pläne schmieden sah, und am schwersten war es, dass er ihr nichts von alledem erzählen konnte. Doch als sie schließlich ihre Koffer packte, war ihm das Herz unerwarteterweise schon nicht mehr ganz so schwer – paradoxerweise aus dem Grunde, dass alles noch ein wenig komplizierter geworden war.
Sarah bedeutete ihm immer noch sehr viel, doch nun wohnten in seiner Brust neben seinen Gefühlen für Sarah auch Gefühle für jemand anderen.
Kapitel 3
London, drei Wochen zuvor
Sarah sah nichts als einen kobaltblauen Himmel und Wolken jener makellosen, reinweißen Art, die man nördlich des Tweed kaum jemals antrifft. Auch für London waren diese gewiss nicht typisch, vermutete sie nach allem, was sie bisher beobachtet hatte. Rauch und Staub hingen ewig in der Luft und verdeckten den Blick auf das Firmament. Vielleicht hatten ihre Gastgeber eben aus dem Grunde diesen Ausblick an die Decke ihres Speisezimmers malen lassen, weil man ihn nicht genießen konnte, wenn man vor die Tür trat. Eine Erinnerung daran, wie der Himmel eigentlich aussehen sollte.
Das Dekor bot ihr zumindest einige Ablenkung vom Monolog des Herrn zu ihrer Linken, der anscheinend beabsichtigte, seine Sammlung mikroskopischer Präparate in Gänze zu beschreiben. Er merkte wohl nicht einmal, dass Sarah bereits ganze fünf Minuten an die Decke starrte.
»… die Lunge eines Frosches. Ein Stück Haihaut. Der Flügel einer Bremse …«
Sarah bedauerte, dass der Tisch schon vor einer Weile abgedeckt worden war, sonst hätte sie womöglich vorgeben können, sich lebensbedrohlich verschluckt zu haben, um diesem langwierigen, einseitigen Gespräch ein Ende zu bereiten. Sie sah Mina an, die auf der anderen Seite des Tisches saß und offensichtlich einen günstigeren Platz bekommen hatte. Man hatte sie neben einen gut aussehenden jungen Mann mit intelligentem Gesicht und vollem Haar gesetzt, das bei jeder seiner Bewegungen mitwippte, und gerade hatte sich eine prächtige Strähne gelöst und schwang vor sein linkes Auge, während er zum Ende einer unterhaltsamen Anekdote kam, die Sarah nicht mithören konnte. Mina lachte diskret hinter vorgehaltener Hand, während die anderen Männer in der Nähe lauthals wieherten.
»… ein Stück Ziegenhorn. Die Schuppen einer Süßwasserforelle …«, leierte der Präparateenthusiast weiter.
Vielleicht konnte sie einen Schwächeanfall vortäuschen. Oder sich die Kuchengabel ins Auge rammen.
Glücklicherweise wurde ihr Rettung zuteil durch Lady Montague.
»Begeben wir uns alle in den Salon«, sagte sie. »Wir wollen einem musikalischen Zwischenspiel beiwohnen. Mein Neffe Geoffrey wird ein Stück von Mendelssohn auf dem Piano spielen.«
Drei Tage zuvor hatten sie Edinburgh verlassen und auf dem Weg nach Paris einen Halt in London eingelegt. Sarah hatte sich sehr auf die große Metropole gefreut, von der sie bereits so viel gehört hatte, aber schon bald war sie dieses Ortes überdrüssig geworden. Es war zu voll, die Atmosphäre war bedrückend. Alles, selbst die herrlichsten Paläste, schienen von Schmutz überzogen.
Sarah hatte die große Expedition angestoßen, aber Mina – Mrs Simpsons Schwester – hatte festgelegt, welcher Reiseroute sie folgen, welche Einladungen sie annehmen und welche Sehenswürdigkeiten sie auf dem Weg besuchen würden. Minas Bruder Robert, der männliche Begleiter der Reisegruppe, war zwar der offiziell Verantwortliche, aber er folgte allgemein Minas Vorstellungen und tat klaglos, was man von ihm verlangte. Bis auf seine Teilnahme bei einigen geschäftlichen Treffen hatte er keine besonderen Vorlieben, also stellte er kein Hindernis für Minas große Pläne dar.
Folglich hatte Sarah keinen nennenswerten Einfluss darauf, wie sie ihre Zeit verbrachten, und man hatte ihr strikt untersagt, allein Ausflüge zu unternehmen. Doch selbst in ihren verdrossensten Augenblicken hätte sie so etwas nicht getan, denn sie war eingeschüchtert von der Größe der Stadt und hätte sich womöglich hoffnungslos verlaufen. Die Besichtigung der Westminster Abbey hatte ihr besonders gefallen – so eine große Kirche hatte sie noch nie gesehen. St Giles’ in Edinburgh kam jener nicht ansatzweise nahe. Sie hatten sich auch die neuen Houses of Parliament angeschaut und den vor Booten strotzenden Morast der Themse betrachtet.
Im Kopf hatte sie eine Liste der Orte, die sie lieber besucht hätte, aber sie wollte nicht launisch oder undankbar erscheinen. Sie hätte zu gern die Abteilungen der großen Krankenhäuser gesehen – St Bartholomew’s, St Thomas’ – oder wäre entlang der Exponate der pathologischen Anatomie im Hunterian Museum gewandelt. Auch mit dem British Museum wäre sie zufrieden gewesen, und sie hatte es vorgeschlagen, aber Mina hatte abgelehnt. Das Wetter sei viel zu schön, um den Tag drinnen zu verbringen, hatte sie gesagt.
Sarah konnte die Weiterreise zu ihrem endgültigen Ziel kaum erwarten, aber dazu genoss Mina die Besichtigungen und die gesellschaftlichen Besuche allzu sehr. Als Schwägerin des Dr. James Young Simpson, Professor der Geburtshilfe und Entdecker des Chloroforms, erwartete sie ein stetiger Strom an Einladungen zu Mittagessen, Dinners und Feierlichkeiten.
Bei vielen dieser Anlässe fühlte sich Sarah fehl am Platze. Ihre bescheidene Garderobe reichte nicht aus für solch eine Vielfalt an Zusammenkünften, weshalb sie in kurzen Abständen immer wieder zwischen denselben wenigen Kleidern wechselte. Anfangs sorgte sie sich, dass es den Leuten auffallen könnte, aber dann beschloss sie, dass es sie nicht kümmerte. Sie hoffte, dass sie wenigstens Menschen von wissenschaftlichem Geiste kennenlernen würde, mit denen sie sich über Dinge unterhalten konnte, die sie interessierten, wenn sie schon all die gesellschaftlichen Termine wahrnehmen musste. Stattdessen musste sie die immer gleichen geistlosen Gespräche über Kleider ertragen – die neueste Mode aus Paris (geradezu skandalös, wie man sagte) – sowie die Abwägungen der Vor- und Nachteile, das Dinner à la russe zu servieren, statt traditionell à la française. Es wurde immer schwerer zu durchschauen, wann man den Franzosen nacheifern und wann man sie ablehnen, wann man sie bewundern und wann verspotten sollte.
Erleichtert entfernte Sarah sich von ihrem Tischnachbarn und ging um die gewaltige Tafel zu Mina, die keine Anstalten machte, sich zu erheben. Als Sarah sich näherte, hielt Mina ihr ein leeres Weinglas entgegen, das Sarah kommentarlos annahm, um zu der Anrichte mit den Dekantern zu gehen und es aufzufüllen.
Was tue ich hier eigentlich?, fragte sie sich, als sie den Wein einschenkte. Sarah wusste nicht, über wen sie sich mehr aufregte – über Mina, die sie wie eine Dienerin behandelte, oder über sich selbst, weil sie es mit sich machen ließ. Mina hatte große Schwierigkeiten, Sarahs neue Stellung anzuerkennen, wie ihr nun auffiel. Sarah war einst ein Hausmädchen gewesen, aber das hatte sich durch ihre Heirat und darauf folgende Verwitwung geändert. Sie war nun eine Frau mit eigenem Vermögen, so bescheiden dieses auch sein mochte.
Als Sarah den anderen Gästen aus dem Zimmer folgte, verlor sie Mina aus den Augen. Ein gemächlicher Umzug in den anderen Raum fand statt, wobei die prominentesten Gäste die Führung übernahmen und die von bescheidenerem Stande hintan folgten. Der Salon war ebenso groß und reich verziert wie das Speisezimmer und mit gewaltigen Gemälden gestrenger Herren in militärischer Uniform behangen sowie mit einer Tapisserie, die eine altertümliche Schlacht darstellte.
Die Pianodarbietung verzögerte sich, da die Noten verschollen waren. Lady Montague rauschte durch den Raum und entschuldigte sich vielmals bei ihren versammelten Gästen, griff sich dabei an ihre Gagatperlenkette und richtete sich den Spitzenkopfputz, der in all dem Trubel verrutscht war.
»Als hätte sie jemanden vergiftet und nicht bloß ein Concerto verbummelt«, sagte eine Stimme hinter Sarahs Schulter. Sie wandte sich um und sah den Herrn mit dem prachtvollen Haar, der beim Dinner Mina so gut unterhalten hatte.
»Mr Cadge«, sagte er, »zu Ihren Diensten.« Er lächelte und verbeugte sich. Eine Locke fiel ihm über das Gesicht, und beim Aufrichten schob er sie sich hinter das Ohr. »Man verriet mir, dass Sie mit dem großen Dr. Simpson zusammenarbeiten.«
»In der Tat«, sagte Sarah und erwiderte das Lächeln.
»Und worin besteht Ihre Arbeit?«
»Ich assistiere.«
Mr Cadge zog die Augenbrauen hoch.
»Ich helfe bei den Patienten mit und verabreiche hin und wieder Chloroform«, erklärte sie.
»Sie interessieren sich für die Anästhesie?«
»Ich interessiere mich für die Medizin.«
»Dann dürften Sie unserer Miss Gillies gefallen.«
»Miss Gillies?«
»Sie ist Künstlerin.« Er sah sich im Raum um. »Sie ist hier irgendwo. Ah, ja. Dort ist sie. In ein Gespräch vertieft und wild gestikulierend, als hätte sie einen Anfall.«
Er deutete auf eine Frau am anderen Ende des Salons, die extravagant in bunte Seiden gekleidet war, eine Explosion der Farben in einer ansonsten fahlen Ecke.
»Sie ist der Überzeugung, dass Frauen sich eine Beschäftigung jenseits von Heim und Herd suchen sollten. Arbeit tue der Seele gut, sagt sie.«
Das hängt durchaus von der jeweiligen Arbeit ab, dachte Sarah. An das Schrubben von Böden hatte die gute Frau dabei sicher nicht gedacht.
»Sie war ganz hingerissen von Dr. Blackwell, die letzten Sommer bei uns weilte«, fuhr Mr Cadge fort. »Sie haben gewiss von ihr gehört.«
»Durchaus.«
»Die erste Frau, die jemals eine medizinische Approbation erlangt hat. Eine beträchtliche Leistung.«
»Wir hoffen, sie in Paris kennenlernen zu können«, sagte Sarah, obwohl dies in Wahrheit nur ihr eigener Wunsch war, ja der Grund, aus dem sie diese Reise überhaupt erst angetreten hatte. Mina hatte sich zwar von Dr. Blackwells Erfolg beeindruckt gezeigt, verspürte anders als Sarah jedoch keinen Drang, ihr nachzueifern.
»Ist sie dorthin gereist? Ich hatte angenommen, sie sei nach Amerika zurückgekehrt«, sagte Mr Cadge und nippte an seinem Brandy. »Ich betrachte mich ja selbst durchaus als eine Art Pionier auf dem Feld der Anästhesie«, fuhr er fort, da sein Interesse an Dr. Blackwell nun erschöpft schien. Sarahs begrenzter Erfahrung nach waren Männer sich meist selbst das Lieblingsthema, auf das sie jedes Gespräch bei der erstbesten Gelegenheit zu lenken wussten. »Ich war dabei, als Liston die erste Operation unter Äther durchführte. Ich war zu der Zeit sein Hauschirurg. Kennen Sie die Geschichte?«, fragte er.
»Nicht in allen Einzelheiten«, erwiderte sie. Diese Anekdote wollte sie nun doch hören.
»Einem Butler von der Harley Street musste man das Bein abnehmen, und der Bursche hatte gewisse Bedenken. Selbst als man ihm versicherte, dass Liston so eine Amputation in etwa dreißig Sekunden durchführen konnte, war er nicht zu überzeugen. Er war heilfroh über die Möglichkeit, sich Äther verabreichen zu lassen. Das Lustige an der Sache war – und das weiß kaum jemand –, dass man die Äthernarkose vorsichtshalber vorher an einem der Krankenträger ausprobieren wollte, einem vierschrötigen Kerl, der sich gegen ein Entgelt bereit erklärte, an dem Experiment teilzunehmen. Nachdem er das Mittel ein paarmal kräftig eingeatmet hatte, sprang er vom Tisch, wütete im Raum umher und brüllte aus voller Brust die schlimmsten Flüche. Wir mussten ihn zu viert bändigen, bis er wieder bei Sinnen war. Hätte Liston das gesehen, hätte er die ganze Sache abgesagt und seinen Platz in der Geschichte eingebüßt.«
»Setzt Mr Liston heutzutage Chloroform ein?«
»Nein.«
»Warum denn nicht?«
»Er ist kurz nach dessen Entdeckung gestorben. Der Baum einer Segeljacht schlug ihm auf die Brust. Dies führte zu einem thorakalem Aneurysma mit darauf folgender Ruptur.« Mit der freien Hand stellte Mr Cadge eine Explosion dar.
»Tragisch.«
»Blutig.«
Sarah war etwas verwundert und wollte nach weiteren Einzelheiten fragen, doch in dem Augenblick trat ein anderer Gast zu ihnen, ein älterer Herr mit dicken Brillengläsern, die seine wässrig blauen Augen vergrößerten. Er schien etwas wacklig auf den Beinen und versäumte es, sich vorzustellen. Dieser Fauxpas war vielleicht dadurch zu erklären, dass der Herr ausgiebig Lady Montagues Bordeaux zugesprochen hatte, von dem einiges auf dem Hemd gelandet war.
»Lady M verriet mir, dass Sie sich nach Ihrer Weiterreise mit der bezaubernden Miss Blackwell treffen möchten«, sagte er und stand Sarah dabei so nah, dass sie seine Fahne riechen konnte.
»Dr. Blackwell«, korrigierte Sarah.
»Ja, ganz recht. Die Frau Doktor. Ich habe sie kennengelernt, als sie letzten Sommer hier war. Entzückendes kleines Ding. Doch welch eine Überraschung.«
»Dass sie eine medizinische Approbation erlangen konnte?«
»Ja, auch das, durchaus. Aber wir hatten alle jemand von robusterem Bau erwartet. Breite Schultern. Kräftig.«
»Männlich?«, schlug Sarah vor.
»In der Tat.« Der alte Mann schüttelte den Kopf. »Ich gratuliere ihr ja zu ihren Leistungen und so weiter, aber es ist doch nun einmal kein angemessener Beruf für das schöne Geschlecht, oder?«
Er lächelte sie an, als handelte es sich dabei um eine offensichtliche Wahrheit. »Ich meine, welcher Mensch bei Verstand würde sich denn an eine Frau Doktor wenden?«, fuhr er fort, ohne Sarahs wachsende Verärgerung zu bemerken.
Sarah spürte, wie ihr die Zornesröte ins Gesicht stieg. Sie sah wieder den Weinfleck auf seinem Hemd. Dieser erinnerte sie an die Blutspritzer nach einer Zahnextraktion. Oder nach einem Fausthieb ins Gesicht.
Sie hörte Mr Cadge kichern und fragte sich, ob er etwas entgegnen würde, etwas, das die Bemerkungen des anderen wiedergutmachen könnte, aber er schien eher belustigt als entsetzt, und Sarah hatte den Eindruck, dass er die Sicht des Alten grundsätzlich teilte, auch wenn er diese vielleicht etwas behutsamer zum Ausdruck gebracht hätte.
Sie rang nach einer so geistreichen wie erschütternden Replik, welche die beiden umstimmen könnte, doch fand sie in ihrer Wut kaum Worte. Denn welche Worte konnten schon Männer umstimmen, die sich ihrer Ansichten so gewiss waren? Worte allein konnten niemals ausreichen. Es brauchte Taten. Eine klare Demonstration des Irrtums dieser Männer.
Sie sah Mina eilig auf sich zukommen, und sie war sichtlich unzufrieden. Weil Sarah ihr nicht ihren Wein gebracht hatte? Oder weil sie ihr den Tischherrn abspenstig gemacht hatte? Sie konnte sie gern beide haben.
Nicht zum ersten Mal musste Sarah sich in Erinnerung rufen, dass sie in Minas Schuld stand. Ohne Mina wäre sie niemals nach London gekommen.
»Ich glaube, es ist Zeit, sich zu verabschieden«, verkündete Mina mit einem schmalen Lächeln. Weder wartete sie ab, vorgestellt zu werden, noch erklärte sie, aus welchem Grunde sie so eilig gehen mussten. »Hol doch bitte unsere Mäntel, ja, Sarah?«, fügte sie hinzu, indem sie sich umwandte und auf die Tür zuhielt.
Kapitel 4
Nachdem Dr. Morris so lange auf sich allein gestellt war, hatte sich die Morgensprechstunde weit über die übliche Zeit hinausgezogen, wie hätte es anders sein können? Raven hastete in die Küche und schnappte sich zum Mittagessen ein übrig gebliebenes Hühnerbein, Mrs Lyndsays Ermahnung im Ohr, während er die Treppe zum Eingangsflur emporstieg. Er konnte den Weg zum Maternity Hospital nicht ausgehungert antreten, worauf sie offensichtlich nicht vorbereitet war, so häufig es auch vorkam.
Auf dem Weg zur Haustür wich er gerade einem der Kinder aus, als er die Stimme des Professors vernahm. In gewohnter Geschwindigkeit kam dieser die Treppe herab. Simpson war ständig in Eile, als wäre jeder Augenblick bereits einer bestimmten Aufgabe zugeteilt, ohne dass man die nötige Zeit einberechnet hatte, vom einen Ort zum anderen zu gelangen.
»Will, wie schön, dass ich Sie treffe. Haben Sie heute Abend schon etwas vor?«
Die unausgesprochene Antwort auf diese Frage lautete stets: »Nun nicht mehr.« Raven hatte Henry in einem ihrer Lieblingspubs aufsuchen wollen, um sich nach der Möglichkeit zu erkundigen, der Leichenschau des Säuglings aus Leith beizuwohnen. Nun würde er ihm stattdessen einen Brief schicken müssen.
»Ich stehe Ihnen stets zur Diensten, Herr Professor.«
Simpson konnte er keinen Wunsch abschlagen, und nicht nur, weil dieser sein Dienstherr war. Er war auch sein langjähriger Mentor, und Raven suchte fortwährend dessen Anerkennung und wollte ihn beeindrucken. Und dies ging nicht von Raven allein aus. Simpson versprühte einen Eifer, der so mitreißend wie labend war, als ließe er einen selbst umso heller brennen, auch wenn dies zuweilen bis zur Erschöpfung gehen konnte.
»Geht es um eine abendliche Behandlung?«, fragte Raven und erhoffte sich eine reiche Patientin in einem der Hotels an der Princes Street. Raven war immer erpicht darauf, einen guten Eindruck bei so jemandem zu hinterlassen, sodass sein Name ins Spiel kommen könnte, falls der Professor selbst einmal nicht zur Verfügung stehen sollte.
Jarvis tauchte geräuschlos wie immer auf und reichte dem Professor seinen Hut, unter dem ein gewöhnlicher Kopf gänzlich verschwunden wäre.
»Nein«, erwiderte Simpson und blickte Raven verschwörerisch an. »Ich sollte Sie warnen, dass es mir diesmal nicht um Ihren klinischen Beistand geht. Meine Pflichten führen mich heute Abend durch düstere, heimtückische Örtlichkeiten, an denen mir wohler wäre, wenn ich tatkräftige Verstärkung im Rücken hätte.«
»Selbstverständlich, Herr Professor.«
Raven hatte sich hin und wieder gefragt, wie viel Simpson von seinen Erfahrungen mit Gewalt ahnte. Die Anfrage bestätigte wieder einmal, wie weise es war, grundsätzlich davon auszugehen, dass der Professor alles wusste. Doch die Frage, wovor sich ein solcher Mann fürchten musste, weckte Ravens Neugierde wie auch eine gewisse Sorge. Selbst in den trostlosesten und verrufensten Ecken der Old Town brachte man Simpson Respekt, ja Wärme, entgegen, da er oftmals in den Häusern der Ärmsten geholfen und dafür keinen Penny angenommen hatte. Da er mit seinem Hut und Mantel von Weitem zu erkennen war, hatte Raven geglaubt, der Professer könnte selbst in schwärzester Nacht unbelästigt wandeln, wo es ihm gefiel.
Als Jarvis die Haustür öffnete, sah Raven, dass man Simpsons Kutsche gerufen hatte, auf deren Bock sein treuer Kutscher Angus saß.
»Ich würde Sie ja mitnehmen, aber ich fahre in die gänzlich falsche Richtung, nach Newhaven.«
Das bedauerte Raven nicht. Er war ohnehin schon verspätet, da kam es darauf auch nicht mehr an, aber vor allem gab es einen Grund, weshalb er lieber zu Fuß gehen wollte. Sein Weg zum Milton House war zu einem Höhepunkt seines Tagesablaufes geworden, weil er dabei die Gelegenheit bekam, sie zu sehen.
Er war gerade mit dem Hühnerbein fertig, als er auf die George Street kam, wo er sich zunächst die Finger mit dem Taschentuch reinigte, bevor er sich im Schaufenster einer Herrenschneiderei begutachtete. Er sah recht vorzeigbar aus, doch sein Blick fiel alsbald auf die Narbe an seiner Wange. Er hatte überlegt, ob er sich wieder einen Bart stehen lassen sollte, wie er es damals unmittelbar nach der Verletzung getan hatte. Es galt, einen guten Eindruck auf mögliche Patienten zu machen, und Raven wollte nicht wie jemand aussehen, den ein Geldleiher zur Warnung in einer dunklen Gasse hatte aufschlitzen lassen.
Er hatte jedoch Abstand davon genommen, weil sie sagte, ihr gefalle die Narbe, und weil diese für sie beide eine gewisse Bedeutung trug. Nichtsdestoweniger fragte Raven sich, welche Bedeutung ihr Vater der Narbe wohl beimessen mochte.
Er zog seine Taschenuhr hervor und sah, dass es schon fast zwei Uhr war. An manchen Tagen richtete sie es ein, dass sie gerade auf dem St Andrew Square spazieren ging, wenn er auf dem Weg zum Maternity Hospital war. An anderen Tagen stand sie bloß an ihrem Zimmerfenster, damit sie einander sehen konnten, wenn er vorbeikam. Mehr konnte er sich heute nicht erhoffen, aber er würde den Augenblick dennoch auskosten.
Raven hatte sich damit abgefunden, dass er Sarah nicht heiraten würde, aber das hieß nicht, dass er anderweitig auf Brautschau gegangen wäre. Denn Aussichten hätte er reichlich gehabt, auch wenn ihn keine verlocken konnte. Eine Weile hatte sich Mina, die nichts von seinen Gefühlen ahnte, fleißig für ihn umgeschaut. Raven wertete es als Zeichen, dass sie die Suche nach einem Bräutigam für sich selbst weitgehend aufgegeben hatte, wenn sie mit solcher Hingabe Ausschau nach Kandidatinnen für ihn hielt. Aus Mitleid mit ihr ließ er dies geschehen und gab vor, es nicht zu bemerken, wenn sie wieder und wieder »Zufallsbegegnungen« mit Damen einfädelte, die ihr geeignet erschienen.
Raven strebte schon länger nach einem beruflichen Aufstieg als nach einer Gefährtin, mit der er diesen teilen könnte. Er wusste, dass ein Arzt aus der Sicht vieler unbedingt ein Familienvater mit einer Gattin sein musste, die gemäß gewissen Ansprüchen auftrat. Im Fach der Geburtshilfe galt dies umso mehr: Simpson gab bereitwillig zu, dass er unter anderem deshalb um Jessies Hand angehalten hatte, weil die Eheschließung seine Aussichten auf eine Professur steigerten. Ein Junggesellendasein galt als Ausschlusskriterium.
Wie auch in vieler anderer Hinsicht beneidete Raven den Professor um die Beziehung zu seiner geliebten Jessie. Als Cousin und Cousine zweiten Grades hatten sie sich schon jahrelang gekannt und einander Geheimnisse, Sorgen, Beobachtungen und Bestrebungen anvertraut sowie sich miteinander über die Bücher ausgetauscht, die sie so liebten. Folglich hatten sie bereits ein tiefes Verständnis von Geist und Seele des anderen, lange bevor sie Mann und Frau wurden. Und hätte ihnen dies gefehlt, hätten sie niemals die herzzerreißenden Tragödien überstanden, die sie heimgesucht hatten.
Minas Kandidatinnen waren alle durchaus angenehme Mädchen und zweifellos gänzlich bereit, die Rolle der Gattin eines Arztes und der Mutter seiner Kinder auszufüllen, aber es enttäuschte Raven, dass diese Rollen bereits alles waren, was sie wollten. Sie waren lieblich, schön und gefällig, doch man hatte sie zur Fügsamkeit erzogen. Zum Gehorsam. Zur Arglosigkeit.
Die Eigenschaften, die aus Sarah eine vermeintlich unpassende Gattin machten, waren nun die Attribute, die er an einer Frau am meisten schätzte. Also war es wohl nur passend, dass keines von Minas Ränkespielen ihn zu seinem Glück geführt hatte. Vielmehr war es die Bitte des Professors gewesen, Raven möge sich zum Haus des Dr. Cameron Todd begeben, welcher die Wirkung des Chloroforms bei einer seiner Patientinnen beobachten wollte, die an hartnäckiger Neuralgie litt.
An einem frischen Frühlingsmorgen gut sechs Wochen zuvor hatte Raven sich an der Adresse am St Andrew Square vorgestellt. Dr. Todd war einer der reichsten Ärzte der Stadt, der es wegen seines ererbten Vermögens nicht nötig hatte, seine Honorare durch Lehraufträge am Krankenhaus aufzubessern.
Als Raven am Seil der Türglocke zog, staunte er über den Widerhall im Inneren. Ein Hausmädchen kam und führte ihn in einen geräumigen Salon, wo er zurückblieb und die Ölgemälde an den Wänden bewundern konnte. Er betrachtete gerade eine dramatische Landschaft aus Klippen, Wasserfällen und dräuenden Wolken, als ihm auffiel, dass er nicht allein war. Auf einem Sofa saß zurückgelehnt eine junge Frau mit einem offenen Buch auf dem Schoß. Sie starrte ihn an und hörte weit länger nicht damit auf, als man es höflich nennen könnte, so als taxierte sie ihn in irgendeiner Weise.
»Es tut mir leid. Ich wähnte mich allein«, sagte Raven.
»Und mit wem habe ich die Ehre?«, fragte sie.
»Ich bin Dr. Will Raven.«
»Ein Mediziner. Ich hatte anderes vermutet. Etwas Exotischeres, Interessanteres.«
Sie machte weiterhin keine Anstalten, aufzustehen und sich angemessen vorzustellen. Raven fragte sich, ob sie eine Patientin war, doch fehlte ihr die Blässe einer chronisch Kranken, und sie war zu modisch gekleidet für jemanden, der seine gesamte Zeit im Haus verbrachte. Je länger er hinsah, desto mehr fiel ihm auf, dass sie die augenscheinlich gesündeste Patientin war, die er jemals gesehen hatte. Eigentlich wirkte sie nicht nur gesund, sie war ganz und gar umwerfend, doch konnte sein Blick nicht allzu lange auf ihrem hübschen Gesicht verweilen, während sie ihn weiterhin so unverfroren anstarrte.
Bevor er in Erfahrung bringen konnte, mit wem er da sprach, gesellte sich ein elegant gekleideter Herr zu ihnen, der sich als Dr. Todd vorstellte. Er war ein dünner Mann mit vollem grauem Haarschopf und säuberlich gestutztem Backenbart. Er trug einen schwarzen Gehrock und eine schwarze Hose, einen gestärkten weißen Kragen und eine Krawatte. Seine Kleider hatten weder Flecken noch Falten, was nahelegte, dass er sein Handwerk in der traditionellen Weise durchführte, in der ein Arzt seinen Patienten kaum jemals berührte. Die Präzision und Sorgfalt seiner Erscheinung verliehen ihm eine Aura der geschmeidigen Professionalität, die auch Raven eines Tages gern verströmen würde. Er sah auf seinen eigenen Mantel und die Hose hinab, die abgetragen und vom Wetter in Mitleidenschaft gezogen waren. Er gab im Vergleich kein gutes Bild ab und wusste nicht, was an seinem Äußeren der jungen Dame in irgendeiner Weise exotisch hatte erscheinen können.
Da sein Gespräch mit der Frau bisher überaus seltsam gewesen war, war Raven dankbar für die Unterbrechung, doch Dr. Todd schien weniger glücklich, sie beide zusammen zu finden.
»Eugenie! Was machst du hier? Man hatte mir gesagt, du seist ausgegangen.«
»Nun, dem ist offensichtlich nicht so.«
Dies ignorierte Todd, und nun wandte er sich Raven zu.
»Dr. Raven, nehme ich an«, sagte er und schüttelte ihm die Hand. »Bitte entschuldigen Sie meine Tochter. Mitunter vergisst sie ihre Manieren.«
Dann sprach er mit besagter Tochter, die immer noch zurückgelehnt dasaß.
»Lässt du uns nun bitte allein, meine Liebe? Wir haben wichtige Angelegenheiten zu besprechen.«
Eugenie klappte das Buch zu und erhob sich gemächlich.
»Wichtige Angelegenheiten, die ich nicht verstehen würde, oder unfeine Angelegenheit, über die sich vor einem fragilen Wesen wie mir nicht zu sprechen geziemt? Seien Sie vorsichtig, Dr. Raven. Sagen Sie vor mir auch nur ein falsches Wort, verliere ich sofort das Bewusstsein, und Sie müssen mich wiederbeleben.«
In einem Wirbel mazarinblauer Seide glitt sie durch den Raum und hinterließ einen Hauch von Rosenwasser in der Luft. Dabei nahm sie sich alle Zeit der Welt. Als sie die Tür erreichte, hielt sie inne und sah sich um.
»Das ist eine beeindruckende Narbe, Dr. Raven. Wie hat sich ein ehrenwerter Mann wie Sie diese wohl zugezogen?«
Raven war sprachlos ob solcher Direktheit, doch blieb ihm ohnehin keine Zeit, zu antworten, bevor Dr. Todd seine Tochter schalt und des Raumes verwies.
»Ich muss mich erneut für Eugenies fehlenden Anstand entschuldigen. Sie müssen wissen, dass ihre Impertinenz keine Respektlosigkeit Ihnen, sondern allein mir gegenüber ausdrücken sollte. Es gefällt ihr zuweilen, ihren Vater zu quälen.«
»Es ist wahrlich nicht der Rede wert«, versicherte Raven.
»Wie Sie sich die Narbe zugezogen haben, geht außer Ihnen niemanden etwas an.«
Dies war gewiss als eine höfliche Besänftigung gemeint, doch schwang für Raven durchaus ein gewisses Urteil mit. Schließlich sagte man Derartiges nicht, wenn man annahm, die Narbe sei Folge eines Sturzes von einem Vollblutpferd bei der Jagd. Vielmehr suchte Dr. Todd Raven davor zu bewahren, dass er von finsteren Gassen und zwielichtigen Bekanntschaften reden musste.
Als die Angelegenheit mit Dr. Todd abgeschlossen war und Raven gehen wollte, tauchte Eugenie wieder im Flur auf. Sie hatte offensichtlich genau den Moment abgepasst, als ihr Vater in seinem Büro verschwunden war.
»Und, haben Sie eine Antwort für mich?«, fragte sie.
Raven brauchte einen Augenblick, bis er verstand, was sie meinte. Unwillkürlich hob er die Finger an die Wange.
»Eine Säbelwunde«, sagte er. »Ich habe sie mir in einem Duell zugezogen.«
»In dem Sie die Ehre einer Dame verteidigten, der man unrecht getan hatte«, erwiderte sie, um zu zeigen, wie ernst sie seine Antwort nahm. Eine Art Spiel war im Gange.
»Haben Sie gewonnen?«
»Niemand gewinnt einen Kampf wahrlich, Miss Todd.«
»Also haben Sie verloren. Daher die Narbe.«
Raven dachte an die Gasse, die Klinge, die zwielichtigen Bekanntschaften.
»Oh, ich habe ganz gewiss verloren.«
»Sie sind Assistent von Dr. Simpson, nicht wahr? Ich habe schon so manches Gerücht gehört.«
Raven schüttelte den Kopf. »Schenken Sie dem keine Beachtung. Bei Dr. Simpson ist die Wahrheit stets weitaus bemerkenswerter als alles, was die Gerüchteküche der New Town servieren mag.«
Ihr wacher Blick ließ nicht von ihm ab, sie lächelte verspielt, so wie eine Katze, die sich mit einem verletzten Vögelchen vergnügt.
»Ich sprach nicht von Dr. Simpson.«
Diese beiden flüchtigen Begegnungen hatten insgesamt kaum mehr als einige Minuten gedauert, doch hatte Raven die folgenden Tage immerfort an Eugenie denken müssen. Er erwischte sich beim Tagträumen, während Patienten in der Sprechstunde unbedeutende Symptome ewig ausführten, er suchte, sich an ihre Kinnlinie zu erinnern, an ihren Duft und an den Schimmer in ihrem Auge, während sie sprach. Von ihr ging eine betörende Verheißung von Dreistigkeit aus, ihre Verschmitztheit bot einen erfrischenden Kontrast zu Minas faden, fügsamen jungen Frauen. Eugenie schien spitz, aber nicht grausam, amüsiert, aber nicht höhnisch.
Er überlegte sich, wie er ein erneutes Treffen mit ihr einfädeln könnte, doch sie kam ihm zuvor und tauchte unter Umständen auf, die noch gestellter wirkten als Minas Arrangements. Eugenie klingelte mit einem Brief ihres Vaters an den Professor in der Queen Street 52. Sie sagte, sie habe sich bereit erklärt, diesen zu überbringen, da sie ohnehin ihre Tante am Randolph Crescent habe besuchen wollen. Raven ging allerdings nicht davon aus, dass sie für gewöhnlich auf ihren Spaziergängen Post auslieferte.
Und dies war der Beginn von etwas gänzlich Unerwartetem.
Ebenso war es der von etwas notwendigerweise Geheimem. Sie verabredeten sich zu einem Treffen am St Andrew Square zwei Tage später, und Ravens Vorfreude auf dieses Rendezvous wurde von einem gewissen Schauder der Gefahr noch verstärkt. Die Wahl des Ortes verlieh einer Zufallsbegegnung einige Glaubhaftigkeit, erhöhte aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Angehöriger von Eugenies Haushalt sie beide sehen würde.
Er verspürte einen exquisiten Kitzel, als er an jenem Tage die George Street entlangging, ungewiss, ob sie da sein würde, schließlich gab es viele Gründe, fortzubleiben. Umso berauschter fühlte er sich, als er sie dort warten sah.
Er fragte sie, wie sie ihren Morgen verbracht habe, um ihren eigenen Erkundigungen zuvorzukommen. Schließlich wünschte er nicht, ihre wertvolle gemeinsame Zeit mit Beschreibungen von Wunden und Ausschlägen zu vergeuden.
»Ich habe gelesen«, erwiderte sie. »Einen aus dem Deutschen übersetzten Roman. Die Wahlverwandtschaften.«
»Von Goethe.«
»Ach, haben Sie ihn gelesen?«
»Nein«, gestand er. »Aber ich habe während meiner Studien in Preußen oft davon reden hören.«
Ihre Augen weiteten sich. »Wo haben Sie denn studiert?«
»In Berlin, unter anderem. Ich bin ein Jahr lang durch Europa gereist.«
»Also hatte ich recht – Sie sind tatsächlich exotischer als ein gewöhnlicher Mediziner. Haben Sie unter Künstlern und Bohemiens gelebt?«
Raven wollte von diesem Thema lieber ablenken. Geschichten von seiner Bekanntschaft mit einer geflüchteten Aristokratin, die Künstlerin geworden war, hätten Eugenie unter anderen Umständen gewiss beglückt, doch es hätte sicherlich einen falschen Ton angeschlagen, ihr von einer vergangenen Liebschaft mit einer älteren Frau zu erzählen.
»Sie halten Mediziner für uninteressant?«, fragte er, ohne seine Sorge vor den Konsequenzen durchscheinen zu lassen, wie er hoffte.
»Nicht grundsätzlich, bloß ist es bei Ärzten allzu oft so, dass sie nur über eine einzige Sache zu sprechen bereit sind: Und damit meine ich nicht die Medizin, sondern sie selbst.«
»Ich vermute, dass Sie durch Ihren Vater mehr Umgang mit Ärzten haben, als Ihnen genehm ist.«
Hierauf hatte sie seltsam gelächelt, wie jemand, der eine Sünde beichtet, für die er keine Buße getan hat.
»Vater führt mich gern bei gesellschaftlichen Anlässen vor, doch geht er dabei stets das Wagnis ein, dass ich Anlass zum Ärgernis geben könnte. Sein Bangen ist mir ein heiterer Anblick.«
»Geben Sie denn häufig Anlass zum Ärgernis?«
»Es ist durchaus eine Verlockung. Die Zahl großer Männer in Edinburgh ist deutlich geringer als die Zahl jener, die solche zu sein meinen, und Letztere sind gemeinhin um einiges dünnhäutiger.«
Raven wusste aus Erfahrung, dass auch Erstere durchaus dünnhäutig sein konnten.
»Sie sprechen mit mir wie mit einem dummen Mädchen, also schmähe ich sie mit feinen Spitzen, die sie mir niemals zugetraut hätten. Sie behandeln mich, als wäre ich arglos, also antworte ich, als wäre es wahr.«
»Was meinen Sie damit?«, hatte Raven gefragt.
Wieder zeigte sie ihr reueloses Lächeln.
»Ich möchte nicht so indiskret sein, seinen Namen zu nennen, aber zum Beispiel berichtete mir einmal ein Herr davon, wie er die Prinzessin Marie Amalie von Baden behandelte, die hier zu Besuch war. Ich sagte ihm: ›Wie ich Ihre Gattin beneide, die diese wunderbare Geschichte gewiss wieder und wieder hören darf.‹«
Raven lachte.
»Mein Vater befürchtet, dass den Herren die Beleidigung auffällt, wenn sie in der Kutsche nach Hause sitzen oder wenn sie am nächsten Morgen wieder nüchtern sind. Ich hingegen behaupte, dass er ihnen da eine zu große Einsichtsfähigkeit zuschreibt.«
»Die arme Frau.«
»Seine Gattin?«
»Nein, Prinzessin Marie Amalie. Sie muss ja schwer krank gewesen sein, dass die halbe Ärzteschaft Edinburghs behauptet, sie während ihres Besuches behandelt zu haben.«
Das hatte Eugenie gefallen. Ihr Lachen war freudig und ungehemmt.
»Worum geht es denn in Goethes Roman?«, fragte er dann. »›Wahlverwandtschaften‹, das klingt nach einem wissenschaftlichen Begriff?«
»Das ist es auch. Das Buch postuliert, man könne die Beziehungen zwischen Menschen mit denen zwischen chemischen Stoffen vergleichen. So man gewisse Kombinationen zueinanderbringe, sei eine Reaktion unausweichlich.«
Sie blieben an der nordöstlichen Ecke des Platzes stehen und blickten einander in die Augen.
»Ich glaube, ich verstehe«, hatte Raven gesagt.
Über die folgenden Wochen hatten sie sich wieder und wieder getroffen; dabei lastete immer schwerer die Frage auf Raven, ob sein Interesse Dr. Todd willkommen wäre. Die Ärzteschaft Edinburghs glich in mancher Hinsicht den europäischen Höfen der vergangenen Jahrhunderte, insofern als mächtige Männer Allianzen bildeten und ihre Stellung durch die Heirat ihrer Kinder festigten. Deshalb die geheimen Treffen – kurze Spaziergänge und verstohlene Blicke durch Fensterscheiben.
Obwohl Diskretion vonnöten war, fragte Raven sich allmählich, wie lange sie beide sich noch mit derartigen Begegnungen zufriedengeben würden. Es schien ihm so viel mehr als eine bloße Tändelei, doch war er sich unsicher, worin ihr nächster Schritt bestehen könnte.
Raven zähmte einige eigensinnige Haare und strich sein Jackett glatt, bevor er weiter gen Osten auf den Platz zuging. Als er sich dem Hause näherte, spähte er erwartungsvoll hinauf zu dem Fenster im ersten Stock.
Eugenie war nicht da.
Stattdessen sah er dort mit verschränkten Armen und der Achtsamkeit eines Wachpostens ihren Vater stehen. Ihre Blicke trafen sich kurz, dann zog Dr. Todd sich zurück, als hätte er alles gesehen, wonach er Ausschau gehalten hatte.
Kapitel 5
Simpsons Kutsche hatte das Pflaster der South Side schon lang hinter sich gelassen und rollte nun auf einem staubigen Weg zwischen den Feldern der Grange hindurch. Auch wenn es schon fast sieben Uhr am Abend war, schien die Sonne immer noch so warm und hell wie am Nachmittag, und Raven wurde sich dessen bewusst, dass Simpson sich bei ihrem Gespräch am Mittag wohl einen Scherz erlaubt hatte. An einem solchen Juniabend gab es schlichtweg keine dunklen Winkel, nicht einmal in der Old Town, und sie waren nun fern deren labyrinthischer Fäulnis. Jetzt näherte sich der Brougham dem Crossford House, dem Anwesen von Sir Ainsley Douglas, einem der wohlhabendsten und einflussreichsten Männer der weiteren Umgebung.
»Hatten Sie schon das Vergnügen?«, fragte Simpson. Der Ton des Professors ließ vermuten, dass er den Begriff euphemistisch verwendete.
»Bisher nicht, doch seinen Sohn Gideon habe ich an der Universität kennengelernt. Er studierte ebenfalls Medizin.«
Mehr sagte Raven nicht, gewiss, dass seine Knappheit für sich sprach. Gideon Douglas war der dünkelhafte, abscheuliche Kerl, an den er am Morgen hatte denken müssen und dem Henry zur Wahl seiner Eltern gratuliert hatte. Wenn der Apfel wahrlich nicht weit vom Stamm fiel, dann konnte Raven Simpsons behutsame Warnung vor Sir Ainsley gut verstehen. Weniger offensichtlich dagegen war, warum der Professor dessen Einladung überhaupt angenommen hatte.