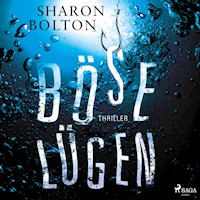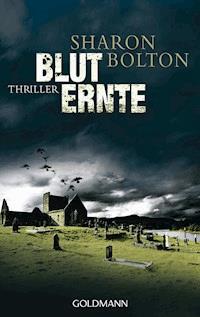2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Das Böse in dieser Stadt ist niemals verschwunden …
Ein schauderhafter Fund führt Florence Lovelady, die ranghöchste Polizeibeamtin Großbritanniens, zurück in ihre Heimat: In der englischen Kleinstadt Sabden sind in der Nähe des ehemaligen Waisenhauses vier Kinderskelette aufgetaucht. Nach offizieller Verlautbarung sind sie uralt. Doch Larry Glassbrook, verurteilter Mörder und berüchtigtster Sohn der Stadt, vertraut Florence an, dass hier etwas vertuscht wird. Um das Böse endgültig aus Sabden zu vertreiben, muss Florence sich ihrer eigenen Vergangenheit stellen – und sich in tödliche Gefahr begeben …
Der zweite Fall für Florence Lovelady: Hochspannung von der »Königin des Thrillergenres« (Huffington Post)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 667
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch
Dreißig Jahre sind vergangen, seit Florence Lovelady den Mörder Larry Glassbrook hinter Gitter brachte. Dreißig Jahre, in denen sie ihre Heimatstadt Sabden um jeden Preis gemieden hat. Doch kurz vor seinem Tod vertraut Larry ihr an, dass ihre Arbeit dort noch nicht getan ist. Denn die vier Kinderskelette, die kurz zuvor in der Nähe des ehemaligen Waisenhauses gefunden wurden, sind nicht so alt, wie es offiziell heißt. Florence, mittlerweile die ranghöchste Polizeibeamtin Großbritanniens, kehrt also in die Stadt zurück, in der sie einst den größten Fall ihrer Karriere löste. Und sie ist nicht die Einzige: Auch Larrys Tochter Cassie ist zurück in Sabden. Und sie setzt alles daran zu verhindern, dass Florence ein lang gehütetes Geheimnis ans Licht bringt …
Autorin
Sharon Bolton, geboren im englischen Lancashire, hat eine Schauspielausbildung absolviert und Theaterwissenschaften studiert. Ihr erster Roman »Todesopfer« wurde von Lesern und Presse begeistert gefeiert und machte sie über Nacht zum Star unter den britischen Spannungsautorinnen. In den darauffolgenden Thrillern stellte Bolton ihr brillantes Können immer wieder unter Beweis. Sie war für zahlreiche Krimipreise nominiert, wurde für »Schlangenhaus« mit dem Mary Higgins Clark Award ausgezeichnet und erhielt den Dagger in the Library für ihr Gesamtwerk. Sharon Bolton lebt mit ihrem Mann und ihrem Sohn in Oxford.
Weitere Informationen zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Sharon Bolton
Das Gift des Bösen
Thriller
Aus dem Englischen von Marie-Luise Bezzenberger
Die englische Originalausgabe erscheint 2020 unter dem Titel »The Poisoner« bei Trapeze, an imprint of the Orion Publishing Group, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstveröffentlichung März 2020
Copyright © der Originalausgabe 2019 by Sharon Bolton
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2020
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: FinePic®, München
Redaktion: Heiko Arntz
LS · Herstellung: kw
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-23266-5V001
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Vorbemerkung der Autorin
Das Gift des Bösen ist sowohl ein Folgeroman als auch ein Vorläufer von Der Schatten des Bösen. Die Erzählzeiten überschneiden sich. Fragen aus dem ersten Buch werden im zweiten beantwortet und umgekehrt. Im Voraus verraten wird nichts.
Den Ort Sabden gibt es wirklich, doch mit dem Sabden in diesem Buch hat er nur wenig Ähnlichkeit. Auch den Pendle Hill gibt es, aber niemand weiß, wo der Malkin Tower ursprünglich gestanden hat.
1612 wurden mehrere »Hexen« in Lancashire vor Gericht gestellt und gehängt. Sämtliche Verweise auf diese Ereignisse in der Florence-Lovelady-Reihe basieren auf historischen Gegebenheiten.
Teil 1
1999
Larry Glassbrooks letzte Tage
1. Kapitel
Giftmischer
Ein Giftmischer ist schwach.
Er ist dein Diener, dein Kind, deine Ehefrau, das ohnmächtige Gesinde, für das du kaum einen Gedanken erübrigst, es sei denn, dein Wohlbefinden ist beeinträchtigt.
Der Giftmischer geht neben dir, kaum bemerkt, nur selten bedacht. Er weiß, dass du ein Narr bist, in seliger Unkenntnis des geduldigen Attentäters, der dein Essen kocht, an deinem Herd hantiert, in deinem Bett schläft. Nie bist du sicher vor dem Giftmischer, denn er ist stets an deiner Seite.
Die Geduld des Giftmischers ist endlos. Er wartet auf den richtigen Augenblick, zählt alles Unrecht und alle Kränkungen zusammen, die ihm widerfahren sind, so wie ein Geizhals sein Gold zählt, und weiß, dass alles seinen Lauf nehmen wird. Ein Giftmischer kann es sich leisten, zu warten.
Der Giftmischer verfügt über Fertigkeiten und Kenntnisse, von denen du nicht die leiseste Vorstellung hast, denn er verspürt kein Bedürfnis, nach deinem Lob oder deiner Aufmerksamkeit zu streben. Die größte Gefahr ist die, die du nicht kommen siehst.
Ich sage »der Giftmischer«, richtiger wäre: »die Giftmischerin«, denn Gift war schon immer die Waffe der Machtlosen.
Der Giftmischer ist eine Frau.
Die Giftmischerin bin ich.
2. Kapitel
Florence
Montag, 26. Juli 1999
Larry hat etwas auf dem Herzen. Das merke ich immer. Jedes Mal, wenn das Gespräch stockt, weicht er meinem Blick aus, als würde er überlegen, ob jetzt der richtige Moment ist. Bei Larry ist Timing das Allerwichtigste, und wie immer läuft die Uhr. So macht er das. Es gefällt ihm, wenn ich mich in einem Zustand von ihm verabschiede, der irgendwo zwischen neugierig und frustriert liegt. Wenn ich mehr will. Er glaubt, ich komme deswegen immer wieder, dass er auf diese Weise dafür sorgt, dass ich an ihn denke. Ich habe ihm nie gesagt, dass er sich da keine Gedanken zu machen braucht.
Ich denke ständig an Larry.
Hinter mir bricht Streit aus. Eine Trillerpfeife ertönt, irgendjemand bellt einen Befehl. Wir achten nicht darauf.
»Hab Sie in den Nachrichten gesehen«, bemerkt er, und ich weiß, darum geht es nicht. Reine Verzögerungstaktik.
»Und, wie habe ich ausgesehen?«
»Wie immer.«
Larrys schwarzes Haar ist schneeweiß geworden, und seine Haut ist gröber. Die Nase ist ihm mehr als einmal gebrochen worden, und über dem rechten Auge hat er eine wulstige Narbe. Da hat mal jemand versucht, es ihm mit einer Gabel auszustechen. Trotzdem sieht er gut aus. Jeder, der sich fragt, wie Elvis ausgesehen hätte, wenn er siebzig geworden wäre und sein Gewicht in den Griff bekommen hätte, braucht sich bloß Larry anzuschauen.
Ich warte, doch er sagt nichts mehr, und ich werde nicht nachhaken. Nach all der Zeit fühle ich mich bei Komplimenten von Larry noch immer unbehaglich.
Er fängt an zu husten und zieht ein Taschentuch hervor. Ein Taschentuch mit Blutflecken darauf.
»Noch zehn Minuten, Ladys und Gentlemen«, ruft der Wärter. Um uns herum hören wir Vorbereitungen zum Aufbruch. Manche Leute haben noch einen weiten Weg vor sich und sind ungeduldig, wollen möglichst schnell hier raus. Hinter Larrys Kopf sehe ich ein Paar, das sich umarmt.
Larry und ich berühren uns nie. Larry und ich sind kein Liebespaar, kein Ehepaar und keine Lebenspartner. Wir sind nicht miteinander verwandt, noch nicht einmal befreundet. Ich habe keine Ahnung, was Larry und ich sind.
»Was haben Sie auf dem Herzen, Larry?«, frage ich.
Wieder wühlt er in seiner Tasche und schiebt einen schmalen Zeitungsausschnitt über den Tisch. Ich erkenne das viktorianische Gebäude auf dem Foto wieder, und irgendetwas in meinem Innern verkrampft sich. Es geht um Sabden. Eine kleine Industriestadt im Nordwesten. Dort habe ich meine berufliche Laufbahn begonnen.
Fast hätte dort mein Leben geendet.
Der Mittelfinger meiner linken Hand tut weh. Phantomschmerzen: Ich habe den Finger schon vor Jahren verloren. Doch er tut trotzdem weh, vor allem, wenn ich Angst habe. Normalerweise schiebe ich die Hand in die Achselhöhle, und der Druck hilft, doch vor Larry werde ich das nicht tun.
»Erinnern Sie sich an das Waisenhaus?«, erkundigt er sich. »Kinderheim, ich glaube, so haben die das damals genannt, als Sie aufgetaucht sind.«
»Black Moss Manor.« Ich sehe die steile, von Lorbeerbüschen gesäumte Auffahrt am Stadtrand vor mir, das rußgeschwärzte Mauerwerk, den spitzen Giebel in der Mitte des Schieferdaches. Ich kann große viereckige Fenster sehen. Die im Erdgeschoss sind vergittert.
Ich erinnere mich an die abblätternde rote Farbe der Haustür, an die rostigen Fallrohre und das Farnkraut, das aus bröckelndem Mörtel spross. Fast kann ich die kalte Luft des Moors riechen, das gekochte Gemüse, den Uringestank. Beides bildete eine üble Dunstglocke rund um die Rückseite des Gebäudes.
Ich lese den Artikel aus der Lancashire Morning Post von Anfang bis Ende durch und bin mir dabei Larrys Blick bewusst, der auf mir ruht.
9. Juli 1999
Die Leichen, die auf einem Gelände oberhalb der Laurel Bank in Sabden gefunden wurden, sollen laut einer Mitteilung der Lancashire Constabulary Ende des Monats im Rahmen einer nicht öffentlichen Zeremonie eingeäschert werden.
Das Kinderheim »Black Moss Manor«, früher als »Waisen- und Findelhaus« bekannt, wurde 1893 eröffnet. Ins Leben gerufen durch Spenden von wohltätigen Bewohnern des Orts, war es zeit seines Bestehens in privater Hand und wurde von einer gemeinnützigen Stiftung geleitet. Das Haus nahm zahlreiche Kinder aus den umliegenden staatlichen Heimen auf, wenn diese überbelegt waren. Als Kinderheim wurde es 1969 geschlossen. Seit 1981 dient das Gebäude als Erholungsheim für Berufstätige sowie als Reha-Klinik.
Man nimmt an, dass die gefundenen sterblichen Überreste von vier Kindern stammen, die wahrscheinlich an Influenza oder Tuberkulose gestorben sind, zwei Krankheiten, die im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert in Lancashire weit verbreitet waren. Die ehemalige Bibliothekarin und Lokalhistorikerin Daphne Reece sagte der Post, dass Waisenhäuser in der viktorianischen Zeit üblicherweise über eigene Friedhöfe verfügten, obgleich im Black Moss Manor, soweit sie wisse, keine Beerdigungen stattgefunden hätten. »Man würde Grabsteine erwarten«, sagte sie, »und seien es ganz einfache. Aber es ist möglich, dass sie schon vor Jahren entfernt worden sind.«
Die sterblichen Überreste waren im Zuge einer Routineinspektion der örtlichen Entwässerungsanlange entdeckt worden. Police Superintendent Tom Devine sagte der Post, dass keine formelle Untersuchung eingeleitet werden würde. »Die Leichenfunde sind sehr alt«, erklärte er. »Sie stammen aus einer Zeit, in der die Kindersterblichkeit viel höher war als heute. Wir haben keinen Grund zu der Annahme, dass ein Verbrechen begangen wurde.«
Die Identität der verstorbenen Kinder ist nicht bekannt, und man geht nicht davon aus, dass es lebende Angehörige gibt.
»Dieses Haus hat eine Menge Kinder durch seine Tür kommen sehen«, sage ich. »Ein paar davon sind bestimmt gestorben.«
Larry senkt die Stimme. »Ganz gewiss. Ich hab sie alle begraben, und zwar nicht bei denen auf dem Grundstück.«
»Was wollen Sie damit sagen?«, frage ich. »Waren Sie das etwa? Haben Sie sie umgebracht?«
Larry verzieht das Gesicht, eine Grimasse des Erstaunens oder der Enttäuschung. »Verdammt, nein.«
»Sie können es mir ja wohl kaum verdenken, dass ich frage.«
»Florence, ich habe Susan Duxbury, Stephen Shorrock und Patsy Wood umgebracht. Das habe ich zugegeben, und ich habe drei Jahrzehnte lang dafür gesessen.«
Das braucht er mir nicht zu sagen. Vor dreißig Jahren verschwanden in Sabden drei Teenager in unmittelbarer Nähe ihrer Wohnhäuser und wurden nie wieder lebend gesehen. Ich war damals eine kleine WPC, eine Streifenpolizistin, noch in der Probezeit, aber ich habe den Mörder aufgespürt und gefasst. Larry.
»Ich komme hier ja doch nicht lebend raus«, sagt er. »Was sollte es mir bringen, zu lügen?«
Es würde ihm nichts bringen. Überhaupt nichts.
»Ich erinnere mich an jeden Sarg, den ich jemals geschreinert habe, Florence. Können Sie sich das vorstellen?«
Bevor er ins Gefängnis kam, war Larry Schreinermeister und Mitbesitzer von Sabdens einzigem Beerdigungsunternehmen Glassbrook & Greenwood gewesen. Sein Partner Roy Greenwood führte die Geschäfte und marschierte im schwarzen Frack und Zylinder vor dem Leichenzug her, einen Stock mit Silbergriff in der Hand. Larry fertigte die schönen, mit Satin ausgeschlagenen Hartholzsärge an.
»In der Zeit, die ich mit Roy zusammengearbeitet habe, habe ich acht Kindersärge für das Black Moss Manor gemacht«, erklärt Larry mir. »Drei davon für Babys. Gerechnet hat sich das nicht, aber ich hab sie trotzdem schön gemacht, weil ich ja selbst zwei Kinder hatte.«
Ich hebe unwillkürlich die Augenbrauen. Ein liebender Vater, der die Kinder anderer Leute umbringt? Entweder sieht er es nicht, oder er ignoriert mich.
»Worauf ich hinauswill, ist«, fährt er fort, »die Kinder sind nicht auf dem Gelände von Black Moss beerdigt worden, sondern auf dem der Gemeinde von St. Augustine. Das war der nächste Friedhof.« Er tippt mit dem Finger auf den Zeitungsausschnitt. »Wo kommen die Leichen also her?«
»Das war vor Ihrer Zeit«, gebe ich zu bedenken. »Wann haben Sie angefangen, für das Beerdigungsinstitut zu arbeiten?«
»1946.« Er hat mit der Frage gerechnet. »Roy hat sich an die Schule gewandt. Er hat einen Lehrling gesucht, jemanden, der gut im Werken war.«
Ich werfe erneut einen Blick auf den Zeitungsausschnitt. Vier kleine Skelette. »Dann sind diese Kinder eben noch früher gestorben. Hier steht, dass es das Heim seit dem 19. Jahrhundert gegeben hat.«
Larry seufzt, ein feuchtes, ungesundes Geräusch. »Florence, ich kenne mich ganz gut mit Toten aus, und damit, was unter der Erde mit denen passiert. Der Boden da oben ist sauer. Und nass. Kleine Leichen würden sich da keine fünfzig Jahre halten.«
»Wollen Sie damit sagen, das waren inoffizielle Beerdigungen?«
»Jep. Und vor noch gar nicht so langer Zeit. In den letzten zwanzig Jahren. Allerhöchstens dreißig.«
»Dann wird man das untersuchen.«
»Sieht es für Sie aus, als hätten die vor, irgendwelche Untersuchungen anzustellen?«
Noch einmal überfliege ich den Artikel. Die sterblichen Überreste sollen nach einer kleinen Zeremonie eingeäschert werden. »Ich kann mich da nicht einmischen.«
»Hört sich nicht an wie die WPC Lovelady, die ich kenne.«
Ich bin die letzte Besucherin, die noch sitzt. Der Wärter schaut auf die Uhr.
»Larry«, sage ich, »wir haben das Kinderheim dichtgemacht. Die Leute, die es geleitet haben, sind wegen Verletzung der Aufsichtspflicht und Körperverletzung angeklagt worden. Sie haben im Gefängnis gesessen.«
Ich versuche, mich an die Namen der beiden zu erinnern. Ashton? Aston?
»Ein paar Jahre«, entgegnet Larry. »Dann waren sie wieder draußen. Das Kinderheim haben Sie vielleicht dichtgemacht, aber das, was da vorgegangen ist, haben Sie nicht beendet.«
Ich schüttele den Kopf.
»Sie wissen genau, dass in dieser Stadt etwas nicht stimmt, Florence«, sagt er. »Sie haben es all die Jahre gespürt.«
Wieder ziehe ich die Brauen hoch.
Diesmal sieht er es und lächelt. »Und das lag nicht bloß an mir.«
»Ich gehe nicht dahin zurück.« Das ist mein Ernst. Ich werde nie nach Sabden zurückkehren.
Larry zieht sein blutbeflecktes Taschentuch hervor, und mir fällt von Neuem auf, wie grau seine Haut wirkt. Das Fleisch an seinen Knochen scheint sich auflösen zu wollen. Das sollte mich nicht erschrecken. Und doch tut es das. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten muss ich mich dem Gedanken an ein Leben ohne Larry stellen.
»Nicht mal zu meiner Beerdigung?«, fragt er.
3. Kapitel
Cassie
Unterschätzt nie die Macht einer anderen Hexe. Das hat meine Mutter uns immer eingeschärft, und ich halte mich daran, selbst wenn die fragliche Hexe meine Mutter ist. Zu ihrer Zeit war Sally Glassbrook eine mächtige Vertreterin der alten Künste, und ich nehme mich in ihrer Nähe in Acht.
Ich sehe nach, ob mein Amulett aus schwarzem Turmalin dort ist, wo es sein soll, unter dem Rand meines Shirts. Als ich aus dem Auto steige, spreche ich ein Gebet. Ich bitte um Kraft und stelle mir eine dünne Silberschnur vor, die aus meinem tiefsten Innern geradewegs bis ins Zentrum der Erde verläuft. Als ich ganz ruhig bin – Herrgott, es stinkt mir, dass sie das immer noch mit mir machen kann –, als ich ruhig genug bin, gehe ich zur Tür.
Das Pflegeheim, in dem die alte Zicke lebt, liegt ein paar Kilometer außerhalb von Sabden. Es ist nicht annähernd so alt, wie es aussieht, und wenn man erst mal drinnen ist, könnte es irgendeine x-beliebige moderne Klinik sein. Das alte Mauerwerk außen ist so wenig echt wie meine vermeintliche Fürsorge, mit der ich das teuerste Heim in der ganzen Gegend für meine Mutter ausgesucht habe. Das Wohlergehen meiner Mutter ist mir so was von egal. Ich habe das Heim wegen seiner Lage ausgesucht.
Ich benutzte nie die Haustür, sondern schlüpfe lieber unbemerkt durch einen Nebeneingang hinein. Ihr Zimmer hat den kitschigen Namen »Pfingstrose«. Teppichboden gibt es hier keinen, doch sie hört mich nie kommen. Gerade will ich den Türknauf drehen, als ich drinnen Stimmen höre.
»Alle Zeichen deuten darauf hin, dass Larry bald sterben wird.« Eine sonore weibliche Stimme mit Lancashire-Akzent. »Vielleicht sogar am Tag des Vollmondes.«
Meine Mutter lacht leise auf. »Er hatte schon immer einen Hang zum Dramatischen.«
Meine Mutter? Scheiße, was geht denn da ab? Meine Mutter hat seit Jahren kaum ein Wort gesagt. Sie hat präsenile Demenz, verstärkt durch eine chronische Depression. Sie liegt mit weit offenen Augen im Bett oder sitzt in einem Sessel und starrt aufs Moor hinaus. Manchmal läuft sie barfuß im Zimmer herum und zerrt an ihrem Haar. Gelegentlich murmelt sie vor sich hin. Mit anderen Menschen redet sie nicht.
Die fremde Stimme sagt: »Cassie hat Erkundigungen eingeholt. Sie will die Beerdigung in Sabden abhalten.«
»Sie ist wieder da?«, fragt meine Mutter. »Sie war in der Stadt?«
»Nein, nein, das glaube ich nicht. Nur per Telefon. Das ist keine gute Idee, Sally. Das mit der Beerdigung, meine ich. Sogar zehn Kilometer weiter die Straße runter wäre besser.«
Ich kann Spuren eines Karibik-Akzents heraushören. Vor Jahren waren wir mal mit einer Familie aus der Karibik befreundet, aber ich komme nicht auf den Namen.
»Was spielt das jetzt noch für eine Rolle?«, fragt meine Mutter. »Die Leute regen sich ein paar Stunden lang auf, und dann gehen sie alle wieder, auch Cassie.«
Zu hören, wie sie meinen Namen sagt, fühlt sich an, als würde man an einer alten Wundstelle kratzen. Es ist Jahre her, dass sie auch nur meine Existenz zur Kenntnis genommen hat.
»Sie will das Haus verkaufen«, sagt die Frau aus der Karibik. »Sie hat Avril geschrieben.«
Avril Cunningham ist meine Anwältin. So viel zum Thema anwaltliche Schweigepflicht.
»Das will ich auch«, erwidert meine Mutter. »Ich hätte es schon vor Jahren verkauft. Zumindest das bin ich ihr schuldig, nach dem, was ich ihr angetan habe.«
»Werden Sie zur Beerdigung gehen?«
»Nein.«
Nach dem, was sie mir angetan hat?
Sogar im Korridor kann ich den Seufzer hören, der als Nächstes kommt. »Sally, Sie müssen zu uns zurückkommen. Wenn es vorbei ist, wenn er wirklich nicht mehr da ist, werden Sie dann dieses Heim verlassen?«
Etliche Sekunden lang herrscht Schweigen im Zimmer. Dann sagt meine Mutter: »Was kann ich denn tun? Was kann denn irgendjemand von uns tun?«
»Sie haben doch bestimmt die Nachrichten gesehen. Das von den Kinderleichen, die beim Black Moss Manor gefunden worden sind?«
Ich habe die Nachrichten gesehen. Ich habe die Lancashire Morning Post abonniert. An diese Geschichte erinnere ich mich. Inzwischen dringt ein schweres Seufzen aus dem Zimmer. »Ja, habe ich«, sagt meine Mutter. »Und?«
»Sie werden sie einäschern. Nicht begraben, einäschern.«
»Das ist am billigsten.«
»Und es vernichtet jegliche Beweise.«
Ich drücke mich dichter an die Tür heran.
»Es heißt, es soll am selben Tag passieren, Sally. Alle werden auf Larrys Beerdigung schauen. Niemand wird sich dafür interessieren, was sie auf der anderen Seite der Stadt treiben.«
Ich kann keine Antwort hören.
»Die versuchen, etwas zu vertuschen, Sally.«
Die? Wer sind »die«?
»Sally, Sie kennen dieses Heim. Dieses Mädchen, dem Sie geholfen haben, das kam doch von dort, oder?«
»Marigold?« In der Stimme meiner Mutter klingt Wärme mit. »Florence und ich haben ihr Baby auf die Welt geholt.«
An Marigold erinnere ich mich. Sie ist in unserem Haus erschienen, kurz nachdem mein Vater verhaftet worden war. Und dann genauso plötzlich wieder verschwunden.
»Wir haben versucht, sie zu retten«, sagt meine Mutter gerade. »Wir haben unser Bestes getan. Wieso fragen Sie nicht Florence?«
»Nein«, wehrt die Frau schroff ab. »Wir waren uns doch alle einig. Florence darf nicht zurückkommen.«
Versucht, sie zu retten? Ihr Bestes getan? Wovon reden die eigentlich? Marigold ist doch zu ihrer Familie zurückgegangen.
»Die Meister sind unser Fluch, Sally«, sagt die Frau. »Niemand außer uns kann sich ihnen entgegenstellen.«
Die Meister? Ich habe keine Ahnung, wen oder was sie damit meint, doch irgendwo tief in meinem Innern hallt etwas wider, wie eine uralte Furcht, die nach langem Schlaf erwacht ist.
»Leichen, schon lange tot, Marlene«, sagt meine Mutter. »Was können wir tun?«
»Und was ist, wenn sie noch gar nicht so lange tot sind?«, fragt die Frau namens Marlene. »Was ist, wenn es noch nicht vorbei ist?«
Im Zimmer ist Bewegung zu hören. Rasch weiche ich zurück, husche um die nächste Ecke herum. Ich bekomme kaum Luft.
Meine Mutter hat mich angelogen. Oh, natürlich, sie hat nie direkt gesagt: »Cassie, Liebling, mein Verstand hat sich verabschiedet und mich als leere, nutzlose Hülle zurückgelassen, keine Spur mehr von der Mutter, die du einst geliebt hast.« Das hat sie nie so gesagt, nur – verflucht noch mal, ich hatte ja keine Ahnung, dass meine Mutter so gut schauspielern kann.
Und Marigold? Die Meister? Was soll dieser Scheiß?
Und was genau hat sie mir angetan?
Ich höre, wie sich eine Tür schließt. Schritte entfernen sich. Marlene – natürlich, jetzt erinnere ich mich. Sie heißt Marlene Labaddee, eine alte Freundin meiner Mutter und die Besitzerin des Blumenladens in Sabdens Hauptstraße. Zum Glück hat Marlene nicht wie ich die Gewohnheit, sich zur Hintertür hereinzuschleichen.
Rasch gehe ich auf das Zimmer meiner Mutter zu, hoffe, sie in flagranti zu ertappen … Ich weiß nicht genau, bei was – bei irgendeiner Form von Leben. Doch sie sitzt wieder in ihrem Sessel am Fenster und starrt regungslos aufs Moor hinaus.
Sie trägt einen formlosen Wollrock, der ihr zu groß und für das Wetter zu warm ist. Darüber eine Bluse, an die ich mich von früher als Kind erinnere, und eine dünne rosafarbene Strickjacke. Ihr Haar, einst lang und hellblond, ist längst grau und dünn geworden. Sie hat die Angewohnheit, sich Strähnen um die Finger zu wickeln und daran zu zerren. Ihre Strickjacke ist übersät mit ausgefallenen Haaren.
Sie fährt zusammen, als die Tür hinter mir zuknallt. Einige Sekunden lang beobachte ich ihr Spiegelbild in der Fensterscheibe. Erst als sie den Blick hebt und meinem begegnet, gehe ich zum Bücherregal und knie mich hin. Während ich anfange, Bücher herauszuziehen, beobachte ich sie aus dem Augenwinkel und warte – hoffe – auf eine Reaktion. Doch sie starrt bereits wieder regungslos vor sich hin.
Ich stelle die Bücher in einer anderen Reihenfolge wieder ins Regal. Jedes Mal, wenn ich herkomme, bringe ich ihr Bücherregal durcheinander. Manchmal lasse ich Bücher unter dem Bett liegen oder draußen auf dem Fenstersims, oder ich benutze sie, um verschütteten Kaffee unter einem Becher aufzusaugen.
»Dein Mann liegt im Sterben«, verkünde ich. Dabei habe ich einen Geistesblitz und stelle die Bücher so zurück, dass die Rücken nach innen ins Regal zeigen. »Es kann jetzt jeden Tag so weit sein. Lungenkrebs, der auf den Herzbeutel übergegriffen hat. Mein herzliches Beileid, bla, bla, bla.«
Ich richte mich auf und gehe zum Kleiderschrank. Als ich das letzte Mal hier war, habe ich alles darin auf links gedreht. Ich habe die Hand schon an der Tür, als mir klar wird, dass es sinnlos ist. Meine Mutter wird nie aus ihrem Dämmerzustand aufwachen und mich anfahren, dass ich ihre Sachen in Ruhe lassen soll. Sie weiß ganz genau, was ich tue, und auch, warum, und es ist ihr egal.
Plötzlich fühle ich mich schrecklich müde. Ich setze mich in den anderen Sessel. Im selben Moment ist auf dem Korridor das vertraute Klappern zu hören. Der Teewagen kommt. Ein Klopfen, dann öffnet sich die Tür.
»Hallo, Sally. Möchten Sie ein Tässchen? Oh, hi, Cassie, ich wusste gar nicht, dass Sie hier sind.«
Ich habe mir die Namen der Angestellten nie gemerkt, aber das Gesicht dieser Frau ist mir vertraut. Aufgedunsen und schwabbelig, voller roter Äderchen und verschwitzt von der Anstrengung, den Teewagen zu schieben. Sie kennen mich natürlich alle. Ich zahle ja jedes Quartal die Rechnung.
»War meine Schwester in letzter Zeit mal hier?«, erkundige ich mich.
»Nicht dass ich wüsste, Liebes.« Sie schenkt Tee ein und geht wieder.
»Am Mittwoch gehe ich Dad besuchen«, sage ich, als wir wieder allein sind. »Ich habe eine Sondererlaubnis, weil er im Sterben liegt.«
Meine Mutter antwortet nicht. Und sie rührt sich auch nicht. Nie trinkt sie den Tee, der ihr eingeschenkt wird. Bis jetzt habe ich angenommen, dass die Pfleger ihn ihr nur servieren, weil ich dabei bin, um zu zeigen, wie gut sie sich um sie kümmern. Jetzt ist mir klar, dass sie wahrscheinlich ganz anders ist, wenn ich nicht da bin. Bestimmt würde sie diesen Tee gern trinken, geht mir auf. Vielleicht sollte ich ihn trinken.
»Irgendwelche Vorlieben in Sachen Blumen zur Beerdigung?«, frage ich. »Wie hieß noch mal diese Freundin von dir? Du weißt schon, die Floristin in der Hauptstraße, Marlene Irgendwas. Siehst du die manchmal?«
Nicht mal ein Augenlid zuckt.
»Ich habe überlegt, ob ich Marigold zur Trauerfeier einlade«, fahre ich fort. »Du erinnerst dich doch an Marigold, oder? Hat eine Zeitlang bei uns gewohnt. Du kannst mir nicht zufällig eine Adresse von ihr geben?«
Noch immer rührt Sally sich nicht, doch ich bemerke ihre veränderte Atmung. Sie hat begriffen, dass ich draußen vor der Tür gelauscht habe.
»Was hast du mir angetan?«, frage ich. »Was hast du geglaubt, wiedergutmachen zu müssen?«
Nichts. Absolut nichts.
An der Tür bleibe ich stehen, drehe mich noch einmal um.
»Ich bleibe in der Stadt, wegen der Beerdigung. Ich habe mir ein Zimmer im Black Dog reserviert«, sage ich. »Bei John.«
Endlich eine Reaktion. Ihr Kopf ruckt hoch, ihre Augen sind vor Schreck weit aufgerissen. Als ich das Zimmer verlasse, lächele ich.
4. Kapitel
Florence
Dienstag, 27. Juli 1999, sehr früh am Morgen
»Florence! Florence, wach auf. Es ist nur ein Traum.«
Ich bin in einem Grab. Kann mich nicht bewegen. Die Schwärze ist überall um mich herum, und es kommt immer näher …
»Komm schon, Florence. Wach auf!«
Bewegung neben mir, sanftes Licht … Ich bin zurück in meinem Schlafzimmer, wo mein Mann sich über mich beugt. Ich habe mich in der Bettdecke verheddert. Schwitzend mache ich mich los. Nick reicht mir ein Glas Wasser.
»Alles klar?«, fragt er.
Ich nicke. »Habe ich Ben geweckt?«
Wenn die finsteren Träume kommen, schreie ich. Ich habe schon die Nachbarn aufgeweckt, wenn die Fenster offen sind.
»Ich höre nichts«, sagt er. »Ich sehe gleich mal nach. Bist du sicher, dass alles okay ist?«
»Alles bestens. Schau nach Ben.«
Es ist nicht alles bestens. Bis auch nur annähernd alles bestens ist, wird es noch Stunden dauern, aber ich will, dass Nick geht. Wenn er im Zimmer bleibt, weiß ich genau, was als Nächstes …
»Der übliche Traum?«, erkundigt er sich.
Wieder nicke ich, obgleich es genau genommen drei immer wiederkehrende Träume gibt, vor denen wir uns fürchten. Im ersten greifen die Hände toter Kinder aus der Erde heraus nach mir, aus ihren Gräbern. Der ist ziemlich schlimm. Im zweiten schneidet ein Mann ohne Gesicht Stücke von mir ab, eins nach dem anderen. Der macht wirklich keinen Spaß. Und im dritten und allerschlimmsten bin ich noch am Leben, bin aber in einem Sarg tief unter der Erde gefangen. In einem Sarg, den Larry geschreinert hat.
Diese Träume habe ich seit dreißig Jahren.
»Jedes Mal, wenn du ihn besuchst«, bemerkt Nick, als ich mich auf den Weg ins Badezimmer mache.
Das stimmt zwar nicht ganz, kommt der Wahrheit aber nahe genug, sodass ich nicht einmal versuche zu widersprechen.
»Wie lange noch?«, fragt er mich.
Mein Gesicht im Spiegel ist leichenblass. »Vielleicht nicht mehr lange. Er ist krank.«
Ich fange an, zu zählen, ein Therapietrick, um meine Atmung unter Kontrolle zu bekommen. »Er stirbt«, füge ich hinzu, noch ehe ich bei vier angekommen bin.
»Gut«, knurrt Nick.
Nick schläft irgendwann wieder ein. Das schaffe ich nach diesen Träumen nie, also versuche ich es auch nicht. Stattdessen gehe ich in den obersten Stock hinauf und lasse die Leiter zum Dachboden herunter. Hinter einem Kasten mit Bens Baby-Spielsachen, von denen ich mich nicht trennen kann, finde ich einen Karton – die Pappe verstaubt, eingehüllt in Spinnweben und mit angeknabberten Ecken. Die Frau, die ich früher einmal war, hat SABDEN auf den Deckel geschrieben.
Ich lasse die Akten mit den Glassbrook-Morden, wo sie sind. Von diesen Erinnerungen brauche ich heute Nacht ganz bestimmt nicht noch mehr in meinem Kopf. Ich hole nur meine Unterlagen vom August 1969 heraus. Tatsächlich, dort sind Zeitungsartikel von dem Black-Moss-Fall. Ich finde einen, in dem es darum geht, was mit den Kindern geschehen ist, nachdem das Heim geschlossen wurde. Ich entdecke Berichte über die Gerichtsverhandlungen. Zusammenfassungen der Prozesse gegen die Leute, die dort gearbeitet haben. Aster war der Name, an den ich mich nicht mehr erinnern konnte. Die beiden Heimleiter waren Dr. Frederic Aster und Dr. Judith Aster.
Und dann finde ich den Artikel, nach dem ich suche. Am Donnerstag, dem 14. August 1969, widmete sich die Titelseite des Lancashire Evening Telegraph ausschließlich dem Großbrand, der das Heim in der Nacht, in der wir es dichtgemacht hatten, verwüstete.
Das dazugehörige Foto war am nächsten Morgen aufgenommen worden, um kurz nach neun. Das weiß ich, weil ich auch darauf bin. Tom war mit mir hingefahren. Wir hatten ein ganzes Stück entfernt von dem rußgeschwärzten Gebäude halten müssen. Es waren einfach zu viele Löschfahrzeuge im Weg gewesen.
Auf dem Foto schaue ich das Gebäude an. Tom, der vielleicht gemerkt hat, dass wir beobachtet werden, hat sich zur Kamera umgedreht. Eigentlich brauche ich die Story gar nicht zu lesen. Ich erinnere mich an jede Einzelheit – von der Hitze herausgesprengte Fenster, der durchweichte Boden übersät mit kaputten Möbeln, Büchern, Kinderkleidern. Ich erinnere mich an den Ruß, der in der Luft zu hängen schien, an die verkohlten Mauern, den herabgestürzten Kronleuchter.
Ich erinnere mich, wie der Brandmeister uns herumführte und uns zwei eindeutige Brandherde in den Mitarbeiterbüros zeigte.
»Feuer bricht doch nicht zweimal versehentlich aus«, hatte ich bemerkt.
»Nein, ganz bestimmt nicht, junge Lady«, hatte er geantwortet.
Ich erinnere mich an die von der Hitze verzogenen Aktenschränke, ihr Inhalt zu Asche verbrannt. Sie waren geöffnet worden – damit das Feuer ihre Geheimnisse vernichten konnte.
Ich werde nicht nach Sabden zurückkehren, aber ich kann immerhin ein oder zwei Telefonate führen. Ich kann Larry Trost zusprechen, bevor er stirbt. So viel bin ich ihm schuldig. Ich wende mich ab und will den Dachboden schon verlassen, als ich wie angewurzelt stehen bleibe.
Ich bin ihm das schuldig? Ich bin Larry etwas schuldig? Was zum Teufel ist los mit mir?
5. Kapitel
Cassie
Larry liegt im Sterben. Die meiste Zeit ist er müde, tut sich schwer mit dem Essen, hat Schmerzen. In ein paar Tagen, vielleicht sogar Stunden, sagen sie mir, wird es vorbei sein. Er wird seine Geheimnisse mit ins Grab nehmen.
Und ich werde frei sein.
Der aufgehende Mond hat mich geweckt, wie er es oft tut. Noch ein Tag bis Vollmond. Eine Zeit, in der die menschliche Energie am größten ist. Meine besten Arbeiten schaffe ich in der Zeit um Vollmond. Mein Loft hat auf drei Seiten Fenster, die vom Boden bis zur Decke reichen. Mondlicht strömt herein. Es wird ganz schön heiß hier, vor allem im Sommer, aber normalerweise schlafe ich tagsüber und arbeite nachts.
Vor ein paar Jahren, in einem der seltenen Zeitschriften-Interviews, zu denen ich mich bereit erklärt habe, haben sie ein Mordsgewese um meine nächtliche Lebensweise gemacht. Ich wurde als »Vampir mit dem Silberhaar« bezeichnet. Dämliche Arschgesichter. Ich bin kein Vampir. Ich bin eine Hexe.
Ich stehe auf. Eigentlich muss ich noch ein Stück fertig schreiben – die Ouvertüre für ein neues Musical –, aber ich weiß nicht, ob ich heute Nacht arbeiten kann. Also stehe ich am Fenster und blicke auf die funkelnden Lichter und tiefen Schatten des nächtlichen Salford hinunter, und ich habe das Gefühl, dass mein Leben sich öffnet wie eine Blume. Alles, wovon ich so lange geträumt habe, ist ein wenig näher gekommen, wird bald leicht zu greifen sein.
Gut fünfzig Kilometer entfernt liegt die Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Sabden. Und in Sabden wohnt der einzige Mann, den ich jemals wirklich geliebt habe. Solange Larry am Leben ist, kann ich nicht dorthin zurück, und doch war ich nie imstande, Sabden vollständig zu verlassen. Vom Pflegeheim meiner Mutter aus kann man die Dächer von Sabden sehen, jenseits des Moores. Ich verharre an den äußersten Rändern der Stadt, halte mich an den Bann, der mir auferlegt ist, bin aber nahe genug, um rasch dort sein zu können, wenn die Zeit kommt.
Und diese Zeit kommt. Ich kann es fühlen.
Ich sehe die Lichter von Sabden vor mir, die schmutzigen Reihenhausstraßen, die Fabrikschornsteine, die wie geschwärzte Finger nach dem Himmel greifen. In meinem Kopf kann ich den als schwarze Masse aufragenden Pendle Hill bei Nacht sehen und unser altes Haus am Rand des Moores. Ich höre die Bienen meiner Mutter in den Apfelbäumen ihre Lieder summen und das Hämmern in Larrys Werkstatt, wo er im Takt von Elvis Presleys Musik, die er so liebt, poltert und sägt und nagelt.
Ein jäher Schmerz. Als hätte mir jemand einen Schlag in den Magen versetzt. Ich schnappe nach Luft, und als ich sie wieder herauslasse, klingt es wie ein Schluchzen.
Mein Vater stirbt.
Nein, ich werde nicht weinen. Nicht um Larry. Und doch tue ich genau das. Tränen strömen mir übers Gesicht, ich ringe nach Luft und ich weine um alles, was ich früher einmal für wahr gehalten habe, und um das Leben, das ich hätte leben sollen. Ich weine um den ersten Mann, den ich geliebt habe und der mich jetzt für immer verlässt. Wo kommt diese furchtbare Trauer her? Darauf habe ich doch dreißig Jahre gewartet. Ich hätte ihn doch selbst umgebracht, wenn es mir möglich gewesen wäre.
Ich kann nicht aufhören, also gestatte ich mir zu weinen. Nach einiger Zeit, als der Mond höher gestiegen ist, werde ich ruhiger. Ich rufe mir ins Gedächtnis, dass ich auf Larrys Tod gewartet habe. Dieser Kummer ist einfach nur der Preis, den ich zahlen muss. Meine Tränen sind das Opfer.
Vielleicht sind sie ja das einzige Opfer, das nötig ist. Aber da kann ich flexibel sein.
Allmählich wird mir kalt, doch ich mache das Fenster nicht zu. Stattdessen gehe ich zur Stereoanlage und drücke auf »Play«. Der Song ist eins meiner Lieblingslieder, und heute Nacht erscheint er mir angemessen. Paul Simons Fifty Ways to Leave Your Lover.
Die Musik setzt ein. »Stab her in theback, Jack«, singe ich. »Throw her ’neath a bus, Gus.« Ich fühle mich schon besser.
Dann schaue ich hinaus, zu der Schwärze, von der ich weiß, dass es Sabden ist. Dorthin, wo er ist, und ich schicke meine Worte in die Nacht hinaus.
Ich komme, mein Liebster.
6. Kapitel
Florence
Es wird später Nachmittag, ehe mein Terminplan eine Lücke aufweist und ich Gelegenheit habe, die Anrufe zu tätigen, über die ich den ganzen Tag nachgedacht habe. Ich fange mit dem einfachsten der drei an, dem bei den Wasserwerken.
»Was kann ich für Sie tun, Assistant Commissioner?«, erkundigt sich der leitende Direktor schroff. Wäre ich irgendjemand anders, hätte er den Anruf wahrscheinlich nicht entgegengenommen, aber die meisten Leute ziehen es vor, sich mit den hohen Tieren der Londoner Polizei gut zu stellen, selbst im hohen Norden des Landes.
»Da gibt’s eigentlich nicht viel zu sagen«, meint er, als ich erklärt habe, warum ich anrufe. »Wir haben ein Reservoir oben bei Astley Bank, ein Stück weiter das Moor rauf. Um es kurz zu machen, wir haben mehr Wasser verloren, als es um diese Jahreszeit der Fall sein sollte, also hab ich die Jungs nach undichten Stellen suchen lassen. Ihre Messgeräte haben gleich hinter dem Gebäude was angezeigt, also haben wir da das Rohr freigelegt. Und da haben wir die Leichen gefunden.«
»Haben Sie sie selbst gesehen?«, erkundige ich mich.
»Aye, ich bin raufgefahren. So was nehmen wir ernst.«
»Können Sie mir etwas über den Zustand der Leichen sagen?«
Eine kurze Pause. »Na ja, ich denke, das ist eher ’ne Frage für die zuständige Polizei.«
Ich lasse ein paar Sekunden des Schweigens verstreichen und hoffe, dass er es füllt. Er tut es nicht.
»Ist beabsichtigt, das Gelände weiträumig abzusuchen?«, frage ich. »Nach möglichen weiteren Leichen?«
»Ist schon passiert.« Er klingt sehr zufrieden mit sich. »Alles aufgegraben. Nichts gefunden. Fall abgeschlossen.«
Die Pressestelle gibt mir die Telefonnummer, die ich als Nächstes brauche, aber erst nach wiederholten Beteuerungen meinerseits, dass es um eine persönliche Angelegenheit geht und nichts mit der Londoner Polizei zu tun hat.
Abby Thorn, die 1969 mehrere der Artikel über das Black Moss Manor geschrieben hat, war als junge Reporterin in Sabden tätig, zur selben Zeit, als ich dort meine Probezeit absolviert habe. Genau wie ich zog sie weg, als ihre Karriere Fahrt aufnahm. Im Laufe der Jahre habe ich hin und wieder von ihr gehört. Sie hat für etliche der überregionalen Zeitungen als Korrespondentin im Nahen Osten gearbeitet und hatte auch mal eine eigene Radiosendung bei der London Broadcasting Corporation. Jetzt scheint sie genau wie ich allmählich kürzerzutreten. Sie ist Nordengland-Korrespondentin bei der Times und moderiert eine wöchentliche Nachrichtensendung für BBC Radio Lancashire.
Die Telefonzentrale der BBC in Blackburn meldet sich rasch, und ich werde in die Nachrichtenredaktion durchgestellt. Miss Thorn ist nicht zu sprechen, also hinterlasse ich meine Telefonnummer.
7. Kapitel
Cassie
Ich sollte lieber von Angesicht zu Angesicht mit ihr reden. Menschen können lügen, wenn wir nur ihre Stimmen hören. (Lasst euch das von mir gesagt sein: Ich habe Lügen zur Kunstform gemacht.) Und wenn ich sie richtig in Rage bringe, kann sie einfach auflegen. Ich sollte hinfahren, in ihren Laden marschieren, ihr in die Augen sehen.
Larry hat höchstens noch ein paar Tage zu leben. Was kann das jetzt noch ausmachen?
Nur macht es eben doch etwas aus. Das alles ist mir so lange eingehämmert worden, dass ich es jetzt nicht ändern kann. Solange Larry lebt, kann ich nicht nach Sabden zurück.
»The Flower Pot«, meldet sie sich mit ihrer sonoren Singsangstimme. »Wie kann ich Ihnen helfen?«
»Hallo, Marlene«, sage ich. »Hier ist Cassandra Glassbrook.«
Sie schnappt nach Luft. Ein guter Anfang.
»Hallo, meine Kleine«, sagt sie. »Lange nichts von dir gehört. Wie geht’s dir, Cassie?«
Sie weiß genau, wie es mir geht. Meine Mutter wird es ihr erzählt haben.
»Die Zeit deines Vaters ist fast gekommen«, fährt sie eilig fort. »Ich hoffe, er findet endlich seinen Frieden.«
Das ist höchst unwahrscheinlich. Ich sage noch immer nichts.
»Was kann ich für dich tun, Cassie? Rufst du wegen der Blumen für die Beerdigung an? Es wäre mir eine Ehre, einen Kranz für deinen Vater zu machen.«
»Ja«, sage ich, dankbar für das Stichwort. »Kannst du einen aus Chrysanthemen machen? Oder noch besser – aus Marigolds?«
Schweigen.
»Solche Blumen haben wir eigentlich nicht im Laden.« Jetzt klingt ihre Stimme wachsam.
»Schade«, sage ich. »Marigold sollte doch nicht vergessen werden, nicht wahr?«
Nichts. Dann: »Ich weiß, dass du gestern im Pflegeheim warst. Deine Mutter hat angerufen und es mir erzählt.«
Telefonieren kann sie also auch.
»Wieso tut sie so, als wäre sie dement?«, frage ich. »Was zum Teufel treibt sie da?«
»Sie tut doch gar nicht …«
»Ich habe ihre Krankenakte gesehen. Sie ist eine Betrügerin. Ich will wissen, warum.«
»Dann musst du sie selbst fragen.«
Ich gehe zum Fenster meiner Wohnung und schaue nach Norden, dorthin, wo Marlene ist. Ich hätte hinfahren sollen. Ich sollte jetzt bei ihr im Laden sein, ihr direkt in die Augen sehen.
»Sie redet nicht mit mir«, sage ich. »Sie hat seit Jahren nicht mehr mit mir geredet.« Ich höre das Zittern in meiner Stimme. Ich habe so gut wie verloren.
»Dann musst du dich fragen, warum das so ist.«
Ich kämpfe gegen den Drang an, den Hörer aufzuknallen. Genau das will sie ja.
»Redet sie mit Luna?« Ich hasse mich selbst dafür, dass ich das frage.
»Das weiß ich nicht.«
Ich versuche es anders. »Was ist mit Marigold passiert?«
Sie sagt nichts.
»Ich habe euch gestern gehört. Ihr habt gesagt, meine Mutter und Florence Lovelady haben versucht, sie zu retten. Was soll das heißen?«
»Cassie«, seufzt sie, »das ist lange her.«
»Luna und ich haben gedacht, Marigold wäre zu ihrer Familie zurückgegangen. Dass sie sich mit ihren Eltern versöhnt hätte, dass sie ihr helfen würden, das Baby großzuziehen. Das hat Florence uns gesagt, und Mum war dabei. Haben sie gelogen?«
Marlene antwortet nicht.
»Sag mir, was mit Marigold passiert ist.«
»Ich weiß es nicht.«
»Wie meinst du das?«
»Niemand weiß es. Sie ist verschwunden. An dem Abend, als das Kinderheim abgebrannt ist. Bei euch hat es Krach gegeben, und sie ist weggerannt. Zumindest glauben wir das.«
Natürlich hat es Krach gegeben. Fürchterlichen Krach. Ich war der Auslöser. Bin ich etwa auch schuld an Marigold?
»Ihr müsst doch nach ihr gesucht haben.«
»Natürlich«, erwidert Marlene. »Aber sie war weg.«
»Wer sind die Meister?«
Wieder ein scharfes Atemholen.
»Es ist jemand im Laden«, sagt Marlene. »Ich muss Schluss machen. Soll ich jetzt Blumen für deinen Vater zurechtmachen?«
»Nein«, antworte ich. »Auf gar keinen Fall.«
8. Kapitel
Florence
Der dritte Anruf ist der, vor dem ich mich fürchte. Während ich darauf warte, durchgestellt zu werden, stehe ich auf und trete ans Fenster meines Büros. Es ist im fünften Stock, und man hat freien Blick den Fluss hinunter zur Waterloo Bridge. Das gigantische Riesenrad, das zum »London Eye« werden wird, liegt flach auf dem Wasser und wartet darauf, anlässlich der Feiern zum Jahresende aufgerichtet zu werden.
»Collins«, meldet sich die Frauenstimme. Meine linke Hand beginnt zu schmerzen, als hätte die Stadt noch immer die Macht, mir wehzutun, sogar durch eine Telefonleitung hindurch.
»Hier ist Florence Lovelady«, sage ich. »Wie geht es Ihnen, Perdita?«
»Ma’am, guten Tag. So eine Überraschung. Gut, danke. Und Ihnen?«
Detective Sergeant Perdita Collins und ich sind uns begegnet, als sie noch ein Kind war, und sind uns dann vor ein paar Jahren auf einer Konferenz wieder über den Weg gelaufen, auf der es darum ging, mehr junge Frauen für aussichtsreiche Polizeikarrieren zu begeistern. Der Zufall hatte uns in dieselbe Diskussionsgruppe geführt, und ich hatte Gefallen an ihr gefunden. Damals hat sie in Manchester gearbeitet. Seither sind wir in Kontakt geblieben, hauptsächlich per E-Mail und gelegentlich per Telefon.
»Glückwunsch zum Sergeant«, bemerke ich.
»Danke. Macht richtig Spaß. Ich leite die Abteilung Häusliche Gewalt.«
Perdita plaudert drauflos, und ich höre ihr eine Weile zu. Schließlich frage ich: »Perdita, sind Sie gerade allein?«
Ihre Stimme wird leiser. »Moment.«
Als ich Vogelgezwitscher und Verkehrslärm höre, weiß ich, dass sie ins Freie getreten ist, und ich erinnere mich an den Parkplatz hinter dem Gebäude. Wenn sie auf die Mauer steigt, die den Parkplatz umgibt, sieht sie auch einen Fluss, aber einen, der schmal ist und zumeist unterirdisch durch die Stadt fließt. Ganz anders als die Themse.
»Ich bin ganz Ohr«, sagt sie.
Ich werfe erneut einen Blick auf den Ausschnitt aus der Lancashire Morning Post.
»Können Sie mir mehr erzählen als das, was ich in der Zeitung gelesen habe?«, frage ich, nachdem ich ihr den Grund meines Anrufs genannt habe, ohne Larry zu erwähnen.
»Mit dieser Geschichte habe ich nichts zu tun«, sagt Perdita. »Darum kümmert sich einer von den DIs. Was brauchen Sie denn?«
»Na ja, idealerweise würde ich gern Kopien der Obduktionsberichte und Fotos von den Leichen sehen«, antworte ich. »Und ich würde mir wünschen, dass das diskret gehandhabt wird.«
Sie schweigt.
»Keine Sorge, darum werde ich Sie nicht bitten. Aber wenn es irgendetwas gibt, was Sie mir sagen können, wäre ich dankbar.«
»Gibt’s ein Problem?«
»Nein, nein. Aber die Geschichte hat nur etwas wachgerufen, das vor langer Zeit passiert ist. Kennen Sie dieses nervige, bohrende Gefühl, wenn man versucht, sich an etwas zu erinnern, und einfach nicht draufkommt?«
»Was brauchen Sie?«
Ich sage es ihr und versuche, kein schlechtes Gewissen zu haben, weil ich sie in eine schwierige Lage bringe.
9. Kapitel
Cassie
Mittwoch, 28. Juli 1999
Das muss ein Irrtum sein. Der Hutzelgreis in dem Metallbett mit den Bettgittern an den Seiten muss mein Großvater sein. Ich drehe mich zu dem Wärter um, der mich in den Krankenhaustrakt des Gefängnisses gebracht hat, aber der ist weg. In diesem Moment spricht das Wesen in dem Bett.
»Sal? Sal, bist du’s?«
Sein Kopf liegt nicht mehr auf dem Kissen, er streckt eine zitternde gelbe Hand aus, und Freude leuchtet in seinen Augen.
»Ich bin’s, Dad«, sage ich. »Cassie.«
Ich möchte, dass er enttäuscht ist, doch als ein Lächeln um seine Mundwinkel spielt, merke ich, wie mein Herz weich wird. Ich muss aufpassen.
»Cass«, sagt er. »Schön, dich zu sehen.«
Ich trete näher und setze mich auf den Besucherstuhl. Am Gestänge des Bettes sind Handschellen angebracht, doch sie hängen leer herab. Dieser Mann wird nie wieder aus dem Bett aufstehen. Er ist für niemanden mehr eine Gefahr. Nicht einmal für mich.
»Ich hab den Artikel in der Zeitung gesehen«, krächzt er. »Der stellvertretende Gefängnisdirektor hat ihn mir gegeben. Über diese Filmmusik, die du geschrieben hast.«
»Nicht alle Zeitungen waren so freundlich«, entgegne ich, obwohl ich gerührt bin, dass er die Besprechung gelesen hat, mehr, als ich es mir eingestehen möchte.
»Du hast dich so gut gemacht. Du und Luna. Ich bin ja so stolz auf euch, Schatz.«
Sein Atem wird schneller, er verzieht das Gesicht vor Schmerz. Kabel und Schläuche, keine Ketten, halten ihn jetzt am Bett fest.
»Hast du Luna gesehen?« Ich weiß nicht, warum ich das frage. Ich will nicht über meine Schwester reden.
»Nein«, sagt er.
Ich warte darauf, dass er weiterspricht, doch anscheinend hat er zum Thema Luna nichts mehr zu sagen. Soll mir recht sein.
»Wie geht’s deiner Mum?«, erkundigt er sich.
Die Eine-Million-Dollar-Frage. Ich habe keine verdammte Ahnung, lautet die einzige ehrliche Antwort. »Ein bisschen besser«, sage ich ausweichend. »Besser als vorher.«
Er nickt erfreut, und ich bin sauer, dass ich ihm gute Neuigkeiten beschert habe. Du hast Mum umgebracht, möchte ich sagen. Sie ist nie darüber hinweggekommen, was du getan hast. Die ganze Scheiße, die uns passiert ist, alles, was ich getan habe, alles, was wir verloren haben, das war alles deinetwegen. Ich öffne den Mund, um loszulegen, doch in diesem Moment beginnt sein Körper zu krampfen. Der Kopf ruckt nach hinten. Larry japst nach Luft. Der Herzmonitor neben dem Bett piept schneller.
»Dad? Dad, was ist denn?«
Er kann mir nicht antworten. Ich springe auf, stürze zur Tür. Ganz in der Nähe ist das Stationszimmer.
»Mein Vater hat Schmerzen«, rufe ich der Frau hinter dem Schreibtisch zu. »Er braucht Hilfe.«
»Er will keine Schmerzmittel«, erklärt sie mir, als wir zum Zimmer zurückeilen. »Wir können dafür sorgen, dass er nicht dehydriert, aber das ist auch alles.«
»Warum? Warum will er denn Schmerzen haben?«
Ich überlege, ob das irgendeine abgefahrene Buße ist.
»Die Medikamente, die wir in diesem Stadium verabreichen, sind sehr stark«, antwortet die Schwester. »Er wollte einen klaren Kopf behalten.«
Bei der Zimmertür bleiben wir stehen, und sie senkt die Stimme. »Ich glaube, er hat Ihnen etwas zu sagen.«
Nachdem die Schwester uns allein gelassen hat – mein Vater hat Schmerzmittel erneut abgelehnt –, scheint er einzudösen. Ich warte. Dann öffnen sich seine Augen von Neuem.
»Ich brauch kein Testament zu machen«, sagt er. »Ich habe deiner Mum schon lange alles überschrieben. Und was alles Übrige betrifft – ich hab einen Brief geschrieben. Er ist in dem Schrank da.«
Ich folge seinem Blick mit den Augen zu dem Nachtschränkchen neben dem Bett. Der Brief, den ich in der Schublade finde, ist an mich adressiert, mit einer krakeligen Handschrift, die ich nicht wiedererkannt hätte.
»Mach ihn auf«, sagt er.
Der Brief besteht nur aus wenigen Sätzen. Er enthält Anweisungen für seine Beerdigung. Er will im Gefängnis eingeäschert werden, ohne Andacht oder Gottesdienst. Seine Asche soll anonym entsorgt werden. Es soll keinen Grabstein und keine Trauerfeier geben.
Er sieht zu, wie ich den Brief zerknülle.
»Du wirst im Familiengrab in St. Peter beigesetzt«, erkläre ich ihm. »Ich habe mit Dwane gesprochen, vom Beerdigungsunternehmen von damals. Er hat mir ein paar Termine angeboten, hat sich allerdings ein bisschen geziert, weil du noch am Leben bist. Sentimentaler alter Trottel, was?«
Larry schüttelt den Kopf. »Nicht dort. Nicht in Sabden.«
»Das ist unser Zuhause.« Jetzt habe ich die Oberhand.
»Ich will nicht, dass ihr dahin zurückgeht. Du, deine Mum und Luna. Bleibt weg von da.«
»Es gibt etwas in Sabden, das mir gehört«, sage ich. »Ich werde es mir zurückholen.«
Er ist erregt, versucht tatsächlich, sich aufzusetzen. »Nein«, stößt er hervor. »Du musst von da wegbleiben. Du musst dich von dem Jungen fernhalten.«
»Er ist kein Junge mehr«, erwidere ich. »Es sind dreißig Jahre vergangen. Dreißig Jahre, die du mir gestohlen hast, Dad. Tja, jetzt ist es vorbei. Ich gehe zurück.«
Seine Hand umklammert meine, bevor ich sie zurückziehen kann.
»Du kannst mich nicht daran hindern«, verkünde ich. »Jetzt nicht mehr.«
Ein verschlagenes Lächeln huscht über seine Züge. »Doch, kann ich«, sagt er. »Ich habe Florence geschrieben.«
Was?
»Was?«, entfährt es mir. »Was hast du Florence geschrieben?«
Sämtliche Luft scheint aus seinem Körper zu entweichen, als er einen tiefen Seufzer ausstößt. »Ich habe dreißig Jahre gesessen«, sagt er. »Ich habe für meine Verbrechen bezahlt, Cass. Wann bezahlst du für deine?«
Und dann stirbt er.
10. Kapitel
Florence
Ich sitze im Auto, auf dem Weg nach Hause, als ich es erfahre. Ich höre gerade LBC, und sie bringen es in den Kurznachrichten. Der Serienmörder Larry Glassbrook ist im Gefängnis Wormwood Scrubs verstorben.
»Glassbrook wurde 1969 der Entführung und des Mordes an drei Jugendlichen für schuldig befunden«, liest der Sprecher vor. »Während seiner dreißigjährigen Haftstrafe hielt er eine enge Freundschaft mit der Polizeibeamtin aufrecht, die ihn festgenommen hatte, Assistant Commissioner Florence Lovelady von der Metropolitan Police. Sie war heute Abend für einen Kommentar nicht verfügbar.«
Eine Hupe ertönt hinter mir. Die Ampel ist umgesprungen. Noch eine Hupe. Eine wahres Hupkonzert setzt ein. Londoner Autofahrer im Feierabendverkehr kennen kein Pardon, und trotzdem kann ich mich nicht rühren.
Es ist also vorbei.
Fühlt sich gar nicht so an.
11. Kapitel
Cassie
Er hat Florence geschrieben.
Ich sitze im Stationszimmer. Die Tasse Tee vor mir wird langsam kalt. Eigentlich will ich unbedingt weg von hier, doch ich muss noch verschiedene Formulare unterschreiben und zahllose Beileidsbekundungen des Personals entgegennehmen. Ich starre vor mich hin, und sie halten meine Sprachlosigkeit, dämlich, wie sie sind, für eine Folge des Schocks. Vielleicht ist das gar nicht so verkehrt. Ich stehe wirklich unter Schock.
Der alte Drecksack hat Florence geschrieben. Er hat es ihr erzählt.
Das war keine leere Drohung. Das war mir in dem Moment klar, als er es gesagt hat. Sie hat ihn schließlich all die Jahre lang immer wieder besucht.
In den Augenblicken, nachdem er seinen letzten Atemzug getan hatte, als die tanzenden Linien auf dem Apparat neben seinem Bett zur Ruhe kamen und der schrille Alarm einsetzte, habe ich sein Zimmer durchsucht. Ich habe mich beeilt, weil ich wusste, dass der Alarm binnen Sekunden Pfleger herbeirufen würde.
Ich habe Schränke durchwühlt, Taschen geöffnet, nach einem nicht abgeschickten Brief Ausschau gehalten, nach irgendetwas, das mir sagen könnte, ob er die Wahrheit gesagt oder einen letzten verzweifelten Versuch unternommen hat, zu verhindern, dass ich aus der Reihe tanze.
In der Schublade des Nachtschränkchens habe ich einen Schreibblock gefunden. Auf der ersten Seite waren schwache Abdrücke seiner Handschrift zu erkennen. Ich konnte Liebe Florence erkennen, aber sonst nichts. Außerdem habe ich ein kleines Heftchen mit Briefmarken gefunden, und ein verblichenes, zerfleddertes Adressbuch aus der Zeit, bevor er eingebuchtet worden war. Unter »L« für »Lovelady« fand ich ihre Adresse in London. Er hat nicht geblufft. Er hat ihr wirklich geschrieben. Er hat es Florence gesagt.
Scheiße, Scheiße, Scheiße!
Was zum Teufel soll ich jetzt machen?
12. Kapitel
Florence
Nick hat für uns einen Tisch im Umberto reserviert, einem kleinen italienischen Restaurant in der Nähe unseres Hauses in Clerkenwell. Der Mittwochabend ist der Abend der Woche, auf den ich mich am meisten freue. Nick holt Ben um acht vom Schwimmen ab. Bis dahin bin ich normalerweise mit der Arbeit fertig. Wir essen spät, gehen spät ins Bett und sind am nächsten Tag immer ein bisschen müde. Ich möchte es nicht anders haben.
Während wir auf das Essen warten, berichtet Ben: »Wir haben heute Schnorcheln und Freitauchen geübt.«
»Ich dachte, ihr trainiert Zeitschwimmen«, sagt Nick.
»Mit sechzehn dürfen wir Flaschentauchen lernen.« Bens Hand kriecht über den Tisch auf das Weinglas seines Vaters zu. »Kann ich da mitmachen? Es kostet zweihundert Pfund.«
»Wie kann man denn in anderthalb Meter tiefem Wasser Freitauchen üben?«, frage ich.
»Wir haben im Springerbecken geübt. Ich konnte am besten unter Wasser die Luft anhalten.«
»Da sind deine Mutter und ich aber sehr stolz.« Sein Vater erobert nach einem kleinen Gerangel sein Weinglas zurück. »Aber beim Flaschentauchen hat man die Sauerstoffflasche. Da braucht man die Luft nicht anzuhalten.«
»Die Luft in der Lunge funktioniert wie eine Schwimmweste«, belehrt Ben uns. »Man braucht nur tief einzuatmen, dann steigt man im Wasser auf.«
»Mehr Luft im Körper reduziert die Körperdichte«, ergänzt sein Dad.
»Genau, und weißt du, wie man am allermeisten Luft in den Körper kriegt?«
»Erleuchte mich.«
»Man atmet ein paar Sekunden ganz schnell, um die Lunge zu weiten. Dann atmet man einmal ganz tief ein und hält die Luft an.«
Ben demonstriert es. Er fängt an zu hecheln, dann bläht er die Backen auf wie ein Hamster. Ich schaue ihm eine Zeitlang zu, dann wende ich mich an Nick.
»Ich habe vorhin deinen Anruf verpasst«, sage ich.
»Hatte einfach nur ein bisschen Zeit«, antwortet er. Das ist unser Code für »Nicht vor Ben«.
Die Luft platzt geräuschvoll aus unserem Sohn heraus. »Über eine Minute«, verkündet er mit einem Blick auf die Uhr. »Ich muss mal aufs Klo.« Er steht auf und zieht ab. Sobald er außer Hörweite ist, holt Nick einen Briefumschlag aus seinem Jackett.
»Der ist heute gekommen«, sagt er. »Wurde gestern abgeschickt.«
Der Brief ist aus Wormwood Scrubs. Von Larry.
»Wenn du ihn aufmachen willst, tu’s, bevor Ben zurückkommt«, sagt Nick.
Ich öffne den Umschlag. Lese die beiden kurzen Sätze, schaue in den Umschlag, um mich zu vergewissern, dass da sonst nichts drin ist, dann reiche ich ihn Nick.
»Was soll das heißen?«, fragt er.
»Ich bin mir nicht sicher.« Wieder blicke ich auf den Brief hinunter.
Ich habe dreißig Jahre lang dafür gesorgt, dass ihnen nichts passiert. Jetzt sind Sie dran …
»Er wollte, dass ich mich mit ein paar Leichen befasse, die bei einem alten Kinderheim ausgegraben worden sind«, sage ich. »Ich habe das abgelehnt. Ich habe nicht vor, mich in die Arbeit einer anderen Dienststelle einzumischen.«
Nick sagt nichts.
»Vielleicht meint er ja seine Familie«, fahre ich fort. »Sally und die Mädchen.«
»Mit denen hattest du doch seit Jahren keinen Kontakt mehr«, erwidert Nick. »Florence, bitte sag mir, dass du keinen Kontakt mit ihnen hattest.«
»Hatte ich nicht«, antworte ich wahrheitsgemäß. Ich weiß nur das, was Larry mir über seine Familie erzählt hat. Sally ist in Sabden geblieben, die Mädchen haben studiert und haben die Stadt verlassen. Cassandra, die wir Cassie genannt haben, ist eine erfolgreiche Songwriterin geworden und lebt in der Nähe von Manchester. Luna, deren Taufname Elanor lautet, ist Anwältin für Gesellschaftsrecht und wohnt irgendwo in London.
»Fährst du zur Beerdigung?«, will Nick von mir wissen, und weil ich nicht darauf antworten möchte, spiele ich die Frage zu ihm zurück.
»Meinst du, ich sollte hinfahren?«
»Nein«, antwortet er.
Nick und ich streiten uns nur selten. Eigentlich streitet nie jemand mit Nick. Doch meine Beziehung zu Larry hat immer wieder zu unschönen Ausnahmen geführt.
»Warum bist du so aggressiv?«, frage ich.
»Larry Glassbrook war sehr lange der andere Mann in deinem Leben. Ich bin froh, dass er tot ist. Aber das hier« – Nick nagelt den Brief mit dem Zeigefinger auf dem Tisch fest – »das sieht für mich aus, als ob er noch aus dem Grab heraus versucht, dich zu manipulieren.«
»Das ist doch lächerlich«, sage ich, doch ich denke: Nein, nicht Larry. Wenn es in unserer Ehe jemals eine dritte Person gegeben hat, dann war das nicht Larry. Vor meinem geistigen Auge sehe ich jemand anderen, einen hochgewachsenen, dunkelhaarigen jungen Mann in Kleidern, die in den späten Sechzigern Mode waren. Ein Mann, über den ich nie mit Nick gesprochen habe. Ein Mann, der inzwischen vielleicht ein bisschen so aussieht, wie mein Ehemann es heute tut, ich bin nämlich meinem Typ immer treu geblieben, und in Sabden habe ich entdeckt, was mein Typ ist.
»Du bist doch am Wochenende in Paris«, gebe ich zu bedenken. »Ich habe Urlaub, und Ben hat keine Schule.«
»Ich will nicht, dass Ben auch nur in die Nähe dieser Stadt kommt.«
»Was ist denn los?«, erkundigt sich Ben. Keiner von uns hat bemerkt, dass er an den Tisch getreten ist. Beiläufig stecke ich den Briefumschlag von Larry in meine Handtasche. »Welche Stadt?«
»Sabden«, antworte ich, denn wir wissen beide, dass Ben keine Ruhe geben wird.
»Da, wo die Hexen wohnen?« Seine Augen leuchten auf. Nicks Miene verfinstert sich.
»Nein«, sage ich. »Wo die Hexen vor langer Zeit gewohnt haben. Vor sehr langer Zeit.«
Nicks Blick begegnet meinem. Er sagt nichts. Seine Augen sagen alles.
13. Kapitel
Cassie
Donnerstag, 29. Juli 1999
Sabden. Ich sehe die Schilder, als ich vom Hochmoor herunterfahre. Unwillkürlich stelle ich mir die rostigen Ketten vor, die über die Straße gespannt sind, die verwitterten »Zutritt verboten«-Schilder, geschrieben mit der Handschrift meines Vaters, und ich fahre schneller. Die Stadtgrenze, die ich seit drei Jahrzehnten nicht mehr überquert habe, huscht vorbei. Die Ketten zerspringen, ihre Splitter fliegen rund um mein Auto herum durch die Luft, und ich bin zu Hause.
Der Bann ist gebrochen. Die Prinzessin ist frei.
Meine Heimatstadt hat sich verändert. Sehr. Die Fabrikschornsteine, die früher alles beherrscht haben, die uns heimgeleitet haben, wenn wir noch kilometerweit entfernt auf dem Moor waren, sind zum größten Teil umgelegt worden. Das kleine Krankenhaus, in dem ich zur Welt gekommen bin, ist jetzt ein chinesisches Restaurant. Als ich weiter in die Stadt hineinfahre, sehe ich, dass die Straßenbahnschienen herausgerissen und die Kopfsteinpflasterstraßen asphaltiert worden sind. Aus dem Plattenladen, wo wir samstagnachmittags immer herumgehangen haben, ist eine Oxfam-Filiale geworden.
Es regnet heftig, und der Wind wird stärker. Wenigstens das Wetter ist noch immer dasselbe.
Ich spüre, wie mir Tränen in die Augen steigen. Ich habe so viel verpasst.
Als ich mich dem Stadtzentrum nähere, scheint die schwer fassbare Vertrautheit, der ich nachjage, langsam in Reichweite zu kommen. Hier sind die viktorianischen Prachtbauten: die Bibliothek, das Rathaus, das Theater, die Freimaurerloge. Der Marktplatz ist allerdings verschwunden, und an seiner Stelle erhebt sich eine Siebzigerjahre-Monstrosität aus Beton und bunten Plastikplatten. Ich fahre bei Gelb über die Ampel, biege um die Ecke auf den Markplatz ein, biege noch einmal links ab und bin da.
St. Peter, die alte Kirche unserer Familie, ist die größte in der Stadt. Sie ist aus Feldsteinen erbaut, mit einem gewaltigen Glockenturm, und überragt weithin sichtbar das Stadtzentrum. Mum, Luna und ich waren natürlich Heiden, und Larry hatte mit Religion auch nichts am Hut, doch sein Beruf als Bestatter bedeutete, dass wir den Schein wahren mussten. Damals, als wir noch eine Familie waren, sind wir an den meisten Wochenenden hierhergekommen.
Als ich aussteige, schlägt mir der Wind entgegen. Es ist immer so verdammt windig in Sabden. Und wenn er einmal abflaut, werden wir nervös. Für uns bedeutet ruhiges Wetter, dass noch etwas Schlimmeres als der Wind im Anzug ist.
Das große Eingangsportal ist offen. St. Peter ist erstaunlich groß, aber wir werden wohl auch eine große Kirche brauchen. Larry hatte eine Menge Feinde, die werden sich bestimmt vergewissern wollen, dass er wirklich tot ist. Ich werde mich auf die Empore verziehen. Da kann ich alle sehen, ohne gesehen zu werden.
»Cassie?«, sagt eine Stimme hinter mir. »Miss Glassbrook?«
Ein Mann Mitte fünfzig in der Uniform eines ranghohen Polizisten und mit einem schwarzen Regenschirm in der Hand kommt auf mich zu. Er ist groß und dunkelhaarig, sieht auf klassische Art und Weise gut aus. Mein Herz gehört nicht mehr mir, seit ich sechzehn bin, aber gegen eine unverbindliche Nummer zwischendurch habe ich nie etwas einzuwenden gehabt. Den Typen würde ich jedenfalls nicht von der Bettkante stoßen. Er streckt mir eine große, warme Hand entgegen, und mir fällt das Fehlen eines Eherings an der anderen auf.
»Tom Devine«, stellt er sich vor.
Ich hätte es wissen müssen. Tom Devine war ein junger Detective Constable, als Larry verurteilt wurde. Sämtliche Mädchen in der Schule haben für ihn geschwärmt. Luna und ich hätten das wohl auch getan, bis er an jenem Abend in unser Haus kam. Ich habe oben am Treppengeländer im Nachthemd gestanden und schlotternd zugesehen, wie er meinem Vater Handschellen anlegte und ihn zur Tür hinausschubste. Er war nicht der Ranghöchste unter den anwesenden Polizisten, aber für mich ist Tom Devine immer derjenige, der meinen Vater mitgenommen hat. Nein, beschließe ich, mit diesem Mann werde ich garantiert keine Nummer schieben.
»Sie sehen Ihrer Mutter sehr ähnlich«, sagt er. »Wie geht es ihr?«
»Fortgeschrittene Demenz«, antworte ich, weil die Wahrheit zu kompliziert ist. »Sie ist nicht mehr die, die sie einmal war. Und Ihrer Frau?«