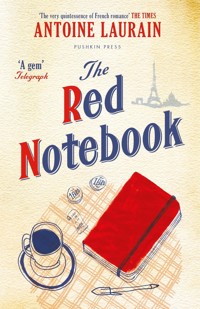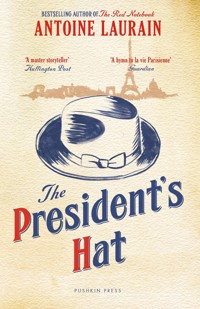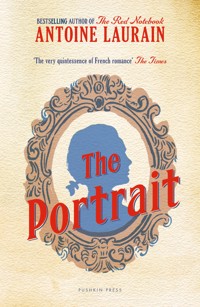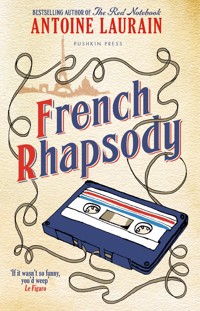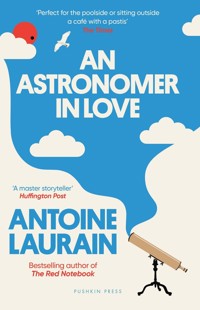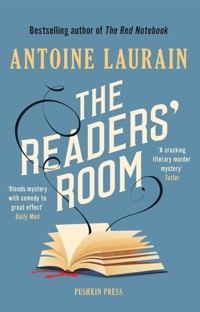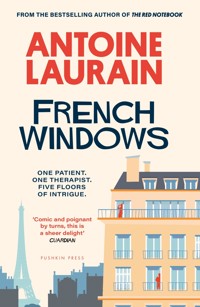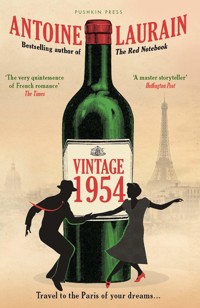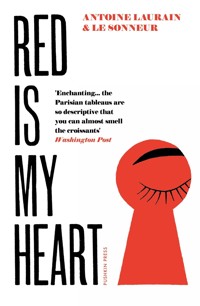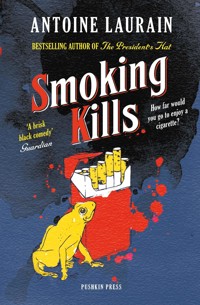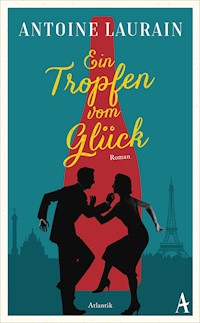10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantik
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Seit seine Familie zerbrochen ist, kommt dem Pariser Makler Xavier das Leben ganz entzaubert vor. Da fällt ihm ein altes Teleskop in die Hände und lässt ihn den Blick endlich wieder auf Neues richten: Auf die Sterne, die Dächer von Paris und sein quirliges Stadtviertel, in dem ihm eine Nachbarin ganz besonders ins Auge sticht, und das nicht nur, weil in ihrer Wohnung ein echtes Zebra steht. Wenige Jahrhunderte zuvor bringt eben jenes Teleskop dem Astronomen Guillaume Le Gentil auf einer Indienreise ein ganz anderes Glück als das erhoffte... Charmant verquickt Antoine Laurain die Geschichten zweier unverbesserlicher Romantiker zu einem funkelnden Roman über das Suchen (und Finden) der Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Antoine Laurain
Das Glück im Sternbild Zebra
Roman
Roman
Aus dem Französischen von Katrin Segerer und Maja Ueberle-Pfaff
Atlantik
Dieses Buch ist Guillaume Le Gentil (1725–1792) gewidmet: glückloser Astronom, ehrenwerter Mensch und wahrer Held.
Die Sonne ist der Schatten Gottes.
Michelangelo
Am 26. März ging Guillaume Joseph Hyacinthe Jean-Baptiste Le Gentil de la Galaisière, Astronom an der königlichen Akademie der Wissenschaften von Paris, in Lorient an Bord der mit fünfzig Kanonen bestückten Fregatte Le Berryer, die mit Ziel Indien in See stach. Als das Kriegsschiff den geschützten Hafen der französischen Küstenstadt verlassen hatte, konnte er sich gerade noch rechtzeitig an einen Mast klammern, denn beinahe wäre er mit seinen Lackschuhen, auf denen silberne Schnallen schimmerten, auf den Deckplanken ausgerutscht. Der Wind der Bretagne fuhr unter seinen blauen Gehrock und blähte das Spitzenjabot, und er drückte sich mit der freien Rechten den Dreispitz aus schwarzem Filz fester auf den Kopf. Vor ihm lag eine lange, gefahrvolle Reise. Wer zu jener Zeit den Fuß auf ein Schiff setzte, um die Meere zu überqueren, wusste nie so genau, ob er lebendig zurückkommen würde. Guillaume Le Gentil hatte von Seiner Majestät, König Ludwig XV. von Frankreich, einen präzisen Auftrag erhalten, und er war auch zweifellos hervorragend geeignet, ihn auszuführen. Mit Hilfe seiner Teleskope und anderer astronomischer Instrumente sollte er den Durchgang der Venus vor der Sonne beobachten, auch Venustransit genannt, damit man sich nicht mehr auf Vermutungen stützen musste, sondern die tatsächliche Entfernung zwischen Erde und Sonne errechnen konnte.
Der kleine Planet, der den Namen der Liebesgöttin trug, erschien in Zeitabständen vor der Sonnenscheibe, die man nur als originell bezeichnen konnte: Nach dem ersten Durchgang dauerte es acht Jahre bis zum nächsten und dann wieder einhundertzweiundzwanzig Jahre. Danach ging es mit acht Jahren weiter, darauf folgten einhundertfünf bis zum nächsten Transit. Diese Zyklen von acht, einhundertzweiundzwanzig und einhundertfünf Jahren waren seit der Entstehung des Universums konstant geblieben.
Guillaume Le Gentil hatte alle erdenklichen Vorkehrungen getroffen, um das erstaunliche Phänomen nicht zu verpassen, das er am 6. Juni 1761, ein Jahr nach seiner Abreise, von Pondichéry aus beobachten wollte. Würde es ihm gelingen, wäre er als einer der ersten Menschen in der Lage, die Entfernung zwischen dem Zentralgestirn und der Erde viel genauer als bisher zu bestimmen.
Alles war bis ins kleinste Detail vorbereitet, und doch sollte nichts so verlaufen wie geplant.
Sie atmen.
Sie sind am Leben.
Alles ist gut.
Sie sitzen. Spüren Sie das Gewicht Ihres Körpers, das Gewicht Ihrer Füße, Ihrer Hände, nehmen Sie die Geräusche wahr, die Sie umgeben.
Die vertraute Frauenstimme aus den Kopfhörern seines Smartphones wirkte beruhigend. Es war bei jeder Sitzung dieselbe. Xavier Lemercier hatte inzwischen fünfzehn davon absolviert, eine pro Tag. Sogenannte »Achtsamkeitsmeditationen«. Diese wissenschaftliche Praktik hatte er zufällig entdeckt, als er das Rauchen aufgeben wollte. Er hatte sich zuvor noch nie mit dem Thema beschäftigt und stand dieser Art von Übungen aus Prinzip eher ablehnend gegenüber, weil er vermutete, sie wären voller esoterischer Phrasen, eingefärbt von New Age und billigem Schamanismus. »Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Fuchs, schnuppern Sie an der Blume, die in Ihnen blüht«, »Richten Sie Ihr Herz auf den ewigen Planeten Gaia, die nährende Mutter allen Lebens«. Doch das Programm, das er heruntergeladen hatte, war anders, es zielte allein darauf ab, in jeden Tag eine dreißigminütige Pause einzubauen und so bestmöglich den rastlosen Rhythmus der Gedanken zu verlangsamen, die einen ständig wie Fliegen umschwirrten. Die inzwischen gewohnte Verabredung mit »der Stimme« und ihren beruhigenden Sätzen war fast so angenehm wie ein kühles Getränk auf einer sonnigen Terrasse nach Feierabend. Für dreißig Minuten pro Tag gelang es Xavier beinahe, seine Sorgen zu vergessen, was für ihn eine echte Leistung war.
Lassen Sie nun, wenn Sie mögen, Ihre Gedanken in den Hintergrund treten und beginnen Sie mit dem Bodyscan.
Beim Bodyscan durchwanderte man im Geist den Körper von den Zehenspitzen bis zum Kopf hinauf und identifizierte Stellen des Unwohlseins. Xavier bemerkte regelmäßig Schmerzen im unteren Rücken und einen verkrampften Magen.
Seit gut zwei Monaten plagten ihn Sorgen. Die Geschäfte seiner Immobilienagentur stagnierten. Es kam nur noch selten zu Abschlüssen, und das ohne triftigen Grund. Natürlich blieb der Markt in Paris auch 2012 lukrativ, die Preise sanken nicht, aber in diesem Jahr waren die Kunden, die Immobilien verkaufen oder erwerben wollten, rar gesät. Die üblichen Indikatoren – privater Konsum, Kaufkraft, Börsenmarkt – konnten diese Zurückhaltung in keinster Weise erklären. Trotzdem zogen alle »Marktteilnehmer«, wie es so schön hieß, dieselbe Bilanz: Aktuell ging nicht viel. Die robusteren blieben gelassen oder taten zumindest so, die fragileren fingen an, sich beunruhigende Fragen zu stellen. Die Immobilienagentur Lemercier & Bricard war seit mittlerweile zwanzig Jahren eine feste Größe. Xavier hatte sich mit einem Kommilitonen von der Handelshochschule in den Immobilienmarkt von Paris und Umgebung gestürzt. Heute war er siebenundvierzig und leitete Lemercier & Bricard allein. Wenn irgendjemand nach »Monsieur Bricard« fragte, antwortete Xavier beharrlich, der Kollege sei gerade auf Geschäftsreise. Zwei Namen klangen in seinen Ohren seriöser, nach einem eingeschworenen Team und vielen gut gerüsteten Mitarbeitenden.
Bruno Bricard, sein Partner »auf Geschäftsreise«, hatte vor zwei Jahren urplötzlich beschlossen, aufs Land zu ziehen. Er hatte seinem Freund anvertraut, er sei das Großstadtleben, den Verkehr und den Smog leid und würde ihm gerne seine Anteile verkaufen. Zusammen mit seiner Frau und den beiden Kindern wollte er noch einmal neu anfangen, vom Erlös ihrer Pariser Wohnung ein gigantisches Domizil aus dem siebzehnten Jahrhundert auf achtzehn Hektar in der Dordogne erwerben und es in ein Bed and Breakfast verwandeln. Während seiner letzten Monate in der Agentur hatte er mehrfach versucht, Xavier davon zu überzeugen, es ihm gleichzutun, mit jeder Menge Diagrammen, Umfragen und Hochrechnungen, die prophezeiten, dass die Städte bald versinken würden in Feinstaub, Verschmutzung und sich wie Ungeziefer vermehrenden Autos. Natürlich hatte Bruno nicht ganz unrecht, aber Xavier konnte sich ein Leben auf dem Land nicht vorstellen. Außerdem hatte sein Freund, im Gegensatz zu ihm, eine intakte Familie. Seit der schwierigen Scheidung von Céline teilte Xavier sich mit ihr das Sorgerecht für ihren elfjährigen Sohn Olivier. Als er dieses Argument Bruno gegenüber angebracht hatte, konnte der nur zerknirscht nicken. »Ja, für dich ist es tatsächlich komplizierter«, hatte er zugegeben.
Es kam Xavier vor, als wäre sein Leben irgendwann aus den Fugen geraten, aber den genauen Moment konnte er nur schwer bestimmen. Oft fühlte er sich wie ein Junggeselle ohne Zukunft, der anderen mit mehr Tatendrang und Mitteln Wohnungen verkaufte, damit sie sich darin ein Leben aufbauen konnten – so viele Pläne, die ihm selbst nicht länger realisierbar erschienen.
Im Grunde ist nichts kompliziert.
Schwierigkeiten existieren häufig nur in Ihrem Kopf. Sie befrachten Situationen mit einer Angst, die Sie überhaupt nicht brauchen und die keinen Mehrwert hat.
Beachten Sie sie gar nicht.
An einer Seereise ist im Grunde nichts kompliziert, außer dass das Schiff von haushohen Wellenbergen in die Höhe und die Tiefe geschleudert wird, empfindsame Gemüter unter Seekrankheit leiden und man auf Dauer leichte Platzangst bekommt. Louis de Vauquois, der Kapitän der Le Berryer, war, weil der Herzog von La Vrillière es so angeordnet hatte, sehr um seinen Astronomen bemüht. Guillaume Le Gentil war zwar bei Sturm ein wenig grün um die Nase und bekam einen starren Blick, doch wenn eine sanfte Brise wehte und die Sonne schien, erwies er sich als charmanter Reisegefährte. Außerdem war seine Anwesenheit durchaus nützlich, denn mit seinen präzisen Messinstrumenten verhalf er dem Kapitän zu Informationen, die dessen Seekarten nicht zu entnehmen waren. Le Gentil berechnete die Route auf Grund der Beobachtung von Mond und Gestirnen und korrigierte nicht selten die von den Offizieren ermittelte Entfernung zum Festland um mehrere Tausend Seemeilen. Sein gewaltiges Teleskop aus Kupfer und Messing, das auf einem Stativ stand und wie Gold glänzte, imponierte Vauquois außerordentlich. Bei Vollmond hatte Guillaume Le Gentil den Kapitän einmal eingeladen, das Auge ans Okular eines kleineren Teleskops zu legen, und dem Kapitän der Le Berryer hatte es schier den Atem verschlagen: Der Erdtrabant war auf einmal so nahe gerückt, dass die Krater nicht weniger deutlich vor ihm lagen als der Leuchtturm von St. Malo bei der Einfahrt in den Hafen. Ein anderes Mal machte der Kapitän den Wissenschaftler auf einen Lichtstreif aufmerksam, der ihnen seit einer guten halben Stunde über den Himmel zu folgen schien. Daraufhin holte der Astronom ein anderes, etwas massiveres Teleskop aus seinem Gepäck, das nur auf einem Bein stand. Der Lichtstreif war ein Komet, und Guillaume Le Gentil konnte, wenn er die Augen zusammenkniff, sogar dessen Schweif erkennen. In der folgenden Woche schrieb er mehrere Notizhefte voll und legte Kompass und Gänsefeder kaum aus der Hand, weil er unbedingt die Geschwindigkeit des Kometen messen wollte. Die Aufgabe machte ihm Freude, und infolge der milden Temperaturen auf dem Weg zum Kap der Guten Hoffnung vergaß er seine Angst vor dem Meer und sogar seine Seekrankheit. Bei den Mahlzeiten, die er in der Kapitänskajüte einnahm, wurden ihm gebratene Fische vorgesetzt, die er aus französischen Gewässern nicht kannte. Eines Morgens hing im Netz der Le Berryer sogar ein Tintenfisch von der Größe eines Pferds, dessen Tentakel vom Bug bis zum Heck reichten. Die Mannschaft hackte ihn mit Äxten in Stücke, und der Koch leerte ein ganzes Fass Wein in seine gusseisernen Töpfe und garte die Teile in einer selbst kreierten Brühe. Am Abend ließen sich die Männer das zarte, jodhaltige Fleisch des riesigen Mollusken munden.
Der unerwartete Fang gab Anlass zu Gesprächen über Meereskreaturen, von denen eine furchterregender aussah als die andere, und keiner der Anwesenden konnte sagen, ob die Bilder, die er von Holzstichen kannte, der Phantasie entsprangen oder auf echten Beobachtungen fußten. Angeblich ließ sich in den Gewässern vor dem Kap der Guten Hoffnung bei heftigen Stürmen gelegentlich der schreckliche Caracac blicken. Der Kapitän hatte ihn selbst noch nie zu Gesicht bekommen, aber er kannte die Beschreibung von Augenzeugen. Eifrig holte er einen dicken Wälzer aus seinem Regal, für dessen Einband sicherlich die Haut zweier fetter Schweine verarbeitet worden war, und schlug ihn auf. Als Guillaume Le Gentil sich darüberbeugte, sah er einen Holzstich mit der Abbildung eines Ungeheuers, das einem dreißig Meter langen Drachenkopf ähnelte. Das weit aufgerissene Maul des Fisches war fünfmal so breit wie das vergoldete Gitter im Palast von Versailles, und aus der Spitze seines Schädels schoss ein Wasserstrahl hoch in die Luft. Guillaume Le Gentil lief ein Schauer über den Rücken. Sollte es ihnen beschieden sein, den Weg des Ungeheuers zu kreuzen, sagte der Kapitän, so zähle er darauf, dass Gott ihnen zu Hilfe komme. Er bekreuzigte sich und schlug mit entschlossener Geste das Buch wieder zu.
Einige Tage später kam Le Gentil an Deck, während das Schiff gerade zur Umrundung der Südspitze Afrikas ansetzte. Er trat an die Reling und sah eine grau glänzende, vom Salz des Ozeans gegerbte Masse aus den Wellen auftauchen. Aus ihr spritzte ein Geysir fünfzehn Meter hoch in die Luft. Dem Astronomen stockte der Atem, der Holzschnitt wurde lebendig … gleich würde der Caracac untertauchen und das Schiff mit sich in die Tiefe reißen!
Er hatte noch nie einen Wal gesehen, und nun umkreisten gleich mehrere dieser Kreaturen das Schiff, überall schossen Wasserfontänen in die Luft, an Steuerbord und an Backbord, während die gutgelaunten Matrosen fröhliche, unerschrockene Gesänge anstimmten. Einigermaßen beruhigt zog Guillaume Le Gentil seine kleine runde Stahlbrille aus der Jackentasche, die er sich von Margissier, der auch die optischen Komponenten seiner Teleskope baute, eigens hatte anfertigen lassen. In dem Gestell steckten zwei geschwärzte Augengläser, mit denen er in die Sonne blicken konnte, ohne seine Netzhaut zu schädigen. Er dachte an Hortense, die Frau, die in Paris zurückgeblieben war und seit fast anderthalb Jahren auf ihn wartete. Er sah sie vor sich, in der Abgeschiedenheit ihrer gemeinsamen Wohnung, wie sie mit ihren zarten Fingern ein kompliziertes Muster auf ein Zierdeckchen stickte, während er zur selben Zeit, von Walen begleitet, durch die Meereswogen glitt. Bei dem Gedanken, was er ihr bei seiner Rückkehr alles würde erzählen können, lächelte der Astronom versonnen. Da fegte ihm eine Windböe unvermutet den schwarzen Dreispitz vom Kopf. Der Hut flog auf einen Walrücken, wo er erst liegen blieb und Sekunden später von einem kräftigen Wasserstrahl in die Luft gewirbelt wurde.
Xavier dachte oft an sie. Nichts hatte funktioniert mit Céline. Wer hätte ahnen können, dass der schöne Moment ihrer ersten Begegnung zwölf Jahre später mit einem Scheidungsurteil in einem Gerichtssaal enden würde? Ihre Geschichte war schrecklich banal, und genau darin lag ihre Macht. Der Mangel an Originalität bot keinerlei Angriffspunkt für den Zufall oder eine unerwartete Wendung. Nein, die platten Zahlen türmten sich auf wie eine unüberwindbare Mauer: Jede zweite Ehe wird wieder geschieden. Fifty-fifty. Drei Jahre nach der schmerzlichen Trennung, die in den letzten Monaten eskaliert war, musste Xavier noch immer mindestens ein paarmal pro Woche daran zurückdenken. Wenn die Stimme sagte: »Sobald Ihre Gedanken wandern, lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit sanft, aber bestimmt wieder zu Ihrem Atem«, wusste er genau, wohin diese Wanderschaft führen würde, nämlich in die Flure des Justizpalastes, zu seinem Anwalt Monsieur Murier und Célines Anwältin Madame Guerinon, zu den Falschaussagen von Célines Freunden, denen zufolge Xavier ein Haustyrann war und seine Frau und sein Sohn in ständiger Angst vor ihm lebten. Zu den wahnwitzigen Unterhaltsforderungen und zu Olivier, für den Céline im ersten Jahr das alleinige Sorgerecht erhalten hatte und den sie gegen seinen Vater aufstachelte, indem sie ihm einredete, es sei alles Xaviers Schuld. Bruno war Xavier in dieser schwierigen Zeit eine Stütze gewesen, und ein paar gute Wohnungsverkäufe zu hohen Preisen hatten es ihm ermöglicht, den Sturm zu durchsegeln. Natürlich war er ordentlich gebeutelt worden, aber danach wurde das Fahrwasser ruhiger, und er konnte allmählich wieder eine Beziehung zu seinem Sohn aufbauen. Xavier hatte den Entschluss gefasst, vor Olivier niemals schlecht über Céline zu sprechen. Diese Beschwichtigungsstrategie wirkte sich nun zu seinen Gunsten aus, denn Céline hatte keineswegs nachgelassen und machte den Vater vor dem Jungen weiterhin mies. Doch seit ein paar Monaten schien Olivier sich von den Manövern seiner Mutter nicht mehr so leicht täuschen zu lassen.
Beim leisen Gong, der das Ende der Sitzung markierte, öffnete Xavier die Augen. Sonne flutete das Wohnzimmer der Sechzig-Quadratmeter-Wohnung, in der er nun lebte. Wenigstens zu einem war sein Job als Immobilienmakler gut gewesen: ihre hundertdreißig Quadratmeter im Haussmann-Stil dank seiner Verbindungen zum besten Preis zu veräußern und etwas Ruhiges für sich in einer guten Lage zu finden. Ein Zimmer für ihn, eins für seinen Sohn, eine große Terrasse mit Blick auf eine Grünanlage, die meistens leer war. Es schien, als würde in seinem Leben nicht mehr viel Bedeutsames passieren.
Xavier erhob sich aus seinem Sessel, streckte sich ein wenig. Es war Zeit, zur Arbeit zu gehen.
Frédéric Chamois, sein Praktikant, hatte zwei Anrufe entgegengenommen. Eine Besichtigungsanfrage für eine Achtzig-Quadratmeter-Wohnung mit Blick auf den Innenhof, fünfte Etage mit Aufzug – eine schöne Immobilie, die seit drei Monaten auf dem Markt war. Der andere Anruf kam von den neuen Eigentümern der letzten Wohnung, die Xavier vor der deutlich spürbaren Flaute verkauft hatte. Madame Carmillon machte sie darauf aufmerksam, dass die alten Eigentümer einen Schrank im Flur nicht geleert hätten. Die Agentur solle ihnen doch bitte Bescheid geben, damit sie ihre Sachen abholten und die Carmillons besagten Schrank nutzen könnten. Anscheinend waren sie schon während der Renovierungsarbeiten eingezogen.
»Sie haben die Abnahme gemacht, oder, Chamois?«, fragte Xavier.
»J-J-J… Ja«, antwortete der junge Mann, »a-a-a… an einen vollen Schrank kann ich mich nicht erinnern.«
»Ich mich auch nicht«, meinte Xavier. »Egal.«
Frédéric Chamois stotterte. Wie schwer, hing vom Tag und vor allem vom Wetter ab. Xavier war aufgefallen, dass »Chamois« – er nannte ihn immer beim Nachnamen – weniger stotterte, wenn es regnete. Aber diese Erkenntnis behielt er wohlweislich für sich.
Xavier hinterließ eine Nachricht bei den alten Eigentümern. Keine Antwort bis zum nächsten Tag. Ebenso wenig bis zum übernächsten. Die Sachen aus dem Schrank schienen ihnen nicht sonderlich wichtig zu sein, und es überraschte Xavier auch nicht, dass er kein Lebenszeichen bekam. Wenn die Leute eine Immobilie verkauften, wollten sie nicht mehr dorthin zurück, nichts mehr davon hören. Sobald sie den Scheck eingelöst hatten, schlossen sie das Kapitel ab und vergaßen sogar das Gesicht des Maklers, der den Verkauf durchgeführt hatte.
Xaviers Handy klingelte. Auf dem Display stand »Banque Marchandeau«.
»Guten Tag, Monsieur Lemercier«, begrüßte ihn sein Bankberater, »sind Sie gerade in Paris oder auf Geschäftsreise im Ausland?«
»Ich bin in Paris, in meiner Agentur«, antwortete Xavier.
»Das dachte ich mir schon«, bemerkte der Bankberater. »Eben wurden 650 Euro von Ihrem Konto abgebucht, aus Hongkong. Da hat jemand Ihre Kreditkarte gekapert. Ich kümmere mich um alles und melde mich wieder, Monsieur Lemercier.«
»Piraten! Piraten! An Steuerbord! Sie wollen uns kapern!«
Die Schiffsbesatzung ließ alles stehen und liegen und blickte zum Ausguck hinauf. Ganz oben am Großmast saß in einem breiten Mastkorb ein junger Mann, der mit einem Fernrohr den Horizont vor sich absuchte und ein besonderes Augenmerk auf die Flaggen der Schiffe richtete, die die Route der Le Berryer in näherer oder weiterer Entfernung kreuzten.
Auch Guillaume Le Gentil stürzte aus seiner Kabine, unter dem Arm das lange Teleskop, das er an Steuerbord auf ein Stativ montierte. In den hellen Lichtkreis vor seinen Augen schob sich ein Schiff, das etwas kleiner war als die Le Berryer, aber nicht weniger eindrucksvoll, und als er mit dem beweglichen Rohr dem Mast nach oben folgte, sah er an seiner Spitze die Flagge mit dem Totenkopf über zwei gekreuzten Knochen.
»Sie wenden!«, schrie die Wache. »Sie halten auf uns zu!«
Der Kapitän lief zu dem Astronomen, stellte sich neben ihn und hob ebenfalls sein Fernrohr. Guillaume Le Gentil erwartete eine beruhigende Bemerkung, doch der Kapitän ließ sich Zeit. Dann senkte er das Instrument und rief seinen Männern zu: »Kurs zwei Strich Steuerbord und Großsegel setzen!« Der Befehl wurde von den Matrosen mit lauter Stimme wiederholt, und das Schiff änderte seinen Kurs. Guillaume Le Gentil schloss die Augen. Bilder von grausam grinsenden Ganoven mit Zahnlücken tauchten vor ihm auf, Männern, deren Körper von Tätowierungen und Narben übersät waren. Sie würden ihn misshandeln, ihm seine seidenen Kleider vom Leib reißen, seine astronomischen Instrumente über Bord werfen, sie würden ihm die Augen verbinden, seine Hände fesseln, ihn bespucken und ihn unter Schmähungen und hämischem Gelächter über die Planke gehen lassen. Die Planke würde unter seinen Füßen verschwinden, und er würde in die Fluten stürzen und in ihnen versinken wie in eiskaltem Pech. Er konnte nicht schwimmen und würde vor Erschöpfung einsam ertrinken, wenn die Fische ihn nicht vorher bei lebendigem Leib auffraßen. Und all das wegen eines launenhaften Sterns, der in über einem Jahr wie eine schwarze Murmel vor der Sonnenscheibe vorbeiziehen würde!
»Dieses unverschämte Gesindel soll unsere königlichen Orgeln kennenlernen! Rollt die Kanonen an Steuerbord heraus!«, rief der Kapitän.
»Kanonen an Steuerbord!«, hallte das Echo übers Deck, und bald spürten sie unter ihren Füßen das Rumpeln der Geschütze, die die Matrosen auf dem Batteriedeck auf die Bordwand zuschoben. Die fünfundzwanzig Geschützpforten öffneten sich gleichzeitig wie Fensterläden, und die feucht glänzenden Mündungen der Rohre erschienen.
»Wir lassen sie noch ein Stück näher kommen«, sagte der Kapitän mit einem boshaften Lächeln. Er zog eine Tonpfeife aus der Uniformtasche und begann, sie in aller Ruhe zu stopfen. »Der Tabakgeruch passt sehr gut zu dem Geruch von Schießpulver«, erklärte er gelassen. Er griff nach seinem eleganten Steinschlossfeuerzeug, schlug den Flintstein gegen den Feuerstahl, der Zunder glomm auf, und ein Funkenregen sprühte in den Pfeifenkopf, sodass der Tabak Feuer fing. Nach ein paar Zügen verbreitete sich ein aromatischer Duft nach Gewürzen und Holzrauch, und der Kapitän brummte: »Ich wäre Ihnen sehr verbunden, werter Monsieur Le Gentil, wenn Sie sich die Ohren zuhielten.«
Die Eingangstür eines Wohnhauses, eine dieser schweren Eichentüren, die sich mit dem elektrischen Klacken eines per Zahlencode entriegelten Schlosses öffneten. Dahinter ein Foyer in Form eines Flurs, der zu einem Innenhof führte, und rechts die Loge der Pförtnerin. Der Foyerflur war dunkel und kühl durch die Steine, den Lichtschalter musste man ertasten. Der typische Eingangsbereich der Häuser im Haussmann-Stil, die ihre Originaltür behalten hatten. Vor dieser Tür auf dem Gehweg wartete Xavier auf seine Kunden für eine Besichtigung der Achtzig-Quadratmeter-Wohnung mit Blick auf den Innenhof, fünfte Etage mit Aufzug. Er beobachtete die Pärchen, die die kleine Kreuzung überquerten. Eins davon würde schließlich auf ihn zukommen: die Pichards. Bisher hatte er nur am Telefon mit ihnen gesprochen, in seinem Beruf sah man die Leute oft nicht vor der ersten Besichtigung von Angesicht zu Angesicht. Das passierte immer häufiger, die Zahl der E-Mail-Anfragen stieg, alles wurde entmaterialisiert. Die Sonne stand hoch am blauen Himmel. Xavier kniff die Augen zusammen und holte seine Persol-Sonnenbrille mit pechschwarzem Rahmen und ebensolchen Gläsern heraus. Keines der vorüberlaufenden Paare steuerte auf ihn zu, er fühlte sich, als würde er Wache halten vor diesem Haus, in dem er weder eine Wohnung besaß noch mietete. Er war nur ein Passant, der ein Geschäft abwickeln, seine Provision einstreichen würde. Nie würde er den Alltag an dieser Adresse erleben, die Nachbarn, die Eigentümerversammlung, die Sonne im Hof. Im zweiten Stock befand sich eine Arztpraxis, nie würde er das Gesicht von »Dr. Zarnitsky, Allgemeinmediziner« kennen, wie es auf der draußen angebrachten, golden glänzenden Messingtafel stand. Wie oft hatte er sich wohl schon so vor einem Haus postiert, zu früh dran für einen Termin, in der Tasche die Wohnungsschlüssel, in der Hand das Exposé, allein, aufrecht. Wie ein Soldat. Hunderte Male. Sein Beruf hatte etwas Eigentümliches an sich, etwas sehr Privates: Seine Wohnung oder sein Haus zu verkaufen, war nicht ohne. Es bedeutete, einen Teil seines Lebens zu verkaufen, seiner Erinnerungen – manchmal sogar das ganze Leben. Es bedeutete, eine Tür zu schließen, die man nie wieder öffnen würde. Zahlreiche Kundinnen und Kunden vertrauten ihm im Laufe der Wochen oder Monate, bis ihr Eigentum auf dem Markt war, private Details über ihr Leben, ihre Frau, ihre Eltern oder Großeltern an. Die Generationen folgten aufeinander, die Immobilien gingen in andere Hände über, und meist erfuhr man nie irgendetwas über die vorherigen Bewohner. Erst vor Kurzem hatte Xavier einen verblüffenden Artikel gelesen. Dort hieß es, dass fünfundachtzig Prozent der Menschen nichts über ihre Vorfahren vor hundertfünfzig Jahren wüssten. Zuerst hatte ihn diese Zahl überrascht, bis ihm klar geworden war, dass auch er zu diesem Prozentsatz gehörte: Er wusste heute im Jahr 2012 ebenfalls rein gar nichts über seine Urahnen von 1862. Wer waren sie gewesen? Niemand in seiner Familie hatte sie je erwähnt, wahrscheinlich hatte niemand mehr den geringsten Schimmer von ihnen – was die Statistik noch weiter erhöhte.
Vor ein paar Monaten war er am Rand des Arrondissements gewesen, und erst, als er die Eingangstür aufschob, hatte er die Immobilie wiedererkannt – einer seiner ersten Verkäufe. Ein schöner Verkauf: eine einzigartige Wohnung in einem Haus aus den siebziger Jahren, hundertzwanzig Quadratmeter und achtzig Quadratmeter Garten hinter bodentiefen Fenstern, das Ganze als Etagenwohnung, eine echte Rarität. Es war tatsächlich die Wohnung gewesen, die er verkauft hatte, aber nicht mehr die Eigentümer, die sie vor zwanzig Jahren erworben hatten. Die Wohnung mit Garten war wieder auf dem Markt gelandet und bei ihm. Der Kirschbaum war immer noch da gewesen, und die Eigentümer hatten ihm angeboten, eine Kirsche zu probieren – genau wie die Eigentümer davor. Die Frucht war genauso lecker und süß gewesen wie damals. Der Baum blieb und blühte geruhsam weiter, während die Bewohner kamen und gingen. Erst hatte Xavier verraten wollen, dass er das Objekt bereits kannte, es dann aber für sich behalten.
»Sind Sie Monsieur Lemercier?«
Er drehte sich um.
Unter Donnergetöse wurde die Geschützsalve abgefeuert. Die Kugeln klatschten mehrere Meter vor dem Rumpf des feindlichen Schiffes ins Wasser, wobei hohe Wasserfontänen aufspritzten. Das Piratenschiff drehte hastig bei und suchte schleunigst das Weite. Obwohl Guillaume Le Gentil sich die Ohren zugehalten hatte, hörte er noch tagelang im linken Ohr ein Pfeifen, das nicht von einem vergnügten Matrosen um ihn herum stammte. Er musste an seinen Kollegen Louis de La Marchandière denken, einen berühmten Astronomen, der während seiner letzten Lebensjahre unentwegt über einen Pfeifton geklagt hatte, den er angeblich Tag und Nacht hörte. Der Kollege hatte seine Tage in einer Anstalt für Geisteskranke beschlossen. Andererseits war La Marchandière, als ihn das Unheil ereilte, bereits recht betagt und auch ein wenig senil gewesen, und beides traf auf Le Gentil nicht zu.
Ein anderes Missgeschick verstimmte den Astronomen fast noch mehr: Als das Geschützfeuer das gesamte Schiff ins Wanken brachte, fiel ihm sein Teleskop aus den Händen. Entsetzt überprüfte er, ob Margissiers optische Bauteile noch heil waren. Glücklicherweise schien alles weiterhin gut zu funktionieren, nur am Gehäuse gab es eine leichte Delle.
Kapitän de Vauquois riet ihm, gegen das Pfeifen Salzwasser in die Ohren zu träufeln und sich hinzulegen. Folgsam streckte sich Guillaume auf seinem Lager aus und redete sich zu: Er atmete, er war am Leben, alles war gut. Er spürte das Gewicht seines Körpers, seiner Füße, seiner Hände und nahm die Geräusche wahr, die in seine Kabine drangen – das Knarren des Schiffsrumpfes, die gedämpften Stimmen der Seeleute.
Er schloss die Augen, und seine Gedanken schweiften in seine Pariser Wohnung, deren Räume er mit fast unheimlicher Präzision vor sich sah. Dort erwarteten ihn seine zahlreichen Bücher und astronomischen Schriften, dort empfing er bedeutende Gelehrte. Mit seinen fünfunddreißig Jahren war er, was seine Sachkenntnis betraf, vielen Älteren voraus und hatte sich zugleich den Enthusiasmus der Jugend und seine Träume bewahrt, Träume, die ihn immer weiter getragen hatten, von den ersten nächtlichen Himmelsbeobachtungen als Junge in Coutances, seinem Heimatort in der Normandie, bis zu seiner Mitgliedschaft in der Pariser Akademie der Wissenschaften.
»Meine liebe Freundin«, sagte er gern zu seiner Frau, »ein Mann, der seine Leidenschaft lebt, ist von den Göttern gesegnet.«
»Sie haben recht, lieber Freund«, antwortete dann Hortense.
»Venustransit«, unterbrach ein schrilles Krächzen seine Träumereien. Le Gentil schlug die Augen auf. Auf dem Nachttisch hockte Molière, der Beo des Kapitäns, und beäugte ihn mit seinen runden, schwarz glänzenden Augen. Kapitän de Vauquois hatte ihm zu Ehren des illustren Gastes unbedingt einen Begriff aus der Astronomie beibringen wollen. Der sprechende Vogel hatte das Wort in weniger als zwei Stunden gelernt und gab es nun bei jeder Gelegenheit zum Besten – und das würde sein Leben lang so bleiben. »Venustransit«, krächzte der Beo noch einmal.
»Ja, der Venustransit«, seufzte Guillaume, »der letzte Transit ist hundertzweiundzwanzig Jahre her, der nächste findet im kommenden Jahr statt, und dann dauert es wieder acht Jahre.«
»Acht Jahre«, kreischte der Vogel.
»Acht Jahre«, murmelte Guillaume, »und dann einhundertfünf. Das heißt im Jahr 1874, dann wieder 1882, dann 2004 und 2012 und danach 2117 und 2125 …«, und dann fielen ihm die Augen zu.
Die Pichards wollten »darüber nachdenken«, wie sie es genannt hatten. Das verhieß nichts Gutes. Xavier hatte genug Erfahrung, um die Nuancen in den Abschiedsfloskeln nach einer Besichtigung unterscheiden zu können. Ein »Wir besprechen das« war deutlich besser als ein »Wir denken darüber nach«. Ein »Ich rufe Sie morgen Mittag an« bedeutete, dass der Verkauf so gut wie unter Dach und Fach war. Diese Besichtigung bestätigte nur einmal mehr, wie schwach der Markt aktuell war. Xavier setzte sich auf die Außenterrasse eines Cafés und bestellte ein Perrier. Heute Abend würde Céline ihm Olivier fürs Wochenende vorbeibringen. Die Konversation würde sich auf ein Minimum beschränken, die Stimmung war jedes Mal zum Zerreißen gespannt, und es wurde gefühlt zehn Grad kälter im Zimmer, sobald Céline klingelte. Xavier wollte etwas mit seinem Sohn unternehmen, aber er hatte noch nichts Konkretes im Kopf – außer vielleicht einen Ausflug zu den Pfauen im Parc de Bagatelle, aber hatte Olivier Lust, sich die Pfauen anzuschauen? Xavier versuchte immer, sich bestmöglich vorzubereiten und kreative Vorschläge zu machen, damit Olivier eine gute Zeit hatte. Ihm graute bei der Vorstellung, sein Sohn könnte nur am Tablet kleben und Videospiele spielen. Auch wenn er deren Anfänge mit Pac-Man und Space Invaders selbst miterlebt hatte, nahmen sie durch den technologischen Fortschritt seiner Meinung nach inzwischen unverhältnismäßig viel Raum in Kopf und Kalender von Kindern und Jugendlichen ein. »Man kann sein Leben doch nicht vor dem Bildschirm verbringen! Das ist kein Leben, ich weiß, wovon ich rede, schließlich sitze ich den ganzen Tag am Computer«, hatte er sich irgendwann einmal Céline gegenüber ereifert, die Olivier immer die neuesten Apps und Geräte kaufte – womöglich ja nur, um seinen Vater zu ärgern.
»Ich sitze den ganzen Tag am Computer. Du gehst ständig raus zu deinen Besichtigungen und spazierst stundenlang durch die Gegend«, hatte Céline erwidert; so was könne sie bei sich im Büro ja nicht, mehr als eine kurze Zigarettenpause unten vor dem Gebäude sei nicht drin.
»Ich lasse nicht zu, dass mein Sohn vor seinen Videospielen verblödet, Museen, Parks, Spaziergänge, das ist das wahre Leben!«
Wie so oft war die Auseinandersetzung eskaliert, und Céline hatte einfach aufgelegt. Nur um am nächsten Tag mit verkniffener Miene und Olivier an der Hand vor seiner Tür zu stehen. Vater und Sohn waren auf dem See im Bois de Boulogne Bötchen gefahren. Während Xavier ruderte, musste er Fragen beantworten wie: »Warum seid ihr nicht mehr zusammen, ihr habt euch doch mal geliebt, oder nicht?« »Würdet ihr euch überhaupt noch sehen, wenn’s mich nicht gäbe?« Er hatte Unmengen an Diplomatie aufbringen und jedes Wort auf die Goldwaage legen müssen, ehe es seine Lippen verließ.
An manchen Abenden rief Xavier Bruno an und erzählte ihm alles. Bruno hatte auch keine Lösung parat und fühlte sich ohnehin nicht qualifiziert als Ratgeber, immerhin führte er eine glückliche Beziehung mit seiner Frau und ihren beiden gemeinsamen Töchtern. Zumindest hörte er ihm zu. Das war wenigstens etwas. Wurde mal wieder Zeit, sich bei Bruno zu melden. Er hatte Xavier Fotos von den Arbeiten an seinem Wohnsitz geschickt. In einem Anbau wurden gerade neue Gästezimmer eingerichtet, und er wartete auf einen Besuch seines Freundes, um ihm sein neues Leben zu zeigen. Er hatte einen Instagram-Account erstellt, eine Website, eine Facebook-Seite, ein Booking.com-Profil und bewarb das »Gut Turteltaube« mit erstaunlicher Energie. Das letzte Foto zeigte einen Korb voller Brombeeren, darunter stand »Frisch aus unserem Garten«, gefolgt von zwinkernden Emojis. Brunos Leben war von dem seines ehemaligen Kommilitonen inzwischen meilenweit entfernt. Da Xavier mit den Bildern nichts anzufangen wusste, schickte er seinerseits ein lächelndes Emoji und ein »Super, ich komme bald«. Aber die Monate verstrichen.
Xaviers Handy klingelte. Frédéric Chamois meldete, die neuen Eigentümer würden ungeduldig, was die vergessenen Sachen im Flurschrank anging. »Die, die, die … Frau hat angerufen, sie ist sehr, sehr, sehr … verärgert.«
»Na schön«, entschied Xavier, »ich kümmere mich darum.« Die fragliche Wohnung lag nur zwanzig Minuten zu Fuß vom Café entfernt, er würde hingehen und mitnehmen, was er tragen konnte, oder sonst morgen noch einmal mit dem Auto vorbeifahren. Mittlerweile war klar, dass die ehemaligen Eigentümer nicht auf seine Nachrichten reagieren würden. Also würde er selbst alles wegschaffen und entsorgen müssen.
»Es tut mir leid, Sie damit zu belästigen, Monsieur Lemercier«, sagte die Frau – die überhaupt nicht so wirkte, als täte es ihr leid, eher als wäre es ihr gutes Recht, die sofortige Entrümpelung des fraglichen Schranks zu verlangen. Wie vermutet, war die Wohnung inzwischen renoviert worden: Das Büro hatte man zu einer offenen Küche umgebaut und mit dem Wohnzimmer zusammengelegt, der traditionelle Stuck an der Decke war verschwunden, und die ursprüngliche Küche am Ende des Flurs hatte sich offenbar in ein Kinderzimmer verwandelt. In der Diele stand ein Tretroller aus Aluminium. Die sah man mittlerweile immer häufiger in Paris. Die Erwachsenen hatten sich dieses Kinderspielzeug mit einer Selbstverständlichkeit zu eigen gemacht, die Xavier oft irritierte. Sie schwärmten in aller Ernsthaftigkeit davon, wie leicht und geschmeidig man damit durch den Stadtverkehr kam, ohne dass ihnen je die Lächerlichkeit eines solchen Fortbewegungsmittels dämmerte. Sogar Céline überlegte, sich für den Weg zur Arbeit einen anzuschaffen.
»Hier ist es.« Feierlich öffnete Madame Carmillon den berüchtigten Wandschrank, der hinter der Täfelung versteckt war und statt eines Griffs einen kleinen Schlüssel hatte. Xavier hatte ihn schlicht übersehen. Er tauchte nicht einmal in der Objektbeschreibung auf. Hinter der Tür lagerten drei alte Stoffballen, eine Vase, ein nicht mehr gebräuchliches Barometer und ein rechteckiger Kasten aus lackiertem Holz, bestimmt anderthalb Meter lang und vierzig Zentimeter breit. Lederriemen waren mit großen Polsternägeln daran befestigt. Drei alte eiserne Zahlenschlösser sicherten den Inhalt. »Es geht vor allem um den da«, sagte Madame Carmillon und deutete auf den Kasten. »Der wiegt eine Tonne. Mein Mann hat sich beim Joggen den Ischias eingeklemmt, er kann das Ding auf keinen Fall tragen, und ich noch viel weniger.«
»Selbstverständlich«, erwiderte Xavier und hob den Kasten aus dem Schrank. Eine Tonne war übertrieben, aber dreißig Kilo wog er locker.
»Um die Stoffballen und das alte Barometer kümmere ich mich«, lenkte Madame Carmillon ein, überglücklich, den Immobilienmakler an der Hand zu haben und ihr Problem prompt lösen zu können. »Aber befreien Sie mich von diesem Kasten, Monsieur Lemercier.«
Die Lederriemen waren klug angebracht, sodass man sie sich quer über die Schulter schlingen konnte, wie bei einem Jagdgewehr. Dadurch verteilte sich das Gewicht auf dem Rücken, und die Last wurde tragbar. So angeschirrt verabschiedete Xavier sich von seiner ehemaligen Kundin und machte sich auf den Weg zur Agentur. An einer Kreuzung begegnete er einem Cellisten, der seinen Cellokoffer ganz ähnlich auf dem Rücken trug. Der Mann wechselte einen kurzen Blick mit ihm und drehte sich anschließend noch zweimal um. Bestimmt fragte er sich, welches Instrument Xavier wohl spielte.
»Wir, wir, wir … haben die Codes nicht«, sagte Frédéric.
»Nein, wir haben die Codes nicht«, wiederholte Xavier.
»Was, was, was … ist da wohl drin?«
Die beiden Männer standen links und rechts neben dem Kasten, der auf dem Boden lag. »Solange wir die Schlösser nicht aufbekommen, werden wir das nie erfahren.«
»Wir bräuchten ei-ei-ei… einen Trennschleifer, um sie aufzusägen«, meinte der Praktikant.
»Wir haben keinen Trennschleifer, und wir werden auch nicht extra dafür einen kaufen.«
Frédérics Miene hellte sich auf. »Oder einen Schlosser.«
»Ja«, seufzte Xavier, »früher gab’s hier mal einen, aber der ist weg.« Sie schwiegen eine Weile. »Ich schaue bei Claude vorbei«, entschied Xavier, »vielleicht hat der eine Idee.«
Der Laden des Antiquitätenhändlers befand sich nur ein paar Häuser weiter und war schon lange vor Xaviers Immobilienagentur da gewesen. Ganz im Gegensatz zu dem, was der Name »Das Lächeln der Vergangenheit« vermuten ließ, lächelte Claude kein bisschen mehr. Seine Umsätze waren eingebrochen. Niemand interessierte sich noch für Tabakdosen, antike Korkenzieher, historische Quecksilberspiegel, kristallene Tintenfässchen oder Nachttischchen aus Rosenholz. Nichts davon lockte die junge Generation hinter dem Ofen hervor, und die wenigen Sammlerinnen und Sammler, die weiterhin auf der Jagd nach so etwas waren, besorgten es sich günstiger auf eBay. Claude stand kurz vor der Rente und redete nur noch von den Olivenbäumen auf seinem Anwesen in Südfrankreich, wohin er nächstes Jahr ziehen wollte. Seinen Laden öffnete er trotzdem jeden Tag, um »seine Stunden abzuleisten«, wie er es nannte. »Das ist eine Attrappe«, murmelte er gerade.
»Eine Attrappe?«, wiederholte Xavier. Der rechteckige Kasten lag auf der Ladentheke des Antiquitätenhändlers, der eins der Zahlenschlösser durch eine wie ein Monokel vor das rechte Auge geklemmte Juwelierlupe begutachtete.