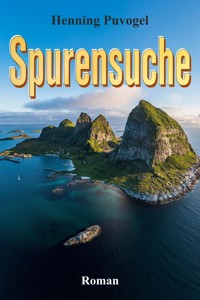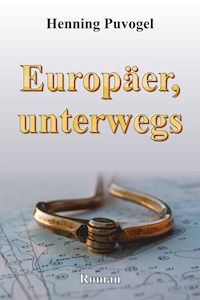Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie viele Jungen träumt Achim Petersen davon, einmal Kapitän zu werden und ferne Länder kennenzulernen. Seefahrt hat allerdings viele Varianten – es gibt Frachtschiffe, Kriegsschiffe, Segelschiffe und Spezialschiffe. Aber – was ist ein "glückhaftes Schiff"? Nicht eigentlich das, was seine Eltern und Großeltern darunter verstehen, findet Achim. Eher im Gegenteil. Dass Schiffe aber manchmal eine Seele haben und ein unerklärliches Eigenleben entwickeln, was ihre gegenwärtigen und zukünftigen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 759
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch
Wie auf ein braunstichiges Foto der Blick zurück auf die Kindheit Achim Petersens, der in einer Kleinstadt an der Küste aufwächst: Dorthin, in die niedersächsische Provinz, hat es die Hamburger Familie nach dem Krieg verschlagen. Die Nähe des Meeres, Schiffe und die enge Bindung an den Großvater, der ihm die Bedeutung der Seefahrt vermittelt, prägen den Jungen früh. Und dass auch kleine Fahrzeuge die See befahren können, sieht er bald.
Doch in seiner Familie gibt es Dinge, über die nicht gern gesprochen wird. Und der große Bruder lebt ihm vor, dass Seefahrt auch eine erfolgreiche Flucht sein kann. Und bald sind Abenteuerlust und der Fluchtgedanke aus familiärer und schulischer Enge stärker als alles andere. Petersen geht wie sein großer Bruder zur See.
Dort durchläuft er in langen Jahren die klassische Karriereleiter vom Schiffsjungen zum Kapitän. Aber selbst seinem oft naiven Blick, den er sich wie mancher Fahrensmann stets bewahrt, bleibt am Ende nicht verborgen, dass die moderne Seefahrt eine Knochenmühle ist, in der Privatleben, Partnersuche und Glück oft auf der Strecke bleiben.
Und ein <Glückhaftes Schiff> zu finden, das sich von den Vorstellungen seiner Eltern und Großeltern unterscheidet, ist gar nicht so einfach.
Aber er findet es. Und auch der Einstieg in die Freiberuflichkeit scheint zu klappen. Das hat viel mit Anneke zu tun, die er gewissermaßen auf Decksplanken kennen lernt.
Sie bleiben zusammen und sind bald nicht nur eine Familie, sondern finden auch einen Weg, sie alle zu ernähren und ihr kleines Schiff trotz hoher Kosten einsatzbereit zu halten.
Doch nach Jahren zunehmender Schwierigkeiten wird beiden klar, dass sie reichlich blauäugig waren und es nicht ewig so weitergehen kann. Das kleine Unternehmen ist auf Dauer gewissermaßen eine Art Verschleißorgie für Mensch und Material.
Wieder muss ein Ausstieg her – der diesmal gezwungenermaßen ein Einstieg ist: Achim Petersen hat ja immer noch seinen Beruf.
Und er findet einen Job, der nach einigen Anfangsschwierigkeiten maßgeschneidert für ihn ist. Sogar ihr Schiff können sie noch eine Weile halten.
Aber irgendwann wird klar, dass er dies Schiff, das für sie alle emotional so eng verbunden ist mit glücklichen Zeiten, Freiheit, Freiberuflichkeit und gemeinsamen Erinnerungen, in fremde Hände geben muss. Eigentlich kein ganz so ungewöhnlicher und schon gar nicht dramatischer Vorgang.
Aber niemals hätte er geahnt, wie sich dieser Eignerwechsel entwickelt. Dass sie dabei auf Dinge stoßen, die außerhalb seiner Vorstellungskraft lagen...
Eine Achterbahn der Gefühle setzt ein - bis alles doch noch ein gutes Ende findet.
Über den Autor
„Das glückhafte Schiff“ erzählt die (spätestens seit Graf Luckner) klassische Geschichte „Vom Schiffsjungen zum Kapitän“ einmal anders – ohne Seehelden, eher mit einer Art Antiheld. Nicht als gradlinigen Werdegang, sondern mit vielen Irrungen und Wirrungen. Und einer nicht alltäglichen Familiengeschichte.
Aber ohne Buddelschiffkitsch oder falsche Romantik, übertragen in eine modernere Zeit: Die auch politisch turbulenten letzten Jahrzehnte des vorigen Jahrhunderts - bis in die Gegenwart hineinreichend.
Puvogel schreibt durchgängig in der genau beobachtenden, zuweilen naiv anmutenden Sprache des Kindes oder Jugendlichen, die sich nie ganz verliert...und er muss über so etwas wie ein fotografisches Gedächtnis verfügen, so präzis und farbig entstehen Szenen der Seefahrt dieser Zeit: Einer Epoche, in der die Ära der traditionellen Frachter zu Ende ging und der Container im Seeverkehr eingeführt wurde – bis zur Globalisierung des Seetransports heute und der Einführung der Riesen-Containerschiffe.
Einer Zeit aber auch, in der das Land selbst tief greifenden Veränderungen unterworfen war - und heute durch Probleme, die schneller als geahnt global geworden sind, wieder ist. In der neben der Aufbruchstimmung in der Wirtschaft, Einführung neuer Schiffstechnik auch andere Aspekte wie Umweltschutz und Fair Trade in der Seeschifffahrt immer weniger ausgeklammert werden konnten. In der Umweltschutzorganisationen entstanden, die mit eigenen Schiffen tätig wurden, auf Raubbau und Meeresverschmutzung durch aufrüttelnde Aktionen hinwiesen und sie ins Bewusstsein der Öffentlichkeit brachten.
Aber noch von etwas anderem handelt dieser kleine Entwicklungsroman, der durch und durch nach Salzwasser schmeckt, aber auch norddeutsches Lokalkolorit atmet. Ein roter Faden, der sich durch die ganze Erzählung zieht und von einer für Seeleute nicht alltäglichen Leidenschaft berichtet: Der Liebe zu kleinen Schiffen, die sich nur mit Windkraft fortbewegen.
Henning Puvogel war 45 Jahre lang in seinem Beruf als Seemann, Nautiker und Kapitän tätig. Er fuhr von 1972 bis 2017 ohne Unterbrechung auf Frachtern, Spezialschiffen und Seglern zur See und lebt mit seiner Familie in Norddeutschland.
Von ihm erschienen bisher:
„Die letzte Fahrt der Scarabea“ (Hausschild, 1990)
„Ebbstrom“ (Koehler, 1999)
Impressum
Texte: copyright beim Autor
Umschlag: Kay Elzner, copyright beim Autor
Layout: Alexander Kaczorowsky
Seekarte „Den Helder to North Foreland“:
angefertigt & copyright beim Autor
Verlag: Henning Puvogel
Streekmoorweg 3
26316 Varel
Druck: epubli, ein Service der neopubli GmbH, Berlin
„Ich weiß doch wenigstens eines mit unumstößlicher Gewissheit, dass nämlich ein Menschenwerk nichts anderes ist als ein langes Unterwegssein, um auf dem Umweg über die Kunst die zwei oder drei einfachen, großen Bilder wiederzufinden, denen sich das Herz ein erstes Mal erschlossen hat.“
Albert Camus
Erster Teil
Das glückhafte Schiff
1.
Am schönsten war es, wenn Vater ihn morgens fliegen ließ.
Achim drückte von außen die Klinke herunter und lugte vom dunklen Flur ins Elternschlafzimmer. Von dort führte eine Glastür, die meist offenstand, in den Wintergarten und ließ Licht herein.
Es war heller Tag, und ein entfernter Pfauenruf drang an sein Ohr. Die Eltern rührten sich, als jetzt leise die Tür aufschwang und er barfuß hereintappte.
Die Decke wurde zurückgeschlagen, um ihn ins Bett zu lassen. Er schlüpfte auf die Matratze neben den Vater, ließ aber Abstand zu ihm und wartete, bis es losging. Er war nämlich „pomadig“, wie es Mutters Freundinnen nannten.
Das schien etwas Besonderes zu sein, wenn auch nichts Gutes.
Zu Weihnachten musste er diesen Freundinnen immer kleine, in buntes Papier verpackte Geschenke überbringen. Schon dagegen sträubte er sich, wenn auch vergebens. Wenn er dann aber geklingelt hatte, die Frauen öffneten und ihm zum Abschied noch „den Lockenkopf durchwuscheln“ wollten, gelang es ihm stets, sich zu entwinden. Das mochte er gar nicht, und das war wohl „pomadig“. –
Vaters Griff war eisern. Er lag auf dem Rücken, winkte ihn mit ausgestreckten Armen herbei und Achim setzte sich rittlings auf seinen Brustkorb. Dann wurden seine Fußgelenke umfasst und er langsam emporgehoben, immer höher. Ihm blieb nach ängstlich-entzückten Schreien nichts anderes, als sich in der Luft hinzuhocken und die Arme auszubreiten, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. So musste es auf dem Fliegenden Teppich sein, mit dem man in ferne Länder reisen konnte – alles schwankte, man sah von oben das Bett mit den Eltern unter sich und konnte durch die Veranda weit in den Garten hineinschauen. -
So wie jetzt müsste es immer bleiben, dachte er, nachdem er gelandet war und Vater ihn vorsichtig abgelegt hatte. Er fühlte sich ganz geborgen.
Die Matratze war kühl und es roch gut im Schlafzimmer – nach frischer Wäsche, aber auch nach Flieder, Sommer und Baden im Freibad. Ein Weilchen blieb er reglos liegen und lauschte den Atemzügen der Mutter.
Ein Windzug aus dem Garten bewegte die grünen Vorhänge, von denen nur einer halb zugezogen war.
Er rollte sich herum, als draußen der klagende Ruf der Fabriksirene anschwoll. Es war sieben Uhr, und die Arbeiter in der Weberei mussten mit der Arbeit beginnen.
Das Werksgelände begann gleich hinter ihrem Garten.
Direktor Fischer fuhr einen schwarzen Mercedes mit bulligem, runden Heck. Es war das neueste Modell, das die Scheinwerfer schon im Kotflügel hatte.
In seinem Mund steckte meist eine helle Zigarre. Er war sehr dick, redete nie mit den Kindern und trug weite Mäntel aus festem grünen Stoff. Er wohnte auch in der Windallee, nur einige Häuser weiter in einer weißen Villa mit einem Ententeich und einem Park dahinter. Auf den kiesbestreuten Wegen spazierten Pfauen. Da es zwischen dem Fabrikgelände und dem Grundstück der Fischer-Villa keinen Zaun gab, wanderten sie überall umher.
Achim fand die großen Vögel ein wenig eigenartig, wenn sie mit zierlichen Bewegungen über den Rasen stelzten, stehenblieben und ihn starr beäugten, wobei sie einen Fuß halb in der Luft behielten und so ruckartig die Hälse verdrehten. Zwar hatten sie Kronen und sahen schön aus, besonders die Hähne, aber ihre klagenden Schreie mochte er nicht besonders.
Es war gut, dass sie wenigstens nachts nicht riefen. Dann, wenn er im Kinderzimmer im Bett lag und die Stille manchmal so groß wurde, dass auch kleinste Geräusche unheimlich laut schienen.
Das Kinderzimmer war groß und hell, er teilte es sich mit seinen beiden Brüdern. Eine Schiebetür, die nie geöffnet wurde, trennte es von der Wohnstube.
Christian, der älteste, war sehr wild und mutig und beschützte ihn.
Der stärkste der ‚Hafenbutjer’, der Fischerjunge Klaas Heyenga, der mit bloßen Fäusten den schweren Kutter seines Vaters heranziehen konnte, hatte Achim einmal im Winter auf der Todesbahn in der Sandkuhle beim Rodeln vom Schlitten gestoßen und in den Schnee geschleudert. Aber der große Bruder hatte es gesehen und Klaas Heyenga erst einen Eisball ins Gesicht geworfen und ihn dann so wild umgestoßen, dass er geflüchtet war. Sogar seine Zähne hatten geblutet.
Christian war genau wie sein zweiter Bruder Eilert in Hamburg geboren, noch bevor die Familie von dort wegen Vaters neuer Anstellung in die kleine Stadt am Jadebusen gezogen war.
Obwohl Christian erst zehn war, hasste er die hiesige Knabenschule schon von ganzem Herzen.
Er und sein bester Freund Addi waren unzertrennlich, und zusammen hänselten sie den siebenjährigen Eilert oft. Der hatte immer eigene Ideen und machte alles anders als die andern.
Achim hatte noch nicht einen so guten Freund. Meist aber, wenn er vorm Haus auf dem Bürgersteig Runden mit seinem Roller drehte, kam Roger mit einer Einkaufstasche heraus. Der sagte dann: „Achim, du kommst wie gerufen.“ Das war ein Signal, er sprang vorn aufs Trittbrett, Roger hängte die Tasche an den Lenker, stellte sich hinter ihn und sie rollerten zu zweit die Windallee hinunter zu Busses Laden. Wo die Teichgartenstraße abzweigte, roch man den köstlichen Duft der Honigkuchenfabrik. Der Fußweg war breit und führte unter alten Linden dahin.
Roger war schon neun und einen Kopf größer als er. Sein komischer Vorname hatte irgendwie mit seinem Vater zu tun, der nicht mehr da war. Er musste viel arbeiten zu Hause, nicht nur einkaufen, auch Kohlen nach oben schleppen.
Manchmal boxten sie. Roger war Bubi Scholz, und er musste „Scharl Omeh“ sein, der verlor.
Roger wohnte mit seiner Schwester und seiner Mutter in der kleinen Dachwohnung der Villa nebenan.
Die war noch stattlicher als die Fischer-Villa, hatte eine säulengestützte, überdachte Terrasse mit einer breiten Treppe davor und gehörte Herrn Schünemann, dem Unternehmer.
Auf dem weitläufigen Hof mit den großen Garagen wuschen Arbeiter nachmittags immer zwei Müll-Laster, die einen sechszackigen Stern auf dem Kühlergrill hatten.
Herr Schünemann selbst fuhr sogar zwei Autos: Einen dicken Opel Kapitän, der fast so aussah wie Achims amerikanisches Fernlenkauto, und neuerdings einen richtigen Sportwagen, einen blassgrünen Karmann-Ghia.
Im Hundezwinger unter der Außentreppe wohnten seine beiden Schäferhunde Hasso und Ova. Er ging oft mit ihnen spazieren. Alle Jungen der Windallee sahen ihm bewundernd nach, wenn er eingerahmt von den beiden wolfsähnlichen Tieren durch das weiße Portal mit der aufgehenden Sonne, den „Steinernen Pfeilern“, im Wald verschwand. Die Hunde waren nie angeleint, weil sie aufs Wort gehorchten und immer ganz dicht „bei Fuß“ gingen.
Herr Schünemann war groß und weißhaarig, hatte eine schneidende Stimme und sein Gesicht war braungebrannt. Den Jungen rief er oft derbe Scherze zu, aber Achim hatte schon auch Angst vor ihm. Er hatte ein richtiges Gewehr, mit dem er in seinem Garten auf Eichelhäher schoss, die dann tot von den Kirschbäumen fielen.
Da hatte es vor nicht langer Zeit einen großen Krach gegeben. Schon morgens war wieder geschossen worden und eine Kugel war über Eilerts Bett in die Wand im Kinderzimmer gefahren, nachdem sie ein Loch in die Scheibe gemacht hatte.
Vater war zu Herrn Schünemann gegangen und hatte ihn zur Rede gestellt, aber der hatte dröhnend gelacht, eine wegwerfende Handbewegung gemacht und alles abgestritten. Erst als Vater drohte, ihn bei Kommissar Lehmann anzuzeigen und Frau Schünemann dazukam, hatte er sich entschuldigt und den Glaser bestellt, der die Scheibe ausgewechselt hatte.
Überhaupt wurde Herr Schünemann nicht von allen so bewundert wie von den Jungen der Windallee.
Gleich um die Ecke, in der Lohstraße, wohnte Dr. Marquardt, der Chefarzt im Krankenhaus. Der hatte große Söhne, von denen der eine ein angehender Richter war und oft mit einem Gewehr über der Schulter in Jägerkleidung in den Wald ging. Meist war ein Jagdhund mit gelben Augen dabei und manchmal eine schöne junge Frau.
Wenn die beiden sich auf dem Hauptweg unter den hohen Buchenreihen begegneten, zog Herr Schünemann wortlos ganz tief seinen Hut und der junge Herr Marquardt warf ihm finstere Blicke zu. Er grüßte nie zurück. Christians Freund Addi erzählte, er habe schon einmal hinter einem Baum gestanden und belauscht, wie der junge Herr Marquardt Herrn Schünemann im Wald wegen irgendwas zur Rede gestellt habe. Dabei solle er seine Jagdflinte von der Schulter genommen und gesagt haben, er könne auch anders. Aber das glaubte Achim dem Addi nicht ganz.
Und den alten Doktor Marquardt hatte er auch schon kennengelernt.
Er fuhr genau so einen schwarzen 220er wie Direktor Fischer, rauchte unentwegt Astor-Zigaretten, war mager und weißhaarig und hatte freundliche Augen hinter einer dicken Brille. Meist war er kurz angebunden, und kaum jemand hatte ihn einmal lachen sehen.
Vater sagte, das liege daran, dass er im Krieg war und nun so viele Unfallopfer zusammenflicken müsse.
Jedenfalls hatte sein großer Bruder ihn eines Tages zum Angeln an die Jadebrücke mitgenommen, wie immer vorn auf der Längsstange seines Fahrrades, mit zur Seite baumelnden Beinen.
Christian hatte einen neuen Metallwobbler mit Drillingshaken für Hechte bekommen und wollte ihn ausprobieren. Er stand am Ufer und holte mit der Rute weit nach hinten aus, um zu werfen. Achim verspürte einen Schlag am rechten Auge und dann war er plötzlich wie blind, sah nur noch undeutlich ein verschwommenes Blinken. Während er wie am Spieß Zeter und Mordio schrie, weil er glaubte, was Christian angstvoll rief: „Achims Auge läuft aus!“, machte sich der große Bruder so schnell er konnte mit ihm vorn auf dem Fahrrad auf den Weg ins sieben Kilometer entfernte Krankenhaus. Die Angelrute mit der Schnur, zum Löffelblinker führend, der dicht vorm Auge tanzte und dort festhing, hielt er mit dem Lenker zusammen fest in der Hand.
Bald überholte sie ein schwarzer Borgward, ein riesiger mit Fußstützen im Fahrgastraum, und hielt. Der Fahrer winkte sie heran, Christian warf sein Rad an den Straßenrand, sie mussten in den Wagen steigen, was mit der Angelrute leichter gesagt als getan war, und der Mann, der nach frischen Kuhfladen roch, hatte sie ins Krankenhaus gefahren.
Sogleich waren die Nonnen händeringend zusammengelaufen und hatten Dr. Marquardt herbeigeholt. Der schlurfte ohne Eile heran, schüttelte den Kopf, murmelte etwas von einem „schönen Fang“, untersuchte kurz, fummelte eine Schere aus der Tasche seines weißen Kittels, schnitt die Angelschnur durch und knurrte, ohne die Zigarette aus dem Mund zu nehmen, dass es nicht so schlimm sei.
Achim musste in den richtigen Operationssaal hinter der Doppeltür. Es roch betäubend nach Äther, er hatte eine Spritze bekommen und es dauerte eine Weile, bis ihm der Doktor den Drillingshaken aus der Augenbraue geschnitten hatte, weil der Widerhaken noch im Fleisch saß. Und es wurde mit einer Naht zugenäht.
Dann holten ihn seine Eltern ab.
Telefon hatten sie nicht zu Hause, aber der Bauer war mit Christian im Wagen in die Windallee gefahren und hatte ihnen Bescheid gesagt. Später tranken sie alle zusammen im Wohnzimmer Kaffee, auch der nette Mann mit dem Borgward.-
*
Manchmal, vor allem im Sommer und im Herbst, kam die Granatfrau vom Hafen in die Windallee. Sie hatte ein Fahrrad mit einem großen Korb vorn, der bis obenhin mit glänzenden rosa Garnelen gefüllt war. Ihre Strümpfe gingen bis kurz über die Knie und waren mit Gummiringen befestigt. Sie trug eine starke Brille und rief: „Granat, frische Granat!“. Meist kaufte Achims Mutter einen Liter, den die Granatfrau mit einer alten Konservenbüchse abmaß.
Der Lütjehaver Hafen lag zwei Kilometer vom Städtchen entfernt und war ein verlockendes Areal. Man ging über die Bahnhofsbrücke, wo man ganz in Dampf und Rauch eingehüllt war, wenn gerade ein Zug kam. Man musste achtgeben, dass keine Funken ins Auge flogen.
Wer dort wohnte, war ein Hafenbutjer und ging zur Hafenschule wie Klaas und Hero Heyenga. Mit den Hafenbutjern legte man sich besser nicht an. Klaas Heyenga wollte sogar gegen die fahrenden Boxer in der Bude mit Ring kämpfen, wenn Kramermarkt in Lütjehave war. Jedenfalls sagte das Hero, der kleine Bruder von Klaas, mit dem er schon gespielt hatte.
Ganz am Ende der Pier lag ein altes Frachtschiff. Man konnte durch die Bullaugen in die Kajüte sehen, wo ein Kessel auf dem Herd stand und ein Sofa mit einem Tisch davor. Um den saßen sicher die Matrosen, wenn sie auf dem offenen Meer fuhren und draußen Sturm und hohe Wellen waren. Das Schiff hieß „Akke Meyer“.
Wenn man den Weg neben der langen Fahrrinne weiterging bis vor die Schleusentore, kam man an roten und grünen Kuttern vorbei, die vor Fischerkaten vertäut waren. Und es ging durch die Schwaden einer bestialisch stinkenden Leimkocherei.
Aber direkt vor der Schleuse, gleich neben dem Sielwärterhaus, schwamm eine blaue Segeljacht. Wenn Ebbe war, lag sie in ihrem Schlickbett. Sie hieß „Nina“, hatte einen Klüverbaum wie die „Pamir“, die im Sturm untergegangen war, nur viel kleiner natürlich, und war herrlich anzusehen.
Ein richtiges Schiff, nur für Vergnügungsfahrten gebaut… sicher konnte man auf ihm weit hinausfahren aufs Meer und vielleicht sogar andere Länder besuchen. Durch die ovalen Fenster in den Aufbauten sah man in die behagliche Kabine. Achim stellte sich vor, wie geborgen man sich dort drinnen fühlte, sogar mitten auf dem Ozean.
Aber die „Nina“ lag immer auf demselben Platz. Nie sah man sie hinausfahren oder segeln. Sie gehörte Herrn Rebecker, dem Inhaber des Textilhauses. Dem genügte es wohl, dass er eine so schöne Jacht sein eigen nennen konnte.-
Wenn man über den himmelhohen Deich gestiegen war, der die Nordsee bei Sturmflut abhielt, sah man bei Ebbe kaum Wasser: Nur eine endlose Fläche spiegelnden Schlicks, die bis zum Horizont reichte. Wenn die Silbermöwen und Austernfischer schwiegen, hörte man das gärende Knistern aus dem Watt.
Bei Flut leckten die Wellen an den grauen, glitschigen Uferkanten des Außentiefs. Nach langem Suchen konnte man die winzigen Punkte der Lerchen entdecken, die in der Luft standen und jubilierten.
Am Boden wuchs langes, weiches Gras wie dickes Haar und dazwischen moosartige Pflanzenbüschel, die betäubend gut dufteten, wenn man sie zwischen den Fingern zerrieb.
In der Ferne waren flach und undeutlich die Küstenlinie von Butjadingen und die Stadt Wilhelmshaven zu sehen. Die kantigen Umrisse des Rathausturms staken heraus. Und mittendrin in der trockenfallenden Meeresbucht erhob sich der rotweiße Leuchtturm Arngast, der den großen Schiffen den Weg wies.
Vor der Schleuse wurde die Fahrrinne flankiert von Dückdalben. Die dicken Stämme waren immer zu dritt in den Boden gerammt. Sie lehnten sich oben aneinander und waren mit Eisenbändern verschnürt, damit wartende Schiffe an ihnen festmachen konnten.
Den einen hatte einmal Onkel Dieter bei einem Spaziergang durchschossen, mit seiner „Browning“. Achim hatte es genau gesehen: Er zog das Ding innen aus dem Mantel, zielte kurz, die silbrige Pistole zuckte hoch und spuckte, der graue Stamm erzitterte kaum merklich, ein ohrenbetäubender Krach, die Kugel fuhr hindurch und ins Wasser, und auf der Rückseite stand ein frischer dunkelgelber Span heraus.
Vater hatte ihn gefragt, ob er verrückt geworden sei.
Onkel Dieter war Vaters jüngerer Bruder, der manchmal auf Besuch kam. Er war Ingenieur in Hamburg, bei Rudolf Otto Meyer, und hatte einen schwarzen Gürtel in Judo. Vater nannte ihn einen „tollen Hecht“. Das war halb ironisch und halb bewundernd gemeint.
Er fuhr einen Buckeltaunus und hatte viele Waffen, neben der Browning auch Trommelrevolver. Ihre kleine Stadt nannten er und seine junge Frau immer ein Kuhdorf. Tante Lütsch war hübsch und schwarzhaarig, lächelte häufig, was irgendwie verheißungsvoll aussah und hatte einen kleinen Leberfleck direkt neben dem Mund.
Onkel Dieter trug gern seinen langen grünen Ledermantel. Vater besaß auch so einen.
Langweilig war es jedenfalls nie, wenn er aus Hamburg auf Besuch kam. Er brachte Schallplatten mit von einem amerikanischen Sänger, der Guy Mitchell hieß. Im Musikhaus Kleff in Lütjehave gab es nur die neuesten Platten von Peter Kraus und Jan und Kjeld, die jeder doof fand. Da war „Singing The Blues“ schon was anderes.
Oder die gelb-rote Kunststoffrakete, die er ihm einmal geschenkt hatte. Man konnte die Spitze mit einem Rädchen herausdrehen und wenn man sich die dazugehörigen Kopfhörer ins Ohr steckte, hörte man verschiedene Radiosender.
Aber manchmal war er gar nicht so ein toller Hecht.
Achim hatte ihn einmal auf einer Silvesterfeier weinen sehen, weil er nicht wusste, wo seine Frau gerade war. Und später, als er es wusste, hatte er seinen Papierhut vom Kopf gerissen und war darauf herumgetrampelt.
*
Achims Vater war kein Ingenieur, sondern Lehrer an der Berufsschule.
Vor fünf Jahren, kurz bevor er geboren wurde, waren sie mit der ganzen Familie hergezogen, weil „ein Neuanfang gemacht werden sollte“ und hier weit weg von Hamburg eine Lehrerstelle frei war.
Vater war im Krieg gewesen, in Norwegen und Russland. Er war verwundet worden und zwei Jahre blind gewesen. Und auch sein ganzer Bauch war von Granatsplittern vernarbt. Ein berühmter Professor in Kiel hatte ihn operiert und es geschafft, dass er wieder sehen konnte, wenn auch nur auf einem Auge und mit einer starken Brille.
Eigentlich hasste er den Krieg, weil dort die Leute so kaputtgeschossen wurden.
Nur Marschmusik hörte er immer noch gern. Das kam daher, weil er bei den Soldaten Tambourmajor gewesen war.
Was der „Neuanfang“ war, wusste Achim nicht genau. Er hatte es nur aufgeschnappt, und da zwischen Vater und Mutter oft solche Geschichten aus Hamburg erwähnt wurden, hörte er nicht so richtig hin. Ihre Stimmen klangen dann so gereizt und sie ließen Sätze unvollendet, die in der Luft hängenzubleiben schienen.
Die Eltern taten oft so geheimnisvoll, und viele dieser Dinge schienen mit „dem Krieg“ zu tun zu haben. Darüber wurde nicht viel gesprochen.
Aber man konnte ja sehen, was von Menschen dort übrigblieb, selbst wenn sie überlebt hatten. In Lütjehave gab es einen rotbärtigen Mann, der auf einem ausrangierten Kinderwagengestell saß, weil er keine Beine mehr hatte. Mit zwei Stöcken stieß er das quietschende Gefährt mühsam vorwärts, wenn er die ansteigende Düsternstraße hinauf wollte. Ein anderer Mann war ungeheuer fett, sah ganz komisch aus und hatte eine hohe Fistelstimme. Auf Achims Drängen sagte schließlich Vater fast zornig, dass man dem „die Eier weggeschossen habe“, und er solle jetzt nicht mehr fragen. Aber am grauenvollsten war „Der Schüttler“ mit seiner blauen Brille, den man nur ganz selten erblickte. Achim hatte ihn einmal von weiten gesehen, wie er torkelnd und tänzelnd in einem Hinterhof verschwunden war.-
Manchmal holte er Vater mit dem Tretroller von der Schule ab. Der Roller hatte Gummireifen und einen runden Motorradtacho mit biegsamer Welle zum Vorderrad, man konnte damit über sechzig fahren. Roger sagte aber, der Tacho ginge falsch.
Die Schule war ein rotes Backsteingebäude schräg gegenüber der großen Windmühle, mit zwei Klassenräumen im „Hochparterre“. Es roch staubtrocken nach Kreide und muffigen Tafellappen dort. Nach dem Klingeln brachte ihn Herr von Harten, der Hausmeister, hinein.
Vaters Schüler blieben oft noch da. Er erklärte dann besonders schwierige Algebraaufgaben für die, die es immer noch nicht verstanden hatten. Es waren große Jungen, die sehr nett zu Achim waren.
Vater sagte, dass sie bald einmal eine Schiffsreise mit der „Rüstringen“ nach Helgoland machen würden und dass er vielleicht mitdürfe.
Am meisten Spaß machte ihm das Zeichnen mit der farbigen Kreide auf der Schultafel. Er konnte es zwar nicht so schön wie Vater, der einen Ozeandampfer mit einem riesigen gelben Adler als „Galionsfigur“ malte, aber sein blaues Segelboot hatte zwei Masten und sogar eine weisse Bugwelle.
2.
Pass mal auf, Achim“, sagte Hansopa, lächelte mit den Augen und hob einen Zeigefinger. Dann steckte er ihn in den Mund, beulte seine Wange damit weit aus und ließ sie knallend zurückschnellen, dass es - plock! - haargenau wie ein gezogener Flaschenkorken klang. Nun zog er den Finger heraus, formte seine offenen Lippen zu einem lautlosen „O“ und begann, sich mit der flachen Hand rhythmisch gegen die Wange zu klopfen. Dabei öffnete er den Mund weit und weiter und der imaginäre Wein ergoss sich mit immer hellerem Gluckern ins Glas. Es klang täuschend echt, erst der Korken und dann das leise, sich verändernde Geräusch.
Achim lachte anerkennend.
Hansopa hatte eine tiefe, unglaublich volltönende und warme Stimme.
Er spielte zuweilen auf seiner Geige, und das klang sehr schön. Auch Oma Anna seufzte dann weniger häufig und hörte gern zu.
Sie war immer noch traurig, weil ihr einziger Sohn Eilert, Mutters Bruder, im Krieg gefallen war - in Belgien. Und das würde sich auch nie ändern, sagte Mutter. Onkel Eilert war mit Tante Grete verheiratet gewesen, einer Schwester von Vater.
Achim liebte die Besuche in Hamburg bei Mutters Eltern, und diesmal durfte er die ganzen Weihnachtsferien dort bleiben.
Er war zur Schule gekommen und ging in die erste Klasse. Wie er insgeheim befürchtet hatte, passierte dort nicht viel Erfreuliches. Schreiben und Lesen lernen brachte zwar Spaß und ging einfach. Aber die Lehrer waren schlecht gelaunt, weil Deutschland den Krieg verloren hatte und sie nicht so darüber reden durften, wie sie wollten. Aber sie taten es doch. Er hatte schon eine so saftige Ohrfeige bekommen, dass sein ganzer Kopf herumgeflogen war, nur weil er den Namen „Karl“ genau so geschrieben hatte, wie ihn der Lehrer ungeduldig mit friesländischem Zungenschlag diktiert hatte: „Kardel“, eine ganze Reihe. Er hatte gedacht, „Kardel“ sei ein plattdeutsches Wort. Und das sprachen sie zu Hause nicht. Er hatte es nur besonders gut machen wollen. –
Aber jetzt in den Ferien war die Knabenschule weit weg.
Es war tiefer Winter. Seit Wochen herrschte strenger Frost und die hohen Bogenlampen an der Tangstedter Landstraße beleuchteten schon am frühen Nachmittag die hartgefrorenen Schneemauern an den Straßenrändern, die höher waren als er selbst.
Er wusste nicht, was schöner war: wenn er mit Großvater im warmen Wasser des grün gekachelten Hallenbads in der Kellinghusenstraße den Nachmittag verbrachte oder die Fahrt mit der Hochbahn nach Hause, wo Kaffee und Kakao auf sie warteten.
Die Wohnung war nicht groß. Aber schöne alte Möbel standen darin aus dunklem Holz mit geschnitzten Aufsätzen – die Schränke mit den vielen Büchern hinter Glasscheiben, der ovale Esszimmertisch mit den geschwungenen Beinen, dicke rote Teppiche und Hansopas riesiger Ohrensessel neben dem mannshohen Kachelofen. Es war immer mollig warm in der Wohnstube, ganz gleich, welch strenger Frost draußen herrschte.
Frühmorgens, wenn es noch dunkel war, fachte Hansopa den Ofen wieder an. Achim beeilte sich, noch vor ihm unten zu sein, um dabei zuschauen zu können und vor allem, um nach „Nigger“ zu sehen. Das war ein riesiger schwarzer Kater, der tagsüber draußen herumstrich und abends zurückkehrte. Dann bekam er zu fressen, legte sich unter den Kachelofen und schlief.
Dort lag er auch jetzt, nur sein haariger Schwanz schaute hervor. Hansopa langte hin, um ihn zu wecken, und als das Tier die Krallen ausstreckte, griff er zu und zog den ganzen Kater rückwärts unter dem Ofen hervor- am Schwanz! Fauchend und spuckend hieb der wie ein schwarzer Teufel giftig nach Hansopas Hand, aber der lachte nur, nannte ihn einen alten Verbrecher, ließ ihn fahren und machte die Ofenklappe auf, um die Glut mit dem Schürhaken aufzustochern.
Achim schwankte zwischen Mitleid und Bewunderung. Oma Anna rief aus der Küche tadelnd: „Hans!“, aber er hatte ihm nicht wirklich weh getan - und Nigger schien das ruppige Spiel zu kennen. Wenig später strich er ihnen wieder schnurrend um die Beine, während die Flammen hinter der Gitterklappe zu prasseln begannen. Orangeroter Schein zuckte über Hansopas rundes, bartloses Gesicht, und er summte tief vor sich hin.
Jetzt kam Achims Job. Er hastete nach ganz oben in die Schlafkammer ‚Sperlingshöh’ und zog sich schnell an, auch die warmen Socken und unten im Flur die dicke Winterjacke. Nur eine Mütze hatte er nicht, er verabscheute Mützen.
In der Küche stand die Großmutter am Herd vor der leise fauchenden Gasflamme. Das plötzlich einsetzende, knisternde Surren der elektrischen Kaffeemühle in ihren Händen wurde rasch zu einem feinen, hohen Sington, der nun verstummte. Oma Anna drehte den Deckel aus Plexiglas vorsichtig auf, um nichts zu verschütten.
Köstlicher Duft nach frisch gemahlenem Kaffeepulver breitete sich aus, aber der Raum war noch eiskalt. Die Fenster waren ganz mit Eisblumen überzogen. Draußen mussten mindestens „fünfzehn Grad minus“ sein, wie Hansopa jetzt feststellte. Oma Anna sagte : „Na, Achim“ und drückte ihm eine kleine rote Geldbörse in die Hand.
„Sechs Rundstücke und ein viertel Pfund gute Butter, hörst du!“
Nirgendwo schmeckten die Brötchen so gut wie hier. Allein schon der Duft nach Milch, frischem Brot und Kuchen beim Bäcker Beger um die Ecke, wo er sie holte, machte Appetit auf ein ordentliches Frühstück.
Und das brauchten sie. Heute wollte Hansopa viel mit ihm unternehmen: Ins Planetarium, zum Elbtunnel… und alles natürlich mit der Hochbahn, über viele Stationen. Über die Brücken mit den steinernen Löwen an den zugefrorenen Wasserläufen bis mitten in die Stadt, wo sich auf der Alster vor dem Rathaus, das aussah wie ein Schloss im Märchen, die Menschen auf dem Eis tummelten.
Das war gestern abend schon im Fernsehen gekommen, in der Nordschau. Die guckte Hansopa immer, aber nach dem Gong mit der Fanfare machte er den Apparat wieder aus. Das andere sei Mist. „Fernsehen ist langweilig für Kinder“, sagte er.
Achim liebte Hansopa besonders für seine starken Ausdrücke. Er scherte sich überhaupt nicht darum, dass man nicht fluchen sollte, so oft seine Frau ihn auch zur Ordnung rief. Und er strahlte trotzdem fast immer gute Laune aus.
Überhaupt war einiges anders als zu Hause in der Windallee. Dort wohnten sie zwar in einer Villa mit vielen Zimmern und hohen Räumen, hatten aber weder einen Fernseher noch ein Auto noch so schweres Silberbesteck. Sogar Serviettenringe aus Silber mit ‚Monogrammen’ gab es hier und leinerne Servietten darin.
Ein Auto hatte Hansopa allerdings nicht, aber er brauchte auch keines. Er fuhr mit der Hochbahn in die Stadt, wo er sich bestens auskannte, in der Mönckebergstraße und auf dem Rathausmarkt und überall. Achim konnte sich auch nicht vorstellen, dass er selbst hinterm Steuer saß. Höchstens hintendrin, in einem schwarzen Wagen mit seinem steifen Hut, und jemand fuhr ihn.
Aber mit Schiffen wusste er Bescheid. Er kannte alle Flaggen und Schornsteinmarken der Dampfer, die in den Hafen kamen und wusste sogar, was sie geladen hatten.
Ein schneeweißes, herrliches Frachtschiff lief gerade ein und wurde mit drei bulligen Schleppern, die vor Anstrengung ganz schief lagen, gedreht. Achim konnte den Namen nicht lesen, aber Hansopa sagte, daß es die „Piräus“ aus Hamburg sei und sie direkt aus Mittelamerika komme, voll mit Bananen.
Er war nämlich Reeder gewesen, in einem „Consortium“. Deswegen sprach er auch so gut Englisch, Französisch und Spanisch. Früher hatte die ganze Familie, auch Mutter, in Uhlenhorst gewohnt – da gab es Dienstmädchen, und Hansopa war viel geschäftlich unterwegs gewesen, hauptsächlich in Ägypten.
Aber jetzt war er kein Reedereikaufmann mehr. Es hatte ihm wohl auf Dauer nicht so gut gefallen, und aus dieser Zeit hatte er einen ziemlich großen Zorn auf die Leute in den Geschäftshäusern am Rödingsmarkt.
Heute arbeitete er als Dolmetscher und Übersetzer in einem kleinen Büro in der Innenstadt. Er führte manchmal Selbstgespräche in verächtlichem Ton und schaute dabei so zornig an den prächtigen Fassaden hoch, dass Achim sich wünschte, er möge wieder lustig sein. Und das dauerte auch nie lange.-
Sie verbrachten einen wunderschönen Wintertag in der Stadt. Hansopa stieg mit ihm auf den Michel, wo ein schneidender Ostwind wehte, dann gingen sie Hand in Hand hinunter zum Hafen – den Baumwall entlang zu den Landungsbrücken, wo die weiß-grünen, zweistöckigen Barkassen anlegten. Knirschend bahnten sie sich den Weg durch die bräunlichen Eisschollen.
Mit der Taxe fuhren sie im Fahrstuhl zum Elbtunnel hinunter und unter der Elbe durch, so dass über ihnen die Ozeandampfer der „Hamburg-Süd“ waren, die sie eben noch vor der Riesenwerft Blohm und Voss hatten schwimmen sehen.
Gegen halb vier Uhr nachmittags, als es schon dunkelte, begann es zu schneien und sie machten sich auf den Weg vom Café, wo sie heiße Schokolade getrunken hatten, zur Station St. Pauli. Achim war randvoll mit Eindrücken und entsprechend müde und glücklich, aber er freute sich auf die Hochbahnfahrt durch die glitzernde Innenstadt und nach Langenhorn. Hamburg war sicher die schönste Stadt der Welt.
Da brauchte er nicht soviel an den morgigen Tag zu denken. Er wäre viel lieber mit Hansopa zum Staubecken gewandert, aber einen Tag wenigstens musste er auch zu seinem anderen Großvater.
Das Haus war nur fünf Minuten entfernt, gegenüber der Pro und Storchenvater Schwen, und Carlopa holte ihn morgen nach dem Frühstück ab.
*
Wie sie sich schon begrüßten!
Es klopfte dreimal laut und herrisch an die Außentür.
Hansopa ging hin, Unverständliches murmelnd, öffnete und streckte die Hand aus: „Carl?“
„Hans?“ krächzte Carlopa mit seiner heiseren, hohen Stimme. Beide hatten den Namen des anderen wie eine Frage ausgesprochen.
Einen Augenblick dachte Achim, dass Carlopa die ausgestreckte Hand Hansopas übersehen würde, aber schließlich ergriff er sie doch und trat sogar ins Wohnzimmer. Dann streckte er ruckartig sein Kinn vor, warf den Kopf zurück und fixierte Achim scharf.
Er war groß und hager und hatte einen kurzen stacheligen Schnurrbart unter der Nase. Seine hellen Augen blickten durch eine funkelnde Brille mit runden Gläsern, und wenn er etwas sagte, klang es kurz und militärisch knapp. Vater sagte, er habe ‚Rittmeister-Allüren’ und fragte zuweilen, ob ’Opa wieder seine 6-PS-Hosen angehabt habe’. So nannte er die komischen, oben ausgebeulten Hosen, die in langen Schaftstiefeln steckten. Allerdings sagte er sowas nur in seiner Abwesenheit. Denn Carlopa war berüchtigt für seine Ausfälle, die monate- oder jahrelange Verstimmungen nach sich zogen. Auch Onkel Dieter war schon die Treppe heruntergeschubst worden.
Carlopa war Senatsamtmann im Hamburger Rathaus. Mutter hatte Achim erzählt, dass er dort einmal auf dem Flur einen Untergebenen geohrfeigt habe, weil der ihn nicht ordnungsgemäß gegrüßt hatte. Er besaß einen kauzigen Humor, der selten einmal durchblitzte. Dann stieß er ein sonderbares, posaunenartiges Lachen aus und schnitt Grimassen.
Er malte „Aquarelle“, von Raddampfern auf der Weser und Schleppzügen auf der Elbe. Er hatte auch ein Skizzenbuch, wo uniformierte Männer mit Monokel im Auge stramm standen und witzige Bemerkungen machten, die in komischer „Deutscher Schrift“ als eingerahmte Sprechblasen wie Wolken vor ihnen standen. Aber außer ihm verstand die Witze kaum jemand.
Auch seine Sprache war eigenartig. Er sagte beispielsweise zu Oma Else, seiner Frau: „Else, gebe den Rest des Reises dem Hunde aus dem Siebe, mit etwas Tunke“.
Dann bekam Tex, der scheue Terrier, den Rest des Mittagessens.
Oma Else hatte schon Briefe abgefangen, die an ihren Mann gerichtet waren und sie weggeworfen, damit er nicht antwortete, sich ärgerte oder gar lange prozessierte. Vater sagte, das sei ein Segen.
Seit sie aber vor zwei Jahren gestorben war, lebte er allein mit Onkel Dieter und seiner Familie zusammen. Tante Lütsch hatte jetzt ein kleines Mädchen bekommen. Sie wohnten im Erdgeschoss des Doppelhauses.
Carlopa hauste allein in einem Zimmer im ersten Stock. Dort gab es haufenweise Zeitschriften und Bücher, die überall gestapelt waren, auch auf dem Fußboden. Oben auf dem wuchtigen Schrank thronte ein schweres Modell aus Holz: Ein schnittiges langes Schlachtschiff mit mehreren Drillingsgeschützen und einem kleinen Wasserflugzeug auf dem Achterdeck, das Achim gern einmal angefasst hätte.
Ein großer brauner Fernsehapparat stand in einer Bücherlücke im Regal.
Manchmal musste er zusammen mit Carlopa eine lehrreiche, langweilige Sendung gucken, zu der es lange Erklärungen gab, die mit mahnendem Unterton schlossen. –
Jetzt blickte er tadelnd auf Achim, weil der noch nicht fertig angezogen und gekämmt war, und schüttelte kaum merklich den Kopf. Aber wenigstens sagte er nicht wieder „krause Haare, krauser Sinn“.
Stattdessen fragte er, ob er schon in die Schule gehe. Und dass er eigentlich mit ihm zu den Alsterquellen gewollt habe, das Wetter aber nicht danach sei.
So schlug Achim vor, sie könnten doch zum Staubecken wandern.
Hansopa hatte einen kleinen Schlitten, den er extra aus dem Kohlenkeller für ihn hervorgeholt hatte. Die Kufen hatten sie zusammen blitzblank geschmirgelt.
Das Staubecken im Wördemoor war umgeben von einem Damm, von dem aus man mit einem Rutsch auf den zugefrorenen Teich sausen konnte.
Hansopa hatte nicht mitgewollt. Carlopa stand frierend am Ufer, und auch Achim hatte bald keine Lust mehr, obwohl zwei kleine Mädchen ihn ansprachen und fragten, ob er mit ihnen Schlitten fahren wolle.
So gingen sie durch den Harnacksweg zurück zu Carlopas Haus in der Tangstedter Landstraße. Er sagte, um vier komme eine Sendung über einen Dichter im Fernsehen, der Matthias Claudius hieß. Die wollten sie sich zusammen ansehen. Dieser Dichter hatte auch in Hamburg gewohnt, in Wandsbek.
Achim hoffte, dass Onkel Dieter wenigstens da sei und er vielleicht unten bei ihnen bleiben könne. Aber als er Carlopa zaghaft danach fragte, presste der nur gereizt die Lippen zusammen und schüttelte wortlos den Kopf. Er lotste ihn die dunkle Treppe hinauf, wo es nach kaltem Zigarrenrauch roch, und dort musste er die ganze Sendung mit ihm ansehen. Zum Schluss, bevor er ihn im Dunkeln wieder in die Fritz-Schumacher-Allee brachte, bekam er noch die Anweisung, in Zukunft statt „Schiet“ „Unrat“ zu sagen, und dann war er für diesmal entlassen.-
3.
Wir warteten im Hafen von Bassora, bis ein günstiger Wind sich erhob, und stachen in See. Aber nicht lange wehte der günstige Wind. Bald sprang er um und wurde zum Orkan. Wir warfen Anker mitten im Meer, doch es nützte nichts, denn der Sturm riss die Segel in Fetzen und knickte die Masten, und das Ankertau riss, und Wind und Wogen wüteten mit dem Schiff, und das Schiff versank. Kaum also, dass wir unsere Reise recht begonnen hatten, war sie schon zu Ende, und mit dem Schiff versanken unsere Güter und Waren. Wir retteten uns in die Boote, aber der Sturm zerschmetterte sie, und ich stürzte ins Meer…“
Achim hatte das dicke Märchenbuch aufgeschlagen auf den Knien liegen. Diese Stelle las er am liebsten vor. Aber es gab auch noch eine andere aus einem Buch von Jack London, wo Franzosen-Pete mit einem anderen Piratenkapitän um die Wette segelte und der rote Nelson sein Schiff im Sturm verlor.
Sie hockten zu dritt im Schatten unter dem dichten Rhododendronstrauch, in der „Zauberhöhle“ vor dem Balkon in der Windallee. Die beiden Ruthchens, achtjährige Mädchen aus der Nachbarschaft und er. Er musste mal wieder vorlesen, und da ließ er sich nicht lange bitten und war gar nicht pomadig. Sie hatten sich dicht neben ihn gehockt und hingen mit einer Mischung von Faszination und Schaudern an seinen Lippen. Auch Achim selbst lief eine Gänsehaut über den Rücken, so sehr konnte er sich in die verzweifelte Lage Sindbad des Seefahrers hineinversetzen. Er sah die riesigen Wellen vor sich, die das Segelschiff zerschmetterten.
So musste es auch der „Pamir“ ergangen sein, die unlängst im Atlantik gesunken war. In allen Zeitungen hatte das gestanden.
Was waren das für mutige Männer, die sich freiwillig solchen Gefahren aussetzten. Aber sie hatten meistens Glück, ihre Schiffe trugen sie in ferne Länder und Sindbad jedenfalls kehrte immer reich beschenkt zurück.
Er selbst war leider nicht so mutig, auch wenn die beiden kleinen Mädchen das glauben mochten. Zwar hatte er schon mit fünf Jahren im Freibad ‚Am Bäker’ schwimmen gelernt und seinen Freischwimmer gemacht, aber vom Drei-Meter-Brett war er gar nicht gern gesprungen. Es kitzelte so mordsmäßig im Bauch und man musste sich zusammennehmen, um in der Luft nicht zu schreien. Und im DLRG-Vordruck für den „Jugendschwimmschein“ stand es ja schwarz auf weiß: „Mutsprung aus 3 m Höhe“. –
Er ging jetzt in die vierte Klasse der Knabenschule und hatte gerade die eine Woche Probeunterricht hinter sich, die man erfolgreich absolvieren musste, wenn man auf das Gymnasium in der Moltkestrasse wechseln wollte.
Er sollte unbedingt dorthin, aber es war nicht alles erfolgreich verlaufen.
Einige schwere Matheaufgaben hatte er nicht gekonnt und die Gründe dafür neben den Aufgaben vermerkt, was wegen der Wortwahl Befremden hervorgerufen hatte. Und im Deutschunterricht war er nach Anfangserfolgen im Vorlesen übermütig geworden. Als die Lehrerin nach einem Satz mit „Widerstand“ fragte und wie man dies Wort schriebe, hatte er in die Klasse gerufen „Widerstand gegen den Staatsanwalt, nur mit ‚i’!“ Das klang ihm so plausibel, als habe er es schon oft gehört. Aber den nur halb amüsierten Nachfragen der Lehrerinnen zufolge musste es wohl doch irgendwie anders heißen. Da hatte er wahrscheinlich irgendwas verwechselt. Oder er hatte noch den Titel des Films im Kopf, den seine Eltern neulich im Schütting-Theater gesehen hatten: „Rosen für den Staatsanwalt“.
Alles in allem schienen die Lehrer netter als in der Volksschule. Viele Lehrerinnen hatten sie gehabt, was ja auch nur normal war, wenn man bedachte, dass die eine Hälfte der Klasse aus Mädchen bestand. In der Knabenschule gab es nur Jungen und keine einzige Lehrerin.
Einmal allerdings hätten sie auch dort vertretungsweise fast eine gehabt. Sie hätten eine Doppelstunde Malen bei ihr haben sollen.
Aber in der Stunde davor hatte ihr Klassenlehrer ihnen in höhnischem Ton erzählt, was diese neue Lehrerin mit ihnen vorhatte: Sie sollten sich alle vorstellen, dass sie im Wald in einer halbdunklen Höhle einen Schatz aus Edelsteinen und Gold finden würden. Und wie das blitzte und funkelte, das sollten sie malen!
Es hatte aber erst mal keiner gelacht - viele versuchten sich das vorzustellen und Hasso Remer, der Buntstifte besaß, hatte sogar begonnen, sie hervor zu kramen und zu malen angefangen. Der Lehrer wurde ärgerlich und forderte sie auf, das lächerlich zu finden. Das taten sie dann auch, denn Herrn Lehnsmann widersprach man besser nicht – dann konnte es leicht einige pfeifende Schläge mit dem Rohrstock in die nackten Handflächen geben, was richtig gemein weh tat.
Die Lehrerin kam dann aber doch nicht in die Knabenschule.–
Neu war auch, dass die Tage in der Windallee gezählt waren.
Die Eltern hatten ein Grundstück in einem Neubaugebiet gekauft. Dort sollte ein neues Haus gebaut werden.
Auf dem Baugrund am Stadtrand, einem alten Obstgarten, standen mannshoch die Brennnesseln zwischen Apfelbäumen und Rhabarberstauden. Ein Mann vom Beamtenheimstättenwerk war in der Windallee gewesen und hatte mit den Eltern im Wohnzimmer besprochen, wie das neue Haus aussehen sollte.
Achim hatte sich die Pläne kaum angeschaut, als er dazu aufgefordert wurde – ihm graute davor, dorthin zu ziehen. Er wollte nicht weg aus der Windallee in diese Brennnesselwildnis, wo gar keine Häuser standen und hinter der Leke das Moor bald begann. Der Wald mit den hohen Buchen und die Sandkuhle mit der riesigen Douglastanne, die Christian bis in die Spitze erklettert hatte, war auch weit weg. Wo sollte man im Winter rodeln?
Eine einzige schöne Stelle gab es, wenn man an ihrem neuen Eckgrundstück den löcherigen Sandweg, der rechtwinklig abknickte, weiter geradeaus ging. Dort schlängelte sich ein kleiner Bach mit grasbewachsenen Ufern unter Birken und Kastanien am Rande von Rosen-Doras Garten der Leke zu, in die er mündete.
Aber es half alles nichts. Jede freie Stunde verbrachten sie jetzt im verwilderten Garten der alten Frau Bischoff. Der hatte das ganze Land gehört, das jetzt nach und nach als Bauland verkauft wurde. Bald staken die winkligen Holzlatten im Boden und markierten die Lage des neuen Hauses.
Mutter war die fleißigste von allen. Unermüdlich grub sie in Gummistiefeln das Land um, rupfte Brennnesseln aus, legte Beete an und pflanzte Bohnen.
Achim schämte sich, weil er sich insgeheim lieber eine Mutter mit Seidenstrümpfen und Kostüm wünschte wie die anderen Jungen.
Vater machte inzwischen den Autoführerschein.
Eines Nachmittags rollte ein schneeweißer Taunus 17 M den Sandweg hinunter, und Vater stieg aus. Er hatte die Führerscheinprüfung bei der Fahrschule Kuchenbuch bestanden und sich bei der Autovermietung Bents den Wagen geliehen. Der stand jetzt häufiger vor dem Grundstück. Vaters uraltes Motorrad aus dem Krieg kam weniger zum Einsatz. Das sechseckige schwarze Nummernschild mit der Aufschrift „British Hamburg“ war lange abmontiert und innen an das neue hölzerne Garagentor geschraubt. Jetzt gab es wieder deutsche.
Das war natürlich etwas Besonderes, in diesem geräumigen Wagen zu sitzen. Vorn und hinten waren nagelneue weiße Nummernschilder angeschraubt: JEV- C 405. Zwar war Achim schon öfter einmal mit dem Sohn des Hoteliers Wollkamp aus der Windallee in dessen Taunus 15 M zum Pilzesuchen in den „Herrenneuen“ gefahren.
Aber dieser hier … drinnen roch es nach nagelneuem Auto, es gab rote Kunstledersitze, die weiß abgesetzt waren und das Armaturenbrett blinkte vor Chromeinfassungen, schwungvollen Schriftzügen und Kombiinstrumenten. Sogar ein Radio war da, und neben dem Radio ein schwarzer Knopf, den man hineindrücken konnte. Nach einer Weile sprang er mit leisem Klicken zurück, Achim zog ihn ganz heraus und sah in eine rotglühende Spirale. Als er das Ding zur Probe auf die weißen Kunstlederpolster drückte, zischte es leicht, roch stechend und dann war da ein scharf abgegrenzter schwarzer Ring. Noch drei weitere ineinanderfassende Kreise fügte er hinzu, so dass es genau so ein Emblem gab wie das DKW-Zeichen auf Vaters Motorrad.
Er hatte das unbestimmte Gefühl, er habe das Innere des Wagens aufgewertet, aber das wurde von Vater anders gesehen. Es gab das gewaltigste „Fellvoll“, das er jemals eingesteckt hatte. Schmerzhafter sogar als damals, als er aus seinem Bettlaken ein kleines Dreieck herausgeschnitten hatte, um Segel für sein selbstgebautes Rindenboot zu bekommen. Dabei fiel es gar nicht auf. Wenn man das Laken wieder unter die Matratze steckte, sah man das fehlende Dreieck gar nicht.
4.
Zwei Jahre wohnten sie jetzt schon nicht mehr in der Windallee, sondern im neuen Haus.
Es war groß, hässlich asymmetrisch und hatte kleine Zimmer.
Achim ging in die siebte Klasse des Gymnasiums, die „Quarta“ hieß.
Die Dinge standen nicht zum Besten dort. In Mathematik wurden seine Leistungen immer schlechter.
Er bekam Nachhilfeunterricht bei einem alten Oberstudienrat in der Friedrich-August-Straße zusammen mit einer frühreifen Zahnarzttochter, die Ines hieß. Sie hatte schon einen richtigen Busen und als sie eines Abends im Dunkeln an der Einmündung zur Lohstraße standen, eröffnete sie ihm, er stünde bei den Lehrern auf der „Abschussliste“. Das habe ihre Mutter gesagt.
Achim glaubte ihr sofort, er war nicht sehr überrascht. Er hatte schon zu viele Klassenbucheintragungen wegen unvollständiger Hausaufgaben und schlechten Benehmens bekommen. Die Lehrer, besonders sein neuer Mathematiklehrer, hatten sich auf ihn eingeschossen. In der Sexta und Quinta hatten sie einen netten Mathelehrer gehabt, bei dem er auch leidlich mitgekommen war, aber der war plötzlich verstorben.
Von den Sprechtagen kamen seine Eltern von Mal zu Mal mit sorgenvolleren Mienen heim. In Deutsch, Englisch und Französisch kam er zwar mit, aber dass sie ihren Mathematiklehrer auch noch in „Leibesübungen“ hatten, wirkte sich weiter verhängnisvoll aus… bei einem Waldlauf rund um die Sandkuhle hatte er unlängst mit noch zwei anderen Jungen die Strecke querfeldein abgekürzt. Aber genau dort, wo sie aus dem Wald sprangen, stand der gestrenge Oberstudienrat im Trainingsanzug, als habe er auf sie gewartet. Es wurde als unsportlicher Täuschungsversuch gewertet, was es ja auch war, und ins Klassenbuch eingetragen. Ihm wurde eröffnet, dass man nunmehr „Nägel mit Köpfen“ machen werde.
Zuhause, im neuen Haus, herrschte auch keine gute Stimmung.
Er war nicht gern dort und sehnte sich oft nach den Stunden in der Windallee zurück. Sein neues Zimmer zur Straßenseite war klein. Immer öfter lag er auf seinem Bett, hatte die Tür geschlossen und verschlang Bücher, eines nach dem andern. Christian und Eilert hatten noch kleinere Zimmer mit Dachschrägen im Obergeschoss. Ein Teil davon war vermietet an ein altes Ehepaar, bei denen es komisch roch.
Roger oder Hero Heyenga sah er so gut wie gar nicht mehr.
Christian war mit achtzehn schon aus dem Haus und kam nur noch auf Besuch, wenn er Urlaub hatte.
Vater kaufte zwar einen neuen schwarzen Mercedes mit roten Polstern, auf den er sehr stolz war, aber zwischen Mutter und ihm gab es immer öfter Streit. Sie hatte auch den Führerschein gemacht, nur fahren durfte sie nicht. Sie hatte jetzt oft heftige Rückenschmerzen. Deswegen kam seit einiger Zeit zweimal die Woche die lustige, tüchtige Frau Wagner aus der Jürgensstraße und half ihr beim Reinemachen.
Trotzdem hatte es unlängst eine ganz, ganz schlimme Szene gegeben, fand Achim. So etwas hatte er noch nie erlebt, die ganze Zeit in der Windallee nicht, obwohl sie sich gar nicht angeschrien hatten oder sonst irgendetwas Spektakuläres passiert war.
Mutter war seit einiger Zeit Mitglied in der Kantorei der Lütjehaver Schlosskirche und sang dort eine der Altstimmen.
Vater aber liebte es, Sonntagmorgens im Wohnzimmer Schallplatten mit Marschmusik aus seiner Zeit als „Spielmannszugführer“ aufzulegen, und neulich war es wieder soweit. Gerade als Vaters Lieblingsmarsch, der Badenweiler, mit großer Lautstärke lief, kam plötzlich Mutter aus der Haustür gestürzt. Sie presste die Hände fest auf die Ohren, und ihr Gesicht war schmerzlich verzerrt: „Ich halte es nicht mehr aus“, flüsterte sie halb zu sich, halb zu Achim gewandt, der draußen sein Fahrrad putzen musste. Dann war sie weggelaufen und erst abends wiedergekommen. Vater fragte, wo sie den ganzen Tag gewesen sei…
Es war, als seien sie Fremde und kannten einander gar nicht mehr.-
*
Eines Tages besuchten sie alle Christian, auf seinem Schiff.
Er hatte sich selbst nach der endlich überstandenen Schulzeit eine Lehrstelle auf der Jadewerft in Wilhelmshaven besorgt. Danach war er zur See gegangen. Er wollte Schiffsingenieur werden.
Jetzt fuhr er schon auf Großer Fahrt, und die „Ilse Schulte“ lag nur kurz im Hamburger Hafen, am Rosshöft.
Sie reisten mit Vaters Mercedes über die Autobahn nach Hamburg.
Achim saß auf der Rücksitzbank und versuchte in einem Buch zu lesen, das der Vater ihm dringend ans Herz gelegt hatte. Es hieß „Das glückhafte Schiff“ und handelte von den Fahrten eines mächtigen Schlachtschiffes.
Was sollte das sein – ein glückhaftes Schiff? Hieß es so, weil „Schiffe eine Seele hatten“, wie Vater einmal gesagt hatte? Oder waren die Seeleute, die auf diesem Schiff fahren durften, besonders glücklich - oder wurden es? Oder war das Schiff einfach nur „glückhaft“, weil es auf den stürmischen Ozeanen nicht unterging?
Achim schlug aufs Geratewohl eine Seite auf und begann zu lesen. Es war natürlich Krieg. Ein englischer „Hilfskreuzer“, der Frachtschiffe beschützen sollte, wurde von den deutschen Granaten versenkt. Dem britischen Kapitän war gleich zu Anfang bei einem Volltreffer in die Kommandobrücke ein Bein weggeschossen worden. Jetzt kroch er auf dem blutenden Stumpf zur Heckkanone seines Schiffes, das schon sank, und half seinen Männern zu laden, weil er hoffte, den „Admiral Scheer“ mit einem Zufallstreffer auf der Brücke zu treffen. Aber der blieb außer Reichweite und zerschoss den kleinen Hilfskreuzer mit seinen Riesenkanonen.
Es war eine von diesen typischen, wahnsinnigen Erwachsenensachen. Eine niederträchtige, ungerechte, tödliche Gemeinheit.
,Glückhaft’ war das Schiff aber deshalb, weil es auf den Ozeanen erfolgreich feindliche Handelsschiffe jagte und versenkte. Ab und zu kaperten sie ein Kühlschiff, dann hatten sie Millionen von Eiern und tonnenweise Fleisch. Wenn getankt werden musste, warteten sie auf einen feindlichen Tanker. Dann hatten sie eine „Prise“ genommen.
Und die britischen Zerstörer konnten es nicht kriegen. Ihre Wut auf das schnittige lange Schlachtschiff wuchs immer mehr. Sie nannten es „damned pocket - battleship“, Westentaschenkreuzer, weil ihre zwar größer, aber nicht so schnell waren und so weit fahren konnten. Sie hatten auch nur Zwillings-Kanonenrohre an den Türmen, sagte Vater, die „Admiral Scheer“ aber Drillingsrohre von Krupp und am Heck sogar ein Wasserflugzeug. Wenn die eigenen Geschütze eine Salve abfeuerten, schrien die Leichtmatrosen unter Deck, die neu an Bord waren, voll Entsetzen, weil sie glaubten, ihr eigenes Schiff sei getroffen.
Vater sagte aber, das wichtigste sei nicht die überlegene deutsche Technik, sondern die „Ethik“ des Kommandanten, der alle feindlichen Frachtschiffe als „Prise“ aufgebracht habe. Bevor er sie versenken ließ, sei stets die gesamte Besatzung gewarnt und mit den Booten geborgen worden. Nur funken durften sie nicht, dass sie überfallen wurden, weil ihnen sonst die ganze Welt gegen die Deutschen zu Hilfe gekommen wäre. Dann wurde sofort geschossen und versenkt. Aber auch dann wurden die Überlebenden aus dem Wasser gefischt.
Achim blätterte in dem Buch und betrachtete eine Fotografie. Ein Großadmiral in schwarzer Uniform schritt die in Reih und Glied angetretene Besatzung ab. Glücklich sah niemand aus, und ‚glückhaft’ schon gar nicht. Das war sowieso ein komisches Wort, das es eigentlich gar nicht gab. Der Admiral hatte ein glattes, regelmäßiges Gesicht wie ein Filmstar, trug einen prächtigen Säbel und hatte einen herrischen, hochmütigen Zug um den Mund.
Darunter war ein anderes Foto von dem englischen Kapitän eines Kühlschiffs. Das hieß „Mopan“, war gekapert worden und versank in einiger Entfernung gerade wie ein toter Wal im Meer. Dabei stieß es weiße Dampfwolken aus.
Er fand, dass dieser junge Kapitän, der mit steinerner Miene einen letzten Blick auf sein schönes Frachtschiff warf, Ähnlichkeit mit Onkel Dieter hatte. Nicht mit dem fröhlichen von früher, der ihn übermütig knuffte, sondern mit dem, den Vater zuletzt immer öfter besucht hatte.
Zwar stand inzwischen ein Ford 20 M mit sechs Zylindern auf der Auffahrt, Tante Lütsch hatte ein zweites Töchterchen bekommen, aber Onkel Dieter war ganz verändert. Er lachte nur noch bitter, hinkte schwer, ging am Stock und starrte verzweifelt vor sich hin. Und kurze Zeit später, an seinem Geburtstag, hatte er sich mit seiner Browning in den Mund geschossen.
Nur Vater war nach Hamburg zur Beerdigung gefahren. Tante Lütsch war mit den beiden Kindern und einem Mann nach Südafrika ausgewandert.
*
Vater parkte den Wagen hinter dem Freihafentor. Sie stiegen aus und legten die letzten paar hundert Meter zu Fuß zurück. Achim sah gelbe Masten über ein hohes Lagerhaus ragen, und dann bogen sie um die Ecke des Schuppens. Ein riesiger, graugrüner Frachter lag direkt vor ihnen. Haushoch schwang sich der Bug über ihren Köpfen und die Güterwaggons, die davor standen, wirkten wie Spielzeug.
Auf so einem Ozeanriesen Kapitän sein, dachte Achim.
Sie stiegen eine endlos lange Gangway hinauf an Deck. Dort stand ein Seemann als Hafenwache. Als Vater nach Christian fragte, führte er sie durch lange Gänge und Treppen tief hinunter zu einer kleinen Kabine. Er sagte, dass Christian noch arbeiten müsse und sie hier warten könnten.
Zögernd traten sie ein und sahen sich in dem Raum um. Achim sah sofort, dass Christian hier wohnte. Sein großer Bogen aus Eschenholz lehnte entspannt in einer Ecke der Kammer, neben der ungemachten Koje mit den dunkelroten Vorhängen, die man ganz zuziehen konnte. Daneben stand die zerlegte Angelrute aus Fiberglas.
Dann gab es noch ein Waschbecken, einen Tisch, auf dem Zeitschriften, Zigarettenpackungen, Aschenbecher und eine halbvolle Whiskyflasche herumlagen und -standen, und eine kleine Bank, die mit Kunstleder bezogen war. Mit einem elektrischen Ofen heizte man die Kabine. Durch zwei Bullaugen konnte man hinausschauen und sah, dass man sich dicht, ganz dicht über der Wasseroberfläche befand.
Wenn schwere Brecher das Schiff von der Seite trafen, musste man wohl die runden Stahldeckel dort herunterlassen und mit den dicken Messingschrauben zusätzlich sichern.
Auf der Sitzbank lag ein Köcher aus blauem Leder, der mit Ketten aus Krebsscheren, Muscheln und bunten Perlen verziert war. Die gefiederten Schäfte einiger Bambuspfeile lugten hervor. Als Achim einen vorsichtig herauszog, wies er eine schwere, grob geschmiedete Eisenspitze auf, die wie eine Lanze aussah und Widerhaken hatte.
Der Seemann, der sie hereingeführt hatte, steckte seinen Kopf durch die Tür. Eine Whiskyfahne wehte herein, als er Achim fragte, ob er die Maschine anschauen wolle.
Draußen auf dem Gang war es warm. Es roch nach heißem Metall, Öl und Schmierfett. Gedämpfte Rufe und entferntes Maschinendröhnen waren zu hören, jetzt ein metallisches Klirren. Schräg gegenüber öffnete der Mann im Gang eine andere Tür. Sofort wurde das Motorengeräusch lauter. Er hielt das schwere Schott auf, an dem rote Warntafeln angebracht waren, und winkte Achim heran. Der musste ein hohes Süll übersteigen und betrat zögernd ein Gitterrost, wo er gleich nach einem blinkenden Stahlgeländer griff und stocksteif stehenblieb. Er stand ganz oben wie auf einer Galerie in einem grell erleuchteten Raum, so groß wie ein Kirchenschiff. Es war heiß und stickig, die Wände waren überall hinter Bündeln von Rohrleitungen verborgen, und tief unter ihm sah man den Schiffsmotor.
Der Seemann berührte ihn am Arm, wies mit den Augen nach unten und zählte für Achim lautlos mit dem Zeigefinger die Zylinder mit den Ringen aus baumstammdicken Muttern durch: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann formte er beide Hände zu einem Trichter und brachte ihn an Achims Ohr: „Zwölftausend PS!“ rief er.
Und als der sich jetzt hinunterbeugte, konnte er zwei Männer in blauen Arbeitsanzügen sehen. Einer von ihnen war Christian. Er erkannte ihn am Gang und wie er sich zu dem anderen Mann beugte und ihm etwas ins Ohr rief. Überall lag Werkzeug herum. Sein Bruder nahm einen Maulschlüssel auf, fingerte ihn über eine Mutter an einer Leitung und zog sie fest.
Der Mann mit der Whiskyfahne schickte einen grellen Pfiff hinunter, und die beiden Gesichter blickten hoch.
Achim winkte zaghaft und starr vor Bewunderung hinunter, und sein Bruder grinste kurz und erkennend und winkte zurück. –
Später saßen sie zu viert in Christians Kammer. Ein Messejunge hatte Kaffee gemacht und brachte Tassen auf einem Tablett. Der nette Seemann, der Achim alles gezeigt hatte, versperrte von außen die Türöffnung und erzählte mehr als Christian. Der hatte ihm einen weiteren Whisky ausgegeben.
Das Schiff hatte eine Afrikareise hinter sich und fuhr jetzt nach Südamerika. Es war in der „wilden Fahrt“ eingesetzt. Das hieß, niemand von der Besatzung wusste, wohin die nächste Reise ging. Erst im letzten Moment bekam der Kapitän ein Telegramm von der Reederei, welcher Hafen es würde. Und dann konnte es genauso gut in Brasilien, Afrika oder China sein.
Die Ladung war in Bremen und Hamburg übernommen worden. Der letzte Teil musste aber noch in Antwerpen an Bord, bevor sie über den Atlantik fuhren.
Christian war gar nicht wiederzuerkennen. Er war ölverschmiert und erschöpft, aber selbstbewusst und erzählte, sie hätten noch einen Kolben ziehen müssen. Der sei ungefähr so groß, dass er gerade in diese Kammer passen würde. Jetzt sei die Maschine wieder klar.
Vater sagte: „Na, na“, aber Christian warf ihm nur einen vernichtenden Blick zu und sagte leise und bestimmt: „Davon hast du keine Ahnung, Vater“, und Vater grinste nur schief und schwieg. Schwieg!
Mutter hatte inzwischen schweren Herzens eine ganze Reisetasche mit schmutzigen Overalls und Wäsche eingepackt, um sie mitzunehmen und zu waschen. Aber Christian wies sie an, alles wieder auszupacken. Es bliebe keine Zeit, die Sachen müsste der Wäscher Max an Bord für ihn waschen. Sie würden heute abend noch auslaufen. Der Lotse sei schon bestellt.
Und genauso kam es. Ein lautes Zischen ertönte tief aus dem Bauch des Schiffes und ein Grummeln, als würde ein Riese rülpsen. Christian stand auf und sagte, dass sie jetzt von Bord gehen müssten. Sie verabschiedeten sich, Mutter weinte ein bisschen.
Dann gab Christian Achim den Köcher mit den Pfeilen. Er holte aus einem Spind einen ebenfalls mit blauem Leder bezogenen Bogen, der mit Fransen und Muscheln besetzt war und sagte leise, er solle lieber nicht zuviel damit schießen. Und er müsse ihn durch den Zoll schmuggeln.
Ein Mann mit einer öligen weißen Mütze schaute zur Kammertür herein und sagte:
„He geiht“, und als sie die Treppen hinaufgestiegen waren, an Deck standen und nach der Gangway suchten, schien Achim grell die Toplaterne vom Mast eines kleinen Schiffes ins Gesicht. Die Schlepper hatten sich schon längsseits an den Frachter gelegt. Sie warteten darauf, dass die „Ilse Schulte“ die Leinen loswarf und sie in dem engen Hafenbecken herumgedreht werden konnte, bevor sie mit dem Ebbstrom die Elbe hinunterlief, der Nordsee zu.-
5.
Achim stellte sein Rad in den Fahrradständer hinterm Haus und riss unsanft die schwere Tasche vom Gepäckträger.
Heute war ein besonders niederschmetternder Tag in der Schule gewesen. Und dabei war Hansopa aus Hamburg zu Besuch!
Zuerst hatten sie eine Mathearbeit wiederbekommen. Er hatte fest geglaubt, diesmal wenigstens eine drei zu haben. Aber es war wieder eine fünf. Er hatte das Heft ohne es anzuschauen in die Schultasche gesteckt.
Dann hatte Herr Grohe, der Französischlehrer, seine kostbare neue Single entdeckt und „konfisziert“. Die erste Schallplatte, die er sich selbst von seinem Taschengeld gekauft hatte, wenn auch verbotenerweise. Gerade als er sie seinem Banknachbarn zeigte und der elegante van Grieken „traumhaft“ gesagt hatte, war der Oberstudienrat stocksteif wie immer zur Tür hereingekommen, war schnurstracks zu ihrem Tisch geschritten und hatte zielstrebig den gelben Papierumschlag, in dem die Vinylscheibe steckte, an sich genommen. Er nahm ihn mit spitzen Fingern, warf den Kopf in den Nacken und fixierte den Aufdruck am ausgestreckten Arm durch seine Brille.
„Unglaublich“, murmelte er kopfschüttelnd, und noch einmal:
„Unglaublich“.
- “Eric Burdon and – The Animals! Les Animaux, non?“ höhnte er schneidend, wandte sich um und stieg krachenden Schrittes den hohen Absatz zum Pult hinauf, während er die Hülle wie eine Frisbeescheibe vorwegschleuderte, dass sie übers Pult glitschte und auf der anderen Seite herunterfiel. Achim hoffte inbrünstig, dass er noch mehr Witze über den Namen machen würde, dann wäre es nicht so schlimm. Aber Herr Grohe war schwer berechenbar.