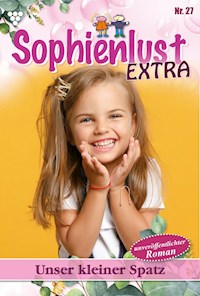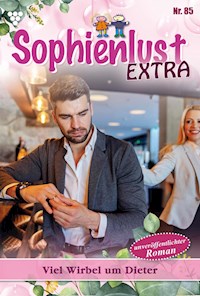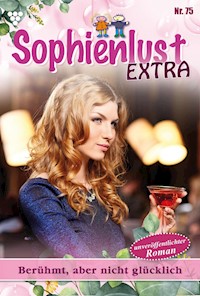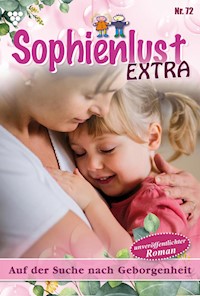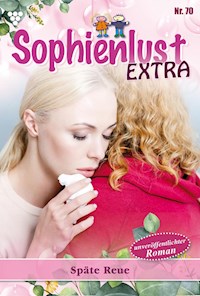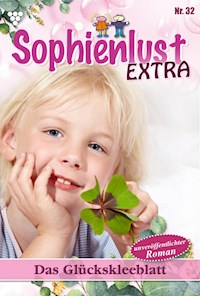
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sophienlust Extra
- Sprache: Deutsch
In diesen warmherzigen Romanen der beliebten, erfolgreichen Sophienlust-Serie ist Denise überall im Einsatz. Denise hat inzwischen aus Sophienlust einen fast paradiesischen Ort der Idylle geformt, aber immer wieder wird diese Heimat schenkende Einrichtung auf eine Zerreißprobe gestellt. Doch auf Denise ist Verlass. In der Reihe Sophienlust Extra werden die schönsten Romane dieser wundervollen Erfolgsserie veröffentlicht. Warmherzig, zu Tränen rührend erzählt von der großen Schriftstellerin Patricia Vandenberg. Sie kamen von einer Hochzeit in Stuttgart. Ein Studienfreund hatte sie eingeladen. Nach dem Mittagessen war ein dringender Anruf gekommen, der Dr. Frank Durand in seine Rechtsanwaltspraxis nach Frankfurt zurückgerufen hatte. Frank hatte dem Klienten versprochen, um sechs Uhr für ihn zur Verfügung zu stehen. Der Klient war ein wichtiger Mann, und Frank lag viel an seiner Karriere. Barbara und Frank hatten sich um vier Uhr von den Freunden verabschiedet. Am meisten hatte Dr. Thomas Calder den verfrühten Aufbruch bedauert. Er hatte sich Barbara als Tischdame ausgebeten und war nicht von ihrer Seite gewichen. Barbara wusste, dass Thomas, der in ihren Kreisen als der hartnäckigste Junggeselle galt, sie liebte. Sie aber war ihrem Mann, dem sie zwei Kinder geschenkt hatte, ganz ergeben. Kurz nach Maibach war es dann geschehen. Blitze zuckten in diesem Augenblick über den Himmel, Donner grollten, Dämmerlicht herrschte. Frank beschleunigte sein Tempo und knurrte: »Hoffentlich schaffen wir es bis Sechs!« Er beugte sich über das Steuerrad und trat das Gaspedal durch. Barbara sah die Schweißtropfen auf seiner Stirn, die zuckende Schläfenader. Er hatte getrunken, wie sie auch. Vergeblich hatte sie ihn gebeten, den Zug zu nehmen. Um ihn jetzt nicht wieder zu reizen, mahnte sie vorsichtig: »Denke an den Sekt, den wir getrunken haben, Frank.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 158
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sophienlust Extra – 32 –Das Glückskleeblatt
Ein dramatisches Ereignis droht eine Familie auseinanderzureißen
Gert Rothberg
Sie kamen von einer Hochzeit in Stuttgart. Ein Studienfreund hatte sie eingeladen. Nach dem Mittagessen war ein dringender Anruf gekommen, der Dr. Frank Durand in seine Rechtsanwaltspraxis nach Frankfurt zurückgerufen hatte. Frank hatte dem Klienten versprochen, um sechs Uhr für ihn zur Verfügung zu stehen. Der Klient war ein wichtiger Mann, und Frank lag viel an seiner Karriere.
Barbara und Frank hatten sich um vier Uhr von den Freunden verabschiedet. Am meisten hatte Dr. Thomas Calder den verfrühten Aufbruch bedauert. Er hatte sich Barbara als Tischdame ausgebeten und war nicht von ihrer Seite gewichen.
Barbara wusste, dass Thomas, der in ihren Kreisen als der hartnäckigste Junggeselle galt, sie liebte. Sie aber war ihrem Mann, dem sie zwei Kinder geschenkt hatte, ganz ergeben.
Kurz nach Maibach war es dann geschehen. Blitze zuckten in diesem Augenblick über den Himmel, Donner grollten, Dämmerlicht herrschte. Frank beschleunigte sein Tempo und knurrte: »Hoffentlich schaffen wir es bis Sechs!« Er beugte sich über das Steuerrad und trat das Gaspedal durch.
Barbara sah die Schweißtropfen auf seiner Stirn, die zuckende Schläfenader. Er hatte getrunken, wie sie auch. Vergeblich hatte sie ihn gebeten, den Zug zu nehmen. Um ihn jetzt nicht wieder zu reizen, mahnte sie vorsichtig: »Denke an den Sekt, den wir getrunken haben, Frank. Könntest du nicht ein wenig langsamer …«
In diesem Moment geschah es. Wie ein Geist tauchte plötzlich ein blondes Mädchen vor dem Kühler auf. Ein Krachen, ein Schrei! Der Wagen schleuderte, Barbara spürte schmerzhaft den Druck des Sicherheitsgurtes auf ihrer Brust. Und dann schrie sie: »Halte an! Das Kind!«
»Schweig!«, zischte Frank und bog von der Straße ab in einen Feldweg. Der Wagen holperte über Schlaglöcher, ratterte über Steine.
Barbara streckte das Bein aus, um auf die Bremse zu treten. Doch Frank stieß sie weg. »Lass das! Sollen wir auch noch verunglücken?«
Sie griff in das Steuerrad. Abermals schleuderte der Wagen. Wieder erhielt sie einen Stoß und einen Seitenblick, so fürchterlich, dass ihr das Blut in den Adern gerann. »Sie würden mich jahrelang einsperren, wenn sie mich erwischten«, zischte Frank.
»Das Kind«, stöhnte Barbara und schlug die Hände vor das Gesicht. »Das Mädchen! Es war ungefähr so alt wie unsere Erika.« Sie zerrte an seinem Arm. »Halt an! Wir müssen uns um das Kind kümmern. Es war so blond wie unser Liebling. Bedenke doch, wenn Erika etwas so Entsetzliches zustoßen würde, Frank. Bitte, bitte …«
Er unterbrach sie. »Gerade weil ich an unsere Kinder denke, muss ich weg. Es ist zu spät, um umzukehren. Ein Rechtsanwalt, der Fahrerflucht begeht! Ich wäre erledigt, und ihr mit mir.«
Sie erreichten die Autobahn, rasten dahin. Blitze stießen auf die Erde herab, Donnerschläge knallten hinterher. Barbara empfand es wie eine tödliche Drohung. Ihr war, als hielte die Natur den Atem an – wie sie selbst. Erst als Wind aufkam, Regen herabrauschte, fühlte sie sich wie von einem unerträglichen seelischen Druck erlöst.
»Der Regen wird die Reifenspuren verwischen«, knurrte Frank und beugte sich noch tiefer über das Steuerrad.
»Wenn jemand sich unsere Wagennummer gemerkt hat, Frank?«
»Hast du Leute gesehen?«
Barbara verneinte.
»Na also!«
»Dann liegt das Kind hilflos auf der Straße!«, schrie sie. Wieder presste sie die Hände auf die Lippen, um den Schrei zurückzuhalten, der aus ihr herausbrechen wollte.
»Die Straße ist viel befahren. Schweig’ jetzt! Ich muss mich konzentrieren.«
Die Räder surrten. Asphaltgeruch erfüllte den Wagen. Das Gewitter zog ab. Als sie in Frankfurt einfuhren, durchbrachen bereits einzelne Sonnenstrahlen die Wolken und vergoldeten deren Ränder.
Frank fuhr den Wagen in die Garage. Barbara eilte in das Haus, fuhr mit dem Lift in den vierten Stock hinauf, klingelte und hörte Erikas Stimmchen: »Mutti kommt! Vati kommt! Schließen Sie doch auf, Hanni.«
Das Dienstmädchen öffnete. Barbara rannte an Hanni vorbei, riss Erika in ihre Arme. Dann kam Bernd aus dem Wohnzimmer, mit seinem Traktor in der Hand. Er ließ ihn fallen und warf sich an die Brust der Mutter. Barbara umfing ihre Kinder mit beiden Armen, küsste die blonden Haarschöpfe und weinte, weinte.
»Warum weinst du denn, Mutti?«
»Weil ich so glücklich bin, dass ihr gesund seid und dass ich wieder bei euch bin, meine Lieblinge.«
Hanni, die dreißigjährige Hausgehilfin, schüttelte heimlich den Kopf. Warum stellte sich Frau Durand so an? Weil sie einmal einen Tag lang ihre Kinder hatte vermissen müssen?
Ihre Sorgen möchte ich haben, dachte Hanni und half Barbara beim Ausziehen des nassen Mantels. Später, als sie von dem Kriminalrat verhört wurde, konnte sie sich nur noch daran erinnern, dass der Mantel von Frau Durand nass gewesen war. Von den Tränen schwieg sie.
Die Kinder hörten den Vater aus dem Lift treten. Sie sprangen ihm entgegen.
Dr. Frank Durand küsste die beiden auf die Wangen, schob sie aber danach gleich von sich. »Später! Ich muss hinunter in das Büro. Ich erwarte einen Klienten. Hanni, kümmern Sie sich bitte um meine Frau. Der Tag war sehr anstrengend für sie!«
Barbara wich seinem Blick aus. Sie saß im Sessel im Wohnzimmer, starrte aus dem Fenster und wirkte wie eine Statue. »Nimm dich zusammen«, zischte er ihr ins Ohr. Dann verließ er eilig die Wohnung.
Das Anwaltsbüro lag im ersten Stock des Hauses. Die Sekretärin empfing ihn mit den Worten: »Pünktlich wie immer, Herr Rechtsanwalt. Direktor Scheuer ist soeben angekommen. Er erwartet Sie!«
»Danke, Frau Stark. Ich möchte nicht gestört werden.« Frank Durand verschwand hinter der gepolsterten Tür seines Privatbüros.
Die Sekretärin schaute ihm nachdenklich nach. Ob er zu viel gegessen und getrunken hat?, überlegte sie. So käsig hat er noch nie ausgesehen. Dem Kriminalrat sagte sie später, dass ihr Chef wie immer gewesen sei. Ruhig, überlegen, liebenswürdig! Sie verehrte ihn und beneidete seine Frau, die ihrer Meinung nach einen so attraktiven und angesehenen Mann nicht verdiente.
Direktor Scheuer aber war zu sehr mit seinen eigenen Problemen beschäftigt, um das kränkliche Aussehen seines Anwaltes zu bemerken.
Währenddessen saß Barbara Durand noch immer im Wohnzimmer. Neben ihr spielten die Kinder. Hanni hatte den Auftrag des Rechtsanwaltes ernst genommen und bedrängte Barbara mit Fragen. »Soll ich Ihnen einen starken Kaffee machen? Oder brauchen Sie eine Kopfschmerztablette? Soll ich Ihnen ein Bad einlaufen lassen?«
»Ich bin erschöpft, Hanni. Lassen Sie mich bitte mit den Kindern allein.«
Das Mädchen zog sich beleidigt in die Küche zurück, um das Abendessen zuzubereiten. Barbara aber sah ihre Kinder an. Die beiden ähnelten sich, und doch glich Erika mit ihrem schmalen Gesichtchen mehr dem Vater, Bernd mit seinen runden Wangen und dem kürzeren Näschen, dagegen ihr. Beide hatten die blauen Augen von ihr geerbt und das blonde Haar. Beide waren so blond wie jenes Kind auf der Straße hinter Maibach. Ist es verletzt?, fragte sich Barbara. Ist es tot? Muss es leiden? Weint eine Mutter um ihre Tochter? Verflucht sie vielleicht den verbrecherischen Fahrer, der das Kind hilflos hat liegenlassen? Suchte ein von Kummer und Zorn erfüllter Vater nach dem Mörder seiner Tochter?
Barbaras Gesicht blieb ausdruckslos. In ihrer Seele aber tobte ein Sturm. Sie wusste nicht, wie sie weiterleben sollte mit dieser Gewissensnot. Der Anblick der Kinder, die fröhlich lachten und sich wie gewohnt stritten, gab ihr jedoch wenigstens die Kraft, ihre Seelenpein zu verbergen. Ihre Augen blieben trocken. Ihr Herz aber weinte um das fremde blonde Kind.
*
Ebenso wie Barbara Durand nahm sich auch Dr. Anja Frey zusammen, als sie, in einen sterilen weißen Mantel gehüllt, die Maske vor dem Gesicht, den Operationssaal betrat und Heidi Holsten bewusstlos auf dem Operationstisch liegen sah.
»Wir haben Sie rufen lassen, Kollegin, weil Sie an diesem Kind besonderes Interesse haben«, murmelte der
Chirurg des Maibacher Krankenhauses. Dabei arbeitete er konzentriert weiter. Die Schlagaderblutung am Hals hatte er bereits mit einer Klemme zum Stillstand gebracht. Der erste lebensbedrohliche Schock war bekämpft worden. Nun bekam das Kind eine Bluttransfusion. Man hatte schwere innere Verletzungen festgestellt und einen doppelten Bruch des rechten Beines. Am Oberschenkel und am Schienbein. Die Brüche waren offen.
»Über die inneren Verletzungen konnten wir uns noch kein genaues Bild machen, Kollegin. Wahrscheinlich werden wir operieren müssen.«
»Heidi schwebt also nicht in Lebensgefahr?«, flüsterte Anja Frey und schaute schmerzerfüllt auf das verletzte Kind. Heidis Gesichtchen war wie aus gelbem Wachs geformt, das blonde Haar war blutverschmiert.
»Das können wir noch nicht sagen, Kollegin. Viel Hoffnung habe ich allerdings nicht. Hat die Kleine Angehörige? Sie müssen benachrichtigt werden.«
»Sie ist ein Waisenkind, das Frau von Schoenecker in das Kinderheim Sophienlust aufgenommen hat. Sie und die Kinder dort sind Heidis Familie.«
»Dann verständigen Sie bitte Frau von Schoenecker.« Der Chirurg winkte ihr und verließ mit ihr zusammen den Operationssaal. »Mehr kann ich im Moment nicht tun. Wir müssen die Reaktion auf die erste Behandlung abwarten. Was wissen Sie von dem Unfall? Hat man den Verbrecher erwischt?«
»Nein! Bis jetzt noch nicht, Herr Professor«, seufzte Anja Frey. »Ich weiß selbst nur das, was mir Schwester Regine in der Aufregung berichten konnte. Die Kinder waren mit ihr bei einer Zirkusvorstellung. Sie marschierten im Gänsemarsch auf dem Feldweg neben der Straße nach Maibach, um von dort von einem der Sophienluster Omnibusse nach Hause gefahren zu werden. Ein starkes Gewitter zog auf. Deshalb beeilten sie sich, um die Stadt noch vor dem Regen zu erreichen. Plötzlich rannte Heidi auf die Straße und direkt vor den Wagen.« »Warum?«
»Auch die Schwester weiß es nicht. Pünktchen, ebenfalls ein Sophienluster Mädchen, das am Schluss der Reihe marschierte, hörte Heidi rufen: ›Das muss ein Kätzchen sein!‹ Und dann ist die Kleine blindlings losgerannt.«
»Wie alt ist Heidi?«
»Vier Jahre. Vielleicht haben Sie von der Tragödie der Eltern gehört. Der Vater war Morphinist und hat die Mutter, die sich von ihm getrennt hatte und in einer Apotheke arbeitete, erschossen, weil sie ihm kein Rauschgift geben wollte. So blieb Heidi allein. Sie ist unser aller Liebling. Schwester Regine macht sich heftige Vorwürfe, aber meiner Meinung nach trifft sie keine Schuld.«
»Sie kann die Kinder ja nicht an einer Kette spazieren führen wie Sträflinge. Hat jemand sich die Nummer des flüchtenden Wagens gemerkt?«
»Wie mir Schwester Regine sagte, jagten die Wolken so tief am Himmel dahin, dass Dämmerlicht herrschte. Sie weiß nur, dass es ein Frankfurter Mercedes war, mit den Buchstaben RM. Die ersten Zahlen waren vier und fünf. Es war ein blauer Wagen. Schwester Regine hat zwei Menschen bemerkt, schattenhaft nur, und weiß nicht, ob es ein Paar war oder zwei Männer oder zwei Frauen. Sie hat alles bereits der Polizei gemeldet.«
»Dann müssen wir uns in Geduld üben.«
»Es wird uns allen sehr schwerfallen, Herr Professor. Heidi ist unser aller Sonnenschein. Wie Sie wissen, bin ich Hausärztin im Kinderheim Sophienlust.« Dr. Anja Frey stand auf. Sie war eine große schlanke Frau mit hochgestecktem mittelblondem Haar und dunkelbraunen Augen, in denen der Schmerz um das schwerverletzte Kind stand. »Ich will nach Sophienlust fahren und mit Frau von Schoenecker sprechen.« Bittend fügte sie hinzu: »Sie benachrichtigen mich doch sofort, falls sich Heidis Zustand verschlechtern sollte?«
»Selbstverständlich, Kollegin. Sie können auch jederzeit anrufen.«
Die junge Ärztin ging zu ihrem kleinen Wagen und fuhr nach Sophienlust. Auf der Freitreppe des ehemaligen Gutshauses drängten sich die Kinder. Schweigend schauten sie ihr entgegen, flehend, fragend.
Anja Frey bemühte sich um ein beruhigendes Lächeln, das auf die Kinder wie eine Erlösung zu wirken schien. »Heidi lebt also! Sie wird gesund, Frau Doktor?«, fragte Pünktchen.
»Wir alle hoffen es. Nun lasst mich durch. Frau von Schoenecker erwartet mich.«
Die Kinder traten zur Seite.
Denise von Schoenecker erwartete die Ärztin in ihrem Salon und ging ihr mit ausgestreckten Händen entgegen. Sie war so groß wie Anja Frey und so schlank. Aber ihr Haar war tiefschwarz, ihre Augen sehr groß. Doch in diesem Moment waren sie nicht so strahlend wie sonst, sondern von Angst und Kummer verschattet. »Wie geht es Heidi?«, fragte sie.
Anja Frey berichtete. Denise von Schoenecker unterbrach sie mit keinem Wort. Sie hielt die schmale langen Hände im Schoß verkrampft. »Ich werde keine Ruhe mehr finden, bis ich den Verbrecher gefunden habe, der das verletzte Kind hilflos liegenließ und sich aus dem Staub machte. Wer es auch sein mag!«, rief sie heftig, als die Ärztin schwieg. Nach einer Weile fügte sie noch hinzu: »Ich habe noch eine Bitte an Sie, Frau Doktor.« »Ja?«
»Sie wissen, ich halte nicht viel von den modernen Beruhigungsmitteln, die uns Menschen das Ertragen des Leides erleichtern sollen. Aber Schwester Regine ist so außer sich und macht sich solche Vorwürfe, dass ich Ihnen doch zu überlegen geben möchte, wie Sie ihr helfen könnten. Sie wissen, Schwester Regine hat ein sehr starkes Pflichtbewusstsein. Außerdem ist sie in diesem Fall besonders betroffen, denn sie hat in Heidi nach dem Tod ihrer Tochter immer ein wenig ihr eigenes Kind gesehen, das genauso alt wie Heidi wäre.«
»Ich gehe zu ihr. Wo ist Schwester Regine?«
»In ihrem Zimmer. Ich habe sie zu Bett geschickt. Frau Rennert ist bei ihr.«
Anja Frey setzte sich an das Bett der Kinderschwester, nachdem sie Frau Rennert, die von den Kindern »Tante Ma«, genannt wurde, hinausgeschickt hatte.
Schwester Regine drückte den blonden Kopf in die Kissen. Ihre Schultern zuckten. Sehr sanft sagte die Ärztin: »Schwester Regine, Sie brauchen sich keine Vorwürfe zu machen. Noch nie haben Sie Ihre Pflichten versäumt. Wir alle kennen Sie! Das Schicksal schlägt manchmal zu, und wir erkennen erst hinterher, warum der Herrgott uns dieses oder jenes Leid auferlegt hat. Sie tun Heidi keinen Gefallen, wenn Sie sich mit Schuldgefühlen belasten und krank machen.«
»Sie lebt also noch?«
»Natürlich!« Die Ärztin gab sich hoffnungsvoller, als ihr zumute war. Aber sie musste die Schwester beruhigen. »Wir haben allen Grund dazu, an Heidis Genesung zu glauben. Das Kind wird Sie noch sehr brauchen, Schwester Regine.«
»Als ich sie so auf der Straße liegen sah und sie dann aufnahm, glaubte ich, meine Elke auf dem Arm zu halten. Ich habe mein Kind verloren. Ich kann nicht auch noch Heidi hergeben. Ich würde am Herrgott zu zweifeln beginnen.«
Da ertönte die Stimme Denise von Schoeneckers von der Tür her. »Zweifel an den Menschen sind erlaubt, aber nicht am Herrgott, Schwester!« Ihre Stimme war gütig, aber auch sehr nachdrücklich. Sie verständigte sich mit einem Blick mit der Ärztin, ging zum Bett, streichelte Schwester Regines blondes Haar. »Sie dürfen uns nicht krank werden, Regine. Wir alle brauchen Sie so sehr. Die Kinder sind in Sorge um Sie!«
»Das darf nicht sein. Die Kleinen haben genug Kummer um Heidi. Ich will aufstehen und mich zusammennehmen.«
Schwester Regine riss sich um der Sophienluster Kinder willen zusammen. Sie kleidete sich an und erschien mit einem kleinen Lächeln um den Mund im Wintergarten, wo alle Kinder um den Papagei Habakuk versammelt waren. »Es ist Zeit zum Abendessen«, sagte sie freundlich. »Geht euch die Hände waschen.«
Die Kinder gehorchten widerspruchslos. Doch bei Tisch war es diesmal viel stiller als sonst. Kein Lachen klang auf, kein Streit brach aus. Aber manche stille Träne floss.
*
In Frankfurt lachte Barbara Durand mit ihren Kindern Erika und Bernd beim Essen. Aber es war ein Lachen der Verzweiflung. Ihr Mann hatte sich damit entschuldigen lassen, dass er mit Direktor Scheuer auswärts speisen müsse. Barbara wusste, dass er sie mied. Sie brachte die Kinder nach dem Abendbrot zu Bett und las ihnen noch das Märchen »Das Sandmännchen kommt«, vor.
Als sie am Ende der Geschichte an gelangt war, klappte sie das Buch zu, stand auf, küsste die Kinder auf die Nasenspitzen und ließ die Rollläden vor den Fenstern herunter. »Nun schlaft!«
»O Mutti, sing uns noch das Lied vom herzigen Veilchen«, bat Erika.
Bernd, nur ein Jahr älter als seine Schwester, hänselte sofort: »Du willst das Lied nur deshalb immerzu hören, weil einmal jemand gesagt hat, du hättest Veilchenaugen. Ich hab’ sie aber auch, und sie sind viel größer als deine. Auch Mutti hat Veilchenaugen.«
»Eben! Darum will ich ja das Lied so gern hören. Bitte, Mutti, sing’ es mir vor. Du hast uns den ganzen Tag mit Hanni allein gelassen. Mach’ mir doch jetzt die Freude!«
»Es ist ein trauriges Lied, Erika. Das Veilchen wird doch zertreten.«
»Aber es freut sich, weil es die Schäferin ist, die es mit ihren kleinen Füßchen tottritt, Mutti. Bitte, sing’ das Lied!«
Tottreten! Totfahren! Zwar ist es nur ein Veilchen, aber ein Kind ist so zart und hilflos und allen Winden ausgesetzt wie ein Veilchen, dachte Barbara. Es war ein blondes Kind! Sicher hat es blaue Augen gehabt wie meine zwei hier in ihren Betten. Wo mag es jetzt sein, das kleine Mädchen? Ist es schon steif und starr oder lebt es noch und leidet Schmerzen?
Die Gedanken stürmten auf Barbara Durand ein. Sie flüchtete aus dem Kinderzimmer und hörte Erika schluchzen: »Mutti ist so seltsam heute. Ich glaube, sie hat uns nicht mehr lieb, Bernd.«
Barbara lehnte an der Wand im Flur. Ich darf nicht seltsam wirken, überlegte sie. Die Kinder dürfen nichts erfahren. Um ihretwillen muss ich schweigen. Ich muss mich zusammennehmen, als sei nichts geschehen, obwohl eine Welt für mich zusammengebrochen ist. Doch die Welt der Kinder muss heil bleiben. Sie sind unschuldig! Meine Erika darf nicht meinetwegen weinen. Ich ertrage das nicht!
Barbara stieß sich von der Wand ab. Hielt sich am Türstock fest und betrat schließlich wieder das Zimmer. Sie knipste das Licht an, löschte es aber sogleich wieder. Die Kinder sollten nicht ihr Gesicht sehen.
Und dann begann sie mit ihrer süßen Sopranstimme zu singen. Ihr selbst aber kam ihre Stimme blechern vor:
»Ein Veilchen auf der Wiese stand, gebückt in sich und unbekannt: es war ein herziges Veilchen. Da kam eine junge Schäferin mit leichtem Schritt und munterem Sinn die Wiese daher und sang.
Ach, denkt das Veilchen, wär’ ich nur die schönste Blume der Natur, ach, nur ein kleines Weilchen, bis mich das Liebchen abgepflückt und an den Busen matt gedrückt, ach nur, ach nur ein Viertelstündchen lang.
Ach, aber ach! Das Mädchen kam, und nicht in acht es das Veilchen nahm, es zertrat das arme Veilchen. Es sank und starb und freut’ sich noch: und sterb’ ich denn, so sterb’ ich doch’ durch sie, durch sie, zu ihren Füßen doch.
Das arme Veilchen! Es war ein herziges Veilchen!«
Barbaras Stimme war immer leiser geworden. Den Schluss hatte sie nur noch gehaucht.
»Aber warum weinst du denn, Mutti? Das Veilchen ist doch glücklich gestorben«, meinte Erika.
»Ich finde es einfach dumm, deswegen zu heulen, Mutti«, kritisierte Bernd. »Die Blumen müssen doch alle welken und sterben. Die Tiere auch. Denke doch nur an unseren Hansi. Plötzlich lag er tot im Käfig.«
Auch wir Menschen müssen sterben, dachte Barbara und wischte sich die Tränen aus den Augenwinkeln. Auch das blonde Mädchen hätte einmal sterben müssen. Ist es so wichtig, ob es jetzt schon vom Tod ereilt wird oder erst dann, wenn es alt ist?
Barbara erschrak vor ihren eigenen Gedanken. Sie drückte die Kinder heftig an sich und sagte noch einmal: »Gute Nacht! Aber jetzt wird geschlafen!«, dann ging sie hinaus und zog die Tür hinter sich ins Schloss. Zugleich zuckte sie zusammen. Frank stand in der Diele, den Kopf an den am Haken hängenden Mantel gepresst. Seine Schultern zuckten.