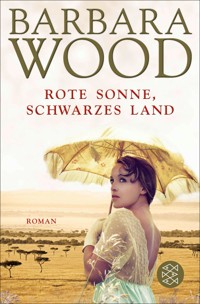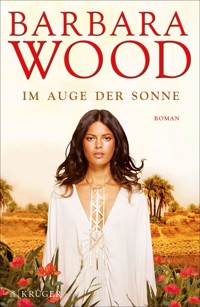9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kalifornische Sonne, üppige Weinberge und eine junge Frau, die um ihr Erbe kämpft – der große Generationenroman von Bestsellerautorin Barbara Wood. Die Schaller-Weingüter sind legendär im Weinland Kalifornien. Aber jetzt steht Nicole, Urenkelin der Gründer, finanziell unter Druck. Als dann noch in einem Weinkeller ein Skelett entdeckt wird, droht sie alles zu verlieren. Sie macht sich auf Spurensuche in die Vergangenheit... Ein Jahrhundert zuvor: 1912 bauen die Schallers, Winzer aus Deutschland, ihr neues Leben in Kalifornien auf. Schnell sind die Brüder Wilhelm und Johann erfolgreich. Doch als klar wird, dass Wilhelms junge Frau Clara eigentlich Johann liebt, entzweien sich die Brüder in tödlichem Hass. Der Riss, der durch die Familie geht, wird das Schicksal dreier Generationen bestimmen. Ein mitreißender Roman über einen schicksalhaften Familienzwist und die Liebe, die Versöhnung bringt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Leseprobe zu:
Barbara Wood
Das goldene Tal
Roman
Aus dem Amerikanischen von Veronica Cordes
FISCHER E-Books
Erfahren Sie mehr unter: www.fischerverlage.de
Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung von Text und Bildern, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Übersetzung oder die Verwendung in elektronischen Systemen.
© S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Inhalt
Prolog
»Tut mir leid, Daddy.« Liebevoll strich Nicole über die zarten Beeren, die sich zu Trauben an den Rebstöcken ballten. »Aber es muss sein. Ich kann nicht länger hierbleiben. Ich muss weg. Dafür verspreche ich dir, nur an Leute zu verkaufen, die unser Weingut genauso gut bewirtschaften werden wie wir.«
Sie wusste nicht, ob Big Jack sie hören konnte. Er war letztes Jahr gestorben, aber Nicole stellte sich vor, dass sein Geist noch hier weilte, unter diesem blauen Himmel und zwischen diesen grünen Rebstöcken voll praller Trauben. »Der Entschluss ist mir nicht leichtgefallen«, sagte sie, während der Wind mit ihrem schulterlangen Haar spielte. »Aber es muss sein, ich muss meinen eigenen Weg finden. Es fällt mir unendlich schwer, alles hier zurückzulassen, aber ich will selbst etwas schaffen, nicht nur ein Erbe übernehmen. Ich habe mir das lange überlegt, Daddy. Versteh mich bitte nicht falsch. Ich liebe dieses Weingut, und ich liebe dieses Tal. Aber der Wunsch, meinen eigenen Weg zu gehen, ist stärker.«
Bedrückt blickte sie zum Himmel, an dem ein Habicht seine Kreise zog. Wie gern hätte sie sich zu ihm emporgeschwungen. Sie dachte daran, wie ihr der Vater früher, als sie noch klein war, erlaubt hatte, ihm Rasierschaum auf Backen und Kinn zu verteilen, und dann gemeint hatte, sie verstünde sich darauf besser als der beste Barbier. Wie gern hatte sie mit baumelnden Beinen am Rand des Waschbeckens gesessen und dem Vater beim Rasieren zugeschaut!
Vor einem Jahr war er gestorben – dabei schien es erst gestern gewesen zu sein, dass sie zusammen durch die Rebstockreihen geschlendert waren und dabei über die Weinlese gesprochen hatten.
Aus den Trauben der Schallers wurde vor allem Wein gekeltert, aber dieser Weinberg hier trug Tafeltrauben, mit denen Obsthändler beliefert wurden. Die Trauben der Schallers waren begehrt, weil sie besonders süß waren. Käufer schätzten es nicht, wenn im Laden Trauben angeboten wurden, die reif und saftig aussahen, sich zu Hause dann aber als sauer herausstellten. Wie konnte es sein, dass Obsthändler sich so etwas erlaubten? Die Antwort lautete: Die mindere Qualität nahm bereits im Weinberg ihren Anfang.
Viele der kleinen Weinbauern ernteten nämlich ihre Trauben schon, wenn sie nur scheinbar reif waren, und nicht erst dann, wenn sie das Höchstmaß an Süße und Geschmack aufwiesen. Nach dem Motto: Je eher die Trauben abgenommen werden, desto schneller stellt sich Gewinn ein. Dementsprechend ernteten viele Landwirte alle Trauben in einem Arbeitsgang, egal, ob alle auch den gleichen Reifegrad erreicht hatten. Gewiss, um zu erkennen, welche Trauben reif waren und welche noch Zeit brauchten, war ein gutes Gespür nötig. Was wiederum für den Winzer bedeutete, mehr Geld für das Anheuern fachkundiger Arbeiter auszugeben und Zeit dafür aufzuwenden, dieselben Rebstöcke mehrmals zu inspizieren. Es war billiger, alle auf einmal zu pflücken und sich dann anderen Aufgaben zuzuwenden.
Für die Schaller-Trauben galt dies nicht, das war man dem Kunden schuldig. So leichtsinnig Big Jack auch gewesen war und sosehr er dem Glücksspiel und den Frauen gefrönt hatte, dem Ansehen seines Familienunternehmens fühlte er sich doch verpflichtet. Er hätte von Nicole verlangt, dafür zu sorgen, dass auch die neuen Eigentümer den richtigen Zeitpunkt für die Lese respektieren, ohne Rücksicht auf Zeit und Kosten. Da das kanadische Ehepaar wild entschlossen zu sein schien, die Farm und die Weinkellerei zu übernehmen, würde Nicole also von ihnen verlangen, dass sie sich verpflichteten, keine sauren Trauben an Supermärkte zu liefern und arglose Kunden zum Kauf zu verleiten. Schaller war ein Name, dem man vertrauen konnte, ob es um Wein ging, Rosinen, Marmeladen oder Tafeltrauben.
Sie knipste eine dicke violette Beere ab und biss hinein.
Die Trauben auf ihren Reifegrad hin zu prüfen war für Nicole das Schönste. Die feste Beere zwischen Daumen und Zeigefinger hin und her zu rollen, wie Big Jack sie das gelehrt hatte. Sie ins Licht zu halten und durch ihr zartes Purpur, Schwarz, Dunkelblau, Gelb, Grün, Orange und Rosa zu schauen. Und dann dieser erste Biss, um sie auf ihre Süße hin zu überprüfen. Wenn es zu früh war, schmeckte sie sauer. Nicht weiter tragisch. Ihr Vater hatte neben ihr gestanden, die Hand auf ihre Schulter gelegt und gefragt: »Ist sie so weit?« Wenn sie dann das Gesicht verzogen und gesagt hatte: »Noch nicht. Zu sauer«, hatte er ausgerufen: »Ganz mein Mädchen! Das liegt dir im Blut.« Allein um dies zu hören, hätte Nicole gern tausend saure Beeren probiert.
Sie hielt inne und ließ den Blick über das grüne Paradies schweifen. Nichts hält das Wachstum auf, sinnierte sie und blinzelte durch den Schwarm herumfliegender Bienen in die Sonne. Dies ist das Wunder der Natur, das Wunder des Lebens. Nichts stirbt ein für alle Mal, alles geht immer weiter.
Sie warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. Zeit, sich für das Treffen mit den potentiellen Käufern zu wappnen. Auf dem Weg zurück zum Haupthaus kam sie am Lagerraum für die Fässer vorbei, in dem zurzeit Renovierungsarbeiten im Gange waren. Als sie den Lärm der Vorschlaghammer und die Zurufe der Arbeiter vernahm, beschloss sie, den Käufern zu versichern, dass die Arbeiten bis zum Abschluss der Verkaufsverhandlungen beendet sein würden.
José Rodriguez, der mit dem Vorschlaghammer auf die alte Steinmauer losging, weilte in Gedanken bereits bei den scharf gewürzten Enchiladas, die ihm seine Maria heute Abend auftischen würde, zusammen mit der Flasche Wein, die ihm als Bonus für seine Überstunden in der Kellerei winkte, und bei seiner dicken, willigen Maria – nicht unbedingt in dieser Reihenfolge –, als sein Hammer unvermittelt eine hohle Stelle in der Mauer traf, ins Leere ging und dazu führte, dass José das Gleichgewicht verlor. Er taumelte und stürzte fast zu Boden.
»Aii!«, schrie er auf, worauf die Arbeiter um ihn herum laut auflachten.
Die Außenmauer des Fasslagers war durch ein leichtes Erdbeben beschädigt worden, und dann war auch noch das Dach plötzlich etwas eingesackt. Die gleichbleibende Temperatur und Feuchtigkeit im Lagerraum waren dadurch nicht mehr gewährleistet. Miss Schaller hatte eine sofortige Überprüfung der Mauer angeordnet, um der Sache auf den Grund zu gehen und den Schaden zu beheben, ehe die hier gelagerten edlen Weine Schaden nahmen.
José, dessen Gedanken noch immer bei der üppigen Fleischlichkeit seiner Maria, den würzigen Enchiladas und dem kräftigen Rotwein weilten, klopfte sich den Staub ab und stimmte in das Gelächter seiner Kumpel ein, ehe er feststellte, dass er in der aus Stein und Lehmziegeln hochgezogenen Mauerwand einen Hohlraum freigelegt hatte.
»Qué es esto?«, fragte Tomás, sein Cousin, und deutete auf das klaffende Loch.
José rieb sich mit verstaubten Knöcheln den Schweiß aus den Augen, beugte sich vor und blinzelte zu dem dunklen Hohlraum in der Wand, aus dem ein so unangenehm muffiger Geruch drang, dass er erschauerte und jedweden Gedanken an gutes Essen, Wein und Liebemachen vergaß. Er sah genauer hin, auch die Männer hinter ihm – mexikanische Wanderarbeiter – beugten sich näher heran, und als ihnen klar wurde, was sie entdeckt hatten, wichen sie erschrocken zurück. »Madre de Dios!«, schrien Tomás und José gleichzeitig auf, und alle bekreuzigten sich und riefen sämtliche Heiligen an, die ihnen einfielen.
»Holt Miss Schaller«, stieß José Rodriguez aus. Und als sich keiner der Männer rührte, drehte er sich zu ihnen um und brüllte: »La Señorita! Pronto!«
Daraufhin liefen sie alle auf einmal los, schon um von dem Ding in der Wand und dem Fluch wegzukommen, der bestimmt über sie kommen würde, und wohl jeder von ihnen überlegte, wann Father Ramón, der Wanderpriester, wieder vorbeikommen würde, um die Messe zu lesen und die heiligen Sakramente zu spenden.
»Unsere Familie war die erste deutsche in diesem Tal«, erklärte Nicole ihren Besuchern auf dem Weg vom Parkplatz zum Haus. »Wir waren die Ersten, die den Riesling, für den wir heute bekannt sind, nach Kalifornien gebracht haben«, fügte sie hinzu und lächelte, um ihre Nervosität zu verbergen.
Sie war mehr als nervös, hatte entsetzliche Angst davor, ihr Zuhause zu verlassen, bemühte sich aber, sich dies nicht anmerken zu lassen. Eine volle Stunde hatte sie gebraucht, um sich für ihre Garderobe zu entscheiden, hatte immer wieder zu was anderem gegriffen, hatte erst ein Minimum an Make-up aufgetragen, dann doch wieder mehr, hatte mit ihrer Frisur gehadert, immer darauf bedacht, adrett und liebenswürdig zu wirken und vor allem wie jemand, dem man ein Weingut abkauft.
Nicole musste verkaufen. Sie musste weg von hier.
Wie auch konnte sie bleiben? Gewiss, sie wohnte in einem großen weißen Haus mit drei Etagen; ein Schwimmbecken, Tennisplätze und ein geräumiger Patio für große Gesellschaften standen ihr zur Verfügung. Aber dieses Tal mit dem nahen Städtchen Lynnville lag am Ende der Welt, war hinterste Provinz, eine verschlafene Gegend. All ihre Schulfreundinnen hatten davon geträumt, aus diesem »Kaff«, wie sie es nannten, herauszukommen. Nach San Francisco, Los Angeles, ganz verwegene sogar nach New York. Niemand, höchstens die Großmutter, blieb auf Dauer in Lynnville. Wie soll man denn hier einen Mann kennenlernen?, hatten sie sich untereinander gefragt. In diesem Tal gab es nur Landwirte, Arbeiter, Bauerntölpel und Hinterwäldler. Sie trugen Cowboy-Hüte und Stiefel mit hohen Absätzen und sprachen nur das Allernötigste. Aber nicht deswegen wollte Nicole weg von hier. Sie liebte dieses Tal, für sie war es nicht hinterste Provinz. Sie war siebenundzwanzig und hier geboren worden, war kaum mal rausgekommen und hatte nichts gegen Feldarbeiter und Landwirte und Männer am Steuer von Kleinlastern. Nein, Nicoles Gründe, das Weingut zu verkaufen, hatten mit einem Haus voller negativer Erinnerungen zu tun, mit dem erstickenden Zusammenleben mit einem dominanten (und dennoch geliebten) Vater und mit der Bürde familiärer Erwartungen, von denen sie sich nur befreien konnte, wenn sie alles verkaufte und ging.
»Hier kannst du der Vergangenheit nicht entkommen«, hatte sie zu ihrer besten Freundin gesagt. »Ich habe das Gefühl, in einer Zeitschleife festzusitzen. Ohne jeden Vorwärtsimpuls.«
Wann war ihr eigentlich bewusstgeworden, dass sie fortgehen musste, dass sie, wenn sie jemals ein eigenständiges Wesen sein und als solches anerkannt werden wollte, einen Schlussstrich ziehen musste unter das, was sie hier festhielt – Big Jack und die Farm und die Weinberge? Zwölf war sie gewesen, als sie mit Grippe zu Hause lag und eines Nachmittags als Gast in einer Talkshow eine Frau erlebte, die ein eigenes Unternehmen aus dem Boden gestampft hatte und nun berühmt war. Als sie dreizehn war, fand in der Schule eine Berufsberatung statt, und eine Ärztin erzählte von Krankenhäusern, die sie in Afrika gegründet hatte. Sie war vierzehn, als ihr ein Lehrer sagte, dass sie, auch wenn sie einer Winzerfamilie entstamme, nicht automatisch Winzerin werden müsse.
Es war keineswegs unvermittelt über sie gekommen, sondern ein schrittweiser Prozess gewesen, der ihr die Augen geöffnet hatte, wie viele Möglichkeiten ihr offenstanden. Und nach dem Tod ihres Vaters sah Nicole ihre Chance gekommen.
Als Traumziel hatte sie sich New York auserkoren. Ein Kontakt über eine Freundin, die eine Freundin kannte, die von einer unbesetzten Position gehört hatte. Die Reise an die Ostküste war höchst erfolgreich gewesen. Dank ihrer Erfahrung war Nicole von einer Kosmetikfirma für die Bereiche Marketing und Vertrieb engagiert worden, außerdem für die Überwachung von Angebot und Nachfrage und den Aufbau eines Markennamens. Ihr Diplom in Betriebswirtschaft war das Sahnehäubchen gewesen. Während des Vorstellungsgesprächs hatte sie Umsicht und Kreativität bewiesen und die Bereitschaft, Kunden anzuhören und mit ihnen zusammenzuarbeiten, anstatt ihnen Vorschriften zu machen. Sie hatte sich aufgeschlossen gezeigt und mehr als kooperationsbereit für die Ideen anderer. Teamfähig. Natürlich fing sie ganz unten an, aber Aufstiegsmöglichkeiten boten sich zur Genüge. Glänzende Aussichten also.
Sie war schon dabei, einige Vorschläge für die Firma auszuarbeiten. Ihrem Gesprächspartner beim Vorstellungstermin waren die Schaller-Weine bekannt; er hatte gesagt, die Weinkellerei habe einen guten Ruf für ihre Innovationen, vor allem in den 1950er und 1960er Jahren, als die kalifornische Weinindustrie weltweit den Markt mit neuen und ausgefallenen Erzeugnissen und Konzepten buchstäblich überschwemmt habe. Er hatte Nicole versichert, dass man ihr zutraue, für seine Firma die gleiche Begeisterung und den gleichen Geschäftssinn unter Beweis zu stellen, durch die sich das Unternehmen ihrer Familie ausgezeichnet habe.
Es waren dieses Vorstellungsgespräch und diese Kommentare über ihre Familie gewesen, die urplötzlich alles hatten deutlich werden lassen: Ja, genau das war es, was ihre ruhelose Seele in den vergangenen Jahren umgetrieben hatte. Nicole wollte nicht in die Fußstapfen anderer treten. Sie wollte sich ihren eigenen Weg bahnen – nicht etwas erben, sondern etwas erschaffen.
Alles, was sie dafür tun musste, war, die Weinberge und die Kellerei verkaufen und in sechs Wochen an ihrem Schreibtisch in New York sitzen.
Wenn sie sich auf dem Anwesen aufhielt und die Arbeiten überwachte, tat sie dies für gewöhnlich in Blue Jeans und T-Shirt. Im Verkostungsraum jedoch, wo sie als Gastgeberin für Touristen auftrat, die leicht beschwipst und ausgelassen in ihren Limousinen von Weingut zu Weingut hoppelten, trug Nicole stets gutgeschnittene Hosen mit Bügelfalte und eine Seidenbluse. Nicht zu elegant, um nicht snobistisch zu wirken, aber doch stilvoll, um zu zeigen, dass das Weingut der Schallers zu den »besseren« gehörte. Wie ihre Mutter und davor ihre Großmutter glaubte sie daran, dass das Auftreten der Familie die Qualität und das Etikett des Weinguts widerspiegelte.
Fest entschlossen, das Familienunternehmen zu verkaufen, unternahm Nicole alles, um sich von ihrer besten Seite zu präsentieren. Sogar auf ihren mit einem einfachen Gummi zusammengehaltenen Pferdeschwanz hatte sie verzichtet und ihr braunes Haar mit modischen goldenen Clips schmeichlerisch hinten zusammengefasst. Dass sie rank und schlank war, hatte sie ihrer Vorliebe für ausgedehnte Wanderungen zu verdanken.
»Ein so altes Anwesen hat sicherlich mit einer abwechslungsreichen Geschichte aufzuwarten«, sagte die höfliche Dame aus Kanada, als sie die Stufen zum Hauseingang hochstiegen. Nicole vermutete, dass die kleine rundliche Frau auf Klatsch und Skandale und Skelette in Schränken erpicht war. Sie hütete sich jedoch, Familiengeheimnisse preiszugeben. Wenn sie das tat, würden diese netten Leute nicht nur das Anwesen nicht erwerben, sondern das Weite suchen. Es waren ja nicht nur die Außenmauern des Hauses und der Kellerei übertüncht worden, sondern auch die Familiengeschichte.
»War der Schaller-Betrieb nicht mal ein riesiges Unternehmen?«, fragte der kanadische Ehegatte, ein hochgewachsener Mann, als er krummbeinig und die Daumen in seinem Gürtel eingehakt durch das Haupthaus schritt. Für Nicole stand fest, dass seine Frage darauf abzielte, in Erfahrung zu bringen, wie es zum Niedergang des einstmals finanzkräftigen landwirtschaftlichen Imperiums gekommen war.
»Aber ja doch. Früher gehörte meine Familie zu den größten Weinanbauern des Landes«, bemerkte sie eher beiläufig, um das Drama ihrer Vergangenheit auszublenden. Die Macintoshes waren darauf aus, einen kleinen Weinberg mit Kellerei für sich selbst zu erwerben, und genau das bot ihnen Nicole Schaller zum Kauf an: den Grundbesitz mit Haupthaus, Nebengebäuden und der hundert Jahre alten Kellerei, die berühmt war für ihre Rieslinge aus den vor langer Zeit aus Deutschland mitgebrachten Setzlingen. Der Kaufpreis räumte ihnen nicht das Recht ein, in der schmutzigen Wäsche ihrer Familie herumzuwühlen.
»Im Laufe der letzten Jahre beschloss mein Vater, sich zu verkleinern und Land an Leute wie Sie zu verkaufen, die mit eigenen kleinen Kellereien liebäugelten.« Den eigentlichen Grund für diese Verkleinerung zu nennen – Spielschulden und Alkohol und kostspielige Frauen und eine offene Brieftasche für jeden mit einer anrührenden Geschichte –, war nicht nötig. Dies alles gehörte der Vergangenheit an, war mit dem Tod des Vaters begraben worden. »Und ja, ich bin jetzt auf mich allein gestellt«, fügte sie überflüssigerweise hinzu. Auf mich allein gestellt … das hörte sich so traurig und einsam an, dass sie kurz auflachte, wie um diesen Fremden zu verdeutlichen, dass es ihr nichts ausmachte, auf sich allein gestellt zu sein.
»Ist das alles im Verkaufspreis mit inbegriffen?« Sie waren in dem riesigen Wohnzimmer angelangt, das ausgestattet war mit Antiquitäten, Andenken, Erinnerungen – kurzum mit alldem, was vor hundert Jahren aus der Alten Welt hierhergeschafft und seitdem zusätzlich gesammelt worden war.
»Ja«, bestätigte Nicole, auch wenn es ihr weh tat, von diesen vertrauten Dingen Abschied zu nehmen.
»Das auch?« Die Frau aus Alberta, Kanada, deutete auf ein Porträt über dem offenen Kamin.
Nicole blickte auf. »Ja, das auch.«
»Eine schöne Frau. Wer ist sie?«
»Meine Urgroßmutter Clara Schaller.«
»Aber natürlich, die Ähnlichkeit ist nicht zu verkennen.«
Von wegen, widersprach Nicole wortlos. Nach drei Generationen ist jedwedes genetische Erbgut vermischt und verwässert. Falls Clara mir irgendetwas vermacht hat, dann vielleicht den ausgeprägten spitzen Haaransatz an der Stirn, sonst nichts.
Da sie ihre Urgroßmutter nie kennengelernt hatte, empfand Nicole keine besondere Verbundenheit oder Zuneigung zu ihrer im Largo Valley berühmten und legendären Ahnin Clara Schaller. Wenn sie jetzt aber diese von schwarzen Wimpern gesäumten grauen Augen und die schön geschwungenen Brauen betrachtete, konnte man in Clara eine durchaus zielstrebige Geschäftsfrau vermuten. Sie dachte an die Geschichten, die sie über diese respekteinflößende Patriarchin gehört hatte, und auch wenn so manche an den Haaren herbeigezogen und im Laufe der Jahre geschönt worden sein mochten, sagte sie plötzlich: »Wenn ich es mir so recht überlege, steht dieses Porträt nicht zum Verkauf. Es ist persönlich. Es gehört in die Familie.«
In welche Familie denn? Wer sollte dieses Porträt aufbewahren? Nicole war ein Einzelkind, sie hatte gegenwärtig keinen festen Freund, eine unmittelbare Heirat zeichnete sich nicht ab. Sie war drauf und dran, in einer anderen Stadt Karriere zu machen. Würde irgendwann mal Zeit für Männer und Babys sein? Wem sollte sie das Porträt vererben? Wenn sie es aber diesen Leuten hier überließ, schoss es ihr jetzt durch den Kopf, würde es letztendlich unerkannt und vergessen bei irgendeinem Trödler verstauben.
Nicole schüttelte sich innerlich. Nein, das konnte sie Urgroßmutter Clara nicht antun.
Die Kanadier schlenderten durch das Wohnzimmer, bewunderten die Antiquitäten: eine Wanduhr von Gustav Becker aus dem Jahr 1890; Dresdner Porzellan; eine Puppe mit einem Kopf aus Biskuitporzellan; eine Lederjacke mit Hirschhornknöpfen; ein hölzernes Schaukelpferd, handgeschnitzt und bunt lackiert; in einer Vitrine deutscher Christbaumschmuck aus dem 19. Jahrhundert; in einem Goldrahmen eine auf 1890 datierte Original-Landkarte des Deutschen Reichs; Nymphenburger Tassen und Untertassen von 1890; zwei vergoldete, handbemalte Rosenthal-Dosen von 1890; ein Gestell mit geschnitzten Meerschaumpfeifen. Das ausladende Wohnzimmer mit der hohen Decke war in der Tat ein Museum voller Kunstschätze und Antiquitäten, die vor über hundert Jahren vom alten Kontinent hierhergeschafft und liebevoll gehütet und ergänzt worden waren.
Der plötzliche Gedanke, dass all diese Erinnerungsstücke überlebt hatten, so vieles andere aber nicht, traf Nicole wie ein Schock. Ich bin die letzte Schaller …
Sie stand in einem Lichtkeil, den die späte Septembersonne durch das hohe Fenster warf, und eine Welle von Traurigkeit überschwemmte sie. Von Geburt an hatte sie jedes Weihnachtsfest in diesem geräumigen Wohnzimmer gefeiert. Zuvor war Big Jack in die nahegelegenen Wälder gezogen, hatte einen Baum ausgesucht, ihn gefällt und in der Ecke des Zimmers aufgestellt. Immer war es eine ausladende Tanne gewesen, die die Familie dann liebevoll und durch den zwischendurch genossenen Schaller-Wein in ausgelassener Stimmung geschmückt hatte. Und jetzt verkaufte Nicole nicht nur ihr Zuhause und diese Antiquitäten an Fremde, sie trat ihnen darüber hinaus ihre siebenundzwanzig Weihnachten ab.
Eigentlich fand sie dieses kanadische Ehepaar ganz nett. Bei anderen Kaufinteressenten, die vorstellig geworden waren, hatte die Chemie nicht gestimmt. Dieses um die vierzig Jahre alte Paar hingegen, das hier investieren und fernab vom kalten Winter in Alberta ein neues Leben beginnen wollte, sagte ihr zu. Die beiden würden bestimmt gut auf Nicoles Zuhause aufpassen und die Weinberge pflegen. Sie konnte beruhigt von dannen ziehen. Ja, sie waren die Richtigen. Hoffentlich entschlossen sie sich zu kaufen.
Sie öffnete die Mappe, die sie bei sich hatte, und präsentierte einen genauen Lageplan des Anwesens mit Angaben über die landwirtschaftlich genutzten Flächen, die Lage der Gebäude, des Haupthauses, der Parkplätze.
»Was ist das hier?« Mr Macintosh deutete mit einem plumpen Finger auf einen leeren Fleck am westlichen Rand der Farm.
Diesen Streifen Land war Big Jack, Nicoles Vater, als er nach und nach Grundstücke verkauft hatte, um seine Spielschulden abzutragen, einfach nicht losgeworden. »Das ist unwirtliches Gelände«, erklärte Nicole. »Karger Boden. Ihn künstlich zu bewässern lohnt sich nicht. Mein Urgroßvater entschied, ihn brach liegen zu lassen, und dabei ist es geblieben. Paradoxerweise erhebt sich dort ein malerischer Hügel namens Colina Sagrada. Heiliger Berg.«
»Klingt romantisch«, meinte Mrs Macintosh. »Dürfen wir ihn uns mal ansehen?«
»Ich fahre Sie gern hin.«
»Miss Nicole!«, hörte man es von weitem rufen. »Miss Nicole!« Sie warf einen Blick aus dem Fenster und sah mehrere Arbeiter auf das Haus zulaufen. Großer Gott, erschrak sie und hastete zur Haustür. Etwa ein Feuer?
Das Ehepaar aus Alberta tauschte einen Blick, als es an der Haustür zu einem überstürzten Wortwechsel kam.
»Was?!«, fuhr Nicole den mexikanischen Arbeiter an. »Sind Sie sicher?« Und als der Mann nachdrücklich nickte, wandte sie sich, unvermittelt blass geworden, an ihre Besucher. »Tut mir leid«, sagte sie nervös. »Ein Zwischenfall. Ich bin gleich wieder da.«
Verwundert sahen die Besucher, wie sie ihre Mappe ablegte und den Arbeitern über den Rasen zu den aus Lehmziegeln gemauerten Gebäuden der Kellerei nachhetzte. Sie eilte durch den Gärraum, die Halle mit der Presse, durch den Raum für die Verkostung, bis sie dort anlangte, wo die Fässer mit dem Riesling lagerten und wo das Loch in der Mauer klaffte. Ziegel und Gestein und Staub bedeckten den Boden.
Sie riss den Mund auf. »Um Himmels willen«, flüsterte sie, derweil sich die Mexikaner erneut bekreuzigten und im Stillen ein paar Ave Maria beteten.
Langsam und zögernd beugte sich Nicole über das Loch, so als ob das, was da in der Mauer zu erkennen war, plötzlich um sich schlagen würde, was, wie sie sich sagte, nicht sein konnte. Es war ja tot – mehr als tot. Nicht das kleinste Fleisch- oder Hautfitzelchen hing noch an dem Skelett. Völlig verwest war es. Die Kleiderreste waren verrottete Lumpen. Fasziniert starrte sie das knochige Gesicht an, die riesigen leeren Augenhöhlen, den aufgerissenen Mund mit dem hängenden Unterkiefer und den übel zugerichteten Zähnen.
»Verzeihung, Miss Nicole«, sagte José, der ein recht ordentliches Englisch sprach, und deutete mit zitternder Hand auf das kleine runde Loch oberhalb des Wulsts, wo einstmals die Augenbrauen gewesen waren. »Ist das … ist das nicht …?«
Sie nickte. »Sieht aus wie das Loch von einer Kugel.« Sie blickte zu ihm auf. »Rufen Sie bitte die Polizei«, sagte sie so ruhig wie möglich, wobei sie es vermied, die Kanadier anzusehen, die sich dazugesellt hatten und wahrscheinlich ebenso entsetzt waren. Durchaus möglich, dass sie bereits von ihrem Vorhaben abrückten, eine Kellerei zu übernehmen, in der sich ein Mord und eine grausige Bestattung ereignet hatten.
Als sich alles um sie herum verlangsamte, die Menschen sich wie im Schneckentempo bewegten und so gedehnt redeten, als würde eine Filmrolle in Slow Motion abgespult, stellte sich für sie angesichts des Schädels mit der mörderischen Kugel darin zwingend, ja sogar wütend und vorwurfsvoll wegen der Unannehmlichkeiten, die das Opfer der Schaller-Weinkellerei plötzlich bescherte, die wichtigste Frage überhaupt: Wer bist du …?
Und dann flogen ihre Gedanken zum Haupthaus, zu der eleganten Frau auf dem Porträt über dem offenen Kamin, Clara Heinze Schaller, die vor mehr als hundert Jahren als Jungverheiratete in dieses Tal gekommen war. Was dieses neunzehnjährige Mädchen aus dem deutschen Rheingau mit dem träumerischen Blick und den Setzlingen im Korb wohl davon hielte, wie dieser Traum endete … mit Kanadiern, die ihre Kellerei in eine Yuppie-Boutique zu verwandeln gedachten, und dass in den Mauern ein Mordopfer entdeckt worden war …
[...]
Über Barbara Wood
Barbara Wood ist international als Bestsellerautorin bekannt. Allein im deutschsprachigen Raum liegt die Gesamtauflage ihrer Romane weit über 13 Mio., mit Erfolgen wie ›Rote Sonne, schwarzes Land‹, ›Traumzeit‹, ›Kristall der Träume‹ und ›Dieses goldene Land‹. 2002 wurde sie für ihren Roman ›Himmelsfeuer‹ mit dem Corine-Preis ausgezeichnet. Barbara Wood stammt aus England, lebt aber seit langem in den USA in Kalifornien.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Über dieses Buch
In den Weinbergen um das Largo-Tal weiß jeder, dass zwischen den Schallers und den Newmans erbitterte Feindschaft herrscht. Ein Skelettfund auf dem Weingut, das Nicole Schaller gerade geerbt hat, facht den Konflikt erneut an. Sie ist wütend, als Lucas, der Newman-Erbe, Verdächtigungen gegen ihre Familie äußert. Um Beweise für die Unschuld der Familie zu finden, beginnt Nicole eine Spurensuche in die Geschichte des Weingutes. Natürlich hat sie immer gewusst, dass ihre Vorfahren aus dem Rheinland nach Kalifornien gekommen waren. Sie kennt die Fotos ihrer Eltern und Großeltern, die alle beherrscht werden von Urgroßmutter Clara, der Matriarchin des Schaller-Clans. Aber dann stößt sie auf Briefe der jungen Clara, die sie völlig durcheinanderbringen. Sie begreift: um die Wahrheit zu finden, muss sie ausgerechnet Lucas Newman um Hilfe bitten.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Book
Die amerikanische Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Far River« bei Turner Publishing, Nashville, Tennessee.
(c) Barbara Wood 2018
Published by Arrangement with Barbara Wood
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen
Covergestaltung: www.buerosued.de
Coverabbildung: Landschaft, Blätter: www.buerosued.de, Gebäude: Getty Images / David C. Tomlinson
Für die deutschsprachige Ausgabe:
(c) 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
ISBN 978-3-10-490306-4