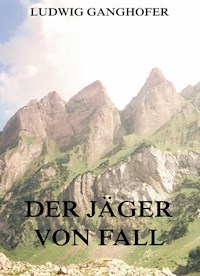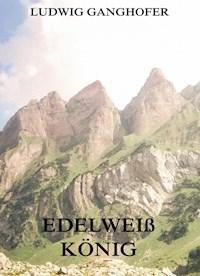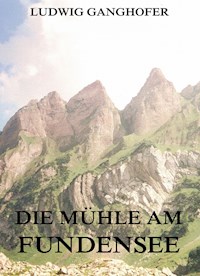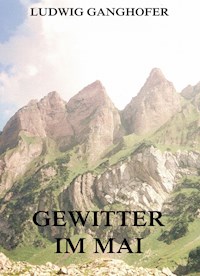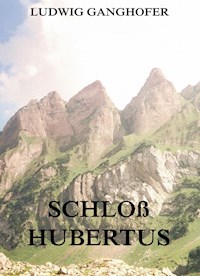Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: TeBiTo Text Bild und Ton
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Klassiker bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Ein spannender Roman aus Roman aus dem 13. Jahrhundert. Das mächtige Kloster zu Berchtesgaden macht nach und nach alle Bauern zu Hörigen. Nur der Bauer Greimold, der seinen Hof »Gotteslehen« nennt, weil Gott sein einziger Lehensherr sei, kann bislang dem Kloster widerstehen. Der ehrgeizige Dekan Wernherus versucht alles, das "Gotteslehen" in die Abhängigkeit des Klosters zu bringen. Der junge Chorherr Irimbert liebt Greimolds blinde Tochter Jutta. Über Greimold wie über Irimbert hält der gütige Probst Friedrich von Ortenburg seine schützende Hand, als er jedoch bei einem Jagdunfall stirbt, wird Wernherus sein Nachfolger. Während die Soldaten des Klosters das Gotteslehen erstürmen und niederbrennen, fliehen Irimbert und Jutta. Ganghofers Werke, vor allem die Romane, werden noch heute verlegt. Weltweit wurden insgesamt mehr als 30 Millionen Werke verkauft (geschätzt, Stand 2004). Null Papier Verlag
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ludwig Ganghofer
Das Gotteslehen
Ein historischer Roman
Ludwig Ganghofer
Das Gotteslehen
Ein historischer Roman
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-954180-86-8
null-papier.de/katalog
Inhaltsverzeichnis
Autor
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Klassiker bei Null Papier
Alice im Wunderland
Anna Karenina
Der Graf von Monte Christo
Die Schatzinsel
Ivanhoe
Oliver Twist oder Der Weg eines Fürsorgezöglings
Robinson Crusoe
Das Gotteslehen
Meisternovellen
Eine Weihnachtsgeschichte
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Autor
Geboren am 7.7.1855 in Kaufbeuren als Sohn eines Forstbeamten. Er arbeitete ab 1872 als Volontär in einer Augsburger Maschinenfabrik. 1873 entschloß er sich, Schriftsteller zu werden. Er studierte in den Jahren 1874-1877 Philosophie und Philologie in München und Berlin und promovierte 1879 zum Dr. phil. in Leipzig. Ab 1880 lebte er in Wien und war dort Dramaturg des Ringtheaters. Von 1886-1892 arbeitete er als Feuilletonredakteur, dann als freier Schriftsteller.
Viele Werke Ganghofers greifen Geschehnisse aus der Geschichte Berchtesgadens auf, wo er sich regelmäßig aufhielt. Seine Heimatromane haben Ganghofer schon zu Lebzeiten den Ruf des »Heile-Welt«-Schreibers eingebracht. Nicht selten sind seine Werke, die meist vom Leben einfacher, tüchtiger, ehrlicher Leute handeln, als Kitsch bezeichnet worden. Ganghofer und seine Werke wurden deswegen schon zu Lebzeiten Zielscheibe satirischer Attacken, beispielsweise von Karl Kraus in seinem Werk Die letzten Tage der Menschheit.
Ganghofers Werke, vor allem die Romane, werden noch heute verlegt. Weltweit wurden insgesamt mehr als 30 Millionen Werke verkauft (geschätzt, Stand 2004).
Ganghofer war ein ebenso produktiver wie erfolgreicher deutscher Volksschriftsteller. Seine Romane aus der bayrischen Alpenwelt zeigen in effektvoller Weise die Schicksale und Erlebnisse meist einfacher Menschen. Ganghofer starb am 24.7.1920 in Tegernsee.
Werke u.a.
1886 Edelweißkönig
1892 Der Klosterjäger
1894 Die Martinsklause
1895 Schloß Hubertus
1899 Das Schweigen im Walde
1900 Der Dorfapostel
Kapitel 1
Mit rotem Laub, in der klaren Sonne standen die herbstlichen Ulmen und Buchen rings um das kleine Blockhaus her und sperrten mit dem Netzwerk ihrer tausend Äste und dem Flammengewirr der farbigen Blätter alle Fernsicht. Man sah nur den blauen Himmel in der Höhe, in weiter Runde nur die weißen Spitzen der Berge.
Über jene steilen Zinnen war, ein Vorbote des nahenden Winters, schon der erste Schnee gefallen, während auf den tieferen Gehängen noch die letzten Blumen des Herbstes blühten. Der kalte Nachtreif hatte die zarten Spitzen ihrer Blätter schon versengt, doch in ihren Kelchen war noch Honig. Die Bienen, deren Stöcke unter dem vorspringenden Moosdach des Blockhauses geborgen standen, flogen emsig ab und zu. Dieser stete Immensang, gepaart mit dem Murmeln eines dünn laufenden Brunnens, umschwebte wie leise Musik das niedere Dach und alle Balkenmauern des kleinen, grau verwitterten Hauses, welches einsam stand, menschenferne, versunken im Bergwald.
Das Haus eines Jägers. Neben dem Brunnen waren Wildfelle zum Trocknen über Stangen gespreitet und über der Tür, zu beiden Seiten eines hölzernen Kreuzes, waren gebleichte Luchsköpfe und Bärenhäupter an die Balken genagelt. Vor der steinernen Schwelle lag ein weiß und braun gefleckter Jagdhund in der Sonne; blinzelnd und mit den Ohrlappen zuckend hielt er in Wohlbehagen den Hals auf die vorgestreckten Pfoten geschmiegt; manchmal hob er den Kopf, spähte funkelnden Blickes in den Wald, als hätte er den Tritt eines ziehenden Wildes vernommen, und blickte zu der alten Frau empor, die spinnend auf der Hausbank saß. Die Greisin achtete des Hundes nicht. Sie spann und spann, mit vorgebeugtem Haupt, so daß ihr die grauen Zöpfe über die Brust hingen. Faltig umschloß eine Kutte aus blauem Hanftuch den von Alter gebeugten Leib. Das Gewand ließ die hageren Arme nackt, und während die eine Hand den halb schon abgesponnenen Rocken hielt, zog die andere ohne Rast den Faden und ließ in der Luft die schwere Spindel tanzen.
Da klang über dem Moosdach ein ächzender Vogelschrei und lautes Flattern. Langsam blickte die Greisin auf und sah einen Habicht mit der weißen Taube, die er geschlagen, im Wald verschwinden. »So fliegt der Tod um und frißt uns auf!«
Als wollte das atmende Leben diesem trübseligen Worte widersprechen, tönte in diesem Augenblick, vom spielenden Windhauch halb verweht und doch getragen, der klare Hall einer singenden Mädchenstimme vom höheren Wald herunter, jeder Laut das Zeugnis einer Herzensfreude, die sich äußern muß, weil ihr die Brust zu eng geworden.
Die Greisin hob lauschend das Gesicht. »Daß die noch singen kann?«
Da ließ sich Geräusch im Haus vernehmen, »So, Herr! Und jetzt das Schießzeug noch!« sagte eine Männerstimme. »Die Bolzen sind geschärft und neu gefiedert, sie fliegen über hundert Gang. Nur gut hinhalten! Und denk, daß der Hirsch im Zwielicht allweil näher steht, als wie’s den Anschein hat. Wenn du gut achthast auf alles, mag’s wohl gelingen, daß du einen weidgerechtem Schuß tust.«
»Den Schuß ins Herz oder keinen!« erwiderte eine jugendliche Stimme von so versunkenem Klang, wie eine Glocke tönt, an die man sacht mit der Hand geschlagen.
Schwere Schritte kamen zur Tür, und Hilpot, der alte Jäger, trat über die Schwelle. Sein furchiges Gesicht versank in dem grauen Bart, der mit struppigem Haar in eins verwuchs und gleich einer gestutzten Mähne den Kopf umstarrte. Vom Fuchsfell, mit dem die stämmigen Beine umschnürt waren, hingen zerrissene Lappen nieder, und das ärmellose Lederwams war schwarz und brüchig. Eine klobige, schwer gebeugte Gestalt, verwittert vom Winter, vom Sturm der Berge, verwildert in der Einsamkeit. Vor dreißig Jahren hatte Hilpot mit Hanna, seinem Weib, dieses im Wald verlorene Haus bezogen. Weil das Waldgeräumte, auf dem es stand, sich von allen Gehängen des Göhl am weitesten hervorschob, nannten es die Leute das »Vorder Eck«. Und seit dreißig Jahren hütete Hilpot die Gemsen und Hirsche, die in reicher Zahl die Felsen und Wälder des hohen Göhl bewohnten, dessen Wildbann einst der Kaiser Rotbart dem ungetreuen Bischof von Salzburg abgenommen und dem kaisertreuen Kloster zu Berchtesgaden verliehen hatte. In diesen dreißig Jahren war Hilpot nur ins Tal hinuntergestiegen, wenn er an hohen Kirchentagen die Messe hören mußte oder wenn es einen Hirsch, der für Hilpots Söhne zu gewichtig war, in die Klosterküche zu liefern galt -- oder wenn er von seinen Buben einen auf dem Totenbrett hinuntertragen mußte zur geweihten Erde. Sechsmal in diesen dreißig Jahren hatte Hilpot solche Last getragen. Das hatte mitgeholfen, um seinen Rücken so tief zu krümmen.
Eine Weile stand er auf der Schwelle und spähte nach allen Seiten. Dann trat er ein paar Schritte in das Gehöft hinaus. Hanna blickte zu ihm auf und sagte: »Der Stößer hat uns das letzte Täubl davon. Du, Jäger, du! Hütest für ander Leut das Gewild und kannst deine eigene Taub nit hüten.«
Sie nickte. »Solche Jägersleut sind wir Menschen all miteinand!« Hilpot schien nicht zu hören. Lauschend spähte er über den Waldsaum hin und rief dann gegen die Tür: »Komm nur, Herr! Nur die Mutter, sonst ist keine Menschenseel in der Näh. Der Forst ist völlig still, nur droben in der Waldhut, neben dem Gotteslehen hört man das arme Mädel singen.«
Im Rahmen der Tür erschien eine hohe Gestalt, ein junger Jäger, der eben die Armbrust hinter die Schulter nahm. Er war gekleidet wie der Alte, nur daß das Gewand nicht so verwittert und verbraucht war; dazu die Marderkappe mit der Adlerfeder. Das Wams zog Falten, als wär es nicht für diesen schlanken Körper geschnitten worden. Und die schmalen Hände wie auch die nackten Knie waren weiß, als hätten sie die Sonne nicht oft gesehen. Nur wenig lugte das kurz geschnittene Schwarzhaar unter dem Pelz der Mütze hervor. Auf den bleichen Wangen lag ein bläulicher Schimmer. Wie fein und scharf waren in diesem Gesicht alle Züge! Die streng geschwungenen Lippen geschlossen wie in trotzigem Schweigen, das die Rede haßt. Doch ungestüme Sprache leuchtete aus der Nacht dieser großen Augen, über denen die schwarzen Brauen wie mit Kohle gezeichnet waren.
Der Jagdhund erhob sich beim Anblick des jungen Weidmanns und knurrte, als stünde ein Fremder vor ihm. Mit zischendem Laut wies Hilpot das mürrische Tier unter die Hausbank und näherte sich mit ehrfürchtiger Scheu.
»Die Weg verlieren sich im Wald. Soll ich dich nit geleiten, Herr?«
Der andere schüttelte den Kopf. »Ich will nicht, daß du Mühe hast um meinetwegen.« Ein bitteres Lächeln zuckte um seinen Mund. »Man könnte sie dir übel lohnen. Ich danke dir schon den einen Dienst, den du mir bietest gegen deine Pflicht.« Den Bergstock fassend, den Hilpot ihm reichte, trat er aus dem Schatten der Tür in die leuchtende Abendsonne. Bei den letzten Worten, die er gesprochen, hatte die alte Frau einen ernsten Blick auf ihren Mann geworfen. Nun wollte sie den Rocken niederlegen und sich aufrichten. Der junge Jäger winkte mit der Hand. »Bleib, Mutter Hanna! Deine Jahre wollen rasten.« Die alte Frau nickte wortlos vor sich hin und brachte die Spindel wieder in Schwung. Der andere stand vor ihr und betrachtete eine Weile sinnend ihre Züge. Dann sagte er: »Deine Spindel ist heute schwer geworden. Gibt das ein Kleid zur Weihnacht?«
»Nein, Herr! Ein Hemd für meinen Buben. Für den letzten, den ich hab. Derweil ich spinn, muß ich allweil sinnen, ob er das neue Hemd wohl tragen wird zur warmen Hochzeit oder zur kalten Freit? Ja, Herr, ich hab gesponnen, derzeit ich leb. Für sieben Buben. Sechs von ihnen haben mein schönes Leinen hinuntergetragen, mannstief unter den Wasen.« Hanna zog den Faden, während Hilpot seufzend das graue Haar mit beiden Händen in die Stirn strich.
»Klag nicht um die Toten, Mutter! Denen ist wohl!« sagte der junge Jäger. »Freu dich an dem einen, der euch geblieben ist.«
Hanna netzte die Finger. »Was ist Freud, Herr? Was ist Weh? Schier weiß ich’s nimmer. Es ist mir so gekommen mit der Zeit, daß ich Weh und Freuden allweil spür, als wär’s ein gleiches.«
»Dann bist du eine weise Frau.« Der junge Jäger atmete tief. »Das Leben halten auf ruhiger Hand? Schmerz und Wonne wie ein gleiches wägen? Seit ich denke, quäl ich mich um diese Kunst.«
Ein halbes Lächeln glitt um die welken Lippen der alten Frau. »Hab nur Geduld, Herr! Du stehst noch in der unrechten Lehr. Wieviel Jährlein hast du über die zwanzig? Schau nur, schau! Der warme, grüne Mai will es dem Winter neiden, daß er weiß und kalt ist.« Nickend sah sie an der hohen Gestalt des jungen Mannes hinauf. Ihre Augen blieben an seinem ledernen Wamse haften. »Das hat mein ältester Bub getragen am selbigen Tag, an dem der Baum ihn erschlagen hat.«
Hilpot winkte seinem Weib, als wär es ihm unlieb, daß Hanna solche Dinge schwatzte; und ein Blick seiner scheuen Augen streifte das bleiche Gesicht des jungen Jägers.
Der lächelte. »Ich danke dir, Hanna, für dieses Wort! Es gibt mir für meinen einsamen Weg einen stillen Gesellen, mit dem sich’s plaudern läßt, ohne daß ich reden muß.« Er nickte grüßend, und seine Stimme klang freundlicher. »Gehab dich wohl, gute Mutter! Dir zuliebe möcht ich wünschen, du hättest deinen Buben noch und ein anderer läge, wo der Baum gefallen ist. Dann wäre zweien geholfen.«
Er wandte sich ab und schritt den Bäumen zu.
Da trug der Abendwind den lieblichen Hall jener singenden Mädchenstimme über den goldleuchtenden Wald herunter, deutlicher als zuvor. Man konnte die Worte verstehen:
»Es lachet um und um der Wald, Es blumet auf der grünen Hald, Und nieder zu den Auen Steigen die Maiden und Frauen.«
Der junge Jäger verhielt den Schritt und lauschte, während Hilpot zur Hausbank trat und seinem Weibe zuflüsterte: »Weswegen hast du’s ihm sagen müssen? Jetzt wird er über die schiechen Wänd ein ungutes Steigen haben, weil er allweil denken muß, er tragt einen Kittel, in dem schon einer verbluten hat müssen. Es hat ihm kein anderes Wamset passen mögen. So schlachtig und hoch ist er gewachsen. Und mein altes Schmierzeug kann ich doch so einem Herren nit umhängen. Schau, Mutter, hättst es ihm doch verschweigen sollen!« Hanna erwiderte kein Wort; sie netzte die Finger und spann. »Was hat er denn sagen wollen mit dem stillen Gesellen?« flüsterte Hilpot. »Wen hat er gemeint?«
»Den Tod.«
Der Alte schüttelte den grauen Kopf. »Geh, Mutter! So ein junges Blut? Und soll einen Gesellen suchen, vor dem alles ein Grausen hat, was lebt?«
»Du bist mir einer!« Hanna zog den Faden lang und lächelte. »Sechsmal hast du den Tod schon getragen auf deinem Buckel. Und noch allweil hast du ein Grausen vor ihm?« Ein matter Seufzer schwellte die Brust der Greisin. »Mir grauset nimmer. Sooft ich denk an ihn, seh ich allweil nur ein Gesichtl, das mir lieb ist.«
Mit dem müden Geflüster der alten Frau vermischte sich der helle, jugendfrohe Klang des Liedes, das über die leis bewegten, leuchtenden Wipfel heruntertönte:
»Gegangen kommet Paar um Paar, Und Blumen tragen all im Haar. Sie heben an zu singen Und schlingen Den liebelichen Reien, Und preisen all den Maien: Huliadei! Sei willkommen, süßer Mai!«
Der jubelnde Laut verschwamm im wachsenden Wehen des Abendwindes und ging unter im Rauschen des Waldes, wie eine Kinderstimme versinkt, wenn rauhe Männer zu reden beginnen. Aus seinem Lauschen erwachend, blickte der junge Jäger auf. Sein Gesicht hatte sich warm gerötet. Oder war es nur die Glut des Abends, deren Widerschein auf seinen bleichen Wangen lag? Er deutete auf einen Pfad, der emporführte gegen die Waldhöhe, von der das Lied geklungen, und über die Schulter blickend, fragte er: »Geht hier mein Weg?«
»Nein, Herr!« erwiderte Hilpot. »Das Steigl führet hinauf zum Gotteslehen. Den Weg zur Linken mußt du nehmen.« Der Jäger folgte dem schmalen Pfad, auf den der Alte ihn gewiesen hatte, und verschwand im farbigen Schatten des Waldes. Da klang aus der Schlucht, zu der die talwärts sinkenden Waldgehänge sich verengten, ein heller Jauchzer. Betroffen blickte Hilpot auf, und halb in Freude und halb verwundert wandte er sich zu seinem Weib. »Hörst du ihn, Mutter?«
Hanna nickte. »Unser Bub!«
»Was kann ihn heraufführen, jetzt, wo er Falkendienst haben muß einen Tag um den andern? Was meinst du, daß er bringt?«
»Eine Sorg! Was sonst? Mit der Freud werden die Kinder allweil selber fertig. Da brauchen sie nit zu Vater und Mutter laufen.«
Eine kurze Weile, und unter den Bäumen trat ein junger Bursch hervor, stämmig und gesund, ohne viel Gedanken im harmlosen Blick der blauen Augen, doch mit der Farbe lachender Jugend auf den Wangen, um die sich das Blondhaar ringelte. Er trug das bunte Falknerkleid, das über die Brust herunter in die Farbe geteilt war, zur Hälfte rot und zur Hälfte grün. Der spielende Wind rollte ihm das gezaddelte Tuch der langen Schlitzärmel um die Hüften und machte die Strähnen seines Haares wehen. Auf der linken Faust, die in grobem Handschuh steckte, trug er einen isländischen Weißfalken, dem der Kopf mit der Falkenhaube bedeckt und die Schwingen mit der hirschledernen Kreuzfessel gebunden waren, so daß er keine Feder bewegen konnte. Als Hilpot den Falken sah, wußte er gleich, weshalb der Bub aus dem Tal heraufgestiegen war. »Tu dich nimmer sorgen, Mutter«, sagte er, »ich denk, der Falk hat eine Wann1 gebrochen, die ich spulen muß.«
Mutter Hanna atmete auf, während Hilpot seinem Buben entgegenging, den der Hund mit freudigem Gebell umsprang. »Gottes Gruß, Reinold!« sagte der Alte und bot seinem Buben die Hand. »Tust du dich auch wieder einmal anschauen lassen bei uns daheim?«
Reinold konnte den Gruß nicht erwidern, denn der Falke, den das Gebell des Hundes unruhig machte, zerrte mit den gebundenen Schwingen an der Fessel. Scheltend jagte Reinold den Hund zurück, nahm die Schwanenfeder vom Käppl und strich sie dem Falken ein paarmal schmeichelnd über den Rücken; das schien dem Vogel wohlzutun; er wurde ruhig. Verschnaufend nickte Reinold dem Vater zu. »Da schau, was ich bring! Mit dem hat mich der Herr heraufgeschickt, weil keiner das Spulen so gut versteht wie du.«
»Hat er eine Wann gebrochen?« Hilpot nahm seinem Buben den Falken von der Faust.
»Wenn’s nur eine wär! Zwei Wannen sind wurzab, und die dritte hat einen Letz gekriegt. Wie der Herr den Falken so gefunden hat, ist ihm das Weinen nah gewesen.« Reinold wischte mit dem Ärmel über die Stirn. Der rasche und steile Aufstieg hatte ihm warm gemacht. »Ich sag dir’s, Vater, wenn du die Wann nimmer spulen kannst, so kriegen wir Trauerzeit im Kloster und sehen bei unserem Herren kein Lachen nimmer, wer weiß wie lang!« Reinold zog die beiden Daumen ein und spuckte über die Schulter, um das gefürchtete Unheil zu beschwören. Dann ging er auf die Mutter zu. »Grüß dich! Hast du allweil gute Zeiten?«
»Wie’s der Tag bringt und nimmt.« Hanna legte die Spindel in den Schoß und faßte Reinolds Hand. Matte Röte stieg ihr in die verhärmten Wangen, als sie ihren Buben, den letzten von sieben, so vor sich stehen sah in lachender Jugend, strotzend von Gesundheit. »Und du? Wie geht’s dir?«
»Allweil gut! Bei einem Herren, der die Falken lieb hat, haben die Falkner sieben Feiertag in jeder Woch. Und Wein und Met und Mahlzeiten, daß man auseinand geht wie Hefenteig in der Wärm.« Er schlug sich lachend mit den Fäusten auf die Rippen und wandte sich an den Vater, der den Falken zur Hausbank trug. »Was sagst du?«
»Ein Falk, wie ich meiner Lebtag keinen zweiten gesehen hab, so schön und stark und stolz! Ich kann’s deinem Herrn nachspüren, daß ihm der Vogel wie sein Leben gilt. Schau her, Mutter«, auf der Faust hielt der Alte seinem Weib den Falken hin, »hätten wir den Haufen Gold, den der da gekostet hat, wir wären reiche Leut. Hundert Heimwesen wie das unsrige könntest du kaufen dafür, und es tat dir noch allweil ein Herrengut übrigbleiben.« Hilpot ließ sich auf die Hausbank nieder, nahm den Falken auf den Schoß, löste ihm die Kreuzfessel und begann die gebrochenen Schwungfedern zu untersuchen. Um den Falken bei Ruhe zu erhalten, streichelte ihm Reinold mit der Schwanenfeder den Rücken und plauderte dazu. Den Falken, erzählte er, hätte Herr Friedrich, der Propst zu Berchtesgaden, auf billige Weis erworben. »Wie unser Kloster in alter Kaisertreu nach dem Fall des Welfenfürsten Otto dem jungen Herren im Deutschen Reich die Huldigung schickte, hat der neue Kaiser unsere Stiftsherren gefragt: ›Wie heißt euer Propst?‹ Und wie sie ihm gesagt haben: ›Friedrich, wie du!‹, da hat der junge Kaiser gemeint: ›Wer Friedrich heißt, dem müssen die Falken lieb sein, so wie mir!‹ Und gut getroffen hat er’s.« Reinold lachte. »Die Stiftsherren haben ihm sagen können, daß es für unseren Fürsten liebere Kurzweil nimmer gab als Beiz und Federspiel. Und da hat der Kaiser, um dem Kloster alle Treu zu lohnen, unserem Propst den schönsten Eisländer aus seinem Falkenhof geschickt.«
»Den hat der Kaiser schon auf der Hand getragen?« fragte Mutter Hanna. »Der Kaiser?«
Seltsam hörte das Wort sich an auf diesen, welken Lippen, und hier in der Öde des Waldes, in diesem verlorenen Winkel der Berge. Weit draußen in der Ferne ging das wirre Leben einer stürmischen Zeit seinen eisernen Schritt, und nur selten brandete eine schon halb verrauschte Welle seines Lärmes in die verborgenen, von himmelhohen Felsen umschützten Täler. Ein Wort aber hat zu allen Zeiten seinen Weg auch zur entlegensten Hütte gefunden, wenn deutsche Herzen unter ihrem Dache schlugen.
»Der Kaiser!«
»Ja, Mutter!«
»Der mit dem roten Bart?«
»Aber Mutter! Der Rotbart ist doch lang schon tot.«
»Tot?« Sinnend schwieg Mutter Hanna.
Da sagte Hilpot: »Droben der Gotteslechner meint, das wär eine Lug. Der Kaiser Rotbart tät noch allweil leben. Daß er gestorben wär und im Judenland versunken in einem reißenden Wasser, das täten nur die anderen sagen, die Schiechen, die den Unfried machen in der Welt. Die sollten nur achthaben, meint der Gotteslechner. Eh die schiechen Unfrieder sich umschauen, war der alte Kaiser wieder im Land und tät die guten Zeiten wieder aufrichten und jedem geben, was sein Recht ist.«
»Geh, Vater, das ist unsinniges Gered. So was müssen doch wir im Kloster wissen. Seit der alte Rotbart tot ist, haben wir schon den dritten Kaiser im Land. Aber ich weiß schon, wie die Leut reden. Droben der Gotteslechner sagt: ›Der Rotbart.‹ Und drunten im Tal die bäurischen Dickschädel, die das rechte Frommsein noch allweil nit lernen wollen, die sagen: ›Der König Wute im Untersberg.‹ Jeder möcht, daß einer käm und tät ihm helfen wider den Klosterzins. Und der Gotteslechner?« Mit einem Seufzer spähte Reinold gegen den höheren Wald empor. »Wenn der auf einen Helfer denkt, ich mein, der wird seine guten Gründ haben.« Hilpot, der auf das Geplauder seines Buben nur halb geachtet hatte, erhob sich und setzte den Falken auf Reinolds Arm. »Ich spul ihm die Wannen wieder und mach ihn wieder heil zum hohen Flug, daß unser Herr seine Freud dran haben soll.« Er trat in die Hütte.
Freudenröte schlug über Reinolds Wangen; er wußte, daß ihm klingender Dank bevorstand, wenn er den verletzten Falken wieder flugfähig hinunterbrachte ins Kloster.
Da fragte Mutter Hanna in Unruh: »Was hast du sagen wollen vom Gotteslechner?«
Reinold zögerte mit der Antwort, »Ich fürcht, der Gotteslechner ist Freibauer gewesen die längste Zeit. Morgen kommen sie und büßen ihn um den Albenzins, als ob er ein höriger Bauer wär.«
»Der wird sich wehren.«
»Wie lang? Er sollt ein Einsehen haben.« Mit scheuem Ernst, als ginge ihm das Schicksal nahe, das dem Gotteslechner bevorstand, blickte Reinold wieder zur Höhe hinauf, um deren Wipfel das Gold des Abends in leuchtenden Wogen brandete. »Mutter? Wenn ich hinaufspringen tät und gäb ihm heimlich eine gute Rede, daß er sich fürsehen möcht?«
Erschrocken umklammerte sie Reinolds Arm. »Bub! Bist du gescheit? Willst du reden gegen deine Herrenleut? Tu deiner alten Mutter die Lieb und laß deine Händ von aller fremden Sorg! Schau lieber, daß dir selber kein widriges Steinl auf deinen jungen Weg fallt.« Sie erhob sich, und leise Worte murmelnd, bekreuzte sie ihm die Stirn und den Mund.
»Der Gotteslechner möcht wohl den Schnabel halten, wenn ich ihn warnen tät. Ich steh in linder Gunst bei meinem Herrn. Was könnt denn Übles kommen über mich?«
»Was über den lieben Tag kommt, wenn die Sonn versinkt. Und was ich fürchten muß bei Licht und Finsternis, wenn ich denk, daß ich sechs verloren hab und du der letzte bist.«
»Geh doch, Mutter!« Ein Schauer rann über Reinolds Schultern. Dann reckte er lächelnd die jungen Glieder, hob den Falken hoch und schüttelte das Blondhaar. »Was tust du dich allweil sorgen? Ich leb doch und lach.«
Kalter Schatten fiel über Gehöft und Hütte; die Sonne war über die Wälder niedergetaucht, und nur um die Höhe, auf der das Gotteslehen stand, und um die beschneiten Berggipfel schimmerte noch der rote Glanz. Verschwommen hörte man die singende Mädchenstimme. Lauschend blickte Reinold auf. »Hörst du, Mutter? Sie singt.« Sein Blick begegnete dem ihren, und da wurde er verlegen. »Warum soll ich’s hehlen? Was tät mich der Gotteslechner kümmern! Aber mir bangt um das liebe Mädel!«
»Lieb und gut, ja, Bub, das ist sie. Aber kannst du ihr helfen?« Hanna legte den Arm um Reinolds Schulter. »Sei gescheit, Bub! Du hast lichte Augen, such dir eine lichte Freud!«
Reinold schwieg.
Zärtlich rüttelte ihn die Mutter. »Bleib daheim und schau dem Vater zu, wie er dem Falk die Wannen spult. Da lernst du was! Und essen und trinken mußt du auch. Hast du Hunger, Büebli?«
Reinold lachte schon wieder. »Allweil, Mutter!«
»Sollst was haben!« nickte sie ihm zu. Als sie zur Tür gehen wollte, hörte man von der steilen Waldhöhe den polternden Fall von Steinen. Im gleichen Augenblick trat Hilpot aus der Hütte.
»Sell droben steigt einer umeinand«, meinte Reinold, »da kriegen wir noch einen Haingart auf den Abend.«
Der Alte schüttelte den Kopf, nahm den Falken und setzte sich auf die Hausbank.
»Der kommt nit, Bub«, sagte Mutter Hanna auf der Schwelle, »heut nimmer, aber morgen wieder, wenn er müd ist von der heimlichen Pirsch, zu der ihn der Vater gewandet hat.«
Reinold schien zu erraten, von wem die Rede war. Erschrocken stammelte er: »Vater! Wenn sie’s merken drunten? Sie büßen dich, weil du ihm hilfst.«
Der Alte schwieg.
Mutter Hanna trat mit einem schweren Seufzer in die Hütte. »Sie suchen ihn drunten schon seit dem Morgen«, flüsterte Reinold dem Alten hastig zu, »und wenn sie’s ausspüren, daß du ihm wieder geholfen hast, das könnt schief ausfallen. Keiner im Kloster mag ihn leiden, alle Herren stehen im Zorn wider ihn.«
Hilpot nickte. »Mir ist er lieb. Er hat Jägerblut. Und geh’s, wie’s mag, ich muß ihm zu Willen sein. Er hat mir’s angetan mit seinen Glutaugen. Dem seine Seel ist kerzengerad gewachsen. Wenn ihn die anderen schelten, tun sie’s bloß, weil er besser ist als sie. Aber komm, Bub, tu mir helfen und leg den Falken in Zwang.«
Scheu blickte Reinold noch einmal über den Waldhang hinauf. Dann trat er zum Vater, faßte mit kundigem Griff den Falken an beiden Fängen und schwang ihn, daß der Vogel mit dem Rücken auf Hilpots Schoß zu liegen kam; der Falke flatterte und wollte sich wehren. Reinold gab ihm den Daumen und den kleinen Finger zwischen die greifenden Fänge und preßte ihm die drei Mittelfinger auf die Brust; nun lag der Vogel, ohne sich zu regen, nur die Spitzen der gespreizten Schwingen zitterten leise. Hilpot lächelte. »Recht so, Bub! Das Zwingen hast du mir gut abgeschaut. Und jetzt paß auf, das richtige Spulen mußt du noch lernen!« Mit bedächtiger Ruhe begann er an den gebrochenen Schwungfedern das Heilwerk, das in der ganzen Falknerei des Klosters keiner so sicher zu üben wußte wie der alte Hilpot.
Den Falken mit pressender Hand im Zwang haltend, kauerte sich Reinold auf die Erde nieder. In stummer Achtsamkeit verfolgte er jeden Handgriff des Vaters, der mit scharfem Messer eine der geknickten Schwungfedern an der Bruchstelle entzweischnitt und die beiden Teile der Federspule mit schief geschnittenen Rändern wieder aneinanderfügte, indem er eine leichte, mit Wachs überzogene Stahlnadel als Halt in das Innere der Spule schob.
»Gleich drei Wannen auf einmal!« sagte Hilpot, während er einen haarfeinen Leinenzwirn in eine dünne Nähnadel faßte und den Faden, um ihn zäher zu machen, mehrmals durch einen geschmeidigen Harzbrocken zog. »Das ist viel, Bub! Wie ist denn das Unglück geschehen?«
»Wie’s geschehen ist, weiß ich nit. Ich bin erst dazu gekommen, wie Herr Friedrich den Falken schon wieder auf der Faust gehabt hat. Und du kannst mir’s glauben, vor Kummer über seinen Liebling sind dem Herrn die Zähren im Aug gestanden. Wer hätt auch denken mögen, daß die heutige Freud ein so trauriges End nimmt? Die ganzen Wochen her, derweil der Falk in der Mauser war, ist der Herr alltag ein paarmal in die Falkenstub gekommen und ist vor der Stang gestanden, als hätt er darauf warten können, daß dem Falk ein Federl wachst. Ehgestern hat unser Meister ihm melden können, daß der Eisländer ausgemausert hat und wieder fertig ist zum Flug. In der ersten Freud hat der Herr für heut im Untersteiner Moor auf Reiher und wilde Schwäne ein großes Beizen angesagt. In der Nacht noch haben wir hinausreiten müssen zu den Grenzburgen und die Burgherren und Frauen laden. Die frommen Schwestern im neuen Klösterl haben Verlaub erhalten, daß sie mitreiten dürfen. Gestern auf den Abend sind von Salzburg die fahrenden Leut gekommen, ein ganzer Haufen, und drei ritterliche Singer sind im Kloster abstiegen, jeder mit seinem Falken und seinem Spielmann. Da hat’s im Refektori ein Liedersingen und eine Kurzweil abgesetzt, daß der Bruder Glöckner aufs Mettenläuten vergessen. Und draußen auf dem Untersteiner Anger haben die Küchenbrüder schaffen müssen die ganze Nacht, haben die Zelte aufgeschlagen und den Herd gemauert, und einen Karren um den anderen haben sie hinausgefahren mit Freßwerk und Wein und Gutigkeiten zum Beizmahl. Heut in aller Gottesfrüh sind drunten im Kloster schon alle Leut auf den Füßen gewesen, Herr Friedrich selber hat das große Hochamt abgehalten, und weil er seinem Lieblingsfalken eine reche Ehr hat antun wollen, hat er ihn vom Kredo bis über das Sanktus sitzen lassen zwischen Kelch und Meßbuch.«
Hilpot brummte ein paar unwillige Worte in seinen Bart. »Was meinst du?« Reinold sah verwundert auf.
»Ich mein, du solltest lieber schweigen und achthaben, wie man die Spul bindet.«
Reinold schien den Ärger des Vaters nicht zu begreifen. Wenn seine Aufmerksamkeit nicht durch den Duft des schmorenden Wildbrets abgezogen wurde, der aus Mutter Hannas Herdstube quoll, war er mit achtsamen Augen bei der Sache. Er sah es wohl nicht zum erstenmal, wie eine gebrochene Wanne »gespult« und »gebunden« wird, aber ihm fehlte die Ruhe und die geschickte Hand, um dem Vater dieses Falknerkunststück nachzumachen: die Bindnadel so sacht durch die Feder zu stechen, daß der Schaft nicht zersprengt wurde und jeder Stich eine Öse der in das Innere des Kiels geschobenen Spulnadel traf, und eine bindende Fadenschlinge so fest und gleichmäßig neben die andere zu legen, daß die zerschnittenen Teile der Feder unverrückbar wieder aneinander hafteten, und das klebende Harz so kundig zu mischen, daß es den Bart der Feder nicht verpichte, sondern an der Luft eintrocknete, sobald die Fadenschlinge gelegt war. Jedes kleinste Versehen machte die ganze Arbeit unnütz, und saßen die gebundenen Federn nicht wie angewachsen, so steuerte der Falke schlecht im Flug und war unbrauchbar für die Jagd.
Auf dem beschneiten Grat der Berge war der letzte Sonnenschein erloschen, und es fiel schon die Dämmerung über den Wald, als Hilpot die Arbeit vollendet hatte. Sich aufrichtend, hob er auf der Faust den Falken empor, der mit ausgespannten Schwingen schlug, als möchte er das Heilwerk seines Arztes erproben. »Der Schlag ist gut und sicher«, sagte der Alte, »ich mein, daß ich nichts versehen hab.«
Während die beiden mit prüfenden Augen den flatternden Falken musterten, ließ sich klirrender Hufschlag von einem steinigen Pfad des Waldes vernehmen. Sie blickten auf, und erschrocken stotterte Reinold: »Um Gottes Lieb, Vater, da kommt der Herr!«
*
Auf bunt geschirrtem Maultier, das von einem Knecht am Zügel geführt wurde und von der Mühsal des steilen Weges keuchte, kam Propst Friedrich unter den Bäumen hervorgeritten. Sein braunes Samtgewand, dessen Säume mit dem zarten, goldgelben Pelzwerk von der Kehle des Edelmarders verbrämt waren, glich einem ritterlichen Kleid, nicht der Tracht eines Priesters, den nur das goldene Kreuz verriet, das an breitem Seidenbande um den Hals geknüpft war. Der Abendwind, der dem Reiter entgegenwehte, lüftete das gestickte, von der Pelzkappe über die Ohren niederhängende Nackentuch und zeigte am Hinterhaupt den Halbmond einer spiegelglatten Glatze. Auch unter dem Rand der Kappe stahl sich kein Härlein hervor, die breite Stirn und die glatt rasierten Wangen des runden, lebensfreudigen Gesichtes glänzten wie poliert, und die kleinen flinken Augen blitzten in hellem Glanz. Klugheit und Erfahrung redeten aus dem Blick dieses Fünfzigjährigen, der dem Heil seiner Seele mit allen Mitteln gedient haben mochte, nur nicht mit Fasten und Pönitenz. Um die leicht aufgeworfenen Lippen lag der spöttische Zug des Mannes, welcher Welt und Menschen kennt und nicht sonderlich viel von ihnen hält. Dennoch sah man es diesem Gesichte an, daß es freundlich und in Nachsicht lächeln konnte. Jetzt freilich war es gerötet von der Mühe des Rittes, jeder Zug war in Erregung um das Schicksal des geliebten Falken. Diese ungeduldige Sorge hatte etwas von der Unruhe eines Kindes, das sich um ein zerbrochenes Spielzeug kümmert, weil es ihm lieb gewesen. Noch ehe das Maultier hielt, ließ sich Propst Friedrich schon aus dem Sattel gleiten. Ohne auf Reinold zu achten, der seinem Herrn mit scheuem Gruß den Saum des Ärmels küßte, rief er dem alten Jäger zu: »Wie steht es, Hilpot? Wirst du ihn heilen können? Oder ist er verloren für die Jagd?« Dabei streckte er nach dem Falken schon die Hände, die mit blitzenden Ringen besteckt und so schlank waren, so weiß und wohlgepflegt wie Frauenhände.
»Gottes Gruß, mein guter Herr!« Hilpot schwang den Falken. »Ich mein, er ist wieder heil zum hohen Flug.«
»Reinold!« rief der Propst in heißem Eifer, während er den Falken von der Faust des Jägers nahm. »Gib ihm das Spiel!«
Der Falke drückte ihm die Fänge tief in das Fleisch der ungeschützten Hand, doch Herr Friedrich achtete des Schmerzes nicht. »Das Spiel! Und wirf, was du werfen kannst!«
In Erregung hatte Reinold aus seiner Falknertasche das Federspiel hervorgerissen -- einen weißen Ball mit kleinen bunten Flügeln -- und seine junge Kraft zusammennehmend, schleuderte er das Spiel hinauf in die dämmerige Luft. Der wehende Abendwind erfaßte das bunte Ding und trieb es den Bäumen zu.
»Falko! Huliiih!« Mit diesem jauchzenden Rufe nahm der Propst dem Falken die Haube ab und schwang ihn. Gellend tönte der Schrei des Falken durch die Stille, mit hastig flatternden Schwingen stieg er senkrecht empor, ein sausender Stoß, und ehe das Federspiel noch zwischen die Wipfel der Bäume gaukelte, hatte der Falk schon seine Fänge in den Ball geschlagen. »Hilpot, das will ich dir danken!« rief Herr Friedrich. Er wollte einen der blitzenden Ringe lösen, doch vom Griff des Falken waren ihm die Finger aufgeschwollen, daß die Ringe wie angewachsen saßen. Da faßte er das goldene Kreuz auf seiner Brust, riß es vom Hals, daß das breite Seidenband in Fetzen ging, und warf das Kleinod dem Jäger zu. »Nimm!«
»Herr Jesus!« stammelte Hilpot erschrocken und streckte die Hände, denn er fürchtete, daß das Kreuz zur Erde fallen könnte. Er haschte es noch, bevor es den Boden berührte. Mit hellem Lockruf war Herr Friedrich auf den Waldsaum zugesprungen und hob dem niederschwebenden Falken die Hand entgegen. Reinold kam gelaufen und wollte ihm helfen. Mit eigener Hand löste der Propst das Spiel aus den Fängen, stülpte ihm die Haube über den Kopf und nickte gnädig dem jungen Falkner zu. »Bleibe bei deinem Vater! Ich gebe dir freien Tag für morgen.« Den Falken streichelnd und zärtlich mit ihm plaudernd, wandte er sich seinem Maultier zu und ließ sich von dem Knecht in den Sattel heben. Ohne Gruß ritt er davon.
Hilpot blickte ihm nach, und als er den Herrn im Wald verschwinden sah, hob er scheu das Kreuz an seine Lippen und sagte leis: »Komm, Bub, wir wollen’s der Mutter zum Kuß hineintragen. Die hat vor lauter Sieden und Braten gar nit gemerkt, daß der Herr gekommen ist.«
»Du!« Reinold hatte den Arm des Vaters umklammert und flüsterte: »Wenn sie hören drunten, daß du demselbigen da droben Gewand und Wehr gegeben hast, und sie wollen dich büßen, so sag dem Herren: ›Ich hab dir den Eisländer heil gemacht!‹ Und er bietet dir eine Gnad, statt daß er dich büßt.«
Der Wind, der über die Wipfel der Bäume strich, drückte den blauen Rauch zu Boden, der aus allen Lücken des Schindeldaches quoll, und spannte ihn gleich einem dünnen Schleier über das ganze Gehöft. Stärker hörte man die Bäche der höheren Berge rauschen, und von den Almen tönte ein langgezogener, dumpf murrender Laut -- der ferne Schrei eines brünstigen Hirsches.
Schwungfeder <<<
Kapitel 2
Im sinkenden Dunkel stieg der junge Jäger, der das Wams eines Toten trug, durch den Wald empor. In treibender Unruh klomm er aufwärts, wie einer, dem irrende Gedanken den Schritt beflügeln. Nur einmal hielt er inne. Der verwehte Laut einer Stimme hatte ihn aus seinem Sinnen geweckt.
Tief unter ihm, wo in der Dämmerung noch matt erkennbar eine Lichtung zwischen den Bäumen schimmerte, dort mußte das Gotteslehen liegen. Er hörte das Poltern des Balkens, mit dem das Hoftor geschlossen wurde, hörte das an Wolfsgeheul erinnernde Gebell eines Hundes, das heitere Lachen einer Magd. Nun kurze Stille. Dann wieder jenes jauchzende Lied:
»Huliadei! Sei willkommen, süßer Mai!
Die Stimme dämpfte sich und erlosch, als wäre die junge Sängerin ins Haus getreten.
Eine Weile stand er noch und lauschte. Als er zögernd weiterschritt, summte er die Weise vor sich hin. Er kannte das Lied. Wie lange war es her, seit er den süßen Klang zum erstenmal gehört hatte? Zehn Jahre? Oder länger noch? Er sann. Und jählings tauchte die Erinnerung in ihm auf. Eine weite, weiße Halle, an deren Mauern Waffen und Geweihe hingen, erhellt vom zuckenden Lichtschein der Wachspfannen. Draußen vor den Säulenbogen die flüsternden Linden und die stahlblaue Frühlingsnacht mit ihren Sternen. An langem Tische saßen die zechenden Lehensleute, jeder mit dem blanken Zinnkrug zwischen den Armen. Und gesondert von ihnen, neben dem Herdfeuer saß die Mutter in ihrem Stuhl. Und er, ein zwölfjähriger Knabe, an ihren Schoß gelehnt. Der Bruder betrunken unter den Zechenden; lauter klang seine Stimme als die Stimmen der anderen, und seine Faust machte auf dem Tisch die Krüge tanzen. Bei jedem Fluch und Schlag ging ein schmerzliches Zucken über die Stirn der stillen Frau. Dann blickte der Knabe in scheuer Sorge zu ihr auf und schmiegte zärtlich seine Wange an ihre zitternde Hand. Und als die Zechenden der Jagdgeschichten und des Trinkens müde wurden, schrien sie nach dem Spielmann und schwiegen. Da klang die Fiedel. Und dann das Lied:
»Huliadei! Sei willkommen, süßer Mai!«
Schwer atmend verhielt der Einsame den Schritt und preßte den Arm über die Augen, als möchte er das Bild der vergangenen Zeit verscheuchen. Hastiger stieg er durch den Wald empor; doch immer wieder summte und sang ihm die Weise durch Herz und Sinne.
Wie ein Lied doch wandern kann! Vom sonnigen, rebengrünen Frankenland bis zu den kalten, blauen Bergen. Und wie ein Lied doch Wunder wirkt! Wie es trösten kann! Und freundlich lügen! Ist ein Lied nicht wie ein Sonnenstrahl, der aus lichten Höhen seinen Weg auch in den kalten Schatten versunkener Wälder findet? Geschehenes wird ungeschehen, Vergangenes wird lebendig, und alles Kommende, das du fürchten solltest, siehst du verwandelt in frohem Bild. Hatte nicht der nahende Winter mit seinem weißen Mantel schon die Berge gestreift, lag nicht das Sterben über den Blumen und die kalte Herbstnacht über dem Wald? Dennoch hatte jene holde Stimme dort unten sonnenfroh und frühlingsfreudig aufgejubelt: »Sei willkommen, süßer Mai!«
Aus seinen Gedanken erwachend, blickte der junge Jäger im Dunkeln um sich her. Er hatte den Pfad verloren. Und suchte ihn nicht wieder. Geraden Weges begann er über den Waldhang emporzuklimmen. Immer wieder sperrte eine kleine Felswand, eine Kluft oder ein Wirrsal gefallener Bäume seinen Weg. Häufig strauchelte er bei der Hast, mit der es ihn aufwärts trieb. Oft rettete ihn nur ein kühner Sprung vor bedenklichem Sturze. Diese Mühsal erschöpfte ihn nicht, sie schien die Kraft seiner jungen Glieder zu steigern. Manchmal hielt er inne, spähte im Dunkeln umher, atmete tief und lachte vor sich hin, um sich im nächsten Augenblick über ein neues Hindernis zu schwingen, als wäre ihm dieser Kampf gegen die Finsternis, die ihn umdrohte, zu einer Freude geworden.
Endlich erreichte er das offene Weideland einer Hochalm. Auf vorgestütztem Bergstock, das Kinn über die Hände gelegt, schöpfte er Atem und blickte in die dunkle Runde. »Wie still und schön!« Es war in schweigender Nacht kein Windhauch mehr zu spüren. Gleich einem schwarzen Riesenhügel, durchwürfelt von den grauen Tönen kahler Blöcke, erhob sich das weite Almfeld, über dem sich der stahlblaue Himmel mit strahlenden Sternen wölbte. Ein Widerschein ihres Zitterlichtes blitzte hier und dort in den Eiskristallen, mit denen der Nachtreif die welken Gräser umspann. Von der Höhe des Feldes klang das Rollen gelöster Steine, und der Schrei eines starken Hirsches dröhnte durch die Nacht. Ein zweiter Hirsch gab zornige Antwort, nun schwiegen die Stimmen, und da klirrten die kämpfenden Geweihe. Zwischen prasselnden Steinen kam’s über den finsteren Hang heruntergesaust. Zwei schwarze Schatten flogen an dem Jäger vorüber und verschwanden im Wald. Der Starke hatten den Schwächeren in die Flucht geschlagen, und mit stolzer Wildheit seinen Sieg hinausschreiend in die stille Nacht, stieg er wieder über den Hang empor. Noch eine Weile stand der Jäger und lauschte. Dann richtete er sich auf. »Haß und Liebe, Streit und Ringen bei allem, was Leben fühlt! Und dem klügsten aller Tiere, dem Menschen, predigen sie wider die Natur den feigen Frieden. Weil die Schwachen den Starken jagen wollen, soll er die Waffe seiner Kraft aus der Hand legen, soll lieben lernen, was er haßt, ehren, was er verachtet, meiden, was er begehrt. Wie mir ekelt vor ihnen!« Er schüttelte die jungen Arme. »Kampf! Wie schön bist du! Wie lieb ich dich!«
In dunkler Ferne dröhnte der Schrei des Hirsches, daß es widerhallte im finsteren Wald.
»Du und ich! Auf morgen!« Treibenden Schrittes stieg der Jäger über den Hang empor. Nach kurzer Wanderung kam er zu einer Almhütte, die schwarz im Dunkel lag. Die Tür stand offen, und man spürte noch den Dunst der Herde, welche die Alm vor wenigen Tagen verlassen hatte. Zögernd trat der Jäger in den finsteren Raum. Bei dem bläulichen Schein des Schwefelfadens, den er mit Feuerstein und Zunder in Brand versetzte, gewahrte er einen Haufen dürrer Äste. Als aus der Asche des Herdraumes die Flammen aufzüngelten, blickte er umher. Kahle, rußgeschwärzte Balken, ein zerklüftetes Dach und in der Ecke eine Stangenpritsche, mit zerlegenem Reisig bedeckt. Dieses Lager schien den Müden nicht zu locken. Oder fühlte er keine Müdigkeit? Er legte die Armbrust und den Bolzenköcher ab, warf ein paar klotzige Äste in die Flammen und trat ins Freie. Neben der Tür ließ er sich auf einen Holzblock nieder. So saß er, die Arme um das Knie geschlungen, und blickte sinnend in die Nacht hinaus.
»Einsame Stille! Wie bist du schön! Und wie süß das wäre, solch ein Schweigen ewig zu genießen, im Tod seiner Ruhe bewußt! Ob der Tod die Ruhe bringt? Sie sagen: nein!« Der Jäger lächelte vor sich hin. »Himmelsfreude dem Guten, Höllenqual dem Bösen? Wie klein und menschlich wäre Gott, wenn er lohnen und strafen würde gleich einer Kindermagd. Dem guten Kind den Honigkuchen, dem schlimmen die Rute. Wie sie erbärmlich von ihm denken!« Wieder lächelte er. »Und wer ist gut? Der denen dort unten wohlgefällt und zu ihrem Nutzen handelt? Wer böse? Der seine eigenen Wege geht und seine Kraft gebraucht, um sich der anderen zu erwehren? Sieht Gott nicht heller als diese Blinden in ihrem Eigennutz? Und wenn er auch die Starken haßt, weshalb erschuf er sie?«
Fern und verschwommen klang ein Jauchzer durch die Nacht, und in der Tiefe, wo zwischen den Buchenwäldern die Niederalmen lagen, glomm ein winziger Lichtschein auf. Die Almendirn, die den Gruß ihres Liebsten vernommen hatte, mußte die Tür der Hütte geöffnet haben, damit das Herdfeuer dem Kommenden leuchten und ihm sagen möchte: »Sieh, wie ich brenne für dich!« Hell und weich, wie eine schwingende Saite, klang der freudige Jodelruf der Sennerin, ihr Bub gab jauchzende Antwort, und die beiden Stimmen umschlangen sich in der schweigsamen Nacht und flossen ineinander zu einem einzigen Laut. Sie verstummten. Und der Lichtschein dort unten erlosch.
»Zwei Herzen, die sich suchen mußten und die sich fanden, damit aus ihrem Glück eine neue Not des Lebens wachse!«
Lange blickte der Einsame zur Tiefe nieder, wo der Lichtschein aufgeglommen und erloschen war. »Wieder eines von den tausend Rätseln, die ich nicht fasse und nicht löse! Daß es den Mann zum Weibe zieht, das Weib zum Manne? Sie sagen, das wäre das Tier im Menschen. Ob es nicht das einzig Göttliche in ihm ist, dieses jauchzende Sorgen für die Ewigkeit des Lebens? Wenn aber Gott das in die Menschen legte, weshalb soll es mir ein Fremdes bleiben? Weil ich geschieden bin von den anderen? Gelöst von allem Lachen des Lebens? Weil sie mir sagen: Wider die Natur zu leben, ist wohlgefällig vor Gottes Augen? Das Wort ist Torheit oder Lästerung. Kann ein Menschenwort die Zwecke Gottes hindern und die Natur verkehren? Wenn aber Gott das in die Menschen legte als einen Trieb, den das Lächeln eines Weibes weckt, wie in der Blume ein Sonnenstrahl den Willen zu blühen? Weshalb erwacht es nicht in mir? Mein Herz ist stumm und ohne Sehnsucht. Mich sehnt nach Ruhe.«
Tief atmend erhob er sich und wollte in die Hütte treten, vor der Schwelle blieb er stehen.
»Ob wohl auch meine Mutter sang, als sie jenen liebte, den ich nie gekannt? Ich habe sie nur schweigsam und weinend gesehen. Nein! Mir hat sie gesungen.«
Überwältigte ihn die Erinnerung an jene Zeit, da ihn das Lied der Mutter in Schlummer wiegte? Oder erwachte jäh in ihm die Sehnsucht der Einsamkeit? Er streckte die Arme in die Nacht hinaus: »Mutter! Mutter! Steh auf und komm und streichle mich! Mich dürstet nach deiner linden Hand. Sieh, Mutter, ich kenne nur Fäuste, die mich schlagen.« Mit den Händen das Gesicht bedeckend, lehnte er sich an den Türpfosten. »Und wenn sie mich quälen bis aufs Blut, nur alles Schöne, an das ich noch glaube, Stück um Stück aus der Seele reißen? Das nennen sie Himmelsdienst und Liebe Gottes.« Er ließ die Arme fallen. »Mutter, wo bist du? Nirgends? Oder dort, wo sie sagen, daß die Guten sind? Über den Sternen? Sterne? Ein Wort, so leer, wie alle Worte sind! Leer? Nein! Sterne! Dieses Wort hat Glanz, weil das Rätsel leuchtet, das wir nennen mit ihm.«
Da fiel’s in der Nacht wie ein sprühender Funke vom Himmel herunter, einen langen Feuerstreif hinter sich herziehend, und erlosch in der Finsternis wie ein Stück glühender Kohle, das zerschlagen wird.
Der Einsame lachte vor sich hin. »Wenn auch die Sterne fallen? Was ist noch ewig in der Welt? Was hat noch Kraft, die alles überdauert? Nur die Asche, zu der alles Leben zerfällt? Und aus der das Leben wieder aufersteht, wie im Frühling die Blume aus dem Kot?«
Er stand eine Zeitlang regungslos. Dann schauerte ihn, als wäre ihm die Kälte der Nacht bis ans Herz gedrungen. Er kehrte in die Hütte zurück, schürte die Flamme und ließ sich am Feuer nieder. In der Wärme, die den züngelnden Flammen entströmte, schien eine matte Wohligkeit durch seine Glieder zu fließen.
So saß er, still, bis ihm die Lider fielen.
In der Herdgrube sank das Feuer, und dann glosteten die Kohlen mit dunkler Glut.
Als die Nacht schon auf den Morgen zuging, tönte durch die Bergwaldstille fern aus dem Tal herauf ein sanft verschwommener Hall, das Geläut einer Kirchenglocke. Leise klang es über alle Ferne her, kaum noch zu hören. Dennoch erwachte der Schläfer, wie einer, der gewohnt ist, um diese Stunde die Augen aufzutun. Verwundert sah er in der Hütte umher, die vom rötlichen Glutschein matt erleuchtet war. Dann lachte er vor sich hin und warf ein paar dürre Äste über die glühenden Kohlen. Mit Geprassel belebte sich das Feuer, und brütend starrte der Einsame in die züngelnden Flammen.
Aus diesem Sinnen weckte ihn der dröhnende Kampfschrei eines Hirsches. Mit hastigem Griff die Armbrust und den Köcher fassend, erhob er sich und trat ins Freie.
Wie Asche war das erste Zwielicht des Morgens über das Almfeld ausgestreut. Dort, wo die Sonne kommen sollte, waren die Sterne im fahlen Blau schon erloschen, gegen Westen flimmerten sie noch über den Bergen, deren gezahnte Grate mit grauen Linien das Dunkel durchschnitten. Scharf zog der Morgenwind von den Felsen nieder, die dürren Stauden raschelten, zu Füßen der Almgehänge rauschten die schwarzen Wälder, und das Murmeln der Bäche war wie ein müdes Lied.
Lautlos stieg der Jäger über das Almfeld empor und erklomm einen hohen Fels, der sich, von Krüppelföhren umwuchert, einsam aus dem kahlen Weideland emporhob. Auf der Zinne des Steines ließ er sich nieder, von Büschen gedeckt, spannte die Armbrust und legte den gefiederten Bolz in die Rinne.
Die schußbereite Waffe fest auf den Knien haltend, lauschte er hinaus in das Zwielicht. Er konnte hören, wie äsendes Wild sich näherte und vernahm den Lockton eines Muttertieres. Der Morgen dämmerte noch so grau, daß der Jäger kaum einen unbestimmten Schatten zu unterscheiden vermochte. Nur wenn von den Tieren eines den Grat des Almenhangs überstieg, war es mit schwarzem Umriß deutlich in den fahlen Himmel gezeichnet.
Da röhrte mit zornigem Schrei ein Hirsch, drei andere gaben Antwort zu gleicher Zeit. Dann wieder Stille. Jetzt ein Rennen und Flüchten im Grau, ein Schnauben und Keuchen, das sich entfernte und wieder näher kam. Ein junges Tier begann zu klagen. Den ängstlichen Laut übertönte der mächtig hallende Schrei des Hirsches. Welche Kraft und Leidenschaft in diesem wilden Liebesliede der Natur! Es widerhallte an den Felsen und im Wald, und von allen Seiten klang die Antwort, als wäre eine riesige Orgel in den Bergen aufgestellt.
Schon hatten die Augen des Jägers sich an das Zwielicht gewöhnt. Rings auf allen Gehängen des Weidelandes konnte er die huschenden Gestalten unterscheiden. Dieses Schattenbild der Leidenschaft, die zu ihm redete mit dröhnenden Stimmen, erregte ihn so heiß, daß ihm das Herz wie ein Hammer schlug. »Nicht Menschen um mich her! Nur Tiere! Wie mir wohl ist!«
Die Helle des Morgens wuchs, ein rötlicher Schein flog über den Himmel hin, und matt begann der Reif zu flimmern, der die welken Gräser umsponnen hatte. Dann war’s, als flösse eine rosige Welle von Licht auf alle Felsen und Wälder nieder.
Inmitten des Almfeldes stand ein Rudel Hochwild, dicht zusammengedrängt. Wenn von den Hirschen einer röhrte, wandten alle Tiere die Köpfe der Richtung zu, aus welcher der Schrei gekommen war. Das Rudel in weitem Bogen scheu umkreisend, irrten die schwächeren Hirsche am Waldsaum hin. Zwischen ihnen und dem Trupp der Tiere zog -- ein Starker, der seinen Besitz verteidigt -- der mächtige Platzhirsch über das Feld, dumpf röhrend, das stolze, reich verästelte Geweih zurückgelegt in den Nacken. Jedes Tier, das sich vom Rudel entfernen wollte, trieb er mit zornigem Sprung zurück. Jedem Hirsch, der Miene machte, sich zu nähern, zog er mit dröhnendem Schrei entgegen. Nur ein einziger wagte ihm standzuhalten. Als die beiden Kämpfer röhrend einander entgegenschritten, erkannte der Jäger die zwei Stimmen, die er am Abend vernommen hatte. Nach dem Probekampf in der Dämmerung des sinkenden Tages sollte der Kampf im Morgengrauen die Entscheidung bringen. Das schienen die Tiere im Rudel zu fühlen; erregt, mit langen Hälsen die Köpfe streckend, zogen sie Schritt um Schritt den beiden Streitern entgegen. Die lagen schon mit verflochtenen Geweihen aneinander. Fast schien es im Anfang nur ein Spiel zu sein, dieses Drängen und Schieben, Stirn an Stirn. Immer straffer spannten sich die Glieder der Kämpfenden, Steine und Rasenstücke flogen unter ihren Hufschalen auf, immer tiefer gerieten sie mit der Brust zur Erde, und in der Kühle des Morgens qualmte der weiße Dampf von ihren Leibern. Da holte der Platzhirsch keuchend aus zu einem gewaltigen Stoß. Der Gegner brach zu Boden und überschlug sich. Ein röchelnder Laut, und der Kampf war zu Ende. Taumelnd erhob sich der Besiegte und schlich dem Walde zu, den Kopf gesenkt und stumm in seinen Schmerzen. Der Sieger, mit stolz erhobenem Haupt und heiserem Schrei, sprengte auf das Rudel zu und trieb von den jungen Tieren eines gegen den Fels, der sich mitten im Almfeld erhob.
Da schwirrte die Sehne der Armbrust. Jäh den Sprung verhaltend, wankte der Hirsch. Er hatte den Schuß empfangen. Über seine Glieder rann das Zittern des Geschöpfes, das der Tod berührte. Dann, als wäre nichts geschehen, als hätte sein Leben noch die ungebrochene Kraft und alle Leidenschaft der letzten Stunde, reckte er mit dumpfem Röhren das Haupt, und während das Rudel in jagender Flucht dem Wald entgegenstürzte, stand er furchtlos und starrte in wildem Trotz den Jäger an, der sich mit jauchzendem Ruf aus den Büschen erhob und über den Fels heruntersprang. Das Tier schien seinen Feind zu erkennen und senkte das Geweih zum Angriff. Ein Sprung. Da wankte der mächtige Körper und stürzte zu Boden. Keuchend raffte der Hirsch sich auf und straffte gewaltsam die Glieder, die ihm nicht mehr gehorchen wollten. Zornig stampfte er mit den Läufen, taumelte wieder, und die schwindenden Kräfte zwingend, stürmte er dem Jäger entgegen. Der hielt den blitzenden Fänger bereit, trat beim Ansturm des Tieres ruhig einen Schritt zur Seite und stieß ihm das scharfe Eisen ins Herz. Röchelnd brach der Hirsch zu Boden, übersprudelt vom roten Quell seines Lebens. Trotz und Drohung funkelten noch in seinen brechenden Lichtern. Ein letzter Krampf durchzuckte die Glieder, die sich streckten. Und alles war vorüber. Mit gesenktem Eisen, von dem die roten Tropfen niederfielen, stand der Jäger vor dem gefällten Tier, erregt und ernst, noch ganz unter dem Eindruck der wilden Schönheit, mit welcher der Todeskampf dieses Geschöpfes auf ihn gewirkt hatte, das im freien Bergwald ein König gewesen.
»Kommt meine Stunde -- wer weiß, wie bald --, dann möcht ich sterben, wie dieses Tier gestorben ist, im Hochgenuß eines Sieges, in aller Kraft des Lebens, noch kämpfend um den letzten Atemzug, noch im letzten Blick den Trotz gegen die dunkle Macht, die mich mordet!«
Er ließ sich auf die Erde nieder und streichelt den starren Nacken des toten Geschöpfes.
Der wachsende Morgen leuchtete. Wie brennendes Blut lag es ausgegossen über die beschneiten Zinnen der Berge und über das steile Felsgewänd. Der klare Himmel flimmerte vom Licht, und ein gleißendes Strahlenbündel fiel durch eine Scharte der Berge über das Almfeld her, auf dem es still geworden. Der glitzernde Reif begann zu schmelzen, und der welke Rasen fing zu dampfen an. Mit goldig umglänzten Wipfeln stand der Wald, irgendwo in den Büschen flötete eine Ringdrossel, die ihre Sommerheimat noch nicht verlassen hatte, und die feuchte Erde duftete, als ob es keimen wollte in ihrem Schoß. Nicht ein Morgen im Herbste schien das zu sein, vielmehr ein Morgen, wie ihn der Frühling bringt, der süße Mai. Drunten im Tal der ziehende Nebel. Er war anzusehen wie ein Meer mit silbernem Gewoge, aus dem die sonnbeglänzten Berge aufstiegen gleich schimmernden Inseln. Hier und dort begannen die ziehenden Schleier sich zu klüften und ließen ein Stück des Tales gewahren mit winzigen Hütten und geteilten Feldern. Da klang es herauf aus der Tiefe, vom bergwärtsziehenden Sonnenwind getragen, wie ein ungeduldiger Ruf: das Geläut der Glocken.
Den strengen Mund umspielt von einem Lächeln, erhob sich der Jäger und blickte ins Tal hinunter. »Ich komme. Soll mir geschehen, was mag! Das war ein Morgen, so schön und frei, daß ich gerne für ihn büßen will ein langes Jahr.« Er wandte sich, schlug mit dem Fänger von den Krüppelföhren einen Haufen Zweige ab und bedeckte mit ihnen den gefällten Hirsch. Dann stieg er durch den Bergwald hinunter. Noch war er nicht lange unter den Bäumen gegangen, da sah er zwischen den welken Ahornblättern, die wie Blutflocken an den Ästen hingen, ein Geweih aus den wirren Büschen ragen. Dort ruhte ein Hirsch. Der Schritt des Jägers störte den Schläfer nicht auf. Es war der Besiegte, der nach dem Kampf das Almfeld verlassen hatte, nun verendet, im Tod noch blutend aus seinen Wunden. Mit einer Regung des Erbarmens blickte der Jäger auf das erloschene Geschöpf. »Unterliegen oder Sieger werden, der Schwache sein oder der Starke, hinter allem bleibt der gleiche Rest, das kalte Rätsel, das keiner löst. Wozu dann die Kraft? Wozu das Leben? Nur um die Erde zu düngen für ein Kraut, das nach uns wächst?« Er wandte sich ab, und während er hinunterstieg durch den Wald, achtete er nicht mehr des leuchtenden Morgens. Oft stand er lange wie einer, der den Weg verloren hat und nicht mehr weiß, wohin. Aus seinem Brüten weckte ihn ein Gruß. Der alte Hilpot war es. »Ich hab gedacht, Herr, ich müßt dich suchen.«