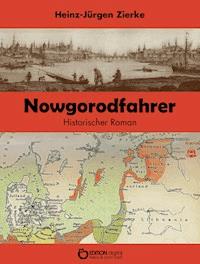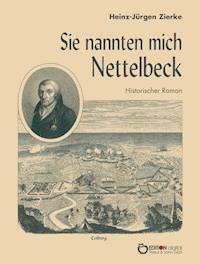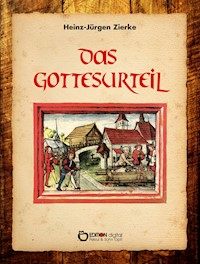
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wirbelnde Hufschläge und raue Landsknechtsflüche hallen durch die Heide. Der Heidereiter Peter Schulze ist mit einer Axt hinterrücks erschlagen worden. Der Mordstahl gehört Kersten Pyper, dem Müller von Belling, dessen Braut der Amtshauptmann Valentin Barfuß gefangensetzt. Liebt Barbara einen Mörder? Wird sie ihr Kind in Unehren zur Welt bringen müssen? Die dramatische Befreiung des Mädchens lässt drei Frauen in den Verdacht geraten, Umgang mit dem Satan zu haben. Doch auch die Folterungen bringen kein Licht in die Mordtat. Kersten stellt sich schließlich dem herzoglichen Gericht, weil er die Frauen vor dem Scheiterhaufen retten will. Er wird verstrickt in das Ränkespiel habgieriger Patrizier und landesherrlicher Obrigkeiten. Ein „Gottesurteil“ entscheidet das Ringen um Recht und Gerechtigkeit — die Liebenden aber, Kersten Pyper und Barbara Dittmers, müssen fliehen: eine Hansestadt öffnet ihnen die Tore. LESEPROBE: „Hast du Salz bei dir, Fuhrknecht?“ „Was soll’s mit dem Salz?“ „Spricht Christus, unser Herr: Habt Salz bei euch! Wenn das Salz schal und eure Späße abgeschmackt und dumm werden, so schüttet sie auf die Gasse.“ „Fromme Sprüche!“ „Des Herzogs Seiler drehen einen guten Hanf.“ „Angst also! Dachte ich mir’s doch. Chim Dittmer’s Kind liegt in Peter Schulzes Rattenkeller, und du zitterst, als ob eine Herde Flöhe auf deinem Rücken Hopser tanzte.“ Kersten sprang auf. „Dein Glück, du bist Gast!“, knurrte er, mühsam seinen Zorn zurückhaltend. Die beiden Männer standen sich in der dunklen Stube gegenüber. Gentz Barnekow war etwas kleiner, aber breiter in den Schultern und kräftiger in den Armen. Kersten mochte wohl behänder sein, denn er war ein gutes Dutzend Jahre jünger. Tews Lindemann wollte den aufkommenden Streit schlichten, wusste aber nicht recht, wie er das anstellen sollte. Als er sich aufgerafft hatte, um sich zwischen die beiden Kampfhähne zu werfen, die jeden Augenblick aufeinander losschlagen konnten, ließ Gentz Barnekow die schon erhobene Faust sinken und brummte: „Wenn die Mauer Risse hat, hält sie nach keiner Seite.“ Auch Kersten Pyper ließ sich wieder auf der Bettkante nieder. „Und was dann?“, fragte er mehr sich selbst als seine Gäste, „was ist, wenn wir den Herren unser Recht abgetrotzt? Sie werden’s nicht halten.“ „Sie müssen’s uns auf Pergament besiegeln“, schlug Tews Lindemann vor. „Pergament ist von Eselshaut, und der Esel ist ein geduldiges Tier“, gab Kersten zu bedenken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 435
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum
Heinz-Jürgen Zierke
Das Gottesurteil
Historischer Roman
ISBN 978-3-95655-274-8 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1965 im Hinstorff Verlag Rostock.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta unter Verwendung einer Buchmalerei in der Luzerner Chronik des Diebold Schilling von 1513
© 2015 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
1. Kapitel
Der Reiter hatte den holprigen Wiesenpfad hinter sich gelassen und jagte nun den schmalen Sandweg entlang dem schützenden Waldrand zu. Alle Augenblicke wandte er den Kopf, um nachzuschauen, ob ihm jemand folgte. Aber die Wiese lag unberührt da, noch in der frostigen Starre des frühen Märztages, und selbst hinten im Dorf, das sich lang und schwarz vor den graugelben Sandbergen hinstreckte, waren weder Mensch noch Tier zu sehen. Nicht einmal der halb verhungerte Hund des Küsters streunte heute um das Gehöft herum. Sicher hatte niemand bemerkt, dass der Mann den Kirchplatz verlassen, in aller Hast das schwere Pferd aus dem Stall geholt hatte und über den Hinterhof zu den Wiesen hinausgeritten war.
Der Reiter erreichte die kahlen Haselbüsche, hinter denen der hochstämmige Kiefernwald, die Heide, begann. Er hatte nicht Zeit, darauf zu achten, wie die ersten scheuen Knospen sich anschickten, die braune Rinde zu durchbrechen — der Februar hatte ein paar warme Tage gehabt—, und den nahenden Frühling ankündigten. Er jagte ungestüm vorüber und trieb das Tier, das, des schnellen Rittes ungewohnt, aus einem schwerfälligen Trab in einen kurzen Galopp und aus dem Galopp in einen müden Schritt fiel, immer wieder zu größerer Eile an. Der Sand flog in körnigen Stücken unter den Hufen davon. Zerfetzte Spuren blieben zurück. Noch hatte die junge Märzsonne nicht die Kraft, den Frost, der sich in der sternklaren Nacht wieder im Boden eingenistet hatte, schon in den Vormittagsstunden zu vertreiben. Durch das dichte Nadeldach der hohen Kiefern fand kaum ein Sonnenstrahl den Weg hinunter bis zum Sand. Hatte sich der Frost hier einmal verbissen, dann hielt er sich.
Der Reiter spürte die Kälte nicht, obwohl er nur eine Hose aus grobem braunem Wolltuch, wie es die Bauern selbst verfertigten, und darüber ein loses wollenes Hemd trug. Er jagte sein Tier voran, schalt es mit heftigen Worten, lobte es und klopfte ihm freundlich den Hals und presste dann wieder jäh seine klobigen Schuhe mit den dicken Holzsohlen dem hechelnden Pferd in die Weichen. Jetzt schaute er sich nicht mehr um; die Kiefern und die Haselbüsche verbargen, was hinter ihm sein mochte.
Das braune Haar hing dem Reiter wirr ins Gesicht, und wenn ein herunterhängender Zweig gegen seinen Körper peitschte, stob ein Kometenschweif grauen Mehlstaubs aus seinen Kleidern und verlor sich auf dem gefrorenen Sandweg.
Es war Kersten Pyper, Müller und Erbpächter zu Belling, einem kleinen Dorfe, das dem Hospital Sankt Spiritus zugehörte. Sein Vater war ein Pasewalker Bürger gewesen, ein Brauer, ehrlich, geachtet unter Meistern und Gesellen, aber arm. Seine Braupfanne hatte sich auf den ältesten Sohn vererbt, und so war Kerstens Bruder Tewes Bürger und Meister zu Pasewalk geworden. Kersten wurde als Müllerbursche in der Stadtmühle vor dem Mühlentore untergebracht. Er wäre sein Leben lang Müllerknecht geblieben, hätte er nicht zum Paten gehabt den Altermann des Brauergewerks, Thomas Steinkopf, der dem kräftigen und anstelligen Burschen sehr zugetan war. Dieser wackere, in seinem Handwerk wie im Geschäft gleich tüchtige Graukopf handelte, als Kersten zweiundzwanzig Jahre alt war, mit dem Präpositus von Sankt Marien und Vorsteher von Sankt Spiritus aus, dass sein Patenkind die durch den Tod des bisherigen Pächters erledigte Stelle des Wassermüllers in Belling in freier Pacht bekam. Der geistliche Herr konnte dem Brauer diesen Wunsch nicht abschlagen. Er war der Pasenelle, dem Pasewalker Bier, allzu sehr zugetan, mehr, als es seiner Gesundheit und seinem Berufe förderlich war. Schon hinderte ihn die Leibesfülle beim Betreten enger oder morscher Kanzelstufen. So hatte er es längst aufgegeben, in der Heiligen-Geistkirche zu predigen. Den Hospitanten tat ein Kirchgang nach Sankt Marien ganz gut. Auch nach Belling, dem Filial von Sankt Marien, ließ er sich nur jeden zweiten Sonntag fahren, wenn er nicht gar den Diakonus schickte. Da der Brauer die erste Pacht gleich in blankem sundischem Silber auf den gescheuerten Eichentisch gelegt und eine Kanne Pasenelle dazugestellt hatte, war Kersten Pyper zu Martini 1605 ein Müller geworden, dem Hospital zugehörig, aber frei geboren und frei geblieben.
Sowenig der Präpositus dem Gewerksmann und Ratsmann der Stadt, sowenig mag auch dieser seinem Patenkind allein aus christlicher Liebe geholfen haben. Die Wassermühle zu Belling war nicht nur eine Mahlmühle, sie war auch eine Schneidemühle. Und wo Holz geschnitten wird, wird auch Holz verschnitten. Sollte der Müller nicht so dankbar sein, seinem Paten, der ihm so viel Gutes erwiesen, zu billigem Holz zu verhelfen? Das Braugewerbe benötigt viel Holz, und je billiger dieses, desto süßer wird dem Brauer das Bier.
Nun hatte Kersten wirklich bald Freunde gefunden, nicht nur in Belling, auch in den Heidedörfern, in Liepe, in Jatznick und auch in Dargitz. Die Bauern aus den Dörfern brachten zwar nicht ihr Korn, Hafer, Gerste und Roggen, zu ihm in die Mühle, denn sie waren Zwangsmahlgäste in der Dargitzer Windmühle und in der Bullermühle zu Jatznick. Aber da sie von den kümmerlichen Erträgen ihrer kargen Sandböden kaum den Fleisch- und Kornzehnt an die Kirche und die Pacht und die Zugabe an das Amt begleichen, geschweige denn davon leben konnten, schlugen sie in der nahe gelegenen Heide Holz und verkauften es den Pasewalker Bierbrauern. Pyper hatte verschiedentlich für seinen Paten und für seinen Bruder bei den Heidebauern nach Brennholz gefragt. So war er zum Mittler geworden. Die Bauern wandten sich an ihn, wenn sie einige Fuder trockener Buchen, Kienen oder Ellern verkaufen wollten, und die Brauer wandten sich an ihn, wenn ihr Holzvorrat zur Neige ging. Da Kersten aus dem Handel für seine eigene Tasche keinen Vorteil zu ziehen verstand — er nahm für seine Dienste nicht einen grauen Groschen, weswegen ihn sein Bruder heimlich verlachte —, wussten sich die Bauern gut bedient. Sie gewannen Vertrauen zu ihm. Auch die Bürger waren zufrieden, fuhren ihnen doch die Gespanne aus Liepe und Jatznick das Holz weit billiger auf den Hof, als die herzogliche Kasse zu Torgelow jemals zu rechnen gewillt war.
Während Kersten Pyper durch die Heide nach Liepe jagte, dass der Stute grünliche Schaumflocken an den Trensenringen herabhingen, stand noch immer die Schar der Bauern und Kossäten auf dem Platz vor der Bellingschen Kirche. Auch die Frauen hatten die Herdfeuer gelöscht, die Mägde die Reisigbesen in die Ecke gestellt und waren den Männern nachgeeilt. Die Kinder folgten ihnen. Sie tollten zwischen den Erwachsenen herum, stießen hier jemand an, traten dort jemand auf die Füße und verstanden von dem, was da vorn vorgelesen wurde, kein Wort. Störten sie zu sehr, waren sie mit Winken und Blicken nicht zur Ruhe zu bringen, erhielten sie wohl auch einen Knuff oder eine Kopfnuss. Sie verlegten ihre Spiele dann um einige Schritte, und nur die Größeren drängten sich neugierig zwischen die Männer und Frauen, die erregt und mit heißen Ohren dem Prediger zuhörten. Die Kälte spürten sie nicht.
Es war dies der Präpositus von Sankt Marien und Sankt Spiritus. Dass er selber kam und nun gar mitten in der Woche, hatte das Dorf auf die Beine gebracht. Wilken Hanen, der Küster, hatte eine Bank aus seinem Hause holen müssen, eine recht breite, auf die sich der füllige Präpositus setzte, und eine Fußbank, auf die der geistliche Herr seine Füße legte, damit er sie sich nicht verkühlte. Noch andere seltene Gäste waren gekommen. Zur Linken des Geistlichen, etwas zurück, stand der herzogliche Heidereiter von Saurenkrug, sein Pferd am Zaumzeug haltend. Seine drei Knechte waren nicht abgesessen. Sie umklammerten ihre kurzen Spieße, als warteten sie nur auf den Befehl, auf die Bauern einzustechen. Ihre Gäule, in den Zügeln kurz gehalten, tänzelten unruhig hin und her; die Erregung der Menschen übertrug sich auf sie. Hätte es einer der mutwilligen Knaben gewagt, sie mit einem Stein zu werfen oder auch nur das widrige Summen der Bremsen nachzuahmen, die Tiere wären davongesprengt, ohne ihren Reitern zu gehorchen. Aber die drohenden Spieße der Knechte schreckten auch die übermütigsten Knaben zurück.
Der Heidereiter hatte aus seiner Satteltasche eine lange gesiegelte Pergamentrolle hervorgezogen, die er dem Geistlichen übergab, und dieser las nun daraus vor. Der Präpositus las mit hoher, tragender Stimme, wie er es von seinen Predigten in dem weiträumigen Schiff der Marienkirche gewöhnt war. Aber die Bauern, so angestrengt sie ihm auch zuhörten, verstanden ihn doch nur halb. Der Text war lang und hochdeutsch, wie sie es nur aus den Sonntagspredigten kannten — und auch da sprach der Präpositus, wenn er seinen Pfarrkindern so recht die Meinung sagen und ihnen für ihre vielfältigen Sünden die ewige Verdammnis androhen wollte, das heimische Platt. Überdies enthielt das Schriftstück so viel unverständliche, fremdländische Wörter, dass man hätte Advokat sein müssen, wenn man sie alle begreifen wollte. Aber eines verstanden sie alle, vom Schulzen Jürgen Möller bis zu Pawel Rülows schieläugiger Witwe, die schon am Stock ging: was ihnen der gnädige Herr Herzog durch den Präpositus und den Heidereiter auszurichten hatte, bedeutete nichts Gutes.
Und der Präpositus las: „... also hat Seiner Fürstlichen Gnaden, der hohen erheischten Notdurft nach, mit reifem, vollbedachtem Rat, aus allerhand bewegenden stattlichen und ansehnlichen Ursachen, zur Beförderung des gemeinsamen Besten Seiner Fürstlichen Gnaden Landschaft und Hintersassen, Seiner Fürstlichen Gnaden Torgelowschen Wald gänzlich geschlossen und darauf geordnet, dass hinfüro keiner, weder Seiner Fürstlichen Gnaden Bauern, noch sonst jemands, aus gedachtem Walde einige Eschen, Buchen, Eichen, Espen oder Tannen und Kienen weder zu verbauen, noch zu verkaufen oder sonsten in einige Wege hauen solle.“
Unter den Bauern entstand Unruhe. Um den Wald ging es also, um das Holz, das sie brauchten, um am Morgen die Suppe und mittags den Brei zu kochen, um Brot zu backen und an Sonn- und Feiertagen Fleisch zu braten, Holz, mit dem sie im Winter ihre Hütten und Katen heizten. Mit dem Silber, das sie für verkauftes Holz bekamen, bezahlten sie ihre Pacht, und für Holz tauschten sie sich in der Stadt Salz ein und Pajäewalker Bier.
Der Vorleser machte eine Verschnaufpause, schlug die Arme um den fülligen Leib und trampelte mit den plumpen Füßen, dass der Küster Angst um seine Fußbank bekam. Metke, des Küsters Eheweib, reichte dem Geistlichen einen Krug angewärmten Bieres, das den märzlich ausgekühlten Leib wohlig durchrieselte und das Blut schneller durch die Adern trieb. Auch der Heidereiter bekam seinen Krug.
Das Murren der Bauern wurde lauter, besonders in den hinteren Reihen, wo die Frauen standen. Pawel Rülows Witwe begann unflätig zu schimpfen. Sie drängte sich durch die Bauern, stampfte mit ihrer Krücke auf, schwang sie empor, als wollte sie sie dem Geistlichen an den Kopf schleudern, und schrie: „Da, nimm hin! Bring das Holz dem Herzog! Er soll es sich —!“ Drewes Kadow sprang hinzu, fiel ihr in den Arm, entwand ihr die Krücke und hielt ihr den Mund zu.
Dem würdigen Herrn da vorn auf der Bank war in der Aufregung ein Schluck Bier in die falsche Kehle geraten. Er hustete erbärmlich. Der Heidereiter gab seinen Knechten einen Wink. Die Reiter senkten ihre Spieße. Die Bauern wichen zurück und verstummten. Nun konnte der Präpositus weiterlesen. Der Heidereiter rief ihm noch zu: „Lest schneller, Herr! Die Bauern haben kalte Füße.“
Die Bauern ballten die Fäuste vor diesem Hohn, aber sie schwiegen.
Der Präpositus beherzigte den Rat des Heidereiters. Nur schnell fertig werden! Ihn fror. Das Bier hatte ihn nicht so erwärmt, wie sein Text die Bauern erhitzt. Er war ein friedfertiger Mensch. Streit mochte er nicht, und Aufregungen ging er am liebsten aus dem Wege.
Dass Kersten Pyper fortgeschlichen war, hatte niemand bemerkt.
Von Belling bis Liepe ist der Weg nicht viel weiter als eine halbe Meile, und Kersten Pyper, der mehr als die Hälfte der Strecke zurückgelegt hatte, rechnete sich einen ansehnlichen Vorsprung aus. Das Pergament war recht lang gewesen. Wenn der Heidereiter so lange wartete, bis der Präpositus das ganze Schriftstück verlesen hatte, musste er, der Müller, Liepe fast erreichen, bevor sich die Herzoglichen auf den Weg machten. Selbst wenn er für den Ritt nicht mehr als eine halbe Stunde rechnete, musste die Zeit, die er gewann, genügen, um die Bauern zu warnen. Vielleicht gewann er sogar noch mehr. Die Reiter hatten noch mehrere Dörfer zu besuchen, wenn sie allen Bauern im Beritt Saurenkrug die Heideordnung verlesen wollten. Sie würden deshalb die Pferde, um sie zu schonen, im Schritt gehen lassen. Die Lieper Bauern hatten, wie auch in den Jahren zuvor, in diesem Winter reichlich Holz geschlagen und es auf ihren Höfen zum Trocknen gestapelt. In den nächsten Tagen, zum Wochenende, sollte eine Last nach Pasewalk gebracht werden. Kersten hatte den Transport bereits Thomas Steinkopf angesagt. Zum ersten Male in diesen fünf Jahren, in denen er die Mühle betrieb und für Bauern und Brauer Holzgeschäfte vermittelte, hatte er es gewagt, vor Thomas Steinkopf hinzutreten und um eine Belohnung zu bitten. Der Alte hatte zuerst mit seinem zahnlosen Mund gelächelt und getan, als verstünde er nicht. Kersten wollte sich schon zur Tür wenden und die knarrende Holztreppe hinunterstürzen, enttäuscht, wütend, da versprach ihm Steinkopf zwar keine feste Summe, aber doch genug, dass er endlich daran denken konnte, Barbara zu sich in die Mühle zu holen. Dass nun das neue Gesetz dazwischenkommen musste!
Aufdringlich kreischte ein Eichelhäher. Die Stute erschrak und setzte wieder zum Galopp an. Wen wollte der Vogel warnen? Noch herrschte in den Kiefern und Tannen, in den Buchen und Eichen Winterruhe. Die Eichkater schliefen in ihren Höhlen, Rehe und Hasen scheuten die Nähe des Weges, und die Finken, Baumläufer und Spechte waren noch fern.
Bis zum Eintreffen des Heidereiters konnten die Bauern das Holz auf ihre Wagen verladen und ins Dickicht gefahren haben. Sie kannten den Wald und seine Verstecke. Später würde sich ein günstiger Tag finden, an dem man das Holz heimlich in die Stadt bringen konnte. Der Heidereiter war oft unterwegs, seine Knechte auch. Wenn der Weg nur nicht an Saurenkrug vorüberführte! Durch die Wiesen, wie jetzt Pyper, konnten sie sich mit den beladenen Fahrzeugen nicht wagen. Wenn der Frost wich, wurde der Weg weich und morastig. So musste List helfen — und Glück. Die Bauern waren klug. Im Wald muss man oft krumme Wege gehen, wenn man nicht die Bäume anrennen will.
Vielleicht blieb für Kersten sogar noch Zeit, bei Chim Dittmers ins Haus zu schauen, ein paar Worte mit Barbara zu sprechen. Barbara! Für sie wagte er diesen Ritt. Die Mühle brauchte eine Hausfrau. Zu Pfingsten, vor der Heuernte, sollte die Hochzeit sein. Drei Tage wollten sie feiern, wie das in den Bauerndörfern üblich war. Aber jetzt blieb keine Zeit, von Hochzeitsschmaus und Kutschfahrt durch die Dörfer zu träumen, keine Zeit, sich Barbaras schwere schwarze Zöpfe vorzustellen, ihre dunklen Augen und ihren lachenden Mund. Wenn die Bauern das Holz nicht in die Stadt bringen konnten, war Barbara für ihn verloren, für lange Zeit jedenfalls, vielleicht für immer. Gewiss, manch einer der Bauern in Belling, in Jatznick, in Dargitz oder Stolzenburg hätte mit Freuden des Müllers Werber in sein Haus gebeten, wenn er sie geschickt hätte. Reiche Bauern waren darunter, reichere als Chim Dittmers in Liepe. Und die Mädchen, die ihm gerne gefolgt wären, waren ansehnlich und arbeitsam, wie er sie sich nur wünschen könnte. Er aber ritt zu Barbara.
Er brach sich im Vorbeireiten einen trockenen Zweig ab und peitschte auf die Stute ein, die wieder langsamer geworden war. Der Zweig zerbrach nach dem zweiten Schlag in lauter kleine Stückchen. So viel Zeit, Barbara einen guten Tag zu wünschen, musste bleiben. Er musste nicht mit anpacken, wenn die Bauern die Kloben auf die Karren warfen. Er hatte genug für sie getan, wenn er sie warnte. Dann blieb Zeit für Barbara. Und wenn es nur zwei Worte wären!
Der Heidereiter durfte weder ihn noch sein Pferd in Liepe sehen. Der war imstande zu vergessen, dass Kersten Pyper kein | Amtsbauer war, sondern ein städtischer.
In einem hatte sich Kersten Pyper geirrt. Seine Verfolger warteten nicht, bis das lange Dokument Wort für Wort verlesen war. Der Präpositus hatte erst schneller gesprochen, dann manchen Satz und schließlich ganze Absätze fortgelassen. Was kümmerte es ihn, den Geistlichen und Bürger der Stadt, ob die Bauern die vielen Bestimmungen, Verbote und Strafen der neuen Heideordnung begriffen oder nicht! Wenn die Bauern weiterhin aus den herzoglichen Wäldern Holz entnahmen, hatte er keinen Schaden davon, eher Nutzen. Das Wort Gottes allein wärmt keine kalte Kirche. Und wenn die Bierbrauer ihr Holz vom herzoglichen Rentamt kaufen mussten, stieg der Preis der Pasenelle. So kam er denn bald an den Schlusssatz: „Gegeben zu Wolgast Anno Domini 1610, Philipp Julius“. Dann rollte er die Urkunde zusammen und reichte sie dem Heidereiter. Der verstaute sie sorgfältig in seiner Tasche. Sie musste noch in Liepe, Jatznick und in den anderen Dörfern des Amtes Torgelow verlesen werden. Allerdings brauchte das nicht der Pasewalker Geistliche zu besorgen, dem oblag die Lesung nur in den Dörfern seines Sprengels. In Liepe wollte Peter Schulze, der Heidereiter, selbst lesen. Er war stolz auf seine Lesekunst, die ihn, den geborenen Märker aus Lieberose, weit über die dummen pommerschen Bauern emporhob. Zwar hatten die herzoglichen Räte bestimmt, dass die Ordnung von den Kanzeln herab verkündet werden sollte, aber der Herzog war weit. In Liepe gab es auch keine Kanzel, von der herab die Ordnung verlesen werden konnte. Das Dorf war von jeher so arm gewesen, dass sich die Bauern nicht einmal ein Gotteshaus gebaut hatten. Den alten Prediger aber von Dargitz zu holen, in dessen Gemeinde die Bauern von Liepe eingepfarrt waren, eine Meile Wegs fast, kostete zu viel Zeit. Es war Alltag, und die Bauern sollten arbeiten, damit sie zu Martini die Pacht nicht schuldig blieben. Wozu auch einen Geistlichen bemühen! Der konnte aus dem Blatt keinen anderen Text herauslesen, als ein Weltlicher.
Der Präpositus erhob sich mühselig, vom Küster gestützt, und trampelte ein paar Schritte hin und her, um sich zu erwärmen und die steifen Glieder gelenkig zu machen. Der Heidereiter schob sein Sattelzeug zurecht, seine Knechte ließen ihre unruhigen Reittiere um den Anger traben. Die Bauern gingen langsam ihren Höfen zu, die einen noch schimpfend, die anderen nur nachdenklich, einige senkten die Köpfe, andere ballten heimlich die Fäuste. Alle, Bauern und Knechte, Frauen und Mägde, machten sich wieder an ihr Tagwerk.
Der Geistliche ergriff den Heidereiter, der eben aufsitzen wollte, am Arm und sprach auf ihn ein: „Komm mit mir, mein Sohn! Des Küsters Bier schmeckte schal und bitter wie eine abgestandene Brotsuppe. Ihr habt eine herzhafte Stärkung nötig. Ich weiß einen Bauern, der bezieht seine Pasenelle vom alten Thomas Steinkopf selbst. Die wird uns Leib und Seele erwärmen.“ Und er strich sich mit den fleischigen Händen seinen warmen Mantel glatt. Als Peter Schulze meinte, er sei in Eile und müsse noch in viele Dörfer, beschwor er ihn: „Schlagt nicht die Bitte eines alten Mannes aus!“
Lange ließ sich der Heidereiter nicht bitten. Er war einem guten Trunke nicht abhold. Die Zügel seines Braunen übergab er einem seiner Knechte und stiefelte hinter dem Geistlichen her. Auch der Küster trippelte mit, halb neben, halb hinter dem Präpositus. Immer wenn eine unebene Stelle kam, ein Stein im Weg lag oder eine gefrorene Pfütze überquert werden musste, fasste der schmächtige Küster dem massigen Priester an die Hüften, um ihn am Stolpern oder Ausgleiten zu hindern. Wurde der Weg wieder besser, ließ er los und schlug sich die Arme um den Leib.
Sie schlugen den Weg zur Mühle ein. Wer sollte sonst das gute Bier haben als Kersten Pyper, der Patensohn des Thomas Steinkopf?
Aber sie rüttelten vergeblich an dessen Haustür. Niemand meldete sich. Auch in Hof und Stall war niemand zu finden. Hinter der Mühle entdeckten sie endlich den Müllerburschen, der alte Säcke gegen einen Zaunpfahl schlug, dass die Mehlreste herausstoben. Der Bursche zuckte mit den Schultern, er wisse nicht, wo der Müller sei.
„Als ich im Dorf herumtrabte“, entsann sich der Küster und rieb sich sein graubärtiges Kinn, „um die Bauern zusammenzurufen, habe ich ihn gesehen und gesprochen. Und mir ist auch, als hätte ich ihn schimpfen hören, wie Ihr das vom verbotenen Holz auf hochdeutsch und lateinisch sagtet. Er zog dazu ein grimmiges Gesicht.“
„Gesicht, Gesicht!“, schimpfte der Geistliche, „bring mir den Müller her! Meine vom langen Lesen ausgedörrte Kehle dürstet nach seiner Pasenelle.“
In dem Heidereiter stieg ein Verdacht auf. Hatte er nicht den Müller allzu oft in den Heidedörfern herumlungern sehen, wo er nichts zu suchen hatte? Hatte nicht Berend Lange, der Bruder seiner Frau und Gerber in Pasewalk, davon gesprochen, dass der Müller den Bierbrauern Brennholz verschaffe? Er ließ den Geistlichen stehen und lief zurück in den Stall. Die braune Stute fehlte!
Er winkte seinen Knechten. Dem Präpositus, der mit des Küsters Hilfe auch wieder auf dem Hof angelangt war, rief er zu: „Lasst nur, Vater! Mich wird ein scharfer Ritt erwärmen.“ Damit sprang er auf sein Pferd und sprengte seinen Knechten voran im Galopp in die Wiesen.
2. Kapitel
Da saßen die vier Männer in den geschnitzten Stühlen rund um den schweren Eichentisch und schwiegen. Thies Adelberg an der Fensterseite, Thomas Steinkopf gegenüber, hatte sich zurückgelehnt und die Fingerspitzen aneinandergelegt wie zum Gebet. Er betrachtete den Balken, der die niedrige Decke in zwei Hälften teilte und die Hauptlast des Obergeschosses trug. Thomas Steinkopf war der Besitzer eines der wenigen zweigeschossigen Häuser der Stadt Pasewalk.
Der Balken ist fest und gerade, dachte Adelberg, das Haus ist nicht alt, wohl erst zwanzig Jahre; aber Steinkopfs Haare sind weiß und seine Zähne schwarz. Was mag er von uns wollen, dass er uns außer der Zeit zusammenruft? Marten Storken, ihm zur Linken, saß vornübergebeugt und stützte den Kopf in die breit auf die Tischplatte gestemmten Arme, sodass seine kräftigen Backenknochen in den rauen Handflächen zu liegen kamen. Storken wunderte sich nicht über die frühe Zusammenkunft, er dachte überhaupt an nichts. Obwohl die Märzsonne eben erst über die Stadtmauer emporgekrochen war, hatte der Altermann des Prenzlauer Viertels schon Mühe, seine Augen offenzuhalten. Zwar zog er mit dem kleinen Finger die Stirnhaut über den Augen hoch, sodass seine Brauen noch stachliger als sonst die schweren Lider beschützten, aber immer wieder senkten sich diese müde über die gelbgrauen Augäpfel mit der wasserblauen Iris.
Marquart Degener dagegen, der Storken gegenüber Platz genommen und seinen dunkelblauen Kragenmantel nicht erst abgelegt hatte, denn es war kalt in Steinkopfs großer Stube, die gleichzeitig als Amtszimmer des Brauergewerks diente, rutschte auf seinem Sitz hin und her. Die Hände hielt er unter dem Tisch in seinem Schoß und knipste mit den Daumennägeln gegeneinander, wie er das immer tat, wenn er aufgeregt war. Schließlich, da Steinkopf noch immer schwieg, hielt er es nicht mehr aus. Mit seiner heiseren, sich immer selbst überholenden Stimme fragte er: „Wo bleibt der Zugeordnete des Rates, Meister Steinkopf? Und auch den Secretarius des ehrsamen Brauergewerks vermisse ich, vermisse ich. Warten wir auf sie?“
Steinkopf, der mit unbeweglicher Miene an der Stirnseite des Tisches thronte, mit dem Blick auf die Giebelfenster, griff hinter sich und zog an der Schelle. Ein dünnes Bim-bim-bim klang durchs Haus. Dann klapperten helle Holzpantoffeln heran. Anke, ein fünfzehnjähriges Mädchen, das der Hausfrau zur Hand ging, trat ein, knickste artig und fragte nach den Wünschen des Herrn. „Fülle uns die Krüge, Kind!“
Die Holzpantoffeln klapperten eilig wieder davon. Steinkopf wandte sich nun seinen Gästen zu, den Altermännern des Brauergewerks: „Es ist nicht gut, über eine ernste Sache zu reden, solange der Mund trocken ist.“
Er schwieg erneut.
Auch die Brauer sagten kein Wort. Sie hatten sich in den langen Jahren, die Thomas Steinkopf Vorsteher der Brauerzunft war, daran gewöhnt, seine Art zu achten und seinem Worte zu folgen. Nur Marquart Degener knipste immer aufgeregter mit seinen Daumennägeln. Es hörte sich an, als ob eine Maus unter der Türschwelle nagte.
Endlich kam Anke mit den Bierkrügen, die gefüllt waren mit Pasenelle, dem besten Pasewalker Bier.
Thomas Steinkopf hob langsam den zinnernen Krug und nahm bedachtsam, als wollte er das eigene Bier auf seine Güte hin prüfen, den ersten Schluck. Seine Gäste gaben ihm Bescheid. Thies Adelberg stellte neiderfüllt fest, dass er ein besseres Bier niemals getrunken, nicht in Prenzlau und nicht in Anklam. Selbst das sundische Bier konnte sich mit Steinkopfs Pasenelle nicht messen. Und ihm selbst, der doch als einer der besten Brauer der Stadt galt, dessen Bier die stettinischen Kaufleute bis nach Schonen und Gotland führten, war eine solche Pasenelle nie gelungen. Man müsste wissen, wie der Alte das Bier ansetzte. Aber von wem sollte man’s erfahren? Steinkopf war ein Fuchs, wie sein Vater einer gewesen war und sein Großvater, dessen Bier die Kauffahrer der Hanse bis nach Spanien gebracht hatten. Und wenn der Fuchs heute den Viertelsleuten der Brauer von seinem besten Fasse schenkte, dann hatte er das wohl überlegt. Man musste achtgeben!
Der Alte hatte seinen Krug abgesetzt und begann: „Ich habe den Zugeordneten des Rates nicht geladen, weil es nicht klug ist, den Kapaun zu braten, bevor er gemästet. Die Zunftordnung, die in jener Lade liegt, in sauberen Lettern auf feines Pergament gemalt, sagt, dass ein Vertreter des löblichen Rates das Recht hat, an den Morgensprachen des Brauergewerks teilzunehmen. Wir aber halten nicht Morgensprache, wir müssten denn alle Zunftgenossen laden. Was uns heute zusammenführt, ist nicht gut für viele Ohren und Zungen. Gib dem Häher einen Ton, und der Wald singt ein Lied. Ich habe auch den Secretarius nicht gebeten.
Es ist nicht klug zu schreiben, bevor man gedacht hat. Und manche Dinge sind im Kopf besser verwahrt als in der Lade.“
Er setzte den Krug an und tat erneut einen tiefen Zug. Marten Storken nickte eifrig; er nickte so heftig, dass er fast sein Bier verschüttet hätte. Erschrocken hielt er den Krug mit beiden Händen fest.
Steinkopf richtete sich auf. Sein hageres Gesicht erschien noch schmaler, seine eingefallenen Wangen noch blasser, seine grünen Augen noch kälter. Seine Lippen, schmal und bartlos, öffneten sich nur wenig beim Sprechen. Seine Rede war leise und fast ohne Betonung; zwischen den Wörtern machte er oft Pausen, wie um Atem zu schöpfen und die Gedanken neu zu sammeln. Es war still, als er zu sprechen begann, selbst Marquart Degener hielt seine Daumen ruhig, sperrte den Mund auf und hörte zu.
„Gildemeister und Viertelsleute des Brauergewerks der Stadt Pasewalk! Euch ist bekannt die ,Ordnung und Bestellung der Torgelowischen Heide’, aufgerichtet von des Herzogs Räten, gegeben und gesiegelt zu Wolgast von Philipp Julius, Herzog beider Pommern und Fürst zu Rügen.“
Marten Storken nickte, achtete aber diesmal auf sein Bier. „Euch ist bekannt, dass die Brauer der Stadt Pasewalk die Pasenelle brauen aus Gerstenmalz und Hopfen, hierzu aber Holz vonnöten ist.“
Thies Adelberg zupfte sich an seinem schwarzen Kinnbärtchen und lächelte heimlich. Was redete da der Alte nur zusammen! Das weiß doch der einfältigste Brauerknecht. Ohne Feuer kocht die Maische nicht.
„Es ist bekannt, dass das Holz, welches durch städtische und herzogliche Privilegien uns gnädig bewilligt ist, kaum ausreicht, Bier zu brauen, soviel man selbst trinken mag, und auszuschenken im eigenen Viertel, nicht aber die Pasenelle auf den Markt zu bringen in den Städten des Herzogtums und über Haff und Meer, an die Küsten von Schonen, Dänemark und Polen.“
Ob es nicht doch gut wäre, gab Adelberg zu bedenken, den Vertreter des Rates zu bitten. Sache des Rates sei es, die Bürger zu schützen und ihr Gewerbe. Bäcker und Fastbäcker vor allem brauchten Holz, und gemeinsam könnte man den Rat bewegen, die Privilegien zu erweitern.
„Pferd und Reiter haben nicht immer dieselben Gedanken“, wies Steinkopf den Jüngeren zurecht. „Als in vordenklichen Zeiten der Rat und der Herzog den Gewerken die Privilegien ausschrieben, war Holz genug für alle Herdstellen der Stadt. Die Bäcker und die Knochenhauer, die Tuchmacher und die Huf- und Grobschmiede hielten ihre Zahl klein, und Meister konnte einer nur werden, wenn ein Meister starb oder hinwegzog aus der Stadt. Die Zahl der Brauer aber wuchs. Denn der Gildebrief sagt, dass keinem Ganzerben die Braugerechtigkeit zu verweigern sei, mag er auch für seines Leibes Notdurft sorgen durch Ackerbau oder ein anderes ehrsames Gewerbe.“
„Zur Sache!“, unterbrach ihn Adelberg.
Storken nickte, hielt aber erschrocken inne, als er bemerkte, dass er Adelberg Beifall gezollt hatte und nicht Steinkopf.
„Euch ist bekannt“, fuhr der Vorsteher fort, ohne auf den Einwurf seines Gegenüber auch nur durch ein Heben der Stimme oder schnelleres Sprechen zu reagieren, „dass das Holz, welches wir brauchen, um Bier zu brauen für den Handel auf dem Meer, bis Britannia und in die lateinischen Länder, von den torgelowschen Amtsbauern in die Stadt gefahren wurde.“
„Wir haben es ehrlich bezahlt“, zischelte Marquart Degener, „mit gutem sundischem Silber oder eingetauscht für süßes Bier.“
Adelberg verzog das Gesicht, wenn er an Degeners Bier dachte. Dass Steinkopf bessere Pasenelle als er selbst braute, wollte er zugeben, aber alle anderen standen weit hinter ihm zurück. Schließlich hatten die Brauer des Mühlenviertels nur deshalb Marquart Degener zum Altermann gewählt, weil er seine jüngste Schwester mit dem Stadtkämmerer vermählt hatte. Sie hofften, der Rat würde bei der Eintreibung der Bierziese nachsichtiger sein.
„Euch ist bekannt, dass Euch Euer sundisches Silber nichts nützt, Ihr müsstet dann das Holz vom herzoglichen Amte kaufen, das Klafter drei Groschen teurer.“
„Die Grütze wird heißer aufgefüllt als gegessen“, unterbrach Thies Adelberg wieder, „Ihr habt uns nicht gerufen, um mit uns zu lamentieren. Sagt, was Ihr von uns wollt!“
„Überlegen, was zu tun ist!“
Steinkopf trank seinen Krug leer.
„Drei Groschen teurer auf das Klafter“, rechnete Marten Storken, und seine Müdigkeit war verflogen, „dann kann ich meine Pasenelle in den Stadtgraben gießen und spare den Frachtlohn.“
„Auch die Gerste wird im Preis anziehen“, verkündete Thies Adelberg, „können die Bauern nichts am Holz verdienen, müssen sie’s beim Korn aufschlagen. Der Höker gibt ihnen um gute Worte und schlechtes Geld nicht Salz noch Tuch oder Eisen.“ Er rieb sich den Bart, stolz darauf, einen Gedanken ausgesprochen zu haben, bevor Thomas Steinkopf darauf gekommen war.
„Wir sind uns einig“, betonte Steinkopf, „die Heideordnung bedroht den Bestand unseres ehrsamen Gewerks, vor allem aber den auswärtigen Handel mit Pasenelle.“
Die Viertelsmeister nickten, auch Thies Adelberg. Sie alle zogen ihre Gewinne aus diesem Handel.
„Wird das Holz teurer, krümmt sich der Beutel. Kleiner Gewinn, in viele Taschen verteilt, bringt wenig in eine. Lasst uns die Zahl der Taschen verringern. Überlegen wir, ob es nicht gut wäre, den Brauern schlechten Bieres die Gerechtigkeit zu entziehen.“
„Unmöglich!“ Thies Adelberg erhob sich, um seinem Wort Gewicht zu geben. „Das schafft uns Feinde, macht die Brauer uneins. Wenn aber die Frösche Krieg führen, haben die Störche ein leichtes Fressen. Und“, er machte eine bedeutsame Pause, „warum sollen wir unsere Zahl verkleinern? Unsere Zahl macht die Stärke der Zunft, dass selbst das Viergewerk nichts ohne unsere Billigung beschließt. Das ist mein Rat: den Vorschlag des Bürgers und Vorstehers Thomas Steinkopf als nicht tunlich zu verwerfen.“
Er zog seinen Rock glatt, dass die Falten, die sich beim Sitzen in die Schöße gedrückt hatten, verschwanden, und setzte sich, stolz auf seine lange Rede, stolz vor allem, weil er dem Zunftvorsteher eine Niederlage beigebracht hatte, wie er meinte. Wenn er aber geglaubt hatte, Steinkopf zu verwirren, so hatte er sich getäuscht. Steinkopf sprach ebenso ruhig wie vorher, ebenso langsam und gedehnt: „So kalt ist kein Winter, dass das Unkraut vergeht. So lege ich denn in euer Urteil, ob es gut sei, in den Vierteln der Stadt, in den Dörfern, die um die Stadt herumgebaut sind, und für die Butenmenschen, welche in unseren Mauern sich an einem kühlen Trunke laben wollen, dem Quart Bier einen Pfennig aufzuschlagen. Die Pasenelle aber, so die Fuhrherren und Fuhrleute bringen zu Wagen und zu Boot in fremde Städte und fremde Länder, mögt ihr verkaufen für gleiches Geld wie bislang. Dass nicht die Prenzlauer ihr Bier handeln an unserer Statt. Sie ziehen das Holz billig aus ihrer Heide. Ist das Bier auch sauer, so ist es doch wohlfeil zu haben. Die Kaufleute wollen es nicht trinken, sondern Gewinn daraus schlagen. Für klingendes Silber verkaufen sie den Teufel in der Hölle, warum nicht auch Prenzlauer Bier? Sollen wir den Märkern, die unseren Vorvätern so oft mit Krieg und Brand zugesetzt, den Verdienst überlassen? Auch unsere Taschen sehen gefüllt glatt aus, leer aber faltig. Mag nun auch die Zeit schwer werden für manchen unserer Zunftbrüder; wer die Gerste gut weichet, dem gerät das Malz. Wir Brauer sind ein alter Baum, stolz über die Dächer hinausragend und mit breiter Krone. Der Stamm scheint noch knorrig und fest und die Krone licht und grün. Aber es sind viel dürre Äste darunter, und wir wachsen auf trockenem Boden, auf Sand und Geröll. Die Quelle, die uns mit Lebenskraft speiste, ist verschüttet. Ein kümmerlich Bächlein nur sickert noch. Blatt um Blatt wird fallen. Ast um Ast verdorren. Das kernige Mark wird verkümmern, trennen wir uns nicht vom toten Gezweig, das den Saft aufsaugt und doch nicht grünt. Mag die Krone lichter werden, Stamm und Äste werden fester. In bessern Zeiten mögen neue Knospen sprießen. Das sei meine Rede. Denkt nun und sprecht!“
Seine Zuhörer nickten, selbst Thies Adelberg, wenn auch erst nach einigem Zögern.
Steinkopf läutete wieder nach Anke. Während diese mit klappernden Holzpantoffeln in den Keller eilte, um die Krüge neu zu füllen, überschlug der grauhaarige Altermann des Stettiner Viertels und Vorsteher des Brauergewerks den Erfolg seiner Rede. Die Altermänner, die im Amt und im Viertel das Wort führten, waren fast gewonnen, damit schon halb das ganze Gewerk. Jeder hoffte, durch die neuen Preise einen ansehnlichen Groschen in seinen Beutel zu stopfen. Der alte Thomas aber rechnete weiter — bis zu dem Müller von Beding, seinem Patenkind. Kersten Pyper wollte heiraten, ein Mädchen aus dem Walddorf Liepe. Die Heide stand voller Holz, und die Nächte waren über den Wiesen grau von Nebel. Der Müller kannte die Wege durch Schilf und Sumpf und wusste auch ein Floß Stämme den Strom hinaufzustaken. Der Pate wollte an der Mitgift nicht sparen. Jeder Groschen kam zurückgerollt auf Holzkarren und geschwommen auf dem Ückerstrom.
Der alte Mann lächelte, als er die gekrausten Stirnen seiner Zunftbrüder sah.
Als Anke die gefüllten Krüge gebracht und jeder einen herzhaften Trunk getan hatte, hob Marquart Degener den Kopf, ließ seine Daumennägel ruhen und krähte: „Wohl, wohl. Ist es aber klug, zu verhandeln ohne den Rat? Wichtige Sache für alle Brauer! Gibt der Rat seinen Konsens nicht zu dem Pfennig Aufschlag, woher dann das Holz? Bedenklich, bedenklich.“ Und er sank wieder zurück in seine gebeugte Haltung, die Hände unter der Tischplatte auf den Knien, die Daumen gegeneinander.
Bevor noch einer erwidern konnte, polterten Schritte auf dem Flur. Eine schwere Hand riss die Tür auf, die in den Angeln knarrte. Herein trat ein Mann in einem grauen Rock, fast so lang wie ein Mantel. Seine Hosen waren grob aus ungefärbter Schafwolle gewebt. Seine Stiefel hatten klobige Holzsohlen und waren mit so viel Stroh gefüllt, dass die Halme aus den Schäften herauskrochen.
„Gott grüß euch, Bürger, Meister und Altermänner des ehrsamen Brauergewerks.“
Die lange Anrede machte dem Eintretenden sichtlich Mühe. Er hielt inne und wischte sich mit dem Rockärmel den Schweiß von der Stirn, wobei ihm die zerzauste Fellmütze ins Genick rutschte.
Vor Thomas Steinkopf, den Ältesten und Würdigsten der Runde, hintretend, überlegte er, suchte nach Worten und stammelte: „Die Braugerechtigkeit — um sie bin ich gekommen. Ich bitte euch, seit zwei Jahren …“
Steinkopf wies ihn an Adelberg: „Wohnst du nicht in der Böttchenstraße, Tews Lindemann, im Anklamschen Viertel? Dort sitzt dein Altermann.“
Lindemann wandte sich um. Adelberg erhob sich. Sein Gesicht wurde streng. Die schwarzen Brauen zogen sich zusammen, und über dem rechten Auge bildete sich eine kleine senkrechte Falte.
„Ist es nicht genug“, donnerte er, „dass du den Schmutz deiner Stiefel an meiner Schwelle abkratzt? Musst du mir auch noch folgen, wo ich zu Gast bin? Zwei deiner Brüder haben die Braugerechtigkeit, obwohl jeder Bürger weiß und jeder Büdner, dass nur ein Sohn eines Vaters seine Braugerätschaft erbt und seine Braugerechtigkeit. Das Gewerbe ernährt nicht eine unbeschränkte Zahl von Brauern.“
„Wenn’s an der Zahl liegt, Meister Adelberg, mein Bruder bekam die Braugerechtigkeit, weil er des Brauers Malten Dreeschen Witwe zum Weibe nahm. So ist kein Brauer mehr gewesen als zu Dreeschens Lebzeiten. Vor zwei Jahren haben ihn die Knechte des Klempenower Junkers Hans von Eickstedt erschlagen. Das Jahr vorher hatte sich sein Weib zu Tode gehustet. Es ist nur billig, dass ich seinen Stuhl im Amt einnehme. Wenn‘s an der Witwe fehlte, wollt ich‘s wohl machen. Gäb’s eine, ich wollte sie nehmen, zählte sie auch ein Dutzend oder eine Mandel über meine Jahre. Nennt mir nur eine!“
„Adelberg als Hochzeitsbitter“, grinste Storken.
„Geh mir“, stieß Adelberg hervor, der die Spöttelei mit halbem Ohr vernommen hatte, „vom Leib mit solch lästerlichen Reden!“
Tews Lindemann zuckte zusammen. Der große, schwere Mann schien einzuschrumpfen wie ein Roggensack, der ausgeschüttet wird. „Als ich aus dem Tor trat, kam ein altes Weib den Marktberg herunter. Wäre ich doch umgekehrt und hätte gewartet, bis mir ein junges Mädchen begegnete!“, murmelte er und verließ mit müden Schritten grußlos die Stube.
Marten Storken unkte: „Stirbt in den nächsten Tagen einer der Brauer, machen wir Lindemann den Halsprozess. Ich habe lange niemand brennen sehen.“
„Du brauchst um dein Leben nicht zu fürchten“, kicherte Degener, „deine Hausfrau ist zahnlos und böslaunig.“ Storken wollte auffahren, aber Thomas Steinkopf sprach schon: „Lasst uns Gedanke und Wort aufnehmen, wo uns der Tölpel unterbrach. Ich habe vor euch ausgebreitet, was Gott mir eingab zu dieser frühen Stunde. Ist mein Sinn auch euer Sinn, so wollen wir am Donnerstag Morgensprache halten im Gewerk. Sprecht, Brüder, mit den Meistern eures Viertels, dass wir uns einig sind in unserm Begehr und einig in der Forderung an den Rat. Es ist nicht gut, so des Rates Zugeordneter Streit sieht im Amt.“
„Der Rat soll seine Zustimmung geben, ohne einen neuen Akzisepfennig aufzulegen“, ergänzte Storken, der trotz seiner Schläfrigkeit ein knausriger Rechner war.
Nur Adelberg hatte noch einen Einwand: „Mag es nicht klüger sein, zum Herzog zu schicken und ihm unser Begehr vorzutragen? Wenn ein kluger, in Wort und Rede gewandter Mann“ — seiner Haltung war anzusehen, wen er für einen solchen hielt — „ihm unsere Sache vorstellt, mag er wohl geneigt sein, uns zu willfahren.“
„Kein Fürst verschenkt, und der Herzog von Pommern schon gar nicht. Wär‘s ihm nicht um den Pfennig, schlüge er nicht den Groschen aufs Holz. Ihr kämt nicht bis zum Herzog. Im Gestrüpp der Räte —“
Lautes Türschlagen und hallende, eilige Schritte unterbrachen den Redner. Die Tür wurde aufgerissen, und schnaufend schob der Präpositus seine massige Gestalt durch den Türrahmen.
„Der Müller“, keuchte er, „der Müller von Belling ...“
„Was ist mit ihm?“, fragte Steinkopf, ohne mehr als das Gesicht dem erregten Geistlichen zuzuwenden. Nur seine Augen flackerten.
Die Meister warteten gespannt,, dass der Präpositus endlich zu Atem kam und weitersprach. Sie wussten, dass der Müller des Brauers Holzgeschäfte betrieb.
„Sie jagen ihn!“
„Wer?“ Der Alte sprang auf. Sein schwerer Stuhl schlug um, fiel gegen die Schnur der Schelle. Schrilles Läuten gellte durch das Haus.
„Der Heidereiter und seine Knechte!“, stieß der Präpositus hervor und sank in den Stuhl, den ihm Thies Adelberg hinschob.
Thomas Steinkopf, seine altersbleiche Haut war noch fahler geworden, bat: „Vergebt, Brüder, es ist mein Patenkind. Tut, wie wir beraten. Wir sehen uns Donnerstag zur Morgensprache.“
Zögernd verließen die Meister den Raum. Gar zu gern hätten sie Näheres vernommen. Thies Adelberg schritt erhobenen Hauptes hinaus, da er den Vorsteher in Verwirrung gesehen hatte. Auch Anke, das Mädchen, und Katherina, die Hausfrau, die auf das wütende Bellen der Glocke herbeigeeilt waren, hieß Steinkopf, an den Herd zurückzukehren. Dann riegelte er die Tür ab, hob bedächtig den umgefallenen Stuhl auf und rückte ihn ganz dicht an den des Präpositus heran.
3. Kapitel
Auch in dem Walddörfchen Liepe leistete der Winter dem hereinbrechenden Frühling erbitterten Widerstand. Die warmen Februartage hatten den Schnee von den Feldern und Waldwiesen weggetaut. Die von den niedrigen Dächern herabhängenden Eiszapfen hatten ausgetropft. Nur in versteckten Winkeln fand man noch hie und da ein Häufchen zusammengeschmolzenen Schnee, ein paar Brocken körniges Eis.
Doch der Winter wollte sich nicht geschlagen geben; er kam wieder, wenn auch nicht mit Schnee. Er schickte in den klaren Nächten erbitterten Frost über Wälder und Wiesen, der dann erst gegen Mittag vor den schräg einfallenden Sonnenstrahlen wich.
Wenn die Bauern aus den schlafwarmen Räumen vor die Häuser traten, zitterten sie in der Kühle. Aus den Stalltüren schlug ihnen heißer Dunst in weißen Schwaden entgegen. Die Ücker floss noch träger als an den warmen Frühlingstagen durch die sumpfigen Wiesen; sie mochte sich vor Kälte nicht bewegen.
Barbara schlang das Tuch fester um die Schultern.
Vor Mondwechsel änderte sich das Wetter nicht, hatte der Vater gesagt, und darauf konnte man sich verlassen. Der Vater war jeden Tag vom ersten Grau des Morgens bis in das tiefe Schwarz der Nacht in frischer Luft, in Hof, Wald und Feld. Er konnte das Wetter voraussagen aus dem Flug der Schwalben, aus dem Gekrabbel der Ameisen und aus dem Netz der Spinnen. In der Wolle der Schafe entdeckte er den nahenden Regen; aus den Vierteln des Mondes las er von Sturm, Nebel und Sonnenschein. Warum sollte Barbara auch auf anderes Wetter warten? Auf Regen vielleicht? In dieser Jahreszeit gab es für die Wäsche nichts Besseres als klaren Frost und einen leichten Wind.
Kaum hatte das erste scheue Morgenlicht das Dunkel zwischen den dürren Kiefernstämmen aufgehellt, als Barbara von ihrem Strohlager aufgesprungen war. Sie packte die Laken und die Tücher, die Hemden und die Röcke in die Holzeimer und eilte den Steg hinunter zur Ücker. Die Mutter, die eine warme Joppe übergezogen hatte, kam langsam hinterher.
Die beiden Frauen ließen sich auf dem Erlenstamm nieder, der vor undenklichen Jahren umgebrochen war und ins Wasser hineinragte. Sie stapelten die Wäsche vor sich und tauchten ein Stück nach dem anderen ins Wasser, das brennend kalt war, obwohl der Fluss kein Eis mehr führte. Die nassen Tücher bearbeiteten sie mit dem Waschholz. Die linke Hand, die die nassen Stücke hielt, war bald starr und steif, während sich die rechte vom schnellen Schlagen besser durchwärmte. Barbara war froh, als sie die beiden Eimer mit der sauberen, ausgewrungenen Wäsche vollgestopft hatte und sie ins Haus zurücktragen konnte.
Die gefüllten Eimer hängte das Mädchen in die Stricke des Tragholzes, dessen Kehlung sie sich in den Nacken schob. Einen Augenblick schien es, als sollte sie unter der Last zusammensinken. Aber Barbara war jung und kräftig und kannte den Schwung, mit dem man das Holz in die richtige Lage brachte. Saß es erst fest im Nacken, verteilte sich die Last. Barbara konnte sogar die Hände von den Eimergriffen lassen, sie musste nur achtgeben, dass sich das Gewicht nicht nach der einen oder anderen Seite hin verschob. Bei jedem Schritt schaukelte die Trage mit den beiden Lasten sanft auf und nieder. Barbara war gezwungen, sich ganz gerade zu halten und gleichmäßig zu gehen.
Mit der Länge des Weges drückte das Tragholz stärker auf ihre Schultern. Ihre Gedanken aber waren leicht und froh. Der nahende Frühling brachte nicht nur Sonnenschein und Wärme, grünende Wälder und blühende Wiesen. Auch der Tag würde kommen, an dem Kersten Pyper, der Müller, an des Vaters Tür klopfte, um zu fragen, wann er Barbara mit sich führen dürfe. Am Ostertag wollte er seine Hochzeitsbitter schicken, und am Freitag vor Pfingsten wollten sie nach Dargitz zur Kirche fahren, um sich einsegnen zu lassen. Der Vater wusste längst, dass sie beide ein Paar werden wollten, und er war recht froh darüber. Er kannte Kersten Pyper seit Langem. Vor Jahren hatte er sich in der Bellingschen Mühle einen Stamm zu Bohlen schneiden lassen, um den Schweinekoben auszubessern. Kersten hatte den Vater und die anderen Lieper Bauern mit den Pasewalker Bierbrauern bekannt gemacht, die für die Fuhre Holz zwei oder drei Groschen mehr zahlten als die herzogliche Amtskasse und noch gutes Bier dazugaben. Das Geld hatten die Bauern bitter nötig. Ihr karger Acker trug gerade so viel, dass sie sich selbst und das Vieh über den Winter bringen konnten. Der Mutter war Kerstens Broterwerb zu staubig. „Ja, ja“, sagte sie oft, „eitlem Müller wird nie das Mehl mangeln. Aber du bist das schönste Mädchen in der ganzen Heide, und auch in der Stadt mag es kaum eine geben, die mit dir in den gleichen Spiegel schauen darf, trotz samtener Kleider, seidener Tücher und silberner Spangen. Du könntest einem Herrn gefallen oder wenigstens einem Meister, der dich mit Atlas und Brokat behängt.“
Bei solchen Reden wurde Barbara unwillig, ließ die Mutter stehen und suchte sich anderwärts Beschäftigung. Sie wusste, wen die Mutter meinte. Aber sie wollte keinen Herrn und auch keinen Meister, gar nicht aber den Schneider, mochte er auch Samt und Seide in seiner Lade liegen und Umgang mit dem Amtshauptmann und mit adligen Herren haben. Sie wollte Kersten Pyper, wenn er auch nur ein Bauernmüller war. Staub im Hemd lässt sich auswaschen, Schmutz auf der Seele bleibt haften.
Plötzlich spürte sie einen Hauch im Rücken, kälter als der beißende Nordost, der ihr ins Gesicht wehte. Sie beschleunigte ihre Schritte, dass die Eimer hin und her schwappten.
„Bleibt stehen, schöne Barbara!“, hörte sie eine dünne, allzu weiche Stimme sagen. Eben hatte sie an diesen Menschen gedacht, ihn sieben Meilen fort von hier gewünscht. Nun ging er hinter ihr, einen Schritt wohl nur Abstand. Sie zitterte. Die Trageimer wurden schwer, wie mit Feldsteinen gefüllt.
„Ich hätt ein Wörtchen mit dem Fräulein zu reden“, begann der Verfolger wieder.
Wie garstig, dachte Barbara, mich Bauernkind Fräulein zu nennen!
Der Mann in dem bunten Kleid, das nicht recht in den strengen Morgen passen wollte, war jetzt neben ihr. Eine Wolke Bierdunst benahm ihr den Atem. Christian Pechule, der Schneider, griff nach einem der Eimer, um ihr zu helfen. Sie wollte ausweichen, schwankte und wäre fast gestürzt, hätte er sie nicht gehalten.
„Nun, nun“, rief er und ließ den Arm um ihre Hüfte, „nicht fürchten, Kind! Ich schütze dich, ich bin dir Fels und Hort in Glück und Unglück.“ Der Fels und Hort war fast einen halben Kopf kleiner als sie und seine Schultern nicht breiter als die schmalen des Mädchens.
„Lasst mich los!“, stieß Barbara hervor. Tränen brannten in ihren Augen. Erschrocken ließ der Schneider den Arm sinken.
„Gewiss“, entschuldigte er sich, „vor den Leuten ...“, und fuhr nach einer kurzen Pause des Nachdenkens mit breitem Lächeln fort: „Am Montag über acht Tage schicke ich meine Freibitter, die Rösser mit seidenen Bändern geschmückt, vor Chim Dittmers‘ Tür. Ich bin gewiss, dass meine Bitte bei Tilde, der Hausfrau, ein gütiges Gehör finden wird. Glücklich wie der Küster übers Osterlamm will ich mich preisen, ist das Töchterlein ein gehorsam Kind einer liebenden Mutter.“
Barbara hatte sich gefasst. Sie ging schneller, dass der Schneider neben ihr kaum mithalten konnte und ins Trippeln kam.
Antworten wollte sie nicht. Wozu Worte verschwenden? Mag auch die Mutter vom Schneider als Eidam träumen, den Hochzeitskuchen würde sie für diesen Menschen nicht backen, wenn Barbara und der Vater nicht davon essen wollten.
Pechule redete noch immer: „Als ich heute Morgen die Decke von mir warf und die Augen aufschlug, sah ich ein Spinnweb am Balken flattern. Man spricht, dann sei bald Hochzeit im Haus.“ Und seine katzgrünen Augen schmatzten an Barbara herum, an ihren braunschwarzen Flechten, die sie zu einem Kranz aufgesteckt hatte, an ihrem kräftigen Nacken, in den sich das Tragholz einschnitt, an ihren festen Armen, die sich um die Stricke der Trage spannten, und an ihrem wollenen Überwurf, der sich straff über die junge Brust zog und in losen Falten über die Hüften herabfiel.
„Ihr solltet Euch einen Strauchbesen binden“, antwortete sie endlich.
„Wie bitter, wie bitter, mein Kind!“ Er schüttelte missvergnügt den Kopf. Der Ton ihrer Stimme kühlte seinen Eifer. Er hielt es für klüger, das Mädchen jetzt allein zu lassen. Es sah nicht gut aus, wenn er mit hängenden Armen dahinging und das Mädchen die schweren Eimer schleppen ließ. Jeden Tag ein paar Worte, immer nur wenige Worte; eine gute Naht braucht viele Stiche. Im übrigen vertraute er auf die Mutter, die ihm gewogen war. Mit stolzen Schritten ging er davon, bemüht, die Beine wuchtig zu setzen, um sich den Anschein von Kraft zu geben. Die Arme schwenkte er fast wie ein Mäher die Sense, dabei schob er die Schultern nach vorn, dass selbst die Federn, die seine Haube zierten, aufgeregt wippten.
Christian Pechule hatte sich erst vor drei Jahren in Liepe niedergelassen. Der Amtshauptmann wies ihm eine wüstliegende Hofstelle zu, deren Wohnhaus leidlich erhalten war. Aber aus dem Schneider wurde kein Bauer. Er pflügte nach wie vor mit Nadel und Faden. Man sah ihn oft in des Amtshauptmanns Haus, und Barfuß, der sonst streng darauf hielt, dass die Bauern Zins und Ziese einbrachten, ließ Pechule ungeschoren, obwohl auf dessen Hufe nur Quecken und Zinnkraut wuchsen. Der Schneider säte nicht und erntete nicht, und doch klimperten in seiner Tasche stets graue Groschen und blanke Schillinge. Er besaß wohl geschickte Hände, aber das Schneidergewerk hatte ihn ausgeschlossen, weil er in der Morgensprache, trunken, den Altermann des Gewerks und den Ratssecretarius der herzoglichen Mediatstadt Ückermünde mit klebrigem Bier begossen hatte. Es hieß auch, aber niemand sagte es laut, er habe die geheimen Absprachen des Gewerks den herzoglichen Beamten zugetragen und dadurch einen Meister und drei Gesellen aufs Rad gebracht. In Ückermünde konnte er sich nicht mehr über die Gasse wagen, ohne von alten Weibern verflucht und von Kindern verhöhnt zu werden. Er selbst sprach gern davon, bald nach Wolgast zu ziehen, wo er des Herzogs Leibschneider werden sollte.
Das Mädchen eilte dem elterlichen Gehöft zu, hängte die Wäsche zum Trocknen über die Holzgerüste und schwenkte sich eine neue Last auf. Die Mutter wartete schon.
„Stipp die Schürze nicht ein“, warnte Tilde Dittmers die Tochter, als Barbara sich niederbeugte, um ein Laken im eisigen Wasser auszudrücken, „du bekommst sonst einen Trunkenbold zum Bräutigam.“
Dem Mädchen schoss das Blut ins Gesicht. Wollte die Mutter wieder von Pechule anfangen? Ihr vielleicht Ratschläge geben, wie sie ihm das Trinken abgewöhnen könnte: eine Handvoll Dill ins Kopfkissen nähen und um Mitternacht vier Vaterunser darüber beten, in jede Himmelsrichtung eines?
Richtig, die Alte begann wieder: „Wohl ist der Schneider nicht schön von Gesicht und Statur und hat auch einige Kirschblüten mehr erlebt als du, aber ein junges Pferd braucht einen erfahrenen Reiter …“
Sie hätte wohl noch mehr solcher und ähnlicher Reden hervorgesprudelt, wenn sie nicht durch das hastige Geklapper nahender Hufschläge aufgeschreckt worden wäre.
Ein Reiter? Die Bauern aus dem Dorf hetzten ihre Pferde nie in den Galopp, schon gar nicht in dieser Jahreszeit, in der das Futter knapp wurde und neues noch nicht heranwuchs. Die Tiere mussten geschont werden für Pflug und Wagen.
War es der Heidereiter? Aber der kam doch nicht über die Bellingschen Wiesen, die nicht zu seinem Revier gehörten. Barbara warf das nasse Laken, ohne es auszuwringen, über den Erlenstamm und rannte, die Mutter vergessend, quer über die Wiese und durch das Gebüsch zum Weg.
In dem heranjagenden Reiter erkannte das Mädchen klopfenden Herzens den Geliebten. Sie wollte ihm entgegenfliegen, aber Kersten rief ihr zu: „Lauf zum Vater, Barbara, und zu den Nachbarn! Sie sollen alles Holz, das auf den Höfen lagert, auf die Karren werfen und in die Stadt fahren! Der Heidereiter sperrt die Straßen.“
Barbara war ein bisschen enttäuscht, dass Kersten nicht ihretwegen gekommen war. Sie hatte ihn auch nur halb verstanden, aber sie lief doch ins Dorf, die Bauern zu benachrichtigen.
Die Männer sammelten sich auf dem Platz vor des Schulzen Haus, Frauen und Kinder kamen hinzu.
Barbara hörte Kersten sprechen, der berichtete, was er in Belling erfahren hatte. Sie sollten das Holz in der Stadt verkaufen, riet er den Bauern, bevor ihnen die Heideordnung aus amtlichem Munde bekannt sei und der Heidereiter das Holz einziehen könne. Die Männer, im langsamen und gleichmäßigen Ablauf des Arbeitsjahres nicht daran gewöhnt, schnelle Entschlüsse zu fassen, wiegten bedächtig die Köpfe.
Warum tun sie nicht, was er sagt? dachte Barbara. Wohl verstand auch sie nicht ganz, warum das mit dem Holzverkauf plötzlich so eilig sein sollte, aber sie fühlte, dass der Geliebte recht hatte. Er sprach nie viel. Sie hatten manche Stunde schweigend beieinandergesessen. Wenn er nun heftig auf die Bauern einredete, so musste er einen sehr triftigen Grund haben. Sie hätte den Männern zurufen mögen: Folgt ihm! Aber es gehörte sich nicht für ein junges Mädchen, sich in die ernsten Angelegenheiten der Bauern zu mengen.
Hans Bille schlug vor, das Holz zu verstecken, bis sich der neue Besen abgewetzt habe. Den Vorschlag unterstützte Jöching Wynke, der Schulze, der meinte: des Herzogs Räte hätten schon viel Papier mit Tinte beschwert, der Wind habe es jedoch stets bald wieder hinweggeweht. Und er gab zu bedenken, es könne nichts schaden, wenn das Brennholz in der Stadt sich verknappe, es ließe sich dann teurer verkaufen. Das leuchtete vielen ein. Aber auch der Müller fand Anhänger, besonders unter den Frauen, denen eine Laus im Kohl lieber war als gar kein Fleisch. Lautstark forderten sie, die Wagen zu beladen und die Pferde anzuspannen.
„Buchweizensaat und Weiberrat geraten alle sieben Jahre“, schrie daraufhin Thomas Kerwitz, ein Kossät, der dem Schulzen zu Gefallen sein wollte.
Metke Schwieneketel, die zungenfertige Witwe, keifte: „Leere Fässer geben hohlen Ton.“
Barbara bewunderte die Frau, die sich öffentlich mit den Männern herumstritt, obwohl sie noch recht jung war. Aber bei so einem Namen musste man wohl eine spitze Zunge bekommen. Spott lässt sich nur durch Widerspott schlagen.
Der Schulze wollte beschwichtigen: „Nichts überstürzen, kommt Zeit, kommt Rat!“
Metke höhnte: „Kommt Zeit, kommt Rat, sagte der Vater.
Aber nicht Hochzeit und nicht Heirat, jammerte das Mädchen.“
„Die Zeiten werden sich ändern.“
„Auf bessere Zeiten hat mein Großvater schon gelauert“, unterstützte Arndt Wupgard die Witwe, „und mein Enkel wird auch noch darauf lauern. Was ist, wissen wir, aber nicht, was kommen wird.“
Elsbeth, seine Ehefrau, pflichtete ihm bei: „Warum warten, bis der Kuckuck seine Eier selbst brütet? Retten wir, was noch zu retten ist!“
Thomas Kerwitz schrie: „Die erste Not muss gekehrt werden, sagte die Großmutter, da schlug sie den Brühtrog zu Kleinholz und heizte damit den Kessel fürs Schlachtwasser.
Metke Schwieneketel spottete: „Wer kahl ist, soll nicht mit dem Widder bocken.“
Kerwitz wollte auffahren und Metke für diese Anspielung auf seine einstige Schönheit mit dem Handrücken die Zähne putzen. Da mischte sich Christian Pechule ein: „Ist es Gebot des Herzogs, muss man ihm willfahren. Ist nicht Herzog Philipp die uns von Gott eingesetzte Obrigkeit? Es heißt in der Schrift: Seid untertan der Obrigkeit! Und es heißt: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist — das will sagen: dem Herzog geben, was ihm gebührt. Drum rat ich euch: Reizt nicht den Heidereiter als des Herzogs Boten durch unchristlichen Widergeist! Werft zusammen die Stämme und Kloben, die ihr wider die Ordnung gehauen, und schafft sie ins Rentamt zu Torgelow. Diesem aber“, er wies mit erhobenem Finger auf Kersten Pyper, „der ein Aufwiegler und Rebell ist, bindet und liefert ihn in des Heidereiters Hände!“
Dies gab den Ausschlag für den Müller. Ein Wutschrei brach aus dem Haufen. Die Männer fluchten, die Frauen zeterten, die Kinder johlten. Pechule hätte wissen müssen, dass niemand im Dorf seinen Rat wollte. Aber der Zorn auf den Müller machte ihn blind und taub.
Barbara hatte um Pyper gefürchtet, als sie ihn aber ansah, atmete sie auf. Kersten stand da und lachte. „Es eilt“, sagte er, „kommt der Heidereiter durch die Wiesen, ist er im Dorf, bevor die Wagen beladen sind. Reitet er aber erst nach Jatznick, so wird’s auch Zeit, er könnte vorher den Schlagbaum über die Straße legen. Mein Schade wär’s nicht, ihr aber verliert manch guten Groschen.“ - Er schob sich durch das Gedränge. Barbara wollte zu ihm, aber die Bauern drängten sich zwischen sie.
„Bauern und Kossäten!“ Barbaras Vater, Chim Dittmers, der sich bisher zurückgehalten hatte, rief ihnen zu: „Hören wir auf den Müller, der uns gut Freund ist, seit wir ihn kennen, der uns zu manchem schönen Pfennig verhalf! Oder wollt ihr jenem folgen, der die Nadel in der Hand und den Zwirn in der Seele hat?“
„An die Wagen!“, grölten die Jungen. „An die Wagen!“, forderten die Frauen. Auch die Männer stimmten zu. Selbst der Schulze brummte: „Wer sich unter die Kleie mengt, den fressen die Säue.“
Der Haufe lief auseinander. Die Gäule wurden aus den Ställen gezerrt und die Wagen an die Holzstapel geschoben, die hinter den Scheunen standen. Mann und Frau, Greis und Kind, alles packte mit an, warf Stämme, Stangen und Kloben auf die Leiterwagen.
Kersten und Barbara waren Hand in Hand zu Dittmers’ Gehöft gegangen. Die Mutter, die gerade die letzten Wäschestücke angeschleppt brachte, wollte dazwischenfahren, aber Chim drückte ihr die Zügel in die Hand. Sie hatte zu tun, die Pferde, die die Unruhe im Dorf spürten, zu halten.
Wohl kein Mensch im Dorf, der seine Hände gebrauchen konnte, stand müßig herum.
Doch. Einer griff nicht zu. Christian Pechule hatte sich hinter seinen Zaun geflüchtet. Er starrte Kersten und Barbara nach.