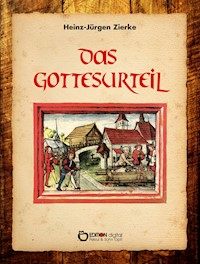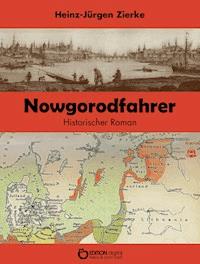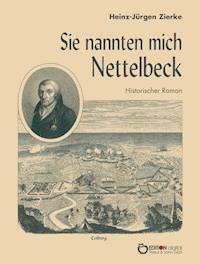
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Lehrer Scharrenberg, genannt Nettelbeck, flüchtet mit dem letzten Dampfer aus dem von der Sowjetarmee abgeschlossenen Kolberg. Er muss fürchten, dass seine Familie in der Stadt umgekommen ist. Um sich abzulenken, erzählt er sich selbst die Geschichte der erfolgreichen Verteidigung im Jahre 1807. So ist er vor der apokalyptischen Gegenwart in die Vergangenheit geflohen. Aber immer wieder drängen sich die Erinnerungen an die letzten Stunden in der brennenden Stadt dazwischen, und er selbst glaubt sich in Nettelbeck und Gneisenau wiederzuerkennen. Sein Freund und Schüler Harald Bögeholt, den er verletzt aus der Frontlinie trug, nimmt die Züge des Barbiergehilfen Philipp Püttmann an, der seine Braut gegen einen Schillschen Offizier verteidigen musste, und dieses Mädchen erscheint ihm wie seine Tochter Karla. 1807, damals, wurde die Stadt durch einen rechtzeitigen Frieden gerettet. Scharrenberg, obwohl er weiß, dass die Geschichte nicht wiederholt wird, sucht darin Trost und Hoffnung. Und doch kann er der Gegenwart nicht entfliehen. Seine dreihundert Gefährten, Frauen, Kinder, Greise, verlangen von ihm eine Entscheidung, die unter konträren historischen Vorzeichen einst Nettelbeck abverlangt wurde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum
Heinz-Jürgen Zierke
Sie nannten mich Nettelbeck
ISBN 978-3-95655-284-7 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1968 im VEB Hinstorff Verlag Rostock.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta unter Verwendung eines Bildes von Joachim Nettelbeck aus dem Brockhaus von 1821-23
© 2015 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
1. Kapitel
Unser kleines, überbelastetes Schiff, ein Bäderdampfer, stampft durch die ruhige See. Unser aller Glück ist die ruhige See; auch die diesige Luft bringt uns Glück, sie nimmt zwar dem Mann auf der Brücke die Sicht und verlangt Aufmerksamkeit von ihm; aber sie schützt uns, Frauen und Kinder, ein paar Greise und Invaliden wie mich und die Beamten, die sich in der Kajüte eingeschlossen haben sollen; sie schützt uns vor der Sicht von oben. Dieses Wetter lässt wohl keinen Sturm, keinen Seegang erwarten. Vielleicht kommen wir bis ans Ziel, wo mag es liegen? Das wissen wir nicht, vielleicht weiß es nicht einmal der Mann am Ruder.
Das Schiff liegt so schwer in der See, dass ich, der ich auf der schmalen Holzbank unmittelbar an der Reling, neben einer Frau, die immerfort Gebete murmelt, einen kümmerlichen Platz gefunden habe und auf die ebene, nur von den Dreiecken der Bugwellen aufgeraute Wasserfläche starre, die Hand bis an den Knöchel eintauchen könnte, ich brauchte mich nicht einmal vornüberzubeugen. „Zugelassen für 250 Personen Haff oder 220 See“, steht auf einer Tafel. „Mindestens 300“, erklärte mir einer der Schiffsleute, „ohne Gepäck.“
Ich werde die Hand ins Wasser tauchen, werde an den Wellen spüren, dass unser müdes Schiff sich bewegt, sich trotz allem vorwärtsbewegt. Ich werde ein Taschentuch durch das Wasser ziehen, um es mir dann auf die Stirn zu legen. Der Abend ist neblig und feucht und kalt, aber meine Stirn ist heiß. Ich möchte mir über die Augen wischen und die letzten Stunden auslöschen. Aber was hülfe es, wenn ich sie aus meinem Gedächtnis tilgte; ich kann die Ereignisse nicht ungeschehen machen. Und wenn ich es könnte, ich dürfte es nicht. Ich muss sie bezwingen, indem ich über sie nachdenke.
Ich entsinne mich, dass wir mit demselben Schiffchen, das uns jetzt einem unbekannten Ziel entgegenträgt, an einem Sonntag im letzten Sommer vor dem Kriege nach Swinemünde fuhren, meine Frau, unsere knapp zehnjährige Karla, mein Schüler Harald Bögeholt und ich. Harald wollte sich in Ostswine die Torpedoboote ansehen, mich interessierte mehr die Apotheke, in der Fontane seine Kinderjahre zugebracht hat. Die Besichtigung der Flottille war nicht mehr gestattet.
„Diesmal wird es ernst, Herr Scharrenberg“, hatte Haralds Vater nach unserer Rückkehr gesagt.
Damals unterrichtete ich nur Geschichte und in einer Klasse Mathematik, später, als die jüngeren Lehrer eingezogen waren, gab ich auch naturwissenschaftliche Fächer. Danach hatte ich mich gedrängt, um nicht mehr Geschichtsstunden übernehmen zu müssen.
Werde ich Harald wiedersehen? Er ist mir wie ein Sohn. Er sollte Lehrer werden wie ich; ich verschaffte ihm eine Freistelle an unserer Mittelschule und dann an der Lehrerbildungsanstalt. Als er vor drei Jahren in das kleine Städtchen jenseits der Oder abreiste, ahnte ich nicht, dass er einmal als Soldat nach Kolberg zurückkehren würde.
Luise erzählte mir mittags, dass Harald da gewesen sei und nach Karla gefragt habe, zuerst nach Karla, dann nach mir.
Den ganzen Tag habe ich auf ihn gewartet, bin nicht mehr aus dem Haus gegangen. Die Stellung der Batterie konnte nicht weit weg sein; ich wusste, feindliche Panzerspitzen waren bis an die See vorgestoßen, am Vormittag im Osten, nachmittags auch im Westen der Stadt. Harald würde in der nächsten freien Viertelstunde bestimmt kommen, glaubte ich, aber er kam nicht. Er kam auch nicht am nächsten Morgen. Der Unterricht fiel seit Tagen aus. Wir schütteten Stroh in die Klassenräume, damit sie Verwundete aufnehmen konnten. Tische und Bänke verluden wir auf Lastwagen, sie sollten zu Straßensperren aufgetürmt werden. Schulbänke als Straßensperren! Das nasskalte Wetter hatte mein Rheuma aus der Winterruhe aufgeschreckt. Der Direktor sah meine Bedrängnis, er schickte mich heim. Das hätte er sicher nicht tun dürfen, aber er glaubte, die Schmerzen rührten von meiner alten Verwundung her; auch die Schüler hatten das immer geglaubt, und das war gut so: ein ziviles Rheuma passte nicht in diese Zeit. Ich war froh, dass er mich ohne Fragen gehen ließ, und schlich mich nach Hause. Harald aber kam nicht. Ich legte meine Papiere, Manuskripte, Notizen, Exzerpte zurecht. Nimm das, mein Junge, wollte ich sagen, nimm es und führe zu Ende, was ich begann! Du bist jung; wenn du überlebst, und ich glaube, dass du überlebst, hast du noch viel Zeit vor dir, Zeit, die mir fehlt. Vielleicht hätte ich auch etwas anderes gesagt, wenn er gekommen wäre, wer weiß das schon! Man nimmt sich etwas vor, legt sich die Worte zurecht, aber wenn man sie aussprechen will, kommen ganz andere über die Lippen; es ist, als ob die veränderte Stunde neue Gedanken geprägt hat. Vielleicht geht es nicht allen Menschen so; Menschen, die wenig Gedanken haben, können sie vielleicht so sortieren, dass sie parat liegen, wenn sie gebraucht werden; ich bewundere immer wieder, dass Menschen, deren Enge ich kenne, doch zur rechten Zeit das Rechte zu sagen wissen, während ich, der ich mit meinen fünfundfünfzig Jahren so viel aus Büchern und aus dem Leben herausgelesen habe, immer in Verwirrung gerate, wenn ich sprechen soll. Also vielleicht hätte ich etwas ganz anderes gesagt, wenn Harald wirklich gekommen wäre. Er kannte eigentlich alles, was ich ihm zeigen wollte; in den Sommerferien hatten wir fast jeden Tag ein paar Stunden darauf verwandt, diese Blätter zu sichten. Eine Geschichte der Belagerungen Kolbergs wollte ich schreiben, die oft behandelten Vorgänge neu durchdenken, die belanglose, kleine Geschichte einer abgelegenen, unbedeutenden Seefestung aufrichten zum Modell für die Geschichte eines Volkes, keine militärwissenschaftliche Abhandlung, eine Geschichte von Bürgerstolz und Bürgertugend.
Vier Belagerungen hatte die Festung überstanden in den letzten zweihundert Jahren, einmal war sie unterlegen, dem gleichen Gegner, der heute vor den Toren stand, und als, fast fünfzig Jahre später, die Stadt mit diesem Land verbündet war, trotzte sie dem Welteroberer Napoleon. Dass die Geschichte der Belagerungen ein fünftes Kapitel bekam, ahnten wir im Sommer noch nicht.
Ich sah, dass Karla unruhig wurde, als Harald nicht kam. Sie putzte ihre Sonntagsschuhe, rieb sie mit einem weichen wollenen Lappen ab, und als sie längst glänzten, rieb sie noch immer. Wozu brauchte sie blanke Schuhe? Sie war zum Schippen befohlen mit der Klasse, aber sie ging nicht. Sie habe sich krankgemeldet, sagte sie, stellte die Schuhe ins Regal und zog sie wieder hervor, und wenn der Klopfer gegen die Haustür schlug, lief sie auf den Flur hinaus.
Auch Luise, meine Frau, war nervös. Sie verpackte Wäsche in Koffer, die ich in den Keller trug. Malte die Angst meiner Frau rote Flecken unter die Augen, oder steckte Karlas Aufregung sie an? Karla war erst fünfzehn. War? Habe ich „war“ gedacht? - Ich steckte meine Papiere in die Reisetasche; sie nahmen nicht viel Platz ein, ich habe eine winzig kleine Handschrift.
Harald Bögeholt kam nicht, aber gegen zehn Uhr erschien mein Freund Blissing, von Büssing, Major a. D., mein Batteriechef, zuletzt, als ich die Batterie übernehmen musste, mein Abteilungschef aus dem Krieg, der heute schon Sage ist. Blissing trug wie stets seinen grünen Rock, die schmucklose Forstmeisteruniform, aber heute leuchtete am Hals der achtstrahlige Stern des „Pour le mérite“.
Mit seiner Kommandostimme, die auch das lange Leben in der Waldeinsamkeit nicht gedämpft hatte, erklärte er: „Man kommt besser durch die Straßen mit dem Ding da, entgeht lästigen Fragen. Packen Sie ein, Scharrenberg!Koffer zu, Marschgepäck mitnehmen, eiserne Ration! Wir müssen uns absetzen.“
„Herr Major?“
„Keine langen Reden, einpacken! Oder wollen Sie Nettelbeck spielen? Ich spüre jedenfalls kein Talent zu einem Gneisenau. Bezweifle auch, dass Gneisenau in so aussichtsloser Position verteidigt hätte; war viel zu klug dazu, wusste genau, wann der Rückzug anzutreten ist, hat es bei Bautzen und Ligny bewiesen. Aber unser Schnürschuh-Napoleon? Pah, kein Wort weiter von dem! Der selige Imperator Rex hat seinerzeit wenigstens begriffen, dass er in den Zug nach Doorn steigen musste. Von diesem österreichischen Gefreiten kann man so viel Einsicht vielleicht nicht verlangen, wohl aber von den Herren mit den goldenen Schulterstücken, die sich in seinem Vorzimmer drängeln. Diesmal kommen wir nicht mit einer Matrosenrevolte, mit Arbeiterräten und mit einem Ebert davon. Ich ereifere mich wieder. Haben Sie einen Kognak im Haus?“
Ich hatte nur einen gewöhnlichen Richtenberger, mit dem ich Einreibungen machte, da es keinen Franzbranntwein mehr gab. Der Major trank und ordnete an: „Einpacken, mitnehmen! Um fünf Uhr abends sind Sie mit Frau, Kind und notwendigstem Gepäck in meiner Wohnung. Habe Sondergenehmigung, mit meinem Boot die Festung Kolberg zu verlassen.“ Er schnipste mit dem Finger gegen den Orden.
Ich fragte den Major nicht nach den Gründen. Mir fiel ein: Stadtrat Momm hatte schon vor drei Tagen davon gesprochen, dass im Notfall die Zivilbevölkerung die Stadt verlassen sollte. Er selbst war für den Abtransport verantwortlich. Dass dieser Fall so schnell eintreten würde, damit hatte er nicht gerechnet, auch ich nicht.
Und ich weiß noch immer nicht, wohin wir fahren.
Der Major war nach dem Kriege nicht in die Reichswehr übernommen worden. Durch seine Grobheit hatte er sich’s mit einigen Generalen verdorben und wurde als Forstmeister in die Neumark abgeschoben. Die Waldeinsamkeit bestärkte seine Verachtung für die Menschen, dennoch kehrte er nach seiner Pensionierung sofort nach Kolberg zurück. „Zuviel Bäume, zu wenig Wasser“, begründete er seine Rückkehr. Mit der neuen Zeit hatte er sich nie befreunden können, auch nicht mit der neuesten; in seinem Waldrevier hatte er vor ihr Ruhe, glaubte er. Wir standen die Jahre über im Briefwechsel; wir waren nicht immer der gleichen Meinung, aber er besaß bei all seiner Grobheit genug Toleranz, meine Auffassungen gelten zu lassen, auch wo sie ihm widerstrebten. Wir wurden älter und einsamer. Frühere Freunde zogen in Walhall ein, wie man jetzt sagte, andere fanden ihr Walhall auf Erden. Blissing verkroch sich in seinen Wald und später in die Kajüte seines Bootes, ich mich in den Staub der Archive.
Ich weiß, meine Schüler nennen mich Nettelbeck; in der Stadt nennt man mich wohl ebenso und lacht hinter mir her; selbst Kollegen tun das. Man hält mich für vertrottelt, aber auch das hat sein Gutes. So brauche ich, obwohl Vorstandsmitglied des Heimat- und Geschichtsvereins, nicht zu beweisen, dass das Feldherrngenie eines Gneisenau seine Erfüllung findet in dem - wie sagte Blissing gleich? - in dem Schnürschuh-Napoleon. Man machte mir nicht einmal ernsthafte Vorwürfe, wenn ich im Geschichtsunterricht die ältere Geschichte ausführlicher, die letzten Jahrzehnte dagegen überaus kurz behandelte. Lehrer sind knapp, seit alle jüngeren Kollegen, die nur halbwegs gesund sind, bei der Truppe stehen, und getreu der Tradition unserer Schule dürfen Frauen bei uns nicht unterrichten, nicht einmal Musik oder Zeichnen. Nur einer meiner Kollegen war unter vierzig, der einzige übrigens, mit dem ich mehr als die notwendigsten Worte wechselte. Er hatte ein Augenleiden. Aber jetzt hatte man ihn zum Volkssturm geholt.
Ich überlegte Blissings Angebot nicht lange. Ich trug die Verantwortung für die Familie und dachte an meine Manuskripte. Ich sagte Blissing zu, obwohl ich nicht wusste, und ich vergaß, danach zu fragen, wohin der Major wollte; vielleicht wusste er es selbst noch nicht. Bis jetzt weiß ich nicht, wohin das Boot steuert, das mein Kind aus der brennenden Stadt trug, oder ob ... ich darf so etwas nicht denken, ich will die Hoffnung nicht verlieren. Ich klammere mich an die Reling.
Harald kam nicht, und ich musste ihn sprechen. Wenn mir etwas zustieß, sollte Harald mein Werk weiterführen; einer von uns würde vielleicht überleben, dachte ich. Selbst wenn das Manuskript verloren ging, er war jung, konnte noch einmal von vorn anfangen. Dass er, der an der Front stand, dem Tode eher ausgesetzt war als ich, der Gedanke kam mir nicht; mir widerstrebte die Vorstellung, ich könnte in einer fremden Stadt an einem fremden Tisch meine Gedanken zu Papier bringen, während der Junge unter den Bülten der heimatlichen Salzwiesen vermoderte. Ich suchte ihn, und ich glaube, wenn ich nicht Nettelbeck gewesen wäre, man hätte mich als Spion eingesperrt. Die Batterie lag jenseits der Matzwiesen, nach Bullenwinkel zu. Der Weg fiel mir schwer. Nicht dass ich Furcht gehabt hätte! Ein paar Granaten heulten über mich hinweg, ich kannte den Ton von früher. Wenn sie nur nicht die Baustraße treffen! dachte ich. Im Augenblick der Gefahr nur an sich und seine Nächsten denken, ist das menschlich? Nicht die Todesfurcht machte mir den Weg zur Qual, sondern mein lächerliches, ziviles Rheuma. Da lebt man Jahrzehnte in seinem See-, Sol- und Moorbad und wird das Rheuma nicht los!
Ich sah Harald von Weitem. Er trug Granaten, trug sie von einem Wagen zu einem Stapel, und ich wunderte mich einen Augenblick, dass der Junge für eine solche Beschäftigung eingeteilt war. Er sah mich, blieb stehen und ließ die Arme sinken. Ich winkte, vielleicht konnte er mir ein paar Schritte entgegenkommen. Er winkte zurück, und ich meinte zu sehen, obwohl ich noch fünfzig Schritt von ihm entfernt war, wie seine Augen aufleuchteten. Ich wollte ihn zu mir heranrufen, aber bevor ich noch die Hand an den Mund legen konnte, begann der Unteroffizier, der weiter hinten am Geschütz stand, zu brüllen. Er brüllte, wie nur Unteroffiziere brüllen können, das war schon im vorigen Krieg so; aber seine Stimme klang nicht militärisch schrill, es schwang ein dunkler ziviler Ton mit, wie ihn alte Pastoren und junge Opernsänger an sich haben. Harald trat an den Wagen und nahm die nächste Granate in den Arm. Ich kannte das Kaliber: 15-cm-Haubitze, meine Waffe.
Der Unteroffizier wandte sich wieder ab. Ich ging weiter.
Mit dem Mann musste doch zu reden sein.
Eigentlich wollte ich mit dem Jungen ein paar Schritte zur Seite gehen, um die anderen nicht zuhören zu lassen - den Bauern in der angeschmutzten Lederjoppe, die Soldaten, Kinder, denen die Röcke lose um Schultern und Taille hingen. Wusste ich denn, wer sie waren? Tierpfleger im Wanderzirkus vielleicht oder Schusterlehrlinge aus einer Berliner Kellerwerkstatt, Waldarbeiter aus Tirol, Wollspinner aus den Sudeten oder Elsässer Gänsejungen, wer weiß? Ich habe nichts gegen diese Berufe und nichts gegen die Landschaften; ich habe gegen keinen Beruf etwas und gegen keine Landschaft, erkenne jede Arbeit für notwendig und jede Gegend für schön, auf ihre eigene Art schön natürlich. Aber ich konnte von diesen Menschen nicht, von keinem Menschen, erwarten, dass sie zu dieser Stunde auch nur ein Gran Verständnis aufbrachten für jetzt so Nebensächliches, wie ich es mit Harald bereden wollte. Sollte ich mich und alles, was mir als meines Lebens Sinn und Aufgabe galt, sollte ich Harald dem Spott dieser Menschen aussetzen? Ich sah stumpfes Hohnlachen in ihren Augen, vernahm die gewöhnlichen Worte, dieselben, die sie für Straßenkot und Querschläger, für unbeliebte Vorgesetzte und den Achselschweiß ihrer Mädchen benutzten. Vielleicht hätte ich alter Mann ihren Spott ertragen, hätte mich geschüttelt und die Belästigungen wie Schnee von der Schulter abgeworfen. Aber Harald? Würde nicht der Zweifel hervorquellen? Jugend neigt von Natur zum Zweifel am Glauben, am Tun der Älteren. Das ist gesund: wie kann Veraltetes überwunden werden, wenn nicht seine Berechtigung in Zweifel gezogen wird? Aber hier sollte kein Zweifel hervorbrechen und mit seiner Unlust alles überschwemmen. Die Mauer stürzt ein, wenn der Zweifel zum Mörtel dient.
In dem Augenblick dachte ich nicht einmal daran, dass Harald diesen Spott auch dann noch würde ertragen müssen, gröber vielleicht, schmutziger, wenn ich längst in Büssings Boot saß, einem unbekannten Ziel entgegengeführt. Ich dachte an das bisschen Papier, das meine Aufzeichnungen barg, das mir Halt gab, ein Strohhalm, mit dem ich nach einem festen Grund in diesem Meer der Sinnlosigkeit stakte.
Ich wollte also Harald beiseitewinken, aber es war niemand da, den ich oder den er hätte bitten können, ihn von seiner Tätigkeit für fünf oder zehn Minuten zu beurlauben. Der Unteroffizier hatte sich wieder entfernt, er stand breitbeinig und selbstbewusst an seiner Haubitze und gab Befehl, die Holme aus dem Sand zu graben, zu schwenken und das Geschütz neu einzurichten.
Harald sah zu ihm hinüber und zuckte die Achseln. Das Achselzucken musste er sich in den letzten Monaten angewöhnt haben; ich kannte es nicht an ihm; noch in den Sommerferien war es mir nicht aufgefallen. Ich stellte mich dicht am Wagen hin, und in der halben Minute, die er dazu brauchte, seine Arme mit der nächsten Granate zu beladen, konnte ich ihm ein paar Worte sagen, Fragen nach Gesundheit und Verpflegung zuerst, nach den nächstliegenden Dingen. Er erkundigte sich nach Karla. Ich bestellte Grüße, obwohl das Mädchen mir keine Silbe davon gesagt hatte. Ich sah, der Junge errötete, und mir fiel auf, seine Gesichtsfarbe harmonierte nicht mit der seiner Uniform; aber das war sicher nur ein Vorurteil. Warum soll ein Soldat nicht erröten dürfen?
Ich begann mein Anliegen vorzutragen, die inständige Bitte, meine Arbeit fortzusetzen und zu beenden. Der Bauer mahnte ungeduldig: „Gleich können wieder die Flieger kommen oder Panzer. Ich habe Frau und Kinder.“ Auf dem breiten Bodenbrett des Ackerwagens lagen noch zwei Schichten Granaten.
„Und wir? Wir sollen für dich Dreckbauer die Knochen hinhalten?“ Der Vorwurf war auch gegen mich gerichtet, der ich in meinem Reiseanzug zusah, wie sie sich quälten, wie ihnen trotz der Kühle des Tages der Schweiß übers Gesicht lief. Harald winkte ab, nahm aber doch das nächste Geschoss auf und trug es zum Stapel. Einer seiner Kameraden hielt ihn fest, sprach auf ihn ein; Harald schob ihn mit dem Arm fort und stellte sich wieder zu mir. Er lehnte sich an den Wagen, den Ellenbogen auf das rissige Seitenbrett gestützt, die Hand an der Runge. Während ich sprach, steckte er sich eine Zigarette an. Es war das erste Mal, dass ich ihn rauchen sah. Darin ungeübt, sog er hastig, wie ein hungriges Kind an der Milchflasche, und versuchte den Rauch weltmännisch durch die Nase wieder auszublasen. Ich hätte darüber lachen mögen.
Er wusste genau wie ich, dass das Rauchen in der gefährlichen Nähe der Munition streng verboten war, aber er tat es, und ich hinderte ihn nicht daran. Ich verspürte Lust, Einzelheiten mit ihm zu besprechen, methodische Fragen; er war bereit dazu, nahm sich die Zeit, ohne Befehl, ohne Genehmigung, ganz unmilitärisch. Er war wieder mein Schüler, der noch meinem Vortrag lauschte, wenn alle anderen ihre Hefte und Federhalter längst eingepackt hatten und ihre Ranzen auf den Rücken schnallten oder ihre Taschen in die Hand nahmen; er war ein junger Freund, der auf stundenlangen Spaziergängen in der Maikuhle, zur Waldenfelsschanze, nach Sellnow und Necknin hinaus nicht genug erfahren konnte über die nahe und ferne Vergangenheit der Stadt.
Wenn mir etwas zustieß, mit Harald würden meine Gedanken mich überleben, würde das winzige Steinchen, das ich in das vielfältige Mosaik der Geschichte einfügen wollte, seinen rechten Platz erhalten. Ich wollte Harald die Hand reichen, sah ihm in die Augen, vielleicht war es ein Abschied für immer. Aber einer überlebt, dachte ich, auch wenn der Junge in der Ungewissheit der Schlacht zurückbleibt und ich in die Ungewissheit der See hinausfahre. Einer muss doch überleben!
„Zigarette aus, Sie Stiesel! Sprengt die ganze Stellung in die Luft!“ Die wohlklingende, dunkle, volltönende Stimme des Unteroffiziers, fähig, eine dreischiffige Hallenkirche zu füllen oder einen voll besetzten Theatersaal zu erregen, schlug mit der Plötzlichkeit eines Wintergewitters in unseren Abschied. Der Bauer, den Mund weit aufgerissen, die Augen geschlossen, ließ die Granate, die er in den Händen hielt, zurückgleiten, griff nach der an der Vorderrunge festgebundenen Leine, die Pferde bäumten sich erschrocken auf. Ich sah Haralds schmerzverzerrtes Gesicht, die Schultern, die sich krümmten, den Arm, der emporflog, wollte zuspringen, da schlug auch schon Haralds Kopf gegen das davonrollende Rad, gegen die eisenbeschlagene Felge.
Jetzt nahm mein Bewusstsein wieder auf, dass hinter dem Horizont Panzermotore heulten, dass Geschosse über uns hinwegpfiffen und irgendwo barsten, dass Maschinengewehre bellten, und ich hörte das Schnauben der Pferde, die der Bauer zwanzig Schritt weiter, kurz vor der Schanze, zum Stehen brachte, sein verhaltenes Fluchen. Als ob die Pferde etwas dafür konnten. Ich stand, wie ich gestanden hatte, die Hand noch ausgestreckt, damit Harald sie ergreifen konnte, in all diesem Lärm, der mich umtoste wie die Brandung im Nordoststurm.
„Der hat Schwein. Wenn er wieder zu sich kommt, ist der Schlamassel vorbei.“
2. Kapitel
Ich suchte in Kolbergs Straßen mit Nettelbeck nach dem Hauptmann Waldenfels, den er weder auf der Bastion Preußen noch auf der Bastion Pommern fand, weder in der Kommandantur noch in Willerts Ausspannung in der Klausstraße, dem Quartier des Vizekommandanten. Der Atem wurde dem Alten knapp, ein Stechen in der Hüfte zwang ihn zum Ausruhen. Er stützte sich mit dem Ellenbogen gegen eine Hauswand, der Kalk färbte den Ärmel des braunen Rockes weiß, Nettelbeck hastete weiter. Er machte sich Vorwürfe, dass er sich in Dinge mengte, die ihn nichts angingen. Er beschimpfte sich selbst mit den Worten, mit denen ihn der Festungskommandant, der alte Oberst Loucadou, verlacht hatte: „Die Bürgerschaft, die Bürgerschaft! Ich will und brauche die Bürgerschaft nicht.“ Nettelbeck fragte Offiziere, Unteroffiziere und Grenadiere. Sie zuckten die Achseln. „Macht dem Spiel ein Ende, ihr guten Leutchen!“, hatte der Oberst gesagt. „Geht in Gottes Namen nach Hause! Was soll mir’s helfen?“
„Der Hauptmann? Ich sah ihn vor Meister Kramohls Tür stehen.“ Ein Bäckerjunge, der mit einem Tragkorb Weißbrot auf dem Wege zur Kommandantenwohnung war, konnte endlich Auskunft geben. Der Kommandant isst Pameln, dachte Nettelbeck bitter, er hat keine Zähne mehr. Doch die Freude, endlich eine Spur gefunden zu haben, beflügelte seine Schritte. Das Stechen in der Hüfte verging. Er hätte sich auch an den Ingenieur-Kapitän Düring wenden können, der dem Befestigungswesen vorstand, den hätte er leicht in seinem Quartier gefunden. Aber wozu sollte er diesem Manne sagen, dass die Franzosen unter dem Schutz der Hohenbergschanze, halben Weges von dort gegen die Stadt, auf dem Sandberge gleich hinter dem Zingel, eine Schanze aufwarfen und eine zweite in der Richtung von Bullenwinkel her, am Matzteiche, die, was sich jeder Segelmacher und jede Fischersfrau ausrechnen konnte, zu dulden höchst gefährlich war? Erreichten jetzt nur die schweren Stücke das Weichbild der Stadt, von dort aus konnten auch die leichten Mörser und Haubitzen unermesslichen Schaden anrichten. Wie schnell brannte das Fachwerk der Bürgerhäuser! Die Schleuse müsste man schließen, die Wiesen auch auf der Ostseite der Stadt überschwemmen, damit den Franzosen die Laufgräben absoffen und sie wie Küken im Jauchepfuhl ertranken. Aber der Herr Ingenieur-Kapitän, wenn er Nettelbeck überhaupt anhörte, lächelte bestenfalls: „Herr, was geht das Ihn an? Mach Er, dass Er an Seine Braupfanne kommt! Dort ist Sein Tun.“
Waldenfels saß nicht mehr in Martin Kramohls Barbierstube. Der Gehilfe Philipp Püttmann scheuerte das Becken und wischte es mit einem groben Tuch trocken. Sein Gesicht sah gelblich bleich aus wie zu früh gereifter Roggen. Philipp war gestern Abend für zwei Stunden in den Turm der Marienkirche gestiegen. Wenn der Kommandant den Ausguck nicht besetzte, mussten es die Bürger tun. Nun sah es ganz so aus, als ob der Junge die Höhe nicht vertrug. Da war ich ein anderer Kerl! dachte Nettelbeck. Er fühlte das Bedürfnis, dem Sohn seines alten Freundes, der auf See geblieben war, ein paar aufmunternde Worte zu sagen. „Wann ist Hochzeit, Philipp?“
Der Blick des jungen Menschen blieb düster. Philipp hängte das Handtuch an den Nagel neben der Tür und stellte das Becken auf den Bord. „In diesen ungewissen Zeiten, Vater Nettelbeck, soll man wohl nicht an Heiraten und Festefeiern denken.“
„Worauf wartet ihr jungen Leute nur? Die Zeit wird nicht besser, wenn wir sie uns nicht besser machen. Beeilt euch! Ich will noch Pate stehen.“
Philipp antwortete nicht. Er drehte sich zur Wand und machte sich wieder am Handtuch zu schaffen. Jetzt war nicht die Stunde, nach der Ursache des Kummers zu forschen, Nettelbeck suchte den Hauptmann. Philipp wusste nicht, wohin Waldenfels gegangen war.
Nettelbeck ging in die schwarze Küche. Kramohl hatte ein Stück trockenes Brot in den Gerstenkaffee getunkt. Als die Tür aufging, ließ er es in den Tassenkopf fallen und fischte mit den Fingern danach. Sophie stand am Fenster und kühlte die Stirn an der Scheibe. Zank zwischen den Verlobten, oder hatte der eigensinnige, spinnige Alte ein Haar in der Hochzeitssuppe gefunden?
„Der Hauptmann? Ach, geh mir mit den Offizieren! Wenn wir sie nur bald aus der Stadt hätten! Der Herr Hauptmann freilich, gegen den gibt’s nichts zu sagen. Zum Hafen hinunter ist er gegangen. Machen Sie mich recht schmuck, hat er befohlen, als ich ihm das Halstuch umlegte, ein Schiff aus Danzig wird erwartet; ich muss einen guten Eindruck machen!“
Nettelbeck hörte ihn nicht weiter an. Um Sophie und Philipp konnte er sich später kümmern, jetzt ging es um die Stadt. Als er zur Pfannschmiede hinauswollte, stieß er gleich hinter dem Münder Tor auf einen Haufen Menschen, die einen Wagen umstanden, der ein Rad verloren hatte; auch das Pferd war gefallen. Mein Gott, dachte er, soll der Bauer achtgeben! Jetzt versperren sie die ganze Straße, und ich hab’s eilig. Da erkannte er den Hauptmann in der Menge. Er drängte sich zu ihm durch, zupfte ihn am Rock, aber Waldenfels wehrte ihn unmutig ab, ohne sich nach ihm umzusehen.
„Herr Hauptmann! Einen Augenblick, Euer Wohlgeboren, höchste Eile!“
Waldenfels wandte den Kopf und erkannte Nettelbeck. „Was haben Sie denn?“
„Einen Gedanken, Herr Hauptmann. Die neuen feindlichen Schanzen - wenn wir die Schleusen schließen, die Matzwiesen überschwemmen ...“
„Sagen Sie das dem Kommandanten!“
Was war nur in Waldenfels gefahren? Er, der sich Nettelbeck sonst nie verschloss, der einzige Offizier - außer Schill natürlich, aber der war fort und hatte auch in der Festung nichts zu bestimmen gehabt -, an den sich die Bürger mit ihren Sorgen wenden konnten, wenn er auch nicht immer die Kraft aufbrachte, sich beim Obersten durchzusetzen, ausgerechnet er schickte ihn jetzt zu Loucadou, von dem er doch wusste, dass er keinen Rat von den Bürgern annahm, ja den geringsten Hinweis als unbefugte Einmischung weit von sich wies. Ausgerechnet jetzt, in höchster Gefahr für Stadt und Festung!
Waldenfels’ Aufmerksamkeit war offensichtlich von einem Mann, einem Offizier in Anspruch genommen, der den Kopf des Pferdes hielt und dem Tier beruhigend den Hals klopfte. Nettelbeck hatte den Mann noch nie gesehen; er war noch jung, bedeutend jünger als Nettelbeck jedenfalls, aber auch nicht sehr jung, älter als Waldenfels, vierzig vielleicht, eine männliche, stattliche Erscheinung, kraftvoll, man traute ihm zu, ein Gespann durchgehender Hengste aufzuhalten. Sein Gesicht schien Heiterkeit und Ruhe auszudrücken; das Haar war dunkel, voll, eine längliche Narbe teilte die Stirn, und die Augen - die Farbe konnte man nicht erkennen von hier aus - blickten gelassen in die Menge der Gaffer. Der Offizier gab die Leine einem der Umstehenden in die Hand und half dem Gespannführer, einem rothaarigen Ackerbürger aus der abgebrannten Lauenburger Vorstadt, das Rad, das einer der Straßenjungen wieder herangerollt hatte, auf die geteerte Achse zu setzen. Dann säuberte er sich die Hände an einem der Säcke, mit denen der Wagen beladen war, und winkte Waldenfels. Der Hauptmann packte Nettelbeck am Arm und zog ihn mit sich. „Kommen Sie, Bürger Nettelbeck! Das ist der Major von Gneisenau, unser neuer Kommandant. Sagen Sie ihm alles, was Sie auf dem Herzen haben!“
Der neue Kommandant? Ich hätte ihn erst für einen Viehdoktor gehalten, dann für einen Stellmacher. Wird dieser Mann auch etwas vom Krieg verstehen? Wer sich mit so kleinen Dingen abgibt, überblickt der die große Sache des Vaterlands? Das Stechen in der Hüfte, das Ziehen im linken Knie waren wieder da. Hinkend trottete der Alte den beiden Offizieren nach.
Und ich begleitete Nettelbeck, der nach seiner Gewohnheit um die Wälle gegangen war, gegenüber der unteren Bastion Geldern beginnend, an der Mühlenschleuse vorbei, wo er geraume Zeit auf und ab ging und in das trübe, schlammige Stauwasser starrte, dann wieder den hellen, dünnen Rinnsalen zusah, die durch die grünalgenbewachsenen Bohlen sickerten, und zwischendurch den Blick hob, um zum Holzgraben hinüberzuschauen, der einen Teil des aufgestauten Wassers ableitete, welches das Salinengelände überschwemmte, und den Rest dem Hafen zuführte. „Einen Posten mit Gewehr müsste man an der Schleuse aufstellen!“, rief mir der Alte zu.
„Wenn es dem Gegner gelingt, die Schleusentore zu sprengen, verläuft sich das Wasser, und die Wiesen um die Festung werden, wenn auch nicht trocken, so doch passierbar. Und wehe, wenn der Feind mit seiner überlegenen Truppenzahl von allen Seiten zugleich stürmt! Wie leicht kann sich ein Musje, als Überläufer womöglich, in die Stadt einschleichen und nachts, wenn der Schleusenwärter den Schlaf des Gerechten schläft, die Kammern öffnen und dem Strom seinen Lauf lassen! Ein Posten mit Gewehr muss her, und wenn der Kommandant keinen Mann dafür frei hat, soll das Bürger-Bataillon die Wache übernehmen.“
An der Matzwiese hielt er wieder inne und sah zu den Verschanzungen unter dem Hohenberg hinüber. Nur langsam kam der Feind voran. Wenn es nur eine Stunde am Tag regnete, füllten sich die Laufgräben mit Wasser, und die Geschützstellungen mussten mit Faschinen ausgelegt werden, sollten die schweren Lafetten nicht in den weichen Untergrund einsinken. Soweit gut. In der Wiese stand das Wasser knöcheltief. Zu niedrig, dachte Nettelbeck, sie können barfuß hindurch, es geht auf den Sommer zu, und auf penibles Aussehen geben sie nichts, sie sind keine Preußen.
Vor der Front Bütow, dem Wolfsberg gegenüber, dem Sandhügel, der wie ein Maulwurfshaufen in der Ebene saß, die nicht durch Überflutung geschützt war, versuchte er einen Leutnant, der einen Befehl vom Außenwerke Lauenburg zu den Erdarbeitern an der Ziegelschanze überbrachte, von seinen Ansichten zu überzeugen: die alte Schleuse musste verstärkt, die Persante ganz gesperrt und das Wasser in Gräben durch die abgebrannte Lauenburger Vorstadt vor den Frauenmarkt geleitet werden. Aber der Offizier hörte nicht zu, vielleicht verstand er nichts von der Fortifikationskunst, er rief: „Sagen Sie es dem Ingenieur-Kapitän oder dem Kommandanten!“, und ließ den alten Mann stehen. Nettelbeck zog seine Schiffermütze in die Augen und ging weiter. Diese jungen Offiziere! Musste er alter Mann, der die längsten Jahre seines Lebens zwischen Vor- und Besanmast zugebracht hatte, ihnen sagen, wie man Landfestungen verteidigt, und sie hörten nicht einmal zu! Aber der Mann hatte recht, mit Gneisenau darüber reden! Man musste immer gleich an die höchsten Stellen gehen, wenn man angehört werden wollte. Mit ausgreifenden Schritten strebte er dem Hornwerk Münde zu, bog in die Pfannschmiede ein, kehrte aber bald um, und anstatt sich zur Bastion Preußen zu begeben, wo er den Kommandanten am sichersten antraf, schlurfte er am Bollwerk entlang wieder der Schleuse zu. Erst gründlich überlegen!
Seit Mittag unterwegs, wurde er nun doch müde und blieb alle paar Schritte stehen, um Atem zu schöpfen. Er hätte sich nach dem Essen eine Stunde aufs Ohr legen sollen, seine siebzig Jahre machten sich bemerkbar. Er zog die leere Kummkarre heran, mit der der Schleusenwärter gewöhnlich Lehm und Steine anfuhr, um die Ausspülungen in der Böschung damit zu stopfen, und setzte sich auf den Karrenbaum. Den Strom, sann er, musste man so weit aufstauen, dass die Stadt zur Insel wurde. Sollten die Wiesenbesitzer beim Bürgermeister oder beim Kommandanten jammern! Er sah jetzt schon, wie sie sich die Hände an den Rockschößen abwischten, bevor sie an die Tür klopften, und während sie flehten, die Wiesen und Weiden nicht zu überfluten, damit nicht auch diese noch verdürben, die offenen, leeren Handflächen vorstreckten, um die bittere Not anzudeuten, in die sie unfehlbar geraten müssten. Aber in dieser schweren Zeit musste jedermann dem Vaterland Opfer bringen, Gutsherr und Offizier, Bauer und Bürger. Er selbst, der sich auf seine alten Tage auf Brauen und Brennen verlegt hatte, erlitt genug Verluste, Korn und Gerste wurden knapp in der belagerten Stadt. Überdies ließen ihm die Angelegenheiten der Verteidigung kaum Zeit für sein Gewerbe. Sein Bargeld aber, vierhundert Taler, hatte er dem Leutnant Schill vorgeschossen, damit die Maikuhle notdürftig verschanzt werden konnte. Sollten auch die Ackerbürger ihr Scherflein in den Klingelbeutel des Krieges werfen!
Nettelbeck hatte wohl eine Stunde so gesessen, als sich in der Stadt Lärm erhob. Er hörte zunächst nicht weiter danach hin, Lärm gab es oft genug - da schoss der Feind in die Festung, die eigenen Batterien antworteten, Offiziere schrien ihre Leute an, Betrunkene prügelten sich, Meister schimpften mit ihren Lehrjungen, Weiber keiften, o ja, Lärm gab es übergenug in dieser kleinen Stadt, die mehr Militär beherbergte als Bürger. Sicher waren sich auch jetzt wieder Husaren oder Füsiliere beim Kartenspiel in die Haare geraten, Schillsche vielleicht, die erbeuteten Branntwein von einem Streifzuge mitgebracht hatten. Bald kam die Patrouille und brachte die Ruhestörer zur Räson oder nahm sie mit zur Wache. Aber der Lärm dauerte an. Vielleicht war keine Streife in der Nähe und die Bürger getrauten sich nicht, danach zu laufen. Er musste selbst nach dem Rechten sehen, er, der Bürgerrepräsentant. Mit einem Ruck erhob er sich und klopfte den Lehmstaub vom Rock.
Ein Junge lief vorbei, die Holzpantoffeln in der Hand, barfuß. Nettelbeck rief ihn an. Der Junge deutete mit dem Arm irgendwohin und rannte weiter.
Auch aus anderen Straßen sah er Leute nach dem Ort der Unruhe eilen, der in dem gefährdeten Ostteil der Stadt liegen musste: Küchenmädchen, einen Böttcher mit dem Spundhammer, einen Schneider noch mit der Elle in der Hand, Bäckergesellen in weißer Schürze. War der Feind durchgebrochen, und die Kolberger liefen hinzu, um die Franzosen, Thüringer, Italiener und Polen anzustaunen? War der Wolfsberg verloren, das Ravelin Bütow erstürmt? Er hatte kein Kleingewehrfeuer gehört, und ohne einen Schuss, ohne wütenden Kampf ließ die tapfere Besatzung den Feind nicht an die Wälle heran. Aber wenn Verrat im Spiel war?
Der Tuchmacher Strippow trat aus dem Haustor. „Was lauft Ihr, Nettelbeck? Sind die Franzosen in den Straßen?“ Nettelbeck wollte vorbei. Strippow hielt ihn am Rockschoß. „Sie werden die Stadt plündern. Hättet Ihr Euch nur nicht in die Verteidigung gemengt! Krieg ist Soldatensache. Was geht mich das an, wenn sich unser König und l’Empereur in die Wolle geraten? Jetzt ziehen sie uns den Balg über die Ohren.“ Nettelbeck riss sich los.
Als er die Wendenstraße erreichte, sah er, dass sich die Menge in der Schmiedegasse sammelte. Vor Kramohls Haus. Hatte sich Sophie etwas angetan? Ihr verweintes Gesicht neulich!
„He, Freund! Was gibt’s zu gaffen?“
„Philipp ist auf die Wache gebracht, drei Mann mit Seitengewehr hinter ihm drein.“ Der friedsame Philipp?
„Er hat einen Offizier umbringen wollen“, wusste jemand.
„I wo“, stritt ein anderer, „er war dem Offizier im Wege bei Sophie.“
„Der Leutnant angelte schon lange nach ihrem Schürzenband“, berichtete eine alte Frau, die in Friedenszeiten gespaltenes Kienholz in den Giebelhäusern und Buden verhökerte und deshalb stets wusste, was in den Rauchfängen hing. „Er hat sich immer nur von ihr den Bart kratzen lassen.“
„Wenn unsere Weiber und Töchter Freiwild für die Herren Offiziere sind, können wir gleich den Franzosen die Tore öffnen“, rief der Bootsbauer Vorberg aus und erhielt damit die Zustimmung der Menge.
„Mann!“ Nettelbecks Hand fuhr an den Degenknauf. Schon wieder sprach man von Unterwerfung und Kapitulation!
„Unsereinem wollt Ihr ans Leder“, entgegnete Vorberg ruhig, und der sanfte Blick des Bootsbauers verwirrte den alten Schiffer. Nettelbeck ließ den Degen stecken. Er fürchtete nicht die erregten Leute, er hätte sich den Weg gebahnt mit der blanken Waffe. Mit einer eingerosteten Pistole und mit einem Tauende hatte er eine meuternde Schiffsmannschaft zur Räson gebracht, und die Matrosen sind wahrhaftig wilde Kerle, die dem Teufel ein Auge ausreißen, wenn sie ein Quart Rum dafür kriegen! Sollte er sich da vor Schustern, Bierschrötern und Fischweibern verstecken? Aber er sagte sich, dass die Leute zu Recht aufgebracht sein könnten.
„Seid Ihr Bürgerrepräsentant, Kapitän Nettelbeck, dann schützt uns vor den Blauröcken!“ Die Hökerfrau zeterte: „Ihr wisst wohl nicht mehr, wie das tut, wenn einem die Frau weggenommen wird?“
Nettelbeck schüttelte sich, als wollte er die Erinnerungen, die alte Geschichte, die er längst vergessen glaubte, von sich abwerfen. Aber sie überflutete ihn wie die Sturzsee, und wenn er glaubte, daraus emporzutauchen, traf ihn die neue Welle, und er suchte nach dem Mast, an den er sich klammern konnte, um der aufgewühlten See zu entgehen, wie in jener Nacht auf der Schute des Schiffers Prey, den er angebettelt hatte, ihn für gute Worte mitzunehmen nach Königsberg. Für gute Worte; Geld hatte er nicht zu bieten, all seine Barschaft und den Erlös der heimlich verkauften Hälfte seines Hauses dazu hatte das Weib mitgenommen, als sie mit ihrer Tochter dem Offizier, der ihr die Zeit während des Hausherrn langer Seereisen vertrieb, bei Nacht und Nebel gefolgt war. Der Offizier hatte sie nach zwei Wochen, nachdem ihr Geld am Spieltisch durchgebracht war, davongejagt, und sie flehte ihren Mann, als er endlich ihre Spur gefunden, auf Knien an, ihr die himmelschreiende Sünde zu verzeihen und sie in Gnaden wieder aufzunehmen. Keinen schwarzen Pfennig besaß sie mehr. Nettelbeck blieb hart und stieß die Frau von sich.
Sie rannte zum Stadtrichter. Er musste sich durch die Hintertür aus seinem Quartier schleichen und lief nachts zu Fuß nach Pillau, heuerte als Steuermann nach Riga an und kehrte erst nach Wochen in die Heimatstadt zurück.
Er musste eine Hypothek auf den ihm verbleibenden Teil des Hauses aufnehmen, um die Scheidung bezahlen zu können. Der Hass des Bürgers gegen das Offizierskorps hatte sich auch in ihn eingebrannt. Er bahnte sich einen Weg, stieß die Leute beiseite und stürmte ins Haus.
Der Offizier saß noch in seinem Stuhl, die Beine bequem auf eine Fußbank gelegt, die kurze Pfeife im Mund. Kramohl stand hinter ihm, ihn halb verdeckend, ein Handtuch über dem Arm.
„Herr!“
Der Offizier stieß die Fußbank von sich, erhob sich und sagte, wobei er die Pfeife kurz aus dem Mund nahm, ein paar Worte zu dem Meister. Nettelbeck verstand sie nicht, er hörte nur die warme, volltönende, angenehme Stimme, die einem törichten jungen Mädchen so süß klingen musste, wenn sie ihr Honigworte ins Ohr flüsterte. Er sah in das fast kindliche, glatte Gesicht, zart wie die Haut eines Ferkels, auf das zierliche Kinn, an dem eine winzige, rosa schimmernde Narbe auffiel. Die Narbe kam ihm bekannt vor, aber er wusste nicht, wo er sie gesehen hatte; dieser Offizier war ihm bestimmt nie begegnet; er wusste nicht seinen Namen, seinen Dienstrang, es konnte nur ein Leutnant sein, aber die Narbe erinnerte ihn an etwas, auf das er sich nicht besinnen konnte, und ihre zartrosa Farbe, die sich im Rhythmus des Pulsschlags verdunkelte und aufhellte, verwirrte ihn. Er biss sich auf die Lippen, sah wieder die glatte, kalte Stirn des Leutnants, die höhnischen Augen, er blickte auf die zitternden Hände des Barbiers und zog den Bürgerdegen halb aus der Scheide.
„Herr!“ Er hätte zustoßen mögen, aber der Mann trug des Königs Rock.
Der Leutnant warf dem Meister ein Geldstück hin, ging an Nettelbeck vorbei und blieb breitbeinig, selbstbewusst stehen, die Rechte schon am Türgriff. „Ein königlich-preußischer Offizier schlägt sich nicht mit einem Branntweinbrenner!“
Gegen das aus der Obertür einfallende Licht war von der rötlichen zuckenden Narbe nichts zu sehen.
Nettelbeck schob den Degen in die Scheide zurück und ließ sich seufzend in den Barbierstuhl fallen. Er nahm dem Meister das Handtuch vom Arm und trocknete sich die schweißnasse Stirn. „Nettelbeck, Nettelbeck, jetzt werden sie auch uns beide noch arretieren. Auf meine alten Tage ins Stockhaus! Meine arme Frau, meine arme Tochter!“ Nettelbeck sprang auf und stieß Kramohl vor die Brust. Wenn er noch ein Wort jammerte, wollte er ihm das Handtuch ins Gesicht schlagen. Wozu lamentieren? Was getan war, war getan. Wer wollte das ungeschehen machen? Kein Heulen und kein Zähneklappern half! Es blieb nur zu prüfen, ob er seinen Degen zu Recht oder zu Unrecht gezogen hatte. War es zu Recht geschehen, würde er sich zu verteidigen wissen, sich und Meister Kramohl und Philipp Püttmann dazu. Er hatte sich mit französischen Reedern und niederländischen Versicherungsgesellschaften, mit portugiesischen Hafenbeamten und britischen Kaperkapitänen herumgeschlagen; er fürchtete sich auch nicht vor preußischen Richtern.
„Was bist du für ein Barbier, Kramohl! Kratzt andern Leuten am Hals und bist selber kitzlig.“
„Sprich nicht vom Messer, Nettelbeck, sprich nicht vom Messer!“
„Ich sehe, du musst einen Kümmel trinken.“ Er packte den Barbier, der doch gut zwanzig Jahre jünger war, an den Schultern und schob ihn in die Küche. Bevor er ihm folgte, trat er noch einmal vor die Haustür; noch immer starrten die Leute das Haus an, Gaffer, Neugierige, wie sie sich überall sammeln, wo Sensationen zu erwarten sind. Als ob nicht jeden Augenblick eine feindliche Bombe dazwischenfahren könnte! Er spürte, sie unterbrachen ihre Gespräche, merkten auf, als er vor sie hintrat, aber er wartete, bis sich das Gemurmel völlig gelegt hatte, bis ihn jedermann ansah. „Kolberger Bürger und Schutzverwandte, Freunde! Geht wieder an eure Arbeit! Was hier geschehen ist, ob Recht oder Unrecht, wird untersucht werden. Ich sorge dafür. Die Zehnmänner, eure Bürgerrepräsentanten, werden vom Herrn Kommandanten eine strenge Verifikation verlangen. Ich verbürge mich dafür. Ihr wisst, dass ihr euch auf mein Wort allezeit verlassen könnt.“
In den hinteren Reihen lebte das Gemurmel wieder auf, und plötzlich rief eine helle Knabenstimme: „Vivat, Vater Nettelbeck!“
Kramohl saß am Küchentisch. Nettelbeck ging an ihm vorbei und langte hinter das Schapp, wo er die bauchige Flasche wusste, die er am Geschirrtuch abwischte und entkorkt vor Kramohl hinstellte. Der Barbier trank. Nettelbeck nahm ihm die Flasche vom Mund. „Erzähle!“ Kramohl begann wieder zu zittern und langte nach der Flasche. Nettelbeck entzog sie ihm.
„Wo werde ich denn erzählen, ich habe ja nichts gesehen.“ Nettelbeck setzte sich ihm gegenüber und sah ihn scharf an, die Flasche hielt er hinter seinem Rücken verborgen. „Hör gut zu, Kramohl!“ Er pfiff durch die Zähne, es sollte sich nach einer Seemannsmelodie anhören; plötzlich sprach er weiter: „Du weißt, ich bin Bürgerrepräsentant, eine Amtsperson gewissermaßen, und dies ist ein amtliches Verhör, damit du mich recht verstehst.“
„Gib mir was zu trinken, Nettelbeck!“
„Beim Verhör muss man nüchtern sein.“
„Wenn du meinst, Nettelbeck. Wie war das bloß gleich? Mein Kopf ist wie ein Kescher, in den ein Schwarm Stinte geraten ist. Philipp, ja, der war schon die ganzen Tage so, wie soll ich das sagen? So wie ein Hecht, der an der Angel sitzt, so recht zapplig. Und Sophie machte ein Gesicht, als wenn ihr eine Handvoll Dill in die Kreude gefallen wäre. Ich dachte bei mir: so ist das mit den jungen Leuten, das renkt sich alles wieder ein, und was nicht säuert, süßt auch nicht. Dass aber Philipp so was machen wollte, ich hätt’s nie für möglich gehalten.“
„Immer der Reihe nach, sonst kommt in meinem Kopf das Protokoll durcheinander.“
„Dass du in deinen Jahren noch einen solchen Kopf hast! Ich könnte bald dein Junge sein, aber meiner ist schon wie ein Seihtuch. Vorigen Montag, kann auch Dienstag gewesen sein, aber Sonntag nicht, den Sonntag heilige ich, da fasse ich kein Stück an, also ich habe meinen Abziehstein gesucht und nicht gemerkt, dass ich ihn in der Hand hielt. Ja doch, es geht ja schon weiter! Also meine Sophie und Philipp sind so gut wie versprochen. Er war ein so ruhiger Mensch, verstand seinen Bart zu schaben und seinen Zopf zu flechten und zu pudern, sogar einen Offizierszopf, aber der neue Kommandant hat ja nun alle abschneiden lassen, nun braucht er’s nicht mehr zu können. Er kann auch die Ader schlagen, dass einer nicht gleich beschwögt wird, das kann Philipp alles. Er ist ehrbarer Leute Kind und stammt nicht von Leinwebern und Müllern ab, er soll meine Sophie kriegen und Meister werden, wenn ich mich mal aufs Altenteil setze! Meine drei Jungen liegen auf dem Georgenkirchhof, und jetzt wird mir Gott ja keinen mehr in die Wiege packen.“
Nettelbeck sah in den schwarzen Rauchfang hinaus. Das Gespräch trieb dahin wie eine Brigg bei Flaute im Ärmelkanal, man sah an beiden Seiten Land und gelangte nicht hin. „Zur Sache, Kramohl!“