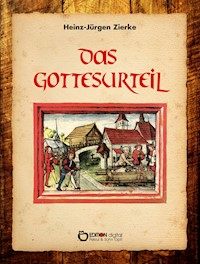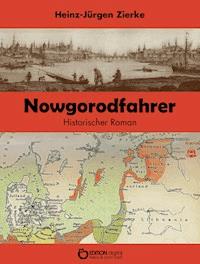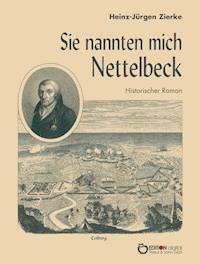8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Preußen 1806. Die Schlacht bei Jena und Auerstedt ist geschlagen. In Magdeburg sammeln sich Versprengte. Das französische Heer rückt heran. Da macht ein Schneidergeselle - der Zufall ließ ihn an den Rock eines toten Leutnants geraten - sich auf und folgt beherzten Leuten, die nicht einfach kapitulieren wollen vor der Übermacht der Waffen. Und er, eben noch wandernder Handwerksbursche, nimmt die Rolle an, die ihm aufgedrängt wird: Er wird Ferdinand von Schill. In seinem Buch versucht Heinz-Jürgen Zierke — in der Erzählweise anknüpfend an seine erfolgreichen historischen Romane „ Nowgorodfahrer “ und „Karl XII. —, ein möglichst genaues historisches Bild der Zeit zu zeichnen und einen Schill vorzustellen, der sowohl Patriot ist als auch Mensch sein darf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 487
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum
Heinz-Jürgen Zierke
Ich war Ferdinand von Schill
Historischer Roman
ISBN 978-3-95655-278-6 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1983 im VEB Hinstorff Verlag Rostock.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2015 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
1. Kapitel
Ob ich mir nun heißen Rum eingeholfen habe oder nicht, wenn ich von dem Major Schill reden höre, tritt mir der kalte Schweiß auf die Stirn. Auf ein Denkmal wollt ihr ihn stellen, schön, und wie soll er dastehen, der Herr Major? In Wahrheit sah der brave Schill nämlich nicht viel anders aus als ich, vor dreißig Jahren, versteht sich. Den Schnauzbart trugen wir damals alle ... Will sagen, alle jungen Offiziere trugen ihn nach der gleichen Art, buschig gekämmt, und die borstigen Enden hingen über die Mundwinkel herab. Türkisch nannten wir das, und es sollte zeigen, dass wir so todesmutig fechten würden wie des Sultans wilde Horden, nicht nur im Felde. Nicht allein die Offiziere, alle Burschen, die etwas gelten wollten, trugen den Bart nach Leutnantsart; bei den hübschesten Mädchen, ganz gleich welchen Standes, galten eben nur die Herren Leutnants.
Auch in der Statur passten wir zueinander, sind ja auch wohl in einem Alter gewesen, vielleicht war ich eine Fingerbreite größer und er um das gleiche Maß stärker, seinem Rock nach zu urteilen, unsereins sieht das. Und was das Gebaren betrifft: Die enge Montur macht alle Bewegung einförmig, der Griff nach dem Degen ist eingeübt wie das Schrittmaß und die Kehrtwendung. Nur was unterm Tschako vorgeht, aber das sieht man von außen nicht.
Nehmen Sie dieses Bild: Der Major von Schill, nach dem Leben gestochen. Und nun denken Sie mich dreißig Jahre jünger und in Husarenmontur! Haben Sie nie die Geschichte gehört, die man sich noch lange Jahre nach dem 31. Mai 1809, diesen Tag vergesse ich nie, also die man noch jahrelang am Spinnrocken und beim Federnreißen erzählte: Nicht Schill sei zu Stralsund durch Hieb und Schuss ums Leben gekommen; einem andern, den man für den Major gehalten, habe man das Haupt abgeschnitten und in Spiritus getränkt, den Leichnam aber wie den eines Hundes eingescharrt. Der Mann war so zugerichtet, über und über mit Wunden bedeckt und blutverschmiert, dass ihn keiner mit Sicherheit erkennen konnte, nicht seine Offizierskameraden und auch nicht sein Bartscherer; zuletzt sagten sie zu allem ja und amen, damit das Morden aufhöre. Denn solange Schill lebte ... Sein Orden diente als Beweis, und hat doch der König auch anderen Husarenoffizieren den Pour le mérite an die Schärpe gesteckt.
Schill aber, sagt man, sei in einem Zeesekahn auf die Insel Rügen übergesetzt und von da unerkannt nach Russland oder England entkommen; zu gelegener Stunde werde er die Segel aufziehen lassen, zurückfliegen in die Heimat, wo vertraute Freunde schon sein Pferd sattelten, Flinten und Säbel verteilten, und mit eisernem Besen werde er die deutsche Flickenkiste auskehren. Ein Gerücht, ganz gewiss. Aber kann ein Gedanke zum Gerücht werden, wenn niemand ihn glaubt? Zugegeben, nur das niedere Volk tat es, Bäcker, Salzträger, Kleinschmiedsgesellen und anderer Pöbel. Die Herrschaften vom Stande mochten ihn nie, den braven Ferdinand — nur einige Damen, des Husarenbartes wegen.
Sagen wir: ein Märchen. Jedes Märchen ist voller Hoffnung, dass der Samen aufbrechen möge und wachsen zu einem blühenden, fruchtspendenden Baume. Schill also sei nicht im Jahre 1809 in der Fahrstraße der Stadt Stralsund zu Tode verwundet vom Pferde gestürzt, Schill nicht. Aber warum kam er nicht wieder, gab er nicht das Flammenzeichen? Schauen Sie das Bild genau an! Gestochen nach dem Leben.
Die Gesichtszüge freilich, so viel Kühnheit und heiligen Ingrimm hat man nie darin gesehen. Aber es muss auf Bildern wohl sein, dass man etwas hinzutut: Zornesfalten auf die Stirn, Feuer in die Augen, den geschwungenen Säbel in die Faust, damit man auf den ersten Blick den Helden erkennt. Wenn ihr ihn in Erz auf den Sockel stellt — bestimmt tut ihr das, wenn nicht heute, dann in zwanzig oder siebzig Jahren, das Vaterland hat nie genug Heroen, es kann sich nicht leisten, einen zu vergessen-, wer weiß, was ihr da alles in sein Gesicht hämmert, feilt, meißelt oder wie sonst auch immer. Metalle sind nicht mein Fach; Eisen macht mir Ohrensausen, seit ich seine geschliffene Kälte im Fleisch gespürt habe; Gold und Silber dagegen haben vor mir Respekt, sie halten gebührenden Abstand. Wollen Sie aber etwas über Tuche wissen, über Leinen, Barchent, Cotton, Seide, Brokat, bin ich gern zu Diensten, auch wie man solche zusammenstückt zu Abendroben und Reitermonturen, die ich seinerzeit höchst ästimierte. Später schlug ich mich mehr auf Röcke für Küster, Schäfer und Gutsverwalter, auch solche für Bierbrauer und Handschuhmacher, die zahlen besser als die Herren Leutnants und Rittmeister. Zu tun ist mehr, als meinen Händen recht ist, mit den Jahren werden die Finger knotig, und die alten Wunden schmerzen wieder. Aber ich mag keinem etwas abschlagen, das war immer mein Fehler. Heutzutage will ja jeder Hirschhornknopfdreher beim sonntäglichen Kirchgang einen bunten Frack um seine dürren Knochen schlottern haben wie weiland Friedrich Wilhelm, als er noch die selige Luise zum Cotillon führte. Eine feine Frau, das Lieschen, wenn man bedenkt, dass sie eine Großherzogstochter war. Nun haben auch sie die Würmer längst unter, nicht anders als unsern braven Ferdinand Baptista, an welchem man ersehen kann, dass der Umgang mit der Elle gesünder ist als der mit dem Säbel. Sie glänzt nicht vom Walde im Sonnenschein, wie der Dichter Körner singt, sie hat aber auch nicht so scharfe Kanten. Die Würmer sollen leben, prosit! Nein, ich war kein Schillscher Reiter, ich war — Ferdinand von Schill.
2. Kapitel
Am Nachmittag des 13. Oktober 1806 stellte eine französische Feldwache unweit von Auerstedt eine männliche Person, die sich durch die französischen Linien geschlichen hatte und im Begriff war, in das Gelände überzuwechseln, das die preußische Armee eingenommen hatte, um Kaiser Napoleon eine Schlacht zu liefern.
Der Mann gab sich als wandernder Schneidergeselle aus, war auch mit einigen Utensilien dieses Gewerbes versehen, mit Schere, Elle, einem Sortiment Nadeln und einigen Knäueln Zwirn, und behauptete, aus Hessen, wo er einige Zeit bei verschiedenen Meistern gearbeitet habe, unterwegs nach seinem Heimatort zu sein, einem Städtchen an der unteren Oder, um dort ein Mädchen zu ehelichen und sich als Meister niederzulassen.
Die französischen Soldaten, Lothringer wohl, waren lange genug durch die italienischen und deutschen Länder gezogen, bis weit nach Istrien und Böhmen hinein; sie kannten die Gepflogenheiten. Der Mann war in dem Alter, in dem der Handwerker gemeinhin längst sesshaft war und sich bei solchem nasskalten Herbstwetter nicht auf endlosen Landstraßen und einsamen Waldwegen herumtrieb, sondern seinen Werktisch näher an den mit Buchenholz geheizten Ofen rückte und sich von seinem Eheweib angewärmtes Bier zur Vespermahlzeit reichen ließ. Wer aber nicht in die Zunft geerbt oder eingeheiratet hatte, also Geselle geblieben war, hauste in dem Alter doch wohl in einer Bude in der Vorstadt oder in einem Keller der Unterstadt, wo die vom Gebären schon welke Hausfrau mit dem ersten halben Dutzend hohlwangiger Kinder am Schürzenzipfel auf den Vater wartete, der vielleicht eine ihm von der Meisterin zugesteckte Brotrinde heimbrachte oder einen verschimmelten Pfennig, den ein mitleidiger Kunde in seine hohle Hand fallen ließ. Also musste dieser Herumtreiber ein feindlicher Kundschafter sein, der mit geübtem Blick Stärke, Bewaffnung und Marschrichtung der Kaiserlichen Armee ausforschte und wohl schon beim Herzog von Braunschweig zum Rapport avisiert war. Überdies sprach der Mann französisch, wenn auch stockend und kehlig. Lernte neuerdings der preußische Straßenpöbel fremde Sprachen? O nein, dies war kein Handwerksbursche. Alles deutete darauf hin, selbst die lebhaften, neugierigen Augen und der strähnige Bart, dass es sich um einen verkleideten Offizier handelte, um ein ganz gefährliches Subjekt also.
Die Chasseurs luden schon die Büchsen, um den Mann kurzerhand zu erschießen, als der Kommandeur entschied, ihn die Nacht über einzusperren. Wenn am Morgen die Ablösung komme, sei er dem Regiment zu übergeben, wo man wohl wissen werde, wie mit einer solchen Person rechtens zu verfahren sei. Das war gut gesagt, doch auf dem elenden Gehöft fand sich kein Arrestlokal, nicht einmal ein Keller. Also sperrte man ihn in den nächstbesten Heustall, hieß ihn sich bis aufs Hemd ausziehen, schloss die knarrende Tür, blockierte den Riegel mit einem eingeschlagenen Hufnagel und stellte einen Posten davor. Bei diesem Hundewetter, so meinte man, renne kein nackter Mensch, und schon gar kein gebildeter, in das unwirtliche Dunkel; das wäre ja der sichere Tod. Drinnen könnte er sich ins Heu graben und warm und wohlbehalten die Nacht überstehen. Jedermann hängt doch am Leben, nicht wahr, und wenn’s für ein paar Stunden ist.
So dachten die Messieurs, weil sie ihren Gefangenen nicht kannten. Der — Sie ahnen jetzt natürlich, wer unser Mann ist — wusste aus Erfahrung, dass Unschuldsbeteuerungen die denkbar schlechtesten Beweismittel sind. Da er aber über keine anderen verfügte, hielt er es für besser, die Untersuchung nicht abzuwarten. Robert, sagte er zu sich selbst, wenn schon gestorben sein soll, dann kommt es auf die Art und Weise nicht an und auch nicht auf den Zeitpunkt. Ob durch das Erschießungskommando, die Kugel des Wachtpostens oder durch ein hitziges Fieber, wenn du in die kalte, triefendnasse Nacht hinausläufst ...
Als er sich an das Halbdunkel gewöhnt hatte, stellte er fest, dass die äußere Seitenwand seines Kerkers aus Schalbrettern bestand, die gegen dürre, schon vom Holzwurm zerfressene Querstangen genagelt waren. Ein kräftiger Ruck mit der Schulter, und sie gaben den Weg in die Freiheit frei. Nein, das Krachen würde den Posten alarmieren.
Vorsichtig legte er Handballen und Fingerkuppen gegen die Verschalung nahe der unteren Querlatte. Ein leichter Druck, ein Knirschen, er hustete, um den Posten zu täuschen, dann lockerte sich das erste Brett, der Nagel ließ sich herausziehen, das zweite löste sich noch leichter, aber für das dritte brauchte er die doppelte Zeit. Nun hingen die Bretter nur noch locker an den oberen Nägeln; wenn er sie beiseiteschob, konnte er durch die Öffnung hindurchsteigen. Aber er musste die Nacht abwarten.
Vorerst kroch er ins Heu, um sich zu erwärmen, er durfte nur nicht einschlafen. Um sich wach zu halten, stellte er sich vor, er müsste ein verfitztes Knäuel Garn entwirren; aber seine Hände waren kalt und die Finger an dem rauen Holz steif und fühllos geworden. Der Heustaub kratzte in Mund und Nase, die harten Halme stichelten hier und stachen dort. Unruhig warf er sich immer wieder herum, stieß auch wohl mit dem Ellenbogen oder mit dem Knie gegen die Wand. Das hatte auch sein Gutes: Der Posten gewöhnte sich an die Geräusche und merkte nicht auf, wenn Robert nachher die Bretter zur Seite drückte. Das Knäuel verfitzte immer mehr, statt sich zu ordnen, die Augen fielen zu, und als ihn ein Hustenanfall aufschreckte, blinkte nicht der geringste Lichtschimmer mehr durch die breiten Ritzen. Also war längst Nacht. Tropfen trommelten leise und eintönig auf die Schindeln. Regen. Umso besser, dann stand der Wächter mit eingezogenem Genick unter dem überhängenden Dach und war froh, dass er ein halbwegs trockenes Plätzchen gefunden hatte.
Er warf sich herum und stieß wie aus Versehen gegen die Holzwand, Der Posten reagierte nicht. Schlief er? War er gar nicht mehr da? Robert schob die lockeren Bretter zur Seite, klemmte die Enden übereinander und stieg hinaus. Als er die nackten Sohlen auf den nassen Boden setzte, brannte die Kälte wie Feuer. Er verbiss den schneidenden Schmerz. Die bloßen Füße polterten wenigstens nicht so wie feste Stiefel; man muss in allen Dingen das Gute sehen, dann geht’s leichter.
Als man ihn zum Heustall geführt hatte, hatte er sich blitzschnell umgesehen. Formen und Linien merkte er sich leicht, darin war sein Gedächtnis geübt. Zwanzig Schritte geradeaus bot eine schiefe Holzmiete Deckung. Von da aus musste er sich halb links halten bis an ein Gebüsch, eine Hecke oder einen Schlag Jungholz, das hatte er im Nebel nicht erkennen können.
Er kam eben an dem Stapel an, da rief ihm der Posten auch schon sein »Quivive!« hinterher. Zu spät, sich zu ducken. Mit langen Sprüngen hastete er auf das Gesträuch zu. Ein Schuss. Lärm im Gehöft. Die Wache war alarmiert!
Verfluchtes Hemd! Sein Weiß verriet ihn auch im Finstern, die Länge hinderte beim Laufen. Rufe, wütendes Geschimpfe, Flüche, Schüsse. Zwei Kugeln pfiffen an ihm vorüber. Dann hörte er nur noch seinen eigenen Schrei; er klang fremd, fern, wie der eines Kranichs, der aus dem Sumpf auffliegt. Der Schlag warf ihn ins Gezweig, Dornen zerkratzten das Gesicht, zerfetzten das Hemd. Er stürzte, stürzte tief hinab, bis in die Hölle.
Ganz so tief wohl nicht. Nässe, Kälte und Schmerz warfen ihn auf die Erde zurück. Als er die Lider einen Spalt öffnete, blickte er in undurchdringliche Schwärze. War noch Nacht? Irgendetwas rüttelte ihn, eine Peitsche knallte. Lag er auf einem Fuhrwerk? Aber keine Achse knarrte, kein Pferd schnaubte, und der Peitschenknall kam von ganz fern her, über den See, über die Thuewiesen. Das Rütteln ließ nach, begann ganz plötzlich wieder, schüttelte ihn heftiger. Er zog die Hand unter dem Kopf hervor, die Stirn sank vornüber, die Lippen schmeckten regennasses Gras. Da begann er zu begreifen. Krieg war, zwei Heere standen sich gegenüber, beide von ihrer Unbesiegbarkeit überzeugt, die Fahnen des einen bestickt mit jungem, die des andern mit altem Ruhm, Franzosen und Preußen. Morgen würden sie aufeinander einschlagen, -stechen, -schießen, und er lag zwischen den Linien. Nur fort von hier, irgendwohin, wo ihn weder Säbel noch Kugel erreichten!
Später wusste er nicht zu sagen, wie er aus dem Tal auf die jenseitige Anhöhe und von dort über ein welliges Brachland in den Wald gekommen war, taumelnd, halb kriechend, die Hand gegen die Brust gepresst, nach zwei, drei Schritten wieder fallend, und erst als ihn ein Dickicht aus Jungfichten vor dem Wind schützte, blieb er keuchend liegen. Erschöpft schlief er ein, vielleicht war es ein Fieberschauer, der ihn für eine halbe Stunde oder länger auslöschte. Irgendwann schimmerte ein mattes Grau durch die Stämme. Er versuchte sich aufzurichten, sank aber gleich wieder zusammen, drehte sich auf die gesunde Seite, fasste ein Stämmchen, stieß sich mit den Füßen ab und hangelte sich vorwärts. Frost schüttelte ihn und Hitze, schon packte ihn das Fieber wieder, um ihn in die Dunkelheit zurückzuwerfen, da hörte er Pferde schnauben. Menschen in der Nähe, Menschen! Keine fünfzig Schritt vor ihm, Reiter, abgesessen, Soldaten, Preußen.
Dragoner, erkannte er, Königin-Dragoner. Der dumpfe Trommelwirbel verdichtete sich zu einem harten Marsch, schrill fielen die Pfeifen ein. Der Hauptmann auf einem Grauschimmel voran, ritt die Eskadron durch das Pyritzer Tor in das Städtchen ein, an Hofpfosten, Haustüren und hinter den kleinen Fensterscheiben erschienen Mädchengesichter; ein Schweinetreiber scheuchte seine Herde in eine Nebenstraße, Halbwüchsige pfiffen auf den Fingern, als wollten sie die Spielleute aus dem Takt bringen; die blanken Hufeisen schlugen Funken aus den Pflastersteinen.
Vater ließ die Schere fallen, griff nach dem Zeigestock und brüllte: Antreten! Front zur Straße! Das Dutzend Schuljungen stürmte hinaus, stellte sich drängelnd und schubsend der Größe nach auf, Vater kommandierte: Achtung! Stillgestanden! Das Gewehr über! Er schulterte den Stock, und die Jungen hantierten mit ihren Griffeln, als wären es Musketen. Ihr Kommandeur befahl sich selbst: Kehrt!, machte Front zu der vorüberreitenden Kolonne, und der Hauptmann legte grüßend die Rechte an den Federhut. Zum Teufel, Junge, bei der Kavallerie heißt es Rittmeister! Warte, ich wil’s dir einbläuen! Der Haselstock zischte, pfiff wie eine Flintenkugel, schlug gegen einen Kiefernstamm.
Er duckte sich flach in die Mulde. Der süßliche Geruch der welken Nadeln und des modernden Laubs gab ihm das wohlige Gefühl des Geborgenseins, wie einst das Bettstroh, wenn er abends dem Unmut des Vaters entronnen war. Selbst die Kälte biss hier weniger.
Der wachthabende Dragoner warf die Arme in die Höhe und sank lautlos neben dem Baum hin, an dem er sich postiert hatte. Die übrigen, die eben noch frierend beieinander kauerten, sprangen auf, rannten zu den Pferden, schwangen sich in die Sättel, aber bevor die meisten von ihnen den Säbel ziehen oder gar das Gewehr von der Schulter reißen konnten, waren die Chasseurs schon unter ihnen. Der Hauptmann war der erste, den sie von seinem Schimmel hieben.
Wütend wehrten sich die Dragoner, Säbel gegen Bajonett, und immer wieder ein Schuss, der einen der Preußen vom Pferd riss. Ein junger Leutnant — so jung nun auch nicht, jedenfalls nicht jünger als Robert, also um die Dreißig — focht zuletzt allein gegen ein Dutzend Bedränger, als alle seine Kameraden tot oder verwundet am Boden lagen oder gefangen hinweggeführt wurden. Er ritt einen brandroten Fuchs, blutete aus mehreren Wunden, aber er wirbelte seinen Säbel nach rechts und nach links, schlug einem Kapitän das Ohr vom Kopf, wehrte ein Bajonett ab, riss einem Trompeter das Piston aus der Hand und stieß zuletzt einem Franzosen, der ihn aus dem Sattel zerren wollte, die Stiefelspitze unter das Kinn.
In diesem Augenblick zog ihm der Kapitän den Säbel über den Kopf. Der Hut des Preußen war gut gepolstert; die mit wütender Kraft geschlagene Klinge glitt ab, drückte dem Leutnant nur die Krempe über die Augen, beraubte ihn so jeder Sicht und riss dem Fuchs einen Fetzen Fleisch aus der Seite. Das schmerzgepeinigte Tier stieg hoch, warf den Angreifer um und galoppierte in voller Karriere davon, geradeswegs auf das Dickicht zu. Drei, vier Franzosen hoben zugleich ihre Pistolen. Robert duckte das Gesicht in den Moder, Querschläger pfiffen über ihn hinweg. Als er den Kopf vorsichtig hob, sah er, dass der Leutnant nur noch mit dem linken Fuß im Steigbügel hing. Das Tier brach durch das Gebüsch, der Fuß löste sich aus seinem Halt, der leblose Körper blieb ein halbes Dutzend Schritte vor Robert liegen: Der von seiner Last befreite Fuchs wieherte auf und stürmte weiter.
Die Franzosen rückten mit ihren Gefangenen ab. Die Verwundeten und selbst die Toten luden sie den erbeuteten Pferden auf. Um den Leutnant kümmerte sich keiner. Ihr siegesfrohes Lärmen verklang.
Wäre diese Stille plötzlich hereingebrochen, sie hätte ihm die Ohren zerrissen. Aber bevor sich die Abziehenden so weit entfernt hatten, dass sie nicht mehr zu hören waren, kreischte der Häher. Schimpfte er den Fremden hinterher, oder warnte er vor einer neuen Gefahr? In der Ferne grollte Kanonendonner, die Schlacht begann. Aber das war so weit weg, so unwirklich, dass er nicht sicher war, ob es nicht, was er für Salven hielt, vielleicht nur Regentropfen waren, die auf Borkenstückchen trommelten.
Als endlich auch der Häher schwieg, drückte die Stille den Frost in die Glieder und den Schmerz in die Brust. Das völlig durchnässte Hemd wärmte nicht, im Gegenteil, Robert fühlte sich wie in Eis eingeschlossen. Der Tote da vor ihm, der hatte es gut, der spürte nichts mehr, nicht seine Wunden und nicht die beißende Kälte. Seine Reiterseele schwebte längst der wärmenden Sonne zu, wo die süßen kleinen Engel in ihren kurzen Hemdchen von Wolke zu Wolke hüpfen und nachts mit ihren Stupsnäschen die Sterne blank reiben.
Hätte nicht eine verirrte Kugel, ein Abpraller, auch ihn erlösen können von allem Schmerz, aller Kälte und von diesem Schütteln, unter dem das Laub raschelte und die Zweige knackten, als bräche ein wildes Tier durch die Dickung. Wenn alles nur schnell ginge und er nicht so viel davon spürte! Vor dem Totsein fürchtet sich der Mensch nicht, die Toten liegen so still da, etwas eingefallen vielleicht und grau im Gesicht, aber doch recht friedlich und beinahe zufrieden; man sieht gleich, das kann so schlimm nicht werden, das Totsein. Aber bis man dahin kommt! Denn vor dem Sterben hat man Angst. Da liegen sie und quälen sich, stöhnen, schreien, röcheln, krallen die dürren Finger in die leere Luft, als wollten sie sich daran halten; da muss man ja eine Gänsehaut kriegen. Ja, wenn’s wäre, als wenn ein Milchtopf ein Loch hat. Man spürt, da läuft es langsam hinaus, man wird immer weniger, und plötzlich ist nichts mehr da. Ja, wenn es so einfach wäre!
Da bewegte der Tote den Mund, als wollte er noch etwas sagen, vielleicht eine letzte Bitte aussprechen oder dem Lebenden einen späten Rat geben. Robert stützte das Kinn auf das Handgelenk, um dem Leutnant die Worte von den starren Lippen abzulesen: Nimm, Tote brauchen nichts mehr!
Er zog den Arm unter dem Kopf hervor; die Stirn schlug auf den feuchtkalten Grund, eine Fichtennadel bohrte sich in die linke Braue. Unsinn, der da vor ihm war tot, kalt, steif! Eine Eidechse war über trockenes Laub gehuscht, ein Hirschkäfer über einen Kienapfel gekrabbelt. Aber hatten diese Tierchen sich nicht längst ins Moos verkrochen, um zu überwintern? Der Tote hatte recht, hundertmal recht, er brauchte nichts mehr, weder den Rock noch die Stiefel und auch nicht das Stück Hartbrot, das-er vielleicht, vielleicht in der Tasche trug. Um das lästige Stechen in der Braue fortzuwischen, hob er den Kopf, und jetzt zwinkerte ihm der Leichnam zu, tatsächlich, das Auge zwinkerte! Robert spürte, seine Nackenhaare sträubten sich wie bei einem verängstigten Kater. Oder hatte er sich von einem Schatten täuschen lassen, den ein im Wind wedelndes Eichenblatt auf das starre Gesicht warf? Dennoch, er musste dem Toten recht geben, und er wollte ihn ehren, indem er seinen Willen erfüllte, und zwar sofort, denn je länger er wartete, desto mehr durchnässte auch dessen Kleidung. Passen würde sie, das sah er, der Tote hatte ungefähr seine Statur. Notfalls versetzte er ein paar Knöpfe.
Als er sich hinkniete, durchfuhr ihn ein so heftiger Schmerz, als hätte ihn eine zweite Kugel getroffen. Unwillkürlich stützte er sich mit dem gesunden Arm ab. Stak denn das Blei noch immer im Fleisch? Nein, das Loch in der Hemdbrust, die Wunde, das getrocknete Blut, das das Leinen wie eine breite rote Schärpe überzog ... Glück gehabt, sagte er sich, ein glatter Durchschuss.
So kroch er denn hinüber und entkleidete den Toten, das Gesicht vor Schmerzen verzerrt und vor Entsetzen abgewandt. Wen, der nicht völlig abgestumpft ist, befällt nicht ein Schauder, wenn er mit Leichen umgehen muss! Wenn die starren Arme sich plötzlich bewegen, die steifen Finger sich krümmen und sich ihm in die Augen krallen!
Das Hemd ließ er dem Toten; es war blutverkrustet wie sein eigenes, sonst aber trocken, und er hätte es gut gebrauchen können. Doch es widerstrebte ihm, den Unglücklichen wie einen Strauchdieb splitternackt liegen zu lassen. Nein, er war kein Leichenschänder, er nahm nur, was er bitter nötig hatte und was der andere entbehren konnte. Dem war ja nicht damit geholfen, wenn er Rock, Hose und Stiefel am Leibe behielt; in der Kolonne, in der er jetzt marschierte, brauchte man keine Montur und keine Waffen.
Der Mann war, wie er selbst, unter der linken Schulter getroffen worden, da konnte das Loch im Rock keinen Verdacht erwecken. Freilich war die Kugel etwas tiefer und mehr zum Rückgrat hin eingeschlagen und damit tödlich gewesen, während er, wie es schien, mit einer leichten Fleischwunde davongekommen war. Je brennender der Schmerz, hatte Vater behauptet, desto weniger gefährlich, und mit elf Narben am Körper mochte er es wohl wissen. Nur vor Fieber und Brand musste man sich hüten.
Als er den Rock überzog, fühlte er die eisige Nässe des Hemdes doppelt; er schüttelte sich, es half wenig, die Bewegung verstärkte den Schmerz. Aber der Rock passte. Die Stiefel dagegen drückten. Das lag daran, dass er mit einer Hand die Fußlappen nicht kunstgerecht legen konnte. Diesmal ließ er Vaters Rat, besser barfuß als mit schlechtem Schuhwerk, außer Acht. Der galt wohl nur für Sommerfeldzüge.
Er klopfte die Taschen ab, Papiere knisterten, die konnte er später durchsehen, ein paar Münzen klapperten, Brot fand er nicht. Den Säbel wischte er an einem Stamm ab, bevor er ihn in die Scheide steckte. Er hätte ihn gern weggeworfen, aber ohne Waffe glaubte ihm niemand den Offizier. Jetzt brauchte er nur noch ein Pferd.
Er drehte sich noch einmal um. Was da so armselig lag, war noch vor wenigen Stunden voller Leben gewesen, konnte reiten und fechten, lachen und fluchen und befehlen. Und sicher bangte irgendwo auf einem hinterpommerschen Vorwerk oder in einer schlesischen Kleinstadt eine Mutter um ihn, eine Braut, vielleicht Frau und Kinder. Und er lag hier verlassen, starr und steif, ein verfallendes Stück Fleisch im Gestrüpp, unbedeckt wie ein erschlagener Pferdedieb.
Er zerrte den Leichnam in die Mulde, scharrte Moos, Nadeln und Laub darüber, legte aus trockenen Ästen ein Kreuz und sprach ein stilles Gebet. Da merkte er, dass er sich die Lippen blutig gebissen hatte.
Den Hut des Leutnants, der sich an einem schweinskopfgroßen Feldstein verfangen hatte, hob er auf; vielleicht schlug man auch nach seinem Kopf mit dem Säbel. Der Dreispitz war etwas groß, zusammengedrückt passte er.
Nun noch das Pferd. Ein Tier, das gut behandelt wird, verlässt seinen Herrn nicht ohne Not. Robert pfiff, wie er es oft von den Dragonern gehört hatte. Ein Schnauben antwortete ihm. Er kannte sich mit Pferden aus. In seinem Heimatstädtchen betrieb jeder Bürger ein wenig Landwirtschaft. Und er war der Sohn eines Husaren.
Tatsächlich ließ sich der Gaul anlocken, auch streicheln; vielleicht nahm ihm der vertraute Geruch der Kleidung die Scheu. Erschöpft und doch beinahe glücklich lehnte sich Robert gegen den warmen Leib des Tieres.
Fürchtete er nicht, auf einen Regimentskameraden des Leutnants zu treffen oder sonst jemanden, der ihn gekannt hatte? Um die Wahrheit zu sagen, er fühlte sich in der Wärme des Pferdes viel zu glücklich, als dass er daran auch nur gedacht hätte. Ebenso wenig ahnte er, dass ihn diese Montur für fast drei Jahre zu einem anderen Menschen machen würde. Er wollte so nur ins nächste Dorf reiten, sich Bauernkleidung verschaffen, notfalls mithilfe des Säbels, und weiterziehen bis in eine Gegend, in der kein Soldat zu sehen und kein Waffenlärm zu hören war, und dort einen Doktor oder wenigstens ein Kräuterweib aufsuchen. Der Krieg ging einmal zu Ende, und im Frieden dachten die Leute nicht nur ans Essen und Trinken, sie wollten sich auch gut anziehen. Schneider werden immer gebraucht.
Als er sich ein wenig erholt hatte, kramte er mit zitternden Fingern in den Satteltaschen, fand aber auch da kein Brot, nur den Tabaksbeutel und die Pfeife. Gern hätte er ein paar Züge genommen, um den Magen zu betäuben, doch die Funken, die er aus dem Stahl schlug, zündeten nicht, die Lunte war durchnässt.
Der Fuchs stand ruhig, vertraute schnell dem neuen Herrn, war eben ein Herdenvieh. Robert setzte den Fuß in den Steigbügel; er hätte sich vor Schmerzen krümmen mögen und durfte es doch nicht. Ihm fehlte die Kraft, sich mit einem Schwung in den Sattel zu bringen, mit der einen Hand konnte er sich gerade so weit hochziehen, dass er quer über dem Rücken des Tieres lag. Der Fuchs wurde nervös, die aufgestellten Ohren spielten erregt, er setzte sich in Trab. Robert klammerte sich an irgendwelchen Gurten fest, auf die Richtung achtete er nicht. Nur nicht loslassen!
3. Kapitel
Die Trümmer der kläglich geschlagenen preußischen Armee schleppten sich ohne alle Ordnung, ohne Hoffnung, Not leidend an allem, nach Norden und Nordosten, um dem nachdrängenden Feind zu entgehen und, Offiziere wie Gemeine, das nackte Leben zu retten.
Auch die Division Schmettau, Teil der vom alten Herzog von Braunschweig kommandierten Hauptarmee, wurde überrascht, aufgerieben, der jämmerliche Rest auseinandergesprengt, mit ihr die blauen Dragoner des Leibregiments der Königin, die sich einst, damals noch Ansbach-Bayreuth-Dragoner, unter dem vorvorigen Könige bei Hohenfriedberg viel besungenen Ruhm erstritten hatten. Das war das Glück im Unglück des wandernden Schneidergesellen.
Am späten Nachmittag dieses misslichen Herbsttages sahen die von ihren Kameraden abgekommenen Unteroffiziere Thessen und Franz einen Leutnant ihres Regiments unter einem zusammengebrochenen brandroten Fuchs liegen. Der Mann rührte sie wenig, aber auf das Tier meinten sie ein Anrecht zu haben, vielmehr auf ein Stück Fleisch davon, das sie in schwelendem Feuer oder glimmender Asche rösten wollten. Als sie die Messer in den Kadaver stießen, der noch frisch zu sein schien und damit genießbar, merkten sie, dass der Leutnant stöhnte. Er lebte also noch.
Musste man ihn nicht retten? Ja, wenn man ihm wirklich helfen könnte, aber er war dem Tode verfallen. Sie waren lange genug Soldat und hatten im Frankreichfeldzug manchen braven Mann sterben sehen, um zu wissen, dass in solchen Fällen die Hilfe nur die Qualen verlängert. Und wer wollte sie auch zur Verantwortung ziehen, wenn sie den Mann sich selbst überließen!
Sie sahen sich an, jeder las im Gesicht des andern seine eigenen Gedanken, aber dann siegte doch ein Rest menschlichen Gefühls, den die langen Jahre des Dienstes noch nicht aufgezehrt hatten. Sie zogen den Verletzten unter dem Gaul hervor. Ob sie ihm damit wirklich halfen, daran zweifelten sie freilich noch immer.
Sie wussten nicht, wer er war, der Herr Leutnant. Die Schwadronen garnisonierten in weit voneinander gelegenen Kleinstädten rechts und links der Oder, nur zum Regimentsexerzieren oder zu den jährlichen Revuen kamen die Bataillone zusammen. Da hatte man nicht genügend Zeit, sich alle Gesichter einzuprägen. Wozu auch? Es genügte, wenn man die Herren der eigenen Schwadron kannte. Und so wie dieser aussah, so zerstochen, zerschlagen, zerschunden, hätte selbst seine Mutter Mühe gehabt, den Sohn zu erkennen.
Während Thessen aus dem Fleisch des Tieres handliche Brocken herausschnitt, hob Franz den Kopf des wie tot Daliegenden an. »Herr Leutnant, Herr Leutnant!«
Der aber stöhnte nur. Da entdeckte Franz den Blutfleck im Rock und das Loch, das die Kugel gerissen hatte. Man muss ihn verbinden, dachte er, aber womit?
In den Rocktaschen fand er nichts, was sich eignete, nur ein paar Briefe, adressiert an den Leutnant von Schill. Der also!
»Thessen, hat er in den Satteltaschen Verbandszeug?«
»Damit schleppt sich doch kein Offizier ab.«
»Herr Leutnant, Herr von Schill!« Wieder nichts. Selbst ein paar behutsame Ohrfeigen weckten den Besinnungslosen nicht auf.
Was tun? Lange durften sie sich nicht aufhalten. Gewiss suchten die Franzosen die Umgebung des Schlachtfeldes nach Versprengten ab, um sie in die Gefangenschaft abzuführen, auf die Galeeren oder auf die Pfefferinseln.
Die Beine des Leutnants schienen unverletzt. Wenn er wieder bei sich war, konnte er vielleicht gehen; notfalls stützten sie ihn.
Thessen briet das Fleisch, das er auf sein Bajonett gespießt hatte, über einem schwachen Feuer. »Wenn ihm erst der Bratenduft die Nase kitzelt, sperrt er den Schnabel schon auf.«
Er behielt recht. Der Leutnant schlug die Augen auf, aber sie blickten so angstvoll, so entsetzt auf Franz, dass der erschrocken zurückfuhr. War er denn ein zähnefletschender Kannibale, vor dem man sich fürchten musste?
»Herr Leutnant, wir sind Preußen, Regimentskameraden, wenn auch bloß Unteroffiziere.«
Der Verletzte öffnete den Mund, brachte aber nur ein paar gurgelnde Töne hervor. Der Blick irrlichterte umher, die Hände zitterten wie die eines Greises.
»Großer Gott, er ist wirr im Kopf.«
»Was Wunder! Lass du dir man über den Schädel hauen und dann noch durch die Brust schießen. Wenn er uns nur nicht unter den Händen wegbleibt!«
»Wir hauen ab, je eher, desto besser.«
»Einen Kameraden in der Not verlassen?«
»Einen Offizier! Was bist du denn für ihn? Der Stock, der die Rekruten prügelt und den er in den Straßengraben wirft, wenn er ihn nicht mehr braucht. Ob hier oder eine halbe Meile weiter. Er krepiert ohnehin.«
»Und wenn wir dereinst vor dem großen Tor stehen und der Herr fragt: Kain, wo ist dein Bruder Abel?«
»Pfaffengeschwätz!«
»Wir wollen ihm zu essen geben, dann werden wir sehen.«
Ganz so außer sich, wie die beiden glaubten, war er nun doch nicht. Gewiss hatte er sich fast zu Tode erschrocken, als er die bekannte Uniform über sich sah, aber er begriff sehr schnell, dass ihm von daher im Augenblick keine Gefahr drohte. Er wollte den beiden fluchen, die ihn aus dem sanften Nichts zurückgerissen hatten, denn nun spürte er wieder die Kälte, den Hunger, die Schmerzen. Gerade diese aber weckten seinen Lebenswillen. Oder war es gar der Duft des gebratenen Fleisches?
Er war also nun der Herr von Schill. Den Namen hatte er schon gehört, ganz gewiss. Kein Wunder, der Vater wusste die Ranglisten ganzer Reiterregimenter herzubeten. Aber vorstellen konnte er sich den Leutnant nicht.
Auch die beiden Unteroffiziere kannten ihn anscheinend kaum. Zum Glück, denn er brauchte sie. Allein kam er nicht weiter. Einem Leutnant halfen sie, wenn auch vielleicht nur aus eingeprügeltem Respekt, einen Schneidergesellen ließen sie liegen. Freilich wuchs mit der Länge des Weges die Gefahr der Entdeckung, also musste er sich, wenn ein Arzt oder Feldscher ihn verbunden hatte, sofort aus dem Staub machen.
Wenn sie ihn nur nichts fragten, nicht nach dem gestrigen Tag, nicht nach den Kameraden, schon gar nicht nach Begebenheiten aus dem Garnisonsleben! Während er noch verzweifelt einen Ausweg suchte, gab ihm Franz in seiner Einfalt den rechten Rat: Großer Gott, er ist wirr im Kopf! Wie soll so einer vernünftig antworten.
Der Hieb über den Schädel hatte sein Gedächtnis gestaucht. An etwas Ähnliches erinnerte er sich. Vor Jahren war ein Junge vom Rande einer Kiesgrube auf den steinigen Grund gestürzt. Wie tot blieb er liegen, atmete aber noch. Die erschrockenen Spielkameraden packten ihn an Armen und Beinen und tragen ihn nach Hause. Nach drei Tagen kam er wieder zu sich, aber er hatte vergessen, wer er war, erkannte die Mutter nicht, nicht den Vater und die Geschwister. Er plapperte nur nach, was man ihm vorsprach, von selbst wusste er nicht, wie die Dinge hießen. Er lernte alles neu, war dabei ein stiller, freundlicher, arbeitsamer Mensch. Äußerlich blieben nur ein paar Narben zurück, welcher Junge hat die nicht. Aber es hatte keinen Sinn, ihn nach Vergangenem zu fragen, die Erinnerung war ausgelöscht.
Thessen reichte ein Stück heißes Fleisch herüber; an den verbrannten Rändern kräuselte noch blauer Rauch. Robert starrte darauf wie auf ein totes Stück Stein. Dabei zitterten seine Hände vor Gier, Speichel lief über die Lippen, Krämpfe zogen Mägen und Gedärm zusammen, aber er beherrschte sich.
Franz schüttelte bekümmert den Kopf, nahm das Fleisch, schnitt es in fingerkuppenkleine Bröckchen und schob sie ihm einzeln zwischen die Zähne. Da schien der Kranke zu begreifen, er kaute, erst wie zufällig und lustlos, dann mit sichtlichem Behagen. Zuletzt riss er, wenn er einen Bissen geschluckt hatte, den Mund weit auf. Ein junger Spatz, der um Futter bettelt.
Thessen kratzte sich mit dem Heft des Messers das Genick. »Was für ein armseliges Wesen ist der Mensch: ein Stoß gegen das Dach, schon knickt das Gebälk, beim Offizier nicht anders als beim Gemeinen. Um diesen wird sich der Oberst nicht grämen, ist froh, ihn auf bequeme Weise los zu sein — falls er davongekommen ist.«
»Oberste kommen immer davon.«
»Tritt doch Leutnant Schill, ja dieser, beim Morgenappell mit verkehrt geknöpftem Rock vor die Front, oben ein Knopfloch, unten ein Knopf zu viel.«
Und das mir, der ich ein Schneider bin und weiß, was ein akkurater Anzug für das Avancement eines Menschen bedeutet.
»Blitz, Blei und Bombenhagel. Der Rittmeister riss sich in der Rage die Stulpen von den Stiefeln. Drei Wochen Arrest und danach die unbequemsten Wachen.«
»Zu den Leuten soll er gut gewesen sein.«
»Ein Spinner! Hätte auf Pastor studieren sollen, anstatt sich bei den Dragonern einzuschreiben. Schleppt Bücher mit sich herum. Ein Offizier und Bücher! Und kein Kriegsbuch, von Alexander, Cäsar oder einem andern alten Feldmarschall, nein, eine Komödie! Seines Rittmeisters Reitknecht, der mir das erzählt hat bei einer Kanne Pasewalker Bier, hat es mit eigenen Augen gesehen.«
Robert, durch die Mahlzeit ein wenig gestärkt, wenn auch nach wie vor von Wundschmerz gequält und zudem von einem heißen Prickeln, das von den Schultern her den Rücken überzog und mit Fröstelschauem abwechselte, wandte alle seine Energie auf, um dem Gespräch zu folgen. Nur wenn die beiden seine Aufmerksamkeit nicht spürten, wenn sie unbefangen blieben, erfuhr er etwas über den Mann, der er für die nächsten Tage bleiben musste. Er legte sich einen Kienapfel auf die flache Hand und besah ihn mit einem geradezu kindlichen Staunen.
Eine leise Ahnung stieg in ihm auf, er hatte nicht nur den Namen des Mannes gehört, er hatte ihn wohl auch gesehen, flüchtig nur und nicht zu Hause in Bahn, sondern in Gartz, wo er einige Monate bei einem tüchtigen Meister gearbeitet hatte, bis ... Mein Gott, wenn er das wäre!
Er trudelte den Kienapfel von einer Hand in die andere. Franz schaute kurz herüber und freute sich an dem Spiel. »Der Soldat muss seinen Spaß haben«, sagte er.
»Hat sich was! Eine todtraurige Geschichte. Eine Königin bringt eine andere um — oder umgekehrt. Mariechen hieß sie, glaub ich, der Nachname ist mir aus dem Kopf gefallen, macht nichts, war sowieso ausländisch. Aufgeschrieben hat’s aber bloß ein sächsischer Professor, der hieß ..., na, der hieß auch Schill oder so ähnlich. War vielleicht sein Onkel. Warum hat der nur seinen Neffen Offizier werden lassen! Wollen eben alle hoch hinaus, die Gelehrten.«
Robert konnte noch immer nicht fassen, dass er ausgerechnet für diesen Menschen gelten sollte. Er hatte Schill, wenn es wirklich der war, den er jetzt meinte, nur ein oder zweimal von Weitem gesehen und ihn wohl deshalb am Morgen nicht wiedererkannt. Soweit er sich erinnerte, war an dem Manne nichts gewesen, was ihn auffällig gemacht hätte, äußerlich jedenfalls nicht. Er galt als kein guter Offizier, ein Eigenbrötler war er, versponnen, nachlässig im Dienst, hockte nicht in Schankstuben herum, randalierte nicht, flanierte nicht auf der Marktstraße, nicht einmal Weibergeschichten sagte man ihm nach; bis auf ... Nicht daran denken, Robert brauchte jetzt einen klaren Kopf.
»Und warum bringt die eine die andere um?«
»Weiß ich’s, frag ihn! Sicher eines Kerls wegen. Königinnen sind doch auch Weiber.«
Ein Glück, dass sein Gesicht so verunstaltet war, man hätte ihn, wie er jetzt aussah, auch für den General Bernadotte halten können. Aber wenn die Wunden heilten und der Schorf abfiel? Bis dahin musste er unbedingt den Leutnantsrock abwerfen. Und die Augen? Die Augen verraten den Menschen. Wer sieht schon, tröstete er sich, seinem Gegenüber so genau ins Gesicht, manche Leute leben jahrelang zusammen, und der eine kennt die Augenfarbe des andern nicht.
»Vielleicht suchte er in der Komödie den wahren Charakter der Weiber. Er soll ja halbe Nächte lang zum Fenster eines Mädchens hinaufgestarrt haben, hat der Reitknecht gesagt. Einmal warf sie ihm eine Petunie zu. Er drückte die Blüte an die Lippen und taumelte selig davon. Als ob auf dem Gehöft eines Malers keine Leiter ...«
»Verdammt!«, entfuhr es Robert.
»Gott sei Dank«, rief Franz aus, »er flucht. Also ist er wieder beisammen. Können Herr Leutnant gehen?«
Der aber spielte schon wieder lächelnd mit dem Kienapfel. Hinter dem Lächeln versteckte er seinen Zorn auf sich selbst.
Ein nüchtern denkender Mensch, wie es heutzutage die jungen Leute sind, hätte ein so seltsames Spiel des Zufalls strikt abgelehnt. Er aber, der nicht auf die Philosophen, sondern auf die Schneiderkunst studiert war, hätte sich allenfalls gewundert, welch bunte Flicken der Meister da oben für sein Leben zugeschnitten hatte, und sich dann, da es nun einmal so bestimmt war, darangesetzt, sie nach bestem Vermögen zusammenzuheften. Nur war er jetzt selbst für solcherlei Schneiderphilosophie zu erregt und wohl auch durch die Unfälle des Tages zu geschwächt.
Sie stellten ihn auf die Beine. Franz fasste behutsam zu, als hülfe er einem neugebornen Ziegenlamm, Thessen packte derb an, fast grob, als müsste er einen Sack Mehl aufrichten. Der Kienapfel fiel achtlos zu Boden. Robert ließ es geschehen, lächelte noch dazu, freundlich, beinahe dankbar wie ein Kind, dem man ein paar Kreuzer für den Jahrmarkt schenkt. Die Knie waren weich, er glaubte umzuknicken und lang hinzuschlagen, hielt sich an Thessens Arm, der zog ihn vorwärts, und siehe, nach den ersten stockenden Schritten setzte er tapfer Fuß vor Fuß. Wenn er mit der Stiefelspitze gegen eine Unebenheit des Weges oder einen Stein stieß, stach es in der Wunde, wie wenn man ein Messer darin umdrehte. Einen Augenblick verhielt er, das Gesicht schmerzverzogen, dann zwang er seinem Mund wieder ein Lächeln und seinen Beinen die nächsten Schritte ab.
Während einer seiner Helfer ihn stützte, trug der andere die Satteltaschen, je nach den Beschwernissen des Weges wechselten sie einander ab. So hatten sie genug zu tun, sagten nichts und fragten nichts, und Robert konnte sich ganz auf seine Bewegungen konzentrieren.
Bei Anbruch der Nacht erreichten sie endlich ein Dörfchen, wo man ihnen nach langem Bitten und Betteln ein Hoftor öffnete, eine dünne, ungesalzene, aber warme Suppe vorsetzte und sie nicht wieder weiterschickte. Die beiden Unteroffiziere fanden mit Mühe einen Platz, der wenigstens etwas Schutz vor Kälte, Wind und Nässe bot. Wo es nur anging, lagen übermüdete, abgerissene Gestalten herum, Männer, die gestern noch brav und adrett in Reih und Glied marschiert waren. Den Herrn Leutnant nahm die Bäuerin, eine kleine, rundliche Person mit einem Pferdegesicht, das irgendwie nicht zu ihr passte, mit in die Küche, wusch die Wunden, belegte sie mit in Öl getränkten Leinenlappen und zog ihm das blutfleckige Hemd wieder über. Dann wies sie auf die Holzbank, indem sie in ihrem unverständlichen Dialekt etwas flüsterte, was sich wie Zähneklappern anhörte. Zum Zudecken reichte sie ihm zwei staubige Kornsäcke.
Am andern Tage hatten sie Glück. Nach einer halben Meile holte sie ein Bauer ein, der mit einem Wägelchen trockenen Kienholzes zum nahen Marktflecken zuckelte. Der verwundete Herr Leutnant durfte aufsteigen. Die beiden Unteroffiziere trotteten hinterher, mit ihnen ein paar Gemeine, versprengte Infanteristen, die meinten, solange sie sich in der Nähe eines Offiziers hielten, würde sie niemand für Deserteure ansehen.
Der Passagier fühlte sich auf dem ungefederten Wagen mit seiner nur lose gepackten, hin- und herrollenden Last so heftig durchgewalkt, dass er den Gedanken, hinter dem nächsten günstigen Gebüsch abzuspringen und davonzulaufen, doch aufgab.
Im Städtchen angekommen, bereute er es. Noch als ihm Thessen und Franz von dem unbequemen Gefährt herunterhalfen, eilte ein Dragonerleutnant auf ihn zu, der sich offensichtlich freute, einen Regimentskameraden zu treffen. Aus, dachte Robert, nun binden sie mich und bringen mich vors Kriegsgericht. Oder sie erschießen mich auf der Stelle, einen Straßenräuber, Mörder, Leichenschänder. Die Wunde schmerzte heftiger, ein Schwindelgefühl befiel ihn, Schweiß brach aus allen Poren. Wenigstens davon war er dann befreit. Vorher aber hätte er gern die Papiere angesehen, die in Schills Tasche steckten. Ob ein Brief von Friederike dabei war?
4. Kapitel
Das Fieber war gekommen und mit ihm das Bohren hinter den Augen, heftiger als der Schmerz der Wunde.
Sie waren vom Berg herabgestiegen, nicht einmal sehr steil, da hatte er sich gegen einen borkigen Stamm gelehnt und auf die Zunge gebissen, immer wieder, mit aller Kraft. Nicht sprechen, dachte er nur, kein Wort, kein einziges Wort.
Die Zunge schwoll stark an, erzählte Franz später. Die Gefährten, sie liefen ja in hellen Haufen nach Norden, vom Feinde weg, bekamen das große Zittern. Die Pest! barmte einer, die Cholera! ein anderer, und sie sahen zu, dass sie Abstand gewannen.
Er erwachte in diesem reinweißen, weichen Bett, irgendjemand, ,der etwas davon verstand, hatte seine Schulter mit einem sauberen Verband bewickelt, so fest, dass er kaum noch Schmerzen spürte, auch der Kopf war in Leinen gehüllt; eine grünliche Salbe, die nach Kamille roch, bedeckte die Schrammen im Gesicht. Heilsalbe! Wenn man sie abwusch, war sein Gesicht wieder da, das Schneidergesicht, nicht das des Leutnants!
Das Schütteln war in ein leichtes Frösteln übergegangen, das Bohren quälte ihn nur noch, wenn er den Kopf hob, setzte zwischen den Augen an, genau über der Nasenwurzel; etwas klopfte in den Schläfen, und ein Taumel zwang ihn, sich wieder auf das Daunenkissen zurückfallen zu lassen.
Die Zunge blieb geschwollen, fühlte sich an wie ein in den Mund gepresster Schwamm, der alles ausfüllte, selbst die Lücken zwischen den Zähnen. Wie konnte er sich da verraten haben? Er
hatte ja jetzt noch Mühe, ein verständliches Wort herauszubringen.
Die Frau, diese junge Frau mit den weichen, weißen Händen und den samtschwarzen Augen, sie neckte ihn: »Wer eine so dicke Zunge hat ...« Auf dem schwarzen Samt funkelte ein winziges Pünktchen. Das Funkeln nahm ihm den Schlaf, brannte sich in seine Träume.
Immerhin ein Zeichen, dass sein geschwächter Körper neue Kräfte sammelte. Kraft, viel Kraft würde er nötig haben in diesem unruhigen Magdeburg, der mit Militär vollgestopften Festung. Eine kleine Stadt wäre ihm lieber gewesen; in solchen Orten sind die Menschen überall ähnlich; man weiß bald, mit wem sich reden lässt.
Wem aber durfte er hier trauen? Noch dazu jetzt, wo eine Menge Leute, Kaufleute, Gastwirte, Handschuhmacher, vor allem aber Offiziere, zu plötzlich entdeckten, sie müssten ihr Französisch aufbessern oder wenigstens einige Wendungen dieser Sprache erlernen. Monsieur Berre, sein Quartierwirt, war nun ein gefragter Mann, vom frühen Morgen bis in den späten Abend. Ihm blieb kaum Zeit, nach dem Frühstück, das er hastig in der Küche einnahm, seinem Gast ein kurzes »Bonjour, Monsieur de Schill« zu wünschen, höchstens setzte er hinzu: »Madame lässt es Ihnen an nichts fehlen, n’est-ce pas?« Die Antwort wartete er schon nicht mehr ab.
Sie tat es wahrhaftig nicht, die Madame mit den Samtaugen und den weichen, viel zu weichen Händen. Sie war jünger als ihr Mann, reichlich zehn Jahre, vielleicht zwanzig. Doch was kümmerte ihn das! Ihm war es peinlich, dass diese Hände all das an ihm verrichteten, was man bei Kranken eben tun muss; jeden dritten Tag wechselte sie das Laken, jeden zweiten zog sie ihm ein sauberes Hemd an. Das war noch das wenigste, er war ja hilflos wie ein neugeborenes Kind.
Dass sie ihn danach noch so ansehen konnte! Er schlug die Augen nieder vor diesem Blick, versuchte, um sich abzulenken, sich Friederike vorzustellen. Was hatte sie für Augen? Große und unergründlich tiefe, meinte er sich zu erinnern, graugrün oder dunkelblau mit gelben Streifen wie ein Waldsee, wenn die Abendsonne durchs Gezweig bricht. Nein, die Farbe wusste er nicht, so nah war er ihr nie gekommen.
Es muss um die Osterzeit gewesen sein, nein, gewiss früher; die Wiesen und Böschungen trugen das erste frische Grün, und die Äcker rochen noch nach versickertem Schneewasser. An den milden Vorfrühlingssonntagen spazierten die Mädchen in kleinen Gruppen zur Schrey hinaus, einem hügeligen Wäldchen, von wo aus sie den Frachtkähnen nachschauten, die auf den gewundenen Flussarmen nordwärts trieben. Vielleicht träumten sie sich mit ihnen in die Ferne, wo goldlockige Märchenprinzen ihrer harrten, vielleicht warteten sie aber auch nur auf die Burschen, die ihnen folgten, sie anlachten und allerlei Allotria trieben, um ihnen zu gefallen.
Robert hatte sich ohne besondere Absicht zwei Ackerbürgersöhnen angeschlossen, die sich bemühten, die Aufmerksamkeit einiger Handwerkertöchter zu erregen. Wie sie prahlten! Mit prall gefüllten Kornsäcken spielten sie Fangball, und der eine wollte gar einen eisenbeschlagenen Pflug mit ausgestreckten Armen in Schulterhöhe heben. Nur schade, dass gerade keiner zur Hand war.
Die Mädchen kicherten vor sich hin und drehten sich nicht um.
Robert hielt sich zurück. Er war eigentlich nur hinausgegangen, weil er das auch sonst in seinen freien Stunden gern tat, am liebsten allein, um dem Wellenschlag zu lauschen, Steinchen ins Wasser zu werfen, Borkenstückchen schwimmen zu lassen und immer wieder zum andern Ufer hinüberzuschauen. Drei Meilen weiter lag sein Heimatstädtchen.
Eins der Mädchen blieb stehen, wies über den Graben und rief: »Seht, das erste Himmelsschlüsselchen! Wenn man sich dazu recht von Herzen etwas wünscht, wird es wahr.«
Robert sprang hinüber und bückte sich. »Ich schenke es dir.«
Ein grüngoldenes Käferchen krabbelte eilig davon. Die Hand zuckte zurück. »Nein, es soll nicht vertrocknen. Ich schenke es dir, wie es hier steht, und die ganze Wiese dazu. Immer wenn du hier vorbeikommst, sollst du dir etwas wünschen.«
Friederike sah ihn an.
»Spinner!«, rief der eine Bursche und sprang ihn an. Ein Schulterrücken, und er kollerte in die nasse Grabensohle. Da warf sich der andere, der Pflugheber, auf Robert.
O ja, Kraft hatte der! Wie Schraubzwingen pressten seine Arme den Brustkorb zusammen. Da half kein Schütteln, kein Rucken. Wenn er ihm nur nicht alle Rippen brach! Mit voller Wucht trat er ihm gegen das Schienbein. Ein Aufschrei. Die Zwinge lockerte sich. Mit dem Ellenbogen stieß er nach. Er war frei.
Friederikes Himmelsschlüsselchen hatten sie zertreten, zertrampelt; man sah kaum noch die Stelle, wo es gestanden hatte. Die beiden Burschen humpelten davon, quer über die Wiese, verfolgt von dem Lachen der Mädchen.
Und Robert? Wie sah er aus! Die Hosenbeine bis zum Knie hoch beschmutzt, die Ärmelnaht fingerlang aufgerissen. So konnte er nicht herumlaufen. Den beiden Pferdestrieglern mochte so etwas nichts ausmachen, aber einem Schneider, der etwas auf sich hielt?
Die Mädchen hakten sich unter, trällerten ein übermütiges Liedchen und marschierten im Gleichschritt weiter. Friederike sah sich noch einmal um und nickte lächelnd. Ich habe ja noch die Wiese, bedeutete das. Vielleicht.
Abends in der Kammer, ohne dass ihn jemand darum gebeten hatte, warnte ihn der Lehrjunge: »Ich würde die Finger davon lassen. Da ist schon ein Offizier dran, und mit dem Militär soll man ’s nicht verderben.« Robert zog ihm die Elle über den Hosenboden.
Als sie die Morgensuppe auf den Tisch stellte, sagte die Meisterin: »Ein so anstelliger Geselle wie du lernt in einer kleinen Stadt nicht genug. Du solltest dich in der Welt umsehen, in großen Städten und bei feinen Leuten.«
Der Meister nickte dazu, ohne Robert anzusehen, stotterte: »Wie du meinst, Bertha«, und steckte ihm zum Abschied einen Extrataler in die Westentasche.
»Mach dir nichts draus. Die Familie ist nicht von unserer Art. Und überhaupt, der Alte hat was vor mit ihr.«
Darüber lächelte er jetzt, ein wenig kläglich, wütend auf sich selbst: ein erwachsener Mann! Andere hatten in diesem Alter schon Haus und Hof und ein Dutzend Kinder, er aber träumte von einem Mädchen, von dem er nicht viel mehr wusste als den Namen, nicht mehr besaß als ein freundliches Lächeln und die vage Erinnerung an eine unzeitig blühende Schlüsselblume am Grabenrand. Ja, er war ein Spinner, nicht anders als der Leutnant, vielleicht war er wirklich dieser Schill und der Schneidergeselle Robert nur ein wirres Produkt seines Fiebers.
Wer weiß, wofür Madame dieses Lächeln nahm. Sie strich ihm über die Stirn, ganz sanft, am Rande des Verbandes entlang. Es kitzelte ein wenig, und ihre Augen funkelten wieder.
Zum Glück polterten in diesem Augenblick Soldatenstiefel auf dem Flur, Thessen und Franz, sie kündigten sich immer so an — weiß der Teufel, warum —, wenn sie hereinschauten, jeden Vormittag und meist nachmittags noch einmal, nach seinem Ergehen fragten und ab und zu ein paar Neuigkeiten oder auch nur Gerüchte aus der Stadt mitbrachten.
Madame strich das Bettzeug glatt; sie tat es ebenso sanft, wie sie seine Stirn gestreichelt hatte, aber die Augen verloren den Glanz und verengten sich, zwei dunkle Spalte blieben im Schatten der schwarzen Brauen. Dabei blies sie die Backen auf, und als sie die Klinke niederdrückte, stieß sie die Luft hörbar aus. Die beiden Unteroffiziere mochten es für die französische Antwort auf ihr gemütliches »’n Dach ok« halten.
»Benötigen Sie mich, so rufen Sie. Ich bin in der Küche«, sagte Madame. Wahrscheinlich aber stand sie hinter der Tür und horchte.
Thessen rieb das Genick am Kragen und grinste. »Da kriegt man direkt Lust auf eine niedliche kleine Krankheit.«
Diese aufdringliche Besorgnis war ihm längst lästig. Er hatte gehofft, die Stadt werde ihn von den beiden befreien. Sie waren gesund, unverwundet. Warum sammelte der Kommandant nicht alle Versprengten, um neue Kompanien und Schwadronen zu formieren? Er brauchte doch jeden Mann, wenn er den Franzosen widerstehen wollte. Wer, wenn nicht diese mächtige Festung, sollte den Feind aufhalten, wenigstens einige Tage, damit der König seine geschlagene Armee wiederherstellen konnte. Nein, Robert verstand den Kommandanten nicht, wahrscheinlich eignete er sich wirklich nicht zum Offizier.
Noch kamen sie allein, aber in zwei Stunden brachten sie vielleicht einen Major mit oder einen Stabskapitän, den Hornisten, den Regimentsfeldscher oder auch nur einen Pferdehalter oder Trosskutscher — aus der Traum, Herr Leutnant. Da musste schon der Teufel den Becher umgestülpt haben, wenn sich in dem zusammengewürfelten Haufen Soldaten nur zwei Königin-Dragoner finden sollten.
Sie konnten auch dem Leutnant von Tümpling den Weg zum Berreschen Hause weisen. Diesmal würde der Herr Kamerad den Verletzten genauer ansehen. Damals war Tümpling in seiner Freude, endlich einen überlebenden Offizier des eigenen Regiments zu treffen, wie ein junges Fohlen über den Markt gesprungen, an den Bauernwagen herangetreten, dann aber erschrocken zurückgefahren. »Dich haben sie aber zugerichtet, Kamerad. Dennoch, Glück gehabt! Regiment vollständig unter die Hufe geraten. Kaum einer davongekommen. Ruhmesbanner von Hohenfriedberg in den Kot gestampft.« Und als ihm die Unteroffiziere in ihrer hilfreichen Einfalt erklärten, dass der Herr Leutnant nicht ganz beieinander sei, hatten da nicht seine Mundwinkel so merkwürdig gezuckt? Grub nicht ein erster Verdacht seine Falten in die sonst so glatte Stirn?
Er hatte die beiden angestarrt, sein Blick war trüb wie der Oktobertag, und sich nicht länger mit Schill aufgehalten, aber er sorgte dafür, dass der Chirurgus, der vor der Pfarrkirche einen behelfsmäßigen Verbandsplatz eingerichtet hatte, den Kameraden außer der Reihe annahm.
Der Chirurg sagte: »Glück gehabt, der Herr Leutnant. Glatter Durchschuss!« Er flößte Schill einen Löffel bitteren Branntwein ein, beschnitt die Wundränder, und während er das Messer an einer Ziegelkante neu schärfte, befahl er seiner Helferin, die vor jedem Handgriff die Fingerspitzen aneinanderlegte und zum wolkenverhangenen Himmel aufblickte, die Wunde mit einem Brei aus in saurer Milch geweichtem Schwarzbrot zu bestreichen.
Tümpling hatte auch einen Wagen beschafft, wieder eine rumpelnde Bauernkarre, mit einem halb blinden Gaul bespannt, der den Verletzten und seine Begleiter nach Nordhausen brachte. Er hatte den Unteroffizieren eingeschärft, den Herrn Leutnant sorgsam zu behüten, damit Seiner Majestät der Stamm des ruhmreichen Regiments erhalten bleibe, das dem Großen Friedrich die Schlacht von Hohenfriedberg gewonnen habe. Anders gesagt, sie sollten ihn nicht aus den Augen lassen, bis er sich entlarvte. Das erklärte ihre aufdringliche Treue, die nichts mit Anhänglichkeit ans Regiment oder ähnlichen Gefühlen zu tun hatte. Altgediente Unteroffiziere träumten nur davon, ihre Jahre heil an Leib und Leben zu überstehen, damit man sie nicht ins Invalidenhaus steckte, sondern sie mit einer angemessenen Versorgung aus dem Regiment entließ, als Waldhüter, Flurwächter, Chausseewärter oder auch, wie Roberts Vater, als Schulmeister. Sein Vater hatte Glück gehabt; er hatte vielleicht dem Regimentschef besondere Dienste geleistet, jedenfalls schickte man ihn nicht auf ein abgelegenes Dorf, das man bei Landregen nur in Fischerstiefeln erreichen konnte, vielmehr gab man ihm eine Küsterstelle in dem Städtchen Bahn, knappe drei Meilen rechts der Oder. Die Bezeichnung Stadt war nur insofern gerechtfertigt, als die Bürger Mauer und Wall um die Wohnstätten gezogen hatten, zweimal im Jahr Markt hielten und keinem Gutsherrn fronen mussten. Sonst lebten sie wie die Bauern vom Ertrag ihrer Äcker und Wiesen; selbst die Kaufleute und Handwerker bauten Kohl und neuerdings Kartoffeln, hielten zwei, drei Schweine im Stall und eine Kuh oder wenigstens eine Ziege, damit die Kinder auch in Notzeiten die Milch nicht entbehren mussten.
Jetzt aufspringen, den Fuß über die Schwelle setzen und hinaustreten auf die Gasse! Durch eine Mauerpforte schleichen und ohne Bündel auf dem Rücken, ohne jegliche Last, bei Sonne und Wind, Regen und Nebel fernab der ausgefahrenen Straßen über schmale Feldwege wandern, Trampelpfade durch nasse Wiesen, an den morastigen Ufern träger Bäche von Bülte zu Bülte hüpfen, durch die lichten, kahlen Herbstwälder pilgern, über vom Sturm gefällte Stämme steigen, Eichenblätter von den Zweigen rupfen ... Allein der Gedanke machte schwindlig.
Wusste er die Wirtin außer Haus, probierte er einige Schritte. Wenn er lag, schmerzte die Wunde kaum noch, und der straffe weiße Verband verlieh ihm das Gefühl der Sicherheit. Wenn er aufstand, stieg ihm das Blut in den Kopf, klopfte und pochte und ließ ihn taumeln; die Beine hingegen wurden spröde wie Eis; er brauchte nur irgendwo anzustoßen, und sie zersprangen klirrend. Einmal kam Madame zu früh zurück, fing den Erschrockenen auf, schob ihn zum Lager und drückte ihn sanft in die Kissen. Sie schalt heftig, französisch, und es hörte sich an wie zärtliches Gurren.
Das tat sie öfter und offensichtlich gern. Ihn überkam eine Heidenangst, wenn sie unter die Decke griff und das Laken glatt strich. Solange er ein gewöhnlicher Schneidergeselle war, hatte er keine Angst vor Frauen gekannt. Das brachte der Beruf mit sich. Manch eine Kundin ließ sich lieber vom Lehrjungen oder Gesellen die Maße nehmen als vom Meister. Jetzt aber war er Leutnant und adlig. Musste da nicht alles anders sein, auch das einfachste Ding? Eigentlich wusste er selbst nicht mehr sicher, wer er war, und das machte ihn bange.
Wie hatte es ihn nur nach Magdeburg verschlagen und ausgerechnet in dieses Haus! War das auch Tümplings Werk? Der hatte befohlen, den so ehrenvoll Verwundeten keinesfalls in ein Lazarett zu bringen, dort werde zuviel gestorben. Das stolze Regiment könne es nicht zulassen, dass auch nur der Geringste seiner Offiziere in einem Massengrab verfaule.
So stützten Thessen und Franz jeden seiner Schritte und hüteten ihn wie der Hund die Herde. Den Bauern, der sie nach Nordhausen brachte, bezahlten sie mit dem Geld, das sie in seinen Taschen fanden. Dabei nahmen sie auch die Papiere heraus. Einer der Briefe trug eine Frauenhandschrift. Robert biss sich auf die Zunge und presste die Fingernägel in die Handballen, um die Blätter nicht an sich zu reißen.
Franz steckte die Briefschaften zurück, doch Robert fand keine Gelegenheit, sie anzusehen, immer fühlte er sich beobachtet. Um sich nicht unversehens zu verraten, fand er auch nach und nach seinen Verstand wieder, sein Gedächtnis jedoch nicht. Fragte jemand nach Vergangenem, nach Menschen, denen Schill begegnet war, lächelte er stumm und dumm wie ein Fisch. Die Vergangenheit war ihm zerronnen mit dem Blute seiner Wunden.
Für den Augenblick war er froh, die beiden bei sich zu haben. Obwohl die Neuigkeiten, die Thessen mitbrachte, ihn so beunruhigten, dass selbst die fast verheilten Schürfwunden im Gesicht brannten, als wäre er koppheister in einen Nesselbusch gefallen.
Die Franzosen marschierten auf Magdeburg. Der Kommandant, ein ergrauter General, der seinen späten Ehrgeiz darin sah, dass das Lederzeug der ihm unterstellten Offiziere blinkender glänzte als das der königlichen Garde, habe sich angesichts der Verantwortung, die seine Schultern drückte, so sagte man ganz offen, nicht etwa hinter vorgehaltener Hand, einen Hexenschuss zugezogen. Er liege zu Bett, lasse sich heiße Kastanienbeutel auflegen und könne nicht kommandieren; füglich werde er die wohlbestückte und wohlbesetzte Festung kampflos übergeben. Er wisse sich darin auch eins mit den maßgeblichen Bürgern, die den Himmel anflehten, sie vor Beschießung, Brand und Plünderung zu verschonen. Auch der Soldaten, insbesondere der Offiziere, dabei senkte er die Stimme, als schämte er sich, so von Vorgesetzten zu sprechen, habe sich eine tiefe Verzagtheit bemächtigt. Die Besseren beteten, der König möge Frieden schließen, bevor der Feind seine Bataillone auf dem Glacis aufstelle; die Mehrzahl aber dämmere in dumpfer Ergebenheit dahin, sie sei wohl auch bereit, dem erstbesten französischen Sergeanten die Hemdennähte nach Läusen abzusuchen, wenn er sie nur vor Pulverqualm und Säbelgeklirr bewahrte. Worte wie König, Vaterland, Ehre kenne man in dieser Stadt nicht mehr.
Robert hörte mit Erstaunen den sich steigernden Grimm in der Stimme. Eine solche Betroffenheit hatte er dem poltrigen Kerl nicht zugetraut. Da gab es in Preußen wahrhaftig Menschen, die dieses Land liebten, Erde, die ihnen nicht gehörte, denn wenn davon auch nur eine Fußbreite Thessens gutes Eigen war, brauchte er nicht sein Leben lang die Beine in die Gamaschen und die Haare in das Zopfband zu zwängen.
Warum liebten Leute wie Thessen und Franz dieses Land? Nur weil sie in seinen Grenzen geboren wurden, aufwuchsen, die erste Ohrfeige bekamen und vielleicht den ersten Kuss? Kennen sie es denn? Sie sind immer in Kolonne marschiert, im gleichen Schritt und Tritt, Seitenrichtung, Vordermann. Marschierend sieht man nichts von der Schönheit einer Landschaft; wie kann man sie lieben? Ehre? Ein Gefühl, das die Kriegskasse zum Leutnantssalär zählt. Der König? Knappen Sold, schmale Kost, enge Montur, mehr hatte er nicht für sie. Doch! Sie, die man einst geprügelt und kommandiert hatte, durften nun, Unteroffiziere, selber kommandieren und prügeln. Dafür liebten sie ihn? Sonderbare Wesen sind die Menschen.
Sicher gingen ihm diese Gedanken erst später durch den Kopf, nachher, als er mit sich allein war, oder nachts, wenn ihn nicht einmal Madame stören konnte. Im Augenblick gab es anderes zu bedenken. Übergabe, das bedeutete Gefangenschaft, aber warum sollte er tragen, was dem Leutnant Schill gebührte? Er hatte die Hand nicht erhoben gegen die Franzosen.
»Und ihr?«
»Etliche Offiziere und auch Gemeine wollen sich zu den Unseren durchschlagen. Einmal muss doch der König seine Truppen zum Stehen bringen, an der Oder, der Weichsel oder an der russischen Grenze.«
Sollten sie nur gehen, endlich! Er wollte Madame bitten, ihm andere Kleider zu beschaffen, dann war er nicht mehr der Leutnant Schill. Notfalls zeugten Nadel und Faden für ihn. Kein Adelsherr, kein Offizier konnte damit umgehen. Madame half ihm bestimmt, wenn er sie dafür in der ihr genehmen Münze bezahlte.
»Wann reitet ihr?«
»Wir können Herrn Leutnant doch nicht im Stich lassen.«
Tümplings Befehl. Er hatte es fast befürchtet. »Keine Rücksicht auf mich, Leute. Man trennt uns ohnehin. Bei Kapitulation stecken die Franzosen mich ins Lazarett und euch, die ihr gesund seid ...«
»Auf die Galeere«, murmelte Franz und erbleichte.
»Ja, wenn wir Herrn Leutnant mitnehmen könnten?«
Davonreiten? Gar kein so übler Gedanke. Er fühlte sich kräftig genug für den Sattel. Vor den Franzosen bis an die mecklenburgische Grenze ausweichen, an einer Wegbiegung wie zufällig zurückbleiben, ein kurzer Galopp links ab, volle Karriere querfeldein, und ade, Herr von Schill! Mecklenburg war doch wohl neutral, wie? Mochten die beiden ihrem Herrn von Tümpling erzählen, ein Sumpfloch ..., die Franzosen ..., weiß der Teufel, ihre Sache! Er war so gut wie sicher, dass er in der Gefangenschaft Offizieren begegnete, die Schill gekannt hatten. Er konnte auch den ' Chasseurs in die Hände fallen, denen er entronnen war, die Leutnantsmontur wäre der Beweis, dass er ein Spion war. Darauf wollte er es nicht ankommen lassen.
»Erkunden Sie die Lage! Und beschaffen Sie Pferde. Bis spätestens morgen Mittag Meldung.« Es gelang ihm, seine Stimme militärisch hart klingen zu lassen. So sprach Vater, wenn er den Schülern, ja auch wenn er den eigenen Kindern etwas befahl. Selbst mit der Mutter redete er in diesem Ton.
»Pferde? - Haben Herr Leutnant denn Geld?«
»Potzdonnerwetter, seid ihr Kavalleristen oder Fettviehhändler? Werdet doch wohl drei Gäule requirieren können.«
»Zu Befehl, drei Gäule requirieren!« Thessen stieß seinen etwas verwirrten Kameraden in die Seite. »Komm schon, Alter!«
Die Gewissheit, bald wieder er selbst zu sein, ein freier Mann, der nicht die Sätze wie die Pfennige dreimal umdrehen musste, bevor er sie ausgab, der sich den Teufel um die Unteroffiziere samt ihrem Leutnant Tümpling scherte, ließ Robert neue Kräfte zuwachsen. Das vom langen Liegen träge Blut floss wieder schneller durch die Adern, die Muskeln spannten sich, als wollten sie den strammgewickelten Verband sprengen; selbst die Barthaare schienen sich stolz zu recken. So setzte er sich denn auf im Bett. Als er die linke Schulter hochschob, dabei stützte er sich mit der rechten Hand ab, stach es in der Wunde, aber nur als würde eine Stopfnadel kurz hineingestoßen und gleich wieder zurückgezogen. Das Zirpen und Summen in den Ohren verklang wie das Sprudeln eines Bächleins, das sich auf einer Waldwiese verströmt.
An einem Nagel an der Wand neben der Tür hing Schills Rock. In der linken Tasche steckte der Brief. Er hatte ihn noch immer nicht gelesen. Fürchtete er, ganz in diesem Leutnant von Schill aufzugehen, wenn er sich dessen heiligste Geheimnisse zu eigen machte, oder hielt ihn nur die Angst zurück, Madame könnte ihn überraschen? Jetzt wollte er es tun, gewissermaßen zum Abschied. Schill kratzte es nicht mehr, das Mädchen erfuhr es nicht, und er selbst wurde nur klüger davon; schließlich ist es jedermanns gutes Recht, über sich selbst Bescheid zu wissen.
Schon trabten seine Träume seinem Gaul voraus, nordostwärts, durch das Havelland, den Barnim, die Uckermark, das Welsebruch — halt, nicht nach Pommern hinein! Man kannte Schill in Gartz, man kannte auch ihn. Und das Mädchen? Zum Teufel, er saß noch nicht im Sattel und trabte schon.
Er schlug das Federbett zurück, das leicht und locker war, als hätte Madame das beste Stück ihrer Aussteuer für den Pflegling herausgesucht, stellte die Füße auf den Boden und stemmte sich mit dem gesunden Arm hoch, bis er stand, etwas weich in den Knien noch, aber er stand.