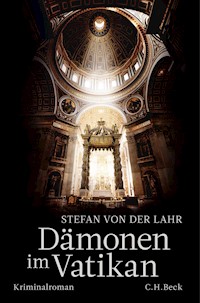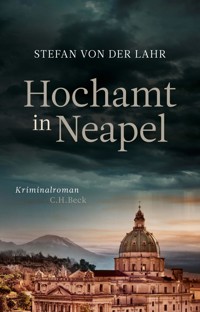14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Rom könnte in diesem Frühjahr so schön sein – sonnig, turbulent, sogar inspiriert vom Geist des herannahenden Konzils. Doch leider haben Wissenschaftler, Bibliothekare der Vatikanischen Bibliothek, die Hohe Geistlichkeit, Polizei und Mafia von einem einzigartigen Papyrus aus der Frühzeit des Christentums erfahren. Sein Besitz verheißt Ruhm und Reichtum, stellt aber zugleich fundamentale Glaubenssätze in Frage.
Zunächst sind alle Beteiligten bemüht, sich das wertvolle Schriftstück unauffällig zu beschaffen. Dann aber kommt es zu einem Zwischenfall, der jeden Versuch, die Angelegenheit diskret zu lösen, Makulatur werden lässt - der geheimnisvolle Papyrus verschwindet. Als Commissario Bariello von der römischen Polizei und Monsignor Montebello aus der Vatikanischen Bibliothek gemeinsam versuchen, das jahrtausendealte Dokument wieder aufzutreiben, entbrennt eine mörderische Konkurrenz um das Wissen, das der Papyrus birgt. Aber in dem ausbrechenden Chaos scheint es jemanden zu geben, der alle Fäden in der Hand hält und weder Tod noch Teufel scheut …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Stefan von der Lahr
Das Grab der Jungfrau
Kriminalroman
C.H.Beck
Zum Buch
Rom könnte in diesem Frühjahr so schön sein – sonnig, turbulent, sogar inspiriert vom Geist des herannahenden Konzils. Doch leider haben Wissenschaftler, Bibliothekare der Vatikanischen Bibliothek, die Hohe Geistlichkeit, Polizei und Mafia von einem einzigartigen Papyrus aus der Frühzeit des Christentums erfahren. Sein Besitz verheißt Ruhm und Reichtum, stellt aber zugleich fundamentale Glaubenssätze in Frage.
Zunächst sind alle Beteiligten bemüht, sich das wertvolle Schriftstück unauffällig zu beschaffen. Dann aber kommt es zu einem Zwischenfall, der jeden Versuch, die Angelegenheit diskret zu lösen, Makulatur werden lässt – der geheimnisvolle Papyrus verschwindet. Als Commissario Bariello von der römischen Polizei und Monsignore Montebello aus der vatikanischen Bibliothek gemeinsam versuchen, das Jahrtausende alte Dokument wieder aufzutreiben, entbrennt eine mörderische Konkurrenz um das Wissen, das der Papyrus birgt. Aber in dem ausbrechenden Chaos scheint es jemanden zu geben, der alle Fäden in der Hand hält und weder Tod noch Teufel scheut …
Über den Autor
Stefan von der Lahr
ist promovierter Altertumswissenschaftler und arbeitet seit über fünfundzwanzig Jahren als Lektor im Verlag C.H.Beck. Dort ist auch sein Kriminalroman «Hochamt in Neapel» (32019) erschienen.
Inhalt
Prolog
Kapitel 1 – Der Besucher
Kapitel 2 – Der Bibliothekar
Kapitel 3 – Die Audienz
Kapitel 4 – Der Brief
Kapitel 5 – Das Privileg
Kapitel 6 – Der Kardinal
Kapitel 7 – Die Bibliothek
Kapitel 8 – Die Abschrift
Kapitel 9 – Das Institut
Kapitel 10 – Der Inspektor
Kapitel 11 – Das Komplott
Kapitel 12 – Das Duell
Kapitel 13 – Der Kommissar
Kapitel 14 – Der Tiber
Kapitel 15 – Die Familie
Kapitel 16 – Der Schatz
Kapitel 17 – Die Durchsuchung
Kapitel 18 – Der Verbündete
Kapitel 19 – Der Verräter
Kapitel 20 – Der Fromme
Kapitel 21 – Der Don
Kapitel 22 – Die Fahndung
Kapitel 23 – Der Orden
Kapitel 24 – Der Aufschub
Kapitel 25 – Die Rache
Kapitel 26 – Der Untergang
Kapitel 27 – Die Bibel
Kapitel 28 – Die Zuflucht
Kapitel 29 – Der Plan
Kapitel 30 – Die Pilger
Kapitel 31 – Die Toten
Kapitel 32 – Die Ratten
Kapitel 33 – Der Held
Kapitel 34 – Das Grab
Kapitel 35 – Der Inquisitor
Kapitel 36 – Die Inschrift
Epilog
Anhang
Übersetzung italienischer Textstellen
Übersetzung der englischen Passage auf S. 149–150
Lektürehinweise
Hauptakteure und Mitstreiter
Erläuterungen zu historischen Sachverhalten und Akteuren
Dank
Für Angelika
Die meisten fremdsprachigen Formulierungen und Spezialbegriffe sind im Anhang übersetzt und erklärt. Ebenso finden sich dort Erläuterungen zu einigen historischen Akteuren und Ereignissen.
Prolog
Die Weisheit hat ihr Haus gebaut, ihre sieben Säulen behauen.Sie hat ihr Vieh geschlachtet, ihren Wein gemischt und schon ihren Tisch gedeckt. Sie hat ihre Mägde ausgesandt und lädt ein auf der Höhe der Stadtburg.
SPRÜCHE 9,1–3
KONZIL schallte es von jeder Kanzel. KONZIL beherrschte die Schlagzeilen der Weltpresse. KONZIL lief über elektronische Laufbänder an Bahnhöfen und Flughäfen. Und in den Suchmaschinen des World Wide Web wurde KONZIL nur noch von SEX übertroffen. Doch niemand ging liebevoller mit dem Wort KONZIL um als die römischen Konditoren, die es in Zuckerguss auf ihre Torten schrieben – stets bekrönt von einem segnenden papa nero, dessen Schokoladenkopf und -hände sich kräftig von seinem Marzipangewand abhoben.
Unter dem Vorsitz von Papst Laurentius – dem ersten Nachfolger Petri aus Afrika seit fünfzehnhundert Jahren – sollten auf dem Dritten Vatikanischen Konzil jene Fragen beraten werden, die den Katholiken in aller Welt auf den Nägeln brannten: das Verhältnis des Klerus zu Armut und Reichtum, zur Stellung der Frauen in der Kirche, zu Homosexualität, Zölibat, Kindesmissbrauch durch Geistliche, Ökumene und nicht zuletzt zur Neuorganisation der höchsten Kirchenverwaltung, der römischen Kurie. Diese Agenda hatte für erhebliche Unruhe unter jenen Würdenträgern im Vatikan gesorgt, die um das theologische Erbe der Kirche und mehr noch um die eigene Macht bangten. Doch all ihre Versuche, darauf Einfluss zu nehmen oder wenigstens den Beginn des Konzils hinauszuschieben, waren erfolglos geblieben.
So hatte der Heilige Vater in der Christmette des letzten Weihnachtsfestes den über tausend Jahre alten Hymnus Ave praeclara maris stella angestimmt und dann die Himmlische Gottesmutter als Schutzpatronin des bevorstehenden Konzils angerufen. Seine Predigt in der Heiligen Nacht aber hatte er mit der Ankündigung der Konzilseröffnung für das Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel, den 15. August, geschlossen.
Noch vor dem Neujahrstag waren die ersten Abgesandten der Kardinäle, Erzbischöfe, Bischöfe, Weihbischöfe, Ordensvorsteher, Äbte und Priores in Rom eingetroffen, die an dem Konzil teilnehmen sollten. Gleichzeitig mit den Sekretären, Beratern und Quartiermachern der Geistlichkeit brach ein Heer von Sicherheitsbeamten aus ganz Italien, verstärkt durch Spezialisten internationaler Geheimdienste, in die Heilige Stadt auf, um einen ungestörten Ablauf des Konzils zu garantieren. Entsprechend groß war das Interesse der Medien, deren Vertreter mit ihrem Tross folgten und sich akkreditieren ließen. Dann kamen die Reiseveranstalter, um die Voraussetzungen für einen lukrativen Konzilstourismus zu schaffen. All dies entfaltete wiederum eine magische Anziehungskraft auf Geschäftemacher, Prostituierte und Kriminelle, die zu Tausenden in die Petrus-Stadt strömten. Und so fieberte Rom der größten Versammlung seiner Geschichte entgegen.
Kapitel 1 – Der Besucher
Das erste warme Frühlingswochenende hatte auch die hartgesottensten Wissenschaftler der Universität Berkeley nach San Francisco Downtown oder ans Meer gelockt. Auf dem sonst so lebendigen Campus war es still geworden. Das tagsüber in leuchtendem Weiß erstrahlende Gebäude der Bancroft Library lag im Dunkeln. Nur oben, im Center for the Tebtunis Papyri, brannte noch Licht. Dort genoss Professor Cyrill Knightley – mit seinen fünfundsiebzig Jahren der Nestor der amerikanischen Papyrologie – einen der seltenen Momente der Ruhe in seinem Institut. Er hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, samstagabends, wenn alle Mitarbeiter längst das Haus verlassen hatten, noch einmal die Handschriftenfragmente durchzusehen, die im Laufe einer Woche aus dem Labor gekommen waren. So bemerkte er nicht, wie die Tür zu seinem Arbeitszimmer sacht geöffnet und, nachdem ein kleiner Leinensack hineingeschoben worden war, wieder geschlossen wurde. Es dauerte nicht lange, bis Bewegung in den Beutel kam. Im nächsten Augenblick schob sich der Kopf einer Texas-Klapperschlange aus der Öffnung, und gleich darauf folgte ihr graugelber Körper. Auf dem warmen Parkett rollte sich das Reptil behaglich zusammen, und nur ab und zu, wenn es seine Lage etwas veränderte, war das leise Scheuern seiner Schuppen zu vernehmen – viel zu leise, um die Konzentration des alten Gelehrten zu stören. Knightley setzte die Brille ab und massierte seine Nasenwurzel. Energisch schob er den Bürostuhl zurück, der ein kurzes Stück über den Boden rollte. Im selben Moment ließ die Schlange die Hornrassel an ihrem Schwanzende klirren. Der Wissenschaftler fuhr herum, und mit einem Schrei sprang er auf. Die Schlange kroch auf ihn zu. Ohne sie aus den Augen zu lassen, wich der Mann vor ihr zurück. Aber es gelang ihm nicht, den Abstand zwischen sich und dem Reptil zu vergrößern. Mit zwei, drei hastigen Schritten versuchte er, die Tür zu erreichen – doch irgendjemand hatte sie abgeschlossen. Mit seinen Fäusten hämmerte er gegen das Holz. Der Körper der Schlange spannte sich wie eine Uhrfeder.
«NEIN! HILFE!»
In diesem Augenblick stieß sie zu – und Cyrill Knightley starb, noch bevor sein massiger Körper auf dem Boden aufschlug. Die Schlange aber hatte nicht einmal die Haut ihres Opfers geritzt. Man hatte ihr die Giftzähne herausgebrochen. Nach und nach verklang das Rasseln ihrer Hornklappern. Bald darauf öffnete sich wieder die Tür, bis sie an den Leichnam stieß und dann mit sanfter Gewalt aufgeschoben wurde. Eine schlanke Gestalt stieg über den Toten hinweg. Feingliedrige Hände in langen Handschuhen packten die Klapperschlange im Genick und schoben sie wieder in den Leinenbeutel.
Am Montag betrat Sarah Milling als Erste das Center, wo sie als Hilfskraft arbeitete und die Morgenstunden nutzte, um an ihrer Dissertation zu schreiben. Im Flur empfing sie ein muffiger Geruch. Wahrscheinlich hatte übers Wochenende wieder niemand gelüftet! Dann sah sie, dass durch einen Türspalt zum Büro des Direktors ein Lichtstreifen in den Gang fiel. Wie alle im Institut mochte sie Cyrill Knightley und freute sich darauf, für ein paar Minuten ganz allein mit ihm plaudern zu können.
«Guten Morgen, Professor! Schon fleißig?»
Schwungvoll öffnete sie die Tür. – Ihr Schrei war noch im Erdgeschoss zu hören. In der Wärme war die Leiche aufgedunsen, und aus dem entstellten Gesicht starrten die junge Frau zwei weit aufgerissene Augen an. Sarah stürzte zum Ausgang. Im letzten Moment bog sie ins Sekretariat ab, wo ein Telefon stand.
Zehn Minuten später standen zwei Streifenwagen vor der Bibliothek, und kurz darauf traf Detective Frank Cunningham ein. Nach und nach erschienen auch die Angestellten des Centers. Die heitere Gelassenheit, die üblicherweise den Alltag im Hause bestimmte, war bald Bestürzung und Trauer gewichen. Nachdem Cunningham sich am Fundort des Toten umgesehen hatte, trat er vor die Tür des Instituts. Dort lief ihm eine in Tränen aufgelöste ältere Dame in die Arme. Sie versuchte vergeblich, zum Büro von Cyrill Knightley vorgelassen zu werden, doch ein Polizist verweigerte ihr den Zutritt, solange die Spurensicherung ihre Arbeit noch nicht erledigt hatte.
«Das musste ja so kommen! Ich habe ihm hundertmal gesagt, er soll abends nicht allein im Institut arbeiten!»
«Verzeihen Sie, Ma’am – Detective Cunningham, Berkeley Police Department. Ich leite hier die Untersuchung. Sie kannten Professor Knightley?»
Auch durch den Schleier ihrer Tränen konnte der Polizist den Zorn in den Augen seines Gegenübers aufblitzen sehen.
«Natürlich kannte ich ihn! Ich bin Mathilda Brown und war siebenundzwanzig Jahre Cyrills Sekretärin.»
«Verstehe. Wie meinten Sie das eben? ‹Das musste ja so kommen!›»
«Der Professor war krank. Wenn ich ihm Vorhaltungen gemacht habe, dass er mit seinem schwachen Herzen nicht allein bleiben dürfe, hat er mich nur ausgelacht. Er hat gesagt, dass er sich bei der Arbeit am besten entspannen kann und ihm deshalb hier am wenigsten passieren wird. Und jetzt …»
Der Rest ihrer Worte ging in Schluchzen unter. Cunningham wandte sich an den Polizeiarzt, der in diesem Moment den Leichenträgern die Tür öffnete.
«Was meinen Sie, Doktor?»
«Bin ziemlich sicher, dass der Mann an Herzversagen gestorben ist. Keine äußeren Verletzungen – zumindest keine, die ich hier feststellen kann. Ich kann schon jetzt sagen, dass er seit mehr als vierundzwanzig Stunden tot ist. Würde mich wundern, wenn er mit seinem Übergewicht nicht bei irgendeinem Hausarzt eine Krankenakte hätte. Mit dem sollten Sie sich in Verbindung setzen.»
«Eine andere Ursache kommt nicht in Frage? Sein Gesicht ist entstellt, als ob er … irgendetwas Schreckliches gesehen hätte.»
«Muss nicht sein. Der Vernichtungsschmerz bei einem Herzinfarkt würde den Gesichtsausdruck ohne weiteres erklären. Heute Abend bekommen Sie meinen Bericht, Detective.»
In diesem Moment stürmte ein elegant gekleideter Mittvierziger die Treppe hinauf.
«Ich habe unten gehört, was geschehen ist. Ist es wahr? Ist Cyrill wirklich …?»
Cunningham reichte dem Arzt die Hand.
«Gut, ich warte. Vielen Dank, Doktor!»
Dann wandte er sich an den großgewachsenen Mann.
«Wer sind Sie?»
«Bill Oakbridge, Stellvertretender Direktor des Centers.»
«Detective Cunningham. Können wir uns hier irgendwo ungestört unterhalten, Mr Oakbridge?»
«Bitte, kommen Sie!»
Cunningham wandte sich an einen Streifenbeamten.
«Officer! Wenn Sie hier fertig sind, versiegeln Sie den Eingang! Bis die Spurensicherung durch ist und ich den Bericht des Doktors habe, darf niemand rein.»
Dann folgte Cunningham dem Stellvertretenden Direktor zu den Konferenzräumen einen Stock höher.
«Bitte nehmen Sie Platz, Detective!»
«Danke! Sind Sie auch Professor?»
«Ja, aber Titel haben in diesem Haus nie eine Rolle gespielt. … Verzeihen Sie bitte, aber ich … ich bin völlig fassungslos.»
«Wie lange kannten Sie Professor Knightley?»
«Über zwanzig Jahre. Ich habe bei ihm studiert. Nach einem Forschungsaufenthalt in Oxford und Rom bin ich in Berkeley Professor geworden und schließlich Stellvertretender Direktor und Cyrills rechte Hand.»
«Was forschen Sie hier?»
Bill Oakbridge schaute sein Gegenüber verdutzt an.
«Entschuldigen Sie, Detective! Wenn man so lange in diesem Institut arbeitet wie ich, kann man sich kaum noch vorstellen, dass jemand nicht weiß, was wir hier machen … Die Bancroft Library beherbergt eine ganze Reihe von Forschungsbibliotheken. Unter anderem finden Sie hier über 30.000 antike Handschriften auf Papyrus. Sie kommen alle aus Ägypten, aus einer Stadt namens Tebtunis in der Landschaft Faijum.»
Oakbridge deutete mit einer Hand hinter sich, wo an der Wand eine große Landkarte hing, die einen Teil des Alten Ägypten zeigte. Ein Fähnchen markierte den Ort.
«Diese Papyri sind über 2000 Jahre alt. Am Ende des zweiten und zu Beginn des ersten Jahrhunderts vor Christus hat man in Tebtunis solche Papyri zu einer Art Pappmaschee verarbeitet und damit Krokodilmumien hergestellt. Es muss damals in kurzer Zeit so viele tote Krokodile gegeben haben, dass man nicht genügend Leinwand hatte, aus der man üblicherweise die Mumien gefertigt hat. Dass man stattdessen Papyri genommen hat, erweist sich heute als wahrer Segen. Die auf diese Weise erhaltenen Texte sind zwar überwiegend Verwaltungsschreiben, private Dokumente, Vorschriften von Priesterbruderschaften – also ganz alltäglich, wenn Sie so wollen –, aber gerade deshalb bilden sie für uns eine besonders interessante Quelle zur ägyptischen Geschichte. Wir präparieren die Papyri, werten sie aus und gliedern sie in die Bestände der Bancroft Library ein. Dass das überhaupt möglich ist, verdanken wir den britischen Papyrologen Grenfell und Hunt, die im Winter des Jahres 1899/1900 in einer Nekropole, einem Friedhof südlich von Tebtunis, diese Krokodilmumien gefunden haben. Dort befand sich eines der wichtigsten Heiligtümer des ägyptischen Krokodilgottes Sobek, der Tempel des Soknebtynis – Sobeks, des Herrn von Tebtunis.»
«Klingt interessant, aber nicht so aufregend, dass man daran sterben müsste.»
«Sicher nicht – auch wenn für uns natürlich vieles sehr spannend ist, was wir aus diesen Papyri erfahren. Aber Cyrills Tod hat wohl andere Ursachen. Vor acht Jahren hatte er einen schweren Herzinfarkt. Er war nicht gerade schlank. Sie haben ihn ja gesehen. Er aß zu viel, trank gern und nicht zu knapp kalifornischen Rotwein und rauchte dazu seine geliebten Havannas, die der Arzt ihm strikt verboten hatte. Er bewegte sich eigentlich nur von seiner Wohnung zum Auto, vom Auto zum Lift und dann hierher in sein Büro und wieder zurück.»
«Hatte Professor Knightley Feinde?»
«Er war weltweit ein ebenso geschätzter wie beliebter Kollege.»
«Hatte er Familie?»
«Er war nicht verheiratet, wenn Sie das meinen. Aber er hatte eine Haushälterin. Und ich glaube, er erwähnte mal einen Neffen in Seattle. Aber Cyrills eigentliche Familie waren die Menschen in diesem Institut.»
«Wer wird jetzt hier sein Nachfolger?»
«Es ist zwar jetzt nicht der passende Moment. Aber … ja, ich vermute, dass ich das sein werde.»
«Hm. Das genügt fürs Erste. Falls sich noch Fragen ergeben sollten, dann …»
«Selbstverständlich, Detective. Ich stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wann können wir das Institut wieder betreten?»
«Vermutlich morgen Nachmittag. Ich rufe Sie dann an.»
Cunningham ließ sich noch von Mrs Brown die Adresse des Hausarztes von Cyrill Knightley geben, der ihm bei einem Besuch bestätigte, was der Polizeiarzt vermutet hatte: ein vorgeschädigtes Herz, Durchblutungsstörungen und eine massive Herzinsuffizienz. Die Obduktion ergab, dass der Tod als Folge eines schweren Infarkts am späten Samstagabend oder frühen Sonntagmorgen eingetreten war. Am Körper des Toten waren keine Verletzungen festzustellen. Auch die Spurensicherung entdeckte nichts Auffälliges, außer einigen sehr feinen Sandkörnern auf dem Boden des Büros, die jedoch auch nur deshalb auffielen, weil der Raum noch am Freitagabend vom Reinigungsdienst gewischt worden war. Zwar passten sie nicht recht ins Bild, boten aber keine ausreichende Grundlage für weitere Ermittlungen. So gab das Berkeley Police Department den Leichnam noch am Montagabend zur Bestattung frei, die der Neffe aus Seattle als nächster Angehöriger umgehend in die Wege leitete. Und als am Mittwochnachmittag zahlreiche Kollegen Cyrill Knightley das letzte Geleit gaben, hatte man seine schmale Untersuchungsakte mit dem Vermerk «Tod durch Herzversagen» bereits geschlossen.
Der Zugang zum Center war am Dienstagmorgen zwar wieder freigegeben worden, doch sollte das Institut in dieser Woche nicht zur Ruhe kommen: Als besonderer Frevel wurde empfunden, dass zur Zeit der Trauerfeier jemand die Tür zum Arbeitszimmer des Stellvertretenden Direktors aufgebrochen und dort 50 Dollar und einen goldenen Kugelschreiber gestohlen hatte. Detective Cunningham war durch den Bericht des diensthabenden Kollegen auf den Vorgang aufmerksam geworden und hatte mit ihm gesprochen. Zwar gab es genug Fingerabdrücke in Oakbridges Büro, doch da es bis auf die Nachtstunden nie abgeschlossen war und jedermann zu jeder Zeit Zugang zu den Direktoren und ihren Handbibliotheken hatte, waren diese Spuren wertlos. Bill Oakbridge hatte die Vermutung geäußert, dass es einer der Junkies gewesen sein könnte, die sich an der nahe gelegenen Bushaltestelle herumtrieben. Dort war es schon öfter zu Diebstählen, einmal sogar zu einem Raubüberfall gekommen. Jedenfalls fanden sich keinerlei Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen dem Tod von Professor Knightley und dem Einbruch bei Professor Oakbridge.
Am Donnerstagvormittag fand eine Sitzung des obersten Verwaltungsgremiums der Universität statt, auf der man beschloss, Oakbridge zu bitten, bis auf weiteres die Leitung des Instituts zu übernehmen. Er erklärte sich dazu bereit, bat jedoch um Verständnis dafür, dass er noch in derselben Nacht für etwa vierzehn Tage nach Rom aufbrechen müsse – eine unaufschiebbare Reise, die er bereits mit dem Verstorbenen abgestimmt habe.
Kapitel 2 – Der Bibliothekar
Der Heilige Vater beugte sich über den Mann, der vor ihm kniete und seinen Ring küsste.
«Erhebt Euch, Gian Carlo Montebello. Ich habe Euch in Eurer Zeit in Rom als ebenso frommen wie klugen Arbeiter im Weinberg unseres Herrn kennengelernt und möchte Euch bitten, den vakanten Sitz des Erzbischofs von Neapel einzunehmen.»
Monsignor Gian Carlo Montebello, Kirchenhistoriker und seit fast zehn Jahren einer der Bibliothekare der Biblioteca Apostolica Vaticana, fühlte, wie ihm das Blut ins Gesicht schoss. Er war Anfang vierzig und somit noch ein Jüngling in der römisch-katholischen Hierarchie. Und heute war der Papst in vollem Ornat zu ihm in sein Büro gekommen und trug ihm die Bischofswürde seiner Heimatdiözese an. Das Herz in Montebellos Brust pochte wild. Er wünschte, der Heilige Vater würde weitersprechen, und das würde er sicher auch tun, wenn nur endlich dieses blöde Telefon aufhörte zu klingeln. Das Geräusch bohrte sich tiefer und tiefer in sein Gehör. Er stammelte eine Entschuldigung, aber er hörte nur, wie ein Lallen aus seinem Mund kam. Das Bild des Papstes verschwamm vor seinen Augen. Er streckte die Arme nach ihm aus, doch griff er ins Leere. Das Einzige, was blieb, war dieses schreckliche Telefon. Der Gedanke, der ihm in diesem Moment durch den Kopf ging, war sicher nicht angemessen für den künftigen Erzbischof einer der altehrwürdigsten Diözesen der heiligen Mutter Kirche.
Der Apparat schrillte weiter. Der Geistliche schlug die Augen auf. Er lag mit dem Kopf auf einem staubigen Folianten – einer Quellenausgabe des Konzils von Ephesos. Er war darüber eingeschlafen, während er die Gedankenwelt des Häretikers Nestorius studierte, den das Konzil im Jahre 431 wegen seiner zweifelhaften Ansichten über die Natur Christi und wegen seiner Ablehnung der orthodoxen Vorstellung von Maria als Gottesgebärerin exkommuniziert hatte.
In der Ferne hupte ein Auto. Draußen war es dunkel. Nur die Schreibtischlampe erhellte das Arbeitszimmer in der Wohnung des Bibliothekars. Er spürte, wie ihm ein Brillenbügel in die Wange drückte. Und noch einmal schrillte das Telefon. Mit einem Stöhnen richtete er sich auf und knurrte in den Hörer:
«Pronto!»
«Gianni, bist du’s? Hier ist Bill.»
Der Mann am anderen Ende der Leitung sprach zwar Italienisch, aber mit dem breiten Akzent des Südstaatlers. Monsignor Montebello hatte Mühe, seine Gedanken zu ordnen.
«Bill? Bill Oakbridge?»
«Wie viele Bills außer mir kennst du denn noch? Muss ich eifersüchtig werden? Was ist los? Du klingst so komisch?»
Der Bibliothekar schaute auf die Zeitanzeige am Bildschirmrand seines Computers. Es war kurz vor drei Uhr morgens. Er musste fast zwei Stunden geschlafen haben. Wenn diese Konzilsakten für seine Forschungen auch wenig hergaben, so waren sie immerhin ein probates Schlafmittel.
«Nein, nein. Schon gut, Bill. Alles in Ordnung. Ich habe noch gearbeitet und war ganz in Gedanken.»
«Du musst ziemlich konzentriert gearbeitet haben. Ich habe es fast zwei Minuten klingeln lassen.»
Langsam kam wieder Leben in Montebello. Man mochte sich für die Papyri, mit denen Bill Oakbridge arbeitete, interessieren oder nicht, aber in keinem Fall war das, was die Forscher in Berkeley mit ihrer Hilfe herausfanden, irgendwie eilig oder weltbewegend. Nichts davon konnte so wichtig sein, seinen ehemaligen Studienkollegen um diese Uhrzeit aus dem Schlaf zu klingeln.
«Was gibt’s denn, Bill? Kann ich dich nicht morgen früh zurückrufen? Es ist hier mitten in der Nacht, und deine Krokodilmumien werden nicht plötzlich priesterlichen Beistand verlangt haben.»
Montebello wusste nur zu gut, dass es auf der ganzen Welt kaum einen fähigeren Papyrologen gab als diesen Amerikaner – der in aller Öffentlichkeit einen Lebenswandel pflegte, den manch ein Geistlicher unter größten Gewissensnöten im Geheimen führte. Als Montebello noch während der Studienzeit auf das Laster seines Kommilitonen aufmerksam geworden war, hatte er sich zunächst von ihm abgewandt. Aber dessen Lebensfreude und Hingabe an seine Profession hatten ihn bezwungen. So hatten sie in einer Sommernacht in Trastevere ein ernstes Gespräch über Oakbridges Neigungen geführt. Der angehende Priester hatte dabei seine seelsorgerischen Pflichten der Ermahnung zu einer aus seiner Sicht angemessenen Lebensführung erfüllt. Sie hatten aber auch in aller Offenheit über die konventionellen erotischen Nöte Montebellos gesprochen – und nach dieser Nacht beide Themen nicht mehr berührt. Sie waren damals als Freunde auseinandergegangen, und an dieser Freundschaft hatte sich nie mehr etwas geändert.
«Wenn du morgen früh aufstehst, sitze ich bereits seit ein paar Stunden in der Maschine nach Rom. Ich werde morgen Nachmittag um halb vier in Fiumicino landen. Gian Carlo, hier im Institut haben sich Dinge ereignet, die vieles verändern werden – nicht zuletzt für mich selbst. Außerdem habe ich etwas herausgefunden, das mich zwingt, sofort zu dir zu kommen. Wegen eures Konzilsrummels habe ich aber auf die Schnelle kein Zimmer mehr in Rom finden können. Bitte lass mich ein, zwei Nächte bei dir schlafen, bis ich mir ein Hotel besorgt habe. Und bitte verschaff mir unbedingt die Erlaubnis, die Papyrussammlung des Vatikans zu besuchen. Ich muss den Papyrus P75/A einsehen. Das ist das Fragment, das dein letzter Chef, Kardinal Ambroso, dem Bodmer-PXV zugeordnet hat.»
Montebello war mit einem Schlag hellwach. Der Schweizer Mäzen Martin Bodmer hatte diese Kostbarkeit zusammen mit ihrem Zwilling, PXIV, in den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts erworben; und vor nicht allzu langer Zeit waren sie durch eine Schenkung Teil der Sammlung des Vatikans geworden. Diese Papyri waren um die Wende vom zweiten zum dritten Jahrhundert nach Christus entstanden und enthielten große Teile des Lukas- und des Johannesevangeliums. In der Bibliothek wurden sie als P75 geführt, gehörten zu den ältesten Handschriften des Neuen Testaments und damit zu den wertvollsten Stücken der Vaticana.
Dem von Oakbridge erwähnten Fragment P75/A hatte Montebello allerdings kaum Beachtung geschenkt. Es war ein inhaltlich wenig bedeutendes Stückchen Papyrus, das anscheinend den Schluss eines Briefes enthielt. Worum es darin ging, war völlig unklar, weil der obere Teil der Handschrift fehlte. Montebello erinnerte sich noch, dass dieser Handschriftenrest außergewöhnlich alt war und einen Hinweis auf die frühe Christengemeinde in Ephesos enthielt, wo auch Johannes – Apostel und Lieblingsjünger Jesu – jahrelang gewirkt hatte. Wenn jedoch der alte Jesuit Ambroso, der so viele Jahre als Cardinale archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa die Vatikanische Bibliothek geleitet hatte, dieses Fragment in Verbindung mit dem Papyrus P75 brachte, so würde er dafür sicher stichhaltige Gründe haben. Stand doch der Kardinal nicht nur im Ruf, ein weltgewandter, weiser Theologe, sondern auch ein Meister in der Entzifferung und Deutung alter Handschriften zu sein.
Dass Montebello seinen Anrufer auf eine Antwort warten ließ, lag jedoch nicht an seiner Unsicherheit über den Inhalt der kleinen Handschrift. Vielmehr war es weniger denn je eine Kleinigkeit, Zugang zu den ältesten Schätzen der Bibliothek zu erhalten: Kardinal Ambroso hatte sich in seinem lebhaften Interesse für die Forschungsziele der Besucher der Vaticana und für die Belange seiner eigenen Leute nie als Sua Eminenza Reverendissima gebärdet. Das war unter seinem Nachfolger und neuen Präfekten der Bibliothek völlig anders geworden. Der gehörte zum Erbe des letzten Papstes, unter dem niemand Karriere gemacht hatte, der jemals einen Fußbreit von den Traditionen und Regeln des Vatikans abgewichen war. Dementsprechend war während dessen Pontifikat auch die Besetzung wichtiger Ämter erfolgt. Dies galt für den immer noch amtierenden Vorsitzenden der Glaubenskongregation, Ludovico Panettiere, und es galt eben auch für das neue Haupt der Vatikanischen Bibliothek, Bartholomäus Angermeier. Mit ihm war ein in jeder Hinsicht linientreuer Benediktiner an die Spitze der Vaticana getreten, ein solider Gelehrter und ein sehr guter Organisator – der jedoch mit nur mäßiger intellektueller Regsamkeit ausgestattet war.
Es fiel Montebello nicht schwer, sich vorzustellen, wie der Mann aus Niederbayern reagieren würde, wenn er ihm das Ansinnen Oakbridges vortrug. Er würde ihn über seine randlose Brille hinweg anschauen, seine Arme vor der Brust verschränken und antworten, dass für alle Gelehrten, die in der Vatikanischen Bibliothek arbeiten wollten, dieselben Regeln zu gelten hätten. Auf jeden Fall müsse der Dienstweg bei der Prüfung des Antrags eingehalten werden. Und genau das war das Letzte, was Montebello brauchen konnte. Denn diese Prüfungsfrist war lang, und währenddessen würde mit Sicherheit irgendeiner der Mitarbeiter Angermeiers seinen Chef auf den in der Fachwelt bekannten Lebenswandel seines Freundes aufmerksam machen. Angermeier hatte sich mit Knechtsnaturen umgeben, für die es ein Fest sein würde, einen Mann wie Oakbridge, mit dem sie intellektuell nie hätten mithalten können, wegen seiner Homosexualität herabzuwürdigen. Und damit war es dann auch überhaupt keine Frage, dass dessen Anliegen abgelehnt würde: Das vatikanische Gesetz über den Schutz seiner Kulturgüter enthielt die Bestimmung, dass kein Objekt einem Gebrauch zugeführt werden dürfe, der mit seinem religiösen Charakter unvereinbar oder aber beispielsweise geeignet war, seine Erhaltung zu beeinträchtigen. Einem Sodomiten einen Papyrus zugänglich zu machen, der anscheinend in Beziehung zu einer der ältesten Handschriften des Johannesevangeliums stand, wäre für Angermeier undenkbar. Dies würde auch in den Augen der Ständigen Kommission für den Schutz der historischen und künstlerischen Monumente des Heiligen Stuhls, die in solchen Fällen angerufen werden konnte, eine Unvereinbarkeit begründen. Aber da man öffentliches Aufsehen vermeiden wollte, würde man einfach sagen, das Stück sei in einem besorgniserregend schlechten Zustand, so dass man es nicht zugänglich machen könne, ohne seine Erhaltung zu gefährden. Sobald die Restaurierung des Papyrus abgeschlossen sei, wolle man dem Antrag selbstverständlich gern stattgeben. Das würde im konkreten Fall nichts anderes heißen als am Sankt-Nimmerleins-Tag.
Oakbridges Stimme riss Montebello aus seinen Gedanken.
«Hey, Gian Carlo, bist du noch dran? Gianni? Hallo?»
«Ja, ja – beruhig dich wieder! Ich bin noch da. Natürlich kannst du bei mir übernachten. Was allerdings deinen Wunsch betrifft, einfach mal in unseren Papyri zu stöbern, so werde ich dir kaum helfen können. Du weißt, dass diese Stücke aus konservatorischen Gründen komplett unter Verschluss liegen. Aber vor allem ist unser Direktor nicht der Mann, der solchen Überraschungsvorstößen geneigt wäre.»
Den anderen Teil seiner Überlegungen unterschlug der Geistliche, um sich zu dieser Uhrzeit nicht auch noch eine Grundsatzdiskussion mit dem Amerikaner einzuhandeln.
«Um was geht es denn überhaupt, Bill? Du scheuchst mich hier zu nachtschlafender Zeit auf, kündigst einen Überfall an und willst auch noch unangemeldet ins Allerheiligste der Bibliothek.»
«Das kann ich dir am Telefon nicht erklären. Aber ich würde nicht so drängen, wenn es nicht wirklich wichtig wäre. Bitte – ich muss dieses Fragment sehen! Das ist für euren Laden mindestens so bedeutend wie für mich! Holst du mich morgen ab?»
«Ich will sehen, was ich tun kann. Und auf jeden Fall versuche ich, morgen um halb vier am Flughafen zu sein. Aber mehr kann ich wirklich nicht versprechen.»
«Du bist ein Schatz, Gian Carlo! Morgen wirst du alles besser verstehen. Ich freue mich, dich wiederzusehen! Mach’s gut, alter Junge!»
«Ciao, Bill!»
Kapitel 3 – Die Audienz
Als am nächsten Morgen um halb sechs der Wecker Monsignor Montebello aus dem Schlaf riss, war sein Nacken steif wie ein Brett. Es hatte ihm nicht gutgetan, auf den Konzilsakten einzuschlafen, und auch das Gespräch mit Bill Oakbridge war kein Stimmungsaufheller gewesen: Wer wie der Bibliothekar noch von Kardinal Ambroso eingestellt worden war, hatte bald zu spüren bekommen, woher neuerdings der Wind wehte. Manch einer bemühte sich um eine andere Stelle, andere erledigten ihre Arbeit wie bisher, begannen aber, sich wie Montebello in eine Art intellektuelle Emigration zurückzuziehen.
Doch es half nichts. Er hatte Oakbridge versprochen, dass er sich dafür einsetzen werde, ihm Zugang zu Papyrus P75/A zu verschaffen. Und dabei führte kein Weg an Seiner hochwürdigsten Eminenz Bartholomäus Angermeier vorbei. Eine heiß-kalte Dusche und das kleine Frühstück – Espresso und ein Cornetto –, das ihm seine Haushälterin hingestellt hatte, weckten wieder seine Lebensgeister. Er stieg in seinen Wagen und fuhr zunächst zu Santi Ambrogio e Carlo al Corso, einer monumentalen Barockkirche im Herzen Roms, die man zu Beginn des siebzehnten Jahrhunderts errichtet hatte. Dort las Montebello allmorgendlich, bevor er seinen Dienst in der Vatikanischen Bibliothek antrat, um halb sieben die Frühmesse in einer Seitenkapelle, die Maria, Helferin der Christenheit, geweiht war. Dieses Amt war fester Bestandteil jener priesterlichen Pflichten, die er neben seiner Arbeit als Bibliothekar zu versehen hatte. Auch an diesem Morgen waren nur ein paar alte Leute in der Kirche, aber Ruhe, Sammlung und Gebet während des Gottesdienstes taten ihm wohl. So keimte, als er gegen acht Uhr die Bibliothek betrat, Hoffnung in ihm.
Er begab sich schnurstracks in die Verwaltung, klopfte am Vorzimmer des Direktors an und betrat auf ein ‹Avanti!› hin das Büro des Sekretärs – eines spanischen Dominikaners namens Padre Luis.
«Laudetur Jesus Christus!»
«In aeternum! Amen.»
«Padre Luis, ob Seine Eminenz wohl kurz für mich zu sprechen ist?»
«Haben Sie einen Termin, Monsignor Montebello?»
«Bedauerlicherweise nicht. Ich komme mit einem Anliegen, das sich ganz überraschend ergeben hat.»
Padre Luis zog die Augenbrauen hoch und griff zum Telefon.
«Ich werde Seine Eminenz fragen; aber … (und dieses ‹Aber› wurde von einem sehr geschäftigen Blick in den Terminkalender auf seinem Schreibtisch begleitet) … aber ich weiß, dass er in einer Dreiviertelstunde den Besuch des italienischen Staatssekretärs des Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali erwartet und sich gerade darauf vorbereitet.»
Es gelang dem frommen Türhüter, seinen Worten einen Klang beizulegen, der deutlich machte, dass in diesen Räumen wirklich Wichtiges verhandelt wurde. Demgegenüber konnte irgendein – noch dazu plötzlich auftretendes – Anliegen eines Bibliothekars schwerlich Geltung beanspruchen.
«Eminenza! Bitte verzeihen Sie die Störung. Aber Monsignor Montebello steht bei mir und fragt, ob er Sie unangemeldet behelligen dürfe.»
Es vergingen zwei Sekunden. Dann legte ein sichtlich konsternierter Padre Luis den Hörer auf.
«Sua Eminenza lassen bitten!»
Montebello verneigte sich einen halben Zentimeter und sagte, begleitet von einem sehr förmlichen Lächeln:
«Haben Sie vielen Dank, Padre Luis! Ohne Ihre Fürsprache hätte ich diesen Termin niemals bekommen.»
Dann öffnete er schwungvoll die Doppelflügeltür, die zu den Amtsräumen Kardinal Angermeiers führte.
«Laudetur Jesus Christus!»
«In aeternum! Amen.»
«Eminenza …»
Noch ehe Montebello mehr als drei Schritte in den Raum hatte machen, geschweige denn sein Anliegen hätte vorbringen können, wurde er von der hageren Gestalt hinter dem Schreibtisch mit einer Handbewegung unterbrochen.
«Monsignor Montebello! Es fügt sich ausgezeichnet, dass Sie gerade heute vorbeikommen. In ein paar Minuten treffe ich den Staatssekretär des italienischen Kultusministers und möchte mich mit ihm über den Stand der Entwicklung digitaler Bibliotheken austauschen. Wie steht es mit der Digitalisierung der Bestände in Ihrer Abteilung?»
Auf so manches war Montebello gefasst gewesen, nicht aber auf diese Frage.
«Also … Ich habe gerade begonnen, Angebote einschlägiger IT-Firmen einzuholen, um eine Vorstellung von den Kosten für die Retrodigitalisierung unserer Bestände zu erhalten. Außerdem mache ich mir derzeit ein Bild davon, welche Konzilsakten man wohl dieser Prozedur unterwerfen kann, ohne dass sie Schaden nehmen.»
An dem Gesichtsausdruck des Direktors war unschwer zu erkennen, dass das nicht die Antwort war, auf die er gewartet hatte.
«Das geht alles viel zu langsam! Ich möchte, dass die Digitalisierung oberste Priorität für alle Abteilungsleiter der Bibliothek hat. Der Fortschritt der Vatikanischen Bibliothek auf diesem Gebiet soll international zur Benchmark werden. Wir werden sehr viel ökonomischer mit unseren Ressourcen haushalten, als dies zu Zeiten meines ehrenwerten Vorgängers, Kardinal Ambroso, der Fall war. Im Vatikan hat niemand ein vernünftiges Kostenbewusstsein, obwohl allenthalben die Einnahmen zurückgehen. Ich werde auch nach innen Maßstäbe setzen. Bislang glauben alle, wir könnten hier Geld ausgeben, als ließe es der liebe Gott auf den Bäumen wachsen. Ich will die Bestände unseres Hauses innerhalb von längstens drei Jahren vollständig digitalisiert sehen. Wir werden die Digitalisate online im Pay-Per-View-Verfahren anbieten und damit einen eigenen Beitrag zu unserem Haushalt leisten. Im Übrigen sollten Sie wissen, dass der Nutzer der natürliche Feind des Bibliothekars und seiner Bücher ist. Wir erfüllen demnach eine zweigliedrige Aufgabe: Zum einen sichern wir die Bestände in unseren Magazinen, zum anderen müssen wir sie zugänglich machen. Je weniger uns das kostet und je mehr uns das einbringt, umso besser. Ich bitte Sie, sich künftig nach dieser Maxime zu richten!»
Montebello war dieses Gerede von Herzen zuwider, das so reich an Floskeln, aber so arm an Kenntnis der wissenschaftlichen Realitäten und – trotz allen Business-Geschwafels – auch der ökonomischen Sachverhalte war. Doch in dieser Situation war es nicht sinnvoll, seinem Vorgesetzten zu widersprechen.
«Sehr wohl, Eminenza! Dürfte ich Ihnen bitte noch mein Anliegen vortragen, das mich zu Ihnen geführt hat?»
«Bitte, aber machen Sie rasch! Sie wissen, dass ich gleich Besuch bekomme!»
«Gewiss! Professor Bill Oakbridge, der Stellvertretende Direktor des Center for the Tebtunis Papyri an der University of Berkeley kommt heute nach Rom und bittet darum, kurzfristig den Papyrus P75/A sehen zu dürfen.»
«Mit welchem Forschungsanliegen will er den Papyrus sehen?»
«Es tut mir leid, aber er rief mich heute Nacht vom Flughafen in San Francisco aus an und konnte es mir am Telefon nicht sagen. Es sei jedoch von außerordentlicher Wichtigkeit. Deshalb ist er bereits auf dem Weg nach Rom.»
Ob die Antwort des Direktors der Vatikanischen Bibliothek huldvoller ausgefallen wäre, hätte Montebello ihm Erfreulicheres über den Stand der Digitalisierung der Bestände in seiner Abteilung mitteilen können, sollte dessen Geheimnis bleiben.
«Monsignor Montebello, wie lange arbeiten Sie bereits in der Bibliothek des Vatikans?»
«Seit fast zehn Jahren, Eminenza.»
«Sehr schön. Dann sollten Sie in der Lage sein, wenn Professor Oakbridge eintrifft, ihm den Unterschied zwischen dieser Einrichtung und einer amerikanischen Leihbücherei zu erklären.»
Das Gesicht Montebellos überzog sich rosa. Der innere Kampf, den er jetzt ausfocht, währte knapp zwei Sekunden; dann hatte er verloren.
«Das wird nicht nötig sein, Eminenza. Professor Oakbridge hat hier bereits als Wissenschaftler gearbeitet, als Sie noch Bibliothekar in Kloster Vornbach waren.»
Von der Straße wehte ein warmer Frühlingswind durch die geöffneten Fenster, doch die Raumtemperatur schien mit einem Mal auf die Frostgrenze gesunken zu sein.
«Sie dürfen sich zurückziehen, Monsignor Montebello.»
Während der Kardinal dies mit tonloser Stimme sagte, streckte er seine Rechte aus. Der Bibliothekar machte einige Schritte auf den Schreibtisch zu, beugte sich vor und küsste den Ring seines Vorgesetzten. Dann wich er, einen Gruß murmelnd, in leicht geneigter Haltung rückwärtsgehend zur Tür zurück, drehte sich um, öffnete sie, durchquerte das Büro des Sekretärs, ohne ihn noch eines Blickes zu würdigen, und verließ die Verwaltung.
Als er wieder in seinem Büro war, atmete er tief durch. Sein Herz hämmerte. Wie hatte er sich nur so leicht provozieren lassen können?
«Ich bin ein Esel. Das hat Bill nichts genützt, und mir wird es schaden.»
An diesem Freitag erledigte Monsignor Montebello seine Arbeit ziemlich fahrig. Die Mittagspause ließ er ausfallen. Er hatte keinen Appetit. Dafür ging er bereits um halb drei. Er fuhr zum Flughafen, wo die Maschine mit fast einer Stunde Verspätung angezeigt war. So fand er Zeit, in einer Bar noch einen Espresso zu trinken. Was sollte er Bill sagen?
«Steig gleich wieder ins nächste Flugzeug! Ich hab’s vermasselt.»
Nein! Er würde sich natürlich anhören, was für eine Entdeckung seinen Freund so sehr beschäftigte.
Als die Ankunft des Fluges aus San Francisco durchgesagt wurde, straffte er sich und begab sich zu den übrigen Wartenden. Es verging noch fast eine halbe Stunde, bis Bill Oakbridge im Strom der Reisenden durch die Milchglastür trat: Hochgewachsen, mit sonnengebräunter Haut, die einen schönen Kontrast zu seinen blonden Haaren bildete, trug er einen schwarzen Anzug mit offenem schwarzem Hemd, unter dessen Kragen ein cremefarbener Seidenschal verschwand. Der Amerikaner erkannte Montebello sofort in der Menge und kam ihm mit strahlendem Lächeln entgegen. Montebello umarmte ihn, und da sein Freund außer einer stattlichen Aktentasche nur einen kleinen Handkoffer dabeihatte, machten sie sich gleich auf den Weg zum Parkhaus, wo das Auto des Bibliothekars stand.
Kapitel 4 – Der Brief
«Es ist wunderbar, wieder hier zu sein, Gianni. In keiner Stadt ist der Frühling so schön wie in Rom.»
«Wenn deine geheimnisvolle Entdeckung kein bloßer Vorwand war, um gerade jetzt herzukommen, dann hast du einfach einen guten Zeitpunkt gewählt: Übermorgen beginnt die Festa di Primavera. Also – womit sollen wir dein Touristenprogramm beginnen? Campari auf der Piazza Dante oder Espresso an der Spanischen Treppe? Wir finden sicher einen Platz: Egal, wie viele Fremde heute dort waren – sie werden alle in einem Meer von roten Azaleen ertrunken sein.»
«Vielleicht später. Jetzt will ich mit dir reden, wo uns keiner zuhört. Wie wär’s mit dem Park der Villa Borghese?»
«Wie du meinst.»
Montebello lenkte den Wagen in die Nähe des Eingangs am Piazzale Brasile, wo er wie durch ein Wunder einen Parkplatz fand, ohne Gefahr zu laufen, abgeschleppt zu werden. Oakbridge ließ den Handkoffer im Wagen und nahm nur seine große Aktentasche mit. Als die beiden durch den Park gingen, fiel erstmals seit dem unerfreulichen Gespräch mit Kardinal Angermeier die Spannung von Montebello ab. Dieses grüne Paradies im Herzen Roms ließ ihn wieder ruhiger atmen. Sie schlenderten an dem See entlang, auf dem bereits die ersten kleinen Boote fuhren. Die Bäume blühten, und die Luft war erfüllt von Vogelstimmen. Sie lenkten ihre Schritte zu einer abseits gelegenen Bank. Es entging dem Bibliothekar nicht, dass Oakbridge, ehe er sich niederließ, noch einmal mit einem Rundblick die Umgebung in Augenschein nahm, sich dann aber offenbar ganz unbekümmert auf die Bank setzte und die Beine ausstreckte.
«Jetzt erzähl mir, weshalb du es so eilig hattest, nach Rom zu kommen! Was ist los?»
Oakbridge schloss ein paar Sekunden die Augen und sog die würzige Luft ein.
«Ich habe dir doch schon oft von Professor Cyrill Knightley erzählt.»
«Deinem väterlichen Freund und Förderer? Ja. Wie geht es ihm?»
Der Amerikaner schwieg einen Moment.
«Er ist letzte Woche gestorben. Er war nachts allein im Institut und bekam einen Herzinfarkt. Der Arzt sagt, er war sofort tot.»
«Wie furchtbar, Bill! Gott sei seiner Seele gnädig! Das tut mir sehr leid für dich.»
Oakbridge schluckte.
«Ich kann es selbst noch nicht fassen. Ich kannte ihn sogar noch länger als dich und hatte fast täglich mit ihm zu tun. Und gestern» – Oakbridge machte eine kleine Pause –, «gestern hat mir die Universität vorläufig die Leitung des Instituts übertragen.»
«Was heißt vorläufig?»
«Bis die Stelle wieder dauerhaft besetzt wird – was wohl noch im Laufe dieses Jahres der Fall sein wird. Es gibt nicht viele Kandidaten, die in Frage kommen.»
«Du wirst einer von ihnen sein.»
«Ich denke, es läuft auf mich hinaus. Aber …»
«Aber?»
«Das ist nicht der Grund, weshalb ich hier bin. Gian Carlo, ich möchte dir einen griechischen Papyrus zeigen, den Cyrill und ich erst wenige Tage vor seinem Tod entdeckt haben. Kannst du so etwas lesen?»
«Kommt darauf an. Ich bin kein ganz schlechter Philologe, aber die Lektüre gedruckter antiker Texte ist eine andere Sache als die Lektüre antiker Handschriften.»
Oakbridge sah sich noch einmal um. Dann griff er nach seiner Aktentasche und zog ein steifes, in grünes Leder gebundenes, rechteckiges Futteral heraus, das etwas größer als ein Briefbogen war. Es war nicht mehr als zwei Fingerbreit hoch und hatte vorn zwei goldglänzende Messingverschlüsse, die er nach oben schnappen ließ. Im Innern war es mit blauem Samt ausgeschlagen, doch war im Boden eine Vertiefung ausgearbeitet, die zwei fest aufeinanderliegende Glasplatten aufnahm. Und zwischen diesen Glasplatten lag ein bräunlicher Papyrus mit verblassenden griechischen Schriftzeichen.
«Dies schließt den Papyrus luftdicht ab, und da wir hier im Schatten sitzen, wird ihm auch das Sonnenlicht nichts anhaben. Ist doch in ganz ordentlichem Zustand, dafür, dass er fast zweitausend Jahre Teil einer Krokodilmumie war – oder?»
Montebello warf einen neugierigen Blick auf den Schatz seines Freundes. Und in der Tat: Das dicht beschriebene Blatt wies nur ein paar kleine Löcher auf. Im Übrigen war es unversehrt. Noch während der Bibliothekar daraufschaute, wurde ihm klar, dass er sich schwertun würde, die Schriftzeichen auf dem Papyrus ohne weiteres zu entziffern.
«Bill, erspar mir eine Prüfung in Paläographie unter freiem Himmel und sag mir einfach, was drinsteht!»
«Schade, ich hätte gern dein Gesicht beobachtet, während du das hier liest. Aber ehe ich dir den Text übersetze, musst du mir versprechen, dass du niemandem gegenüber erwähnst, was du jetzt erfährst. Zumindest so lange nicht, bis ich es dir erlaube. Habe ich dein Wort?»
Der Bibliothekar war ein wenig überrascht, nickte aber.
«Versprochen!»
Oakbridge machte noch eine kleine Kunstpause, dann begann er vorzulesen.
«Johannes, durch den Willen Gottes Apostel Jesu Christi, Sohn des Zebedäus und Bruder des Jakobus, an Markus, seinen Bruder durch den Glauben, und an die Gemeinde der Brüder in Alexandria, die an Christus glauben. Gnade sei mit Euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Christus Jesus.
Stets danke ich Gott, wenn ich in meinen Gebeten an Dich denke. Denn die Gemeinde in Ephesos hört von Deinem Glauben an unseren Herrn und wie Du durch Liebe und Weisheit die Gemeinde derer vergrößerst, die an ihn glauben. Dieses Wissen, dass durch Dich, Bruder, und durch Deine Liebe der Glaube in Alexandria wächst, ist uns ein Trost, denn des Trostes bedürfen wir, da wir heute so Trauriges erlebt haben, dass ich Dir davon künden will. Nicht vermochte die Gottlosigkeit so vieler Ephesier, die den falschen Göttern anhängen, nicht vermochten die törichten Reden mancher, die zwar um den wahren Glauben ringen, aber doch noch im Dunkel wandeln, mich so zu betrüben wie der Tod der Mutter unseres Herrn Christi Jesu. Seit ER sie mir am Kreuze anvertraut hatte, war sie bei mir, und ich habe sie allezeit umsorgt als meine Mutter. Und sie war mir und der Gemeinde von Ephesos stets ein Trost und hat uns Mut zugesprochen, wenn wir kleinmütig wurden ob der Schwierigkeiten, seit wir die Heimat verlassen haben. Täglich erhob sie sich voll Freude und half den Notleidenden, auch wenn ihr der Dienst schwer und schwerer wurde. Heute Morgen aber vermochte sie nicht mehr, sich von ihrem Lager zu erheben. Bald schon waren viele der Gemeinde um sie versammelt. Sprechen konnte sie nicht mehr, doch lächelte sie uns Trost zu und entschlief. Wir aber haben beschlossen, sie im Verborgenen zu bestatten, damit nicht die Ephesier, die in ihrem Zorn auf unsere Gemeinde rasen, ihr Grab verwüsten, da wir ihre Geschäfte mit dem Götzendienst an bösen Geistern stören. Einer aus der Gemeinde aber weiß ein solches Grab, in das noch nie ein Toter gelegt worden ist. Darein wollen wir die Mutter unseres Herrn Christi Jesu legen, da wir sie beweint und die Frauen sie gewaschen und gesalbt haben. So gering ihr steinernes Grabmal auch sein mag, so weiß ich doch, dass es den Untergang des großen Heidentempels überdauern wird, denn die Macht Gottes wird es nicht zulassen, dass die Häuser der falschen Götter für lange Zeit die letzte Wohnung der Gottesgebärerin überragen werden. Der Ort ihres Grabes aber liegt vom Tempel der Artemis ein und …»
Oakbridge blickte auf und sah in das aschfahle Gesicht seines Freundes.
«Warum liest du nicht weiter? Um Gottes willen, lies!»
«Es gibt nichts mehr zu lesen. Hier bricht der Text ab.»
Oakbridge schloss das Futteral und verstaute es wieder in seiner Aktentasche. Ein paar Touristen schlenderten an ihnen vorbei. In den Bäumen zwitscherten die Vögel, und aus der Ferne war die Stimme eines Eisverkäufers zu hören, der sein gelato anpries.
«Das Grab der Jungfrau.»
Die Stimme Montebellos war belegt; er bekreuzigte sich langsam.
«So ist es. Kannst du dir vorstellen, dass Cyrill Knightley und mich fast der Schlag getroffen hat, als wir erkannten, was wir vor uns hatten? Dieser Brief des Apostels Johannes ist nicht nur mit Sicherheit eines der ältesten, sondern auch eines der bedeutendsten Dokumente der Christenheit.»
«Das ist … ungeheuerlich. Das … kann nicht sein … Eine Fälschung?»
«Wäre dir das lieber? Nein, Gianni, dafür gibt es keinen Anhaltspunkt. Der Papyrus ist echt. Er bestätigt manches, das zu beweisen die Kirche kaum noch hoffen konnte, aber er ist natürlich auch von einiger theologischer Brisanz. Er bestätigt wichtige Teile der Passions- und der Apostelgeschichte, er bestätigt, dass Markus in Alexandria gewirkt hat. Er bestätigt das Wirken des Johannes, das Leben und Sterben Marias – aber eben auch ihre Bestattung in Ephesos. Über all das werden die Theologen in den nächsten Jahren viel nachzudenken haben und eine Menge Tinte vergießen.»
Montebello saß neben dem Amerikaner und schüttelte immer wieder den Kopf. Über einen Zeitraum von fast zweitausend Jahren hinweg hatte der Apostel Johannes zu ihm über das Sterben der Gottesgebärerin gesprochen.
«Wer weiß noch von der Existenz dieses Briefes?»
Oakbridge schaute überrascht auf seinen Freund.
«Weshalb fragst du das?»
«Wenn dieser Brief bekannt wird, löst er ein Erdbeben aus. Wenn das stimmt, was du vorgelesen hast, dann fallen zwei Dogmen – das von der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel und damit zugleich das von der Unfehlbarkeit des Papstes. Das wird die Lehrautorität der Kirche schwerer erschüttern als die Entdeckung des Kopernikus. Vor fünfhundert Jahren war die Stellung der Kirche unangefochten, heute ist sie überall in Bedrängnis.»
Bill Oakbridge verstand, was Montebello meinte. Am 1. November 1950 hatte Papst Pius XII. das Dogma der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel verkündet: «Wir erklären und definieren es als einen von Gott geoffenbarten Glaubenssatz, dass die makellose Gottesmutter, die allzeit reine Jungfrau Maria, nach Vollendung ihrer irdischen Lebensbahn mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen wurde.» Seit diesem Tag war das ein unverbrüchlicher Glaubensartikel der katholischen Christen. Das Grab der Jungfrau, von dem der Apostel Johannes sprach, war damit schwerlich zu vereinbaren: Wenn Maria aber nach ihrem Tod nicht mit Leib und Seele in den Himmel aufgefahren, sondern nachweislich bestattet worden war, so war dieser päpstliche Lehrsatz widerlegt. Dann aber fiel auch das Unfehlbarkeitsdogma, das das Erste Vatikanische Konzil unter Papst Pius IX. im Jahr 1870 aufgestellt hatte: «Wenn der Römische Papst in höchster Lehrgewalt spricht, das heißt: wenn er seines Amtes als Hirte und Lehrer aller Christen waltend in höchster apostolischer Amtsgewalt endgültig entscheidet, eine Lehre über Glauben oder Sitten sei von der ganzen Kirche festzuhalten, so besitzt er aufgrund des göttlichen Beistandes, der ihm im heiligen Petrus verheißen ist, jene Unfehlbarkeit, mit der der göttliche Erlöser seine Kirche bei endgültigen Entscheidungen in Glaubens- und Sittenlehren ausgerüstet haben wollte. Diese endgültigen Entscheidungen des Römischen Papstes sind daher aus sich und nicht aufgrund der Zustimmung der Kirche unabänderlich.»
Während Oakbridge noch über beide Dogmen nachdachte, stieß Montebello ihn an.
«Also, Bill, wer außer dir kennt den Brief noch?»
Oakbridge wiegte den Kopf.
«Das, Gian Carlo, beschäftigt mich im Moment am meisten. Bis nach der Beisetzung von Cyrills Urne war ich mir sicher, dass ich nun der einzige Mensch bin, der diesen Text kennt. Der Laborant, der die Präparation unter meiner Aufsicht vorgenommen hat, ist ein fähiger Mitarbeiter, aber er ist ein reiner Techniker und beherrscht keine alten Sprachen. Und ganz sicher kann er keine antiken Handschriften lesen … das macht ja sogar manchen Bibliothekaren Mühe.»
Ein ironisches Lächeln huschte über Oakbridges Gesicht.
«Cyrill und ich waren angesichts der Bedeutung dieses Briefes übereingekommen, dass vorerst niemand davon erfahren dürfe, bis wir alle wissenschaftlichen Fragen geklärt und einen geeigneten Weg gefunden hätten, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Da wir im Institut stets eine Politik der offenen Türen praktizieren, haben wir beschlossen, dass dieser Papyrus zur Sicherheit nicht dort, sondern erst einmal bei mir zu Hause aufbewahrt werden sollte, weil ich einen kleinen Wandsafe besitze.
Als ich dann eines Abends noch einmal den Papyrus betrachtete, fiel mir etwas ein, was ich Cyrill anderntags erzählt habe: Vor ein paar Jahren hat euer Kardinal Ambroso noch als Direktor der Vatikanischen Bibliothek einen kurzen Artikel in der Zeitschrift Studi di Egittologia e di Papirologia veröffentlicht. Darin schreibt er, dass er für die Vatikanische Bibliothek das Papyrusfragment P75/A erworben hat. Aufgrund einer vorläufigen Altersbestimmung, aber auch wegen inhaltlicher Bezüge vermutet er einen Autor dieser Handschrift aus der Entstehungszeit der Gemeinde in Ephesos – vielleicht sogar jemanden aus dem unmittelbaren Umfeld des Apostels Johannes. Und weiter heißt es darin, dass das Brieffragment eine sachlich nicht weiter einzuordnende Geländebeschreibung enthält, die sich vielleicht auf die Umgebung des Artemis-Tempels von Ephesos bezieht.
Cyrill und ich sahen darin eine Chance, vielleicht unseren Brief zu vervollständigen, wenn sich erweisen sollte, dass die beiden Fragmente zusammengehören. Ich sollte so rasch wie möglich nach Rom fliegen, um mir euer Papyrusfragment anzuschauen. Natürlich wäre ich, nachdem Cyrill gestorben war, nicht so bald hierhergekommen. Aber dann ist vorgestern während der Trauerfeier oder schon in der vorangegangenen Nacht in mein Büro eingebrochen worden. Ich habe der Polizei gesagt, dass ich glaube, einer der Junkies aus der Nachbarschaft sei vermutlich der Täter – und damit haben sie sich auch zufriedengegeben. Aber während ich mich umsah, um festzustellen, was außer ein paar Kleinigkeiten noch gestohlen worden war, wurde mir klar, dass jemand mein Zimmer systematisch durchsucht hatte: Ein Einbrecher hätte ohne Rücksicht auf Verluste alles herausgerissen und dann ein paar Wertsachen an sich gerafft. Bei mir wollte aber niemand etwas kaputt machen; doch hat derjenige alle Schränke und Schubladen geöffnet, Papiere und Unterlagen hervorgezogen und sie dann nicht mehr ganz sorgfältig an ihren Platz gelegt. Danach ist alles wieder verschlossen worden. Ich bin sicher, dass da jemand nach etwas ganz Bestimmtem gesucht und einfach irgendetwas mitgenommen hat, um die wahren Motive für seinen Einbruch zu verschleiern.»
«Du meinst, er hat euren Papyrus gesucht?»
Oakbrigde nickte.
«Wer immer es war, konnte nur deshalb nicht finden, was er suchte, weil ich den Papyrus nicht im Büro, sondern bei mir zu Hause hatte.»
«Wer sollte denn davon erfahren haben, wenn ihr beide niemandem etwas gesagt habt? Das kann doch auch einfach nur ein trauriges zeitliches Zusammentreffen sein.»
«Nein. Am Mittwochabend bin ich noch einmal in Cyrills Büro gegangen, nachdem mir der Gedanke an eine gezielte Suche des Einbrechers gekommen war, und habe mich dort umgesehen. Es war das gleiche Bild wie bei mir. Gian Carlo, es gibt jemanden, der von diesem Papyrus weiß und ihn in seinen Besitz bringen will. Deshalb bin ich trotz Cyrills Tod sofort nach Rom geflogen. Die Handschrift ist in Berkeley nicht länger sicher. Umso mehr bitte ich dich, mir zu helfen, den Teil meiner Forschungen, die ich nur hier betreiben kann, rasch voranzubringen!»
Der Appell Oakbridges lenkte Montebellos Gedanken wieder in die Gegenwart zurück. Er senkte den Kopf und griff sich mit beiden Händen in die Haare, während er flüsterte:
«O Gott, Bill! Es geht nicht mehr nur um die beiden Dogmen. Das Konzil! Der Papst hat die heilige Jungfrau zur Schutzpatronin des Konzils erhoben. Wenn dieses Brieffragment publik wird, dann werden alle Gegner der Kirche und alle Atheisten kübelweise Hohn und Spott über die Versammlung ausgießen. Ich sehe die Schlagzeilen schon vor mir: ‹Gottesmutter im Grab statt im Himmel!›, ‹Konzil ohne himmlische Fürsprecherin.› Für die Medien wäre das eine Sensation ersten Ranges, für die Kirche ein Skandal und für den Glauben in der Welt eine Katastrophe. Dir würde man deine Entdeckung vergolden. Du hättest einen Erfolg, der euer Institut zum führenden in der Welt machen würde … ob mit oder ohne unser Stückchen Papyrus in der Vaticana.»
«Gian Carlo, du missverstehst mich! Es geht mir nicht um irgendeine Sensation! Es geht darum, dass ich eine ordentliche wissenschaftliche Forschungsleistung vorlegen will: eine Textausgabe im Kontext aller verfügbaren Teile dieses hochbedeutenden Papyrus. Und außerdem …»
Als Oakbridge verstummte, richtete Montebello sich auf und sah ihn an.
«Außerdem …?»