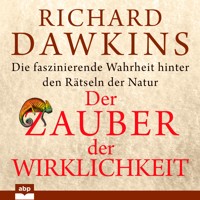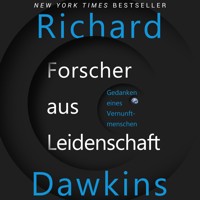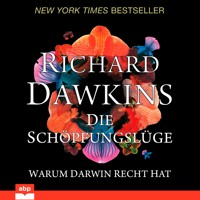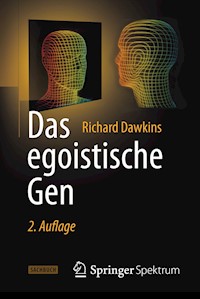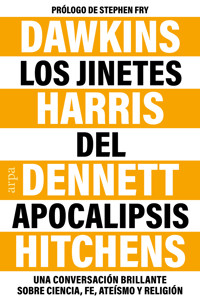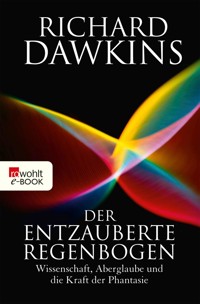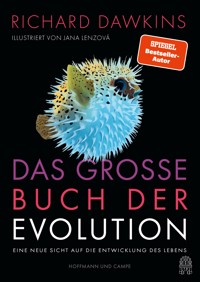
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Der große Dawkins ist zurück – mit dem unverzichtbaren Buch für ein aktuelles Verständnis der Evolution! Richard Dawkins eröffnet uns einen neuen Blick auf die Evolution und das Leben. Jeder lebende Organismus kann wie ein Buch seiner Vergangenheit gelesen werden: Das Verhalten, die Erscheinung und die Genetik eines Lebewesens geben nicht nur Auskunft über dessen Vorfahren, sondern auch über die Welt, in der diese lebten. Die Tiere und Pflanzen um uns herum werden zum Fenster in längst vergangene Zeiten unseres Planeten. Mit unzähligen faszinierenden Beispielen aus dem Reich der Biologie lässt Dawkins uns wieder einmal staunen – über die Wunder des Lebens und der Wissenschaft, die all das zu entschlüsseln vermag. Ein bemerkenswertes Buch vom größten Biologen unserer Zeit – mit zahlreichen Illustrationen. »Das Leben ist voller Wunder. Wie kein anderer hat der Oxford-Professor Dawkins diese beschrieben und der Öffentlichkeit nahegebracht. Auch in seinem jüngsten Werk stellt der Gelehrte seinen Lesern staunenswerte Phänomene aus dem Reich des Lebendigen vor und erklärt, wie sie entstanden sind.« Johann Grolle, SPIEGEL
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 552
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Richard Dawkins
Das große Buch der Evolution
Eine neue Sicht auf die Entwicklung des Lebens
Sebastian Vogel
In dankbarer Erinnerung an Mike Cullen (1927–2001)
MAN HATTE EIN WISSENSCHAFTLICHES PROBLEM. Man wusste genau, wen man um Hilfe bitten konnte, und dann war er da. Ich sehe die Szene vor mir, als wäre es gestern gewesen. Die drahtige, jungenhafte Gestalt im roten Pullover, leicht gebeugt wie eine gespannte Feder voller intellektueller Energie, und manchmal wiegte er sich in voller Konzentration vorwärts und rückwärts. Die zutiefst intelligenten Augen, die verstanden, was man meinte, noch bevor man die Worte ausgesprochen hatte. Die Rückseite eines Briefumschlags zur Unterstützung einer Erklärung, die manchmal skeptisch und fragend schräg stehenden Augenbrauen unter den unordentlichen Haaren. Dann musste er schnell weg – er musste immer schnell irgendwohin –, griff nach seiner Keksdose mit den Drahtgriffen und verschwand. Aber am nächsten Morgen hatte man die Lösung für das Problem in Mikes charakteristischer kleiner Handschrift, zwei Seiten, oft ein wenig Algebra, Diagramme, eine entscheidende Literaturstelle, vielleicht auch ein passendes klassische Zitat oder ein von ihm selbst komponierter Vers. Ermutigend war es immer.
Wir kennen vielleicht andere Wissenschaftler, die ebenso intelligent sind wie Mike Cullen – viele sind es allerdings nicht. Wir kennen vielleicht andere Wissenschaftler, die ebenso hilfsbereit sind – aber das sind verschwindend wenige. In einem aber bin ich mir sicher: Wir haben niemanden gekannt, der so viel zu geben hatte und es mit solcher Großzügigkeit gegeben hat.1
1Das Tier lesen
DU BIST EIN BUCH, EIN UNVOLLENDETES WERK der Literatur, ein Archiv der beschreibenden Geschichte. Deinen Körper und dein Genom kann man als umfassende Akte lesen, als Akte über eine Abfolge farbenfroher, untergegangener Welten, die unsere längst verschwundenen Vorfahren umgaben: als genetisches Totenbuch. Diese Tatsache gilt für alle Tiere, Pflanzen, Pilze, Bakterien und Archaea, aber um ermüdende Wiederholungen zu vermeiden, werde ich manchmal alle Lebewesen als Tiere ehrenhalber bezeichnen. Aus der gleichen Stimmung heraus schätze ich auch eine Bemerkung, die John Maynard Smith machte, als uns ein Wissenschaftler der Smithsonian Institution, der dort arbeitete, durch den Dschungel von Panama führte: »Was ist es für ein Vergnügen, einem Mann zuzuhören, der seine Tiere wirklich liebt.« Die »Tiere«, um die es ging, waren Palmen.
Aus Sicht der Tiere kann man in dem genetischen Totenbuch auch einen Indikator der Zukunft sehen, wenn man von der vernünftigen Annahme ausgeht, dass die Zukunft sich nicht allzu stark von der Vergangenheit unterscheiden wird. Oder man sagt es auf eine dritte Art: Dann verkörpert das Tier einschließlich seines Genoms ein Modell früherer Umgebungen, und dieses Modell nutzt das Tier letztlich, um die Zukunft vorherzusehen und so im Spiel des Darwinismus Erfolg zu haben, dem Spiel um Überleben und Fortpflanzung – oder genauer gesagt, dem Spiel um das Überleben der Gene. Das Genom des Tieres geht eine Wette ein, dass die Zukunft nicht allzu anders sein wird als die Vergangenheit, die seine Vorfahren erfolgreich bewältigt haben.
Ich habe gesagt, man könne ein Tier als Buch über vergangene Welten lesen, die Welten seiner Vorfahren. Warum habe ich nicht von der Gegenwart gesprochen? Warum lesen wir das Tier nicht als Beschreibung der Umwelt, in der es selbst lebt? Das kann man tatsächlich tun. Doch (mit Vorbehalten, von denen noch zu reden sein wird) wurde jeder Aspekt der Überlebensmaschinerie eines Tieres auf dem Weg über seine Gene durch natürliche Selektion der Vorfahren weiter vererbt. Wenn wir also das Tier lesen, lesen wir eigentlich vergangene Umgebungen. Deshalb ist in meinem Titel von »den Toten« die Rede.2 Es geht darum, uralte Welten zu rekonstruieren, in denen aufeinanderfolgende, längst verstorbene Vorfahren überlebt haben und die Gene weitergeben konnten, die darüber bestimmen, dass wir, die modernen Tiere, so und nicht anders sind. Derzeit ist das ein schwieriges Unterfangen, aber eine Wissenschaftlerin der Zukunft, die es mit einem bis dahin unbekannten Tier zu tun bekommt, wird in der Lage sein, seinen Körper und seine Gene als detaillierte Beschreibung der Umgebungen zu lesen, in denen seine Vorfahren gelebt haben.
Auf meine imaginäre Wissenschaftlerin der Zukunft werde ich häufig zurückkommen, wenn sie sich mit dem Körper eines bisher unbekannten Tieres auseinandersetzt und sich vornimmt, es zu lesen. Da ich sie so häufig erwähne, werde ich kurz ihre Initialen WDZ verwenden. Um unbeholfene Satzkonstruktionen zu vermeiden und aus Höflichkeit gehe ich willkürlich davon aus, dass WDZ weiblich ist.[1] Wäre ich eine Autorin, würde ich es umgekehrt machen.
Dieses genetische Totenbuch, dieser »Ausdruck« des Tieres und seiner Gene, diese reichhaltig codierte Beschreibung früherer Umgebungen, muss zwangsläufig ein Palimpsest sein. Alte Dokumente sind teilweise durch einen Text überschrieben, der in späteren Zeiten hinzugekommen ist. Das Oxford English Dictionary definiert ein Palimpsest als »Manuskript, bei dem spätere Schrift über die frühere (ausgetilgte) Schrift gelegt wurde«. Ein geschätzter Kollege, der verstorbene Bill Hamilton, hatte die bezaubernde Gewohnheit, Postkarten als Palimpseste zu schreiben, wobei er verschiedenfarbige Tinte verwendete, um die Verwirrung zu verringern. Seine Schwester Dr. Mary Bliss hat mir freundlicherweise eine davon geliehen.
Diese Karte ist nicht nur ein hübsches, buntes Palimpsest, sondern es ist auch angebracht, sie hier zu verwenden, denn Professor Hamilton gilt weithin als der angesehenste Darwinist seiner Generation.[2] Als Robert Trivers seinen Tod betrauerte, sagte er: »Er hatte den feinsten, vielschichtigsten Geist, der mir jemals begegnet ist. Was er sagte, hatte häufig eine doppelte und sogar dreifache Bedeutung, das heißt, während wir anderen in einzelnen Tönen sprechen und denken, dachte er in Akkorden.«[3] Oder waren es Palimpseste? Jedenfalls stelle ich mir gern vor, dass ihm die Idee von Evolutions-Palimpsesten gefallen hätte. Und auch das genetische Totenbuch selbst.
Sowohl Bills Postkarten als auch meine Evolutions-Palimpseste weichen von der strengen Wörterbuchdefinition ab: Die früheren Texte sind nicht unwiederbringlich ausgetilgt. Im genetischen Totenbuch sind sie teilweise überschrieben, aber man kann sie noch lesen, auch wenn wir dazu »durch ein dunkles Glas« oder ein Gewirr späterer Texte blicken müssen.[4] Die Umgebungen, die im genetischen Totenbuch beschrieben sind, decken das ganze Spektrum ab, von den urzeitlichen Meeren des Kambriums über alle Zwischenstufen der Jahrmillionen bis in die jüngste Gegenwart. Vermutlich sorgt eine Art Gewichtung für eine Balance zwischen modernen und alten Texten. Nach meiner Vermutung folgt sie aber nicht einer einfachen Formel wie die Koranregeln für den Umgang mit inneren Widersprüchen – dort übertrumpft das Neue immer das Ältere. Auf das Thema werde ich in Kapitel 3 zurückkommen.
Wer in der Welt Erfolg haben will, muss vorhersehen, was als Nächstes geschehen wird, oder man muss so tun, als würde man es vorhersehen. Jede sinnvolle Vorhersage muss auf der Vergangenheit basieren, und viele sinnvolle Vorhersagen sind nicht absolut, sondern statistischer Natur. Manchmal ist es eine kognitive Vorhersage: »Wenn ich über diese Klippe falle (diese Schlange bei ihrem klappernden Schwanz greife, diese verlockenden Tollkirschen esse), werde ich anschließend leiden oder sterben«. Wir Menschen sind an Vorhersagen dieser kognitiven Art gewöhnt, aber das sind nicht die Vorhersagen, die ich im Sinn habe. Ich werde mich mehr mit unbewussten, statistischen »als ob«-Vorhersagen beschäftigen, die etwas darüber sagen, was die zukünftigen Chancen eines Tieres, zu überleben und Kopien seiner Gene weiterzugeben, beeinflussen kann.
Die Haut dieser Krötenechse aus der Mojave-Wüste ist so gefärbt und gemustert, dass sie dem Sand und kleinen Steinen ähnelt; damit verkörpert sie eine von den Genen ausgehende Vorhersage, dass sie wahrscheinlich in einer Wüste geboren wird (nun ja, eigentlich schlüpft sie). Entsprechend kann ein Zoologe, der mit der Echse konfrontiert wird, ihre Haut als lebhafte Beschreibung von Sand und Steinen in der Wüstenumwelt lesen, in der ihre Vorfahren zu Hause waren. Hier liegt meine zentrale Aussage. Bis weit unter die Haut, den ganzen Körper durch und durch, kann man jede Einzelheit, jedes Organ, jede Zelle, jeden biochemischen Prozess, jedes Fitzelchen eines Tieres einschließlich seines Genoms als Beschreibung früherer Welten lesen. Im Fall der Echse wird das Genom zweifellos die gleiche Wüstengeschichte spinnen wie die Haut. »Wüste« ist in jedem Teil des Tieres aufgeschrieben, außerdem eine Menge weiterer Informationen über seine frühe Vergangenheit, und diese Informationen gehen weit über alles hinaus, was der heutigen Wissenschaft zugänglich ist.
Wenn die Echse aus dem Ei schlüpft, ist sie mit einer genetischen Vorhersage ausgestattet, wonach sie sich in einer sonnendurchglühten Welt aus Sand und Kies wiederfinden wird. Würde sie dieser genetischen Vorhersage nicht entsprechen, beispielsweise indem sie aus der Wüste auf ein Golfgreen wandert, würde ein vorüberkommender Beutegreifer sie schnell aufsammeln. Und wenn die Welt selbst sich verändert, sodass die genetischen Vorhersagen sich als falsch erweisen, wäre sie ebenfalls zum Untergang verurteilt. Jede nützliche Vorhersage verlässt sich darauf, dass die Zukunft zumindest in einem statistischen Sinn annähernd so ist wie die Vergangenheit. Eine Welt der kontinuierlichen verrückten Launen, ein Umwelt-Irrenhaus, das sich zufällig und unberechenbar verändert, würde Vorhersagen unmöglich machen und das Überleben gefährden. Glücklicherweise ist die Welt konservativ, und die Gene können gefahrlos darauf wetten, dass ein Ort weiterhin mehr oder weniger so ist wie früher. Wenn das bei bestimmten Gelegenheiten nicht zutrifft – beispielsweise nach einer katastrophalen Überschwemmung, einem Vulkanausbruch oder wie beim tragischen Ende der Dinosaurier nach einem Asteroideneinschlag, der die Welt verwüstete –, sind alle Vorhersagen falsch, alle Wetten sind ausgesetzt, und ganze Tiergruppen sterben aus. In den meisten Fällen haben wir es aber nicht mit solchen großen Katastrophen zu tun: Es werden nicht große Teile des Tierreiches auf einen Schlag ausgelöscht, sondern nur die abweichenden Individuen, deren Vorhersagen geringfügig falsch sind, oder aber geringfügig falscher als die von Konkurrenten der eigenen Spezies. Das ist natürliche Selektion.[5]
Die obersten Texte des Palimpsestes sind ganz aktuell und gehören zu einem besonderen Typ: Sie wurden während der Lebenszeit des Tieres niedergeschrieben. Die Beschreibung früherer Welten in den Genen ist durch Abwandlungen und detaillierte Verfeinerungen überlagert, die seit der Geburt des Tieres entstanden sind – Modifikationen, die geschrieben und umgeschrieben wurden, weil das Tier aus Erfahrung gelernt hat; oder aber weil es bemerkenswerte, vom Immunsystem angelegte Erinnerungen an frühere Erkrankungen hatte; oder weil eine physiologische Gewöhnung beispielsweise an große Höhe eingetreten ist; oder sogar weil Phantasie mögliche zukünftige Folgen simuliert hat. Solche aktuellen Palimpsest-Texte werden nicht mit den Genen weitergegeben (die Werkzeuge, mit denen sie niedergeschrieben werden, allerdings durchaus), und doch summieren sie sich zu Informationen aus der Vergangenheit, die hinzugezogen werden, um die Zukunft vorherzusagen. Sie stammen einfach nur aus der sehr jungen Vergangenheit, die in die eigene Lebenszeit des Tieres fällt. Von diesen Teilen des Palimpsestes, die seit der Geburt des Tieres hingekritzelt wurden, handelt Kapitel 7.
Auch in einem noch aktuelleren Sinn baut das Gehirn eines Tieres ein dynamisches Modell der sich ständig wandelnden Umwelt auf und sagt Veränderungen von Augenblick zu Augenblick in Echtzeit voraus. Während ich diese Zeilen an der Küste von Cornwall niederschreibe, empfinde ich neidisches Vergnügen über die Möwen, weil sie auf dem Wind reiten, der um die Klippen der Lizard-Halbinsel tobt. Flügel, Schwanz und selbst der Winkel, in dem jeder einzelne Vogel den Kopf hält, stellen sich empfindsam auf die wechselnden Böen und Aufwinde ein. Stellen wir uns einmal vor, WDZ, unsere Zoologin der Zukunft, würde in das Gehirn einer fliegenden Möwe Elektroden mit Funkverbindung einpflanzen. Dann könnte sie auslesen, wie die Möwe ihre Muskeln einstellt und dies in Echtzeit in einen fortlaufenden Kommentar über die wirbelnden Winde übersetzt: in ein Vorhersagemodell im Gehirn, das sich präzise auf die Tragflächen des Vogels einstellt, damit sie ihn im nächsten Sekundenbruchteil weitertragen.
Ich habe gesagt, ein Tier sei nicht nur eine Beschreibung der Vergangenheit und nicht nur eine Vorhersage der Zukunft, sondern auch ein Modell. Was ist ein Modell? Eine Konturkarte ist das Modell eines Landes; aus diesem Modell kann man die Landschaft rekonstruieren und sich auf ihren Verkehrswegen zurechtfinden. Das Gleiche gilt für eine Liste von Nullen und Einsen in einem Computer, eine digitalisierte Darstellung der Karte, die vielleicht auch weitere einschlägige Informationen enthält: die örtliche Bevölkerungszahl, die angebauten Nutzpflanzen, die vorherrschenden Religionen und so weiter. In dem Sinn, in dem ein Ingenieur das Wort versteht, sind zwei Systeme »Modelle« voneinander, wenn ihrem Verhalten die gleiche Mathematik zugrunde liegt. Man kann ein elektronisches Modell eines Pendels verdrahten. Die Periodizität des Pendels wie auch des elektronischen Oszillators wird durch dieselbe Gleichung bestimmt. Die Symbole in der Gleichung stehen nur nicht für die gleichen Dinge. Ein Mathematiker könnte jedes davon zusammen mit der einschlägigen, auf Papier geschriebenen Gleichung als »Modell« jedes anderen behandeln. Meteorologen konstruieren ein dynamisches Computermodell des globalen Wetters, das durch Informationen von strategisch aufgestellten Thermometern, Barometern, Anemometern und heute vor allem Satelliten aktualisiert wird. Das Modell wird in die Zukunft fortgeschrieben und dient dazu, eine Vorhersage für jede beliebige Weltregion zu erstellen.
Sinnesorgane projizieren keinen originalgetreuen Film der Außenwelt in ein kleines Kino im Gehirn.[6] Das Gehirn konstruiert vielmehr ein virtuelles VR-Modell der wirklichen Welt draußen, und dieses Modell wird durch die Sinnesorgane ständig aktualisiert. Meteorologen schreiben ihr Computermodell des weltweiten Wetters in die Zukunft fort, und das Gleiche tut auch jedes Tier von einer Sekunde zur nächsten mit seinem eigenen Modell der Welt, um sich so bei seinen nächsten Handlungen leiten zu lassen. Jede Spezies baut sich ihr eigenes Modell der Welt auf – es nimmt eine Form an, die für die Lebensweise der jeweiligen Spezies nützlich ist und dazu dienen kann, lebenswichtige Voraussagen darüber zu treffen, wie man überlebt. Das Modell muss von Spezies zu Spezies sehr unterschiedlich sein. Im Kopf einer Schwalbe oder einer Fledermaus muss es sich an eine dreidimensionale, luftige Welt mit schnell beweglichen Zielen annähern. Dabei spielt es unter Umständen keine Rolle, dass das Modell in einem Fall von Nervenimpulsen der Augen aktualisiert wird, im anderen von Impulsen der Ohren. Nervenimpulse sind Nervenimpulse sind Nervenimpulse, woher sie auch stammen. Im Gehirn eines Eichhörnchens muss ein ähnliches VR-Modell ablaufen wie im Gehirn eines Totenkopfäffchens. Beide müssen in einem dreidimensionalen Gewirr aus Baumstämmen und Ästen zurechtkommen. Das Modell einer Kuh ist einfacher und näher an zwei Dimensionen. Ein Frosch stellt eine Szene nicht in dem Sinn, wie wir das Wort verstehen würden, als Modell dar. Das Auge des Frosches beschränkt sich im Wesentlichen darauf, dem Gehirn über kleine bewegliche Objekte zu berichten.[7] Ein solcher Bericht setzt im typischen Fall einen stereotypen Ablauf in Gang: Der Frosch wendet sich dem Objekt zu, hüpft näher heran und lässt schließlich die Zunge in Richtung des Ziels herausschießen. Die Verdrahtung des Auges verkörpert eine Vorhersage, wonach der Frosch wahrscheinlich etwas zu Fressen treffen wird, wenn er die Zunge in die angegebene Richtung bewegt.[8]
Mein Großvater stammte aus Cornwall und war in seiner Pionierzeit bei dem Unternehmen Marconi beschäftigt, wo er jungen Ingenieuren, die neu in die Firma kamen, die Grundlagen der Funktechnik erklärte. Unter seinen Lehrmitteln war eine Wäscheleine, die er schwenkte, um ein Modell von Schallwellen herzustellen – oder von Funkwellen, denn das gleiche Modell lässt sich auf beides anwenden, und genau darum geht es. Jedes komplizierte Wellenmuster – Schallwellen, Funkwellen oder notfalls auch Meereswellen – lässt sich in die Sinuswellen zerlegen, aus denen es besteht – diese »Fourier-Analyse« ist nach dem französischen Mathematiker Joseph Fourier (1768–1830) benannt.[9] Umgekehrt kann man sie auch zusammensetzen und damit die ursprüngliche, komplizierte Welle neu aufbauen (Fourier-Synthese). Um das vorzuführen, befestigte mein Großvater seine Wäscheleine an rotierenden Rädern. Drehte sich nur ein Rad, führte das Seil schlangenähnliche Wellenbewegungen aus, die ungefähr einer Sinuswelle entsprachen. Rotierte gleichzeitig auch ein gekoppeltes Rad, wurden die Schlangenwellen des Seils komplizierter. Die Summe der Sinuswellen war eine einfache, aber einprägsame Verdeutlichung des Fourier-Prinzips. Großvaters schwingende Leine war das Modell einer Funkwelle, die vom Sender zum Empfänger wandert. Oder einer Schallwelle, die ins Ohr dringt: eine zusammengesetzte Welle, mit der das Gehirn vermutlich eine Entsprechung zur Fourier-Analyse durchführt, wenn es beispielsweise ein so kompliziertes Muster wie geflüsterte Sprache plus aufdringliches Husten vor dem Hintergrund eines Orchesterkonzerts entschlüsselt. Erstaunlicherweise kann das menschliche Ohr oder eigentlich das menschliche Gehirn aus der zusammengesetzten Welle des ganzen Orchesters hier eine Oboe und dort ein Horn heraushören.
Ein heutiger Nachfolger meines Großvaters würde keine Wäscheleine benutzen, sondern einen Computerbildschirm; er würde darauf zuerst eine einfache Sinuswelle zeigen und dann eine zweite Sinuswelle mit anderer Frequenz.[10] Anschließend würde er beide zusammenfügen und eine kompliziertere geschlängelte Linie erzeugen, und so weiter. Das Bild auf der folgenden Seite zeigt die Form einer Schallwelle – hochfrequenter Luftdruckveränderungen –, die entsteht, wenn ich ein einzelnes englisches Wort ausspreche. Wenn man weiß, wie man es analysieren muss, könnte man an den darin (in einem stark gedehnten Bild) verkörperten numerischen Daten ablesen, was ich gesagt habe. In Wirklichkeit erfordert es eine Menge mathematischer Akrobatik und Rechenleistung, um es zu entziffern. Aber nehmen wir einmal an, die gleiche geschlängelte Linie wäre die Rille, in der eine altmodische Grammophonnadel steht. Die durch sie entstehenden wechselnden Luftdruckwellen würden unsere Trommelfelle bombardieren und sich in den Nervenzellen, die mit dem Gehirn verknüpft sind, in Impulsmuster verwandeln. Das Gehirn würde dann ohne Schwierigkeiten in Echtzeit die erforderliche mathematische Zauberei ausführen und das gesprochene Wort »sisters« erkennen.
Die Geräuschverarbeitungssoftware in unserem Gehirn erkennt das gesprochene Wort mühelos, aber unsere Bildverarbeitungssoftware hat große Schwierigkeiten, es zu entziffern, wenn sie mit einer Wellenlinie konfrontiert wird, ganz gleich, wie sie dargestellt ist: auf Papier, auf einem Computerbildschirm oder in Form der Zahlen, aus denen diese Wellenlinie zusammengesetzt ist. Um sie zu entziffern, müssten wir die ganzen mathematischen Berechnungen mithilfe eines leistungsfähigen Computers durchführen, und auch das wäre eine schwierige Berechnung. Für unser Gehirn dagegen ist es ein Klacks, wenn ihm die gleichen Daten in Form von Schallwellen dargeboten werden. Diese Parabel soll meine Aussage verdeutlichen – sie ist Dreh- und Angelpunkt meiner Absicht, und deshalb sage ich es zweimal: Manche Teile eines Tieres sind ungeheuer viel schwieriger zu »lesen« als andere. Das Muster auf dem Rücken unserer Mojave-Eidechse war einfach: Es entsprach dem Hören von »sisters«. Die Vorfahren dieses Tieres haben offenbar in einer Steinwüste überlebt. Aber wir sollten auch nicht vor der schwierigen Lektüre zurückschrecken – beispielsweise von den chemischen Vorgängen in den Leberzellen. Sie könnten uns ebenso große Schwierigkeiten bereiten wie der Anblick der Wellenform von »sisters« auf dem Bildschirm eines Oszilloskops. Aber nichts spricht gegen die Hauptaussage: Die Information steckt darin, so schwierig sie auch zu entschlüsseln sein mag. Das genetische Totenbuch mag sich als ebenso undurchschaubar erweisen wie kretische Linearschrift A oder die Indusschrift. Aber die ganze Information ist nach meiner Überzeugung vorhanden.
Das Muster rechts ist ein QR-Code. Er enthält eine verborgene Nachricht, die unser menschliches Auge nicht lesen kann. Das Smartphone entziffert sie aber sofort und zeigt mir eine Zeile meines Lieblingsdichters. Das genetische Totenbuch ist ein Palimpsest aus Nachrichten über frühere Welten, das sich in Körper und Genom eines Tieres versteckt. Wie QR-Codes sind sie meist mit bloßem Auge nicht zu entziffern, aber die Zoologinnen der Zukunft werden mit hochentwickelten Computern und anderen Hilfsmitteln ihrer Zeit ausgerüstet sein und sie lesen können.
Um die zentrale Aussage noch einmal zu wiederholen: Wenn wir ein Tier untersuchen, können wir in manchen Fällen – einer davon ist die Krötenechse aus der Mojave-Wüste – sofort die konkrete Beschreibung ihrer früheren Umgebung ablesen, genau wie unser Hörsystem sofort das gesprochene Wort »sisters« versteht. In Kapitel 2 werden wir uns mit Tieren beschäftigen, bei denen die frühere Umwelt nahezu buchstäblich auf den Rücken gemalt ist. Meist müssen wir aber auf indirektere, schwierigere Methoden zurückgreifen, um sie auszulesen. In späteren Kapiteln tasten wir uns zu Wegen vor, auf denen das möglich ist. In den meisten Fällen sind die Methoden aber noch nicht weit genug entwickelt, insbesondere wenn es um das Lesen von Genomen geht. Ich verfolge unter anderem die Absicht, Mathematiker, Informatiker, Molekulargenetiker und andere, die besser qualifiziert sind als ich, zur Entwicklung solcher Methoden anzuregen.
Zunächst einmal muss ich im Zusammenhang mit dem englischen Originaltitel The Genetic Book of the Dead (»Das genetische Totenbuch«) fünf mögliche Missverständnisse ausräumen. Das erste ist die enttäuschende Eröffnung, dass ich die Aufgabe, das Totenbuch zu entziffern, zu einem großen Teil an die Wissenschaft der Zukunft delegiere. Daran kann ich nicht viel ändern. Zweitens besteht über den poetischen Widerhall hinaus kaum ein Zusammenhang mit den ägyptischen Totenbüchern. Diese waren Anweisungen, die zusammen mit Toten bestattet wurden und ihnen helfen sollten, den Weg zur Unsterblichkeit zu finden. Das Genom eines Tieres ist ein Handbuch, das ihm sagt, wie es sich in der Welt so zurechtfinden kann, dass das Handbuch selbst (aber nicht der Körper) in eine unbegrenzte Zukunft oder sogar in die tatsächliche Unsterblichkeit weitergegeben wird.
Drittens könnte mein Titel so missverstanden werden, als ginge es um das faszinierende Thema der vorzeitlichen DNA. Die DNA längst Verstorbener – nun, leider nicht sehr lange Verstorbener – steht uns in manchen Fällen und häufig in Form zusammenhangloser Fragmente zur Verfügung. Der schwedische Genetiker Svante Pääbo wurde mit dem Nobelpreis ausgezeichnet, weil er das Genom von Neandertalern und Denisova-Menschen, die man ansonsten nur in Form von Fossilien – im Fall der Denisova-Menschen nur aus drei Zähnen und fünf Knochenbruchstücken – kannte, wie ein Puzzle zusammengesetzt hat.[11] Nebenbei bemerkt, zeigen Pääbos Arbeiten, dass die Europäer, nicht aber die Afrikaner von südlich der Sahara, aus den seltenen Fällen einer Kreuzung mit Neandertalern hervorgegangen sind. Manche heutigen Menschen, insbesondere Melanesier, entstammen auch der Kreuzung mit Denisova-Menschen. Die Erforschung »alter DNA« ist heute ein blühendes Forschungsgebiet. Das Genom des Wollmammuts ist nahezu vollständig bekannt, und es besteht ernsthaft die Hoffnung, die Spezies wiederzubeleben. Andere mögliche »Wiederauferstehungen« könnten den Dodo, die Wandertaube, den Riesenalk und den Tasmanischen Beutelwolf betreffen.[12] Leider bleibt aber DNA in ausreichenden Mengen bestenfalls einige Tausend Jahre erhalten. Die alte DNA ist zwar interessant, sie gehört aber nicht zu den Themen dieses Buches.
Viertens werde ich mich nicht mit der Frage beschäftigen, welche Aufschlüsse der Vergleich von DNA-Sequenzen in verschiedenen Gruppen von Jetztmenschen auf die Geschichte und auf die Wanderungswellen der Menschen liefern, die über die Landflächen der Erde hinweggerollt sind. Faszinierenderweise überschneiden sich entsprechende genetische Studien mit Vergleichen zwischen Sprachen. So zeigt beispielsweise die Verteilung von Genen und Wörtern auf den Inseln von Mikronesien im Westpazifik einen mathematisch nachgewiesenen Zusammenhang zwischen den Entfernungen von Insel zu Insel und den Ähnlichkeiten der Wörter.[13] Wir können uns Auslegerkanus vorstellen, die über den offenen Pazifik schießen und sowohl mit Genen als auch mit Wörtern beladen sind! Aber das wäre ein Kapitel für ein anderes Buch. Sollte man es vielleicht Das egoistische Mem nennen?
Den Titel des vorliegenden Buches sollte man nicht so verstehen, als wäre die derzeitige Wissenschaft darauf vorbereitet, DNA-Sequenzen in Beschreibungen früherer Umgebungen zu übersetzen. Das kann niemand, und ob die WDZ jemals dazu in der Lage sein wird, ist nicht klar. Das Buch handelt vielmehr davon, wie man das Tier selbst liest, seinen Körper und sein Verhalten – den »Phänotyp«. Zwar stimmt es nach wie vor, dass die Beschreibungen aus der Vergangenheit durch DNA übermittelt werden. Aber vorerst lesen wir sie indirekt auf dem Weg über den Phänotyp. Der einfachste oder vielleicht einzige Weg, ein menschliches Genom in einen funktionierenden Körper zu übersetzen, besteht darin, dass es von einer ganz besonderen Dolmetschervorrichtung aufgenommen wird: einer Frau.
Die Spezies als Skulptur; die Spezies als mittelwertbildender Computer
Sir D’Arcy Thompson (1860–1948), ein ungeheuer gelehrter Zoologe, Altphilologe und Mathematiker, machte einmal eine Bemerkung, die sich zunächst banal und anhört und sogar zweimal das Gleiche zu besagen scheint, dann aber zum Denken anregt.[1] »Alles ist so, wie es ist, weil es so geworden ist.« Das Sonnensystem ist so und nicht anders, weil die Gesetze der Physik eine Gas- und Staubwolke zu einer rotierenden Scheibe gemacht haben, die dann kondensierte und die Sonne bildete, außerdem kreisende Himmelskörper, die alle in der gleichen Ebene und in der gleichen Richtung rotieren, womit sie die Ebene der ursprünglichen Scheibe kennzeichnen. Der Mond ist so, wie er ist, weil ein gigantisches Bombardement vor 4,5 Milliarden Jahren eine große Materiemenge von der Erde in eine Umlaufbahn schleuderte, wo sie dann von der Gravitation zu einer Kugel geformt und geknetet wurde. Die ursprüngliche Rotation des Mondes verlangsamte sich später durch ein Phänomen, das man »gebundene Rotation« nennt, und deshalb sehen wir ihn immer nur von einer Seite. Weitere kleinere Bombardements verunstalteten die Mondoberfläche mit Kratern. Die Erde hätte ebenfalls solche Pockennarben, würden sie nicht durch Erosion und tektonische Verwitterung abgetragen. Eine Skulptur ist so, wie sie ist, weil ein Block aus Carrara-Marmor der liebevollen Aufmerksamkeit Michelangelos teilhaftig wurde.
Warum ist unser Körper so und nicht anders? Zum Teil tragen wir wie der Mond die Narben äußerer Verletzungen – Schusswunden, Andenken an den Säbel eines Duellanten oder das Messer eines Chirurgen, sogar echte Krater durch Pocken oder Windpocken. Aber das sind oberflächliche Details. Vorwiegend ist ein Körper durch die Prozesse von Embryonalentwicklung und Wachstum so geworden. Und die wiederum wurden von der DNA in seinen Zellen gelenkt. Und wie wurde die DNA so, wie sie ist? Damit sind wir beim springenden Punkt. Das Genom jedes Individuums ist eine Stichprobe aus dem Genpool der Spezies. Der Genpool ist über viele Generationen so geworden, wie er ist – teilweise durch zufällige genetische Drift, vorwiegend aber durch einen Prozess der nicht zufälligen Bildhauerei. Der Bildhauer ist die natürliche Selektion: Sie formt und schnitzt den Genpool, bis er – und die Körper, die seine äußere, sichtbare Ausdrucksform sind – so und nicht anders ist.
Warum sage ich, dass der Genpool einer Spezies geformt wird und nicht das einzelne Genom? Weil das Genom eines Individuums sich anders als Michelangelos Marmor nicht verändert. Das einzelne Genom ist nicht das Gebilde, das der Bildhauer formt. Nachdem die Befruchtung stattgefunden hat, bleibt das Genom festgelegt, von der Zygote über die Embryonalentwicklung und die Kindheit bis zum Erwachsenen- und Greisenalter.[2] Nicht das Genom des Individuums, sondern der Genpool der Spezies verändert sich unter dem darwinistischen Meißel.[3] Als Bildhauerei kann man die Veränderung insofern bezeichnen, als dass die dabei entstehende Form eines Tieres in der Regel eine Verbesserung ist. Verbesserung muss nicht »Schönheit« bedeuten wie bei Rodin oder Praxiteles (auch wenn es oft so ist). Es bedeutet nur, dass das Tier besser überleben und sich fortpflanzen kann. Manche Individuen überleben und pflanzen sich fort. Andere sterben jung. Manche Individuen haben viele Partner oder Partnerinnen, andere haben keine. Manche haben keine Kinder, andere einen Schwarm von gesunden Nachkommen. Die sexuelle Rekombination sorgt dafür, dass der Genpool durchgerührt und durchgeschüttelt wird. Mutationen sorgen dafür, dass neue genetische Varianten in den vermischten Pool einfließen. Natürliche und sexuelle Selektion sorgen dafür, dass die Form des durchschnittlichen Genoms der Spezies sich in konstruktive Richtungen verändert, wenn Generation auf Generation folgt.
Wenn wir nicht gerade Populationsgenetiker sind, sehen wir die Verschiebungen des geformten Genpools nicht unmittelbar. Wir beobachten vielmehr Veränderungen im durchschnittlichen Körperbau und Verhalten der Mitglieder einer Spezies. Jedes Individuum wird durch die gemeinschaftliche Anstrengung einer Stichprobe von Genen aus dem derzeitigen Genpool aufgebaut. Der Genpool einer Spezies ist der sich ständig wandelnde Marmor, an dem die Meißel, die feinen, scharfen, höchst empfindsamen und tief vordringenden Meißel der natürlichen Selektion an die Arbeit gehen.
Ein Geologe sieht einen Berg oder ein Tal und »liest« darin, er rekonstruiert die Geschichte der Landschaft von der fernen Vergangenheit bis in die jüngste Zeit. Die natürliche Formung des Berges oder Tals beginnt vielleicht mit einem Vulkan oder einer tektonischen Subduktion einschließlich der Aufwärtsbewegung. Dann übernehmen die Meißel von Wind und Regen, Flüssen und Gletschern. Betrachtet eine Biologin die Geschichte eines Fossils, sieht sie keine Gene, sondern die Dinge, die wir mit der Ausstattung unserer Gene sehen können: fortschreitende Veränderungen des durchschnittlichen Phänotyps.[4] Aber das Gebilde, das von der natürlichen Selektion behauen wird, ist der Genpool der Spezies.
Die sexuelle Fortpflanzung verleiht der Spezies eine Sonderstellung, die andere Einheiten der taxonomischen Hierarchie – Gattung, Familie, Ordnung, Klasse und so weiter – nicht teilen. Warum? Weil die sexuelle Neukombination von Genen – das Mischen des Kartenspiels – nur innerhalb der Spezies stattfindet. Genau das ist die Definition von Spezies. Damit bin ich bei der zweiten Metapher im Titel dieses Abschnitts: der Spezies als mittelwertbildender Computer.
Das genetische Totenbuch ist eine Beschreibung der Welt, in der kein bestimmtes früheres Individuum eine größere Rolle spielt als ein anderes. Es ist eine Beschreibung der Umwelt, die den gesamten Genpool geformt hat. Jedes Individuum, das wir heute untersuchen, ist eine Stichprobe aus dem gemischten Kartenspiel, dem geschüttelten und gerührten Genpool. Und der Genpool war in jeder Generation das Ergebnis eines statistischen Prozesses, der den Durchschnitt aller individuellen Erfolge und Fehlschläge innerhalb der Spezies gebildet hat. Die Spezies ist ein mittelwertbildender Computer. Und der Genpool ist die Datenbank, die er verarbeitet.
2»Gemälde« und »Statuen«
WENN EIN TIER WIE DIE EIDECHSE aus der Mojave-Wüste die Heimat seiner Vorfahren gemalt auf dem Rücken trägt, versetzen uns unsere Augen sofort in die Lage, mühelos die Welten ihrer Vorfahren und die Gefahren, die sie überlebt haben, auszulesen. Hier sehen wir eine weitere gut getarnte Echse.[1] Ist sie auf dem Hintergrund der Baumrinde zu erkennen? Ja, denn das Foto wurde bei starkem Licht aus nächster Nähe aufgenommen. Damit gleichen wir einem Beutegreifer, der das Glück hat, unter idealen Sichtbedingungen über sein Opfer zu stolpern. Solche nahen Begegnungen haben den Selektionsdruck ausgeübt, durch den eine vollkommene Tarnung den letzten Schliff erhielt. Aber wie hat die Evolution der Tarnung angefangen? Zu einer Zeit, als nur eine Art geringe anfängliche Ähnlichkeit bestand, sorgten wandernde Beutegreifer, die träge aus den Augenwinkeln die Umgebung musterten oder bei schlechten Lichtverhältnissen auf die Jagd gingen, für den Selektionsdruck, durch den die Evolution in Richtung der Baumrinden-Mimikry begann. Die Zwischenstadien auf dem Weg zur vollkommenen Tarnung waren auf mittelgute Sichtverhältnisse angewiesen. Ein ununterbrochenes Spektrum der jeweiligen Bedingungen reichte von »aus der Ferne, bei schlechtem Licht, aus dem Augenwinkel oder ohne besondere Aufmerksamkeit gesehen« bis zu »aus der Nähe bei gutem Licht und genau von vorn gesehen«. Die Echse von heute trägt ein detailliertes, sehr genaues »Gemälde« der Baumrinde auf dem Rücken, und gemalt wurde es von Genen, die im Genpool überlebt haben, weil sie immer genauere Bilder erzeugen konnten.
Den Frosch müssen wir nur ansehen, dann können wir sofort »lesen«, dass es in der Umwelt seiner Vorfahren viele graue Flechten gab. Oder, in einer anderen Formulierung aus Kapitel 1: Die Gene des Frosches »wetten« auf Flechten. Ich benutze hier »wetten« und »lesen« nahezu im wörtlichen Sinn. Man braucht dazu keine raffinierten Methoden oder Apparate. Die Augen der Zoologin reichen aus. Und das hat den darwinistischen Grund, dass das Gemälde dazu dienen soll, die Augen eines Beutegreifers zu täuschen, die genauso funktionieren wie die Augen der Zoologin. Froschvorfahren überlebten, weil sie die räuberischen Augen, die den Augen der Zoologin – oder unseren, den Augen der lesenden Wirbeltiere – ähnelten, täuschen konnten.
In manchen Fällen sind nicht Beutetiere, sondern Beutegreifer von außen mit den Farben und Mustern aus der Welt ihrer Vorfahren bemalt, sodass sie sich an ihre Beute besser ungesehen anschleichen können. Tigergene wetten darauf, dass der Tiger in einer Welt geboren wird, in der senkrecht stehende Stämme Streifen von Licht und Schatten erzeugen. Die Zoologin, die den Körperbau eines Schneeleoparden untersucht, könnte darauf wetten, dass seine Vorfahren in einer gefleckten Welt aus Steinen und Felsen lebten, also vielleicht in einer Gebirgsregion. Und seine Gene platzieren für die Zukunft eine Wette auf die gleiche Umwelt als Tarnung für seine Nachkommen.
Nebenbei bemerkt: Die Säugetier-Beute der Großkatzen findet deren Tarnung vielleicht noch erstaunlicher als wir. Wir Menschenaffen und alle Altweltaffen sehen trichromatisch, das heißt, wir haben wie moderne Digitalkameras drei farbempfindliche Zelltypen in der Netzhaut. Die meisten anderen Säugetiere sind Dichromaten: Sie sind, wie wir es nennen würden, rot-grün-farbenblind. Das dürfte bedeuten, dass ein Tiger oder Schneeleopard für sie noch schwerer vom Hintergrund zu unterscheiden ist als für uns. Die natürliche Selektion hat die Streifen der Tiger und die Flecken der Schneeleoparden so »gestaltet«, dass die dichromatischen Augen ihrer typischen Beutetiere getäuscht werden. Und auch unsere trichromatischen täuschen sie noch recht gut.
Und noch eine Bemerkung: Ich finde es überraschend, dass ansonsten wunderschön getarnte Tiere sich durch einen todsicheren Hinweis verraten: durch die Symmetrie. Die Federn dieser Eule ahmen die Baumrinde wunderschön nach. Aber die Symmetrie verrät sie. Die Tarnung ist durchbrochen.
Mir bleibt nichts anderes übrig, als zu vermuten, dass es irgendwo in der Embryonalentwicklung eine tief liegende Einschränkung gibt, die es schwierig macht, aus der Links-Rechts-Symmetrie auszubrechen. Oder verschafft Symmetrie bei sozialen Begegnungen irgendeinen rätselhaften Vorteil? Schüchtert sie vielleicht Rivalen ein? Eulen können den Hals um einen weitaus größeren Winkel drehen als wir. Vielleicht lindert dies das Problem des symmetrischen Gesichts. Das Foto verlockt zu der Spekulation, die natürliche Selektion könne die Gewohnheit, ein Auge zu schließen, begünstigt haben, weil sich damit die Symmetrie abschwächt. Aber ich habe den Verdacht, dass dies eine übertriebene Hoffnung ist.
Ein wenig anders als die »Gemälde« sind die »Statuen«. Dabei ähnelt der ganze Körper eines Tieres einem bestimmten Gegenstand, der er nicht ist. Ein graubrauner Eulenschwalm oder ein Tagschläfer ähnelt dem Stumpf eines abgebrochenen Astes, eine stabförmige Raupe ist wie ein Zweig geformt, eine Heuschrecke ähnelt einem Stein oder einem trockenen Erdklumpen, eine Raupe ahmt die Exkremente eines Vogels nach: All das sind Beispiele für Tier-»Statuen«.
Zwischen einem »Gemälde« und einer »Statue« besteht der charakteristische Unterschied, dass das Gemälde im Gegensatz zur Statue in dem Augenblick nicht mehr täuscht, in dem das Tier aus seinem natürlichen Hintergrund entfernt wird. Wenn man einen »bemalten« Birkenspanner von der hellen Rinde wegnimmt, der er ähnelt, und ihn vor einen anderen Hintergrund setzt, wird er sofort von einem natürlichen Feind gesehen und gefangen. In dem Foto ist der Hintergrund ein rußgeschwärzter Baum in einem Industriegebiet, für den sich die dunkle, melaninhaltige Mutante derselben Schmetterlingsart, die vielleicht nicht sofort zu erkennen ist, hervorragend eignet.[2] Setzt man dagegen die von Anil Kumar Verma in Indien fotografierte, »verkleidete« Spannerraupe vor einen beliebigen Hintergrund, bestünde immer noch eine gute Chance, dass ein natürlicher Feind sie für einen Stock hält und übersieht. Das ist das Kennzeichen einer guten Tierstatue.
Eine Statue ähnelt zwar Gegenständen aus dem natürlichen Hintergrund, sie ist mit ihrer Wirkung aber im Gegensatz zu einem »Gemälde« nicht darauf angewiesen, dass man sie vor diesem Hintergrund sieht. Im Gegenteil: Dann ist sie unter Umständen in größerer Gefahr. Ein einzelnes stabförmiges Insekt auf einem Rasen wird vielleicht übersehen wie ein Stöckchen, das dort hingefallen ist. Ist das Stabinsekt dagegen von echten Stäben umgeben, wird es unter Umständen als seltsame Ausnahme wahrgenommen. Treibt der Große Fetzenfisch allein im Wasser, ist er unter Umständen durch seine Ähnlichkeit mit einem Stück Tang geschützt, jedenfalls mehr als sein Vetter, das Seepferdchen, das mit seiner Form in nichts dem Seetang ähnelt. Aber wäre diese Statue stärker gefährdet, wenn sie sich in einem wogenden Beet aus echtem Seetang versteckte? Das ist eine strittige Frage.
Wenn die Larven von Süßwassermuscheln der Spezies Lampsilis cardium heranwachsen, ernähren sie sich von Blut, das sie aus den Kiemen eines Fisches saugen. Dazu muss die Muschel einen Weg finden, um ihre Larven in den Fisch einzuschleusen. Das tut sie mithilfe einer »Statue«, die den Fisch täuscht.[3] Die Muschel besitzt am Rand ihres Mantels einen Brutbeutel für sehr junge Larven. Dieser Beutel ist ein eindrucksvolles Abbild zweier kleiner Fische einschließlich falscher Augen und falscher, sehr fischähnlicher »Schwimmbewegungen«. Echte Statuen bewegen sich nicht, deshalb ist das Wort »Statue« streng genommen nicht angebracht, aber das macht nichts; was ich sagen will, ist klar. Größere Fische schwimmen heran und versuchen, die Fischattrappe zu fangen. Dabei fangen sie in Wirklichkeit einen Schwarm Muschellarven – und das tut ihnen nicht gut.
Diese gut getarnte Schlange aus dem Iran trägt an ihrer Schwanzspitze eine Spinnenattrappe.[4] Auf einem Foto sieht sie vielleicht nicht ganz überzeugend aus. Die Schlange bewegt ihren Schwanz aber so, dass es verblüffend danach aussieht, als würde eine Spinne herumlaufen. Es ist wirklich realistisch, insbesondere wenn die Schlange selbst sich in ihrem Bau versteckt, sodass nur die Schwanzspitze zu sehen ist. Vögel stoßen auf die vermeintliche Spinne herab. Und das ist das Letzte, was sie tun. Es lohnt sich, darüber nachzudenken: Dass ein solches Kunststück sich durch natürliche Selektion entwickeln konnte, ist wirklich bemerkenswert. Wie könnten die Zwischenstadien ausgesehen haben? Wie kam der Evolutionsablauf in Gang? Meine Vermutung: Bevor die Schwanzspitze auch nur entfernt nach einer Spinne aussah, war schon ihr Wackeln ein wenig attraktiv, denn die Vögel fühlen sich von allen kleinen, beweglichen Gegenständen angezogen.
Sowohl »Gemälde« als auch »Statuen« sind leicht zu lesende Beschreibungen früherer Welten, der Umgebungen, in denen die Vorfahren überlebt haben. Die stäbchenförmige Raupe ist eine detaillierte Beschreibung früherer Zweige. Der Tagschläfer ist ein hervorragendes Modell längst vergessener Aststümpfe. Nur – eigentlich sind sie nicht vergessen. Der Tagschläfer ist die Erinnerung. Zweige früherer Zeiten haben ihr eigenes Abbild in den verkleideten Körper dieser Raupe eingeprägt. Der Sand der Zeit hat sein gesamtes Selbstporträt auf die Oberfläche dieser Spinne gemalt, sodass man sie nur schwer erkennt.
»Wo ist der Schnee von gestern?«[5] Die natürliche Selektion hat ihn im Winterkleid des Moorschneehuhns eingefroren. Der Plattschwanzgecko lässt uns – aber nicht ihn – an die toten Blätter denken, zwischen denen seine Vorfahren lebten. Er verkörpert die darwinistische »Erinnerung« an Generationen von Blättern, die herabgefallen sind, lange bevor Menschen nach Madagaskar kamen und sie sehen konnten, ja vermutlich sogar lange bevor es überhaupt irgendwo Menschen gab. Die grüne Laubheuschrecke hat keine Ahnung, dass sie die genetische Erinnerung an die grünen Moose und Farnwedel verkörpert, auf denen ihre Vorfahren herumspazierten. Wir dagegen erkennen auf den ersten Blick, dass es so ist. Das Gleiche gilt für den entzückenden kleinen Moosfrosch aus Vietnam.[6]
Nicht immer ahmen Statuen unbelebte Gegenstände wie Stöcke oder Kieselsteine, tote Blätter oder Aststummel von Bäumen nach. Manche tun auch so, als wären sie giftige oder ungenießbare Vorbilder, und dann sind sie eben gerade nicht unauffällig. Auf den ersten Blick könnte man glauben, es sei eine Wespe, und dann zögert man, danach zu greifen. In Wirklichkeit ist es nur eine harmlose Schwebfliege. Das verraten ihre Augen. Fliegen haben größere Komplexaugen als Wespen. Dieses Merkmal ist vermutlich in einer tieferen Schicht des Palimpsestes niedergelegt und lässt sich aus irgendeinem Grund nur schwer überschreiben. Auch der größte anatomische Unterschied zwischen Fliegen und Wespen – Fliegen haben nicht vier, sondern zwei Flügel (was der Ordnung ihren lateinischen Namen Diptera oder Zweiflügler verschafft hat) – ist vielleicht nur schwer zu überschreiben. Möglicherweise fällt dieser potenzielle Anhaltspunkt aber auch kaum auf. Welcher Fressfeind nimmt sich schon die Zeit, Flügel zu zählen?
Wespen, die Vorbilder für die Mimikry der Schwebfliegen, versuchen nicht, sich zu verstecken. Sie tragen das Gegenteil einer Tarnung. Ihr auffällig gestreifter Hinterleib schreit: »Vorsicht! Leg dich nicht mit mir an!« Die Schwebfliege schreit das Gleiche, aber bei ihr ist es eine Lüge. Sie hat keinen Stachel, und ein natürlicher Feind könnte sie gut fressen, wenn er es wagen würde, sie anzugreifen. Sie ist kein Gemälde, sondern eine Statue, denn ihre (falsche) Warnung hängt nicht vom Hintergrund ab. Aus unserer Sicht und im Zusammenhang dieses Buches können wir an ihren Streifen ablesen, dass es im ökologischen Umfeld ihrer Vorfahren gefährliche gelb-schwarz gestreifte Dinge gab, vor denen natürliche Feinde sich fürchteten. Die Streifen der Fliege sind ein Abbild früherer Wespenstreifen und wurden von der natürlichen Selektion auf ihren Hinterleib gemalt. Gelbe und schwarze Streifen auf einem Insekt signalisieren potenziellen Angreifern zuverlässig eine – echte oder falsche – Warnung vor üblen Folgen. Ein besonders augenfälliges Beispiel ist dieser Käfer.
Angenommen, wir würden auf das hier stoßen, wie es uns im Unterholz anstarrt: Würden wir zurückschrecken, weil wir es für eine Schlange halten? Es starrt nicht, und es ist auch keine Schlange. Vielmehr handelt es sich um die Puppe des SchmetterlingsDynastor darius, und Schmetterlingspuppen starren nicht. Als hübsches Abbild des vorderen Endes einer Schlange ist es dazu gedacht, Angst zu machen. Da spielt es auch keine Rolle, was man sich bei genauem rationalem Nachdenken ausrechnen kann: Es sieht nur auf einem Stückchen der Schmalseite nach einer gefährlichen Schlange aus. Aus einer gewissen Distanz – die immer noch so gering ist, dass man besorgt sein kann – wirkt auch eine Schlange so klein. Außerdem hat ein Vogel in seiner Panik keine Zeit, genauer nachzudenken. Ein aufgeregtes Quieken, und er ist auf und davon. Wer als Darwinist das genetische Totenbuch studiert und mehr Zeit für Gedanken hat, liest an der Raupe ab, dass die Welt ihrer Vorfahren von gefährlichen Schlangen bevölkert war. Manche Raupen führen mit ihrem Hinterende den gleichen Trick aus und bewegen sogar ihre Muskeln so, dass die Pseudoaugen sich zu schließen und zu öffnen scheinen. So etwas tun Schlangen zwar nicht, aber dass potenzielle Fressfeinde das wissen, ist nicht zu erwarten.
Schon Augen als solche flößen Angst ein. Deshalb tragen manche Motten auf den Flügeln große Augenflecken, die sie plötzlich zeigen, wenn sie von einem natürlichen Feind überrascht werden. Wer gute Gründe hat, sich vor Tigern oder anderen Angehörigen der Katzenfamilie zu fürchten, würde vielleicht auch beunruhigt zurückschrecken, wenn plötzlich diese südostasiatische »Eulenmotte« (Brahmaea certhia) auftaucht. Auch hier würde ein Tiger oder Leopard aus der Distanz – einer gefährlich kurzen Distanz – auf der Netzhaut ein ebenso großes Bild erzeugen wie die aus der Nähe betrachtete Motte. Nun gut, für unsere Augen sieht sie nicht gerade aus wie ein bestimmtes Mitglied der Katzenfamilie. Vieles spricht aber dafür, dass Tiere verschiedener Arten auf Attrappen ansprechen, die nur eine grobe Ähnlichkeit mit ihrem Vorbild haben – ein vertrautes Beispiel sind Vogelscheuchen, und es gibt auch viele experimentelle Belege. Lachmöwen reagieren auf das Modell eines Vogelkopfes am Ende eines Stocks, als wäre es eine vollständige, echte Möwe.[7] Und ein erschrockener Rückzug reicht schon aus, um die Motte zu retten.
Zu meinem Vergnügen habe ich erfahren, dass auch Augen, die auf das Hinterteil einer Kuh gemalt werden, Löwen sehr wirksam von der Verfolgung abhalten.[8] Nach dem von Jean de Brunhoff geschaffenen, liebenswerten, klugen Elefantenkönig könnten wir auch vom Babar-Effekt sprechen: Er gewann den Krieg gegen die Nashörner, indem er Elefanten Angst einflößende Augen auf das Hinterteil malte.[9]
Was um alles in der Welt ist das hier? Ein Drache? Ein Teufelspferd aus einem Albtraum? Die Antwort: Es ist die Raupe des australischen Schmetterlings Phylloides imperialis, auch pink underwing genannt. Im Ruhezustand der Raupe ist das auffällige Muster mit »Augen« und »Zähnen« nicht zu sehen, denn dann wird es von Hautfalten verdeckt. Wird das Tier aber bedroht, zieht es die Haut zurück und entblößt das Bild – und dann kann ich nur sagen: Wenn ich ein potenzieller natürlicher Feind wäre, würde ich nicht mehr lange bleiben.[10]
Das beängstigendste falsche Gesicht, das ich kenne? Da steht es unentschieden zwischen dem Tintenfisch links und dem Geier rechts. Die echten Augen des Tintenfisches sind über dem inneren Ende der »Augenbrauen« der auffälligen falschen Augen kaum zu sehen. Die echten Augen des Himalayageiers findet man, wenn man zuerst nach dem Schnabel und dann nach dem echten Kopf sucht. Die falschen Augen des Tintenfisches sollen vermutlich natürliche Feinde abschrecken.[11] Der Geier nutzt das falsche Gesicht offenbar, um andere Geier einzuschüchtern und sich damit einen Weg durch die Menge rund um einen Kadaver zu bahnen.[12]
Manche Schmetterlinge tragen auf der Flügelrückseite einen falschen Kopf.[13] Wie könnte das dem Insekt nutzen? Dazu wurden fünf Hypothesen vorgeschlagen. Am beliebtesten ist die Ablenkungshypothese: Vögel hacken mit dem Schnabel vielleicht auf den weniger verwundbaren falschen Kopf ein und verschonen den echten. Mir ist ein sechster Gedanke noch ein wenig lieber: Danach erwartet der natürliche Feind, dass der Schmetterling in der falschen Richtung abhebt. Warum ich das bevorzuge? Vielleicht weil ich an der Idee hänge, dass Tiere überleben, indem sie die Zukunft vorhersehen.
Unter allen Wegen, auf denen ein Totenbuch sich einem buchstäblichen Auslesen annähert, kommen Gemälde und Statuen, mit denen natürliche Feinde getäuscht werden sollen, einer unmittelbaren Beschreibung früherer Welten am nächsten. Auf einen Aspekt möchte ich dabei besonders hinweisen: auf die erstaunliche Genauigkeit und Detailtreue. Dieses Blattinsekt trägt sogar falsche Flecken. Die bereits erwähnte stäbchenförmige Raupe besitzt falsche Knospen.
Ich kann keinen Grund erkennen, warum die gleiche gewissenhafte Aufmerksamkeit für Details nicht auch für weniger offensichtliche Teile des Erscheinungsbildes gelten sollte. Nach meiner Überzeugung verbirgt sich die gleiche, bis ins Detail reichende Vollkommenheit auch in inneren Organen, in der Nervenverdrahtung von Verhaltensweisen, in der Biochemie der Zellen und anderen indirekten oder tief liegenden Ausdrucksformen. Dort wartet sie nur darauf, entdeckt und ausgegraben zu werden, sobald wir die dazu notwendigen Werkzeuge entwickeln. Warum sollte die natürliche Selektion ihre Umsicht gezielt auf das äußere Erscheinungsbild der Tiere richten? Innere Details, und zwar alle Details, sind für das Überleben nicht weniger entscheidend. Sie werden ebenso zu schriftlichen Beschreibungen früherer Welten, allerdings sind sie in einer weniger gut lesbaren Schrift geschrieben und schwieriger zu entziffern als die in diesem Kapitel beschriebenen, oberflächlichen Gemälde und Statuen. Warum Gemälde und Statuen für uns leichter zu lesen sind als die inneren Seiten des genetischen Totenbuches, liegt auf der Hand. Sie zielen auf Augen ab, und zwar insbesondere auf die Augen natürlicher Feinde. Und wie ich bereits betont habe, funktionieren die Augen solcher natürlicher Feinde – zumindest wenn es sich um Wirbeltiere handelt – genauso wie unsere. Da ist es kein Wunder, dass Tarnung und andere Formen von Gemälden und Skulpturen uns von allen Seiten im Totenbuch am stärksten beeindrucken.
Nach meiner Überzeugung wird sich herausstellen, dass die im Inneren begrabenen Beschreibungen früherer Welten die gleiche detaillierte Vollkommenheit aufweisen wie die Gemälde und Statuen, die von außen zu sehen sind. Warum sollte es anders sein? Die Beschreibungen werden nur geheimnisvoller und weniger augenscheinlich sein, und sie werden eine kompliziertere Entschlüsselung erfordern. Wie das gesprochene Wort »sisters« in Kapitel 1, das vom Ohr entschlüsselt wird, so sind auch die Gemälde und Statuen dieses Kapitels mühelos lesbare Seiten aus Totenbüchern. Aber genau wie die Wellenform von »sisters«, die in der sperrigen Form von Binärziffern dargestellt wird und am Ende doch der Analyse zugänglich ist, so wird man auch die nicht offensichtlichen, unter der Haut liegenden Details der Tiere und ihrer Gene entschlüsseln. Das Totenbuch wird bis in die kleinsten, tief im Inneren jeder Zelle verborgenen Details lesbar werden.
Das ist meine zentrale Aussage, und es lohnt sich, sie hier noch einmal zu wiederholen. Die fingerfertige Bildhauerei der natürlichen Selektion ist nicht nur am äußeren Erscheinungsbild von Tieren am Werk wie bei der stäbchenförmigen Raupe, der Eidechse, die auf Bäume klettert, einem blattförmigen Insekt oder einem Eulenschwalm, bei denen wir sie mit bloßem Auge beurteilen können. Die scharfen Meißel des darwinistischen Bildhauers dringen in alle inneren Winkel und Ecken eines Tieres vor, bis hinunter zum submikroskopischen Zellinneren und den schnellen chemischen Zahnrädern, die sich darin drehen. Durch die zusätzliche Schwierigkeit, tiefer vergrabene Einzelheiten zu erkennen, sollten wir uns nicht täuschen lassen. Wir haben allen Grund zu der Annahme, dass bemalte Echsen oder Schmetterlinge oder die Statuen von Tagschläfern und Raupen nur die äußeren, sichtbaren Spitzen riesiger, verborgener Eisberge sind. Wenn es darum ging, diese Erkenntnis in Worte zu fassen, war Darwin besonders eloquent.
Bildlich gesprochen könnte man sagen, dass natürliche Selektion täglich und stündlich auf der ganzen Welt noch die geringfügigste Variation genau im Blick hat und dabei die schlechten verwirft und alle guten erhält und zusammenfügt; so arbeitet sie lautlos und unmerklich, wann und wo immer sich die Gelegenheit bietet, an der Verbesserung jeglichen Lebewesens im Hinblick auf seine organischen wie unorganischen Lebensbedingungen. Von diesen langsamen, stetigen Veränderungen bemerken wir erst dann etwas, wenn der Zeiger der Zeit das Vergehen ganzer Epochen anzeigt, und da unser Blick in längst vergangene Perioden der Erdgeschichte so unvollkommen ist, sehen wir nur, dass die Lebensformen heute anders sind als früher.3
3In den Tiefen des Palimpsests
SCHÖN UND GUT: Ein Tier ist also Ausdruck der Umweltverhältnisse früherer Zeiten. Aber wie weit dringen wir in die Vergangenheit vor? Jedes Mal, wenn uns Schmerzen im unteren Rücken plagen, werden wir daran erinnert, dass unsere Vorfahren noch vor sechs Millionen Jahren auf allen vieren gingen.[1] Unser Wirbeltier-Rückgrat wurde über Hunderte von Jahrmillionen eines horizontalen Daseins aufgebaut, und die Funktion des Körpers hing davon ab – hing im buchstäblichen Sinn daran. Die Wirbelsäule des Menschen »sollte« nicht senkrecht stehen und legt nun verständlicherweise Protest ein. Auf unserem menschlichen Palimpsest steht dick »Vierbeiner« geschrieben, und dann wurde es ziemlich oberflächlich – und manchmal unter Schmerzen – mit einem neuen Text überschrieben: »Zweibeiner«. Ein Emporkömmling, der neuerdings aufrecht geht.
Die Haut der Krötenechse aus Kapitel 1 hat uns von einer früheren Wüstenwelt mit Sand und Steinen berichtet, aber diese Welt gab es vermutlich noch vor kurzer Zeit. Was können wir aus dem Palimpsest über frühere Umgebungen ablesen? Begeben wir uns zunächst einmal sehr weit in die Vergangenheit. Wie alle Wirbeltiere, so sind auch die Embryonen von Echsen mit Kiemenbögen ausgestattet, die vom urzeitlichen Leben im Wasser erzählen. Zufällig haben wir Fossilien, und die berichten davon, dass die wässrigen Texte aller landlebenden Wirbeltiere einschließlich der Echsen in die Zeit des Devon und dann bis zu den Anfängen des Lebens im Meer zurückreichen. Schon oft wurde folgende poetische Aussage formuliert – ich bringe sie mit dem legendären intellektuellen Krieger J.B.S. Haldane in Verbindung[2]: Unser salziges Blutplasma ist ein Überbleibsel aus den Meeren des Paläozoikums. In einem 1940 erschienenen Aufsatz mit dem Titel »Man as a Sea Beast« (»Der Mensch als Meerestier«) wies er darauf hin, dass unser Blutplasma in seiner chemischen Zusammensetzung dem Meerwasser ähnelt, aber stärker verdünnt ist. Er sieht darin ein Indiz – nach meiner widerstrebenden Ansicht kein sehr stichhaltiges Indiz (»widerstrebend«, weil mir die Idee gefällt) –, dass die Meere im Paläozoikum weniger Salz enthielten als heute:
Da das Meer ständig Salz aus den Flüssen aufnimmt und es nur gelegentlich in austrocknenden Lagunen ablagert, wird es von einem Erdzeitalter zum anderen immer salziger, und unser Plasma erzählt von einer Zeit, als es weniger als die Hälfte seines heutigen Salzgehaltes hatte.
Die Formulierung »erzählt von einer Zeit« ist ein großartiger Anklang an unser genetisches Totenbuch. Haldane fährt fort:
Wir verbringen unsere ersten neun Monate als Wassertiere, schweben in einem salzigen, flüssigen Medium und werden von ihm geschützt. Wir beginnen unser Leben als Salzwassertiere.
Wie plausibel Haldanes Vermutungen über den wechselnden Salzgehalt auch sein mögen, eines lässt sich nicht leugnen: Alles Leben begann im Meer. Die unterste Schicht des Palimpsests erzählt eine Geschichte vom Wasser. Nach einigen Hundert Millionen Jahren unternahmen Pflanzen und später verschiedene Tiere den wagemutigen Schritt auf das Land. Wenn wir Haldanes Phantasie folgen, können wir sagen: Sie erleichterten sich den Weg, indem sie ihr privates Meerwasser im Blut mitnahmen. Zu den Tiergruppen, die unabhängig voneinander den Schritt wagten, gehören Skorpione, Schnecken, Hundert- und Tausendfüßer, Spinnen, Landasseln und Landkrebse, Insekten (die später einen weiteren riesigen Sprung in die Luft unternahmen) und verschiedene Würmer, die sich aber bis heute nie weit von der Feuchtigkeit entfernen. Bei allen diesen Tieren steht »trockenes Land« im Palimpsest oberhalb der tieferen, auf das Meer verweisenden Schichten. Von besonderem Interesse für uns als Wirbeltiere sind die Fleischflosser, eine Gruppe von Fischen, die heute durch Lungenfische und Neunaugen repräsentiert werden: Sie krochen anfangs vermutlich aus dem Meer, weil sie anderswo nach Wasser suchten, aber am Ende ließen sie sich dauerhaft auf dem trockenen Land nieder, das in manchen Fällen wirklich sehr trocken war.[3] Dazwischen liegende Texte des Palimpsests erzählen von einem jugendlichen Leben im Wasser (man denke an die Kaulquappen), begleitet vom Übergang des ausgewachsenen Tieres auf das Land.
Das alles ist plausibel. Man konnte an Land durchaus sein Leben fristen. Die Sonne überschüttet die Landschaft und die Meeresoberfläche gleichermaßen mit Photonen. Energie war also da und konnte genutzt werden. Warum sollten Pflanzen sich ihrer nicht auf dem Weg über grüne Solarzellen, und dann die Tiere auf dem Weg über die Pflanzen bedienen? Man sollte nicht annehmen, dass ein mutiertes Individuum plötzlich genetisch vollständig für das Leben an Land ausgerüstet war. Wahrscheinlicher ist, dass Lebewesen mit unternehmungslustiger Einstellung die ersten unangenehmen Schritte vollzogen. Belohnt wurden sie vielleicht mit einer neuen Nahrungsquelle. Wir können uns vorstellen, wie sie lernten, zum Fangen und Greifen kurze Ausflüge aus dem Wasser zu unternehmen. Die genetische natürliche Selektion begünstigte dann Individuen, die den neuen Trick besonders gut beherrschten. Spätere Generationen lernten ihn immer besser und verbrachten immer weniger Zeit im Meer.
Ganz allgemein bezeichnet man das Phänomen, dass erlerntes Verhalten genetisch verinnerlicht wird, als Baldwin-Effekt.[4] Ich möchte hier nicht näher darauf eingehen, aber ich habe den Verdacht, dass er generell von großer Bedeutung für die Evolution wichtiger Neuerungen ist, vielleicht auch für die ersten Schritte, mit denen die Schwerkraft durch die Fähigkeit zum Fliegen überwunden wurde. Was die Quastenflosser angeht, die vor rund 400 Millionen Jahren in der Devonzeit das Wasser verließen, gibt es über den genauen Ablauf verschiedene Theorien. Besonders gefällt mir eine, die von dem amerikanischen Paläontologen AS Romer vorgeschlagen wurde. Durch immer wiederkehrende Dürre strandeten Fische in schrumpfenden Wasserlachen. Die natürliche Selektion begünstigte Individuen, die eine solche zum Austrocknen verurteilte Pfütze verlassen und über das trockene Land zu einer anderen kriechen konnten. Für diese Theorie spricht ein stichhaltiges Argument: Es gab ein ununterbrochenes Spektrum verschiedener Entfernungen zwischen den Pfützen. Zu Beginn des Evolutionsablaufes konnte ein Fisch sein Leben retten, indem er zu einer Nachbarpfütze kroch, wobei nur eine kurze Entfernung zu überwinden war. Später konnten die Fische auch weiter entfernte Pfützen erreichen. Evolutionsfortschritte müssen immer allmählich ablaufen. Damit ein Fisch die Atemluft nutzen kann, muss er sich physiologisch verändern. Wichtige Abwandlungen dieser Art ereignen sich nicht mit einem Schlag. Das wäre zu unwahrscheinlich. Vielmehr musste es einen Gradienten kleiner, schrittweise ablaufender Verbesserungen geben. Und ein Gradient verschiedener Entfernungen zwischen den Pfützen – manche ganz in der Nähe, manche ein Stück weiter entfernt – war genau das, was dafür gebraucht wurde. Das Prinzip wird uns in Kapitel 6 im Zusammenhang mit der erstaunlich schnellen Evolution der Buntbarsche im Victoriasee wieder begegnen. Leider zitierte Romer im Vorfeld seiner Theorie auch Belege, wonach das Devon besonders zu Trockenheit neigte. Als diese Indizien infrage gestellt wurden, litt auch die Anerkennung für Romers gesamte Theorie.[5] Das wäre nicht nötig gewesen.
Wie sich der Wechsel auf das trockene Land auch vollzogen hat, in jedem Fall waren tiefgreifende Umgestaltungen notwendig. Wasser ist wirklich eine ganz andere Umwelt als Luft und Land. Für Tiere war der Umzug aus dem Wasser von radikalen anatomischen und physiologischen Veränderungen begleitet. Die wässrigen Texte in der tiefsten Tiefe des Palimpsests mussten umfassend überschrieben werden. Umso erstaunlicher ist es, dass zahlreiche Tiergruppen später den umgekehrten Weg gingen, ihre hart erarbeiteten neuen Hilfsmittel in den Wind schlugen und ins Wasser zurückkehrten. Bei den Wirbellosen umfasst die Liste Schlammschnecken, Wasserspinnen und Wasserkäfer. Bei dem Wasser, das sie neu besiedelten, handelte es sich nicht mehr um das Meer, sondern um Süßwasser. Einige Rückkehrer aus der Gruppe der Wirbeltiere jedoch, insbesondere Wale (einschließlich der Delfine), Seekühe, Seeschlangen und Schildkröten, begaben sich geradewegs wieder in die salzige Meereswelt, die ihre Vorfahren unter solchen Mühen verlassen hatten.
Robben, Seelöwen, Walrosse und ihre Verwandten, aber auch die Galapagos-Meeresechsen, kehrten nur teilweise ins Meer zurück, nämlich zum Fressen. Sie verbringen immer noch viel Zeit an Land und paaren sich dort. Das Gleiche gilt für die Pinguine, deren stromlinienförmige Wendigkeit im Meer mit einer geradezu lachhaften Unbeholfenheit an Land erkauft wird. Man kann kein Alleskönner sein. Meeresschildkröten schleppen sich mühsam an Land, um ihre Eier abzulegen. Ansonsten sind sie völlig auf das Meer eingestellt.[6] Sobald die kleinen Schildkröten im Sand geschlüpft sind, verlieren sie keine Zeit und stürmen den Strand hinunter zum Meer. Viele andere Landwirbeltiere sind Teilzeit-Süßwasserbewohner, darunter Schlangen, Krokodile, Flusspferde, Otter, Spitzmäuse, Tenreks, Nagetiere wie Wühlmäuse und Biber, Desmane (eine Art Maulwürfe), Schwimmbeutler (eine Art Beutelratten) und Schnabeltiere. Sie alle verbringen viel Zeit an Land und begeben sich vorwiegend zum Fressen ins Wasser.
Eine Meeresschildkröte
Nun könnte man meinen, die Wasser-Rückkehrer würden die unteren Schichten des Palimpsests freilegen und die Konstruktionsmerkmale wiederentdecken, die ihren Vorfahren so gute Dienste geleistet haben. Warum haben Wale und Dugongs keine Kiemen? Ihre Embryonen besitzen wie die aller Tiere sogar die Anlagen dazu. Es scheint das Natürlichste auf der Welt zu sein, den alten Text zu entstauben und wieder in Gebrauch zu nehmen. Aber das geschieht nicht. Nachdem die Landtiere in ihrer Evolution unter solchen Schwierigkeiten die Lunge erworben haben, ist es fast so, als würde es ihnen widerstreben, sie wieder aufzugeben, obwohl Kiemen ihnen, wie man sich vielleicht vorstellen kann, bessere Dienste leisten würden. Mit Kiemen müssten sie nicht immer wieder zum Atmen an die Oberfläche kommen. Aber statt die Kiemen wiederzubeleben, hielten sie treu an der Lunge fest, und das sogar um den Preis tiefgreifender Abwandlungen im gesamten Atmungssystem, mit denen sie sich auf die Rückkehr ins Wasser einstellten.
In der Physiologie der Meeressäuger fanden so extreme Veränderungen statt, dass sie in manchen Fällen über eine Stunde unter Wasser bleiben können. Wenn Wale dann doch an die Oberfläche kommen, tauschen sie ein gewaltiges Luftvolumen sehr schnell mit einem dröhnenden Atemzug aus, bevor sie wieder untertauchen. Man ist versucht, mit dem Gedanken an eine allgemeine Regel zu spielen, wonach alte Texte aus tieferen Schichten des Palimpsests nicht wiederbelebt werden können. Ich kann allerdings nicht erkennen, warum das allgemein gelten sollte. Es muss einen aufschlussreicheren Grund geben. Nachdem die Mechanik der Embryonalentwicklung auf die Lunge zum Luftatmen umgestellt war, wäre der erneute Einsatz der Kiemen nach meiner Vermutung eine noch radikalere embryologische Umwälzung gewesen, und die zu bewerkstelligen, hätte größere Schwierigkeiten bereitet als das Umschreiben oberflächlicher Texte, mit denen die Ausstattung zum Luftatmen abgewandelt wurde.
Seeschlangen besitzen keine Kiemen, sondern beziehen den Sauerstoff mit einem außerordentlich stark durchbluteten Kopf aus dem Wasser. Auch sie haben also nicht die alte Lösung für das Problem wiederbelebt, sondern eine neue gefunden. Manche Schildkröten beziehen eine gewisse Sauerstoffmenge über die Kloake (die Abfallentsorgungs- und Genitalöffnung) aus dem Wasser, aber auch sie müssen an die Oberfläche kommen und Luft in die Lunge saugen.
Da Wale sich niemals vom stützenden Auftrieb des Wassers verabschiedet haben, stand es ihnen in der Evolution frei, sich von ihren landlebenden Vorfahren in unterschiedliche (wirklich unterschiedliche) Richtungen weg zu entwickeln. Der Blauwal ist vermutlich das größte Tier, das jemals gelebt hat. Stellersche Seekühe, ausgestorbene Verwandte der Dugongs und Rundschwanzseekühe, erreichten eine Länge von elf Metern und eine Masse von zehn Tonnen, womit sie größer waren als Zwergwale. Im 18. Jahrhundert, kurz nachdem Steller sie zum ersten Mal gesehen hatte, wurden sie durch die Jagd ausgerottet. Wie Wale, so atmeten auch Seekühe Luft, denn auch sie hatten es versäumt, etwas wiederzuentdecken, was den Kiemen ihrer entfernten Vorfahren entsprochen hätte. Aber aus den gerade erörterten Gründen trifft das Wort »versäumt« vielleicht nicht ganz zu.
Eine Stellersche Seekuh
Die Ichthyosaurier waren Reptilien und Zeitgenossen der Dinosaurier. Sie hatten Flossen, waren stromlinienförmig gebaut und besaßen einen kräftigen Schwanz, der ihre wichtigste Antriebsmaschine war: In dieser Hinsicht glichen sie den Delfinen, nur mit dem Unterschied, dass der Schwanz der Ichthyosaurier sich nicht von oben nach unten, sondern von rechts nach links bewegte. Die Vorfahren der Wale und Delfine hatten an Land bereits den Galopp der Säugetiere perfektioniert, und davon leitete sich ganz von selbst die Auf-und-Ab-Bewegung der Delfinfluke ab. Delfine »galoppieren« gewissermaßen durch das Wasser, während die Ichthyosaurier mehr nach der Art der Fische schwammen. Ansonsten sahen die Ichthyosaurier wie Delfine aus und lebten vermutlich auch ganz ähnlich. Sprangen sie ausgelassen durch die Luft – ein wunderbarer Gedanke – und schlugen dabei wie Delfine mit dem Schwanz (nur von rechts nach links)? Sie hatten große Augen, deshalb können wir vermuten, dass sie sich nicht wie die kleinäugigen Delfine des Sonars bedienten. Dass auch Ichthyosaurier im Meer lebende Junge zur Welt brachten, wissen wir von einer fossilen Vertreterin der Gruppe, die leider bei der Entbindung starb. Im Gegensatz zu Schildkröten, aber wie Delfine und Seekühe hatten sich die Ichthyosaurier völlig von ihrer landlebenden Vergangenheit gelöst. Das Gleiche gilt für die Plesiosaurier, denn auch bei ihnen gibt es Anhaltspunkte, dass sie lebende Junge zur Welt brachten. Angesichts der Tatsache, dass sich das Lebendgebären einer maßgeblichen Schätzung zufolge bei den landlebenden Reptilien mindestens hundertmal unabhängig voneinander entwickelt hat, erscheint es überraschend, dass Meeresschildkröten, die im Wasser schweben, aber an Land schmerzlich schwerfällig sind, sich immer noch auf den Sand bemühen und dort Eier ablegen. Und dass ihre Babys nach dem Schlüpfen gezwungen sind, den gefährlichen Weg hinunter zum Meer zu kriechen, wobei sie einem Spießrutenlauf mit Möwen, Fregattvögeln, Füchsen und sogar marodierenden Krebsen ausgesetzt sind.
Dieser Ichthyosaurier starb, als er ein Junges zur Welt brachte
Meeresschildkröten kehren an Land zurück, um ihre Eier in Löcher abzulegen, die sie in einen Sandstrand graben. Das ist für sie eine gewaltige Anstrengung, denn sie sind entsetzlich schlecht dazu ausgestattet, das Wasser zu verlassen. Robben, Seelöwen, Otter