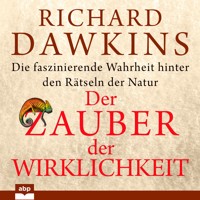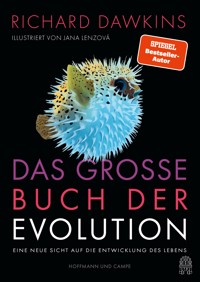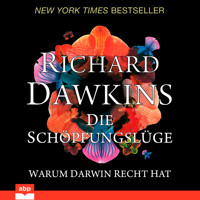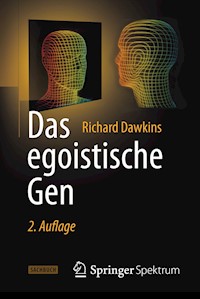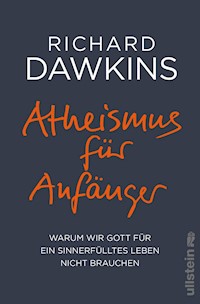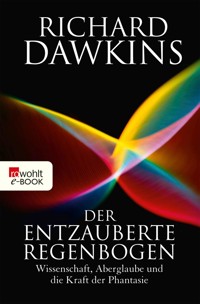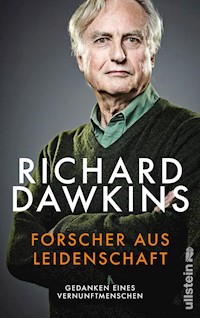
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
In unvernünftigen Zeiten ist Richard Dawkins' unnachgiebiges Plädoyer für die Vernunft aktueller und dringender denn je. Der Evolutionsbiologe und Bestsellerautor reflektiert in seinem neuen Buch über die Werte, die Geschichte und die gesellschaftliche Bedeutung von Wissenschaft. Dabei greift er Themen wie die Wissenschaft als Religion und die Schönheiten, Grausamkeiten, aber auch Kuriositäten unserer Welt auf. Von der Evolution der Schildkröte über Jesus und den Atheismus bis hin zu intelligenten Außerirdischen: Stets legt Dawkins komplexe Sachverhalte mit poetischer Leichtigkeit dar. Die in diesem Band versammelten Reden, Aufsätze und Briefe aus den letzten vier Jahrzehnten geben einen faszinierenden Einblick in das Werk eines überragenden Denkers.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Das Buch
In unvernünftigen Zeiten ist Richard Dawkins’ unnachgiebiges Plädoyer für die Vernunft aktueller und dringender denn je. Die in diesem Band versammelten Reden, Aufsätze und Briefe aus den letzten drei Jahrzehnten ermöglichen einen faszinierenden Einblick in das Werk eines überragenden Denkers. Von der Evolution über die Klimaveränderung und den Terrorismus bis hin zu intelligenten Außerirdischen – Dawkins argumentiert stets mit einer erzählerischen Leichtigkeit.
Der Autor
Richard Dawkins, 1941 geboren, ist Evolutionsbiologe. Von 1995 bis 2008 hatte er den Lehrstuhl für Public Understanding of Science an der Universität Oxford inne. Sein Buch Das egoistische Gen gilt als zentrales Werk der Evolutionsbiologie. Seine Streitschrift Der Gotteswahn ist ein Bestseller.
RICHARD DAWKINS
FORSCHER AUS LEIDENSCHAFT
GEDANKEN EINES VERNUNFTMENSCHEN
Herausgegeben von Gillian Somerscales
Aus dem Englischen von Sebastian Vogel
Ullstein
Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel
Sciene in the Soul. Selected Writings of a Passionate Rationalist
bei Penguin Random House, New York.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1838-7
© 2017 Richard Dawkins
© der deutschsprachigen Ausgabe
Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2018
Richard Dawkins, »Netzgewinn«. Aus: John Brockman (Hrsg.), Wie hat das Internet Ihr Denken verändert?Aus dem Amerikanischen von Jürgen Schröder. © S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2011
Lektorat: Susanne Warmuth, Darmstadt
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
In memoriam
Christopher Hitchens
Einleitung des Autors
Diese Zeilen schreibe ich zwei Tage nach einem atemberaubenden Besuch des Grand Canyons in Arizona. Für viele Völker der amerikanischen Ureinwohner ist der Grand Canyon ein heiliger Ort, Schauplatz zahlreicher Ursprungsmythen für Gruppen von den Havasupai bis zu den Zuni und heimliche Ruhestätte der Toten für die Hopi. Wenn man mich zwingen würde, mich für eine Religion zu entscheiden, so könnte ich mich mit einer solchen anfreunden. Der Grand Canyon verleiht der Religion Format. Er deklassiert die Kleinkariertheit der abrahamitischen Bekenntnisse, jener drei zänkischen Kulte, die aufgrund historischer Zufälle noch heute die Welt quälen.
In dunkler Nacht wanderte ich am Südrand des Canyons entlang, legte mich auf eine niedrige Mauer und blickte hinauf zur Milchstraße. Ich blickte in die Vergangenheit, wurde Zeuge einer Szene aus der Zeit vor hunderttausend Jahren – damals machte sich das Licht auf eine lange Reise, um schließlich in meine Pupillen einzutauchen und auf meinen Netzhäuten Funken zu schlagen. Im Morgengrauen des folgenden Tages kehrte ich noch einmal zu der Stelle zurück, schauderte schwindelnd, als mir klar wurde, wo ich in der Dunkelheit gelegen hatte, und sah hinunter zum Boden des Canyons. Wieder blickte ich in die Vergangenheit, zwei Milliarden Jahre in diesem Fall, zurück in eine Zeit, als nur Mikroorganismen blind unter der Milchstraße wimmelten. Wenn die Seelen der Hopi in diesem majestätischen Schweigen ruhten, leisteten ihnen die im Stein gefangenen Geister der Trilobiten und Schlangensterne Gesellschaft, ebenso die der Armfüßer und Belemniten, der Ammoniten und sogar der Dinosaurier.
Gab es im Verlauf der Evolution, die über fast zweitausend Meter in Schichten den Canyon hinaufzieht, irgendwo eine Stelle, von der man sagen könnte, dass dort eine »Seele« ins Dasein trat wie ein Licht, das plötzlich eingeschaltet wird? Oder schlich sich »die Seele« klammheimlich in die Welt: eine trübe Tausendstelseele in einem pulsierenden Röhrenwurm, eine Zehntelseele in einem Quastenflosser, eine halbe Seele in einem Koboldmaki, dann eine typisch menschliche Seele und schließlich eine Seele vom Format eines Beethoven oder Mandela? Oder ist es einfach töricht, überhaupt von Seelen zu sprechen?
Es ist nicht töricht, wenn man damit so etwas wie das überwältigende Gefühl einer subjektiven, persönlichen Identität meint. Dass wir sie besitzen, weiß jeder von uns, auch wenn viele moderne Denker beteuern, sie sei eine Illusion – eine Täuschung, die, so könnten Darwinisten spekulieren, ihre Entstehung einem kohärenten, nur einem einzigen Zweck, dem Überleben, dienenden System verdankt.
Optische Täuschungen wie der Necker-Würfel
oder Penrose’ unmögliches Dreieck
oder die Tiefenumkehr (englisch Hollow-Mask illusion) machen deutlich, dass die »Realität«, die wir sehen, aus eingeschränkten Modellen besteht, die im Gehirn konstruiert werden. Das zweidimensionale Linienmuster des Necker-Würfels auf dem Papier lässt sich mit zwei möglichen Konstruktionen eines dreidimensionalen Würfels vereinbaren, und diese Modelle macht sich das Gehirn abwechselnd zu eigen: Der Wechsel ist spürbar, und seine Häufigkeit kann man sogar messen. Die Linien des Penrose-Dreiecks auf dem Papier sind mit keinem realen Gegenstand zu vereinbaren. Solche Illusionen fordern die Modellbausoftware des Gehirns heraus und offenbaren so, dass sie existiert.
Auf die gleiche Weise konstruiert das Gehirn in seiner Software auch die nützliche Illusion einer persönlichen Identität, eines »Ichs«, das scheinbar unmittelbar hinter den Augen angesiedelt ist, eines »Handelnden«, der frei seine Entscheidungen trifft, einer einheitlichen Persönlichkeit, die nach Zielen strebt und Gefühle empfindet. Die Konstruktion der Persönlichkeit findet nach und nach in der frühen Kindheit statt, vielleicht indem Bruchstücke, die zuvor getrennt waren, zusammengefügt werden. Manche psychologischen Störungen werden als »gespaltene Persönlichkeit« interpretiert, als Fehler beim Vereinen von Fragmenten. Die Spekulation, dass sich beim allmählichen Heranwachsen des Bewusstseins im Kleinkind etwas Ähnliches abspielt wie im weit größeren Zeitmaßstab der Evolution, ist nicht unvernünftig. Könnte beispielsweise ein Fisch ansatzweise so viel bewusstes Ich-Gefühl besitzen wie ein menschlicher Säugling?
Über die Evolution der Seele können wir Spekulationen anstellen, allerdings nur dann, wenn wir mit dem Wort so etwas wie das innere, konstruierte Modell eines »Selbst« meinen. Ganz anders sieht die Sache aus, wenn wir unter »Seele« ein Gespenst verstehen, das den Tod des Körpers überlebt. Die persönliche Identität erwächst aus der materiellen Aktivität des Gehirns; wenn das Gehirn zerfällt, muss sie sich auflösen und in das Nichts der Zeit vor der Geburt zurückkehren. »Seele« und ähnliche Wörter werden aber auch in poetischen Bedeutungen gebraucht, und die mache ich mir schamlos zu eigen. In einem Essay, der in meiner früheren Anthologie A Devil’s Chaplain erschienen ist, pries ich mit solchen Worten den großen Lehrer F. W. Sanderson, der meine spätere Schule noch vor meiner Geburt geleitet hatte. Der stets gegenwärtigen Gefahr zum Trotz, missverstanden zu werden, schrieb ich über den »Geist« (spirit) und den »Geist« (ghost) des verstorbenen Sanderson:
Sein Geist lebte in Oundle weiter. Kenneth Fisher, sein unmittelbarer Nachfolger, leitete gerade eine Mitarbeiterkonferenz, da klopfte es zaghaft an der Tür, und ein kleiner Junge kam herein: »Bitte, Sir, unten am Fluss sind Trauerseeschwalben.« – »Das hier kann warten«, sagte Fisher entschieden zu den Versammelten. Er erhob sich, griff nach seinem Fernglas neben der Tür und radelte in Begleitung des kleinen Ornithologen davon. Und man kann sich nicht der Vorstellung erwehren, dass ihnen Sandersons Geist mit seinem gutmütigen, runzeligen Gesicht strahlend nachblickte.
Im weiteren Verlauf schrieb ich von Sandersons »Schatten«. Zuvor hatte ich eine andere Szene aus meiner eigenen Schulzeit geschildert: Ioan Thomas, ein höchst anregender Lehrer für Naturwissenschaften (der an die Schule gekommen war, weil er Sanderson bewunderte, obwohl er jung war und den alten Direktor nicht mehr kennengelernt haben konnte), brachte uns einmal eindringlich bei, wie wichtig es ist, Unwissen einzugestehen. Er stellte uns einem nach dem anderen eine Frage, auf die wir alle mit wüsten Vermutungen antworteten. Schließlich war unsere Neugier (»Sir! Sir!«) auf die wahre Antwort geweckt. Mr Thomas wartete dramatisch ab, bis es ruhig war, und sagte mit effektvollen Pausen nach jedem Wort: »Ich weiß es nicht! Ich … weiß … es … nicht!«
Wieder kicherte in der Ecke Sandersons väterlicher Schatten, und keiner von uns wird diese Schulstunde je vergessen. Entscheidend sind nicht die Tatsachen, sondern die Art, wie man sie entdeckt und über sie nachdenkt: Das ist Bildung im eigentlichen Sinn und etwas ganz anderes als die heutige bewertungsbesessene Prüfungskultur.
Bestand die Gefahr, dass Leser meines damaligen Essays die Formulierung, Sandersons »Geist« habe »weitergelebt«, missverstanden? Oder dass sein »Geist« strahle? Dass sein »Schatten« in der Ecke kicherte? Ich glaube nicht, obwohl es in der Welt weiß Gott (da haben wir’s schon wieder) genügend Leute gibt, die geradezu nach Missverstehen lechzen.
Nach meiner Überzeugung ist es höchste Zeit, dass der Literatur-Nobelpreis an einen Naturwissenschaftler verliehen wird. Der nächstliegende Präzedenzfall, das muss ich leider sagen, ist ein sehr schlechtes Beispiel: Henri Bergson, mehr Mystiker als wahrer Wissenschaftler, dessen vitalistischer élan vital von Julian Huxley mit einer satirischen Eisenbahn, die vom élan locomotif angetrieben wird, verspottet wurde. Aber im Ernst: Warum sollte nicht ein wahrer Wissenschaftler den Literaturpreis bekommen? Carl Sagan ist leider nicht mehr unter uns, um ihn in Empfang zu nehmen, aber wer würde abstreiten, dass seine Schriften von nobelpreiswürdiger literarischer Qualität sind und auf einer Stufe mit denen von großen Romanautoren, Historikern und Dichtern stehen? Was ist mit Loren Eiseley? Lewis Thomas? Peter Medawar? Stephen Jay Gould? Jacob Bronowski? D’Arcy Thompson?
Aber abgesehen von den Verdiensten einzelner Autoren, die wir benennen können: Ist nicht die Wissenschaft selbst ein würdiges Thema für die besten Autoren, und ist sie nicht mehr als in der Lage, Anregungen für große Literatur zu liefern? Und welche Eigenschaften es auch sein mögen, derentwegen die Wissenschaft so ist – die gleichen Eigenschaften, derentwegen auch große Dichtung und nobelpreisgekrönte Romane so sind: Haben wir hier nicht einen guten Ansatz, um die Bedeutung von »Seele« zu begreifen?
Ein anderes Wort, mit dem man literarische Wissenschaft im Stile Sagans beschreiben könnte, lautet »spirituell«. Allgemein herrscht die Vorstellung, Physiker würden sich häufiger selbst als religiös bezeichnen als Biologen. Dafür gibt es sogar statistische Belege von den Mitgliedern der Londoner Royal Society und der US-amerikanischen National Academy of Sciences. Die Erfahrung legt aber eine Vermutung nahe: Wenn man bei solchen Elitewissenschaftlern genauer nachfragt, so stellt man fest, dass selbst die zehn Prozent, die sich zu irgendeiner Form von Religiosität bekennen, in den meisten Fällen nicht an Übernatürliches glauben: Es gibt für sie keinen Gott, keinen Schöpfer, kein Streben nach einem Jenseits. Was sie besitzen – und das sagen sie bei genauem Nachfragen auch –, ist ein »spirituelles« Bewusstsein. Ihnen gefällt vielleicht die abgedroschene Phrase vom »ehrfurchtsvollen Staunen«, und wer wollte es ihnen vorwerfen? Sie zitieren vielleicht – wie auch ich in diesem Buch – den indischen Astrophysiker Subrahmanyan Chandrasekhar, der »vor dem Schönen schauderte«, oder den amerikanischen Physiker John Archibald Wheeler:
Hinter alledem steht sicher eine so einfache, so schöne Idee, dass wir dann, wenn wir sie begreifen – in einem Jahrzehnt, einem Jahrhundert oder einem Jahrtausend –, alle zueinander sagen werden: »Wie könnte es anders sein? Wie konnten wir so blind sein?«
Einstein selbst erklärte sehr deutlich, dass er zwar spirituell sei, aber in keiner Form an einen persönlichen Gott glaube.
Was Sie über meine religiösen Überzeugungen lesen, ist natürlich eine Lüge, und zwar eine, die systematisch wiederholt wird. Ich glaube nicht an einen persönlichen Gott und habe das auch nie verhehlt, sondern immer klar zum Ausdruck gebracht. Wenn in mir etwas ist, das man als religiös bezeichnen kann, so ist es die grenzenlose Bewunderung für den Aufbau der Welt, soweit unsere Wissenschaft ihn offenbaren kann.
Und bei einer anderen Gelegenheit:
Ich bin ein tiefreligiöser Ungläubiger. Das ist eine irgendwie neue Art von Religion.
Ich selbst würde es zwar nicht genauso formulieren, aber in diesem Sinn eines »tiefreligiösen Ungläubigen« halte auch ich mich für einen »spirituellen« Menschen, und in diesem Sinn verwende ich die »Seele« im Titel dieses Buches, ohne mich dafür zu entschuldigen.
Wissenschaft ist wunderbar und notwendig. Wunderbar für die Seele – beispielsweise wenn man sich am Rand des Grand Canyons in den fernen Weltraum und ferne Zeiten versenkt. Aber sie ist auch notwendig: für die Gesellschaft, für unser Wohlergehen, für unsere kurz- und langfristige Zukunft. Beide Aspekte sind in dieser Anthologie vertreten.
Ich habe während meines gesamten Erwachsenenlebens Wissenschaft gelehrt, und die meisten hier gesammelten Essays stammen aus den Jahren, in denen ich die erste Charles-Simonyi-Professur für die Förderung des Wissenschaftsverständnisses in der Öffentlichkeit innehatte. Wenn ich mich für Wissenschaft einsetze, vertrete ich schon seit Langem die Carl-Sagan-Denkschule, wie ich sie nenne: die visionäre, poetische Seite der Wissenschaft – Wissenschaft zur Anregung der Fantasie im Gegensatz zur »Teflonpfannen-Denkschule«. Mit Letzterer meine ich die Neigung, beispielsweise den Aufwand für die Weltraumforschung mit dem Hinweis auf Nebenprodukte wie die teflonbeschichtete Bratpfanne zu rechtfertigen – eine Neigung, die ich mit dem Versuch verglichen habe, Musik als gute Übung für den rechten Arm des Geigers zu rechtfertigen. Das ist billig und abwertend, und vermutlich könnte man meiner satirischen Beschreibung vorwerfen, dass sie die Billigkeit übertreibt. Dennoch benutze ich sie weiterhin, um meine Vorliebe für die Romantik der Wissenschaft zum Ausdruck zu bringen. Zur Rechtfertigung der Weltraumforschung würde ich mich eher auf das berufen, was von Arthur C. Clarke gerühmt und von John Wyndham als »Drang nach draußen« bezeichnet wurde: die moderne Version des Dranges, der Magellan, Columbus und Vasco da Gama dazu trieb, sich ins Unbekannte aufzumachen. Aber ja, die »teflonbeschichtete Bratpfanne« ist eine unfaire Herabwürdigung der Denkschule, die ich mit dieser Kurzbezeichnung belege, und ich werde mich jetzt dem ernsten, praktischen Wert der Wissenschaft in unserer Gesellschaft zuwenden, denn von ihm handeln viele Aufsätze in diesem Buch. Wissenschaft ist für das Leben wirklich wichtig – und mit »Wissenschaft« meine ich nicht die schlichten wissenschaftlichen Tatsachen, sondern die wissenschaftliche Denkweise.
Diese Zeilen schreibe ich im November 2016, einem düsteren Monat in einem düsteren Jahr, in dem sich einem die Formulierung »Barbaren vor den Toren« ohne jede Ironie aufdrängt. Treffender noch wäre »innerhalb der Tore«, denn die Katastrophen, von denen die beiden bevölkerungsreichsten Völker der englischsprachigen Welt 2016 betroffen waren, sind hausgemacht: Es sind Wunden, die nicht durch ein Erdbeben oder einen militärischen Staatsstreich geschlagen wurden, sondern durch den demokratischen Prozess selbst. Mehr denn je ist es notwendig, dass die Vernunft in den Mittelpunkt rückt.
Gefühle abzuwerten liegt mir fern – ich liebe Musik, Literatur, Dichtung und die geistige wie auch körperliche Wärme menschlicher Zuneigung. Aber Gefühle sollten ihren Platz kennen. Politische Entscheidungen, Entscheidungen des Staates, zukünftige Vorgehensweisen sollten aus der klarsichtigen, rationalen Abwägung aller Möglichkeiten erwachsen, aller Belege, die für sie von Bedeutung sind, und ihrer voraussichtlichen Folgen. Bauchgefühle sollten selbst dann, wenn sie nicht aus den aufgewühlten dunklen Untiefen von Fremdenfeindlichkeit, Frauenfeindlichkeit oder anderen blinden Vorurteilen aufsteigen, aus der Wahlkabine verbannt werden. Lange waren solche trüben Emotionen weitgehend unter der Oberfläche geblieben. Aber im Jahr 2016 brachten politische Feldzüge auf beiden Seiten des Atlantiks sie ans Licht und machten sie vielleicht nicht respektabel, aber zumindest konnte man sie ungehindert äußern. Demagogen wurden zum Vorbild und erklärten Vorurteile, die man ein halbes Jahrhundert verschämt in heimliche Winkel verbannt hatte, für salonfähig.
Welches auch die innersten Gefühle einzelner Wissenschaftler sein mögen, Wissenschaft selbst funktioniert durch strenges Festhalten an objektiven Werten. Es gibt in der Welt eine objektive Wahrheit, und unsere Aufgabe ist es, sie zu finden. Wissenschaft verfügt über festgelegte Vorsichtsmaßnahmen gegen persönliche Voreingenommenheiten, Bestätigungsfehler, vorzeitige Urteile über Fragen, bevor man die Fakten kennt. Experimente werden wiederholt, Doppelblindversuche schließen das verzeihliche Bestreben von Wissenschaftlern aus, recht behalten zu wollen – aber auch die lobenswerten Bemühungen, möglichst viele Gelegenheiten zur Widerlegung zu schaffen. Ein Experiment, das in New York angestellt wurde, kann man in einem Labor in Neu-Delhi wiederholen, und wir rechnen damit, dass man ungeachtet der geografischen Lage und unabhängig von den kulturellen oder historischen Voreingenommenheiten der Wissenschaftler zu dem gleichen Ergebnis gelangt. Könnte man doch nur über andere akademische Fachgebiete wie die Theologie das Gleiche sagen! Philosophen sprechen fröhlich von der »kontinentalen Philosophie« im Gegensatz zur »analytischen Philosophie«. An amerikanischen oder britischen Universitäten bemühen sich die philosophischen Fakultäten unter Umständen um eine Neuberufung, um »die kontinentale Tradition fortzuführen«. Kann man sich ein naturwissenschaftliches Institut vorstellen, das in einer Stellenanzeige einen neuen Professor sucht, der die »kontinentale Chemie« fortführen soll? Oder »die östliche Tradition in der Biologie«? Schon die Idee ist ein schlechter Witz. Dies sagt etwas über die Werte der Wissenschaft aus und ist nicht nett gegenüber den Werten der Philosophie.
Nachdem ich also von der Romantik der Wissenschaft und dem »Drang nach draußen« ausgegangen bin, habe ich mich nun den Werten der Wissenschaft und der wissenschaftlichen Denkweise zugewandt. Manch einer hält es vielleicht für seltsam, dass ich die Nützlichkeit wissenschaftlicher Kenntnisse völlig hintanstelle, aber in dieser Reihenfolge spiegeln sich meine persönlichen Prioritäten wider. Natürlich sind medizinische Wohltaten wie Impfung, Antibiotika und Anästhesie ungeheuer wichtig, und sie sind auch so bekannt, dass ich sie hier nicht noch einmal durchkauen muss. Das Gleiche gilt für den Klimawandel (düsteren Warnungen zufolge könnte es schon zu spät sein) und für die darwinistische Evolution der Antibiotikaresistenz. Ich möchte hier aber auf eine weitere Warnung aufmerksam machen, die weniger unmittelbar und weniger bekannt ist. Sie fügt sich nahtlos an die drei Themen des Dranges nach draußen, der wissenschaftlichen Nützlichkeit und der wissenschaftlichen Denkweise an. Ich meine damit die unausweichliche, wenn auch nicht zwangsläufig unmittelbar bevorstehende Gefahr einer katastrophalen Kollision mit einem großen Objekt aus dem Weltraum, höchstwahrscheinlich einem, das unter dem Gravitationseinfluss des Jupiter aus dem Asteroidengürtel abgelenkt wurde.
Die Dinosaurier wurden – mit der bemerkenswerten Ausnahme der Vögel – durch einen massiven Einschlag aus dem Weltraum ausgelöscht, einen Einschlag, wie er sich früher oder später erneut ereignen wird. Stichhaltigen indirekten Indizien zufolge schlug ein großer Meteorit oder Komet vor rund 66 Millionen Jahren auf der Halbinsel Yucatán ein. Mit seiner Masse (so groß wie ein stattlicher Berg) und seiner Geschwindigkeit (vielleicht 70.000 Stundenkilometer) setzte das Objekt beim Einschlag eine Energie frei, die plausiblen Schätzungen zufolge mehreren Milliarden gleichzeitig explodierender Hiroshima-Bomben entsprach. Auf die sengenden Temperaturen und die gewaltige Druckwelle des ersten Einschlags folgte ein langer »nuklearer Winter«, der vielleicht zehn Jahre dauerte. Zusammen töteten diese Ereignisse alle Dinosaurier, die keine Vögel waren, außerdem Pterosaurier, Ichthyosaurier, Plesiosaurier, Ammoniten, die meisten Fische und viele andere Lebewesen. Zu unserem Glück überlebten einige Säugetiere, die vielleicht geschützt waren, weil sie in ihrer Version von unterirdischen Bunkern ausharrten.
Eine Katastrophe gleichen Ausmaßes wird auch wieder drohen. Wann, weiß niemand, denn die Einschläge sind Zufallsereignisse. Sie werden in keiner Hinsicht wahrscheinlicher, wenn der zeitliche Abstand zwischen ihnen wächst. Es könnte zu unseren Lebzeiten geschehen, aber das ist unwahrscheinlich, denn der durchschnittliche Zeitraum zwischen solchen riesigen Einschlägen liegt in der Größenordnung von hundert Millionen Jahren. Kleinere, aber immer noch gefährliche Asteroiden, die aufgrund ihrer Größe eine Stadt wie Hiroshima zerstören können, treffen die Erde ungefähr alle ein- bis zweihundert Jahre. Dass wir uns deshalb nicht beunruhigen, liegt daran, dass die Oberfläche unseres Planeten zum größten Teil unbewohnt ist. Und natürlich gilt auch hier, dass sie nicht regelmäßig einschlagen; wir können also nicht auf den Kalender blicken und sagen: »Jetzt ist aber wieder einer fällig.«
Für Beratung und Informationen zu solchen Themen bin ich dem berühmten Astronauten Rusty Schweickart zu Dank verpflichtet. Er ist zum hochkarätigsten Vertreter der Ansicht geworden, man solle das Risiko ernst nehmen und sich bemühen, etwas dagegen zu tun. Was können wir dagegen tun? Was hätten die Dinosaurier tun können, wenn sie Teleskope, Ingenieure und Mathematiker gehabt hätten?
Die erste Aufgabe besteht darin, ein näher kommendes Geschoss zu erkennen. »Näher kommen« vermittelt einen falschen Eindruck vom Wesen des Problems. Es handelt sich hier nicht um Kanonenkugeln, die geradewegs auf uns zukommen und sichtbar werden, wenn sie herannahen. Die Erde und das Geschoss kreisen auf elliptischen Bahnen um die Sonne. Wenn wir einen Asteroiden entdeckt haben, müssen wir seine Umlaufbahn vermessen – was wir mit umso größerer Genauigkeit tun können, je mehr Messwerte wir berücksichtigen – und dann berechnen, ob der Asteroid während eines zukünftigen Umlaufs zu irgendeinem Zeitpunkt – der vielleicht Jahrzehnte in der Zukunft liegt – mit unserer eigenen Umlaufbahn zusammentreffen wird. Nachdem man einen Asteroiden entdeckt und seine Umlaufbahn genau aufgezeichnet hat, ist der Rest nur noch Mathematik.
Das pockennarbige Gesicht des Mondes bietet ein beunruhigendes Bild der Verheerungen, die uns wegen der schützenden Erdatmosphäre erspart geblieben sind. An der statistischen Verteilung von Mondkratern mit unterschiedlichem Durchmesser können wir ablesen, was dort draußen vor sich geht; sie stellen quasi eine Grundlinie dar, an der wir den mageren Erfolg unserer eigenen Versuche, Geschosse im Vorhinein ausfindig zu machen, abgleichen können.
Je größer ein Asteroid ist, desto leichter kann man ihn erkennen. Da kleine Himmelskörper – darunter auch solche, die ganze Städte zerstören können – schwer vorab auszumachen sind, ist es durchaus möglich, dass uns nur eine sehr kurze oder gar keine Vorwarnzeit bleibt. Wir müssen unsere Fähigkeit verbessern, Asteroiden zu erkennen. Und das bedeutet, dass wir eine größere Zahl von Weitwinkel-Überwachungsteleskopen brauchen, die Ausschau nach ihnen halten, darunter auch Infrarotteleskope, die sich in Umlaufbahnen außerhalb der Reichweite der von der Erdatmosphäre verursachten Verzerrungen befinden.
Angenommen, wir haben einen gefährlichen Asteroiden identifiziert, dessen Umlaufbahn die unsere irgendwann zu kreuzen droht: Was tun wir dann? Wir müssen seine Umlaufbahn verändern – entweder indem wir ihn so beschleunigen, dass er in eine größere Umlaufbahn übergeht, später an dem Überschneidungspunkt ankommt und eine Kollision vermeidet, oder wir verlangsamen ihn so, dass sich seine Umlaufbahn verkleinert und er zu früh kommt. Erstaunlicherweise reicht für beide Maßnahmen schon eine sehr geringfügige Geschwindigkeitsveränderung aus: Sie muss nicht größer als 45 Meter in der Stunde sein. Auch ohne zu starken Explosionen zu greifen, können wir dies mit der vorhandenen – wenn auch teuren – Technik erreichen, einer Technik nicht unähnlich der spektakulären Leistung der Europäischen Raumfahrtagentur, die im Rahmen ihrer Rosetta-Mission eine Raumsonde auf einem Kometen landen ließ, nachdem diese zwölf Jahre zuvor, im Jahr 2004, gestartet war. Wird hier nicht deutlich, was ich meinte, als ich davon sprach, den »Drang nach draußen« der Fantasie mit den nüchtern-praktischen Themen einer nützlichen Wissenschaft und der Strenge des wissenschaftlichen Denkens in Einklang zu bringen? Darüber hinaus macht dieses Beispiel einen anderen Aspekt der wissenschaftlichen Denkweise deutlich, einen weiteren Vorteil dessen, was wir als Seele der Wissenschaft bezeichnen können. Wer außer einem Wissenschaftler könnte exakt den Zeitpunkt einer weltweiten Katastrophe voraussagen, die hunderttausend Jahre in der Zukunft liegt, und dann einen sehr präzisen Plan vorlegen, um sie zu verhindern?
Obwohl die Essays in diesem Buch über einen sehr langen Zeitraum verfasst wurden, finde ich nur wenig, was ich heute ändern würde. Ich hätte alle Hinweise auf das ursprüngliche Erscheinungsdatum tilgen können, aber ich habe mich entschlossen, das nicht zu tun. In einigen Fällen handelt es sich um große Reden, die ich bei bestimmten Gelegenheiten gehalten habe, beispielsweise bei einer Ausstellungseröffnung oder als Nachruf auf einen verstorbenen Menschen. Ich habe sie unverändert gelassen, wie sie ursprünglich gehalten wurden. Sie haben immer noch ihre innere Unmittelbarkeit, und die wäre verloren gegangen, hätte ich alle Anspielungen auf die jeweilige Zeit gestrichen. Bei Aktualisierungen habe ich mich auf Anmerkungen und Nachworte beschränkt – kurze Ergänzungen und Reflexionen, die man vielleicht parallel zum Haupttext als Dialog zwischen meinem heutigen Ich und dem Autor des ursprünglichen Artikels lesen kann.
Zusammen mit Gillian Somerscales habe ich aus meinen Essays, Vorträgen und journalistischen Schriften 41 Beispiele ausgewählt und in acht Abschnitten gruppiert. Neben der Wissenschaft selbst enthalten sie meine Überlegungen über den Wert der Wissenschaft, die Geschichte der Wissenschaft und die Rolle der Wissenschaft in der Gesellschaft; außerdem gibt es ein wenig Polemik, einen kleinen, sanften Blick in die Kristallkugel, etwas Satire und Humor und auch persönliche Traurigkeit, mit der ich hoffentlich kurz vor dem Punkt der Selbstgefälligkeit aufhöre. Jeder Abschnitt beginnt mit einer feinfühligen Einleitung aus Gillians Feder. Dass ich dazu noch etwas hinzufüge, wäre überflüssig, aber wie bereits erwähnt, habe ich meine eigenen Anmerkungen und Nachworte ergänzt.
Gegenüber Gillian empfinde ich grenzenlose Dankbarkeit. Außerdem danke ich Susanna Wadeson von Transworld und Hilary Redmon von Penguin Random House USA für ihren begeisterten Glauben an das Projekt und ihre nützlichen Vorschläge. Miranda Hales Internetkenntnisse halfen Gillian, vergessene Essays ausfindig zu machen. Es liegt in der Natur einer Anthologie, deren Beiträge viele Jahre überspannen, dass die Schuld der Dankbarkeit die gleichen Jahre überspannt. Sie wurde in den Originalartikeln zum Ausdruck gebracht, und man wird hoffentlich verstehen, dass ich sie hier nicht alle wiederholen kann. Das Gleiche gilt für die bibliografischen Angaben zu den Zitaten. Wer sich dafür interessiert, kann sie in den Originalartikeln nachschlagen, zu denen sich in der Liste am Ende des Buches alle Details finden.
Einleitung der Herausgeberin
Richard Dawkins hat sich stets dem Kategoriendenken entzogen. Als ein bedeutender, mathematisch orientierter Biologe The Selfish Gene (dt. Das egoistische Gen) und The Extended Phenotype (dt. Der erweiterte Phänotyp) rezensierte, fand er zu seiner Verblüffung wissenschaftliche Arbeiten vor, die offensichtlich frei von logischen Fehlern waren und doch keine einzige Zeile Mathematik enthielten; damit konnte er nur zu einer einzigen Schlussfolgerung gelangen, auch wenn es ihm unbegreiflich erschien: Dawkins dachte offensichtlich in Prosa.
Dass er in Prosa denkt, ist ein Glück. Hätte er nicht in Prosa gedacht – in Prosa gelehrt, in Prosa sinniert, in Prosa gestaunt, in Prosa argumentiert –, wir besäßen nicht das beglückend breite Spektrum von Arbeiten dieses vielseitigsten aller Wissenschaftsvermittler. Das gilt nicht nur für seine dreizehn Bücher, auf deren Qualitäten ich hier nicht noch einmal hinweisen muss, sondern auch für die atemberaubende Fülle seiner kleineren Schriften auf vielen Plattformen – in Tageszeitungen und Wissenschaftsjournalen, in Hörsälen und Onlineforen, in Streitschriften, Periodika, Rezensionen und Retrospektiven –, aus denen wir gemeinsam die vorliegende Sammlung herausdestilliert haben. Sie enthält neben vielen aktuellen Arbeiten auch einige ältere Klassiker, die sich in den reichhaltigen Schätzen aus der Zeit vor und nach seiner ersten Anthologie A Devil’s Chaplain fanden.
Angesichts seines Rufes als streitbarer Mensch erscheint es mir umso wichtiger, gebührende Aufmerksamkeit auf Richard Dawkins’ Wirken als Hersteller von Verbindungen zu lenken, als unermüdlicher Erbauer von Wortbrücken über die Kluft zwischen wissenschaftlichem Diskurs und einem breiten Spektrum öffentlicher Debatten. Ich halte ihn für einen Elite-Gleichmacher: Er will komplexe Wissenschaft nicht nur zugänglich, sondern begreiflich machen, und das ohne »verdummende Vereinfachung«. Immer besteht er auf Klarheit und Richtigkeit, und dabei dient ihm die Sprache als Präzisionswerkzeug, als chirurgisches Instrument.
Wenn er Sprache als Stoßdegen und manchmal sogar als Keule benutzt, dann um die Luft aus Vernebelung und Anmaßung zu lassen, um Ablenkung und Konfusion aus dem Weg zu räumen. Schwindel – ob er nun als falscher Glaube, falsche Wissenschaft, falsche Politik oder falsches Gefühl daherkommt – ist ihm ein Gräuel. Als ich die Artikel, die als Kandidaten für dieses Buch infrage kamen, immer und immer wieder las, dachte ich mir eine Gruppe aus, die man »Pfeile« nennen könnte: kurze, pointierte Texte, manche lustig, manche voll glühendem Zorn, manche voll herzzerreißendem Schmerz oder atemberaubender Unhöflichkeit. Ich war versucht, eine Sammlung solcher Stücke als eigene Gruppe zu präsentieren, aber nach längerem Nachdenken entschloss ich mich, einige davon zwischen die längeren, nachdenklicheren, getragenen Aufsätze einzustreuen, einerseits um einen besseren Überblick über das Spektrum der Schriften zu vermitteln, und andererseits um dem Leser das unmittelbare Erlebnis der Tempo- und Tonartwechsel zu verschaffen, die den Reiz der Dawkins-Lektüre ausmachen.
Hier finden sich Extreme von Vergnügen und Verhöhnung und auch Zorn – aber nie Zorn über das, was gegen ihn selbst gesagt wird, sondern stets Zorn über Schaden, den andere erleiden: insbesondere Kinder, Tiere und Menschen, die unterdrückt werden, weil sie sich dem Diktat von Autoritäten widersetzen. Diese Wut und dahinter die Traurigkeit über all das, was geschädigt wird und verloren geht, erinnern mich – und ich muss betonen, dass es nicht Richards, sondern meine Wahrnehmung ist – an den tragischen Aspekt seiner Schriftsteller- und Rednerlaufbahn seit Erscheinen des Buches The Selfish Gene (dt. Das egoistische Gen). Wer »tragisch« für ein zu starkes Wort hält, sollte Folgendes bedenken: In jenem ersten Aufsehen erregenden Buch erläuterte er, wie die Evolution durch natürliche Selektion einer Logik folgt, die ihren Ausdruck im unbarmherzigen, selbstsüchtigen Verhalten der winzigen Replikatoren findet, aus denen die Lebewesen aufgebaut sind. Anschließend wies er darauf hin, dass allein wir Menschen die Macht haben, uns über das Diktat unserer egoistischen Replikationsmoleküle hinwegzusetzen, uns selbst und die Welt in die Hand zu nehmen, unsere Zukunft zu konzipieren und sie dann zu beeinflussen. Als erste Spezies sind wir in der Lage, unegoistisch zu sein. Das ist eine Art Weckruf. Und da liegt die Tragödie: Statt anschließend seine vielfältigen Begabungen der Aufgabe widmen zu können, die Menschen zu ermahnen, damit sie das kostbare Attribut ihres Bewusstseins und die stetig wachsenden Erkenntnisse von Wissenschaft und Vernunft nutzen, um sich über die egoistischen Triebe unserer evolutionsbedingen Programmierung hinwegzusetzen, musste er einen großen Teil seiner Energie und Fähigkeit darauf verwenden, die Menschen davon zu überzeugen, dass die Evolution wirklich wahr ist. Eine triste Aufgabe, vielleicht, aber irgendjemand musste sie übernehmen, denn »die Natur kann niemanden verklagen«, wie er es formuliert. Und wie er in einem der hier wiedergegebenen Aufsätze anmerkt: »Aber ich habe seither gelernt, dass strenger gesunder Menschenverstand für große Teile der Welt keineswegs auf der Hand liegt. Manchmal ist es sogar notwendig, den gesunden Menschenverstand mit nicht nachlassender Wachsamkeit zu verteidigen.« Richard Dawkins ist nicht nur der Prophet der Vernunft, er ist auch unser unermüdlicher Wächter.
Dass in Verbindung mit Sorgfalt und Klarheit so viele brutale Adjektive – »unerbittlich«, »gnadenlos«, »erbarmungslos« – gebraucht werden, ist eine Schande, sind Richards Prinzipien doch durch und durch von Mitgefühl, Großzügigkeit und Freundlichkeit durchtränkt. Selbst seine Kritik ist nicht nur streng im Urteil, sondern auch von bissiger Witzigkeit, so wenn er in einem Brief an den Premierminister die Baroness Warsi erwähnt, »Ihre Ministerin ohne Geschäftsbereich (und ohne Wahl)«, oder wenn er einen fiktiven Blair-Gefolgsmann auftreten lässt, der sich für den Einsatz seines Chefs für die religiöse Vielfalt engagiert: »Wir werden die Einführung von Scharia-Gerichten unterstützen, aber nur auf rein freiwilliger Basis – nur für diejenigen, deren Ehemänner und Väter sich aus freien Stücken dafür entschieden haben.«
Ich bevorzuge klare Bilder: Prägnanz, kriminalistische Aufmerksamkeit für Logik und Details, durchdringende Ausleuchtung. Und ich bezeichne einen solchen Schreibstil nicht als schlagend, sondern eher als sportlich – er ist nicht nur ein Instrument der Kraft und Stärke, sondern auch einer Flexibilität, die sich auf praktisch jeden Leser, jedes Publikum und jedes Thema einstellen kann. Es gibt wahrlich nicht viele Autoren, denen es gelingt, Kraft und Raffinesse, Wirkung und Präzision mit so viel Eleganz und Humor zu verbinden.
Zum ersten Mal arbeitete ich mit Richard Dawkins vor über zehn Jahren bei The God Delusion (dt. Der Gotteswahn) zusammen. Wenn diejenigen, die die hier folgenden Seiten lesen, nicht nur die gedankliche Klarheit und die leichte Ausdrucksweise des Autors zu schätzen wissen, die Furchtlosigkeit, mit der er sehr großen Elefanten in sehr kleinen Räumen gegenübertritt, die Energie, mit der er sich der Erläuterung des Komplizierten und Schönen in der Wissenschaft widmet, sondern ein wenig auch die Großzügigkeit, Freundlichkeit und Höflichkeit, die meinen Umgang mit Richard Dawkins in den Jahren seit unserer ersten Zusammenarbeit stets geprägt haben, hat der vorliegende Band eines seiner Ziele bereits erreicht.
Ein weiteres Ziel ist erreicht, wenn sich ein Zustand einstellt, der in einem hier wiedergegebenen Aufsatz sehr treffend beschrieben wird: »Harmonische Teile gedeihen in ihrer gegenseitigen Gegenwart, und daraus erwächst die Illusion eines harmonischen Ganzen.« Ich glaube sogar, dass die Harmonie, die aus dieser Sammlung erwächst, keine Illusion ist, sondern das Echo einer der lebhaftesten und lebendigsten Stimmen unserer Zeit.
TEIL I
Wert(e) der Wissenschaft
Wir beginnen beim Kern der Sache: der Wissenschaft. Was ist sie, was macht sie, wie betreibt man sie (am besten)? Der Vortrag, den Richard 1997 bei den Oxford Amnesty Lectures hielt, trug den Titel »Die Werte der Wissenschaft und die Wissenschaft der Werte«. Mit dieser Verschränkung der Begriffe deckte er ein riesiges Terrain ab und verfolgte mehrere Themen, die in der vorliegenden Sammlung an anderer Stelle weiterentwickelt werden: den überragenden Respekt der Wissenschaft für objektive Wahrheit, das moralische Gewicht, das der Leidensfähigkeit beigemessen wird, und die Gefahren des »Speziesismus«, die wichtige Unterscheidung, »ob man mit rhetorischen Mitteln deutlich machen will, was nach eigener Überzeugung wirklich der Fall ist, oder ob man sich der Rhetorik bedient, um das, was wirklich der Fall ist, wissentlich zu verschleiern«. Das ist die Stimme des Wissenschaftsvermittlers, der entschlossen daran festhält, sich der Sprache zu bedienen, um die Wahrheit mitzuteilen, und nicht, um eine künstliche »Wahrheit« zu erschaffen. Schon der allererste Absatz trifft eine wichtige Unterscheidung: Das eine sind die Werte, die der Wissenschaft zugrunde liegen, ein stolzes, kostbares System von Prinzipien, die es zu verteidigen gilt, weil von ihnen der Fortbestand unserer Zivilisation abhängt; ein ganz anderes, verdächtigeres Unternehmen sind die Versuche, Werte aus wissenschaftlichen Kenntnissen abzuleiten. Wir müssen den Mut haben, uns einzugestehen, dass wir von einem ethischen Vakuum ausgehen, dass wir unsere eigenen Werte erfinden.
Der Autor dieses Vortrags ist kein faktenverhafteter Gradgrind, kein trockener Erbsen-(oder Knochen-)zähler. Die Passagen über den ästhetischen Wert der Wissenschaft, die poetische Vision eines Carl Sagan, Subrahmanyan Chandrasekhars »Erschaudern vor dem Schönen« sind Musterbeispiele für Leidenschaft und Begeisterung angesichts der Pracht, der Schönheit und der Möglichkeiten einer Wissenschaft, Freude in unser Leben und Hoffnung in unsere Zukunft zu bringen.
Anschließend wechseln wir sowohl das Tempo als auch die Plattform, und die Sprachebene verschiebt sich vom Ausführlichen, Nachdenklichen zum Prägnanten und Pointierten, das heißt zu dem, was ich mir gern als »Dawkins-Pfeil« vorstelle. Hier verfolgt Richard mit eiserner Höflichkeit mehrere Aussagen weiter, die er in seinem Amnesty-Vortrag vertreten hat: Er erinnert Großbritanniens nächsten Monarchen daran, wie gefährlich es ist, sich nicht von evidenzbasierter Wissenschaft, sondern von einer »inneren Weisheit« leiten zu lassen. Wie es für ihn typisch ist, entbindet er die Menschen nicht davon, ihr Urteilsvermögen im Hinblick auf die Möglichkeiten einzusetzen, die Wissenschaft und Technologie bieten: »Die hysterische Opposition wegen möglicher Risiken gentechnisch manipulierter Nutzpflanzen hat den beunruhigenden Aspekt, dass sie die Aufmerksamkeit von den tatsächlichen Gefahren ablenkt, die bereits gut bekannt sind, aber im Wesentlichen ignoriert werden.«
»Wissenschaft und Sensibilität«, der dritte Aufsatz in diesem Abschnitt, ist wiederum ein ausführlicher Vortrag, der mit einer charakteristischen Kombination aus Bedeutungsschwere und Brillanz gehalten wurde. Auch hier erleben wir eine messianische Begeisterung für Wissenschaft – die aber durch die nüchterne Betrachtung der Frage gedämpft wird, wie weit wir zur Jahrtausendwende hätten kommen können und welche Strecken wir noch nicht zurückgelegt haben. Wie es für ihn typisch ist, wird dies nicht als Rezept für Verzweiflung präsentiert, sondern als Ansporn zu verdoppelten Anstrengungen.
Und woher kommt all diese unstillbare Neugier, dieser Hunger nach Wissen, diese kämpferische Leidenschaft? Der Abschnitt schließt mit »Dolittle und Darwin«, einem liebevollen Rückblick darauf, wie die Werte der Wissenschaft in die Erziehung eines Kindes eingeflossen sind – einschließlich einer Lektion zur Unterscheidung zwischen zentralen Werten und ihrer vorübergehenden historischen und kulturellen Färbung.
In allen diesen ganz unterschiedlichen Texten stechen die Kernaussagen deutlich hervor. Es ist nicht gut, den Überbringer der Nachricht zu erschießen, nicht gut, sich illusorischen Tröstungen hinzugeben, nicht gut, das Ist mit dem Sollte zu verwechseln oder mit dem, was uns vielleicht lieb wäre. Letztlich sind es positive Aussagen: Die klare, nachhaltige Konzentration auf die Frage, wie Dinge funktionieren, führt in Verbindung mit der intelligenten Fantasie des unheilbar Neugierigen zu Erkenntnissen, die inspirieren, herausfordern und anregen. So entwickelt sich Wissenschaft immer weiter, das Verständnis wächst, die Kenntnisse erweitern sich. Zusammengenommen bilden diese Texte ein Manifest der Wissenschaft und einen Aufruf, für sie zu kämpfen.
G. S.
Die Werte der Wissenschaft und die Wissenschaft der Werte1
Die Werte der Wissenschaft – was bedeutet das? In einem schwachen Sinn meine ich damit – und ich werde sie wohlwollend betrachten – die Werte, von denen man erwarten kann, dass Wissenschaftler sie vertreten, soweit sie durch ihren Beruf beeinflusst sind. Es gibt aber auch einen starken Sinn: Danach werden wissenschaftliche Kenntnisse unmittelbar benutzt, um Werte abzuleiten wie aus einem heiligen Buch. Werte in diesem Sinn lehne ich nachdrücklich2 ab. Das Buch der Natur mag als Quelle von Werten, nach denen man leben kann, nicht schlechter sein als ein traditionelles heiliges Buch, aber das hat nicht viel zu sagen.
Mit der Wissenschaft der Werte – der anderen Hälfte meines Titels – meine ich die wissenschaftliche Erforschung der Frage, woher unsere Werte stammen. Von sich aus sollte das eine wertfreie, akademische Frage sein, die nicht automatisch stärker umstritten ist als die Frage, woher unsere Knochen stammen. Man könnte damit zu der Schlussfolgerung gelangen, dass unsere Werte unserer Evolutionsvergangenheit nichts verdanken, aber das ist nicht die Schlussfolgerung, die ich ziehen werde.
Die Werte der Wissenschaft im schwachen Sinn
Ich bezweifle, dass Wissenschaftler ihre Partner oder die Steuerbehörden seltener (oder häufiger) betrügen als andere Menschen. In ihrem Berufsleben dagegen haben Wissenschaftler besondere Gründe, die einfache Wahrheit zu schätzen. Grundlage ihres Berufes ist die Überzeugung, dass es so etwas wie eine objektive Wahrheit gibt, die über kulturelle Unterschiede hinausgeht; wenn demnach zwei Wissenschaftler die gleiche Frage stellen, gelangen sie unabhängig von ihren vorgegebenen Überzeugungen, ihrer kulturellen Herkunft und innerhalb gewisser Grenzen auch ihrer Fähigkeiten zu der gleichen Antwort. Dem widerspricht auch die häufig wiederholte philosophische Überzeugung nicht, dass Wissenschaftler keine Wahrheiten beweisen, sondern Hypothesen vertreten, die sie nicht widerlegen konnten. Der Philosoph mag uns davon überzeugen, dass unsere Fakten nur unwiderlegte Theorien sind, aber bei manchen Theorien würden wir unser letztes Hemd darauf verwetten, dass man sie nie widerlegen wird; solche Theorien bezeichnen wir dann in der Regel als wahr.3 Verschiedene Wissenschaftler werden sich selbst dann, wenn geografisch und kulturell Welten zwischen ihnen liegen, in der Regel auf die gleichen nicht widerlegten Theorien einigen.
Eine solche Weltsicht ist meilenweit entfernt von modischem Geplapper wie dem Folgenden4:
So etwas wie eine objektive Wahrheit gibt es nicht. Wir machen uns unsere eigene Wahrheit. So etwas wie eine objektive Wirklichkeit gibt es nicht. Wir machen uns unsere eigene Wirklichkeit. Es gibt spirituelle, mystische oder innere Möglichkeiten des Wissens, die unseren gewöhnlichen Möglichkeiten des Wissens überlegen sind.5 Wenn ein Erlebnis wirklich zu sein scheint, dann ist es wirklich. Wenn einem eine Idee richtig vorkommt, dann ist sie richtig. Wir sind außerstande, Wissen über das wahre Wesen der Wirklichkeit zu gewinnen. Die Wissenschaft an sich ist irrational oder mystisch. Sie ist nur irgendein Glaube, Glaubenssystem oder Mythos, der nicht mehr gerechtfertigt ist als irgendein anderer. Es spielt keine Rolle, ob Anschauungen wahr sind oder nicht, solange sie für jemanden von Bedeutung sind.
In dieser Richtung liegt der Wahnsinn. Am besten kann ich die Werte eines Wissenschaftlers verdeutlichen, indem ich sage: Wenn eine Zeit kommt, in der alle so denken, möchte ich nicht mehr weiterleben. Dann sind wir in ein neues dunkles Mittelalter eingetreten, allerdings nicht in eines, »das durch das Licht einer pervertierten Wissenschaft noch düsterer und länger wurde«6 – denn dann gäbe es keine Wissenschaft mehr, die man pervertieren könnte.
Ja, Newtons Gravitationsgesetz ist nur näherungsweise richtig, und vielleicht wird auch Einsteins Allgemeine Theorie zu gegebener Zeit überflüssig gemacht. Aber dadurch steigen sie nicht in die gleiche Liga ab wie die mittelalterliche Hexenkunst oder der Aberglaube von Stammesvölkern. Newtons Gesetze sind Näherungslösungen, denen wir unser Leben anvertrauen können und regelmäßig anvertrauen. Wenn es um eine Flugreise geht, würde unser kultureller Relativist auf Levitation oder auf Physik setzen, auf den fliegenden Teppich oder auf McDonnell Douglas? Ganz gleich, in welchem Kulturkreis wir aufgewachsen sind, das Bernoulli-Prinzip wird nicht auf einmal unwirksam, wenn wir in den nicht-»westlichen« Luftraum eintreten. Oder worauf würden Sie Ihr Geld verwetten, wenn es darum ginge, eine Beobachtung vorherzusagen? Wie Carl Sagan erklärt hat, könnten wir die Barbaren von Relativismus und New Age nach Art eines modernen Rider-Haggard-Helden verblüffen, indem wir eine totale Sonnenfinsternis, die sich in tausend Jahren ereignen wird, auf die Sekunde genau vorhersagen.
Carl Sagan ist vor einem Monat gestorben. Ich bin nur einmal mit ihm zusammengetroffen, aber ich mag seine Bücher und werde ihn als »Kerze in der Dunkelheit«7 vermissen. Ich widme diesen Vortrag seinem Andenken und werde Zitate aus seinen Schriften verwenden. Die Bemerkung über die Vorhersage von Sonnenfinsternissen stammt aus The Demon-Haunted World (dt. Der Drache in meiner Garage), dem letzten Buch, das vor seinem Tod erschien. Dort fährt er fort:
Sie können zum Medizinmann gehen, damit er den Zauber aufhebt, der Ihre perniziöse Anämie verursacht, oder Sie können Vitamin B12 nehmen. Wenn Sie Ihr Kind vor Kinderlähmung bewahren wollen, können Sie beten oder es zur Schluckimpfung schicken. Wenn Sie wissen wollen, welches Geschlecht Ihr ungeborenes Kind hat, können Sie natürlich alle möglichen spiritistischen Pendler konsultieren … aber sie haben im Durchschnitt eben nur zu fünfzig Prozent recht. Wenn Sie echte Genauigkeit haben wollen …, versuchen Sie es mit Fruchtblasenpunktion und Ultraschall. Probieren Sie es mit der Wissenschaft.
Natürlich sind Wissenschaftler häufig unterschiedlicher Meinung. Aber sie sind stolz darauf, dass sie sich darüber einigen können, welche neuen Belege notwendig wären, damit sie ihre Ansichten ändern. Der Weg zu jeder Entdeckung wird veröffentlicht, und wer die gleiche Route einschlägt, sollte zu den gleichen Ergebnissen gelangen. Wer lügt – wer Abbildungen türkt oder nur den Teil der Befunde veröffentlicht, die für eine bevorzugte Schlussfolgerung sprechen –, wird wahrscheinlich entlarvt. Ohnehin wird man mit Wissenschaft nicht reich – warum also sollte man es überhaupt tun, wenn man doch durch Lügen den einzigen Sinn des Unternehmens hinfällig macht? Ein Wissenschaftler wird gegenüber seiner Partnerin oder einem Steuerfahnder mit viel größerer Wahrscheinlichkeit lügen als gegenüber einer Fachzeitschrift.
Zugegeben: Es gibt auch in der Wissenschaft Fälle von Betrug, und zwar wahrscheinlich nicht nur die, welche ans Licht kommen. Ich behaupte nur, dass die Verfälschung von Daten in der Wissenschaftlergemeinde die Ursünde ist, und sie ist so unverzeihlich, dass es sich in die Begriffe jedes anderen Berufes kaum übertragen lässt. Diese extreme Wertschätzung hat die unglückselige Folge, dass Wissenschaftler einen außerordentlich großen Widerwillen dagegen haben, Kollegen anzuschwärzen, wenn Grund zu dem Verdacht besteht, dass Zahlen gefälscht wurden. Es ist, als würde man jemanden des Kannibalismus oder des Kindesmissbrauchs beschuldigen. Ein derart düsterer Verdacht wird unterdrückt, bis die Belege so überwältigend sind, dass man sie nicht mehr ignorieren kann, und dann ist unter Umständen bereits viel Schaden angerichtet. Wenn wir unsere Spesenabrechnung frisieren, werden die Kollegen wahrscheinlich Nachsicht zeigen. Wenn wir den Gärtner bar bezahlen und damit die Schwarzarbeit zum Nachteil der Steuerbehörden unterstützen, werden wir gesellschaftlich nicht ausgestoßen. Aber ein Wissenschaftler, der bei der Manipulation seiner Forschungsergebnisse erwischt wird, ist ein Ausgestoßener. Er wird von seinen Kollegen geschnitten und gnadenlos für alle Zeiten aus dem Berufsstand verbannt.
Wenn ein Anwalt sich seiner Beredsamkeit bedient, um seine Sache selbst dann so gut wie möglich zu vertreten, wenn er nicht daran glaubt, und wenn er zu diesem Zweck nur günstige Tatsachen nennt und Indizien manipuliert, wird er wegen seines Erfolges bewundert und belohnt.8 Ein Wissenschaftler, der das Gleiche tut, alle rhetorischen Register zieht, sich in jede Richtung windet und wendet, um Unterstützung für eine Lieblingstheorie zu gewinnen, wird im Vergleich zumindest mit leichtem Misstrauen betrachtet.
Im typischen Fall sehen die Werte der Wissenschaftler so aus, dass der Vorwurf, jemand sei ein Fürsprecher – oder, noch schlimmer, ein geschickter Fürsprecher –, einer Antwort bedarf.9 Es ist aber ein wichtiger Unterschied, ob man mit rhetorischen Mitteln deutlich machen will, was nach eigener Überzeugung wirklich der Fall ist, oder ob man sich der Rhetorik bedient, um das, was wirklich der Fall ist, wissentlich zu verschleiern. Einmal trat ich an einer Universität in einer Podiumsdiskussion über Evolution auf. Der eindrucksvollste kreationistische Redebeitrag stammte von einer jungen Frau, die zufällig beim anschließenden Abendessen neben mir saß. Als ich ihr Komplimente für ihren Vortrag machte, erklärte sie mir sofort, sie habe selbst kein Wort davon geglaubt. Sie hatte nur ihre Geschicklichkeit im Diskutieren geübt und dazu leidenschaftlich das genaue Gegenteil dessen vertreten, was sie für die Wahrheit hielt. Sie wird zweifellos eine gute Anwältin abgeben. Ich konnte nun nichts anderes mehr tun, als gegenüber meiner Tischnachbarin höflich zu bleiben, aber das sagt etwas über die Werte aus, die ich mir als Wissenschaftler in meiner bisherigen Laufbahn angeeignet habe.
Eigentlich möchte ich damit sagen, dass Wissenschaftler eine Werteskala besitzen, nach der die Wahrheit der Natur fast etwas Heiliges hat. Das mag der Grund sein, warum manche von uns so hitzig auf Astrologen, Löffelbieger und ähnliche Scharlatane reagieren, die von anderen nachsichtig als harmlose Unterhaltungskünstler toleriert werden. Der Verleumdungsparagraf bestraft denjenigen, der wissentlich Lügen über andere Menschen verbreitet. Wer aber Geld damit verdient, dass er Lügen über die Natur verbreitet – die keine Klage erheben kann –, kommt ungeschoren davon. Meine Werte mögen verschroben sein, aber ich würde es begrüßen, wenn die Natur vor Gericht ebenso vertreten würde wie ein misshandeltes Kind.10
Die Wahrheitsliebe hat aber auch eine Kehrseite: Sie kann Wissenschaftler dazu veranlassen, ihr ungeachtet aller unglücklichen Konsequenzen zu folgen.11 Wissenschaftler tragen eine große Verantwortung, die Gesellschaft vor solchen Konsequenzen zu warnen. Von dieser Gefahr sprach Einstein, als er sagte: »Wenn ich es vorher gewusst hätte, wäre ich Schlosser geworden.« Natürlich wäre er in Wirklichkeit nicht Schlosser geworden. Und als sich die Gelegenheit bot, unterschrieb er den berühmten Brief, in dem er Roosevelt vor den Möglichkeiten und Gefahren der Atombombe warnte. Teilweise ist die Feindseligkeit, die Wissenschaftlern entgegengebracht wird, gleichbedeutend mit der Ermordung des Nachrichtenüberbringers. Wenn Astronomen uns auf einen großen Asteroiden aufmerksam machen, der sich auf Kollisionskurs zur Erde befindet, wäre es vor dem Einschlag der letzte Gedanke vieler Menschen, es sei die Schuld »der Wissenschaftler«. Ein Element der Ermordung des Überbringers steckt auch in unserer Reaktion auf BSE.12 Anders als im Fall des Asteroiden lag die Schuld hier wirklich bei den Menschen. Einen Teil davon müssen Wissenschaftler auf sich nehmen, einen anderen die Landwirtschafts- und Lebensmittelindustrie mit ihrer Habgier.
Carl Sagan stellt dazu fest, er werde häufig gefragt, ob er an intelligentes Leben im Weltraum glaube. Er neigt zu einem zurückhaltenden Ja, das er aber voller Vorsicht und Unsicherheit ausspricht.
Oft werde ich dann gefragt: »Und was glauben Sie wirklich?«
Ich erwidere: »Ich habe Ihnen doch gerade gesagt, was ich wirklich denke.«
»Ja, schon, aber was glauben Sie aus dem Bauch heraus?«
Aber ich versuche nicht mit dem Bauch zu denken. Wenn ich ernsthaft die Welt verstehen will, dann bekomme ich wahrscheinlich Probleme, wenn ich mit etwas anderem als meinem Gehirn denken will, so verlockend dies sein könnte. Es ist wirklich okay, so lange mit dem Urteil zu warten, bis die Beweise vorliegen.
Misstrauen gegenüber inneren, privaten Offenbarungen ist, wie mir scheint, ein weiterer Wert, der durch das Erlebnis, Wissenschaft zu betreiben, gestärkt wird. Private Offenbarungen passen nicht gut zu den Lehrbuchidealen der wissenschaftlichen Methode: Überprüfbarkeit, Unterstützung durch Evidenz, Präzision, Quantifizierbarkeit, Widerspruchsfreiheit, Intersubjektivität, Reproduzierbarkeit, Allgemeingültigkeit und Unabhängigkeit vom kulturellen Umfeld.
Es gibt aber auch Werte der Wissenschaft, die man vermutlich am besten ähnlich behandelt wie ästhetische Werte. Einstein wurde zu diesem Thema schon häufig genug zitiert, deshalb nenne ich hier stattdessen den großen indischen Astrophysiker Subrahmanyan Chandrasekhar; er sagte 1975, als er 65 Jahre alt war, in einem Vortrag13:
In meinem ganzen wissenschaftlichen Leben … hat mich keine Erfahrung stärker erschüttert als die Erkenntnis, dass eine exakte Lösung der Einsteinschen Gleichungen der Allgemeinen Relativitätstheorie … die absolut genaue Darstellung unzählig vieler massereicher schwarzer Löcher liefert, die das Weltall bevölkern. Dieses »Erschaudern vor dem Schönen«, diese unglaubliche Tatsache, dass eine von der Suche nach dem Schönen in der Mathematik motivierte Entdeckung eine genaue Entsprechung in der Natur hat, veranlasst mich zu sagen, Schönheit sei das, worauf der menschliche Geist am tiefsten reagiert.
Ich finde das bewegend auf eine Art, die im launischen Dilettantismus der berühmten Zeilen von Keats völlig fehlt:
Schönheit ist Wahrheit, Wahrheit schön – dies wisst
Auf Erden, und nur dies ist wissenswert.
Wenn wir ein wenig über die Ästhetik hinausblicken, schätzen Wissenschaftler in der Regel das Langfristige auf Kosten des Kurzfristigen; sie beziehen Inspiration aus den großen, offenen Räumen des Kosmos und den langsam mahlenden Mühlen der erdgeschichtlichen Zeiträume, aber nicht aus den engstirnigen Besorgnissen der Menschheit. Insbesondere neigen sie dazu, Dinge sub specie aeternitatis zu betrachten, selbst wenn sie sich damit der Gefahr aussetzen, dass man ihnen eine düstere, kalte, lieblose Einstellung gegenüber den Menschen vorwirft.
Pale Blue Dot (dt. Blauer Punkt im All), das vorletzte Buch von Carl Sagan, ist rund um das poetische Bild unserer Welt aufgebaut, wie man sie aus der Ferne des Weltraums erkennt.
Sehen Sie sich diesen Punkt noch einmal an. Hier leben wir, hier sind wir zu Hause … Die Erde ist eine kleine Bühne im großen Theater des Kosmos. Man denke nur an die Ströme von Blut, die von Generälen und Feldherren vergossen werden, um für einen winzigen Augenblick zu Herrschern über den Bruchteil dieses Punktes aufzusteigen. Man denke an die endlosen Grausamkeiten, die die Bewohner eines Winkels auf diesem Pixel den kaum anders gearteten Bewohnern eines anderen Winkels auf diesem Pixel zufügen, wie wenig sie sich verstehen, wie gern sie sich gegenseitig umbringen, wie glühend ihr Hass ist. Unsere Anmaßung, unsere eingebildete Wichtigkeit, die wahnwitzige Vorstellung, dass wir im Universum einen besonderen Platz einnehmen, wird von diesem schwachen Lichtpunkt infrage gestellt. Unser Planet ist ein einsames Körnchen im großen Dunkel des Weltalls. Und es ist nicht wahrscheinlich, dass von draußen jemand kommt, um uns vor uns selbst zu schützen.
In der Passage, die ich gerade vorgelesen habe, gibt es für mich nur einen düsteren Aspekt: die Erkenntnis, dass ihr Autor mittlerweile für immer schweigt. Ob man es für düster hält, wenn die Menschheit aus wissenschaftlichen Gründen auf Normalmaß zurückgestutzt wird, ist eine Frage der Einstellung. Es mag ein Aspekt der wissenschaftlichen Werte sein, dass solche großen Visionen auf viele von uns nicht kalt und leer wirken, sondern erhebend und begeisternd. Wir erwärmen uns auch für eine Natur, die Gesetzen folgt und nicht launisch ist. Es gibt Geheimnisse, aber niemals Magie, und Geheimnisse sind umso schöner, wenn sie am Ende gelüftet werden. Dinge sind erklärbar, und wir haben das Privileg, sie zu erklären. Die Prinzipien, die hier wirksam sind, gelten auch dort – und »dort« heißt draußen in entfernten Galaxien. Am Ende seines Origin of Species (dt. Entstehung der Arten), in der berühmten Passage über die »dicht bewachsene Uferstrecke« stellt Charles Darwin fest, dass die gesamte Komplexität des Lebendigen »durch Gesetze hervorgebracht ist, welche noch fort und fort um uns wirken«. Dann fährt er fort:
So geht aus dem Kampfe der Natur, aus Hunger und Tod unmittelbar die Lösung des nächsten Problems hervor, das wir zu fassen vermögen, die Erzeugung immer höherer und vollkommenerer Tiere. Es ist wahrlich eine großartige Ansicht, dass der Schöpfer den Keim alles Lebens, das uns umgibt, nur wenigen oder nur einer einzigen Form eingehaucht hat, und dass, während unser Planet den strengsten Gesetzen der Schwerkraft folgend sich im Kreise geschwungen, aus so einfachem Anfange sich eine endlose Reihe der schönsten und wundervollsten Formen entwickelt hat und immer noch entwickelt.
Die schiere Zeit, die für die Evolution der Arten notwendig war, ist ein beliebtes Argument für ihre Erhaltung. Schon das beinhaltet ein Werturteil, das vermutlich allen, die in die Tiefen der erdgeschichtlichen Zeiträume hinabsteigen, wesensverwandt ist. In einem früheren Werk habe ich den erschütternden Bericht von Oria Douglas-Hamilton über die Dezimierung von Elefantenbeständen in Simbabwe zitiert:
Ich betrachtete einen der weggeworfenen Rüssel und dachte darüber nach, wie viele Jahrmillionen die Evolution wohl gebraucht haben mochte, um ein solches Wunderwerk zustande zu bringen. Ein Rüssel, ausgestattet mit fünfzigtausend Muskeln und gesteuert von einem ebenso komplexen Gehirn, kann mit gewaltiger Kraft tonnenschwere Gegenstände zerren und stoßen. Doch gleichzeitig vermag er die feinsten Arbeiten durchzuführen … Und hier lag er nun, amputiert wie so viele andere Elefantenrüssel, die ich überall in Afrika gesehen hatte.
So bewegend der Absatz auch ist, ich zitiere ihn nur, um deutlich zu machen, welche wissenschaftlichen Werte Mrs Douglas-Hamilton dazu veranlassten, auf die Jahrmillionen hinzuweisen, die für die Evolution des komplexen Elefantenrüssels notwendig waren, statt beispielsweise das Schwergewicht auf die Rechte der Elefanten oder ihre Leidensfähigkeit zu legen oder auch auf den Wert wilder Tiere, die unser menschliches Erleben bereichern oder die Tourismuseinnahmen eines Landes steigern.
Das heißt nicht, dass Kenntnisse über die Evolution für Fragen von Rechten und Leiden ohne Bedeutung wären. Ich werde mich in Kürze für die Ansicht aussprechen, dass man aus wissenschaftlichen Erkenntnissen keine grundlegenden moralischen Werte ableiten kann. Aber utilitaristische Moralphilosophen, nach deren Ansicht es überhaupt keine absoluten moralischen Werte gibt, beanspruchen für sich dennoch zu Recht eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, Widersprüche und Unstimmigkeiten innerhalb bestimmter Wertesysteme zu entlarven.14 Evolutionsforscher bringen gute Voraussetzungen mit, um Widersprüche zu beobachten, wenn die Rechte der Menschen absolutistisch über die aller anderen biologischen Arten gestellt werden.
»Lebensschützer« stellen die unhinterfragte Behauptung auf, Leben sei unendlich kostbar, und gleichzeitig mampfen sie fröhlich ein großes Steak. Bei dem »Leben«, das solche Leute »schützen« wollen, handelt es sich nur allzu eindeutig um menschliches Leben. Nun ist das nicht zwangsläufig falsch, aber der Evolutionsforscher wird uns zumindest vor einem Widerspruch warnen. Dass die Abtreibung eines einen Monat alten menschlichen Fötus ein Mord ist, das Erschießen eines vollständig gefühlsbegabten ausgewachsenen Elefanten oder Berggorillas aber nicht, liegt nicht ohne Weiteres auf der Hand.
Vor etwa sechs oder sieben Millionen Jahren lebte in Afrika ein Menschenaffe, der zum gemeinsamen Vorfahren aller heutigen Menschen und aller heutigen Gorillas wurde. Zufällig sind die Zwischenformen, die uns mit diesem Vorfahren verbinden – Homo erectus, Homo habilis, verschiedene Mitglieder der Gattung Australopithecus und andere –, ausgestorben. Ebenso ausgestorben sind die Zwischenglieder, die denselben gemeinsamen Vorfahren mit den heutigen Gorillas verbinden. Wenn diese Zwischenformen nicht ausgestorben wären, wenn in den Urwäldern und Savannen Afrikas noch Restpopulationen auftauchen würden, hätte dies heikle Folgen. Wir wären dann in der Lage, uns mit jemandem zu paaren und Kinder zu zeugen, der in der Lage wäre, sich mit jemand anderem zu paaren und Kinder zu zeugen, der … nach einigen weiteren Kettengliedern in der Lage wäre, sich mit einem Gorilla zu paaren und Kinder zu zeugen. Dass einige entscheidende Zwischenglieder in dieser Kette der gegenseitigen Fruchtbarkeit zufällig tot sind, ist schlichtes Pech.
Das Ganze ist kein frivoles Gedankenexperiment. Spielraum für Diskussionen gibt es nur in der Frage, wie viele Zwischenstufen wir in der Kette postulieren müssen. Und die Zahl der Zwischenstufen spielt auch keine Rolle für die Rechtfertigung der folgenden Schlussfolgerung. Die absolutistische Überhöhung des Homo sapiens gegenüber allen anderen Arten, die unhinterfragte Bevorzugung eines menschlichen Fötus oder eines hirntoten menschlichen Gemüses vor einem erwachsenen Schimpansen im Vollbesitz seiner Kräfte, unsere Apartheid auf der Ebene der biologischen Arten würde zusammenbrechen wie ein Kartenhaus. Und wenn das nicht der Fall ist, erweist sich der Vergleich mit der Apartheid durchaus nicht als inhaltsleer. Denn wenn wir angesichts eines noch vorhandenen, ununterbrochenen Spektrums von Zwischenstufen immer noch darauf beharren würden, Menschen von Nichtmenschen zu trennen, könnten wir eine solche Trennung nur aufrechterhalten, indem wir uns an Apartheid-Gerichtshöfe wenden, die darüber entscheiden, ob bestimmte Individuen der Zwischenformen »als Menschen durchgehen«.
Eine solche evolutionsorientierte Logik zerstört nicht alle Doktrinen spezifischer Menschenrechte. Sie zerstört aber mit Sicherheit die absolutistischen Versionen, denn sie zeigt, dass die Abtrennung unserer Spezies von Zufällen des Aussterbens abhängt. Wären Moral und Rechte prinzipiell absolut, könnten neue zoologische Entdeckungen im Wald von Budongo sie nicht ins Wanken bringen.
Die Werte der Wissenschaft im starken Sinn
Jetzt möchte ich vom schwachen zum starken Sinn der Werte der Wissenschaft übergehen, zu wissenschaftlichen Befunden als unmittelbarer Quelle für ein Wertesystem. Der vielseitige englische Biologe Sir Julian Huxley – der, nebenbei bemerkt, auch einer meiner Vorgänger als Tutor für Zoologie am New College war – bemühte sich darum, die Evolution zur Grundlage einer Ethik und fast einer Religion zu machen. Das Gute ist für ihn das, was den Evolutionsprozess voranbringt. Sein angesehenerer, aber nicht geadelter Großvater Thomas Henry Huxley nahm fast den entgegengesetzten Standpunkt ein. Ich selbst sympathisiere mehr mit Huxley senior.15
Julian Huxleys ideologische Evolutionsvernarrtheit erwuchs zum Teil aus seiner optimistischen Vorstellung von ihrem Fortschritt.16 Heute ist es in Mode, zu bezweifeln, ob Evolution überhaupt mit Fortschritt verbunden ist. Das ist eine interessante Argumentation, zu der ich auch eine Meinung habe17, aber sie tritt hinter der vorgelagerten Frage zurück, ob wir unsere Werte überhaupt auf diese oder irgendwelche anderen Erkenntnisse über die Natur stützen sollten.
Eine ähnliche Frage erhebt sich im Zusammenhang mit dem Marxismus. Man kann sich eine akademische Geschichtstheorie zu eigen machen, welche die Diktatur des Proletariats prophezeit. Und man kann einem politischen Glaubensbekenntnis folgen, das die Diktatur des Proletariats für etwas Gutes hält, sodass man sich bemühen sollte, sie voranzubringen. Viele Marxisten tun tatsächlich beides, und eine beunruhigend große Zahl von ihnen – sogar, wie man mit Fug und Recht behaupten kann, Marx selbst – kennt und kannte den Unterschied nicht. Logisch betrachtet, folgt aber die politische Ansicht darüber, was wünschenswert ist, nicht aus der akademischen Geschichtstheorie. Man kann ein akademischer Marxist sein und glauben, dass die Kräfte der Geschichte unausweichlich auf eine Revolution der Werktätigen hindrängen, und gleichzeitig konservativ wählen und alles daransetzen, das Unvermeidliche so weit wie möglich hinauszuschieben. Ein Widerspruch ist das nicht. Man kann aber auch ein leidenschaftlicher politischer Marxist sein, der gerade deshalb besonders angestrengt für die Revolution arbeitet, weil er an der marxistischen Geschichtstheorie zweifelt und das Gefühl hat, die ersehnte Revolution brauche jede nur erdenkliche Unterstützung.
Ähnlich die Evolution: Sie könnte die Eigenschaft der Fortschrittlichkeit haben, die Julian Huxley als akademischer Biologe unterstellte, oder auch nicht. Aber ganz gleich, ob er in der biologischen Frage recht hatte oder nicht, es ist eindeutig nicht notwendig, dass wir eine solche Form der Fortschrittlichkeit nachahmen, wenn wir unsere Wertesysteme aufstellen.
Noch augenfälliger wird das Thema, wenn wir uns von der Evolution mit ihrem angeblichen Fortschrittsimpuls ab- und Darwins Evolutionsmechanismus, dem Überleben des Geeignetsten, zuwenden. T. H. Huxley machte sich 1893 in seiner Romanes-Vorlesung »Evolution und Ethik« keine Illusionen, und damit hatte er recht. Wenn man den Darwinismus als moralisches Lehrstück gebrauchen will, ist er eine entsetzliche Warnung. Die Natur ist tatsächlich rot an Zähnen und Klauen. Die Schwächsten gehen wirklich den Bach hinunter, und die natürliche Selektion begünstigt tatsächlich egoistische Gene. Die läuferische Eleganz von Geparden und Gazellen wurde auf beiden Seiten mit einem gewaltigen Blutzoll und dem Leiden unzähliger Vorfahren erkauft. Urzeitliche Antilopen wurden hingemetzelt, und Fleischfresser hungerten, während ihre stromlinienförmigeren heutigen Gegenstücke allmählich Gestalt annahmen. Das Ergebnis der natürlichen Selektion, das Leben in allen seinen Formen, ist wunderschön und vielfältig. Aber der Prozess ist heimtückisch, brutal und kurzsichtig.
Dass wir darwinistische Wesen sind, ist eine akademische Tatsache. Unser Körper und unser Gehirn wurden von der natürlichen Selektion geformt, dem gleichgültigen, grausamen blinden Uhrmacher. Aber das heißt nicht, dass es uns gefallen muss. Im Gegenteil: Eine darwinistische Gesellschaft ist nicht das Umfeld, in dem irgendeiner meiner Freunde gern leben würde. »Darwinistisch« ist keine schlechte Definition für genau die Art der Politik, bei der ich hundert Meilen laufen würde, um nicht von ihr, einer Art auf die Spitze getriebenem, angeborenem Thatcherismus, regiert zu werden.
Hier sei mir eine persönliche Bemerkung erlaubt, denn ich bin es leid, dass man mich mit einer heimtückischen Politik der gnadenlosen Konkurrenz identifiziert und mir vorwirft, ich würde den Egoismus als Lebensform befürworten. Kurz nachdem Thatcher 1979 die Wahl gewonnen hatte, schrieb Professor Steven Rose im New Scientist:
Ich unterstelle nicht, dass Saatchi und Saatchi ein Team von Soziobiologen engagiert haben, damit diese die Thatcher-Drehbücher schreiben, und ich sage auch nicht, dass gewisse Professoren aus Oxford und Sussex nun über diesen praktischen Ausdruck der einfachen Wahrheiten über egoistische Gene, die sie uns mit viel Mühe vermitteln wollten, in Jubel ausbrechen. Das zufällige Zusammentreffen einer modischen Theorie mit politischen Ereignissen ist komplizierter. Eines aber glaube ich: Wenn eines Tages die Geschichte der späten 1970er-Jahre mit ihrer Bewegung nach rechts geschrieben wird, die Geschichte des Überganges von Law and Order zum Monetarismus und des (stärker umstrittenen) Angriffs auf staatliche Eingriffe, dann wird man auch den Wechsel der wissenschaftlichen Mode, selbst wenn er nur den Übergang von Modellen der Gruppen- zur Verwandtenselektion in der Evolutionstheorie betrifft, als Teil der Gezeitenwelle betrachten, die die Thatcheristen und ihr Konzept einer festgelegten, konkurrenzorientierten, fremdenfeindlichen menschlichen Natur nach Art des 19. Jahrhunderts an die Macht gespült hat.
Der »Professor aus Sussex«, auf den er anspielt, war John Maynard Smith, und der gab in der nächsten Ausgabe des New Scientist die angemessene Antwort: Was hätten wir tun sollen – die Gleichungen manipulieren?