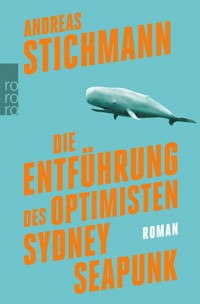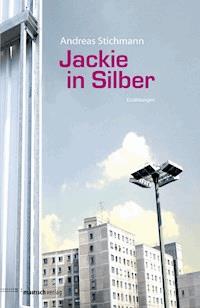9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie führt aus der deutschen Provinz in den Iran und weiter ans Kaspische Meer: die Suche nach Ana – Ana, der Tankstellenräuberin, Ana, deren persischer Vater nie so recht hat Fuß fassen können im deutschen Exil. Es ist ein weiter Weg, kreuz und quer durch die Wüste, voller komischer und rätselhafter Prüfungen, die Rupert zu bestehen hat – und mit ihm sein schizophrener Freund Robert, der am liebsten Vögel beobachtet, der die Welt nicht versteht und stattdessen das Schachspiel neu erfindet. So war das zumindest, bis Ana kam. Bis Rupert und Ana abgehauen sind, um das große Leben zu beginnen. Und bevor Ana plötzlich verschwand. «Das große Leuchten» ist der Roman einer ausgedehnten Reise, abgründig, empfindungsstark und voller abenteuerlicher Echos. Einhörner und Jäger, Derwische und Ex-Generäle, russische Kleinkriminelle, opiumrauchende Kunstfilmerinnen und uralte Orangenfarmer finden darin Platz – Figuren, die niemals blinzeln, sondern «brennen, brennen, brennen wie phantastische gelbe Wunderkerzen» (Jack Kerouac).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Andreas Stichmann
Das große Leuchten
Roman
Über dieses Buch
Sie führt aus der deutschen Provinz in den Iran und weiter ans Kaspische Meer: die Suche nach Ana – Ana, der Tankstellenräuberin, Ana, deren persischer Vater nie so recht hat Fuß fassen können im deutschen Exil. Es ist ein weiter Weg, kreuz und quer durch die Wüste, voller komischer und rätselhafter Prüfungen, die Rupert zu bestehen hat – und mit ihm sein schizophrener Freund Robert, der am liebsten Vögel beobachtet, der die Welt nicht versteht und stattdessen das Schachspiel neu erfindet.
So war das zumindest, bis Ana kam. Bis Rupert und Ana abgehauen sind, um das große Leben zu beginnen. Und bevor Ana plötzlich verschwand.
«Das große Leuchten» ist der Roman einer ausgedehnten Reise, abgründig, empfindungsstark und voller abenteuerlicher Echos. Einhörner und Jäger, Derwische und Ex-Generäle, russische Kleinkriminelle, opiumrauchende Kunstfilmerinnen und uralte Orangenfarmer finden darin Platz – Figuren, die niemals blinzeln, sondern «brennen, brennen, brennen wie phantastische gelbe Wunderkerzen» (Jack Kerouac).
Impressum
Der Autor dankt der Robert-Bosch-Stiftung für die Förderung seiner Arbeit an diesem Buch.
Rowohlt Digitalbuch, veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, September 2012
Copyright © 2012 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung Anzinger | Wüschner | Rasp, München
(Umschlagabbildung: plainpicture/Robert Harding)
ISBN Buchausgabe 978-3-498-06390-0 (1. Auflage 2012)
ISBN Digitalbuch 978-3-644-02221-8
www.rowohlt-digitalbuch.de
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Der große Helfer
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
Das Abc der Parapsychologie
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Tyrhkrdn
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
Der Traum des Jägers
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
Ich möchte das Oberhaupt einer persischen Großfamilie sein
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Einsteigen
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Tote
1. Kapitel
2. Kapitel
Dark Psy
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
Home
Der große Helfer
1
Das riesige Feld der Startbahnen. Aus dem Iran-Air-Flieger heraus gesehen. Vor dem Abflug. Vom Fensterplatz, den Robert mir überlässt, obwohl es auch sein erster Flug ist. Die Spielzeugautos, die dort zwischen den Flugzeugen fahren. Die Beschleunigung, diese Urkräfte, die jetzt verbrannt werden: Das Flugzeug rollt. Der berühmte Menschentraum aus Kabeln und Drähten, in dem man sitzt, ohne selber mitgeschraubt zu haben. Und wie die Erde unter uns wegfällt und sich die Landschaft schräg ins Fenster schiebt.
Es ist Wahnsinn, aber genau so muss es sein, es ist das, was Ana auch machen würde: es einfach versuchen, auch wenn es abwegig scheint. Eben noch in der Einöde und jetzt im Himmel, um sie irgendwo da unten zu finden, unter diesen tiefgelben Lichtmassen. Wir haben exakt sechs Tage und fünf Stunden Zeit. Es ist ein Last-Minute-Flug, der Rückflug ist schon mit drin.
Ich blinzle nicht. Ich versuche jetzt, eine Minute nicht zu blinzeln. Es ist eine Beruhigungstechnik, die wahrscheinlich albern aussieht, aber sie funktioniert, die Farben und Formen hinter dem Bullauge verschwimmen – und wenn ich dann wieder zu blinzeln beginne, entsteht das Gefühl, viel deutlicher zu sehen als zuvor. Ein Klarheitseffekt, ein ruhiger Blick, den ich hier entwickle. Mit Anas Kapuzenpullover im Schoß, der immer noch ein bisschen nach ihr riecht.
Robert schickt mir sein dünnes Lächeln – diesen Blick, der auf etwas hinweisen soll, das sich zwischen den Worten befindet, auch wenn sich da gar nichts befindet, weil wir nicht reden. Er drückt mit demonstrativer Gelassenheit auf dem Bildschirm im Rücken des Vordersitzes herum, staunt über den Entertainment-Arm, der in die Lehne eingefaltet ist wie ein elektronisches Küken. Schlägt sich in die Wolldecke ein, zieht seine Sandalen aus, justiert sich im Sitz. Als wollte er mir seine Lockerheit und Reisefähigkeit beweisen. Dabei ist es offensichtlich, dass er nervös ist – wie er sich am Hals kratzt, der schon ganz gerötet ist von seinen Allergien, wie er an den Knöpfen seines durchgeschwitzten Leinenhemdes rumfummelt. Nebenbei erwähnt er, dass er seine Medikamente nicht im Handgepäck hat, obwohl er sie jetzt nehmen müsste. Ich sage, dass ich über so was jetzt nicht nachdenken kann, er soll sich auf unsere Aufgabe konzentrieren in den nächsten sechs Tagen, schließlich ist er mitgekommen, um zu helfen.
Daraufhin sagt er nichts mehr. Sitzt da und guckt, als säße er immer noch in der Einöde. Im Kräutergarten seiner Mutter oder auf seinem Korbstuhl vor dem Haus. Er scheint innerlich gegen den Gedanken anzukämpfen, dass er sich gerade zum ersten Mal von zu Hause entfernt – und zwar fliegenderweise und mit 700 Stundenkilometern.
Sein Finger findet den Knopf, und der Sitz kippt nach hinten, aber von hinten wird dagegengearbeitet, sodass er wieder nach vorne ruckt – und dann packt er umständlich seine Reiselektüre auf den Tisch, mehrere Bücher über persische Mystik. Um sie nach einer Weile genauso umständlich wieder wegzupacken und stattdessen mit den Iran-Air-Socken und der Duty-free-Broschüre herumzuhantieren, als wäre er darauf aus, mich anzustecken mit seiner Fickrigkeit.
Aber ich sitze hier ruhig, drehe den Blick zum Fenster. Ich sitze hier mit einem ruhigen Gehirn.
Vor mir auf dem Tischchen: mein Brustbeutel. Darin die Adresse und die Telefonnummer von Abolfazl Merizadi, die ich in Anas zurückgelassenen Klamotten gefunden habe. Er will schon mal versuchen, Kontakt zu Anas Mutter herzustellen, hat er am Telefon gesagt, oder zumindest Kontakt zu Kontaktmännern, schließlich ist Anas Mutter Kommunistin, bewegt sich im Untergrund und hat keine Adresse. Wir sollten einfach erst mal kommen, Ana habe sich zwar noch nicht gemeldet, er kenne sie ja gar nicht richtig, aber wir würden sie schon ausfindig machen. Seine Familie sei um mehrere Ecken mit ihrer bekannt.
In diesem überraschend guten Englisch. Sehr klar und sehr nett.
Draußen: glasklare Stadtlandschaften, unsagbar tief unter den Wolken. Ein im aufgeschlagenen Stein funkelnder Erdschatz. Lichtteppiche, die sich im Gebirge verlieren, die sich durch Täler und mittels Brücken über Flüsse ziehen. Ich sage mir, dass es eine beseelte, bedeutsame Erdoberfläche ist, die da unten schimmert. Eine, auf der man Spuren lesen und Wege finden kann, auf der man vielleicht mal fehlgeht, aber nur, um wieder zurückzukommen und die richtige Route zu nehmen. Und dass es Ana eines Tages so sehen wird, dass wir von irgendwoher auf diese Sache zurücksehen werden – und dass sie dann sagt: Du hast es tatsächlich gemacht. Du hast mich da rausgeholt, du hast mich gerettet.
Auf den Monitoren läuft ein Actionfilm. Robert liest.
2
Teheran, Imam-Khomeini-Airport. Die Luft ist ein versmogt kochender Farbbrei, der Schweiß läuft mir in die Augen. Vor dem Haupteingang streunen Hunde herum, über den Souvenir-Läden blinken krabbelnde Leuchtschriftzüge, laute Rhythmen scheppern aus einem Taxi weiter hinten. Ein paar Fahrer sitzen auf den Leitplanken und grillen, während andere am Eingang wütend nach Kunden schreien. Ein großer Mensch mit einer hellgrünen Uniform, einer Sonnenbrille und einem Maschinengewehr steht plötzlich bei uns, scheint etwas zu suchen und verschwindet wieder hinter den Taxis.
Robert ist schon vorgegangen und sieht sich etwas zu auffällig um, ragt als dünne weiße Stange heraus, während neben ihm ein junger breiter Mensch steht und ganz aufgeregt eine Pappe mit unseren Namen hochhält. Er lässt sie immer wieder sinken, als wäre ihm nicht ganz wohl dabei, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, sieht mehrmals auf die Uhr. Wahrscheinlich unterscheiden wir uns für ihn kaum von den anderen Fluggästen, die jetzt mit Rollkoffern und durchgesessenen Gesichtern aus der Drehtür kommen.
Er trägt einen zu großen Fleecepullover mit der Aufschrift Hard & Heavy, wirkt allerdings auffällig gutmütig und weich.
«Abulfazl Merizadi?», frage ich.
«SEID IHR DAS?», ruft Abolfazl Merizadi.
Seine Stimme ist viel dunkler und kräftiger als am Telefon. Er drückt uns nacheinander, als würden wir uns ewig kennen. Ich löse mich etwas beschämt vom fremden Holzgeruch seines Pullovers.
«Nennt mich Abu! Ich freu mich schon die ganze Zeit, dass ihr kommt!»
Wir brettern in seinem abgewrackten Auto durch die Wüstenlandschaft: Ausgetrocknete Flüsse fliegen vorbei, flache Ruinen. Am Straßenrand sind ab und zu Leute mit Schubkarren zu sehen, dazwischen Kinder mit Plastiksäcken auf dem Rücken. Abu rät mir, mich nicht gegen die Hintertür zu lehnen, weil ich sonst auf die Straße falle, ich sitze also lieber ganz steif. In der Ferne taucht eine riesige Steinfaust auf, anscheinend ein politisches Denkmal, das sich aber verwandelt, als wir näher kommen: Es ist nur eine Handywerbung. Eine riesige Steinfaust streckt ein riesiges Steinhandy in den Himmel. Und im nächsten Moment ist sie schon wieder verschwunden, wir drehen um und schießen mit neuer Wucht drauflos, alles ist braun und verschwommen in der Abenddämmerung, nur die Lichter der Autos strahlen hell. Abu lacht mich im Rückspiegel an. Mir fällt auf, dass er viele kleine Falten um die Augen hat, obwohl er erst um die zwanzig sein kann.
Es sei schon ungewöhnlich, dass sich meine Freundin drei Wochen nicht melde, sagt er, auch wenn das nicht zwangsläufig heißen müsse, dass sie Probleme mit der Polizei bekommen habe. Schließlich würden westliche Touristen nicht einfach so verhaftet werden, bei aller Willkür.
«Oder ist sie auch Kommunistin?»
«Eigentlich nicht, sie sucht nur ihre Mutter.»
«Ich hab ein paar Fotos, auf denen Anas Mutter mit meiner Mutter zu sehen ist! Die zeig ich euch gleich! Aber kommt erst mal an. Ich bin so froh, dass ihr da seid!»
Zwei Hügel schieben sich auseinander, und Teheran schält sich aus dem Nebel. Schleimig gelb und flach und laut. Die Ampeln blinken orange, als wollten sie den Verkehr anfeuern. Wir überholen eine Familie auf einem Moped und einen Pkw ohne Türen, und an der nächsten Kreuzung springt plötzlich ein schreiender Mann aus einem Wagen und verfolgt zwei Kinder, die mit einer Eisenstange zwischen den Autos verschwinden – das Dauerhupen schwillt nur unwesentlich an. Abu lenkt mit einer Hand und mustert mich im Rückspiegel, während er Gas gibt, scharf im Kreis, dann an einem Palast vorbei, eine dunklere Straße hinauf, zwischen Werkstätten und Wiesen mit vereinzelt grasenden Schafen. Als ich aus dem Rückfenster sehe, entdecke ich wieder den Soldaten vom Flughafen, den Typen mit der hellgrünen Uniform und der Sonnenbrille, wie in einem billigen Film. Er sitzt dicht hinter dem Lenkrad, ein grüner Pkw – und dann nimmt er seine Sonnenbrille ab, weicht meinem Blick überhaupt nicht aus.
Abu sagt, das sei schon okay, es könne sehr gut sein, dass sich ein Beobachter an uns hefte – wir sollten uns einfach wie normale Touristen verhalten, dann würde er nach einer Weile wieder verschwinden.
«Hat nichts mit euch persönlich zu tun!»
Dann bremst er, springt raus und legt Steinplatten hinter die Reifen, weil der Wagen sonst rückwärts die Straße runterrollen würde. Der grüne Pkw fährt langsam vorbei. Vor uns befindet sich eine Reihe von etwa fünfzig exakt gleichen, lehmfarbenen Vierecken. Alle mit einer blauen Holztür und einem kleinen blauen Fenster.
3
Wir sitzen auf einem großen, weinroten Teppich. Im einzigen Raum des Hauses. Umgeben von rissigen Lehmwänden und kitschigen kleinen Gemälden, auf denen Löwen und Adler zu sehen sind. In einer Ecke ist eine Kochnische durch eine Lehmmauer abgetrennt, mit Plastikblumen und Papiergirlanden verziert, dahinter dampfen Töpfe: Abu und seine Mutter haben direkt mit dem Kochen angefangen. Es gibt einen riesigen Flachbildfernseher, über dem ein Foto von Abus Bruder in Militäruniform hängt. Im Garten ein Plumpsklo, auf das ich eigentlich muss. Aber ich traue mich nicht, es kommt mir jetzt vor, als wären wir irgendwie unbefugt hier eingedrungen, als hätten wir jemanden nicht gefragt, den wir hätten fragen müssen. Zum Beispiel Abus Vater. Der sich schweigend Nüsse in den Schnurrbart steckt.
Er sitzt uns im Schneidersitz gegenüber, heftet seine schwarzen Augen auf uns und schweigt einfach vor sich hin. Nur sein Schnurrbart bewegt sich ab und zu. Ich bin vollkommen durchgeschwitzt, obwohl ich nur ein Unterhemd und eine von den luftigen bunten Haushosen trage, die Abu uns gegeben hat. Und der Vater sitzt drahtig und fremd da, guckt abwechselnd mich und seine nackten Füße an.
Ich sage: «Hallo?»
Keine Antwort von ihm.
Robert steht auf und geht zur Küchennische rüber, um Abu und seiner Mutter zu helfen, aber das ist offenbar unangebracht, die Mutter schiebt ihn lachend zurück. Sie ist in etwa so groß wie Abu, nur etwas dicker und runder, ein fröhlicher Vogel mit ihrem rosa Kopftuch und den langen Spülhandschuhen. Allerdings so übertrieben freundlich, dass es mich misstrauisch macht – als wäre es etwas Großartiges, dass hier zwei junge Deutsche sitzen, die Hilfe brauchen.
Kleine Lacher kleckern aus der Küchennische, während Robert sich wieder hinsetzt. Er guckt den Vater an, und dann guckt er dessen Füße an, und als ich ihn ansehe, nippt er an seinem Teeglas und schiebt mir das Kandiszuckerdöschen hin. Er gibt sich offensichtlich immer noch Mühe, locker auszusehen, aber die Anspannung sitzt ihm im Gesicht, und seine Allergie ist stärker geworden, diese weißen Pusteln an seinem Hals. Ich erinnere ihn besser nicht daran, was Ana uns damals gesagt hat, auf den Feldern vor dem Haus: dass man in Teheran tatsächlich jedem misstrauen müsse, dass es überall Spitzel gebe. Schließlich ist er jemand, der auch dann Spitzel wahrnimmt und panisch wird, wenn es gar keine gibt. Zumindest war das früher so, als er seine Medikamente noch nicht hatte.
«Schön hier», sagt er jetzt.
Die Augen des Vaters sind leer.
Also gut. Ich hole die Gastgeschenke aus der Plastiktüte: den Kühlschrankmagneten in Form einer Deutschlandkarte, das Deutschlandtrikot, das Deutschland-Quartett, das kölnisch Wasser, den Deutschland-Bildband, den ich dem Vater hinschiebe. Und der Vater wird tatsächlich etwas beweglicher, seine Augenbrauen wandern nach oben, während er das Buch durchblättert: Schloss Neuschwanstein, die Lüneburger Heide, Burg Hohenzollern, die Mecklenburgische Seenplatte. Außerdem allerhand Würste und Wälder, eine dicke Frau vor einem Fachwerkhäuschen. Er legt den Finger auf die Frau und sieht uns an – und mir wird schlagartig klar, dass er schüchtern ist. Der Vater ist unsicher, das ist es anscheinend. Einfach ein zurückhaltender Mensch.
«Mutter?», sagt er.
Wir schütteln die Köpfe. Offenbar meint er, dass die Frau aus dem Buch unsere Mutter sein könnte. Abu kommt aus der Küchennische und wechselt ein paar schnelle, kratzige Worte mit ihm.
«Mein Vater will erst mal eure Mutter kennenlernen, bevor wir alles andere besprechen!»
«Wie das?», sagt Robert.
«Na, mit Skype!»
Er geht zum riesigen Bildschirm und friemelt daran herum. Er stöpselt Kabel um, richtet eine kleine Kamera aus und loggt sich ins Internet ein, während der Vater das Foto des Bruders auf dem Teppich aufstellt. Offenbar soll die ganze Familie versammelt werden. Die Mutter kommt auch schon rüber.
Wir brauchen eine ganze Weile, um zu erklären, dass meine Mutter tot ist und dass sich meine Adoptivmutter beziehungsweise Roberts Mutter mit so was nicht auskennt. Abu will gar nicht glauben, dass wir keine echten Brüder sind, er sagt, wir würden uns so ähnlich sehen. Und es würde ihn wirklich freuen, jetzt unsere Mutter kennenzulernen.
«Wir sind keine Brüder, und wir haben einfach kein Skype», sagt Robert. «Ich kann euch höchstens ein Foto von meiner Mutter zeigen.»
Er holt es raus – ich kenne es, er hat es immer in seiner Gürteltasche: Frances auf dem Korbstuhl vor ihrem Hippiehaus. Ein bisschen wie eine Postkarte: links ein Heuballen, rechts ein blühender Busch, in der Mitte Frances mit ihren Leinenklamotten – noch etwas jünger und nicht gut zu erkennen, deshalb wirkt sie einigermaßen freundlich. Und er holt noch ein Foto raus: wir beide als Kinder auf den Rapsfeldern vor der Scheune, mit ernsten Gesichtern im gelben Leuchten.
Abus Eltern betrachten die Fotos eine Weile, nicken und sagen, ja, dieses Haus und auch Roberts Mutter seien sehr hübsch, jetzt würden sie aber lieber skypen wollen. Sie sehen es einfach nicht ein: Deutsche ohne Skype. Irgendjemand aus der Familie müsse doch Skype haben, einer von unseren Cousins oder Neffen oder Onkeln.
«Es gibt nur uns und meine Mutter», sagt Robert.
Ein ungutes Schweigen entsteht.
Abu wirkt fast beleidigt, während er die Kabel wieder ausstöpselt.
Erst nach und nach kehrt seine Freundlichkeit zurück. Er sagt, es sei natürlich in Ordnung, er könne verstehen, wenn es uns noch zu früh sei für so was, vielleicht könnten wir es ja morgen oder übermorgen mit dem Skypen versuchen.
Tee. Tee beim Essen und nach dem Essen wieder Tee. Vor uns auf den Tellern glänzen Knochenreste in der stehenden Hitze, wir haben jeder ein Huhn mit Soße und Reis im Bauch. Viel zu viel, weil uns Mutter Merizadi immer nachgeladen hat, aber sie scheint davon überhaupt nicht müde geworden zu sein, sie plaudert fröhlich auf Persisch vor sich hin, als gäbe es nur diese eine Sprache auf der Welt.
Abu übersetzt, dass sie sich selbstverständlich noch an Anas Mutter erinnern könne, dass Anas Mutter das wildeste Mädchen in der Nachbarschaft gewesen sei und immer mit den Jungs Fußball gespielt habe, damals am Kaspischen Meer. Der Kontakt sei allerdings vor knapp zwanzig Jahren abgebrochen – seit Anas Vater damals mit Ana nach Deutschland geflohen sei.
«Das letzte Mal hat meine Mutter sie hier in Teheran gesehen, auf dem Basar», sagt Abu. «Da sollte man morgen anfangen zu suchen! Es gibt auch ein Foto von einem Baby, das Ana sein könnte. Und zwar aus dem Tuchladen meines Chefs. Gar nicht weit von hier.»
Abus Mutter nickt, setzt sich sehr gelenkig in den Schneidersitz und holt allerhand Fotos aus einer Schachtel, auf denen sie mit Anas Mutter zu sehen ist: als junge hübsche Mädchen vor einem Pferd; mit einer ganzen Gruppe von Mädchen auf einer Picknickdecke.
Abu gibt mir das Babyfoto: ein fröhliches Gesicht, das aus einem Haufen bunt schimmernder Tücher guckt. Schwer zu sagen, ob es wirklich Ana ist. Aber er sagt, sein Chef sei so oder so unser Mann – er habe Einfluss, Verbindungen und kenne sich aus. Nassir heiße er, aber wir sollten ihn besser mit Nassir Chan ansprechen. Das bedeute in etwa: der große Helfer.
4
Morsezeichen über der Stadt. Verrat mir, was passiert ist. Lenk meine Schritte in deine Richtung.
Vom Flachdach der Merizadis aus über die Straßen blickend.
Aber da sind natürlich keine Morsezeichen, zumindest keine mit Sinn, stattdessen: das Mosaik der nächtlichen Gärten, die vielen bunten Glühbirnen und funkelnden Lichter, ein künstlicher Tag über dem gesamten Viertel.
Auf dem Rand des Flachdachs spaziert ein Fasan wie in Trance, hüpft und läuft auf einer Lehmmauer weiter. Die Innenhöfe bilden ein lehmbraunes Schachbrett voller Satellitenschüsseln und Wäscheleinen. Vereinzelte Kinder, die ebenfalls auf den Mauern balancieren, die dem Fasan in einer Kolonne folgen und ihn mit Haarspray vollsprühen, wenn ich das richtig erkenne.
Kein Mond.
Stattdessen Anas Stimme in meinem Kopf.
Stell dir mal vor, man könnte immer nur die ORGANE von einem sehen, dass jeder Mensch zum Beispiel nur als DARM durch die Gegend gehen würde. Wär doch komisch! Dass einfach eine Kette von Därmen in der Luft über dem Bürgersteig schwebt. Meinst du, du würdest mich mögen, wenn ich nur noch ein sprechender DARM wäre, wenn der Rest von meinem Körper sich auflösen würde?
Ich weiß nicht, warum ich ausgerechnet daran denke. Ich sehe eine Kette von kleinen Därmen auf der Mauer langschweben – der Reihe nach dem Fasanendarm hinterher.
Wusstest du, dass es im Iran Polizisten gibt, die MÄDCHENDAUMEN sammeln? Also, wenn ich eines Tages zu meiner Mutter fliege, werde ich mir auf jeden Fall einen Stromschocker oder so was kaufen. Oder du beschützt mich, aber dann musst du erst noch ins FITNESSSTUDIO gehen. Oder meinst du, du kannst es mit daumensammelnden Polizisten aufnehmen? Wohl kaum!
Sie hat es einfach so dahingeredet. Wahrscheinlich ohne Gefühl dafür, wie gefährlich oder ungefährlich es ist, wie ihre Mutter hier überhaupt lebt.
Auf der anderen Seite des Daches steht Robert und lächelt mir zu, einen dünnen Wasserschlauch in der Hand. Er ist in Badehosen und führt seine Waschung durch, dieses meditative Ritual, bei dem ich ihm als Kind immer gern zugesehen habe. Er duscht nie, ich weiß nicht, warum: Er wäscht jeden Körperteil einzeln, als wollte er eine Inventur seines Körpers aufnehmen. Es beruhigt ihn wahrscheinlich, das zu tun. Seift sich da ganz konzentriert das rechte Bein ein und spült es ab, dann das andere Bein, den Bauch, die Arme. Sein Körper ist sehr filigran, als hätte sich ein Bildhauer reingesteigert, bis die Skulptur noch feiner geworden ist, als ein Körper es eigentlich sein kann. Als er fertig ist, trocknet er sich gründlich ab und zieht sich an, sieht einen Moment nach oben, als suchte er seinen Heimatplaneten. Dann nickt er mir sanft zu und steigt wieder nach unten.
Ganz selbstverständlich. Unter diesem Teheraner Himmel.
Den es allerdings gar nicht gibt, weil er sich ja nur in Anas Kopf befindet – zumindest hat sie sich mal eine Zeitlang in diesen Gedanken reingesteigert, nachdem sie irgendein Reclam-Heft gelesen hatte.
Wusstest du nicht, dass das die einzige vollkommen WASSERDICHTE Philosophie ist, die es gibt? Ist doch klar, dass sich alles immer nur in MIR befindet. Ich bin SOLIPSISTIN, es hat noch nie jemand ein Argument dagegen gefunden. Weil es STIMMT. Du läufst immer durch dein eigenes Gehirn, beziehungsweise durch meins, weil es dich ansonsten gar nicht GIBT.
Aber wo bist du dann jetzt, denke ich. Wie kannst du dann so abwesend sein im eigenen Hirn.
Neben mir befindet sich ein kleiner Holzverschlag. Darin zwei Pappkartons mit weiteren Fotos. Abu hat gesagt, sein Vater habe früher Fotograf werden wollen und alles und jeden fotografiert. Ich solle mal sehen, ob ich da noch was finde.
Es sind Unmengen, meine Arme verschwinden bis zu den Ellenbogen darin. Ein langsam vergärendes Archiv. Ich versuche, systematisch vorzugehen, irgendwelche Zusammenhänge zu erkennen, Einzelpersonen sind kaum zu sehen, das fällt auf, meistens drängen sich ganze Mannschaften ins Bild: Tanten, Onkel, Neffen und Cousinen. Ich finde etwa zwanzigmal das gleiche Hochzeitsfoto von Abus Eltern: Sie stehen nebeneinander und lächeln extrem verkniffen, eine starre Pose, vielleicht das Startbild einer arrangierten Ehe, jedenfalls sieht es so aus. Aber was ich suche, sind Gesichter, die neben Ana oder ihren Eltern zu sehen sind – weitere Menschen, die Abu erkennt und die man befragen könnte.
Ich sehe: Mutter Merizadi mit Abu im Arm. Diesmal schon zufriedener lächelnd. Eine Gruppe von etwa dreißig Frauen mit schreiend bunten Kopftüchern auf einer Wiese. Ein verschwommenes Puzzle, etliche Jahrzehnte Familie. Zwischendurch ein halber Fuß in Großaufnahme.
Von der Straße kommen Stimmen, ich gehe aus dem Verschlag und sehe nach: Großfamilien, schon wieder, Menschen ohne Ende. Grillende Grüppchen, ein paar Tee- und Fruchtsaftstände, eine Festivalatmosphäre in der ersten kühlen Luft nach der Hitze des Tages. Die Straße scheint aus ineinander übergehenden Sippen zu bestehen, alle rufen hin und her, ein einschläfernder Stimmteppich liegt in der Luft.
Aber warum hörst du das jetzt nicht, denke ich, warum sind wir beide nicht auch da unten. Als junges Ehepaar vielleicht, als Teil dieser Sippen. Warum stehe ich hier alleine mit diesem Klang im Kopf, wenn doch alles in deinem Kopf ist.
«Liebst du sie?», fragt später eine Stimme im Dunkeln.
Wir liegen auf dünnen Matratzen, die ganze Familie im selben Raum. Die Mutter schnarcht, der Vater liegt still daneben, Robert in der Ecke pfeift leise durch die Nase. Nur Abu ist wieder wach geworden, und ich bin sowieso noch wach, zumindest mit einer Hälfte meines Gehirns. Es ist kühler geworden, weit entfernt rauscht der Verkehr, ab und zu leuchtet der gelbe Blümchenvorhang vor dem Fenster im Licht eines vorbeifahrenden Autos.
«Liebst du sie wirklich?», flüstert Abu. «Hast du in Deutschland schon viele geliebt?»
«Wie meinst du das?»
«Na, ich habe gehört, dass man in Deutschland viele lieben kann und viel Spaß hat, weil man sich einfach trennt, wenn man keinen mehr hat. Also, dass man dann wieder neue Beziehungen hat, sooft man will. Ist doch so, oder nicht?»
«Ich weiß nicht.»
«Seid ihr verlobt? Hast du sie geküsst? Also, ich hab erst einmal eine Frau geküsst. Ich war bei ihr zu Besuch, und wir haben Federball gespielt, und dann haben wir beide nach dem Federball gegriffen, und da hab ich sie einfach geküsst. Und am nächsten Tag habe ich meine Mutter hingeschickt, und ihr Vater hat gesagt, dass ich erst zum Militär muss, bevor ich sie heiraten kann, und ich hab zwei Jahre lang meinen Militärdienst gemacht. Aber was ist, als ich wiederkomme? Da war sie schon verheiratet. Love is a losing game, sage ich immer.»
«Was?»
«Kennst du nicht dieses Lied von Amy Winehouse? Jetzt hab ich auf jeden Fall genug von Iranerinnen, jetzt will ich eine Kanadierin oder eine Engländerin oder von mir aus eine Neuseeländerin. Ich will auswandern und neuseeländische Kinder kriegen, oder deutsche. Kennst du Kanadierinnen? Was meinst du, in welchem Land man am meisten Spaß haben kann?»
Er sieht mich an. Es ist dunkel, aber ich spüre, dass er mich ansieht.
«Amy Winehouse war die Lieblingssängerin von meiner zweiten Liebe, der hab ich sogar an die Titten gefasst. Aber die ist jetzt auch schon verheiratet. Wie will man da glücklich werden?»
«Titten?»
«Was?»
«Jedenfalls kenne ich das Lied.»
Und ich will ihn gerade fragen, ob es tatsächlich denkbar ist, dass er nach Neuseeland auswandert, aber ich komme nicht dazu, denn er fängt plötzlich an, mir seine Kissen rüberzureichen.
«Du liegst zu hart!»
Im nächsten Moment ist seine Mutter wach und reicht mir auch ein Kissen.
«Ich liege gut», sage ich.
«Du liegst nicht gut?», sagt Abu.
Und plötzlich kommen noch zwei Kissen und noch eine Decke, und Abu steht auf und besteht darauf, dass wir die Matratzen tauschen.
«Meine ist viel weicher! Meine ist wirklich zu weich für mich. Ich kriege Rückenschmerzen davon!»
Und Robert wacht auf und gibt mir ein Kissen, und Abus Mutter reicht mir noch eine Decke rüber, sodass ich am Ende mit drei Decken und acht Kissen daliege.
«Wir werden sie finden», sagt Abu zu mir.
5
Wir tauchen in den dunklen Teil des Basars. Am nächsten Tag. In den schwülen Fischgeruch der Tunnelstadt. Ich habe Abu und Robert geweckt, nachdem ich im Morgengrauen eine Stunde die Straße abgegangen bin; ich habe mir an einem kleinen Stand einen Stadtplan gekauft, was allerdings überhaupt nichts bringt, weil er eher nach einer Kinderskizze aussieht als nach einem wirklichen Plan. Abu sagt, es gebe in Teheran zu viele Straßen, als dass je ein Mensch einen exakten Plan davon zeichnen könnte, zumal die Straßen andauernd verschwinden oder neu entstehen. Diese Skizze sei allenfalls das Skelett eines Krüppels – das hätte sein Chef aus dem Tuchladen mal gesagt: dass Teheran wie ein riesiger Krüppel sei. Ein verrückter Krüppel! Und sein Chef habe eben einen Überblick über die Dinge.
Ultra City steht mit Kreide auf einem Schild vor einem Friseursalon – und dahinter geht es steil abwärts in die feuchten Tunnel, vorbei an Höhlen, in denen kleine Männer neben Bergen von Gummischläuchen sitzen, neben Bergen von Schuhen und Schrauben und Töpfen. Rechts hängen gebogene Dolche an der Wand, links geht es in ein ersticktes Zwitschern: Bunte Vögel sitzen in verschnörkelten Käfigen, teilweise halb tot. Immer wenn ich einen Tuchladen entdecke, biegt Abu gerade in einen anderen Gang, und da gibt es dann ebenfalls Tücher, außerdem Blüten, getrocknete Eidechsen, Seifen und Kerzen.
Durch einen Torbogen mit abbröckelnden Blumenornamenten erreichen wir einen Brunnen, an dem sich dürre, ältere Männer waschen, und Robert bleibt sofort stehen, weil sich diese Männer genauso gewissenhaft waschen wie er. Er steht da und guckt, als hätte er gerade seine Artgenossen entdeckt.
«Da hab ich von gelesen!», sagt er. «Das sind die Waschungen vor dem Gebet! Wudhu.»