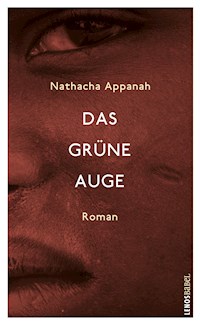
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lenos Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Lenos Babel
- Sprache: Deutsch
Eine junge Frau auf einer Insel der Komoren schenkt einem Jungen das Leben. Er hat ein schwarzes und ein grünes Auge, Zeichen eines Fluchs, wie sie glaubt. Verzweifelt bringt sie das Neugeborene auf gefährlicher Route übers Meer auf die Nachbarinsel Mayotte, die zu Frankreich gehört, und überlässt es dort der Krankenschwester Marie. Diese nennt den Jungen Moïse und gibt sich Mühe, dem Kind ein liebevolles Zuhause zu bieten. Doch als Marie unerwartet stirbt, ist Moïse auf sich allein gestellt. Er schliesst sich einer der Jugendbanden an, die die Strassen des Elendsviertels beherrschen, das alle Gaza nennen. Hier behauptet ihr Anführer Bruce mit Drogenhandel und roher Gewalt seine Autorität. Für Moïse eine neue Welt, die ihn auf der Suche nach seinen Wurzeln nicht mehr loslässt. Nathacha Appanah erzählt mit poetischer Kraft von der brutalen Lebensrealität einer Jugend, die sich selbst überlassen ist. Sie rückt einen wenig beachteten Teil Frankreichs in den Fokus. Und nicht zuletzt ist ihr Roman auch eine Fabel über Abstammung und Identität. Der Roman wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u.a. dem Prix France Télévisions und dem Prix Femina des lycéens. Ausserdem war er nominiert für den renommierten Prix Goncourt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 204
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
www.lenos.ch
Nathacha Appanah
Das grüne Auge
Roman
Aus dem Französischenvon Yla M. von Dach
Die Autorin
Nathacha Appanah, geboren 1973 in Mahébourg (Mauritius). Die Autorin und Journalistin mit indischen Wurzeln lebt seit 1998 in Frankreich, 2008–2010 lebte sie auf Mayotte. Sie veröffentlichte Artikel u.a. in der Zeitschrift GEO und im Air France Magazine sowie Reportagen auf France Culture und RFI. Ihr literarisches Werk umfasst sieben Romane und mehrere Essays. Sie wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.
Die Übersetzerin
Yla M. von Dach, geboren 1946, lebt als freischaffende Übersetzerin und Schriftstellerin in Paris und Biel. Sie hat u. a. Nicolas Bouvier, Sylviane Chatelain, Catherine Colomb, François Debluë, Marie-Claire Dewarrat, Sandrine Fabbri, Alice Ferney, Janine Massard, Sylviane Roche, Catherine Safonoff, Henri Troyat, Alexandre Voisard und Yvette Z’Graggen übersetzt. Ihre Übersetzungen wurden mehrfach ausgezeichnet, u. a. erhielt sie 2000 den Prix lémanique de la traduction, 2016 den Terra Nova Preis Übersetzung der Schweizerischen Schillerstiftung und 2018 den Spezialpreis Übersetzung des Bundesamts für Kultur.
Titel der französischen Originalausgabe:
Tropique de la violence
Copyright © 2016 by Éditions Gallimard, Paris
E-Book-Ausgabe 2021
Copyright © der deutschen Übersetzung
2021 by Lenos Verlag, Basel
Alle Rechte vorbehalten
Coverfoto: Wilhan José Gomes / Pixabay
eISBN 978 3 85787 988 3
www.lenos.ch
Inhalt
Die Autorin
Die Übersetzerin
Marie
Moïse
Bruce
Olivier
Marie
Moïse
Bruce
Moïse
Bruce
Moïse
Bruce
Moïse
Stéphane
Moïse
Bruce
Stéphane
Moïse
Bruce
Moïse
Olivier
Bruce
Marie
Moïse
Glossar
Dank
Das grüne Auge
»Dort?«, fragte ich.
»Dort«, antwortete Gatzo. »Es ist ein schönes Land.«
Henri Bosco, L’Enfant et la rivière
L’Enfant et la rivière (1945). Die im Buch zitierten Stellen wurden folgender deutschen Ausgabe entnommen: Die schlafenden Wasser. Aus dem Französischen von Renate Nickel und Wolfgang Stammler. Stuttgart: Freies Geistesleben 1998.
Marie
Sie müssen mir glauben. Woher ich zu Ihnen spreche, da nützen falscher Schein und Lügen nichts. Wenn ich den Meeresgrund betrachte, sehe ich Männer und Frauen mit Dugongs und Quastenflossern schwimmen, ich sehe Träume an den Algen hängen und Säuglinge in den Weihwasserbecken schlafen. Von da, wo ich zu Ihnen spreche, gleicht dieses Land einem glühenden Staubkorn, und ich weiss, dass ein Nichts genügen wird, damit es Feuer fängt.
Ich erinnere mich nicht an mein ganzes Leben, denn hier bleibt nur der Rand der Dinge übrig und das Geräusch von allem, was nicht mehr ist.
Daran erinnere ich mich.
Ich bin dreiundzwanzig, und der Zug fährt ein, blau und schmutzig. Ich verlasse das Tal meiner Kindheit, wo ich ein schwaches, verlorenes, von den Bergen erdrücktes kleines Ding war. Ich kann das Schwarz des Winters nicht mehr sehen, das auf die Häuser und die Gesichter heruntertropft, ich ertrage den Schimmelgeruch nicht mehr, der schon frühmorgens in der Luft liegt, ich ertrage meine Mutter nicht mehr, die den Kopf verliert, dauernd redet und den ganzen Tag Chansons von Barbara hört.
Ich bin vierundzwanzig und immer noch gleich schwach und verloren. Ich schliesse in einer grossen Stadt meine Ausbildung zur Krankenschwester ab. Ich lebe in einer geräumigen Wohnung mit drei anderen Studentinnen zusammen, und es gibt Abende, da wirken der Lärm, das Licht und die Gespräche auf mich wie ein schwarzes Loch, das mich verschlingt. Ich habe mehrere Liebhaber, ich bumse wie eine Frau, die ich nicht kenne und die mich ein wenig anekelt. Ich nehme, verlasse, nehme von neuem, und niemand sagt etwas. Ich beschliesse, nachts zu arbeiten, im Krankenhaus. Manchmal strecke ich mich auf den aufgedeckten, noch warmen Betten aus und versuche mir vorzustellen, wie es ist, jemand anders zu sein.
Ich bin sechsundzwanzig, und ich lerne Chamsidine kennen, der Krankenpfleger ist wie ich. Als er mich zum ersten Mal anspricht, geschieht etwas Merkwürdiges mit mir. Mein Herz, dieses solide in meiner Brust befestigte Organ, sinkt in meinen Plexus hinunter und schlägt von nun an hier, in meiner Mitte, meinem Zentrum. Chamsidine hat breite Schultern und kann einen erwachsenen Mann in den Armen tragen, ohne das Gesicht zu verziehen. Wenn er lächelt, muss ich tief in den Bauch atmen, um nicht ohnmächtig zu werden. Wenn er lacht, mit seinem schallenden, sprudelnden Lachen, spüre ich, wie mein Geschlecht sich öffnet wie eine Blume, und ich presse die Beine zusammen. Alle Krankenschwestern sind ein bisschen in diesen grossen Schwarzen vernarrt, der von einer Insel kommt, die Mayotte heisst, aber er entscheidet sich für mich, ich weiss nicht, warum, an einem Abend, als ich Dienst habe. Ich bin schüchtern, vor diesem Mann. Ich bin sechsundzwanzig und ich falle. Er spricht zu mir, als hätte er schon lange auf mich gewartet. Er erzählt mir Geschichten und Legenden aus seiner Heimat, erzählt, was ihm als Kind passiert ist, wie er einmal dies gemacht hat, wie ihm seine Mutter jenes sagte, und ich höre wortlos zu, hingerissen. Ich habe das Gefühl, Cham habe auf einer fruchtbaren grünen Kinderinsel gelebt, einer Insel, auf der von morgens bis abends gespielt wird und wo die Tanten, Cousinen und Schwestern alles wohlwollende Mütter sind. Wenn ich morgens aufstehe in der lärmigen Stadt, denke ich an dieses Land.
Ich bin siebenundzwanzig und ich heirate. Ich erinnere mich nicht an mein Kleid, aber ich erinnere mich, dass meine Mutter mit mir vor dem Rathaus wartet. Der Wind ist so stark, dass er die Töpfe mit den Buchsbäumen, die im gepflasterten Hof des Rathauses stehen, umgeworfen hat. Chamsidine verspätet sich. Meine Mutter sagt Pass auf, Marie, die Männer sind alle gleich. Da kommt Cham dahergelaufen, er lacht.
Ich bin achtundzwanzig und lebe auf Mayotte, einer französischen Insel, die in der Strasse von Mosambik liegt. Wir haben den ersten Stock eines Hauses in der Gemeinde Passamainti gemietet, ein paar Kilometer von der Hauptstadt Mamoudzou entfernt. Ich arbeite als Nachtschwester im CHR, dem Regionalkrankenhaus. Chamsidine hat eine Stelle in der Klinik von Dzaoudzi. Jeden Morgen, wenn ich um sechs Uhr früh meinen Dienst beende, gehe ich, wie auch immer meine Nacht gewesen ist, wie hart der Dienst auch gewesen sein mag, langsam, leicht, so leicht durch den Morgen. Ich laufe den Abhang hinunter und weiss, dass das kleine Mädchen auf mich wartet. Sie ist rot vom Staub, ihre Hände und Füsse sind grob wie jene der Arbeiter, ihre Haare schmutzig und grau. Sie wartet auf mich und lächelt. Bevor ich den Dienst verliess, habe ich aus der Cafeteria mitgenommen, was herumlag, eine Packung Kekse, eine Orange, einen Apfel. Zwischen ihr und mir ist eine seltsame Verbindung entstanden, seit ich hier arbeite. Ich bleibe vor ihr stehen, sie lächelt mich an, und ich gebe ihr, was ich zu geben habe. Sie sagt nie etwas, nie guten Tag, nie danke, nie auf Wiedersehen. Sie streckt rasch die Hand aus, ich spüre, dass sie nicht den Eindruck erwecken will, sie bettle, übrigens sieht sie mich an, sie blickt mir in die Augen, nie auf das, was ich ihr in die Hand lege. Sie schliesst sogleich die Finger und versteckt ihre Hand hinter dem Rücken. Ihr Lächeln wird etwas breiter. Das ist ein kleiner Bonus, dem kleinen Nichts entsprechend, das ich ihr gebe. Ich weiss nicht, ob sie Französisch versteht. Ich habe ihr nie meinen Namen gesagt und sie nie nach ihrem gefragt. Vielleicht lebt sie in der Wellblechhütte, die ich zwischen den kümmerlichen Bäumen auf dem Hügel erkenne. Vielleicht lebt sie versteckt in den Wäldchen wie viele Familien illegaler Einwanderer. Vielleicht wird das, was ich ihr gebe, unter mehreren Leuten geteilt. Vielleicht. Aber an diese Sachen denke ich nicht viel. Ich tue, was ich tue, das kostet mich nichts, sie muss mir deswegen nicht dankbar sein, es dauert kaum dreissig Sekunden, ich gehe weiter und vergesse das kleine Mädchen.
Ich verlangsame den Schritt vor der bunten Menschenansammlung, die darauf wartet, dass die Büros der Präfektur aufmachen. Die Gespräche scheinen unbeschwert, die Sonne ist noch zurückhaltend. Die blauweissrote Flagge flattert hoch. Vor dem geschlossenen Gitter kann man noch darauf hoffen, eine Nummer zu ergattern, dank der man bei einem Beamten vorstellig werden und ihm, endlich, seinen Fall, sein Leben, das Wie und Was erklären, die Unterlagen mit dem Gesuch um eine Aufenthaltserlaubnis hinterlegen, eine Empfangsbescheinigung verlangen, sich nach einer Aufenthaltskarte erkundigen, auf eine Verlängerung, auf Gehör, einen Aufschub, ein »Sesam, öffne dich« hoffen kann.
Auf der anderen Seite des Gehsteigs, sozusagen gegenüber, befindet sich eine andere bunte Menschenansammlung, jene vor der Krankenstation. Pro Tag werden hundert Nummern verteilt, und es gibt Leute, die seit vier Uhr morgens warten. Auch hier ist es noch ruhig. Wenn ich vorbeikomme, berühren sich die beiden Gruppen fast, ich bin mittendrin, ich frage mich, wie viele von ihnen, rechts oder links, in Kwassa-kwassas hier gelandet sind, diesen behelfsmässigen Booten, in denen sich die illegalen Einwanderer zusammendrängen, die von den anderen Inseln des Komorenarchipels herüberkommen.
Ich erinnere mich an dies: Ich schlängle mich unauffällig zwischen den beiden Gruppen durch, als würde ich zwischen zwei scharfen Messerklingen durchschlüpfen, und einmal auf der anderen Seite angekommen, kann ich nicht anders, als tief Luft zu holen, wie erleichtert.
Ich gehe weiter bis zum Pier; unterwegs kaufe ich Bananen, Paprika, Tomaten. Ich atme die Gerüche dieses Landes ein, das ich so liebe, ich schaue auf den Grund des Wassers, ich bewundere die Frauen. Ich beobachte gern die Kinder, die in der Reede tauchen. Sie nehmen auf der Betonmole Anlauf, ihre dünnen schwarzen Beine flitzen rasend schnell vorbei. Am Ende angekommen, springen sie mit angezogenen Knien, ausgebreiteten Armen und einem Freudenschrei in den Ozean.
Wenn die Fähre einläuft, dieses blauweisse Boot, das zwischen Petite-Terre und Grande-Terre hin- und herfährt, sehe ich schon von weitem Cham, jeden Tag schöner, jeden Tag unwirklicher in seiner Art, wie er mir gehört.
Wir gehen nach Hause, wir schlafen, wir lieben uns und erwachen mitten am Tag. Wenn ich nicht arbeite, betrachte ich gern die Nacht von unserem Balkon aus. An gewissen Stellen ist sie blau, an anderen schwarz. Die Sterne drängen sich zu Hunderten am Himmel. Ich liebe es, den Flügelschlag der Flughunde zu vernehmen. Auf der glatten Fläche des Meeres bewegen sich gelbe Punkte, wie Glühwürmchen. Es sind die Lichter der Fischerboote, die mit einer am Mast aufgehängten Öllampe ausfahren, um die Fische anzulocken.
Ich habe eine solche Lust auf dieses Land, eine Lust, alles zu nehmen, alles zu verschlingen, das Meer Schluck für Schluck, den Himmel Happen für Happen.
Ich bin neunundzwanzig, und Sie müssen mir glauben. Jeden Tag steigert sich die Erwartung, jeden Tag wächst die Hoffnung, ein Kind zu bekommen. Ich bete die Monate mit Träumen, Lachen und Liebkosungen herunter. Abzählreime steigen aus meiner Kindheit herauf wie durch Zauber, Tourne tourne petit moulin frappent frappent petites mains, Dreh dich dreh dich Mühlenrädchen, klatscht o klatschet Händchen klein, und mein Kopf ist eine Kalebasse voller Dinge, die in Reichweite zu liegen scheinen und sich mir dennoch entziehen. Es gibt so viele Kinder hier, so viele schwangere Frauen, all diese Babys in all diesen Armen, warum nicht in meinen? All diese Babys, die geboren werden, ohne dass man sie sich überhaupt wünscht, während ich doch bete, flehe. Wenn das warme Blut in mein Höschen fliesst, jeden Monat, dann weine ich und verwünsche alle diese Mütter, die ich im Krankenhaus sehe, die von nichts eine Ahnung haben, all jene Illegalen, die gekommen sind, um auf dieser französischen Insel zu entbinden, der Papiere wegen, und ich halte mich zurück, sie zu fragen Willst du es wirklich, dieses Kind, oder kommst du bloss nach Mayotte, um Papiere zu erhalten? Ich verändere mich, ich schwelle an, doch in mir gibt es nur schlechtes Fett, mir dreht sich der Kopf, und meine Worte werden scharf wie saure Milch. Am Morgen gehen mir all diese Bedürftigen, die auf ihre Papiere warten, und all die anderen, die auf ihre medizinische Behandlung warten, auf die Nerven, sie sind zu zahlreich, zu lärmig, zu dies und das. Sie müssen mir glauben. Ich verliere den Verstand, ich bin nicht mehr ich selbst. Ich taumle.
Ich bin dreissig, und ich tu nur dies: warten und weinen.
Eines Tages, im Morgengrauen, während ich im Krankenhaus gerade meinen Dienst beende, kommt das Blut. Am Abend zuvor hatte ich ausgerechnet, sechs Tage verspätet, und mein Kopf, oh, mein Kopf, wenn Sie wüssten, was in meinem Kopf war, ich hatte ein Baby, ich hatte einen Namen, ich hatte Geschichten, Vole vole petit oiseau nage nage poisson dans l’eau, Fliege flieg o Vögelein, schwimme schwimme Fischlein mein, es gab eine schöne Zeremonie für mich, ich war eine Mama in der traditionellen Kleidung von Mayotte und wurde von Chams ganzer Familie verehrt wegen dieses Mischlingsbabys, über das sein Leben lang ein guter Dschinn wachen würde.
Ich passe auf beim Gehen, ich mache mich leicht, ich spreche Gebete, ich gehe in die kleine Kapelle von Dzaoudzi und zünde drei Kerzen an. Ich bete dermassen heftig, dass mir die Ohren sausen. Doch in der Morgenfrühe rinnt mir das dicke, klebrige Blut über die Beine, trotz allem, und ich gehe nach Hause, ich nehme keine Kekspackung, keinen Apfel, keine Orange mit, und als ich zur Strassenbiegung komme, sehe ich sie, doch ich sehe sie nicht wirklich, ich spüre nur diese Flut zwischen meinen Beinen, und ich möchte diese Scheide mit grobem schwarzem Faden zunähen, damit nichts mehr herausfliesst. Ohne einen Blick gehe ich an dem kleinen Mädchen vorüber und höre He, he! Ich drehe mich um, und sie lächelt mich an, beide Hände so ausgestreckt, leer.
Sie müssen mir glauben, ich bin verrückt geworden. Ich hebe einen Stock auf und laufe auf sie zu, ich schreie ich weiss nicht was, vielleicht Verpiss dich, ja, das ist es vielleicht, es ist, als verjagte ich einen räudigen Hund. Sie macht sich eilends aus dem Staub, ich kann ihr nicht folgen, den Hang hinauf, zwischen Gebüsch und Abfällen. Ich schleudere ihr den Stock hinterher. Sie schreit, ich auch.
Ich bin einunddreissig, und Cham hat mich verlassen. Er hat bereits eine andere Frau, eine Komorerin, die er ich weiss nicht wo kennengelernt hat. Die Nutte. Sie trägt bunte Kleider, die ich Clownkostüme nenne, sie trägt die Sandelholzmaske auf dem Gesicht, und das macht ihr ein Clowngesicht. Es ist eine Clown-Nutte. Sie hat einen drallen Hintern, eine junge schwarze Haut. Willst du jetzt schwarz? Reisst du dir kleine Illegale auf? Meine Mutter hatte recht, ihr Männer seid alle gleich. Ist es geil, Neger zu vögeln? Das frage ich Cham, während das dicke rote Blut mir über die Beine rinnt und seine Hand auf meiner Wange landet. In diesem Moment, Sie müssen mir glauben, möchte ich, dass er mich wieder und wieder schlägt, dass diese Frau endlich aus mir hinausfährt, die solche Abscheulichkeiten herausschreit!
Manchmal, nachts, wenn ich allein im Haus bin, möchte ich wieder das feuchte Schmatzen hören, das unsere Körper machten, wenn sie sich aneinander rieben, ich möchte den Flügelschlag der Flughunde draussen hören und einschlafen, von Chams leichtem Schnarchen gewiegt. Ich möchte die Blätter des Ventilators kreisen sehen, während wir uns lieben. Wenn ich allein und wieder schwach und verloren bin, dann tu ich, als würde ich Cham an mich drücken, als würde ich seinen Duft einatmen, seinen Schweiss ablecken. Ich wasche die verletzenden Worte von meiner Zunge, ich schlucke den Zorn an einem Stück hinunter, ich schrubbe mit meinem Körper die Oberfläche unserer Liebe, damit sie wieder glatt und samten wird.
Doch Cham liebt mich nicht mehr, er blickt mich aus erloschenen Augen an, mit einer Grimasse auf den Lippen. Er verlangt die Scheidung, aber ich verweigere sie ihm. Er bleibt tagelang weg, dann verkündet er mir, dass er religiös geheiratet habe, und ich beschimpfe ihn wieder, aber ich will mich nicht scheiden lassen. Ich habe völlig den Verstand verloren, ich bin von meinem Zorn, von meiner Frustration, meiner Verbitterung besessen, und niemand kann mich retten. Er verkündet mir, seine Clown-Nutte erwarte ein Kind. Ich hasse dieses Land.
Ich bin bald dreiunddreissig. Manchmal begegne ich Chams Nutte, die einen Kinderwagen durch die Strassen von Mamoudzou schiebt. Sie hat keine Papiere, und mitunter kommt mich die Lust an, sie anzuzeigen, wie die Leute es während des Krieges taten. Ich denke, ich brauchte nur die PAF* anzurufen und danach ruhig vor ihrem Haus abzuwarten, um zu sehen, wie sie sie ausweisen, diese Hündin, wie sie sie aufstöbern und in ihren Jeep verfrachten, Bye-bye, Clown-Nutte, zurück nach Anjouan, die Rückfahrkarte ist gratis. Aber der kirschrote Kinderwagen stoppt mich, es ist noch gar nicht so lange her, da träumte auch ich von einem solchen Kinderwagen, mit dem ich durch die Strassen von Mamoudzou spazierte. Also gehe ich meines Weges.
Ich bin bald dreiunddreissig, und an jenem Abend, am 3. Mai, arbeite ich. Es regnet seit mehreren Tagen in Strömen, es sind nicht viele Leute da, ich sitze im Raum der Krankenschwestern, allein, und lese. Ich habe keine Freunde mehr, jene, die mich kannten, als ich mit Cham zusammen war, sehe ich nicht mehr. Auf diese Dinge habe ich ohnehin keine Lust mehr, Vollmondabende, das Geschwätz über das Land, das Elend, den Niedergang. Nur Patrick, der Krankenpflegehelfer, spricht noch mit mir. Manchmal, wenn ich ihn sehe, mit seinem geblümten Hemd, seinem Öltropfenbauch, wenn ich ihn dabei ertappe, wie er seinen Jägerblick auf die jungen schwarzen Frauen richtet, versuche ich mir den Patrick vorzustellen, der vor fünfzehn Jahren mit Frau und Kindern nach Mayotte gekommen ist. Hatte er diesen Geruch nach Zigaretten, nach Schweiss und Kölnischwasser, hatte er sein Herz und seinen Kopf bereits verschlossen, stellte er sich vor, dass er seine Freitagabende einst in der Diskothek Ninga verbringen würde, dasitzend wie ein Krösus im Kreise junger Komorerinnen und Madagassinnen, die sich ihre Muschis mit Deodorant parfümieren? Hatte er zumindest Widerstand zu leisten versucht, oder hatte er alles zum Teufel geschickt, als er begriff, welche Macht der weisse Mann hier besitzt? Doch ich verurteile ihn nicht, dieses Land zermalmt uns, dieses Land macht schlechte Menschen aus uns, dieses Land klemmt uns in seiner Kneifzange ein, und wir können nicht mehr weg. Das Telefon klingelt, man teilt mir mit, dass die Feuerwehr zwei Sanitäts-Kwassas in Empfang genommen hat. Ich lege mein Buch ab und nehme einen tiefen Atemzug. Sie fürchte ich am meisten. Die Sanitäts-Kwassas transportieren Kranke, Alte, schwangere Frauen, behinderte Kinder, Schwerverletzte, Verrückte, Menschen mit Verbrennungen. Sie machen die Überfahrt zwischen Anjouan und Mayotte, um sich behandeln zu lassen. Ich habe Frauen gesehen mit einem Krebs, der so weit fortgeschritten war, wie man es im Mutterland nur noch in Medizinbüchern sieht. Ich habe Schwerverbrannte gesehen, mit völlig verfaulter Haut, seit Tagen tote Säuglinge, die immer noch in den Armen ihrer Mütter lagen, Männer, denen Haie die Beine abgerissen hatten.
Ich bin bald dreiunddreissig, ich schliesse mein Buch, und vielleicht vergesse ich an jenem Abend, mein Herz zu verschliessen. Als ich zum Empfang hinuntergehe, stehen da schon rund ein Dutzend Menschen, alle bis auf die Knochen durchnässt. Mehrere hochschwangere Frauen, eine alte Einbeinige, ein Jugendlicher, der auf der Stelle hüpft und sich an einen Feuerwehrmann klammert, und sie, eine bildschöne junge Frau mit einem Säugling im Arm. Sie sticht mir sofort in die Augen, sie ist sechzehn oder siebzehn, scheint bei guter Gesundheit zu sein, sie hat den Blick eines erschreckten Tiers, er geht von rechts nach links, von links nach rechts, ohne je innezuhalten. Die Feuerwehrleute bringen die schwangeren Frauen auf die Geburtsstation, und ausnahmsweise denke ich an nichts, ich wünsche ihnen kein Unglück. Der Feuerwehrmann, an den sich der Jugendliche klammert, kommt zu mir und sagt Er ist verrückt. Der junge Mann beginnt zu lachen, und das erinnert mich an das Lachen von Cham. Etwas Starkes, Sanftes, Ansteckendes. Ich weise ihm den Weg zur Psychiatrieetage. Der Junge schüttelt sich weiter vor Lachen, und sein Gelächter vermischt sich mit dem Prasseln des Regens. Der Feuerwehrmann bittet mich, ich solle mich um die anderen kümmern, bis die Polizei eintreffe. Er entfernt sich rasch, doch ich höre noch lange das laute Lachen des jungen Mannes.
Nun richtet die einbeinige alte Frau sich auf und steuert, gestützt auf einen langen Stock, der ihr als Krücke dient, dem Ausgang entgegen. Sie wirft mir einen schrägen Blick zu, doch ich behalte die Hände in den Taschen meines Kittels, ich halte sie nicht auf, ich helfe ihr nicht, ich sehe ihr zu, wie sie zur Tür hinüberhumpelt und im Regen in der Nacht von Mamoudzou verschwindet. Sie hat es geschafft, sie ist in Frankreich. Ich winke das junge Mädchen herbei, und wir nehmen die Box Nummer 2. Ihr Baby ist in ein traditionelles rotgelbes Tuch gewickelt. Es weint nicht, es bewegt sich nicht. Vielleicht ist es tot? Draussen fällt der Regen, es prasselt wie Maschinengewehrfeuer.
Geschickt wickelt das junge Mädchen das Baby aus seinem Pucktuch, und ich merke, dass es bandagiert ist wie eine Mumie. Hat es Verbrennungen erlitten? Sie wickelt die Binden auf, die sogar einen Teil des Gesichts bedeckten. Der Säugling ist kaum ein paar Tage alt, er atmet, er ist nicht verbrannt, er sieht perfekt aus. Er ist perfekt. Ich beginne zu reden, doch die Mutter legt sich den Finger auf die Lippen und sagt Pst. Sie will nicht, dass wir es aufwecken. Sie zeigt auf das Auge des Babys. Ich begreife nicht, ich sehe nichts, das Baby schläft. Sie wird ungeduldig und zeigt auf ihre beiden Augen, dann auf meine, dann auf jene des Babys. Ach, Ihr Baby ist blind? Sie schüttelt heftig den Kopf, und auf einmal beginnt das Kind zu zappeln, es schmatzt mit den Lippen, einmal, zweimal, als suchte es nach der Brust, und die junge Frau streckt es mir hin, wie man etwas hinstrecken würde, das einem zugleich Angst macht und einen anwidert. Ich weiss nicht, warum ich dieses Baby nehme, das man mir gibt, und es streckt sich in meinen Armen, es ist wunderbar, dieser warme kleine Körper, der sich an mich schmiegt.
Das Kleine öffnet die Augen. Die Mutter weicht zum Bett zurück, und ich, es ist unglaublich, was ich vor mir habe, ich habe es noch nie in meinem Leben gesehen, bloss die genaue Bezeichnung gelernt während meiner Ausbildung. Das Baby hat ein schwarzes und ein grünes Auge. Es leidet an Heterochromie, einer völlig harmlosen genetischen Anomalie. Das Grün seines Auges ist wie das Grün des Brotfruchtbaums, nein, des Mangobaums, oh, ich weiss nicht mehr, es ist dieses unglaubliche Grün, das die Bäume dieses Landes im südlichen Winter manchmal haben. Es schaut mich an, mit diesem zweifarbigen Blick, ich rede mit ihm, ich sage zu ihm Guten Tag, hübsches Baby. Jetzt zeigt die Mutter mit ausholenden Bewegungen auf den kleinen Jungen Er Baby von Dschinn. Er Unglück bringen mit sein Auge. Unglück bringen.
Ich lege ihn ruhig aufs Bett, ich klappe das Gitter hoch und sage zur Mutter, ich ginge ein Fläschchen holen. Als ich ihr den Rücken zukehre, höre ich sie sagen Du ihn gernhaben, du ihn nehmen. Ich bleibe nicht stehen, ich lasse diese Worte hinter mir herfliegen wie einen wunderbaren Lichtschweif von Sternen in der mahorischen Nacht. In den wenigen Minuten, während ich in die Kinderabteilung laufe, um ein Fläschchen vorzubereiten, gehen meine Gedanken auf wie Blumen am Morgen, weit und glücklich; ich sehe mich zu Hause, mit einem Baby, mit einem Gitterbettchen, einem Spielteppich, Büchern, die man lesen kann, Petit moulin a bien tourné petites mains ont bien frappé petit oiseau a bien volé petit poisson a bien nagé. Hat gut gedreht das Mühlenrädchen, hab’n gut geklatscht die Händchen klein, ist gut geflogen das Vögelein, bist gut geschwommen Fischlein mein. Ich bin bald dreiunddreissig, und endlich habe ich ein Kind.
Ich bin vierunddreissig, und Sie müssen mir glauben, wenn ich sage, dass ich die Mama eines Jungen bin, der Moïse heisst. Das bildschöne junge Mädchen war nicht mehr da, als ich mit dem Milchfläschchen zurückkam. Ich erinnere mich an das, was ich getan habe. Ich gab dem Kleinen zu trinken, ich wusch ihn, zog ihm einen mit kleinen grauen Elefanten verzierten Body über, ich legte ihn im Säuglingssaal in eine Wiege und band ihm ein kleines blaues Armband um, auf das ich M geschrieben hatte. Dann rief ich Cham an. Er hob beim ersten Klingeln ab und hörte mir aufmerksam zu, schweigend, wie ich ihm früher zugehört hatte, wenn er von seiner Kindheit erzählte.
Sie müssen mir glauben. Da, von wo aus ich zu Ihnen spreche, nützen Lügen nichts. Als Gegenleistung für die Scheidung habe ich von ihm verlangt, dieses Kind anzuerkennen, ihm seinen Namen zu geben und allen Leuten zu sagen, es sei ein Sohn, den er mit einer Illegalen gehabt habe, und ich, seine Exfrau, sei bereit, ihn grosszuziehen. Eine falsche Vaterschaftsanerkennung gegen eine echte Scheidung. Er hat eingewilligt.
Es soll niemand kommen und mich verurteilen. Ich habe von allen Schwachstellen dieses Landes profitiert,





























