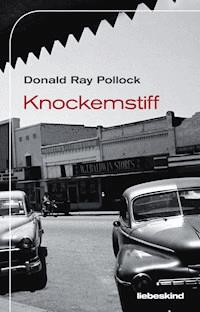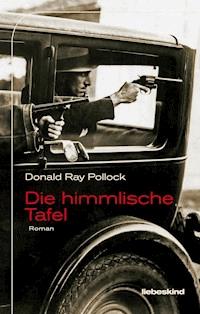8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Liebeskind
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Zwei Lebensfluchten kollidieren, eine auf dem Weg in die Verdammnis, die andere aus ihr heraus. Der junge Arvin wächst in den fünfziger Jahren im heruntergekommenen Niemandsland des Mittleren Westens auf. Hier hat sich der amerikanische Traum in einen fiebrigen Albtraum verwandelt, der bevölkert wird von psychopathischen Verbrechern, korrupten Sheriffs und religiösen Fanatikern. Arvin ringt um einen Ausweg aus dieser Welt. Doch als seine Freundin vom Ortsprediger missbraucht wird und sich daraufhin erhängt, nimmt auch er das Gesetz in die eigene Hand. Zur gleichen Zeit, nur wenige Meilen entfernt, brechen die beiden Serienkiller Carl und Sandy zur Jagd auf. Sie locken arglose Tramper in ihren Wagen, um sie dort auf brutale Art und Weise umzubringen. Irgendwo in der Tiefe des Hinterlandes, in jenem unsichtbaren Grenzgebiet zwischen Zivilisation und archaischer Grausamkeit, kreuzen sie schließlich Arvins Weg ... Unaufhaltsam verstrickt Pollock seine Leser in ein undurchdringliches Labyrinth des Bösen. "Das Handwerk des Teufels" ist ein ebenso verstörender wie mitreißender Roman über den epischen Kampf zwischen Schicksal und Moral, Schuld und Gerechtigkeit. Die Hoffnung stirbt immer zuletzt. Aber sie stirbt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Donald Ray Pollock
Das Handwerkdes Teufels
Roman
Aus dem Englischenvon Peter Torberg
liebeskind
Wieder mal für Patsy
PROLOG
An einem trüben Vormittag gegen Ende eines nassen Oktobers eilte Arvin Eugene Russell seinem Vater Willard am Rand einer Weide hinterher, von der aus man eine lange und felsige Senke namens Knockemstiff im südlichen Ohio überblicken konnte. Willard war groß und knochig, und Arvin musste sich anstrengen, um mithalten zu können. Die Weide war mit Dornengestrüpp und eingefallenen Sträuchern aus Sternmiere und Wildrose überwuchert, und der Bodennebel, der so dicht war wie die Wolken am Himmel, reichte dem Neunjährigen bis an die Knie. Nach ein paar Minuten bogen sie in den Wald ein und folgten einem schmalen Wildwechsel den Hügel hinunter, bis sie zu einem Baumstamm kamen, der auf einer kleinen Lichtung lag, Reste einer großen Roteiche, die vor vielen Jahren umgestürzt war. Ein verwittertes Kreuz aus Brettern von der Rückseite der baufälligen Scheune hinter ihrem Farmhaus neigte sich in dem weichen Untergrund ein paar Meter unterhalb von ihnen leicht nach Osten.
Willard kniete sich auf der höher gelegenen Seite des Baumstammes hin und bedeutete seinem Sohn, es ihm gleichzutun, indem er auf die braunen, feuchten Blätter neben sich wies. Wenn ihm nicht gerade Whiskey durch die Adern floss, kam Willard jeden Morgen und jeden Abend zu dieser Lichtung und sprach mit Gott. Arvin wusste nicht, was schlimmer war, das Trinken oder das Beten. Solange er sich erinnern konnte, war sein Vater ohne Unterlass dem Handwerk des Teufels ausgeliefert gewesen. Arvin zitterte ein wenig in der Feuchtigkeit und zog seinen Mantel enger um sich. Am liebsten wäre er noch im Bett geblieben. Selbst die Schule mit all ihren Kümmernissen war immer noch besser als das hier, aber es war Samstag, und er konnte sich der Pflicht nicht entziehen.
Durch die meist kahlen Bäume hinter dem Kreuz konnte Arvin eine halbe Meile entfernt Rauch aus ein paar Kaminen aufsteigen sehen. 1957 lebten etwa vierhundert Personen in Knockemstiff, und fast alle waren sie aufgrund irgendeines gottvergessenen Schicksalsschlags Blutsverwandte, ob nun aus Fleischeslust, Triebhaftigkeit oder simpler Unwissenheit. Zu den mit Teerpappe vernagelten Hütten und den aus Schlackebetonblöcken errichteten Häusern kamen noch zwei Kramläden, die Church of Christ in Christian Union und eine Kneipe, die in der ganzen Gemeinde als Bull Pen bekannt war. Die Russells hatten das Haus am oberen Ende der Mitchell Flats zwar bereits seit fünf Jahren gemietet, doch die meisten Nachbarn unterhalb von ihnen betrachteten sie noch immer als Außenstehende. Arvin war das einzige Kind im Schulbus, das nicht mit irgendeinem anderen Kind verwandt war. Vor drei Tagen war er mit einem blauen Auge nach Hause gekommen. »Ich halte nichts von Prügeleien nur zum Spaß, aber manchmal bist du ein wenig zu lax«, hatte Willard ihm am Abend gesagt. »Die Jungs sind ja vielleicht größer als du, aber wenn das nächste Mal einer mit diesem Mist anfängt, dann will ich, dass du es zu Ende bringst.« Willard hatte auf der Veranda gestanden und seine Arbeitskleidung abgelegt. Dann hatte er Arvin die braune Hose gereicht, die vor geronnenem Blut und Fett ganz hart war. Willard arbeitete in einem Schlachthof in Greenfield, und an jenem Tag waren sechshundert Schweine geschlachtet worden, ein neuer Rekord für R.H. Carroll Meatpacking. Der Junge wusste zwar noch nicht, was er werden wollte, wenn er groß war, doch er war sich ziemlich sicher, dass er keine Schweine schlachten wollte, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen.
Sie hatten gerade mit ihren Gebeten begonnen, als sie hinter sich das laute Knacken eines Zweiges hörten. Arvin wollte sich schon umdrehen, und obwohl Willard die Hand ausstreckte, um ihn daran zu hindern, sah der Junge kurz zwei Jäger, die im fahlen Licht dastanden, verdreckte, zerlumpte Kerle, die er schon ein paar Mal auf den Vordersitzen einer alten rostigen Limousine auf dem Parkplatz vor Maude Speakmans Laden hatte hocken sehen. Der eine trug einen braunen Jutesack, der am Boden voll leuchtend roter Flecken war. »Kümmer dich nicht um sie«, sagte Willard leise. »Das hier ist die Zeit des Herrn, von niemandem sonst.«
Die Anwesenheit der Männer machte ihn nervös, doch Arvin kniete sich wieder richtig hin und schloss die Augen. Willard hielt diesen Baumstamm für so heilig wie jede von Menschenhand erbaute Kirche, und die letzte Person auf Erden, die der Junge beleidigen wollte, war sein Vater, auch wenn dies manchmal wie ein Kampf schien, der nicht zu gewinnen war. Abgesehen von den Tropfen, die von den Blättern fielen, und einem Eichhörnchen, das auf einem Baum in der Nähe schimpfte, war es im Wald wieder still. Gerade als Arvin dachte, die Männer seien weitergegangen, sagte einer der beiden mit krächzender Stimme: »Herrje, die haben da ’ne kleine Erweckungsversammlung.«
»Immer langsam«, sagte der andere.
»Ach Scheiße. Ich glaub, jetzt wär die Gelegenheit, seiner Alten einen Besuch abzustatten. Die liegt wahrscheinlich eh schon in den Federn und wärmt mir die Matratze auf.«
»Halt die Schnauze, Lucas«, fuhr ihn der andere an.
»Was denn? Jetzt sag nur noch, du würdest bei der Nein sagen. Ich will verdammt sein, wenn die kein heißer Feger ist.«
Arvin sah seinen Vater unsicher an. Willard hielt seine Augen weiter geschlossen, die großen Hände lagen gefaltet auf dem Baumstamm. Seine Lippen bewegten sich schnell, doch die Worte waren zu leise, als dass sie jemand anderer als der Herr hören konnte. Der Junge dachte daran, was ihm sein Vater neulich gesagt hatte; dass man sich zur Wehr setzen müsse, wenn einem jemand dumm käme. Das waren offensichtlich auch nur Worte gewesen. Er hatte das bange Gefühl, dass die langen Fahrten im Schulbus nicht besser werden würden.
»Komm, du Idiot«, sagte der andere, »das wird jetzt zu ernst.« Arvin hörte, wie die beiden kehrtmachten und in die Richtung über den Hügel verschwanden, aus der sie gekommen waren. Lange nachdem die Schritte verklungen waren, konnte er noch immer den Maulhelden lachen hören.
Ein paar Minuten später erhob sich Willard und wartete, bis sein Sohn Amen gesagt hatte. Dann gingen sie schweigend nach Hause, kratzten sich auf den Verandastufen den Lehm von den Schuhen und traten in die warme Küche. Arvins Mutter Charlotte briet Speck in einer gusseisernen Pfanne und schlug in einer blauen Schüssel mit der Gabel Eier auf. Sie goss Willard einen Kaffee ein und stellte ein Glas Milch vor Arvin. Ihr schwarzes, glänzendes Haar hatte sie zu einem Pferdeschwanz nach hinten gekämmt und mit einem Gummiband zusammengebunden, sie trug ein verblasstes rosa Kleid und flauschige Socken, eine davon mit einem Loch an der Hacke. Arvin sah ihr nach, wie sie durch das Zimmer ging, und versuchte sich vorzustellen, was wohl passiert wäre, wenn die beiden Jäger zum Haus gekommen wären, anstatt umzudrehen. Er fragte sich, ob sie sie wohl hereingebeten hätte.
Als Willard fertig gegessen hatte, schob er seinen Stuhl nach hinten und ging mit düsterer Miene hinaus. Seit er seine Gebete beendet hatte, hatte er kein Wort mehr gesagt. Charlotte stand mit ihrer Kaffeetasse auf und trat ans Fenster. Sie schaute zu, wie er über den Hof stapfte und in die Scheune ging. Sie dachte an die Möglichkeit, dass er dort eine Flasche versteckt hatte. Die, die er unter der Spüle aufbewahrte, hatte er seit Wochen nicht angerührt. Sie drehte sich um und sah Arvin an. »Ist dein Dad wegen irgendetwas wütend auf dich?«
»Ich hab nichts gemacht.«
»Das hab ich dich nicht gefragt«, entgegnete Charlotte und lehnte sich gegen die Küchentheke. »Wir wissen doch beide, wie er sein kann.«
Einen Augenblick lang überlegte Arvin, seiner Mutter zu erzählen, was am Gebetsbaum passiert war, doch die Scham war zu groß. Bei dem Gedanken, dass sein Vater einen Mann so über Charlotte hatte reden hören und einfach darüber hinweggegangen war, wurde ihm übel. »Wir hatten nur eine kleine Erweckungsversammlung, das ist alles«, sagte er.
»Erweckungsversammlung?« fragte Charlotte. »Wo hast du das denn her?«
»Weiß nicht, hab ich irgendwo gehört.« Arvin stand auf und ging durch den Flur in sein Zimmer. Er schloss die Tür, legte sich aufs Bett und zog die Decke über sich. Er drehte sich zur Seite und starrte das gerahmte Bild des Gekreuzigten an, das Willard über die verkratzte, zerschundene Kommode gehängt hatte. Ähnliche Bilder der Kreuzigung hingen in allen Zimmern des Hauses, nur in der Küche nicht. Da hatte Charlotte Nein gesagt, wie damals, als er anfing, Arvin zum Beten mit in den Wald zu nehmen. »Nur an den Wochenenden, Willard, das reicht«, hatte sie gesagt. Ihrer Ansicht nach konnte zu viel Religion genauso schlimm sein wie zu wenig, vielleicht sogar noch schlimmer; Mäßigung lag allerdings nicht in der Natur ihres Gatten.
Etwa eine Stunde später wurde Arvin durch die Stimme seines Vaters in der Küche geweckt. Er sprang aus dem Bett, strich die Falten aus der Wolldecke, dann ging er an die Tür und drückte sein Ohr dagegen. Er hörte, wie sein Vater seine Mutter fragte, ob sie etwas aus dem Laden bräuchte. »Ich muss den Laster für die Arbeit auftanken«, sagte er. Als er die Schritte seines Vaters im Flur hörte, trat Arvin schnell von der Tür weg und durchquerte das Zimmer bis zum Fenster. Er tat so, als würde er eine Pfeilspitze aus der kleinen Sammlung an Schätzen begutachten, die er auf dem Fensterbrett ausgebreitet hatte. Die Tür ging auf. »Komm, kleine Spritztour«, sagte Willard. »Hat doch keinen Sinn, den ganzen Tag hier rumzuhocken wie eine Hauskatze.«
Sie gingen zur Haustür und Charlotte rief aus der Küche: »Vergesst den Zucker nicht.« Sie stiegen in den Pick-up, fuhren bis zum Ende ihrer Holperstraße und bogen dann in die Baum Hill Road. Am Stoppschild fuhr Willard nach links auf den Abschnitt asphaltierter Straße, der mitten durch Knockemstiff führte. Obwohl die Fahrt zu Maudes Laden nie länger als fünf Minuten dauerte, kam es Arvin stets so vor, als kämen sie in ein anderes Land, wenn sie die Flats hinter sich ließen. Bei Patterson stand eine Gruppe von Jungs, manche jünger als er selbst, in der offenen Tür einer heruntergekommenen Autowerkstatt, reichten sich Zigaretten hin und her und wechselten sich darin ab, auf einen ausgeweideten Hirschkadaver einzuschlagen, der an einem Balken baumelte. Einer von ihnen johlte und schlug ein paar Mal in die kalte Luft, als sie vorbeifuhren, und Arvin rutschte ein wenig tiefer in seinen Sitz. Vor Jane Wagners Haus krabbelte ein rosafarbenes Baby auf dem Gras unter einem Ahornbaum. Janey stand auf der durchhängenden Veranda, zeigte auf das Baby und schrie durch ein zerbrochenes, mit Pappe verkleidetes Fenster nach jemandem im Haus. Sie trug dieselbe Kleidung, die sie jeden Tag zur Schule anhatte, einen roten karierten Rock und eine ausgefranste weiße Bluse. Sie war zwar nur eine Klasse höher als Arvin, aber auf dem Heimweg saß sie im Schulbus immer hinten bei den älteren Jungen. Er hatte ein paar der anderen Mädchen sagen hören, dass sie hinten sitzen durfte, weil sie die Beine breit machte und sich ihren Schlitz befingern ließ. Arvin hoffte, dass er vielleicht eines Tages, wenn er etwas älter war, herausfinden würde, was genau das heißen sollte.
Willard hielt nicht am Laden, sondern bog scharf rechts ab in die Schotterstraße namens Shady Glen. Er gab Gas und fuhr schlitternd auf den kahlen, schlammigen Platz rings um den Bull Pen. Der Platz war mit Kronkorken, Kippen und Bierkartons übersät. Snooks Snyder, ein ehemaliger Eisenbahner mit warzigem Hautkrebs, lebte dort mit seiner Schwester Agatha, einer alten Jungfer, die den ganzen Tag schwarz gekleidet an einem Fenster im ersten Stock hockte und einen auf trauernde Witwe machte. Snooks verkaufte vorn Bier und Wein, und wenn ihm ein Gesicht auch nur halbwegs bekannt vorkam, dann hinter dem Haus auch Hochprozentiges. Für seine Kunden waren ein paar Picknicktische unter großen Platanen aufgestellt, die neben dem Haus standen, daneben ein Hufeisen-Wurfplatz und ein Plumpsklo, das so aussah, als wolle es gleich zusammenfallen. Die beiden Männer, die Arvin am Morgen im Wald gesehen hatte, saßen am vorderen Ende eines Tisches und tranken Bier, ihre Gewehre lehnten an einem Baum hinter ihnen.
Während der Pick-up noch ausrollte, machte Willard bereits die Tür auf und sprang hinaus. Einer der Jäger schnellte hoch und schleuderte eine Flasche nach ihm, die an der Windschutzscheibe des Pick-ups abprallte und klirrend auf der Straße landete. Dann drehte sich der Mann um und rannte los, sein verdreckter Mantel flatterte hinter ihm her, und seine blutunterlaufenen Augen sahen sich panisch nach dem großen Kerl um, der ihn verfolgte. Willard schnappte ihn und warf ihn in den schmierigen Schlamm, der sich vor der Tür zum Plumpsklo gebildet hatte. Er drehte ihn auf den Rücken, drückte dem Mann mit den Knien die Schultern zu Boden und bearbeitete sein Gesicht mit den Fäusten. Der andere Jäger griff sich seine Waffe und rannte mit einer braunen Papiertüte unterm Arm zu einem grünen Plymouth. Er raste davon, und die abgewetzten Reifen schleuderten bis hinter der Kirche Schotter auf.
Nach ein paar Minuten hörte Willard auf, den Mann zu verprügeln. Er schüttelte sich die schmerzenden Hände aus, holte tief Luft und ging dann zu dem Tisch hinüber, an dem die Männer gesessen hatten. Er nahm die Schrotflinte, die am Baum stand, entlud die beiden roten Patronen, holte mit der Waffe wie mit einem Baseballschläger aus und schlug sie gegen den Baum, bis sie in mehrere Teile zerbrach. Als er sich umdrehte und zum Pick-up gehen wollte, sah er Snooks Snyder mit einer auf ihn gerichteten klobigen Pistole in der Tür stehen. Willard tat ein paar Schritte auf die Veranda zu. »Wenn du auch was von dem abhaben willst, was er gekriegt hat, alter Mann«, sagte er mit lauter Stimme, »dann komm nur her. Ich schieb dir die Waffe in den Arsch.« Dann blieb er stehen und wartete, bis Snooks die Tür hinter sich schloss.
Willard stieg wieder in den Wagen und griff unter dem Sitz nach einem Lumpen, um sich das Blut von den Händen zu wischen. »Weißt du noch, was ich dir neulich gesagt habe?« fragte er Arvin.
»Wegen der Jungs im Bus?«
»Ja, das habe ich damit gemeint«, sagte Willard und nickte zu dem Jäger hinüber. Dann warf er den Lumpen aus dem Fenster. »Du musst nur den richtigen Augenblick abwarten.«
»Jawohl.«
»Da draußen rennen jede Menge nichtsnutziger Mistkerle herum.«
»Mehr als hundert?«
Willard lachte kurz auf und legte einen Gang ein. »Ja, mindestens.« Dann ließ er langsam die Kupplung kommen. »Ich glaube, wir behalten das besser für uns, okay? Hat ja keinen Zweck, dass sich deine Ma deswegen aufregt.«
»Nein, das braucht sie nicht.«
»Gut«, sagte Willard. »Na, wie wär’s jetzt mit einem Schokoriegel?«
Noch für lange Zeit hielt Arvin, wenn er daran zurückdachte, das für den wohl besten Tag, den er mit seinem Vater jemals verbracht hatte. Nach dem Abendessen folgte er ihm zum Gebetsbaum. Der Mond, ein Splitter eines uralten, gebleichten Knochens, begleitet von einem einzelnen schimmernden Stern, ging bereits auf, als sie dort eintrafen. Sie knieten nieder, und Arvin sah hinüber zu den abgeschürften Fingerknöcheln seines Vaters. Als Charlotte ihn gefragt hatte, hatte Willard geantwortet, er habe sich die Hand bei einem Reifenwechsel verletzt. Arvin hatte seinen Vater bis dahin noch nie lügen hören, aber er war sicher, Gott würde ihm vergeben. In jener Nacht waren in den stillen, dämmrigen Wäldern die Geräusche, die von der Senke heraufkamen, besonders deutlich zu hören. Unten am Bull Pen klang das Geklapper der Hufeisen, die an die Metallpflöcke schlugen, wie Kirchenglocken, und die wilden Rufe und Schimpfereien der Betrunkenen erinnerten den Jungen an den Jäger, der blutüberströmt im Schlamm lag. Sein Vater hatte dem Mann eine Lektion erteilt, die dieser nie vergessen würde; das nächste Mal, wenn sich jemand mit ihm anlegen wollte, würde Arvin dasselbe tun. Er schloss die Augen und betete.
I. TEIL
OPFER
1.
Es war ein Mittwochnachmittag im Herbst 1945, kurz nach Ende des Krieges. Der Greyhound hielt wie üblich in Meade, Ohio, einer kleinen, nach faulen Eiern stinkenden Gemeinde mit einer Papierfabrik, eine Stunde südlich von Columbus. Fremde beklagten sich über den Gestank, doch die Ortsansässigen prahlten gerne damit, dass dies der süße Duft des Geldes sei. Der Busfahrer, ein weicher, zu kurz geratener Mann mit Plateauschuhen und einer schlaffen Fliege, hielt in der Gasse neben dem Busbahnhof und kündigte eine vierzigminütige Pause an. Er hätte gern einen Kaffee getrunken, doch sein Magengeschwür meldete sich wieder. Er gähnte und nahm einen Schluck aus einer Flasche mit rosafarbener Medizin, die auf dem Armaturenbrett stand. Der Schornstein auf der anderen Seite des Ortes, das bei Weitem höchste Bauwerk in diesem Winkel des Bundesstaates, rülpste eine weitere schmutzig braune Wolke aus. Man konnte den Schornstein meilenweit sehen, qualmend wie ein Vulkan, der kurz davorstand, seine dürre Spitze abzusprengen.
Der Busfahrer ließ sich auf seinem Sitz zurücksinken und zog sich die Ledermütze über die Augen. Er wohnte außerhalb von Philadelphia, und er dachte, wenn er jemals an einem Ort wie Meade, Ohio, leben müsste, dann würde er sich auf der Stelle erschießen. In diesem Ort fand man nicht mal eine Schüssel Salat. Alles, was die Menschen hier zu essen schienen, war Fett und noch mehr Fett. Wenn er diesen Fraß essen würde, dann wäre er in zwei Monaten tot. Seine Frau sagte ihren Freundinnen immer, dass er empfindlich sei, doch bei dem Ton ihrer Stimme fragte er sich manchmal, ob sie wirklich Mitgefühl hegte. Ohne sein Magengeschwür wäre er in den Krieg gezogen wie die anderen Männer auch. Er hätte einen ganzen Trupp Deutscher abgeschlachtet und seiner Frau gezeigt, wie verdammt empfindlich er in Wirklichkeit war. Am meisten bedauerte er, all die Orden verpasst zu haben. Sein alter Herr hatte mal eine Urkunde dafür bekommen, in zwanzig Dienstjahren nicht einen einzigen Tag versäumt zu haben, und die hatte er seinem kränklichen Sohn die nächsten zwanzig Jahre unter die Nase gehalten. Als den alten Herrn endlich das Zeitliche segnete, hatte der Busfahrer versucht, seine Mutter dazu zu überreden, die Urkunde mit in den Sarg zu legen, um sie sich nicht länger anschauen zu müssen. Doch sie bestand darauf, sie weiter im Wohnzimmer hängen zu lassen, als Beispiel dafür, was ein Mensch im Leben leisten konnte, wenn er sich nicht durch ein wenig Verstopfung davon abhalten ließ. Die Beerdigung, ein Ereignis, auf das sich der Busfahrer seit Langem gefreut hatte, wurde durch die Streiterei um das verdammte Stück Papier beinahe völlig verdorben. Er war froh, diese dummen entlassenen Soldaten nicht mehr ständig vor der Nase zu haben, wenn sie endlich ihre Heimatziele erreicht hatten. Anderer Leute Ruhmestaten gingen einem nach einer Weile ganz schön auf die Nerven.
Gefreiter Willard Russell hatte hinten im Bus mit zwei Seeleuten aus Georgia getrunken, doch der eine war ohnmächtig geworden, und der andere hatte in ihren letzten Krug gekotzt. Willard dachte, wenn er jemals nach Hause käme, würde er Coal Creek, West Virginia, nie wieder verlassen. Er hatte ja schon in den Bergen, in denen er aufgewachsen war, einige üble Dinge miterlebt, aber nichts davon reichte auch nur im Ansatz an das heran, was er im Südpazifik erlebt hatte. Auf einer der Salomonen-Inseln waren ein paar Männer seiner Einheit und er auf einen Soldaten gestoßen, den die Japaner bei lebendigem Leibe gehäutet und dann an ein Kreuz aus zwei Palmen genagelt hatten. Der rohe, blutige Leib war mit schwarzen Fliegen übersät gewesen. Seine Hundemarke hatte an den Resten seines großen Zehs gebaumelt: Gunnery Sergeant Miller Jones. Willard, der nichts mehr für ihn tun konnte, außer ihn zu erlösen, schoss dem Mann hinter dem Ohr eine Kugel in den Kopf, dann nahmen sie ihn ab und bedeckten ihn am Fuß des Kreuzes mit Steinen. Willards Verstand war seitdem nicht mehr derselbe.
Als er den untersetzten Busfahrer etwas von einer Pause rufen hörte, stand er auf und ging zur Tür; er hatte genug von den beiden Seeleuten. Seiner Meinung nach war die Marine ein Teil des Militärs, dem das Trinken verboten gehörte. In den drei Jahren, in denen er gedient hatte, war er nicht einem einzigen Schwabber begegnet, der ordentlich was vertragen konnte. Jemand hatte mal zu ihm gesagt, das würde an dem Salpeter liegen, das man an die Seeleute verfütterte, damit sie nicht verrückt wurden und übereinander herfielen, wenn sie auf hoher See waren. Willard verließ den Busbahnhof und entdeckte ein kleines Restaurant namens Wooden Spoon auf der anderen Straßenseite. Im Fenster hing eine weiße Pappe, auf der das Spezialmenü angeboten wurde, Hackbraten für fünfunddreißig Cents. Willard hielt das für ein gutes Omen: Am Tag bevor er eingezogen worden war, hatte seine Mutter ihm einen Hackbraten gemacht. Er setzte sich in eine Nische am Fenster und zündete sich eine Zigarette an. Rings um den Raum lief ein Wandregal voll alter Flaschen, altmodischem Küchengerät und rissiger Schwarz-Weiß-Fotos; auf allem hatte sich der Staub abgesetzt. An die Wand neben seiner Sitznische war ein verblichener Zeitungsausschnitt geheftet worden, in dem von einem Polizeibeamten aus Meade berichtet wurde, der vor dem Busbahnhof von einem Bankräuber niedergeschossen worden war. Willard sah genauer hin und entdeckte das Datum: 11. Februar 1936. Vier Tage vor seinem zwölften Geburtstag, rechnete er aus. Der einzige andere Gast im Diner, ein alter Mann, beugte sich über seinen Tisch mitten im Raum und schlürfte eine grüne Suppe. Sein Gebiss lag auf einem Stück Butter vor ihm.
Willard rauchte zu Ende und wollte gerade wieder gehen, als endlich eine dunkelhaarige Kellnerin aus der Küche kam. Sie schnappte sich eine Speisekarte vom Stapel neben der Kasse und reichte sie ihm. »Tut mir leid«, sagte sie, »ich habe Sie nicht hereinkommen hören.« Er sah ihre hohen Wangenknochen, die vollen Lippen und die langen, schlanken Beine, und als sie ihn fragte, was er denn essen wolle, stellte Willard fest, dass er einen ganz trockenen Mund hatte. Er bekam kaum ein Wort heraus. So etwas war ihm noch nie passiert, nicht mal in den schwersten Kämpfen auf Bougainville. Sie ging, um die Bestellung aufzugeben und ihm einen Kaffee zu holen, und Willard schoss der Gedanke durch den Kopf, dass er noch vor ein paar Monaten sicher gewesen war, sein Leben würde auf irgendeinem schwül-feuchten, wertlosen Felsen mitten im Pazifik enden; und nun war er hier, atmete noch immer, war nur ein paar Stunden von zu Hause fort und wurde von einer Frau bedient, die aussah wie die lebende Version einer dieser Pin-up-Filmengel. Soweit Willard das überhaupt hätte sagen können, war dies der Augenblick, in dem er sich verliebte. Ganz egal, dass der Hackbraten trocken, die grünen Bohnen zerkocht und das Brötchen so hart war wie ein Stück Kohle. Er fand, sie hatte ihm das beste Essen serviert, das er je in seinem Leben gegessen hatte. Und als er fertig war, stieg er wieder in den Bus, ohne auch nur den Namen von Charlotte Willoughby zu kennen.
Als der Bus den Fluss überquerte und in Huntington hielt, fand Willard einen Schnapsladen und kaufte sich fünf Flaschen Whiskey, die er in seinen Seesack steckte. Er setzte sich in die erste Reihe gleich hinter den Fahrer, dachte an die Frau im Diner und suchte nach irgendwelchen Anzeichen, dass er sich der Heimat näherte. Er war noch immer leicht betrunken. Ganz unvermittelt fragte der Busfahrer: »Na, bringen Sie ein paar Orden nach Hause?« Er sah Willard im Rückspiegel kurz an.
Willard schüttelte den Kopf. »Nur diesen dürren alten Kadaver, in dem ich mich herumschleppe.«
»Ich wollte ja gehen, aber die haben mich nicht genommen.«
»Da haben Sie Glück gehabt«, meinte Willard. An dem Tag, als sie den Soldaten entdeckten, waren die Kämpfe auf der Insel fast vorüber gewesen, und der Sergeant hatte sie losgeschickt, um Trinkwasser zu suchen. Ein paar Stunden nachdem sie Miller Jones’ gehäuteten Körper begraben hatten, tauchten vier ausgehungerte japanische Soldaten mit frischen Blutspuren an ihren Macheten zwischen den Felsen auf, streckten die Hände in die Luft und ergaben sich. Als Willard und seine beiden Begleiter sie zum Kreuz zurückführten, gingen die Soldaten auf die Knie und flehten sie an oder entschuldigten sich, er wusste es nicht. »Sie haben versucht zu fliehen«, log Willard später im Camp. »Wir hatten keine Wahl.« Nachdem sie die Japse erschossen hatten, schnitt ihnen einer der beiden anderen Männer, ein Bursche aus Louisiana mit einer Sumpfrattenkralle um den Hals, die Querschläger abwehren sollte, mit einem Rasiermesser die Ohren ab. Er hatte eine Zigarrenkiste voll mit getrockneten Ohren. Sein Plan war es, die Trophäen für fünf Dollar das Stück zu verkaufen, wenn sie wieder in die Zivilisation zurückgekehrt waren.
»Ich hab ein Magengeschwür«, erklärte der Busfahrer.
»Sie haben nichts verpasst.«
»Ach, ich weiß nicht«, entgegnete der Busfahrer. »Ich hätte mir gerne einen Orden verdient. Vielleicht sogar ein paar mehr. Schätze, ich hätte genug Krautfresser für zwei abknallen können. Ich bin ziemlich schnell mit den Händen.«
Willard schaute dem Busfahrer auf den Hinterkopf und musste an die Unterhaltung denken, die er mit dem mürrischen jungen Priester auf dem Schiff geführt hatte, nachdem er gebeichtet hatte, Miller Jones erschossen zu haben, um ihn von seinem Leid zu erlösen. Der Priester hatte all dieses Sterben satt, das er gesehen hatte, all die Gebete, die er an Reihen toter Soldaten und Stapeln von Leichenteilen gesprochen hatte. Er hatte zu Willard gesagt, wenn auch nur die Hälfte der Menschheitsgeschichte wahr sei, dann sei das verkommene und korrupte Diesseits offenbar zu nichts anderem gut, als einen auf die nächste Welt vorzubereiten. »Wussten Sie«, fragte Willard den Fahrer, »dass die Römer Esel ausnahmen und die Christen bei lebendigem Leib in den Kadavern einnähten, um sie dann in der Sonne verrotten zu lassen?« Der Priester hatte jede Menge solcher Geschichten zu erzählen gewusst.
»Was zum Teufel hat das mit einem Orden zu tun?«
»Denken Sie mal drüber nach. Du bist verschnürt wie ein Truthahn im Bratentopf, nur der Kopf schaut aus dem Hintern des toten Esels heraus; und dann fressen dich die Maden auf, bis du das Himmelreich siehst.«
Der Busfahrer runzelte die Stirn und packte das Lenkrad ein wenig fester. »Mein Freund, ich verstehe nicht, worauf Sie hinauswollen. Ich hab davon gesprochen, mit ein paar Orden an der Brust nach Hause zu kommen. Haben diese Römerleute da den Menschen vielleicht Orden angeheftet, bevor sie sie in die Esel steckten? Wollen Sie darauf hinaus?«
Willard wusste nicht, worauf er hinauswollte. Dem Priester zufolge wusste nur Gott allein, worauf der Mensch hinauswollte. Er leckte sich die trockenen Lippen, dachte an den Whiskey in seinem Seesack. »Ich will auf Folgendes hinaus: Wenn es hart auf hart kommt, dann leiden am Schluss alle«, erklärte Willard.
»Tja«, meinte der Busfahrer, »ich hätte nur ganz gern erst meinen Orden gehabt, bis es so weit ist. Verdammt, ich habe eine Frau zu Hause, die wird ganz närrisch, wenn sie einen Orden sieht. Erzählen Sie mir was von Leid. Ich bin schon ganz krank vor Sorge, wenn ich unterwegs bin, sie könnte mit so einem Ordensträger durchbrennen.«
Willard beugte sich vor, und der Fahrer spürte den heißen Atem des Soldaten in seinem fetten Nacken, roch die Whiskeyausdünstungen und den schalen Hauch eines billigen Essens. »Glauben Sie, Miller Jones würde es interessieren, wenn seine Alte ihn betrügen würde?« fragte Willard. »Kumpel, er würde liebend gern mit Ihnen tauschen.«
»Wer zum Teufel ist Miller Jones?«
Willard sah durch die Scheibe hinaus; der im Dunst liegende Gipfel des Greenbrier Mountain tauchte in der Ferne auf. Ihm zitterten die Hände, seine Stirn glänzte vor Schweiß. »Ein armer Mistkerl, der in dem Krieg gekämpft hat, um den die Sie gebracht haben, mehr nicht.«
Willard wollte gerade aufgeben und eine der Flaschen anbrechen, als sein Onkel Earskell seinen klapprigen Ford vor der Greyhoundstation in Lewisburg zum Stehen brachte. Willard hatte fast drei Stunden auf einer Bank vor dem Gebäude gesessen, sich an einem kalten Kaffee in einem Papierbecher festgehalten und den Leuten zugeschaut, die am Pioneer Drugstore vorbeigingen. Er schämte sich für die Art, wie er mit dem Busfahrer gesprochen hatte, und es tat ihm leid, den Namen des Marine so missbraucht zu haben; er schwor, dass er Gunnery Sergeant Miller Jones niemals vergessen, ihn aber niemandem mehr gegenüber erwähnen würde. Unterwegs griff er in seinen Seesack und gab Earskell eine der Flaschen und eine deutsche Luger. Kurz vor seiner Entlassung hatte er auf der Basis in Maryland ein japanisches Zeremonialschwert gegen die Pistole eingetauscht. »Das ist angeblich die Waffe, mit der sich Hitler das Hirn weggepustet hat«, sagte Willard und unterdrückte ein Grinsen.
»Blödsinn«, sagte Earskell.
Willard lachte. »Was? Glaubst du, der Kerl hat mich angelogen?«
»Ha!« machte der alte Mann. Er drehte den Verschluss von der Flasche, nahm einen langen Schluck und schüttelte sich. »Herr im Himmel, das ist guter Stoff.«
»Trink aus. Ich hab noch drei im Seesack.« Willard öffnete eine weitere Flasche und zündete sich eine Zigarette an. »Wie geht’s meiner Mutter?«
»Tja, ich muss schon sagen, als Junior Carvers Leiche nach Hause zurückkam, da hatte sie für eine Weile nicht mehr alle beisammen. Aber sie hat sich wieder gefangen.« Earskell nahm einen weiteren Schluck und stellte sich die Flasche zwischen die Beine. »Sie hat sich nur Sorgen um dich gemacht, das ist alles.«
Langsam kamen sie in die Hügel Richtung Coal Creek. Earskell wollte ein paar Kriegsgeschichten hören, doch das Einzige, wovon sein Neffe die folgende Stunde sprach, war diese Frau, die er in Ohio gesehen hatte. Earskell hatte Willard in seinem ganzen Leben noch nicht so viel reden hören. Er wollte ihn fragen, ob es tatsächlich stimmte, dass die Japse ihre Toten aßen, wie es in der Zeitung gestanden hatte, aber das konnte wohl warten, schätzte er. Außerdem musste er sich auf das Fahren konzentrieren. Der Whiskey ging fürchterlich glatt runter, und seine Augen waren auch nicht mehr so gut wie früher. Emma hatte nun schon so lange auf die Rückkehr ihres Sohnes gewartet, da wäre es doch eine Schande, wenn er einen Unfall baute und sie beide umbrachte, bevor sie ihn zu sehen bekam. Earskell kicherte ein wenig bei diesem Gedanken. Seine Schwester war eine der gottesfürchtigsten Menschen, die er je kennengelernt hatte, aber sie würde ihm bis in die Hölle folgen, um ihn dafür büßen zu lassen.
»Was findest du denn genau an diesem Mädchen?« wollte Emma Russell von Willard wissen. Es war fast Mitternacht gewesen, als Earskell und er den Ford am Fuß des Hügels abgestellt hatten und den Weg zu der kleinen Blockhütte hinaufgegangen waren. Als er zur Tür hereinkam, musste Emma eine ganze Weile weinen, sie klammerte sich an ihn und durchnässte die Brustseite seiner Uniform mit ihren Tränen. Er sah über ihre Schulter hinweg, wie sein Onkel in die Küche huschte. Ihre Haare waren grau geworden, seit Willard sie das letzte Mal gesehen hatte. »Ich würde dich ja bitten, mit mir niederzuknien und dem Herrn zu danken«, sagte Emma und wischte sich die Tränen mit dem Saum ihrer Schürze vom Gesicht, »aber ich kann Alkohol in deinem Atem riechen.«
Willard nickte. Er war in dem Glauben erzogen worden, dass man niemals betrunken zu Gott sprach. Man hatte immer aufrecht zum Herrn zu sein, falls er mal wirklich helfen musste. Selbst Willards Vater, Tom Russell, ein Schwarzbrenner, der bis zu dem Tag, an dem er in einem Gefängnis in Parkersburg an Leberzirrhose starb, von Pech und Ärger verfolgt worden war, hatte sich daran gehalten. Ganz gleich, wie verzweifelt die Lage auch war – und sein alter Herr hatte häufig in aussichtslosen Situationen gesteckt–, er hatte den Allerhöchsten niemals um Hilfe gebeten, solange er auch nur einen Tropfen Alkohol in sich gehabt hatte.
»Na, komm in die Küche«, sagte Emma. »Du kannst essen, und ich setze Kaffee auf. Ich hab dir einen Hackbraten gemacht.«
Gegen drei Uhr früh hatten Earskell und er vier Flaschen geleert, dazu eine Tasse Schwarzbrand, und arbeiteten sich durch die letzte der mitgebrachten Flaschen. Willard war ganz benommen, und es fiel ihm schwer, die Worte richtig auszusprechen, doch offenbar hatte er seiner Mutter gegenüber die Kellnerin erwähnt, die er im Diner gesehen hatte. »Wie bitte?« fragte er.
»Das Mädchen, von dem du gesprochen hast«, sagte sie. »Was findest du denn an ihr?« Sie goss ihm einen weiteren siedend heißen Kaffee aus einem Stieltopf ein. Willards Zunge war zwar schon ganz taub, aber er war sicher, er hatte sie sich bereits ein paar Mal am Kaffee verbrannt. Eine Kerosinlampe, die von einem Deckenbalken baumelte, erhellte den Raum. Der breite Schatten seiner Mutter schwankte an der Wand. Er kleckerte Kaffee auf das Öltuch auf dem Tisch. Emma schüttelte den Kopf und griff hinter sich nach einem Spüllappen.
»Alles«, antwortete er. »Du solltest sie mal sehen.«
Emma ging davon aus, dass nur der Whiskey aus ihm sprach, trotzdem war ihr bei der Ankündigung ihres Sohnes, eine Frau kennengelernt zu haben, unwohl. Mildred Carver, eine gottes-fürchtigere Christin gab es in ganz Coal Creek nicht, hatte jeden Tag für ihren Sohn gebetet, und doch hatten sie ihn in einem Sarg heimgeschickt. Kaum hatte Emma gehört, dass die Sargträger sich fragten, ob überhaupt jemand in dem Sarg war, wartete sie auf ein Zeichen, was sie zu tun hatte, um Willards Sicherheit zu garantieren. Sie suchte noch immer nach diesem Zeichen, als Helen Hattons Familie bei einem Hausbrand ums Leben kam, der das arme Kind zur Vollwaise machte. Zwei Tage später sank Emma nach langem Nachdenken auf die Knie und versprach Gott, falls er ihren Sohn lebend nach Hause brächte, würde sie alles dafür tun, dass er Helen heiratete und für sie sorgte. Doch wie sie da in der Küche stand und sein dunkles, welliges Haar und seine kantigen Gesichtszüge betrachtete, ging ihr auf, dass sie doch verrückt gewesen sein musste, ein solches Versprechen abzugeben. Helen trug eine schmutzige Haube auf dem Kopf, die sie unter dem starken Kinn zusammengebunden hatte, und ihr langes Pferdegesicht ähnelte dem ihrer Großmutter Rachel wie ein Ei dem anderen; viele hatten die Großmutter für die reizloseste Frau gehalten, die es je in Greenbrier County gegeben hatte. Damals hatte Emma nicht daran gedacht, was wohl passieren würde, wenn sie ihr Versprechen nicht halten konnte. Wenn sie doch nur mit einem hässlichen Sohn gesegnet worden wäre, dachte sie. Gott hatte schon komische Ideen, wenn es darum ging, den Menschen klarzumachen, dass er unzufrieden mit ihnen war.
»Gutes Aussehen ist nicht alles«, sagte Emma.
»Sagt wer?«
»Halt den Mund, Earskell«, fauchte Emma. »Und wie heißt das Mädchen?«
Willard zuckte mit den Schultern. Er betrachtete das Bild von Jesus über der Tür, auf dem er das Kreuz trug. Seit er in die Küche gekommen war, hatte er vermieden, es anzuschauen, um sich nicht die Heimkehr durch Gedanken an Miller zu verderben. Doch nun widmete er sich, wenn auch nur für einen Augenblick, dieser Darstellung. Das Bild in dem billigen Holzrahmen hing schon so lange da, wie er nur denken konnte, und war ganz altersfleckig. Im flackernden Licht der Lampe wirkte es beinahe lebendig. Willard konnte fast die Peitschen knallen und die Soldaten des Pilatus lästern hören. Er sah zu der Luger hinunter, die neben Earskells Teller auf dem Tisch lag.
»Was? Du weißt noch nicht mal, wie sie heißt?«
»Hab nicht gefragt«, entgegnete Willard. »Aber ich hab ihr einen Dollar Trinkgeld gegeben.«
»Das vergisst die nicht«, sagte Earskell.
»Na, vielleicht solltest du erst mal beten, bevor du wieder nach Ohio gehst«, meinte Emma. »Das ist ein ziemlicher Weg.« Ihr ganzes Leben hatte sie geglaubt, dass die Menschen dem Willen des Herrn folgen sollten, nicht ihrem eigenen. Man musste einfach darauf vertrauen, dass sich alles in dieser Welt so entwickeln würde, wie es vorgesehen war. Doch dann hatte Emma diesen Glauben verloren und mit Gott geschachert, so als sei er nichts weiter als ein Pferdehändler mit einem Stück Kautabak im Mund oder ein zerlumpter Kesselflicker, der von Haus zu Haus zieht und seine zerbeulten Töpfe verhökert. Nun musste sie zumindest versuchen, ihren Teil des Handels einzuhalten, ganz gleich, was dabei am Ende herauskam. Danach würde sie alles dem Herrn überlassen. »Ich glaube, das würde nicht schaden, oder? Wenn du mal beten würdest deswegen?« Emma drehte sich um und deckte den Rest des Bratens mit einem sauberen Geschirrtuch zu.
Willard pustete in seinen Kaffee, nahm einen Schluck und verzog den Mund. Er dachte an die Kellnerin, an die winzige, kaum sichtbare Narbe über ihrem linken Auge. Willard sah zu seinem Onkel hinüber, der sich eine Zigarette zu drehen versuchte. Earskells Hände waren von der Arthritis schon ganz knotig und verwachsen, die Knöchel groß wie Vierteldollar-Münzen. »Nein«, sagte Willard und goss sich etwas Whiskey in die Tasse, »schaden würde es nicht.«
2.
Willard hatte einen Kater, er zitterte und saß allein in einer der Bänke in der Church of the Holy Ghost Sanctified in Coal Creek. Es war Donnerstagabend, fast halb acht, aber der Gottesdienst hatte noch nicht angefangen. Es war der vierte Abend in der alljährlichen Erweckungswoche der Kirche, die auf säumige Gemeindemitglieder abzielte und jene, die bislang noch nicht gerettet worden waren. Willard war nun schon seit über einer Woche daheim, und das war der erste Tag, an dem er nüchtern geblieben war. Letzte Nacht waren Earskell und er ins Lewis Theater gegangen, um sich John Wayne in Stahlgewitter anzuschauen. Nach der Hälfte des Films war er aus dem Kino gegangen, so sehr widerte ihn die Verlogenheit des Ganzen an, und am Schluss hatte er sich in der Poolhalle an der Straße geprügelt. Er schreckte hoch, sah sich um, bewegte die wunde Hand. Emma war noch immer vorn. An den Wänden hingen verrußte Lampen, auf halber Länge des Kirchenraums stand rechts am Gang ein verbeulter Holzofen. Die Kiefernbänke waren von über zwanzig Jahren Gottesdienst glatt gewetzt. Die Kirche war noch immer derselbe bescheidene Ort, doch Willard fürchtete, dass er sich wohl ziemlich verändert hatte, seit er in Übersee gewesen war.
Reverend Albert Sykes hatte die Kirche 1924 gegründet, kurz nachdem ein Schacht in der Kohlenmine eingestürzt war und er mit zwei anderen Männern, die dabei ums Leben kamen, verschüttet worden war. Er selbst hatte sich dabei beide Beine mehrfach gebrochen. Er kam an die Packung Five-Brothers-Kautabak in Phil Drurys Tasche heran, aber nicht an das Marmeladensandwich, das Burl Meadows in seiner Tasche hatte, wie er wusste. Am dritten Tag berührte ihn der Heilige Geist, so sagte Sykes später. Ihm ging auf, dass er sich bald den beiden Männern neben sich anschließen würde, die schon nach Tod rochen, aber das machte ihm nichts mehr aus. Ein paar Stunden später, als er gerade schlief, durchbrachen die Rettungsleute den Schutt. Einen Augenblick lang war er davon überzeugt, das Licht, das ihm in die Augen schien, sei das Antlitz Gottes. Eine gute Geschichte für die Kirche, und stets gab es eine Menge Hallelujas, wenn er an diese Stelle kam. Willard schätzte, dass er den alten Prediger im Laufe der Jahre wohl hundert Mal diese Geschichte hatte erzählen hören, während dieser vor der dunklen Kanzel hin und her gegangen war. Am Ende zog er immer die leere Packung Five Brothers aus der Tasche seines dünnen Anzugs und reckte sie mit beiden Händen nach oben. Er hatte sie stets bei sich. Viele der Frauen um Coal Creek, vor allem jene, die noch immer Ehemänner und Söhne in den Minen hatten, behandelten die Packung wie eine Reliquie und küssten sie, wann immer sie die Gelegenheit dazu hatten. Tatsache war, dass Mary Ellen Thomas auf dem Totenbrett darum bat, ihr die Packung zu holen, nicht den Arzt.
Willard sah, wie seine Mutter sich mit einer dürren Frau unterhielt, deren Drahtgestellbrille schief in ihrem langen, schlanken Gesicht saß; dazu trug sie eine blassblaue Haube, die sie unter dem spitzen Kinn verknotet hatte. Nach ein paar Minuten nahm Emma die Frau bei der Hand und führte sie zu der Stelle, wo Willard saß. »Ich habe Helen gebeten, sich zu uns zu setzen«, sagte Emma zu ihrem Sohn. Er stand auf und ließ sie Platz nehmen, und als die Frau sich setzte, bekam er von dem Geruch alten Schweißes ganz feuchte Augen. Sie trug eine abgegriffene, in Leder gebundene Bibel bei sich und hielt den Kopf gesenkt, als Emma sie ihm vorstellte. Jetzt begriff Willard, warum sich seine Mutter die letzten paar Tage darüber ausgelassen hatte, dass Äußerlichkeiten gar nicht so wichtig seien. Willard pflichtete ihr durchaus bei, dass dies in den meisten Fällen wohl so sei, doch Himmel, selbst sein Onkel Earskell wusch sich ab und zu mal unter den Armen.
Da die Kirche keine Glocke hatte, trat Reverend Sykes an die offene Kirchentür, wenn der Gottesdienst beginnen sollte, und rief all die herein, die noch draußen mit ihren Zigaretten, ihren Zweifeln und neuesten Gerüchten herumlungerten. Ein kleiner Chor aus zwei Männern und drei Frauen stand auf und sang: »Sinner, You’d Better Get Ready.« Dann trat Sykes an die Kanzel. Er besah sich die Gemeinde, wischte sich mit einem weißen Taschentuch den Schweiß von der Stirn. Achtundfünfzig Personen saßen auf den Bänken. Er hatte zwei Mal gezählt. Der Reverend war kein gieriger Mensch, aber er hoffte darauf, dass die Kollekte heute Abend drei oder vier Dollar einbrachte. Die ganze letzte Woche hatten seine Frau und er nichts weiter als Zwieback und gammliges Eichhörnchenfleisch gegessen. »Mensch, ist das heiß«, sagte er grinsend. »Aber es wird noch heißer werden, richtig? Vor allem für jene, die nicht mit dem Herrn sind.«
»Amen«, sagte jemand.
»So ist es«, sagte ein anderer.
»Nun«, fuhr Sykes fort, »darum werden wir uns gleich kümmern. Zwei Jungs aus Topperville werden heute den Gottesdienst leiten, und wie mir alle bestätigen, haben sie eine frohe Botschaft zu überbringen.« Sykes sah hinüber zu den beiden Fremden, die im Schatten neben dem Altar saßen und durch einen zerschlissenen schwarzen Vorhang vor der Gemeinde verborgen waren. »Bruder Roy und Bruder Theodore, kommt her und helft uns, ein paar verlorene Seelen zu retten«, sagte er und winkte sie zu sich.
Ein großer Dürrer erhob sich und schob den anderen, einen fetten Kerl in einem quietschenden Rollstuhl, hinter dem Vorhang hervor zur Altarmitte. Der mit den gesunden Beinen trug einen ausgebeulten schwarzen Anzug und ein paar schwere, ausgetretene Schuhe. Seine braunen Haare waren mit Haaröl nach hinten geklebt, seine eingefallenen Wangen von der Akne löchrig und rotnarbig. »Ich heiße Roy Laferty«, sagte er mit leiser Stimme, »und das hier ist mein Cousin Theodore Daniels.« Der Krüppel nickte und lächelte die Kirchenbesucher an. Er hielt eine zerschundene Gitarre auf dem Schoß und trug einen Suppentopfhaarschnitt. Sein Overall war mit Flicken aus einem Futtersack ausgebessert worden, und seine dürren Beine unter ihm standen im spitzen Winkel ab. Er trug ein schmutziges weißes Hemd und einen bunt geblümten Schlips. Später sagte Willard, der eine habe ausgesehen wie der Fürst der Finsternis und der andere wie ein vom Glück verlassener Clown.
Schweigend stimmte Bruder Theodore eine Saite auf seiner Gitarre. Ein paar Besucher gähnten, andere flüsterten bereits miteinander und wirkten zu Beginn dieses bestimmt langweilig werdenden Gottesdienstes, der von zwei schüchternen und heruntergekommenen Frischlingen abgehalten wurde, recht nervös. Willard wünschte sich, er wäre auf den Parkplatz entwischt und hätte dort jemanden mit einer Flasche Schnaps getroffen, bevor der Gottesdienst anfing. Es war ihm noch nie wohl dabei gewesen, Gott in Gegenwart von Fremden anzubeten, eingezwängt in einen Raum. »Heute Abend werden wir keine Kollekte einsammeln, Leute«, erklärte Bruder Roy schließlich, nachdem ihm der Krüppel zugenickt hatte. »Wir brauchen kein Geld, um Gottes Werk zu tun. Theodore und ich leben auch von der süßen Luft, wenn nötig, und glauben Sie mir, das haben wir schon häufig getan. Seelen retten hat nichts mit schmutzigem Geld zu tun.« Roy sah zu dem alten Prediger hinüber, der schief lächelte und zögernd zustimmend nickte. »Und nun lasst uns den Heiligen Geist in diese kleine Kirche rufen, oder, so schwöre ich, bei dem Versuch zugrunde gehen.« Bei diesem Stichwort legte der fette Kerl auf der Gitarre los, und Bruder Roy lehnte sich zurück und gab einen hohen, fürchterlichen Schmerzensschrei von sich, der so klang, als wolle er die Himmelstore eigenhändig aus den Angeln rütteln. Die halbe Gemeinde fiel fast von den Bänken. Willard musste kichern, als er seine Mutter neben sich aufschrecken spürte.
Der junge Prediger ging den Mittelgang auf und ab und fragte die Menschen mit lauter Stimme: »Wovor habt ihr am meisten Angst?« Er fuchtelte mit den Armen und beschrieb die Widerwärtigkeiten der Hölle – den Schmutz, den Schrecken, die Verzweiflung – und die Ewigkeit, die sich endlos vor einem erstreckte. »Wenn eure größte Angst Ratten sind, dann wird Satan dafür sorgen, dass ihr genug davon bekommt. Brüder und Schwestern, sie werden euch die Gesichter abnagen, während ihr daliegt und nicht den kleinsten Finger gegen sie rühren könnt, und es wird nie aufhören. Eine Million Jahre in der Ewigkeit sind nicht mal ein Nachmittag hier in Coal Creek. Versucht gar nicht erst, das auszurechnen. Kein menschlicher Verstand ist groß genug, um so viel Elend zusammenzuzählen. Wisst ihr noch, die Familie drüben in Millersburg, die letztes Jahr im Schlaf ermordet wurde? Denen ein Irrer die Augen ausgestochen hat? Stellt euch das eine Billion Jahre lang vor – das ist eine Million mal eine Million, Leute, ich hab das nachgeschaut –, stellt euch vor, so gefoltert zu werden, ohne jemals zu sterben. Man schneidet euch die Augen aus dem Kopf, mit einem blutigen schartigen Messer, immer und immer wieder, in alle Ewigkeit. Ich hoffe nur, die armen Leute waren eins mit dem Herrn, als der Irre durchs Fenster kletterte, das hoffe ich wirklich. Doch ganz ehrlich, Brüder und Schwestern, wir können uns gar nicht ausmalen, welche Wege der Teufel einschlägt, um uns zu quälen, kein Mensch war je böse genug, nicht mal dieser Hitler, um an die Art heranzureichen, mit der der Satan die Sünder am Tag des Jüngsten Gerichts büßen lässt.«
Während Bruder Roy predigte, behielt Bruder Theodore einen Rhythmus bei, der zum Fluss der Worte passte, und verfolgte die Bewegungen des anderen genau. Roy war sein Cousin mütterlicherseits, doch manchmal wünschte sich der fette Bursche, sie wären nicht so eng miteinander verwandt. Er war zwar zufrieden damit, das Wort Gottes mit Roy zu verbreiten, doch hegte er schon seit Langem Gefühle, die er nicht einfach wegbeten konnte. Er wusste, was die Bibel dazu sagte, aber er konnte nicht verstehen, warum der Herr solch einen Gedanken für Sünde hielt. Liebe war Liebe, so sah er das jedenfalls. Verdammt, hatte er denn nicht bewiesen, hatte er Gott denn nicht gezeigt, dass er ihn mehr liebte als sonst jemanden? Er hatte dieses Gift geschluckt, bis er zum Krüppel geworden war, hatte dem Herrn gezeigt, dass er den rechten Glauben hatte, auch wenn ihm manchmal der Gedanke kam, dass er vielleicht ein wenig zu übereifrig gewesen war. Doch nun hatte Theodore Gott, er hatte Roy, und er hatte seine Gitarre, mehr brauchte er nicht in dieser Welt, auch wenn er vielleicht nie wieder aufrecht stehen konnte. Und wenn Theodore Roy beweisen musste, wie sehr er ihn liebte, dann würde er das gern tun, alles, was er nur wollte. Gott war die Liebe; und ER war überall und in allem.
Dann sprang Roy zurück zum Altar, griff unter Bruder Theodores Rollstuhl und zog ein großes Einmachglas hervor. Alle beugten sich auf ihren Bänken vor. Eine schwarze Masse schien in dem Glas zu brodeln. »Preiset den Herrn«, rief jemand, und Bruder Roy sagte: »Ganz recht, mein Freund, ganz recht.« Er hielt das Glas in die Höhe und schüttelte es heftig. »Freunde, ich sage euch etwas«, hob er an. »Bevor ich den Heiligen Geist fand, hatte ich eine Heidenangst vor Spinnen. Stimmt’s, Theodore? Seit ich noch am Rockzipfel meiner Mutter hing. Spinnen krabbelten mir durch den Schlaf und legten ihre Eier in meinen Albträumen ab; ich konnte nicht mal aufs Plumpsklo, ohne dass jemand meine Hand halten musste. Überall baumelten sie in ihren Spinnweben und lauerten auf mich. Ein fürchterliches Leben, die ganze Zeit Angst zu haben, Tag und Nacht, ganz egal. Und genau so ist die Hölle, Brüder und Schwestern. Nie hatte ich meine Ruhe vor diesen achtbeinigen Teufeln. Bis ich zum Herrn fand.«
Dann ging Roy auf die Knie und schüttelte erneut das Glas, bevor er den Deckel abschraubte. Theodore spielte langsamer, bis nur noch eine traurige, drohende Melodie zu hören war, die den Raum so eisig werden ließ, dass einem die Nackenhaare zu Berge standen. Roy hielt das Glas über sich, sah in die Gemeinde, holte tief Luft und kippte es aus. Eine quirlige Masse aus Spinnen, braunen, schwarzen und orange-gelb gestreiften, ergoss sich ihm auf Kopf und Schultern. Ein Schauder durchfuhr ihn wie elektrischer Strom, er stand auf, schmetterte das Glas auf den Boden, sodass die Splitter nur so umherflogen. Dann gab Roy wieder diesen entsetzlichen Schrei von sich, schüttelte Arme und Beine, und die Spinnen fielen zu Boden und eilten in alle Richtungen davon. Eine Frau mit einem Strickschal über den Schultern sprang auf und rannte zur Tür, andere schrien, und in all dem Getümmel trat Roy vor, ein paar Spinnen klebten ihm noch im verschwitzten Gesicht, und rief: »Achtet auf meine Worte, der Herr wird euch all die Ängste nehmen, wenn ihr ihn nur lasst. Schaut, was er für mich getan hat.« Dann würgte er ein wenig und spuckte etwas Schwarzes aus.
Eine andere Frau klopfte sich ihr Kleid ab und rief, sie sei gebissen worden, Kinder schluchzten. Reverend Sykes eilte hin und her und versuchte, wieder Ordnung zu schaffen, doch die Gemeinde lief bereits in Panik auf die schmale Tür zu. Emma fasste Helen am Arm und wollte sie hinausführen. Doch die junge Frau schüttelte sie ab, drehte sich um und trat den Gang entlang. Sie drückte sich ihre Bibel an die flache Brust und starrte Bruder Roy an. Theodore spielte weiter Gitarre und sah, wie sein Cousin sich beiläufig eine Spinne vom Ohr wischte und die zarte, unscheinbar wirkende Dame anlächelte. Theodore hörte nicht auf zu spielen, bis er sah, wie Roy die dürre Frau mit den Händen zu sich winkte.
Auf dem Heimweg sagte Willard: »Junge, Junge, die Nummer mit den Spinnen war klasse.« Er streckte die rechte Hand aus und ließ seine Fingerspitzen leicht über den dicken, weichen Arm seiner Mutter laufen.
Sie kreischte und schlug nach ihm. »Lass das. Ich kann sowieso schon nicht schlafen.«
»Hast du den Kerl schon mal predigen hören?«