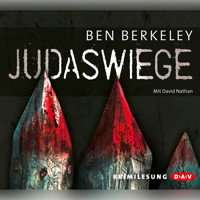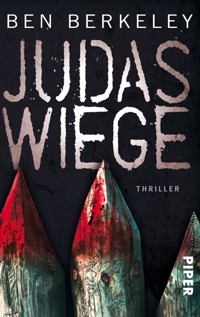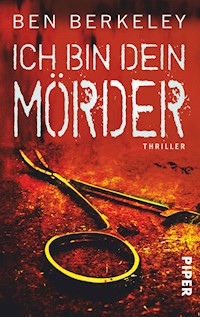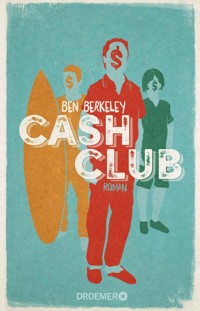6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Als sich die tausend Augen der National Security Agency auf Gary Golay, den Stellvertretenden Stabschef im Weißen Haus, richten, wird sein Leben zum Alptraum: Er soll eine Prostituierte ermordet haben, auf grausamste Art und Weise. Während Gary um seinen Ruf, seine Familie und seine Freiheit kämpft werden die Beweise gegen ihn immer erdrückender. Selbst seine Frau kann sich dem Strudel von Verdächtigungen nicht entziehen. Einzig der kauzige Anwalt Thibault Stein und seine Assistentin Pia Lindt glauben seine Geschichte von einer Verschwörung, die bis ins Oval Office reicht. Und die uns alle betrifft, denn das Haus der tausend Augen blickt nicht nur auf Gary Golay. Sondern auch auf Dich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 401
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Ben Berkeley
Das Haus der tausend Augen
Thriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Alle reden vom »gläsernen Bürger« – Ben Berkeley erweckt ihn zum Leben, um ihn gnadenlos zu jagen: Denn in Crypto City steht das Hauptquartier der NSA, das Haus der tausend Augen. Als sich die tausend Augen auf den stellvertretenden Stabschef des Weißen Hauses richten, wird sein Leben zum Alptraum. Er wird verhaftet. Ausgerechnet am Tag der wichtigsten Abstimmung seiner Karriere über das neue Geheimdienstgesetz. Der Vorwurf: Spionage, Verschwörung und Mord an einer Prostituierten. Seine einzige Hoffnung: der kauzige Staranwalt Stein und dessen Assistentin.
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Kapitel 87
Kapitel 88
Kapitel 89
Kapitel 90
Kapitel 91
Epilog
Thank you
Für die Generation meiner Tochter.
»Um die Nadel im Heuhaufen zu finden, brauchen wir zunächst einmal den Heuhaufen.«
General Keith B. Alexander Direktor der National Security Agency (NSA 2005–2014)
Prolog
Carrie Lanstead tauchte unter. Die Schaumbläschen über ihr brachen das Licht der in die Decke eingelassenen LED-Lampen und glitzerten durch die Wasseroberfläche wie kleine Diamanten. Sie presste die Lippen aufeinander und dachte daran, wie gerne sie mit Feuer spielte. Nach dreißig Sekunden wurde die Luft in ihren Lungen knapp, aber sie zwang den Reflex nieder. Noch ein klein wenig länger, dachte sie. Nur ein klein wenig. Nach fünfundvierzig Sekunden dachte sie daran, wie ihr Leben wohl verlaufen wäre, wenn sie einen anderen Weg eingeschlagen hätte. Sie hätte niemals studieren können, zumindest so viel war sicher. Sie stammte aus Omaha, Nebraska, jetzt lag sie in der Badewanne eines Luxusappartements an der zwanzigsten Straße in Arlington. Nach einer Minute dachte sie an ihre Eltern, die sie zweimal im Jahr besuchte. Sie kaufte Hosen und T-Shirts für diesen Anlass bei Old Navy, damit ihre Eltern keinen Verdacht schöpften. Sie sollten wissen, dass es ihr gutging. Dass sich ihre Tochter nicht verändert hatte. Ihr Vater war ein cholerischer Gebrauchtmaschinenhändler, der seine Frau mehr liebte als seine Tochter, und Carrie konnte es ihm nicht verdenken. Ihre Mutter war die perfekte Hausfrau. Nur der Hackbraten, den sie für Carrie zubereitete, weil sie glaubte, es wäre immer noch ihr Leibgericht, wurde von Jahr zu Jahr salzloser. Carrie mochte es ihr nicht sagen. Was hätte das für einen Sinn? Wie alles andere? Wie konnte man erklären, wofür es keine Begründung gab?
Nach einer Minute und fünfzehn Sekunden wurden ihre Füße taub, und Carries Gedanken kehrten ins Hier und Jetzt zurück. Die Diamanten glitzerten so wunderschön, das Licht schien ihr ferner als zuvor. Wie war sie nur in dieses Appartement gekommen? Wie hatte es so weit kommen können? Nach einer Minute und dreißig Sekunden begannen ihre Hände zu zittern, und Carrie dachte an Luft, nichts als Luft. Sie senkte ihre Handflächen zum Wannenboden hinab und drückte sich aus dem Wasser. Ein großer Schwall landete auf dem Badezimmerboden, und Carries Lungen schrien nach Leben. Sie bäumte sich auf und umschlang ihre Knie, bis sie aufhörte zu zittern. Dann nahm sie das Shampoo und den Conditioner vom Wannenrand und seifte ihre Haare ein.
Eine halbe Stunde später stand sie in einem blauen Abendkleid vor dem mannshohen Spiegel neben der Badewanne und zog den brombeerroten Lippenstift nach. Mit dem Absatz ihrer Schuhe schob sie die nassen Handtücher in der Pfütze vor der Wanne hin und her und stopfte sie dann in den Wäschesack hinter der Tür. Es klingelte. Carrie warf einen Blick auf ihre schmale Armbanduhr, verließ das Bad und drückte den Türöffner. Er war pünktlich, was sie als gutes Zeichen wertete. Das erste Date in ihrer Wohnung war immer aufregend, egal wie viel Mühe sie sich gab, es zu verbergen. Sie füllte zwei Weingläser, die schon auf der marmornen Anrichte bereitgestanden hatten. Als es zum zweiten Mal klingelte, war Carrie bereit. Sie öffnete die Tür mit einem Lächeln.
Er hielt das Glas am Boden, wenn er es zum Mund führte, was Carrie verriet, dass er ein draufgängerischer Genießer war. Es verriet Männer wie Frauen gleichermaßen, wie sie ihr Glas führten. Carrie hielt es am Stiel, sie bevorzugte den Kampf mit dem Bajonett, außerdem spielte sie ihre Rollen stets so elegant wie möglich. Er war charmant, gab sich Mühe, sie zu verführen, genau wie Carrie es erwartete. Und er kannte die Regeln. Der Umschlag zur richtigen Zeit, kein falsches Wort, so wie Carrie es mochte. Und er war definitiv kein Cop, sein K-Street-Anzug kostete vier Monatsgehälter eines kleinen Staatsdieners. In der Gegend von Washington war die Polizei ohnedies kein allzu großes Problem, weil jeder wusste, wohin es führen würde, wenn sie das Gesetz wörtlich nahmen. Allesamt wären sie verhaftet, die Senatoren aus fernen Staaten im Hauptstadtexil und die Abgeordneten aus den Kleinstädten, wo die Hockey-Mom-Ehefrauen Maulbeerkuchen für die Wahlparty stifteten. Das Washingtoner Establishment waren die besten Kunden von Frauen wie ihr.
Als er Carrie zum Bett führte, spürte sie eine starke Hand an ihrer Taille. Er bettete sie auf die Kissen wie eine Königin, während er sie küsste. Seine Hand wanderte langsam ihren Oberschenkel hinauf. Carrie legte einen Zeigefinger auf seine Lippen und griff nach ihrem Weinglas. Sie prostete ihm zu. Er hatte seinen Wein fast nicht angerührt, was äußerst selten vorkam. Möglicherweise ein Alkoholiker, dachte Carrie, die gab es in Washington öfter, als man annehmen mochte. Er griff nach dem Reißverschluss ihres Kleids und zog ihn langsam nach unten. Carrie kicherte und ließ die Träger über ihre Schultern fallen.
Er fasste sie um die Hüften, küsste sie. Sanft streifte er den rauhen Stoff über ihr Dekolleté und schlug ihr brutal mit der Faust ins Gesicht. Warmes Blut rann aus den geplatzten Gefäßen ihrer Oberlippe. Der Schlag war so unerwartet gekommen, dass Carrie nicht einmal schrie. Während sie sich noch darüber wunderte, hielt er ihr mit seiner tellergroßen Hand den Mund zu, drückte ihr die Luft ab, hielt ihren Kopf wie in einem Schraubstock, unbeteiligt wie ein Farmer, der eine Katze ertränkt, gewissenlos und mit Gleichgültigkeit gegenüber der unterlegenen Kreatur.
Panik erfasste Carrie, lähmte sie für Augenblicke, und da hatte er bereits blitzschnell ihre Arme mit Klebeband an die Bettpfosten gefesselt, dann die Füße, dann ein Stück über ihren Mund geklebt. Die große Hand war verschwunden. Carrie wand sich in ihren Fesseln, aber sie gaben nicht nach, schnitten nur noch stärker in ihre Haut. Sie lag auf ihrem Bett – unfähig, sich zu bewegen, unfähig zu fliehen, unfähig, ihrem Schicksal zu entrinnen. Opfer, blitzte die Erkenntnis durch das dumpfe Dunkel in ihrem Kopf. Der Schweiß rann über ihr Nasenbein und tropfte auf den Klebstreifen über ihrem Mund, und wenn sie sich drehte, soweit sie konnte, spürte sie den kalten Hauch der Klimaanlage auf ihrem feuchten Rücken. Der Mann, mittelgroß, mittelbraun, mittelblond stand in seinem teuren Anzug in ihrer Küche und wog die Messer aus dem Messerblock in der Hand. Sie beobachtete ihn wie kurz zuvor die Diamanten auf dem Badewasser. Seltsam unbeteiligt, obwohl sie wusste, was folgen würde. Es waren die Warnungen ihrer Eltern, ausgesprochen am Sonntagstisch gegen die jugendliche Überzeugung, unsterblich zu sein. Die Warnungen vor der großen Stadt und dem, was sich in ihrem Innersten hinter der glitzernden Fassade verbarg. Dem Bösen. Der Bestie. Diesem Mann. Er griff nach ihrem Telefon und wählte eine Nummer. Ohne mit jemandem zu sprechen, legte er auf, zog sich aus und kam näher. Als er ihr das erste Mal in den Bauch stach, spürte Carrie die warmen Blutspritzer auf ihrem Gesicht noch vor dem Schmerz. Als er in sie eindrang, kotzte sie hinter ihrem Plastikknebel und wäre daran erstickt, wenn er ihn nicht heruntergerissen hätte. Kein Mensch konnte sich das vorstellen, die Schmerzen, wie sie sich wirklich anfühlten. Gewalt war Teil der Popkultur. Man sah sich das Blut im Fernsehen an und sah es doch nicht. Man glaubte zu wissen, was Schmerzen sind, und blieb doch vollkommen ahnungslos. Zweidimensionale Bilder waren abstrakte Blaupausen der Wirklichkeit. Nicht vergleichbar. Ihr Körper schrie, schrie, schrie, die Nerven versendeten Schmerz, Schmerz, Schmerz.
Eine Stunde später hätte sich Carrie alias Samantha Sweet gewünscht, er hätte sie verrecken lassen. Und sie hätte Omaha, Nebraska, nie verlassen. Aber dazu war es zu spät.
Kapitel 1
The White House
1600 Pennsylvania Avenue, Washington, D. C.
2. Dezember, 09:11 Uhr
Gary Golay fischte einen Double Choc Brownie von der silbernen Etagere, die auf einer antiken Kommode unter dem Gemälde »Watson and the Shark« von John Singleton Copley stand. Er betrachtete die Fischer, die den Jungen vor dem Hai zu retten versuchten. Direkt vor der Tür zum Oval Office schrie ein Gemälde nach Rettung in aussichtsloser Lage. Copley zeigte anschaulich, dass die richtigen Beweggründe wichtiger waren als der Ausgang ihrer Mission. Die Fischer mussten es versuchen, koste es, was es wolle. Der Zusammenhalt einzelner Menschen war nichts anderes als der Zusammenhalt einer ganzen Nation. Der Präsident hatte es am ersten Tag des Shutdown aufhängen lassen, als Mahnmal für die Republikaner im Kongress, dass es diesmal um alles ging. Eugenia Meeks, die langjährige persönliche Sekretärin des Präsidenten, hatte ihr Gebäck darunter plaziert, damit jeder Republikaner die Botschaft verinnerlichte. Ihre Brownies hatten Tradition, seit sie das Senatsbüro des Präsidenten geleitet hatte, heute wurden die benötigten Mengen von der Küche des Weißen Hauses gebacken, nach ihren Rezepten, wie Eugenia betonte. Sie hob eine Augenbraue, weil Gary nicht gefragt hatte. Er machte ein schuldbewusstes Gesicht und wusste dabei genau, er würde damit durchkommen.
»Er liegt hinter dem Zeitplan«, sagte Eugenia Meeks.
»Ach was«, sagte Gary und betrachtete den saftigen Kuchen. Er hatte gute Neuigkeiten im Gepäck, er hatte keinen Grund, das Gespräch mit dem Präsidenten zu fürchten, obwohl man in letzter Zeit nicht immer wusste, woran man bei ihm war oder ob man noch auf seiner Liste stand. Seit er vor dem Wahlkampf für seine zweite Amtszeit nahezu alle Mitarbeiter ausgetauscht hatte, war niemand mehr sicher, auch Gary nicht, obwohl er schon länger dabei war als die meisten. Als Stellvertretender Stabschef war er für die Innenpolitik zuständig. Er hielt die Kanäle offen, besorgte die Stimmen, die sie für jede Gesetzesvorlage brauchten. Den Shutdown hatte Gary überstanden, was fast verwunderlich war. Und immerhin reichte sein Ansehen im Raum vor dem Oval Office noch für einen ungebetenen Griff nach Eugenias Gebäcketagere. Oftmals waren eine unvermeidbare Wartezeit vor dem innersten Sanktum des Weißen Hauses die einzigen ruhigen Minuten an einem bis auf die letzte Sekunde durchgetakteten Arbeitstag im Westflügel.
»Wie wäre es mit einem kleinen Tipp zur Großwetterlage?«, fragte Gary.
Eugenia warf einen skeptischen Blick auf seinen Brownie: »Sie wollen wissen, wie er gelaunt ist? Manchmal glaube ich, die aus dem Untergeschoss mischen bewusstseinsverändernde Drogen in den Teig«, sagte sie.
»Woher nehmen Sie die Gewissheit, dass sie nicht einfach unseren Kaffee vergiftet haben?«, fragte Gary.
»Wir haben Sensoren, die unsere Raumluft auf Anthraxsporen überwachen, vor der Tür stehen zwei Marines, und wenn ich eine Taste an meinem Schreibtisch drücke, wird der Westflügel abgeriegelt. Glauben Sie mir, Gary, unser Kaffee ist sicher.«
»Ebenso wie Ihre vorzüglichen Brownies, Eugenia«, sagte Gary und tat so, als betrachte er wieder das Gemälde mit den Fischern. Eugenia lächelte milder gestimmt. Sie würde ihm trotzdem niemals verraten, was ihn nichts anging.
Fünf Minuten später rauschte Präsident Ward an ihm vorbei, eingekeilt zwischen der Nationalen Sicherheitsberaterin und dem Stabschef, Garys direktem Vorgesetzten. Als er Gary sah, setzte er das breite Präsidentenlächeln auf, das er anknipsen konnte wie eine Schreibtischlampe, und zeigte weiße Zähne. Sein Blick fragte: Alles okay mit der Abstimmung? Verdammt noch mal, Gary, haben Sie die Stimmen? Es war die wichtigste Gesetzesvorlage seiner zweiten Amtsperiode, sein Geschenk an das amerikanische Volk. Sie sollten ihn als einen der Guten in Erinnerung behalten, nicht nur wegen der Gesundheitsreform. Gary sagte: »Guten Morgen, Mister President, ja, wir werden gewinnen.« Er sagte das an den Rücken des Präsidenten gewandt, der im Vorbeigehen ein Dokument unterzeichnete, das Eugenia ihm in einer schwarzen Ledermappe unter den Stift hielt.
»Gut gemacht, Gary, ich danke Ihnen!«, rief der Präsident auf dem Weg zu seinem täglichen Sicherheitsbriefing, sein Tross war schon fast aus der Tür.
»Danke, Mister President«, sagte Gary Golay der Vollständigkeit halber. Der National Security Privacy Act hatte ihn einige graue Haare gekostet.
»Sind Sie sicher, dass Sie sich nicht verzählt haben?«, fragte Eugenia Meeks.
»Der Präsident kann sich auf mich verlassen«, murmelte Gary Golay. Tatsächlich hatte er sich anstrengen müssen, genügend Republikaner umzudrehen und die eigenen Reihen geschlossen zu halten. Die Lobbygruppen der Internetfirmen mit ihren tiefen Taschen hatten nicht gerade geschadet. Insbesondere dem Hochtechnologiesektor drohten durch die weltweite Bespitzelung, die Amerika seit dem elften September betrieb, große Verluste. Irgendwann, so die Befürchtung, würden sich ihre Kunden abwenden und ihre Daten in anderen, weniger paranoiden Ländern speichern. Es ging um viel Geld. Sehr viel Geld. Es ging um eine Zukunftsindustrie. Hightech war das Automobil des 21. Jahrhunderts. Die Branche, die eine ganze Volkswirtschaft vom Weh ins Wohl zu steuern vermochte. Wenn man es nicht versaute. Und deshalb stand seine Armee seit zwei Stunden abstimmbereit in den überaus unübersichtlich angelegten Schützengräben des Kongresses. Morgen war der Tag der Schlacht. Möglicherweise würde er den einen oder anderen Abtrünnigen zurück zur Herde treiben müssen, aber das wäre das geringste Problem. Absprachen galten immer noch, persönliche Zusagen waren das Letzte, was dieses Land überhaupt noch regierbar hielt.
»Nehmen Sie sich noch einen Brownie für den Weg«, sagte Eugenia, als er sich zum Gehen wandte. »Sie wissen doch, wie wichtig ihm die Vorlage ist.«
Das wusste Gary Golay tatsächlich. Und er wusste, was das Gesetz für seine Karriere bedeuten konnte. Der nächste Präsident würde einen neuen Stabschef brauchen. Kontroverse Vorlagen wie diese waren das Eisen, aus dem Chiefs of Staff geschmiedet wurden.
Kapitel 2
St. Johns Place
Brooklyn, New York
2. Dezember, 09:56 Uhr (eine halbe Stunde später)
Ana-Maria Guerro legte einen Teigfladen direkt auf die Herdplatte und beobachtete, wie sich kleine Bläschen auf der Oberseite bildeten. Mit der gesammelten Erfahrung von über fünfzig Jahren wendete sie den Tortilla genau im richtigen Augenblick und betrachtete zufrieden die kleinen dunkelbraunen Röstflecken. Im Kühlschrank lagerten noch ein paar Tomaten und in dem Tontopf neben Marleys Decke einige rote Zwiebeln für eine Salsa. Avocado oder Hühnchen kamen nur sonntags in Frage, aber sie war eine Frau, die mit wenig zufrieden war und mit jedem Jahr weniger benötigte. Marley lungerte neben ihren Füßen herum, um ein Stück Brot oder eine Tomate zu ergattern. Er war der einzige Hund, den sie kannte, der Gemüse mochte, und er war ihr Ein und Alles, vor allem seit Ernesto gestorben war. Und seit der Sache mit der Wohnung. Die Fixsterne ihres Lebens drohten zu verblassen. Mit furchtlosen Fingern bugsierte sie den Fladen in ein rotes Plastikkörbchen, das sie vor Jahren bei einem Imbiss hatte mitgehen lassen, weil die dort in den Mülleimer wanderten. Ana-Maria Guerro sah nicht ein, warum man funktionsfähige Körbchen wegwerfen sollte. Genauso wenig wie alte Menschen. Ana-Maria Guerro war vierundsiebzig Jahre alt.
Um elf Minuten nach neun Uhr klingelte es an der Tür. Ana-Maria Guerro schlurfte in ihren Hausschuhen durch den winzigen Flur ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung, vorbei an der schmalen Anrichte mit den Fotos. Sie hielt inne. Was wäre, wenn er einfach klingeln würde? Wenn er da stünde, als hätte es die Schläuche in seinen Armen nie gegeben, und auch nicht die Maschine, die Luft in seine Lungen gepumpt hatte? War es Ernesto, der klingelte? Oder war es ihr Sohn, den sie seit über zwei Jahren nicht mehr gesehen hatte? Nein, Raoul würde anrufen. Und selbst das käme einem Wunder gleich, schließlich war heute nicht einmal ihr Geburtstag. Ihre Träume spielten ihr wieder einmal einen Streich. Sie räusperte sich, weil sie fürchtete, ihre Stimme könnte brechen. Manchmal tat sie das beim ersten Satz des Tages. Das war Ana-Maria sehr unangenehm. Es schickte sich nicht, dass die Stimme brach, weil man niemanden hatte, dem man einen guten Morgen wünschen konnte. Dann drückte sie den Knopf an der Gegensprechanlage.
»Guten Tag, Mrs. Guerro, hier ist Pia Lindt.«
»Wer ist dort?«, fragte Ana. Also nicht Ernesto und auch nicht Raoul.
»Pia Lindt, Mrs. Guerro. Wir haben Ihren Namen vom Sozialamt.«
»Ich brauchte nichts, danke sehr«, sagte Ana-Maria und hängte den Hörer ein. In letzter Zeit kamen keine guten Nachrichten vom Sozialamt. Sie konnte heute keine schlechten Nachrichten mehr gebrauchen. Nur eine Tortilla mit Salsa und vielleicht etwas Sauerrahm. Es klingelte erneut.
»Mrs. Guerro? Ich komme von der Kanzlei Thibault Stein. Uns ist zu Ohren gekommen, dass Sie Schwierigkeiten mit Ihrem Vermieter haben. Vielleicht kann ich Ihnen helfen!«
»Wie sollten Sie mir schon helfen können?«, fragte Ana. Sie fragte sich inzwischen schon, warum sie das Klingeln überhaupt beantwortet hatte.
»Wir würden Sie gerne vertreten«, sagte die Unbekannte. Ana kannte die Anzeigen von Anwälten in den U-Bahnen und an den Bushaltestellen. Viele von ihnen waren auf Spanisch verfasst. »Hatten Sie einen Arbeitsunfall? Wir holen das Maximum für Sie heraus. Rufen Sie 0800-Arbeitsanwalt-Jetzt. Wir kämpfen für Ihr Recht!« Ana-Maria Guerro glaubte nicht an die Selbstlosigkeit von Anwälten, vor allem nicht, wenn sie Werbung auf Spanisch schalteten.
»Kostenlos«, fügte die Unbekannte vor ihrer Tür hinzu. Marley bellte ein dunkles Großhundebellen.
»Sie wollen mich kostenlos vertreten?«, fragte Ana-Maria.
»Ja, Mrs. Guerro. Wie gesagt, wir kommen vom Sozialamt.«
»Warum sollten Sie das tun?«, fragte Ana-Maria Guerro.
»Würden Sie mich rauflassen? Dann erkläre ich es Ihnen«, versprach die Unbekannte. Ana-Maria überlegte, warf einen Blick auf das Foto ihres verstorbenen Mannes und drückte den Türöffner.
Keine zwei Minuten später stand eine junge Frau vor ihrer Tür, die aussah, als wäre sie einer Telenovela entstiegen. Blond, vielleicht Anfang dreißig, kurvige, aber sehr attraktive Figur und sehr gut geschnittenes Kostüm, das sie vor zehn Jahren kaum besser hätte schneidern können. Sie sah aus wie eine Frau, zu der sie ihrem Sohn gratuliert hätte, wenn er nicht so ein erwiesener Nichtsnutz wäre.
»Sie sehen nicht aus wie vom Sozialamt«, sagte Ana-Maria durch den schmalen Spalt ihrer Wohnungstür. Marley hockte neben ihr auf ihrem Schwanz und schaute verängstigt aus den großen schwarzen Augen. Der Rhodesian Ridgeback reichte Ana-Maria fast bis zur Brust. Ihre Besucherin schien nicht eingeschüchtert, was bemerkenswert war.
»Vermutlich nicht«, sagte die junge Frau und streckte ihr eine perfekt manikürte Hand entgegen. Ana-Maria ergriff sie mit ihrer altersfleckigen und bemerkte in den Augen der jungen Frau, die kaum halb so alt sein dürfte wie sie, kurzes Erstaunen. Vermutlich hätte sie nicht gedacht, dass eine alte Frau weiß, wie man sich ordentlich die Hand schüttelt.
»Pia Lindt«, stellte sie sich erneut vor und reichte ihr eine Karte, die aussah, als koste sie mehr als zwei Tortillas mit geschmorter Rinderschulter. »Thibault Godfrey Stein – Attorneys« stand darauf und eine Adresse in Manhattan. Feine Karte, feines Pflaster, feine Lady, dachte Ana-Maria, und ihre Skepsis wuchs.
»Wie ich höre, haben Sie Probleme mit Ihrem Vermieter?«, fragte Pia Lindt.
»Das kann man so sagen«, bestätigte Ana und blickte dabei zu Marley, die sich hinter ihren Beinen versteckte.
»Erst hat er mir sechstausend Dollar geboten, wenn ich ausziehe, später noch mehr Geld. Und jetzt klagt er wegen Marley. Sie bauen ein Luxus-Appartementhaus aus meiner Wohnung, das ist alles.«
»Hat Ihr Vermieter kürzlich gewechselt?«, fragte Pia Lindt.
»Früher hat alles dem Metzger gehört, der wohnte eine Straße weiter. Herzinfarkt. Und seine Söhne haben alles verscherbelt. Seitdem geht alles bergab.«
Pia Lindt zückte einen Kugelschreiber.
»Nicht so schnell«, sagte Ana-Maria.
Pia Lindt steckte den Stift wieder weg.
»Was heißt, Sie arbeiten kostenlos? Nichts ist kostenlos im Leben«, sagte Ana-Maria. »Glauben Sie mir, ich weiß das.«
»Normalerweise schon«, sagte ihre ungebetene Besucherin. »Aber manchmal gewinnt man auch etwas, wenn man nicht aufgibt. Und das haben Sie niemals getan, wenn ich dem Sozialamt glauben darf.«
»Sie meinen, so etwas Ähnliches wie ein Lottogewinn? Mein Ernesto hat jede Woche gespielt, über vierzig Jahre lang, und er hat nicht einen Penny gewonnen.«
»Vielleicht hat er nicht umsonst gespielt, Ana«, sagte Pia Lindt, die Frau mit der teuren Visitenkarte. »Thibault Stein wird Sie persönlich vertreten, wenn Sie möchten.« Sie sagte das, als wäre Moses höchstselbst vom Berg gestiegen.
»Lassen Sie mich Ihnen erklären, was wir vorhaben«, sagte die junge Frau. Ana-Maria öffnete die Tür. Zum Gewinnen, das wusste sie, gehörte nicht nur das Spielen, sondern auch das beherzte Zugreifen im richtigen Moment.
Kapitel 3
Fort Meade, Maryland
Crypto City, Gebäude 22, Cubicle 04-22-5866
2. Dezember, 20:04 Uhr
Der Beamte mit der Personalnummer AF-523940TTEE349 der National Security Agency saß in seiner dreieinhalb Quadratmeter großen Parzelle eines offenen Büros im vierten Stock. Er war gerade dabei, auf seinem Backup-System eine Archivierung zu starten, als er plötzlich auf seinem Hauptmonitor etwas Ungewöhnliches bemerkte. Seine Augen wanderten zu dem Kürzel aus roten Buchstaben, der sogenannten Flag, das ankündigte, dass neue Daten zu observierten Personen gesammelt wurden, die sofort bearbeitet werden mussten. Rote Flags gab es äußerst selten, fast immer handelte es sich dabei um Terroristen oder militärisch bedeutsame Zielobjekte. Der Mann tippte einige Takte in seine Tastatur, woraufhin ein Fenster mit den zu sammelnden Daten erschien:
AUDIO TRANSMISSION #013014FFF8523409
IDENTIFIED SUBJECT: Golay, Gary
IDENTIFIED SUBJECT: Golay, Emma
TIME OF RECORDING: 20:02-##:##
Die Aufgabe des Mannes, der an einem anonymen rechteckigen Arbeitsplatz saß, abgeschirmt durch dünne, aber effektive Plastikwände von seinen zweihundert Kolleginnen und Kollegen, mit denen er sich den vierten Stock des Gebäudes 22 teilte, war es, die vom System fortlaufend vergebene Nummer den entsprechenden Fällen zuzuordnen. Jeder einzelne Mitschnitt wies im besten Fall Dutzende von Querverbindungen zu anderen überwachten Personen oder E-Mail-Konten auf. Die Vernetzung des Systems, die Verschlagwortung, wie es Archivare in den letzten vierhundert Jahren vor dem Computerzeitalter genannt hätten, war der heilige Gral ihrer Arbeit. Einiges erledigten die Programme von selbst, aber bei den eiligen Fällen, den Staatsfeinden und den Terroristen, war manuelles Eingreifen erforderlich. So wie in diesem Fall, das signalisierte die rot leuchtende Schrift. Der Mann setzte Kopfhörer auf und schaltete sich live in die Konversation, um die Datei korrekt und möglichst vollumfänglich verlinken zu können. Bisher waren nur die beiden Gesprächsteilnehmer identifiziert, am Ende der Aufzeichnung würde er unzählige Fäden zu anderen Personen gesponnen haben. Der Mann hörte kein Rauschen, die modernen Mikrofone waren ausgereift und ermöglichten eine störungsfreie Übertragung. Es waren keine Mikrofone der NSA, die das Gespräch für ihn belauschten, sie saßen in den Handys, die heutzutage überall auf den Restauranttischen lagen. Es waren Tausende Ohren, die für die NSA arbeiteten. Und sie hatten sie nicht einmal bezahlen und installieren müssen.
Kapitel 4
The Velvet Restaurant and Bar at the Clairmont
23rd Street, Washington, D. C.
2. Dezember, 20:05 Uhr (zur gleichen Zeit)
Wie wäre es mit einem Salat?«, fragte Gary.
»Nicht heute Nacht«, sagte Emma. »Dieser Abend ist ein Fleischabend.«
Gary hob eine Augenbraue, enthielt sich aber eines Kommentars. Über die riesige Speisekarte hinweg bestellte er eine Flasche Pinot Noir und einen Brotkorb bei einem Kellner, der für seinen Geschmack deutlich zu livriert daherkam.
»Ist heute Nacht eine besondere Nacht?«, fragte Gary.
»Ich würde sagen, heute Nacht ist die Nacht aller Nächte«, antwortete Emma verschwörerisch und gerade noch rechtzeitig, bevor die Livree an ihren Tisch trat, um die Flasche im 23-Grad-Winkel zur Inspektion anzubieten. Emma bedeutete dem Kellner, das Glas vollzuschenken, statt den üblichen Probierschluck abzuwarten.
»Das mit dem Korken ist eine Augenwischerei der Franzosen«, versuchte sich Gary an einer Erklärung. »Vor allem, wenn man bedenkt, dass das Weingut seit zehn Jahren keinen Naturkork mehr verwendet.«
Der Sommelier nickte betroffen und trat einigermaßen entsetzt den Rückzug an.
»Glaubst du, er hält mich für einen Banausen?«, fragte Gary.
»Nein«, sagte Emma und trank einen sehr großen Schluck von dem Pinot. Ihr breites Grinsen verschwand hinter dem Glasrund und der tiefroten Pfütze. »Der Wein ist prima.«
»Wir haben nicht angestoßen!«, protestierte er.
»Es bringt Unglück, einen Tag vorher darauf anzustoßen.«
»Ich wollte auf uns anstoßen!«, sagte Gary.
»Du wolltest auf uns anstoßen?«, fragte Emma. »Was ist nur in dich gefahren?«
Gary betrachtete die Frau im schummrigen Licht des Restaurants. Er sah die Kette mit der silbernen Kralle, die eine große, schwarz schimmernde Perle in der kleinen Halsgrube unterhalb ihres Schlüsselbeins hielt. Er sah die schlanken Finger mit dem dunklen Nagellack. An ihrem zarten Handgelenk baumelte ein maskuliner Chronograf, der zu groß für sie war. Er sah ihren Mund, geschwungen und spöttisch.
»Gibt es einen Grund, warum wir nicht auf uns trinken sollten?«
»Nein«, sprach Emma in die Tiefe des Glases, und hätte Gary es nicht besser gewusst, hätte er schwören können, dass sie ihn verführen wollte. Sie war umwerfend in dieser Rolle. Dabei hatte er sich vorgenommen, es diesmal nicht so weit kommen zu lassen. Heute würde er die Zügel nicht aus der Hand geben. Er würde derjenige sein, der sie verführte.
»Wie geht es dem Präsidenten?«, fragte Emma, während sie die Karte studierte. Sie konnte schneller die Themen wechseln als er, und das sollte etwas heißen, schließlich arbeitete Gary im West Wing, wo es in einer Minute um das Verbot von Maschinengewehren und in der nächsten Sekunde um eine bemannte Marsmission gehen konnte.
»Gut«, antwortete Gary denkbar knapp. »Der Lammrücken ist sehr zu empfehlen.«
»Sagst du, weil du mit allen deinen Liebhaberinnen hierhergehst?«
Gary lächelte. Waren das noch Emmas Spottlippen? Oder ahnte Gary einen Anflug von Eifersucht hinter den grünen Augen?
»Soll mir dieses überhebliche Grinsen sagen, dass du die Stimmen hast?«, setzte Emma nach.
»Wo sollte ich deiner Meinung nach mit meinen anderen Liebhaberinnen hingehen?«, fragte Gary und klappte die Karte zu. »Und ja, ich habe die Stimmen. Glaubst du ernsthaft, sonst säßen wir am Abend vor der Abstimmung im Velvet?«
Das Handy in der Innentasche seines Jacketts kündigte einen drohenden Anruf mit zwei vorsichtigen Vibrationen an. Natürlich handelte es sich technisch gesehen bereits um einen Anruf, so dass die folgende Störung unausweichlich war. Gary seufzte. Er war sehr lange nicht mit Emma hier gewesen, und er hatte sich einiges vorgenommen für den Abend vor seinem wichtigsten Erfolg der letzten sechs Monate. Er zog das Handy heraus, auf dem Display stand »Christina«. Gary hob abwehrend beide Hände und beeilte sich aufzustehen.
»Wir müssen gehen«, sagte er, als er an den Tisch zurückkehrte.
»So? Was ist passiert? Haben sie sich an Christinas Popcorn überfressen?«
»So ähnlich …«, seufzte Gary und warf einen bedauernden Blick auf Emmas Beine unter dem schwarzen Kleid.
»Immerhin hatten deine Kinder dann mehr zu essen als wir«, sagte Emma.
»Christina hat uns etwas von dem Makkaroniauflauf übrig gelassen«, versprach Gary und half ihr in den Mantel.
»Wenigstens hatten wir einen schönen Wein.«
»Glaub nicht, dass ich dich so einfach davonkommen lasse«, raunte ihr Gary auf dem Weg nach draußen ins Ohr. »Immerhin sind es auch deine Kinder.«
»Wir werden schon einen Weg finden, unser Vorweihnachtsdinner gebührend ausklingen zu lassen«, sagte Emma. »Haben wir das nicht immer?«
Gary grinste. Er wählte Christinas Nummer und warf Emma den Schlüssel zu ihrem Wagen zu. »Du fährst, ich erkläre ihr die Strategie für besondere Sondernotfälle.«
Kapitel 5
The White House
1600 Pennsylvania Ave., Washington, D. C.
2. Dezember, 23:12 Uhr (drei Stunden später)
Colin Ward saß zu nachtschlafender Stunde in seinem Büro am Schreibtisch und versuchte, trotz seiner Müdigkeit einen klaren Gedanken zu fassen. Sieben schlaflose Jahre brachten den konditionsstärksten Bullen an den Rand eines Burn-outs und graue Haare obendrein. Du kommst als Bulle und gehst als Greis, dachte Colin Ward. Er hatte die Beine übereinandergeschlagen, und neben seinen blankpolierten Lederschuhen lag das Manuskript einer Rede, die er morgen im East Room halten würde, wenn das Gesetz den Kongress passiert hatte. Die weißen Seiten lagen auf der dunklen Tischplatte, die ihn vom Denken abhielt, denn er mochte keine dunklen Hölzer. Aber es war ausgeschlossen, den Resolute Desk zu kritisieren, geschweige denn, ihn auszutauschen. Schließlich war der Schreibtisch einst aus dem Holz der HMS Resolute gefertigt und Rutherford Hayes als Geschenk von Queen Victoria übersendet worden. Das hässliche Monstrum war ein Stück Geschichte und lag damit außerhalb seines Einflusses. Ein kurzes energisches Klopfen, direkt gefolgt von dem Aufschnappen eines Türschlosses, signalisierte, dass sein Stabschef ihn sprechen musste.
»Guten Abend, Mister President«, sagte Michael Rendall. Er trug eine Mappe mit dem Emblem der NSA unter dem Arm.
»Hallo, Michael«, sagte Colin Ward. »Haben Sie sich je gefragt, warum ich mit dieser Monstrosität von Schreibtisch auskommen muss? Ich bin der Führer der freien Welt, aber die Inneneinrichtung meines Büros kann ich mir nicht aussuchen.«
»Er wurde aus dem Holz der HMS …«
Colin Ward machte eine wegwerfende Handbewegung.
»Soweit ich weiß, hat Reagan den Schreibtisch im Gästezimmer der Wohnung aufstellen lassen. Und niemand sagt, dass Sie …«
»Geschenkt«, unterbrach ihn der Präsident. »Hören Sie sich das hier an: ›Amerika wurde gegründet als das Land der Freiheit. Amerika ist ein Versprechen von Freiheit. Amerika ist ein Synonym für Freiheit.‹ Finden Sie das gut?«
»Freiheit ist unsere DNA, Mister President. Sie finden in diesem Land Menschen, die dagegen sind, den Verkauf von Maschinengewehren zu verbieten. Sie finden in diesem Land Menschen, die dagegen sind, Milch zu trinken oder das Recht auf Abtreibung zu gewähren. Aber Sie finden in diesem Land niemanden, der gegen die Freiheit ist. Es ist ein guter Satz, Mister President. Er hat in der Marktforschung sehr gut abgeschnitten.«
»Oder hier: Als in Berlin die Mauer fiel, atmeten die Menschen hinter dem Eisernen Vorhang auf. Weil die Überwachung der Staatssicherheit ein Ende fand. Heute kann Amerika aufatmen, denn heute findet die Online-Überwachung ein Ende. Der Kampf gegen den Terror wird fortgeführt. Mit aller Härte. Aber nicht mehr mit allen Mitteln. Weil nicht alles, was möglich ist, auch Recht ist. Heute fällt eine Mauer – auf der ganzen Welt. Und morgen wird Amerika wieder das Land der Freiheit sein.«
Colin Ward schwang die Füße von der antiken Tischplatte und beugte sich nach vorne: »Machen wir einen Fehler, Michael? Glauben Sie, dass es ein Fehler ist?«
»Die Geheimdienste behaupten das, Mister President.«
»Ich weiß, aber was meinen Sie?«
»Dieses Gesetz wird als Überschrift für Ihre Präsidentschaft in den Geschichtsbüchern stehen«, sagte Michael Rendall und verlagerte das Gewicht auf das andere Bein. »Auf die eine oder die andere Weise.«
Colin Ward biss auf dem Nikotinkaugummi herum, bis sich der betäubend scharfe Geschmack einstellte. Was, wenn das Attentat auf den Bostoner Marathon nach seinem Gesetz verübt worden wäre? Sie hätten ihn verantwortlich gemacht, ihn und seine demokratische Verweichlichung, seine Liberalität. Liberal war ein Schimpfwort geworden im Amerika der Tea Party, die seine Nation nach rechts gezwungen hatte. Die stolze Nation, die beanspruchte, die moderne Demokratie erfunden zu haben, drohte an einer Minderheitenmeinung zu zerbrechen. Was, wenn es ein zweites Boston gab? Schwarz wäre die Überschrift seiner Präsidentschaft in den Geschichtsbüchern.
»Mister President?«, fragte Michael Rendall.
Colin Ward lächelte sein Präsidentenlächeln.
»Wir müssen über das Weihnachtssingen reden.«
»Weil es auf der Welt nichts Wichtigeres gibt?«, fragte Colin Ward. »Zum Beispiel, dass wir den Glass-Steagall-Act pulverisiert haben und die Banker von der Wall Street uns wieder auf der Nase herumtanzen? Oder dass wir nicht wissen, wie wir uns am Hindukusch zur Hintertür rausschleichen sollen, obwohl uns da nie jemand haben wollte?«
Michael Rendall nickte.
Colin Ward seufzte: »Dann lassen Sie uns darüber reden.«
Er legte die Rede beiseite. Es war ohnehin nicht mehr aufzuhalten, oder nicht? Gary Golay hatte für ihn die Büchse der Pandora geöffnet. Ein Teil von ihm hatte gehofft, Gary würde scheitern. Und er wusste in dieser Nacht nicht mehr, welchem Teil seiner widerstreitenden Gefühle er trauen sollte.
Kapitel 6
Mohican Road, Bethesda, Maryland
3. Dezember, 08:31 Uhr (am nächsten Morgen)
Auf dem Rücksitz tobte die Schlacht von Gettysburg, als Gary Golay seinen Dodge Durango auf den Bordstein vor der Schule lenkte. Er war spät dran, aber auf das tägliche Ritual, seine beiden Töchter in Ruhe zur Schule zu fahren, verzichtete er selten. Auch wenn es fast immer zu schweren verbalen Gefechten auf der Rückbank kam.
»Wir sind da«, rief Gary in der leisen Hoffnung auf einen Waffenstillstand.
»Was du nicht sagst, Dad«, zog ihn die dreizehnjährige Louise auf. Sie hatte die besserwisserische Phase nie überwunden, und Gary vermutete, dass die Pubertät kein Spaziergang im Park werden würde.
»Louise hat kein Recht, fies über meine Freunde zu reden«, hörte er die glockenhelle Stimme des Nesthäkchens. Mit acht Jahren war die Welt noch in Gut und Böse geordnet, so dass es im Grunde unvernünftig war, sich nicht von der Kindergeneration regieren zu lassen. Zumal Jo den Gerechtigkeitssinn ihrer Mutter geerbt hatte. Emma konnte es nicht ertragen, wenn Menschen Unrecht widerfuhr, und sei es an der Supermarktkasse. Ansonsten war Emma Golay allerdings ein harter Hund. Wie Josephine, seine Jüngere, auch.
»Louise, reiß dich zusammen. Und Jo, du darfst es dir nicht immer so zu Herzen nehmen, was deine Schwester sagt.« Es gab deutlich zu viele Frauen in Gary Golays Leben. »Und jetzt raus.«
»Erst, wenn Louise das zurücknimmt«, sagte Josephine, die niemand jemals bei ihrem vollen Namen nannte. Gary sah ihre verschränkten Arme vor sich, bevor er in den Rückspiegel blickte. Als Nächstes würde Louise die Flucht antreten, ihre Hand ruhte schon auf dem Verschluss des Sicherheitsgurts.
»Louise«, mahnte Gary. »Tu uns den Gefallen, okay?«
»Okay, Dad«, sagte Louise.
Gary drehte sich nach hinten um und setzte seinen strengsten Blick auf, seine Ältere rollte mit den Augen.
»Pete ist ein netter Kerl«, sagte Louise, löste den Gurt und griff nach ihrer Schultasche, an deren Schulterriemen unzählige Freundschaftsbändchen und Anhänger baumelten. Keine zwei Sekunden später fiel die Tür ins Schloss.
»Okay für dich, Jo?«
Seine jüngere Tochter war ein tapferes, schüchternes Mädchen, die es mitnahm, wenn es Streit in der Familie gab. Jo nickte: »Kommst du uns heute abholen?«
»Das werde ich nicht schaffen, Schatz. Aber Christina hat Moms Wagen behalten und sammelt euch nach der Schule ein, okay?«
Jo nickte erneut und starrte auf den Boden. Gary spürte einen vertrauten Stich in der Brust. Kümmerten sie sich genug um die beiden Mädchen? Oder wurden ihnen ihre eigenen Eltern fremd, weil beide arbeiteten und ein Teil der Kinderbetreuung an Christina hängenblieb, ihrem venezolanischen Kindermädchen? Christina war über jeden Zweifel erhaben, sie behandelte Jo und Louise wie ihre Schwestern. Eine Schwester war kein Ersatz für die Eltern, wusste Gary. Aber was hatten sie für eine Wahl? Heute zumindest keine.
»Na komm, dann sieh mal zu, dass du nicht zu spät kommst«, sagte er, während das schlechte Gewissen in ihm weiternagte.
»Okay«, sagte Jo und stieg aus dem Wagen. Ihr Schulrucksack mit dem weißen Einhorn sah groß aus auf dem kleinen Rücken. Groß und schwer. Gary Golay hoffte, dass das Gepäck nicht zu schwer war für seine Tochter. Dann rollte er vom Parkplatz der Schule auf die Straße und fuhr weiter auf den 190er, der ihn in die Stadt bringen würde.
Als er den Polizeiwagen hinter sich bemerkte, kontrollierte er seine Geschwindigkeit. Er war zehn Meilen zu schnell unterwegs, eine Ordnungswidrigkeit, mit der man im Berufsverkehr normalerweise durchkam. Trotzdem ging er vom Gas, er hatte nicht vor, sich seinen Tag von einem übereifrigen Beamten mit einem Ticket vermiesen zu lassen. Es versprach ein wunderbarer Tag zu werden. Er hielt sich rechts und dachte darüber nach, ob Emmas Terminkalender eine kleine Feier heute Abend zulassen würde. Sie würden mit den Kollegen die Abstimmung anschauen und ein paar Drinks nehmen und Roastbeef-Brötchen aus der Küche ordern. Es hatte selten genug etwas zu feiern gegeben im letzten Jahr. Ein kurzer Blick in den Rückspiegel verriet ihm, dass ihm der Streifenwagen noch immer folgte. Schön, dass die Polizei nichts Besseres zu tun hat, dachte Gary.
Kapitel 7
Fort Meade, Maryland
Crypto City, Gebäude 21, Cubicle 06-08-1197
3. Dezember, 08:44 Uhr (zur gleichen Zeit)
Der Beamte mit der Personalnummer HW-468951DZEE483 bearbeitete den zweiten Fall an diesem Morgen. Er bestätigte den Erhalt der Anordnung, verifizierte den Absender anhand seines kryptografischen Schlüssels und begann mit der eigentlichen Arbeit. Seine Aufgabe war es, bestimmte Dateien in den Datenbanken zu suchen und in die Systeme der Strafverfolgungsbehörden einzupflegen. Es war eine Sisyphus-Arbeit, denn die Systeme waren untereinander nicht immer kompatibel, so dass er in manchen Fällen die Dateien öffnen und den Inhalt manuell kopieren musste. Es war keine ungewöhnliche Aufgabe, es gehörte zum Standard-Repertoire der NSA, bei Anfragen vom FBI oder anderer Behörden unterstützend einzugreifen. Der Großteil ihres Materials unterlag der Geheimhaltung, aber wenn die entsprechenden Dokumente des Secret Surveillance Courts vorlagen, gaben sie weiter, was sie hatten. Dabei war es von Vorteil für die Sicherheit Amerikas und der westlichen Welt, dass die Geheimgerichte nicht gerade dafür berühmt waren, auf Einhaltung der Bürgerrechte zu pochen. Von 1782 Anfragen des Jahres 2013 hatten sie 1779 im Sinne der Geheimdienste entschieden. Ungewöhnlich an dem heutigen Fall war jedoch die Anweisung, die Herkunft bestimmter Daten zu verschleiern und die jeweiligen Referenznummern innerhalb des NSA-Systems zu löschen. Der Angestellte versicherte sich noch einmal der Authentizität der E-Mail und begann dann mit seiner Arbeit. Er würde den Fall niemals wieder auf seinen Schreibtisch bekommen. Dies war eine der Sicherheitsvorkehrungen der NSA, um dem Missbrauch der Überwachungssysteme vorzubauen. Nur in Ausnahmefällen bearbeitete dieselbe Person einen Vorgang zweimal, was dazu führte, dass niemand wusste, wen er eigentlich überwachte und warum. Wie Jungvögel, die von ihren Eltern Vorverdautes in den Schnabel bekamen. Manchmal Würmer, manchmal Körner, immer öfter die Plastikreste der Konsumgesellschaft. Letzteres machte die jungen Vögel krank, aber das wussten sie noch nicht, ebenso wenig wie ihre sorgenden Eltern. Satt machte die verbotene Frucht, über die langfristigen Folgen machten sich weder die Jungvögel noch die rangniederen Mitglieder der NSA Gedanken.
Kapitel 8
Kings County Civil Court
Brooklyn, New York
3. Dezember, 08:55 Uhr (zur gleichen Zeit)
Die Gegenseite wurde von Arby, Klein and Caufield vertreten, was ein schlechtes Zeichen war. Sie waren teuer, was hieß, dass hinter der Kündigung von Ana-Marias Mietvertrag handfeste wirtschaftliche Interessen steckten. Satte Gewinne, fette Beute aus dem Kauf eines Hauses, das heute noch am äußersten Rand der begehrten Wohnstraßen lag und schon bald mittendrin stehen würde im ganz großen Business der Gentrifizierung. Nach dem Plan ihrer Gegner wäre es dann aufs feinste renoviert, gläserne Fahrstühle wären eingebaut, und es würde The 499 Brooklyn Gardens heißen oder so ähnlich. Ana-Maria Guerro war die Letzte, die ihrem Namen alle Ehre machte und Widerstand leistete. Die 9600 Dollar auf die Hand abgelehnt hatte, obwohl sie nicht wusste, womit sie morgen ihre Tortillas füllen sollte. Weil sie seit über dreißig Jahren in dieser Wohnung lebte und es nicht einsah auszuziehen. Weil ihre Erinnerungen an jedem Quadratzentimeter der verblichenen Tapeten hingen und an jeder Fuge der knarzenden Dielen. Und weil es nicht recht war. Pia Lindt blickte hinüber zu der Vertreterin von Arby, Klein und Caufield. Erschienen war eine Senior Partnerin der Firma, die in ihrem dunkelgrünen Kostüm aussah wie ein kleiner Marine in Galauniform. Sie saß auf dem Stuhl hinter der Bank der Ankläger wie in einem Café am Columbus Circle und plauderte betont entspannt mit ihrem Auftraggeber, dem Mann, dessen Firma Ana-Maria entwohnen wollte. Pias Blick wanderte über Thibault Stein, der scheinbar in die Akte vertieft war, bis zu Ana-Maria, die nervös an ihren Nägeln herumknibbelte. In diesem Moment unterbrach sie die Ankunft des Richters. Der uralte Thibault Stein war als Erster auf den Beinen, gestützt auf seinen obligatorischen Gehstock, deutlich vor Pia und noch deutlicher vor den Vertretern der Anklage.
Als sie sich wieder setzten, beugte sich Thibault über Pia, die zwischen ihnen saß, zu Ana-Maria herüber und tätschelte ihr die Hand. Sie waren fast gleich alt. Die beiden hätten ein hübsches Pärchen abgegeben, fand Pia. Wenn auch ein sehr ungleiches.
Der Richter war ein schwerer schwarzer Mann in den Vierzigern. Da ihre Kanzlei ansonsten fast ausschließlich mit Strafprozessen beschäftigt war, kannten ihn weder Pia noch Stein persönlich. Sie hatte das dumpfe Gefühl, dass sich das bei der Senior Partnerin von Arby, Klein und Caufield anders verhielt.
»Dies ist die erste Anhörung. Ich gehe davon aus, dass Sie Ihre Mandanten aufgeklärt haben? Auch, was die Möglichkeit eines Vergleichs vor Gericht betrifft?«, fragte Richter Cole. Er gab Thibault und der Gegenseite seine Erwartungshaltung deutlich zu verstehen. Richter an Zivilgerichten bevorzugten unkomplizierte Einigungen gegenüber den langwierigen Prozessen, die ihre Wartelisten verstopften.
Thibault stand auf: »Natürlich, Euer Ehren.« Er stellte den Stock aus, Richter Coles Blick blieb für den Bruchteil einer Sekunde daran hängen. Pia Lindt goss Wasser aus einer Karaffe in ein Glas. Paragraf 7 der Steinschen Prozessordnung lautete: »Ein leeres Glas hemmt den Strafverteidiger.« Sie hatte dafür zu sorgen, dass Steins Glas stets halb gefüllt war. Es bedeutete nicht etwa, dass Stein besonders optimistisch auf die Welt sah. Ein halbvolles Glas bedeutete vielmehr, dass man daraus entweder trinken oder nachschenken konnte. Beides führte zu einer unterschiedlich langen Pause, bei der sich das Gericht auf das zuletzt Gesagte konzentrierte. Pausen waren Stein bei seinen Prozessen sehr wichtig. Und seine Prozessordnung war ihm heilig. Es war eine Sammlung von Regeln, die Steins Assistenten im Schlaf beherrschen mussten. Es war das erste Dokument, das man von Thibault überreicht bekam, wenn man es tatsächlich geschafft hatte. Wenn man den Posten bekommen hatte, über den auf den Fluren von Harvard, Yale und Stanford nur geflüstert wurde. Thibaults Kanzlei war klein, sie bestand aus niemandem als Thibault Godfrey Stein und Pia Lindt. Aber sie war so exklusiv, ihr Kundenkreis so ausgewählt und die Fälle der letzten zwanzig Jahre so aufsehenerregend, dass ihr unter den Studenten, denen es nicht um das ganz schnelle und das ganz große Geld ging, ein legendärer Ruf vorauseilte. Es hieß, wenn man es zwei Jahre bei Thibault Stein aushielt, könne man sich die nächste Kanzlei aussuchen und direkt als Senior Partner mit einem mittleren sechsstelligen Jahresgehalt einsteigen. Pia Lindt war seit knapp vier Jahren bei Stein und konnte sich nicht vorstellen, warum sie mit einer Senior Partnerin von Arby, Klein und Caufield tauschen sollte. Eben eine solche arbeitete sich in diesem Moment am Vortrag ihres Antrags ab.
»Euer Ehren, es handelt sich um zwei separate Vorgänge, von denen jeder einzelne meinen Mandanten zur sofortigen Zwangsräumung der Wohnung von Mrs. Guerro berechtigen würde. Sie finden die Vorgänge im Appendix E bis F unseres Antrags.«
Richter Cole blätterte, und die Anwältin wartete, bis er die Stelle gefunden hatte. Stein lächelte.
»Erstens: Bereits am 13. April letzten Jahres wurde Mrs. Guerro die Änderungskündigung ihres Mietvertrags für die Wohnung zweites OG Mitte links seitens des neuen Eigentümers, der Connolly Construction Company, übersendet. Der neue Mietvertrag wurde von Mrs. Guerro nicht unterschrieben, ihm wurde jedoch auch nicht formal widersprochen. Er gilt damit als angenommen zum 1. Juni letzten Jahres und darf seitdem als gültige Vereinbarung zwischen beiden Parteien angenommen werden. Zweitens: Die Änderung der für Mieter verbindlichen Hausordnung vom 22. Juli letzten Jahres betreffend das Halten von Haustieren. Ich zitiere: ›Aufgrund von Hygienemaßnahmen im Interesse aller Mieter unserer Objekte ist ab sofort das Halten von Haustieren jedweder Größe und jedweder Art untersagt.‹ Mit angenommener Wirksamkeit der geänderten Hausordnung und einer von meinem Mandanten freiwillig eingeräumten Übergangsfrist von zwei Monaten darf hiermit angenommen werden, dass spätestens mit dem 1. 11. letzten Jahres ein eklatanter, anhaltender Verstoß seitens Mrs. Guerro gegen die gültige Hausordnung vorliegt. Die ordentliche Kündigung des Mietverhältnisses zum 1. 12. ist damit als rechtsgültig anzusehen.«
Sie legte die ordentliche Kündigung überaus ordentlich auf den ordentlichen Aktenstapel, als schlösse sie eine Tür. Endgültig. Mustergültig. Widerspruch zwecklos.
Der Richter blickte zu Thibault Stein, der daraufhin einen Schluck Wasser trank. Pia goss nach.
»Wir beantragen daher die sofortige Räumung der Wohnung seitens der Mieterin zum nächstmöglichen Zeitpunkt«, sagte die ordentliche Senior Partnerin ordnungsgemäß.
Thibault Stein stand auf, noch bevor sich die Gegenseite gesetzt hatte. Er stellte sich mitten in den Gang vor die Richterbank und wartete. Eine Sekunde, zwei Sekunden. Dann sprach er leise, aber mit seiner kräftigen Gerichtsstimme, die Pia ihm wegen seiner kleinen Statur und seines Alters anfangs nicht zugetraut hätte. Es schien ihr jedes Mal, als ob seine Stimme vor der Richterbank anders klang als in einem persönlichen Gespräch.
»Euer Ehren, davon ausgehend, dass Ihre und unsere Zeit knapp bemessen ist, kann ich annehmen, dass Sie mir etwas Spielraum einräumen würden, wenn ich verspreche, dem Gericht eine Menge dieser kostbaren Zeit zu sparen?«
Der Richter blickte auf und nickte. Seine Gesichtszüge waren weicher, als Pia gedacht hatte. Eine gängige Taktik von Thibault, die es dem gegnerischen Anwalt schwermachte, Einspruch einzulegen, vor allem, wenn er unerfahren war.
»Hinsichtlich Ihrer Ausführungen, Miss …«
Thibault griff zum Glas. »… entschuldigen Sie bitte, aber ich habe Ihren Namen vergessen, es muss das Alter sein … bitte verzeihen Sie …«
»Bosworth. Sarah Bosworth«, sagte die Anwältin von Arby, Klein und Caufield.
»Bosworth, Bosworth«, murmelte Thibault Stein zu sich selbst, obwohl Pia genau wusste, was kommen würde. Sie hatte die Akte zusammengestellt. Paragraf 2 der Steinschen Prozessordnung lautete: »Kenne deinen Gegner besser als deinen Fall.«
»Ihr Vater war Timothy Bosworth«, rief er auf einmal, als wäre der Blitz in die alte Eiche geschlagen. Richmond and Bosworth war eine der angesehensten Adressen in Manhattan, ihr Vater einer der Gründer. Ungefähr jeder Jurist an der Ostküste wusste das. Wäre es nicht so clever, hätte man es für den peinlichen Aussetzer eines alten Mannes halten können. Sarah Bosworth blieb nichts anderes übrig, als zu nicken. Stein wusste, dass sie ehrgeizig war. Und dass sie es ganz sicher nicht nur durch die schützende Hand ihres Vaters zur Senior Partnerin bei Arby, Klein und Caufield gebracht hatte. Pia und Thibault Stein wussten das, aber der Rest im Saal wusste es nicht. Und was das Wichtigste war: Sarah Bosworth wusste es auch nicht. Da war ihr Selbstzweifel. Ihre Achillesferse.
»Grüßen Sie ihn von mir«, murmelte Thibault. »Aber zurück zu Ihren Ausführungen: Was die stillschweigende Übereinkunft zum neuen Mietvertrag angeht …«
Thibault beugte sich zu Pia herunter, und sie reichte ihm das Wasserglas. Er trank einen kleinen Schluck und nickte ihr dankbar zu.
»Geschenkt«, sagte er dann in Richtung des Richters.
Sarah Bosworth starrte zu ihnen herüber.
»Was verstehen Sie unter ›geschenkt‹?«, fragte die Anwältin mit scharfer Stimme. Sie wollte jetzt zeigen, was sie konnte. Es wäre nicht nötig gewesen. Aber es zahlte auf Thibaults Konto. Und damit auf Ana-Marias. Das war alles, was zählte.
»Verehrte Miss Bosworth, geschenkt heißt geschenkt. Wir wissen doch beide, wie das jetzt ablaufen wird: Ich sage Ihnen, dass sie keinen rechtlichen Beistand hatte, dann werden Sie ausführen, dass sie bei der Stadt New York jederzeit einen solchen hätte anfordern können. Dann debattieren wir zwei Tage über die Verfügbarkeit dieser Information, wir laden Zeugen der Stadtverwaltung und welche Veranstaltungen der Mieterschutzbund veranstaltet hat, dann bringen Sie einen Kalender bei und eine Menge Tabellen, und am Ende einigen wir uns darauf, dass sie es hätte wissen sollen, vielleicht sogar müssen, aber da sie es nicht wusste, einigen wir uns auf den 1. 12. Und schlussendlich, nach für uns alle kräftezehrenden Verhandlungen und drei überhöhten Rechnungen Ihrerseits an Ihren Mandanten, werden wir feststellen, dass dieser Mietvertrag heute seine Gültigkeit besitzt, oder etwa nicht? Das war doch eben erst der Grund, warum Sie diesen ganzen Schlamassel überhaupt eingereicht haben …«
Stake your claim. Nimm, was du kriegen kannst. Gericht ist Wildwest. Paragraf 6 der Steinschen Prozessordnung.
Sarah Bosworth konnte ihr Glück kaum fassen. Sie hatte soeben die Hälfte dieses Prozesses gewonnen, indem sie ein Eingangsstatement verlesen hatte. Sie starrte immer noch zu ihr herüber. Ganz so naiv war sie vielleicht doch nicht, dachte Pia.
Ana-Maria schluckte.
»Insofern«, schloss Stein, »geschenkt!«