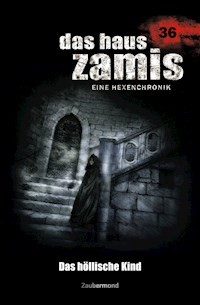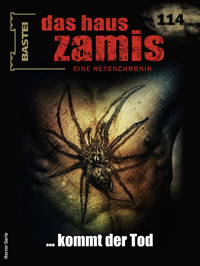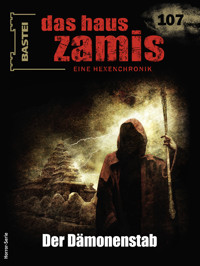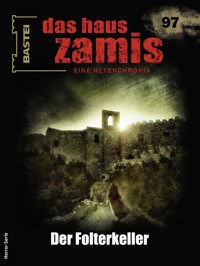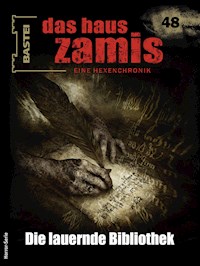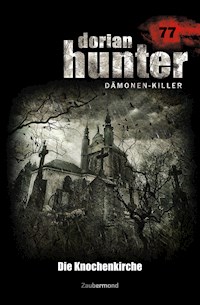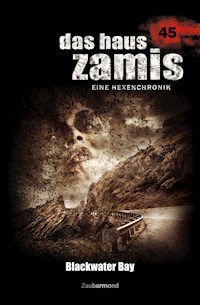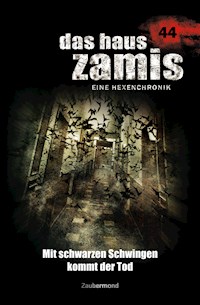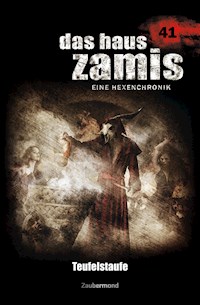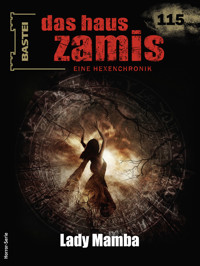
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Erstmals im Leben beschlich mich eine Ahnung davon, wie kranken Sterblichen im Patientenwartesaal zumute ist. Meine Freundin Rebecca und ich saßen schon eine gefühlte Ewigkeit in einer Wartezone der Klinik. Rebecca war die einzige Patientin, ich stand ihr zur Seite. Leichenblass, mit hohlen Wangen und entzündeten Augen, wirkte sie wie ein Karnevals-Vampir. Ihr war sterbenselend, und sie hatte Angst. Das Krankenhaus war eine Privatklinik für menschliche Patienten in der New Yorker Park Avenue und spezialisiert auf Neurochirurgie. Der Leiter, Professor Cathán Connor, war jedoch ein Dämon. Wie viele Arztpraxen oder Anwalts- und Wirtschaftskanzleien in Dämonenhand verfolgte die Klinik nicht nur finanzielle Interessen, sondern sie diente auch dazu, Kontrolle über einflussreiche Menschen zu erlangen. Alle Versuche, Rebecca mithilfe meiner Hexen-Heilkunst zu helfen, waren fehlgeschlagen. Daher hatte Darragh, unser zeitweiliger Verbündeter, der nach dem Tod des Grauen Mannes zum Oberhaupt des Morrigan-Clans aufgestiegen war, uns an den Professor verwiesen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 137
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Was bisher geschah
LADY MAMBA
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
mystery-press
Vorschau
Impressum
Coco Zamis ist das jüngste von insgesamt sieben Kindern der Eltern Michael und Thekla Zamis, die in einer Villa im mondänen Wiener Stadtteil Hietzing leben. Schon früh spürt Coco, dass dem Einfluss und der hohen gesellschaftlichen Stellung ihrer Familie ein dunkles Geheimnis zugrundeliegt.
Die Zamis sind Teil der Schwarzen Familie, eines Zusammenschlusses von Vampiren, Werwölfen, Ghoulen und anderen unheimlichen Geschöpfen, die zumeist in Tarngestalt unter den Menschen leben. Die grausamen Rituale der Dämonen verabscheuend, versucht Coco den Menschen, die in die Fänge der Schwarzen Familie geraten, zu helfen. Ihr Vater sieht mit Entsetzen, wie sie den Ruf der Zamis-Sippe zu ruinieren droht. So lernt sie während der Ausbildung auf dem Schloss ihres Patenonkels ihre erste große Liebe Rupert Schwinger kennen. Auf einem Sabbat soll Coco zur echten Hexe geweiht werden. Asmodi, das Oberhaupt der Schwarzen Familie der Dämonen, hält um Cocos Hand an, doch sie lehnt ab. Asmodi kocht vor Wut und verwandelt Rupert Schwinger in ein Ungeheuer.
In den folgenden Jahren lässt das Oberhaupt keine Gelegenheit aus, gegen die Zamis-Sippe zu intrigieren. So verlangt Asmodi von Coco, einen gewissen Dorian Hunter für ihn töten. Es gelingt Coco, Dorian zu becircen – doch anstatt den Auftrag sofort auszuführen, verliebt sie sich in ihn. Zur Strafe verwandelt Asmodi Dorian Hunter in einen seelenlosen Zombie, der fortan als Hüter des Hauses in der Villa Zamis sein Dasein fristet.
In Wien übernimmt Coco ein geheimnisvolles Café. Sie beschließt, es als neutralen Ort zu etablieren, in dem Menschen und Dämonen gleichermaßen einkehren. Zugleich stellt Coco fest, dass sie von Dorian Hunter schwanger ist. Coco, Michael und Toth bitten Asmodi um Hilfe gegen die Todesboten, müssen dafür jedoch das für sie jeweils Wertvollste als Pfand hinterlegen. So wird Coco ihr Ungeborenes genommen.
Mit Hilfe von Cocos Bruder Volkart gelingt es, die Todesboten zu besiegen. Doch Asmodi gibt den Fötus zunächst nicht wieder her. Mit Hilfe ihres neuen Liebhabers Damon Chacal gelingt es Coco schließlich, das Kind zu finden und es im Totenreich zu verstecken. Danach trennt sie sich wieder von Chacal, wird jedoch bald von Albträumen heimgesucht – als sie einen Anruf von ihrer Freundin Rebecca erhält. Diese lädt Coco nach New York ein ...
Doch die schwangere Rebecca steht unter dem Einfluss der dämonischen Vanderbuilds. Als Coco bei der Voodoo-Priesterin Mama Wédo um Hilfe ersucht, fährt diese in Rebecca ... Coco kann nicht verhindern, dass das Kind im Dakota Building zur Welt kommt. Es entpuppt sich als missgestalteter Dämon mit gewaltigen Kräften. Coco hilft Mama Wédo, die von ihr verhassten Vanderbuilds und das Dämonenkind zu töten. Dafür gibt Mama Wédo Rebeccas Körper wieder frei. Doch ein Teil von ihr steckt noch immer in Rebeccas Geist. Coco begleitet Rebecca nach New Orleans, weil sich Rebecca dort Hilfe von einer alten Wegbegleiterin erhofft ...
LADY MAMBA
von Rüdiger Silber
Erstmals im Leben beschlich mich eine Ahnung davon, wie kranken Sterblichen im Patientenwartesaal zumute ist. Meine Freundin Rebecca und ich saßen schon eine gefühlte Ewigkeit in einer Wartezone der Klinik. Rebecca war die einzige Patientin, ich stand ihr zur Seite. Leichenblass, mit hohlen Wangen und entzündeten Augen, wirkte sie wie ein Karnevals-Vampir. Ihr war sterbenselend, und sie hatte Angst.
Das Krankenhaus war eine Privatklinik für menschliche Patienten in der New Yorker Park Avenue und spezialisiert auf Neurochirurgie. Der Leiter, Professor Cathán Connor, war jedoch ein Dämon. Wie viele Arztpraxen oder Anwalts- und Wirtschaftskanzleien in Dämonenhand verfolgte die Klinik nicht nur finanzielle Interessen, sondern sie diente auch dazu, Kontrolle über einflussreiche Menschen zu erlangen.
Alle Versuche, Rebecca mithilfe meiner Hexen-Heilkunst zu helfen, waren fehlgeschlagen. Daher hatte Darragh, unser zeitweiliger Verbündeter, der nach dem Tod des Grauen Mannes zum Oberhaupt des Morrigan-Clans aufgestiegen war, uns an den Professor verwiesen.
1. Kapitel
Um die Untersuchungsergebnisse der Vampirin vor dem menschlichen Personal geheim zu halten, hatte er uns einen Termin außerhalb der normalen Sprechzeiten gewährt.
Endlich ging die Tür auf. Herein trat ein kleiner, dicker Mann im weißen Arztkittel. Kurzes graues Haar umkränzte sein Haupt, Oberlippe und Kinn zierte ein Bärtchen, auf der Nase saß eine rahmenlose Brille.
»Guten Tag, bitte entschuldigen Sie, dass Sie warten mussten.«
Wir erhoben uns, und Professor Connor gab Rebecca die Hand. »Sie müssen die Patientin sein.«
»Rebecca Manderley«, stellte sie sich vor.
»Coco Zamis, Krankenschwester auf Zeit«, sagte ich. Er reichte auch mir die Hand. Ich spürte nur eine geringe dämonische Ausstrahlung an ihm. Sie war so schwach, dass ich hätte raten müssen, welche Art von Dämon er war. Aber er war sicher ein hervorragender Arzt, sonst hätten die oberen Zehntausend von New York ihn nicht an ihr Gehirn gelassen.
Wir folgten ihm in sein Büro. Er wies uns bequeme Besucherstühle an und ließ sich selbst hinter dem Schreibtisch nieder, dessen Arbeitsfläche genug Platz bot, um darauf die Präsidentenlimousine zu parken. Die Einrichtung des Büros war ganz auf den Effekt abgestimmt. Alles wirkte leicht überdimensioniert, als Zeichen der Macht. Verglaste Bücherschränke aus dunklem Mahagoni voller ledergebundener Bände erweckten den Eindruck von Gelehrsamkeit. Die Kunstwerke an den Wänden waren modern, aber gefällig und unpersönlich. Es gab gerade genügend anatomische Modelle und Tafeln, um den Eindruck von Fachkenntnis zu erwecken und doch empfindliche Besucher nicht zu grausen. Den Anschluss an die Neuzeit vermittelte die Schreibtischausstattung mit modernster Computer- und Kommunikationstechnik.
Professor Connor legte die Hände ineinander. »Wie kann ich Ihnen helfen, Mrs Manderley?«
»Ich ...« Rebecca sah mich Hilfe suchend an.
Also übernahm ich das Reden.
»Begonnen hat es mit starken Kopfschmerzen ... Das ist jetzt etwa zwei Wochen her. Dann ...«
»Es ist, als würde ich ein Kopfei ausbilden«, ergänzte Rebecca leise, »das wächst und wächst und mir irgendwann die Schädeldecke sprengt.«
Ich fuhr fort: »Dann kamen Albträume hinzu und eine Geräuschempfindlichkeit gegen bestimmte Musikinstrumente. Der Ton einer Trompete oder eines Saxofons verursacht meiner Freundin furchtbare Qual.«
»Früher mochte ich den Klang solcher Instrumente«, flüsterte Rebecca. »Aber jetzt ist es, als würde mir flüssiges Metall ins Ohr geschüttet und zerfräße mir das Gehirn.«
»Sie schläft nicht mehr, isst nicht mehr. Sie wird immer schwächer.«
Der Professor nickte verstehend. »Wie steht es mit der Koordination? Haben Sie Bewegungsstörungen?«
Rebecca schüttelte den Kopf.
»Sehstörungen?«
»Nicht dass ich wüsste.«
»Olfaktorische Halluzinationen?«
»Wie bitte?«
»Ich meine: Nehmen Sie sonderbare Gerüche wahr? Gerüche, die eigentlich nicht da sind?«
Rebecca sah mich an. Ich schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte sie.
Connor erhob sich, kam um den Schreibtisch herum und bezog vor Rebecca Aufstellung. Er zückte eine Diagnostiklampe, die zwischen den Kugelschreibern an der Brusttasche seines Kittels klemmte. Nacheinander leuchtete er in beide Pupillen. Er führte einige Koordinationstests durch, wie man sie auch bei Verdacht auf Trunkenheit macht, und prüfte die Kraft der einzelnen Muskelgruppen.
Anschließend geleitete er uns in die radiologische Abteilung, um ein Magnetresonanztomogramm anzufertigen. Rebecca musste sich auf der fahrbaren Liege des Tomographen ausstrecken. Connor legte Rebecca einen intravenösen Zugang. »Für das Kontrastmittel«, sagte er. »Manche Sterbliche sind allergisch dagegen. Wie es auf Vampire wirkt, weiß ich nicht. Es wird einen Vampir nicht umbringen, aber zur Sicherheit spritze ich Ihnen zunächst eine geringe Testdosis.«
Eine halbe Stunde verstrich. Da keine Nebenwirkungen auftraten, ließ Connor die Patientin auf der Liege in die enge MRT-Röhre gleiten.
Eine Sekunde lang hatte ich die Vision, meine Freundin würde ins Leichenkühlfach geschoben. Ich schüttelte die Vorstellung ab. Zum Glück litt Rebecca, wenn sie auch keine Sargschläferin war, nicht unter Klaustrophobie.
Ich hatte Connor nicht alles über Rebeccas Symptome erzählt. Verschwiegen hatte ich ihm, dass Rebeccas ›Albträume‹ in manchem den Vergangenheitsvisionen glichen, die ich selbst von Asabi, der Voodooienne in Diensten der älteren Vanderbuilds gehabt hatte.
Sie waren wie Erinnerungsblitze aus dem Leben Asabis. Andere Traumfetzen schienen aus Asabis späterem Leben zu stammen, nachdem sie zu Mama Wédo geworden war. Mama Wédo hatte vorübergehend mit Rebecca den Körper getauscht gehabt. Beim Rücktausch war Mama Wédo gestorben. Aber Rebecca und ich glaubten, dass irgendetwas von der alten Voodoo-Zauberin zurückgeblieben war in Rebecca ... in ihrem Schädel.
Aber das brauchte Professor Connor nicht zu wissen. Wir waren nur an seiner schulmedizinischen Meinung interessiert.
Nach einer Stunde saßen wir wieder zu dritt im Chefarztbüro.
Connor drehte den Bildschirm mit den MRT-Aufnahmen, sodass Rebecca und ich sie ebenfalls vor Augen hatten. Es waren Querschnitte ihres Gehirns, von ›unten‹ gesehen, wie Connor uns informierte. Für mich sahen die fast spiegelbildlichen Hirnhälften aus wie schwarz-graue Rorschachbilder. Mittendrin breitete sich eine erschreckend große »Raumforderung« aus, wie Connor es nannte. Für mein Laienauge wirkte sie wie ein annähernd rundes, unscharf abgegrenztes Nebelfeld.
Ich hörte, wie Rebecca scharf die Luft einsog.
»Was ist das?«, fragte ich.
»Ich weiß es nicht«, bekannte Connor. »So etwas habe ich noch nie gesehen. Man würde es für ein Artefakt, eine Fehldarstellung, halten, aber das habe ich bereits ausgeschlossen. Offenbar handelt es sich um etwas, das das MRT nicht darstellen kann. Um etwas Unbekanntes.«
Hinter den Brillengläsern strahlten die Augen des Professors. Ich las Entsetzen in seinem Blick. Aber noch mehr Faszination.
»Ist es ein Tumor?«, fragte Rebecca.
»Von der Lage her könnte es ein Tumor sein«, erklärte Connor. »Es würde zu den Symptomen passen, die Sie geschildert haben. Aber ich habe noch nie einen Tumor gesehen, der so aussieht. Außerdem ist das ... Ding zu groß, für einen Tumor ist es riesig. Ein Sterblicher mit einem solchen Tumor wäre auf die vegetativen Nervenfunktionen beschränkt oder tot. Er würde nicht vor mir sitzen und mit mir sprechen.«
»Ist es therapierbar?«, fragte ich.
»Das kann ich nicht sagen, solange ich nicht weiß, was es ist. Wir müssten eine Gewebeprobe entnehmen. Oder besser noch, gleich den Schädel öffnen und hineinsehen.«
Gierig, wie er Rebecca abschätzte, nahm er in Gedanken bereits die Knochensäge zur Hand.
Ich erhob mich. »Vielen Dank, Herr Professor Connor, für Ihre Hilfe. Wir werden uns darüber beraten.« Ich fasste Rebecca am Arm, und wir traten die Flucht aus der Klinik an.
Auf dem Bürgersteig musste ich langsam gehen, damit Rebecca mit mir Schritt halten konnte. Sie sagte: »Mit dem Ding im Gehirn kann ich unmöglich nach Kalifornien reisen.«
Das war unser Plan gewesen.
Rebecca hatte in Erfahrung gebracht, dass sie nicht der letzte Vampir ihrer Sippe war, wie sie ein Leben lang geglaubt hatte. Eine direkte Tante von ihr lebte an der Westküste, im Sonnenstaat Kalifornien. Rebecca hatte der Tante einen Besuch angekündigt, mit mir als Reisegefährtin. Wir hatten vorgehabt, in New York einen offenen Sportwagen zu mieten und einen mehrwöchigen Roadtrip durch die USA nach Blackwater Bay zu unternehmen, dem Wohnort Tante Elviras.
»Ich möchte nach New Orleans«, hörte ich Rebecca sagen. »Immerhin liegt das in Louisiana, also auf dem Weg nach Kalifornien.«
»Nach New Orleans?«, wunderte ich mich. »Du hast eine Allergie gegen Blasinstrumente ... und dann willst du ausgerechnet nach New Orleans?«
Sie nickte nachdrücklich. »Du hast gehört, was Connor gesagt hat. Er kann mir nicht helfen. Ich habe kein medizinisches Problem. Ich habe ein Voodoo-Problem. Nur Voodoo kann mir helfen.«
Darin waren sie und ich einer Meinung. Aber warum musste es New Orleans sein? »Voodoo wird auch hier in New York praktiziert«, sagte ich. »Und in Los Angeles. Und in Chicago. Die Heimat des Voodoo ist Haiti.«
»Kennst du einen Voodoo-Heiler in New York, in Los Angeles, in Chicago? Oder auf Haiti?«
»Nein«, gab ich zu.
»Aber ich habe Verbindungen nach New Orleans«, sagte Rebecca. »Keine Voodooisten«, schränkte sie ein. »Vampire.«
»Noch mehr unbekannte Verwandtschaft?«
»Diese Vampire gehören keiner Sippe an«, erklärte sie. »Sie bilden eher eine Art ... Kommune.«
»Hippie-Vampire?«
»Die Vampire dieser Gemeinschaft kommen von überall her. Was sie verbindet, ist nicht die Sippschaft. Sie sind nicht so wie die meisten Vampire. Sie sind eher ... wie ich.«
Ich ahnte etwas.
»Diese Vampire töten nur Mörder, um sich zu ernähren. Einige trinken sogar nur das Blut von Tieren. Ich habe vor einigen Jahren von ihnen erfahren und habe Kontakt zu ihnen aufgenommen. Und ihn zum Glück nie abreißen lassen.«
»Also Hippie-Vampire!«
»Wenn du so willst. Sie würden mir helfen, da bin ich sicher. Bestimmt kennen sie auch Voodoo-Leute in ihrer Stadt.«
Wir legten etliche Meter in nachdenklichem Schweigen zurück.
»Ich bin auf schnelle Hilfe angewiesen«, nahm schließlich Rebecca den Faden wieder auf. »Das Ding im Kopf lässt mir nicht mehr viel Zeit, ich spüre es deutlich. Wir müssen das Flugzeug nehmen.«
»Und deine Fledermaus-Staffel?«
»Die muss nachkommen. Anders geht es nicht.« Offenbar hatte sich Rebecca bereits Gedanken gemacht, denn sie fuhr fort: »Nach der Schlacht ums Dakota sind ohnehin nur noch neun von ihnen übrig. Wir könnten sie einzeln in Kisten einschließen und mit einer Spedition nachschicken.« Sie hob ratlos die Schultern. »Bis zu ihrer Ankunft muss ich eben ohne sie auskommen.«
New Orleans, Vieux Carré
Die Zeiger meiner Armbanduhr standen auf 11 Uhr 30. Schon im Flugzeug hatte ich sie eine Stunde zurückgedreht, von New Yorker auf New Orleanser Zeit.
Ich trat auf den Balkon hinaus. Unser Hotel lag in der Burgundy Street. Wir hatten ein Doppelzimmer bezogen.
Noch herrschte nicht die Hitze, die New Orleans ab Ende März in ein Treibhaus verwandelt, aber meine Kleidung war sehr viel luftiger als noch vor etlichen Stunden in New York. Eine laue Mississippi-Brise zupfte an meiner Bluse. Sie trug den Geruch von Zypressen und Flusswasser mit sich.
Die Straße war gesäumt von den typischen zwei- oder dreistöckigen Häusern im spanischen Kolonialstil, welche die Architektur des Vieux Carré bestimmten. Sie hatten flache Dächer und Arkadengänge und verschnörkelte gusseiserne Balkongeländer, die um die oberen Etagen verliefen wie Spitzenborten. Ich sah etliche Gebäude, die noch aus dem 19. Jahrhundert stammten, und einige aus dem 18. Jahrhundert.
Hier in der legendären französischen Altstadt Unterkunft zu nehmen, war meine Idee gewesen, nachdem ich mir schon in einem Buchladen am New Yorker Flughafen einen schmalen Reiseführer für New Orleans gekauft hatte. Ein minimales touristisches Programm war Pflicht, fand ich, wenn es mich schon einmal ins Big Easy verschlug, den Großen Leichtsinn, wie diese berühmte Stadt auch genannt wurde.
Auf einem der Balkone schmetterte eine Trompete. Von den Docks schrillte das Pfeifen der Flussboote herüber.
Aus Rücksicht auf Rebecca trat ich ins Zimmer zurück. Ich verschloss die Balkontür und zog die Vorhänge zu. Außerdem bewirkte ich einen magischen Schallschutz.
Das Zimmer war eng, aber hoch, und der Balkon der nächsten Etage spendete Schatten. Der Ventilator an der Decke wirkte überdimensioniert. Die vier riesigen Flügel standen still, ließen aber erahnen, wie heiß es hier werden konnte. In den Winkeln hing der Geruch von Kakerlakenpulver. Die fingerlangen Cockroaches waren hier eine noch schlimmere Plage als an der Ostküste, in New York.
Rebecca lag angezogen auf ihrer Hälfte des Doppelbettes. Sie schlief den Schlummer der Entkräftung. Blass war die Vampirin sowieso, aber jetzt wirkte ihr Gesicht schmal und kantig, wie eine expressive Schnitzmaske. Die eingesunkenen Augen verbargen sich hinter Strähnen des nachtschwarzen, stumpf gewordenen Haars wie hinter dem Gewebe eines Schleiers.
Von allem anderen abgesehen hatte Rebecca schon länger keine Nahrung mehr zu sich genommen. Wäre sie nur zu schwach zum Jagen gewesen, hätte ich schon eine Mahlzeit für sie herbeigeschafft. Doch in ihrem Elend verweigerte Rebecca die Nahrung.
Mir hingegen knurrte der Magen. In dem Reiseführer hatte ich ein Restaurant gefunden, in dem ich gerne speisen wollte. Anstatt Rebecca zu wecken, schrieb ich ihr eine Notiz.
Das Lokal lag in der Touristenmeile von New Orleans, in der Bourbon Street. Da ich etwas vom Vieux Carré sehen wollte, ging ich zu Fuß. Ich musste nur wenige Blocks weit laufen, vorbei an Galerien und Antiquitätengeschäften, von denen es hier jede Menge gab. Aus der St. Ann Street, offenbar ein Treffpunkt der Schwulenszene, schwenkte ich in die Bourbon Street ein. Hier reihten sich Andenkenläden, Fresslokale aller Art und vor allem Bars und Strip-Clubs, die aber erst abends aufmachten. Auf dem »Bankett«, wie der Bürgersteig in New Orleans hieß, reihten sich altmodische Straßenlaternen mit gusseisernen Pfählen. Sie rahmten ein paar bunte Straßenhändler ein sowie Musikanten, deren Banjogeschrappe, Saxofongetute und schrille Trompeten Rebecca in den Irrsinn getrieben hätten. Vorherrschend war der Geruch nach abgestandenem Bier, Whiskey und Marihuana.
Vor dem Schaufenster von Marie Laveau's Voodoo Shop blieb ich stehen und betrachtete die Auslage. Es war eher ein Souvenirladen. Etliche Artikel waren aus Plastik. Das meiste stammte aus industrieller Fertigung. Am besten gefielen mir noch die bedruckten T-Shirts.
Endlich erreichte ich das Galatoire's. Das Speisehaus hatte ich nicht wegen seiner als vorzüglich gepriesenen Küche gewählt. Sondern weil das Lokal keine Reservierungen entgegennahm und jeder Gast Schlange stehen musste, bis er hineinkam. Genau darin lag für mich der Reiz. Beschwingt schritt ich an der Warteschlange vorbei, drängte mich durch den Eingang und verlangte, den