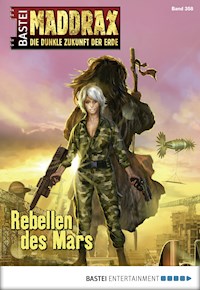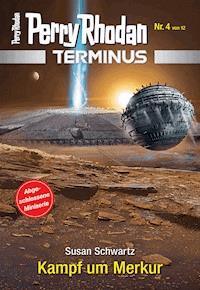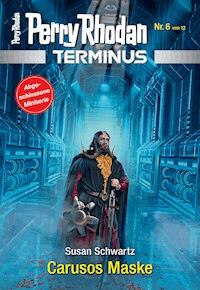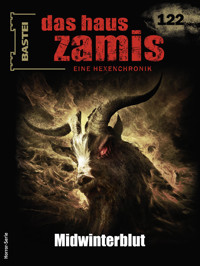
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Plötzlich sah ich einen Schatten vorbeisausen, und gleich darauf war ich im freien Fall, aber nur sehr kurz, und landete auf dem ¬Rücken. Ich schlug mir dabei den Hinterkopf an und sah Sterne. Unfähig, mich zu bewegen, erkannte ich den Blutbaron, der sich mit aller Kraft auf Caedes stürzte. Er trug ein langes Schwert bei sich, das er tief in den dämonischen Leib des Assassinen trieb. Caedes jaulte auf und taumelte zurück, riss dabei das Schwert aus den Händen des Barons, umklammerte es mit seinen Krallenhänden. Zog es in einer ungeheuren Kraftanstrengung aus seinem geschundenen Leib und ließ die blutige Klinge zu Boden fallen. Einen Moment lang verharrte er vor dem Fenster und musterte den Blutbaron aus lodernden Augen, die Zähne gebleckt, blutige Blasen schnaubend und tief knurrend ... Lydia steht immer noch unter dem Bann, der sie auf magische Weise altern lässt. Es scheint, als könnte ihr nur ein berüchtiger Dämon helfen - der Blutbaron!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Was bisher geschah
MIDWINTERBLUT
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
mystery-press
Vorschau
Impressum
Coco Zamis ist das jüngste von insgesamt sieben Kindern der Eltern Michael und Thekla Zamis, die in einer Villa im mondänen Wiener Stadtteil Hietzing leben. Schon früh spürt Coco, dass dem Einfluss und der hohen gesellschaftlichen Stellung ihrer Familie ein dunkles Geheimnis zugrundeliegt.
Die Zamis sind Teil der Schwarzen Familie, eines Zusammenschlusses von Vampiren, Werwölfen, Ghoulen und anderen unheimlichen Geschöpfen, die zumeist in Tarngestalt unter den Menschen leben. Die grausamen Rituale der Dämonen verabscheuend, versucht Coco den Menschen, die in die Fänge der Schwarzen Familie geraten, zu helfen. Ihr Vater sieht mit Entsetzen, wie sie den Ruf der Zamis-Sippe zu ruinieren droht. So lernt sie während der Ausbildung auf dem Schloss ihres Patenonkels ihre erste große Liebe Rupert Schwinger kennen. Auf einem Sabbat soll Coco zur echten Hexe geweiht werden. Asmodi, das Oberhaupt der Schwarzen Familie der Dämonen, hält um Cocos Hand an, doch sie lehnt ab. Asmodi kocht vor Wut und verwandelt Rupert Schwinger in ein Ungeheuer.
In den folgenden Jahren lässt das Oberhaupt keine Gelegenheit aus, gegen die Zamis-Sippe zu intrigieren. So verlangt Asmodi von Coco, einen gewissen Dorian Hunter für ihn töten. Es gelingt Coco, Dorian zu becircen – doch anstatt den Auftrag sofort auszuführen, verliebt sie sich in ihn. Zur Strafe verwandelt Asmodi Dorian Hunter in einen seelenlosen Zombie, der fortan als Hüter des Hauses in der Villa Zamis sein Dasein fristet.
In Wien übernimmt Coco ein geheimnisvolles Café. Sie beschließt, es als neutralen Ort zu etablieren, in dem Menschen und Dämonen gleichermaßen einkehren. Zugleich stellt Coco fest, dass sie von Dorian Hunter schwanger ist. Coco, Michael und Toth bitten Asmodi um Hilfe gegen die Todesboten, müssen dafür jedoch das für sie jeweils Wertvollste als Pfand hinterlegen. So wird Coco ihr Ungeborenes genommen.
Mit Hilfe ihres neuen Liebhabers Damon Chacal gelingt es Coco schließlich, das Kind zu finden und es im Totenreich zu verstecken. Danach trennt sie sich wieder von Chacal und folgt einer Einladung ihrer Freundin Rebecca nach New York ... Doch die schwangere Rebecca steht unter dem Einfluss der dämonischen Vanderbuilds. Coco kann nicht verhindern, dass das Kind im Dakota Building zur Welt kommt. Es entpuppt sich als missgestalteter Dämon mit gewaltigen Kräften. Coco kann das Dämonenkind jedoch töten.
Unterdessen erscheint in Wien eine junge Frau, die sich als Dorian Hunters Schwester Irene ausgibt. Im Café Zamis hinterlässt sie eine seltsame Uhr. Zurück in Wien spürt Coco deren gefährlichen Einfluss: Sie und die anderen Zamis werden immer jünger. Dahinter steckt die Hexe Mother Goose. Als ihr Haus in Flammen aufgeht, erlischt der Fluch. Außer bei Lydia, die zusehends altert. Thekla bittet Coco, Lydia zu einem Dämon zu begleiten, der ihrer Schwester helfen könnte: Baron Delaville! Coco ahnt jedoch nicht, dass ihnen der Blutdämon Caedes auf den Fersen ist ...
MIDWINTERBLUT
von Susan Schwartz
»Monsieur, wir können bald nicht mehr weiter, die Pferde gehen mir noch zuschanden!«, rief der Kutscher vom Bock herunter. Er saß dick in Pelze gehüllt und mit einer Kappe auf dem Kopf im Freien, Wind und Wetter ausgesetzt, genau wie die Pferde, auf deren Rücken bereits eine geschlossene mehrere Zentimeter hohe Schneedecke lag.
Die Reisenden in der Kutsche hatten zwar ein Dach über dem Kopf, aber ansonsten erging es ihnen kaum besser. Es war zugig, und die Kälte drang durch alle Ritzen herein. Die sechzehnjährige Marie und die zehnjährige Jeanne hatten schon blaue Nasenspitzen, obwohl sie sich dicht aneinanderdrängten und versuchten, sich gegenseitig zu wärmen. Auch Sophies Gesicht sah durchgefroren aus. Der Schneefall, der mittags eingesetzt hatte, war immer stärker geworden, und das Vorankommen wurde zusehends schwieriger. Die Straße war kaum mehr erkennbar, die Spuren der Fuhrwerke, die vor ihnen unterwegs gewesen waren, waren nur noch schmale Rinnen, die bald zugeweht sein würden. Die hereinbrechende Dunkelheit bereitete zusätzlich Probleme.
1. Kapitel
Da kam die Ortschaft, die sie soeben erreichten, gerade recht. Die Kutsche rumpelte in eine mäßig erleuchtete kleine Stadt hinein und hielt auf das Zentrum zu, wo es zumeist nicht nur eine Kirche, sondern auch ein Gasthaus mit Übernachtung für Reisende gab.
»Lasst uns hier Station machen«, sagte Jean Fortrand zu seiner Frau und den beiden Töchtern, als sich die Annahme bezüglich des Gasthauses als Tatsache herausstellte. Auf den Straßen war niemand unterwegs, aber das große Gebäude mit den angeschlossenen Stallungen war erleuchtet, und aus den Fenstern fiel verlockend warmer Schein auf den zugeschneiten Gehweg.
Jean Fortrand klopfte mit dem Gehstock gegen die Decke, schob das Seitenfenster nach unten und streckte den Kopf hinaus. Für einen Moment verschlug es ihm den Atem, als der eisige Wind sein ungeschütztes Gesicht traf und Eiskörner wie Hagel gegen seine Haut prasselten.
»Wir werden in dem Gasthaus übernachten, Kutscher! Dort findet sich bestimmt auch ein Platz für Pferde und Kutsche.«
»Dazu kann ich nur raten, Monsieur! Aber wenn wir morgen früh nicht weiterreisen können, weil es immer noch schneit, müssen Sie einen Zuschlag zahlen.«
»Ja, das ist mir durchaus bewusst. Keine Sorge, Sie werden angemessen entlohnt.«
»Ich habe Ihnen ja gesagt, dass niemand zu dieser Zeit übers Land fährt, und mittlerweile bereue ich, dass ich mich dazu habe überreden lassen.«
»Das Wetter wird nicht ewig so schlecht sein, und dann können wir bald weiter. Ich übernehme Kost und Logis, also sollten Sie zufrieden sein, guter Mann, denn sonst würden Sie zu dieser Zeit gar nichts verdienen.«
Die Kutsche hielt an, der Kutscher sprang ab, schüttelte den Schnee aus seiner Kleidung und öffnete den Verschlag. »Ich kümmere mich um das Gepäck und den Rest, dennoch würde ich um einen Vorschuss bitten, Monsieur, denn ich habe schon die schlechtesten Erfahrungen gemacht.«
Fortrand verzog keine Miene. Er war immer noch auf den Kutscher angewiesen, wollte er sein Ziel noch vor Weihnachten erreichen. Umso mehr, da sie sich offenbar verirrt hatten und er nicht wusste, wo in der nördlichen Bretagne sie sich befanden; dort, an der Grenze zur Normandie, mit verwischenden Übergängen, gab es viele verlassene Gegenden. Mit ruhiger Geste drückte er dem Kutscher die Kosten für den zurückgelegten Weg und die zu erwartenden Auslagen für Übernachtung, Essen und die Versorgung der Pferde in die Hand.
Dann half er seiner Frau und den Mädchen aus der Kutsche, und sie betraten das Gasthaus.
Die Frauen gingen sofort weiter in die große Stube, wo ein Feuer im Kamin brannte, um sich aufzuwärmen. Fortrand diskutierte eine Weile mit dem Wirt und bekam schließlich das Zimmer zum angemessenen Preis. Er winkte dem Kutscher, der gerade mit dem Gepäck hereinkam, und wies ihn an, wohin er es bringen solle. Dann beeilte auch er sich, in die Stube zu kommen. Eine Schale kräftiger Eintopf und ein heißer Würzwein waren ihm gerade recht.
Erstaunlicherweise war der große Raum sehr voll. Lange Tische und Bänke in mehreren Reihen, am anderen Ende der große Kamin mit dem prasselnden Feuer. Schankknechte eilten zwischen den Tischen herum, trugen ab und auf. Sophie winkte ihm, und er ging zu ihnen; sie hatte mit den Töchtern einen kleinen Tisch an einem Fenster bezogen.
Die Menschen stammten wohl alle aus der Umgebung, denn sie starrten die Fremden unverhohlen an.
»Bon soir«, sagte Fortrand freundlich und nickte in die Runde. »Sehr freundlich, dass wir über Nacht bleiben können, dort draußen ist ja das reinste Unwetter.« Er legte den Mantel auf die Bank und setzte sich.
Sophie hatte wohl schon bestellt, denn ein Schankdiener brachte heißen Würzwein für die Eltern und Tee für die Mädchen, dazu Brot, Speck und Eintopf.
Die Menschen rings um sie schwiegen immer noch. Sophie blickte beunruhigt um sich. »Das ist ein wenig unheimlich hier, findest du nicht?«, flüsterte sie ihrem Mann zu.
»Wie es am Land eben so ist, typische Kleinstadt«, gab er gut gelaunt zurück. Er saß im Trockenen und Warmen, hatte zu essen und zu trinken, was wollte er mehr?
Er sah auf, als der Kutscher hereinkam und sich an einen Tisch setzte, der für das Gesinde reserviert war. Das war zwar so üblich, aber offenbar kannte er das Gasthaus hier schon, weil er so zielstrebig dorthin gegangen war. Ein wenig verwundert war Fortrand schon, da sie sich doch angeblich verirrt und dieses Städtchen nur durch Glück erreicht hatten. Andererseits, umso besser, dann würden sie morgen desto schneller auf die normale Route zurückfinden.
Sie aßen und tranken, ohne auf die Umgebung zu achten. Endlich wurden die Unterhaltungen wieder fortgeführt.
Nach einer Weile setzte sich jemand, ohne höflich zu fragen, an ihren Tisch. »Jacques Bonnair, zu Diensten«, stellte er sich vor. »Sie müssen die Leute entschuldigen, aber zu dieser Jahreszeit haben wir sonst nie Gäste.«
»Ja, ich weiß, bei dem Wetter jagt man keinen Hund vors Haus. Aber als wir losgefahren sind, war bestes Wetter, und es gibt einen guten Grund für unsere Reise.« Jean stellte nun sich und seine Familie vor und lächelte freundlich, wie es seine Art war.
»Ich wundere mich, wie Sie auf diese abgelegene Straße gekommen sind«, fuhr Bonnair fort. »Selbst im Sommer verirrt sich nur selten jemand hierher. Sind Sie der Gegend kundig?«
»Ganz und gar nicht, im Gegenteil. Alles, was ich weiß, ist, dass es recht karg ist und dennoch einen großen Schatz birgt.«
Jean entging nicht, dass sich bei der Erwähnung des Wortes mehrere Männer zu ihm umdrehten. Und auch Bonnair hob die Augenbrauen.
»Ja! Calvados! Von Ihren wunderbaren Apfelbäumen!«, Jean strahlte über seinen Scherz.
Die Menschen beruhigten sich wieder, lachten sogar kurz und wandten sich wieder ihren Gläsern zu.
»Gewiss, da haben Sie recht.« Bonnair lächelte jetzt ebenfalls. »Dafür sind wir bekannt. Durch die Brennerei gelangen wir auch zu bescheidenem Wohlstand. Es gibt Arbeit und Auskommen für alle. Dennoch schätzen wir sehr unsere Abgeschiedenheit, wir sind da ganz traditionell. Veränderungen mögen wir nicht sehr.«
»Oh! Wir werden Sie nicht lange belästigen, schon morgen geht die Reise weiter.«
»Nun, dann will ich Sie auch nicht aufhalten, Sie sind sicher müde und werden bald zu Bett gehen.« Das klang schon fast wie eine Aufforderung.
Sophie beugte sich über den Tisch, nachdem Bonnair gegangen war. »Jean, hier stimmt doch etwas nicht! Die Leute sind sehr merkwürdig! Und wenn man bedenkt, wie schäbig diese Stadt von außen aussieht ... das passt einfach nicht zusammen.« Sie stand auf. »Lass uns zu Bett gehen, ich bin sehr müde«, sagte sie lauter. »Kommt, Mädchen.«
Jean trank hastig aus und folgte ihnen nach oben. Das Zimmer war gerade erst eingeheizt worden und entsprechend kalt; das Wasser in der Schüssel mit einer Eisschicht überzogen. Ohne sich lang auszuziehen, kuschelten sie sich, die beiden Mädchen in der Mitte, alle ins Bett und zogen die Decken über sich.
»Aber was sollte denn nicht stimmen?«, fragte Jean in die Dunkelheit hinein. »Was passt deiner Ansicht nach nicht zusammen?«
»Diese Leute sehen viel zu ... wie soll ich es sagen ... wohlhabend aus? Viele tragen Goldschmuck. Wo haben sie den her? Mit Calvados allein kann man das nicht erreichen, erst recht nicht die Bauern, deren Eheringe klotziger sind als unsere. Und wir sind aus Paris und haben ein gut gehendes Geschäft!«
»Mag sein. Doch wir sollten uns nicht zu viele Gedanken machen. Morgen können wir sicher weiterfahren, und dann verschwinden wir aus diesem unangenehmen Ort. Lass uns deshalb jetzt schlafen.«
»Mir hat nicht gefallen, wie sie unsere Kinder angestarrt haben. Mit so einem komischen ... gierigen Glitzern.«
»Das bildest du dir nur ein, Sophie, weil du deine hübschen Mädchen überbehütest. Aber nicht alle Menschen sind Bestien.«
Darin jedoch täuschte er sich.
Mitten in der Nacht, während sie tief schlummerten, wurden sie aus dem Bett gerissen. Bevor Jean irgendetwas unternehmen konnte, wurden ihm die Hände auf den Rücken gefesselt und die Augen verbunden. Als er protestierte, bekam er einen Knebel in den Mund gestopft.
Er hörte seine Kinder schreien, dann erhielt er einen Schlag auf den Kopf und wusste nichts mehr.
Die beiden Schwestern saßen zusammengekauert in der Kuhle. Die Wände waren so steil, dass sie, noch dazu bei all dem Schnee, nicht von allein nach oben klettern konnten. Deswegen waren sie auch nicht gefesselt worden. Sie hatten nur zwei Wolldecken gegen die Kälte bekommen und zitterten heftig.
Noch immer fiel der Schnee in dicken, weichen Flocken herab; wenigstens war es durch die weiße Pracht nicht ganz dunkel.
»Marie, ich hab Angst ...«, stieß Jeanne zähneklappernd hervor.
»Du musst keine Angst haben, Maman und Papa kommen bestimmt ganz schnell und holen uns hier raus.«
»Glaubst du da wirklich dran?«
»Sei still, lass den Mund zu, sonst bekommst du Schwindsucht.«
Die Männer hatten nicht mit ihnen geredet. Sie hatten sie hierhergebracht und gezwungen, an einem um den Leib geschlungenen Seil hinunterzusteigen. Dann mussten sie das Seil lösen, und es wurde wieder hochgezogen. Der Schnee hatte alle Spuren schnell verwischt, und sie waren allein zurückgelassen worden, ohne begreifen zu können, was mit ihnen geschah.
Marie zog Jeanne fest in ihre Arme. Sie zerbrach sich vergeblich den Kopf, was die Männer mit ihnen vorhatten. Es kam ihr so vor, als wären sie beide ... ja, wie ein Köder ausgelegt worden. Aber für wen? Fing man so Wölfe? Das machte man doch normalerweise mit Ziegen. Vielleicht hatten sie aber keine mehr und wollten nicht ihre eigenen Kinder opfern?
»Marie ...«, wimmerte Jeanne verzweifelt, als das tiefe Grollen erklang.
Marie erspähte durch die Dunkelheit ein rotes Glühen oben auf der Kante des Kessels, in dem sie mit ihrer Schwester gefangen saß. Mächtige weiße Reißzähne, von denen herab Speichel troff. Mehr war nicht zu erkennen, aber das genügte schon. Sie waren der Köder.
Das Grollen erklang lauter.
»Was ... was ist das, Marie?« Jeanne hatte vor lauter Angst und Entsetzen fast keine Stimme mehr, nicht mehr als ein Piepsen brachte sie hervor.
Marie zog sie noch fester an sich und tastete nach dem kleinen Messer, das sie immer dicht bei sich trug, in einer Halterung an ihrer Korsage. Die Männer hatten sie nicht durchsucht; es war nicht üblich, dass ein Mädchen ein Messer mit sich führte. Auch ihre Eltern wussten nichts davon. In der Mädchenschule hatte Marie einiges über die Welt gelernt. Und nichts Gutes.
»Du träumst, Jeanne«, flüsterte sie. »Das ist alles nur ein böser Traum, aus dem du bald aufwachst. Schließ die Augen und atme tief durch. Lehn dich an mich. Alles wird gut.«
Jeanne gehorchte, sie vertraute der Älteren vollauf.
Marie küsste ihre Schwester auf die Stirn, bevor sie ihr mit schnellem Streich die Kehle durchschnitt.
Sie machte sich keine Illusionen. Dieses Ungeheuer, diese Bestie war echt, kein Spiel. Selbst wenn es nur die Männer in Verkleidung sein mochten, ihr beider Schicksal war besiegelt, hier kamen sie nicht mehr lebend heraus. Marie hatte schon von solchen Geschichten gehört. Von mehr als einer. Sie wusste, wozu Männer fähig waren und wie wenig die Frauen dem entgegenzusetzen hatten. Das Alter spielte dabei keine Rolle.
Ihr Vater machte sich keine Vorstellungen, was Frauen alles zustoßen konnte, er lebte in seinem friedlichen Elfenbeinturm und hatte keine Ahnung von der wahren Welt draußen. Er war zu harmlos, zu freundlich. Der beste aller Väter, der seine »drei Mädchen«, wie er sie nannte, innig liebte. Sie nur nicht beschützen konnte.
Es hatte keinen Sinn zu trauern. Sie hatte eine glückliche Kindheit gehabt, das war schon mehr als viele andere in ihrem ganzen Leben erfuhren.
Jeanne hatte nun keine Angst und keine Schmerzen mehr, sie war auf den Weg in den Himmel und trug bestimmt schon hübsche weiße Flügelchen, der kleine Engel.
Marie machte sich bereit.
Ein donnerndes Brüllen von oben, wahrscheinlich hatte die Bestie den Blutgeruch gewittert, und das brachte sie zur Raserei. Ein riesiger Schatten flog herunter, doch es war kein rettender Engel, sondern der knurrende, rot glühende, nach Schwefel stinkende Tod. Marie, die instinktiv zur Seite weichen wollte, ächzte auf, als sie unter dem gewaltigen Körper, der den Kessel fast vollständig ausfüllte, begraben wurde.
Sie spürte, wie ihre Kleidung von langen scharfen Krallen in Fetzen gerissen wurde, dann die froststarrende Kälte an ihrer Haut und nur einen zittrigen Atemzug später einen brennenden Schmerz in ihrem Unterleib. Speichel tropfte auf ihr Gesicht, und während sie noch schrie vor Schmerz und das Gefühl hatte, innerlich zerrissen zu werden, kam noch mehr Pein hinzu, als die Bestie ihren Fang in Maries linken Arm versenkte und ein großes Stück Fleisch herausriss, das sie gierig verschlang. Mit letzter Kraft stieß Marie mit dem Messer zu. Nicht in den Hals, der war von einem dicken Fellkragen geschützt, sondern in die Schulter darunter.
Die Bestie heulte auf, als sie getroffen wurde, und Marie, bereits halb bewusstlos, zog das Messer zurück, um noch einmal zuzustoßen. Sie würde ihren und den Tod ihrer Schwester teuer verkaufen, nicht als wehrloses Lämmchen.
Ein Schwall Blut stürzte aus der Wunde auf sie herab, und da erstarrte ihre Hand mitten in der Bewegung.
Gold, war Maries letzter, erstaunter Gedanke.
Dann war es vorbei.
Désirée war total aufgeregt. Frisch von der Journalistenschule, und gleich ihr erster Auftrag! Na gut, sie wurde nicht dafür bezahlt, weil sie erst mal als Volontärin bei dem mondänen Magazin Beauté Femme genommen worden war, aber jeder fing klein an! Was für ein Glücksfall, dass keine Kollegin Zeit gehabt hatte, um die Einladung zur DeLaVienouvelle mode