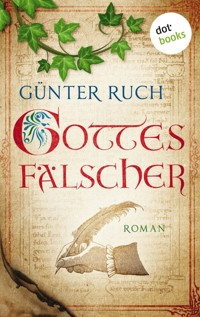Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Das Schicksal einer mutigen jungen Frau: Der fesselnde historische Roman »Das Herz einer Gräfin« von Günter Ruch als eBook bei dotbooks. Wenn größtes Glück und tödliche Gefahr nah beieinander liegen … Für Genovefa, die Tochter des Herzogs von Brabant, wird im Jahre 732 ein langgehegter Traum wahr: Sie kann den Hof ihres gefühlskalten Vaters verlassen und an der Seite ihres Mannes ein neues Leben beginnen! Dass der Pfalzgraf im Ruf steht, ein rauer Krieger zu sein, der seine Braut nur aus Machtinteresse zu sich in die Eifel holt, schreckt sie nicht – Genovefa ist überzeugt, sein Herz durch Anmut und Schlauheit gewinnen zu können. Doch ihr Liebreiz weckt auch das Interesse eines anderen Mannes: Golo, der skrupellose Verwalter des Grafen, setzt alles daran, Genovefa in sein Bett zu zwingen. Als sie sich widersetzt, spinnt er einen eiskalten Plan, um Rache zu nehmen … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Im historischen Roman »Das Herz einer Gräfin« erweckt Günter Ruch die bekannte Sage zu neuem Leben. Doch während Genofeva – auch Genoveva genannt – in der Überlieferung ein Opfer des Pfalzgrafen Siegfried und seines Verwalters Golo wurde, erzählt Ruch die Geschichte aus der Sicht einer willensstarken Frau, die nicht bereit ist sich in ihr Schicksal zu fügen. Wer liest, hat mehr vom Leben! dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Wenn größtes Glück und tödliche Gefahr nah beieinander liegen … Für Genovefa, die Tochter des Herzogs von Brabant, wird im Jahre 732 ein langgehegter Traum wahr: Sie kann den Hof ihres gefühlskalten Vaters verlassen und an der Seite ihres Mannes ein neues Leben beginnen! Dass der Pfalzgraf im Ruf steht, ein rauer Krieger zu sein, der seine Braut nur aus Machtinteresse zu sich in die Eifel holt, schreckt sie nicht – Genovefa ist überzeugt, sein Herz durch Anmut und Schlauheit gewinnen zu können. Doch ihr Liebreiz weckt auch das Interesse eines anderen Mannes: Golo, der skrupellose Verwalter des Grafen, setzt alles daran, Genovefa in sein Bett zu zwingen. Als sie sich widersetzt, spinnt er einen eiskalten Plan, um Rache zu nehmen …
Über den Autor:
Günter Ruch (1956–2010), wurde in Sinzig am Rhein geboren, studierte in Bonn mittelalterliche Geschichte und arbeitete später als Journalist, Grafiker, Fotograf und Autor.
Bei dotbooks erschienen außerdem Günter Ruchs hervorragend recherchierten und mitreißend erzählten historischen Romane »Das Geheimnis des Wundarztes« und »Gottes Fälscher«.
***
eBook-Neuausgabe April 2019
Dieses Buch erschien bereits 2002 unter dem Titel »Genovefa« im Rhein-Mosel-Verlag.
Copyright © der Originalausgabe 2002 Rhein-Mosel-Verlag, Alf/Mosel
Copyright © der Neuausgabe 2019 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung von Bildmotiven von shutterstock/Morphart Creation, lisima, Kovalev Anatolii
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-96148-439-3
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Das Herz einer Gräfin« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Günter Ruch
Das Herz einer Gräfin
Roman
dotbooks.
Inhalt
ERSTER TEIL
I
II
III
IV
V
VI
ZWEITER TEIL
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
DRITTER TEIL
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
Lesetipps
ERSTER TEIL
I
Schwer und plump wirkte der Kastenwagen, mit dem Graf Sygifrid seine Braut in ihrer brabantischen Heimat abgeholt hatte. Das Gefährt rumpelte über die alte Römerstraße, holperte durch ein tiefes Schlagloch. Bertrada krachte mit dem Kopf gegen die niedrige Decke des Wagens. Sie schrie laut auf vor Schmerz.
»Verflucht sei diese Reise!«, schimpfte die Amme Genovefas. »Man kann die verdammte alte Straße kaum noch erkennen! Und in was für einem erbärmlichen Zustand sie ist!«
Genovefa, die Brabanterin, lachte. Sie war fest entschlossen, sich die gute Laune durch nichts verderben zu lassen. Sie glitt noch immer dahin auf dieser Woge des Glücks, und dazu passte der strahlende Sonnenschein, der das Tal von Kesseling übergoss – so und nicht anders sollte es sein, denn genauso hatte sie es sich vorgestellt.
»Ist schon gut«, lenkte Bertrada ein. »Es ist das Land deines Grafen, und alles ist herrlich und wunderbar.« Sie grinste ironisch. »Ich weiß doch, wenn du dir etwas in den Kopf gesetzt hast, dann wird schwarz zu weiß und krumm zu gerade. So bist du immer gewesen, schon als kleines Kind.«
»Freu' dich einfach mit mir!«, schlang Genovefa ihre Arme um Bertradas Hals. »Du weißt doch, wie ich bin. Entweder ganz, oder gar nicht. Wenn ich mich einmal für eine Sache entschieden habe, dann bin ich mit Haut und Haaren dabei.«
Bertrada machte ein strenges Gesicht. »Erinnerst du dich an Arko? Du wolltest ihn unbedingt haben. Feuer und Flamme warst du, und für dich wäre die Welt untergegangen, wenn du dieses Pferd nicht bekommen hättest. Selbst dein Vater hat ja schließlich zugestimmt, und das will etwas heißen. Aber dann war es wie mit allen deinen Spielzeugen: Was du besitzt, an dem verlierst du schnell das Interesse.«
Genovefa machte eine wegwerfende Handbewegung. »Das ist tausend Jahre her!«, rief sie fröhlich. »Ich bin jetzt kein Kind mehr. Glaubst du denn nicht, dass man sich ändert, wenn man erwachsen wird?«
Bertrada zuckte mit den Schultern. »Wahrscheinlich werde ich dich immer wie ein Kind ansehen. Vielleicht werde ich niemals begreifen, dass du erwachsen bist, eine Frau ... und eine Braut.«
»Ja!«, lachte Genovefa. »Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich wirklich eine verheiratete Frau bin, und dass draußen vor dem Wagen mein Gemahl reitet ...«
Genovefa schloss die Augen und gab sich ganz ihren Gefühlen hin. So ist es also, wenn alle Wünsche in Erfüllung gehen, dachte sie euphorisch. Sie kannte sich selbst gut genug, einem solchen Überschwang der Gefühle zu misstrauen; schnell konnte das ins Gegenteil umschlagen, und am Ende blieb nur gelangweilte Gleichgültigkeit – aber bei Sygifrid war das alles anders.
Als sie noch sehr jung war, hatte sie von den Helden geträumt, wie sie die Geschichten bevölkerten, mit denen man sich an den Kaminfeuern in den langen Wintermonaten unterhielt. In ihren Träumen war sie die umworbene Prinzessin, die von ihrem Zukünftigen in ein lichtstrahlendes Leben ohne Sorgen und im Überfluss geführt wurde.
Als einziges Kind des brabantischen Kleingrafen Ugobert fehlte es ihr zwar an nichts, aber die Strenge und die Kälte des Vaters hatten Genovefa den Abschied leicht gemacht.
Plötzlich schlich sich Nachdenklichkeit in das Gesicht der jungen Gräfin, so als habe sie für einen kurzen Augenblick hinter die Kulissen ihrer Euphorie, und hinter die Kulissen ihres Lebens geschaut. Aber das verging schnell wieder.
»Ich weiß ja, dass es für dich viel schwerer als für mich war, dich von unserer Heimat zu trennen«, legte Genovefa nach kurzem Schweigen beschwichtigend die Hand auf Bertradas Arm. »Aber glaube mir, dir wird es in Magus sicherlich genauso gut ergehen wie zu Hause.«
Bertrada wirkte nicht sehr überzeugt. Aber sie wusste, dass es sinnlos war, gegen Genovefas Meinung und gegen ihre Laune zu opponieren. Wenn sich Ugoberts Tochter etwas in den Kopf gesetzt hatte, dann war sie nicht davon abzubringen. Da war sie ganz wie ihr Vater. Und sie hatte sich nun einmal in den Kopf gesetzt, dass Graf Sygifrid ein Volltreffer für ihr Leben war.
»Ich geb' es ja zu, er ist wirklich ein stattlicher Mann«, sagte die Amme entgegenkommend, während draußen vor den Fensteröffnungen knospende Obstplantagen vorbeizogen, die sicherlich zum Kloster Kesseling gehörten. »Eins ist sicher: So wie er auf seinem Araberhengst sitzt, können ihm unsere Jungen aus Brabant nicht das Wasser reichen.«
Genovefa nickte zustimmend und strahlte dabei über das ganze Gesicht. Vergessen war der kalte Abschied vom Vater und der traurige Blick der Mutter, die sie in dem Gefängnis ihres Lebens zurücklassen musste. Ihre Gewissheit war unumstößlich, dass bei Sygifrid alles anders sein würde. Niemals sollte es so kommen wie bei ihrer Mutter Asmuth, die aus Friesland gekommen, in Brabant niemals heimisch geworden war, und die sich irgendwann in der Stille ihrer ewigen Melancholie verloren hatte.
Von der Mutter hatte Genovefa ihre Feinfühligkeit geerbt, vom Vater dagegen allenfalls ihre Zähigkeit; ansonsten war ihr Ugobert genauso fremd geblieben, wie er der Mutter über all die langen Jahre fremd geblieben war. Eine Fremdheit, die schnell in Kälte umschlug: Seit Genovefa sich erinnern konnte, war ihr vom Vater niemals eine Herzlichkeit, niemals eine liebevolle Geste oder Berührung entgegengebracht worden, und sie verstand nur allzu gut, warum die Mutter sich in das dunkle Tal ihres Trübsinns verirrt hatte, zumal das Alter den Vater noch halsstarriger und eigenbrötlerischer gemacht hatte.
Sygifrid war ganz anders, und das machte die frisch vermählte Gräfin überglücklich: »Sygifrid und Aldebaran – es ist, als ob sie zusammengewachsen wären wie ein Zentaur.« Sie lehnte sich aus dem Fenster, deutete aufgeregt zur Spitze des Trosses, wo ihr Gemahl ritt. »Ich glaube, ich kann mich niemals an diesem Anblick sattsehen.«
Bertrada verzog mürrisch das Gesicht. »Ich kann nur hoffen, dass du recht hast. Arko konntest du in den Stall stellen und vergessen, als du das Interesse an ihm verloren hattest.« Plötzlich huschte ein Schatten des Zweifels über ihre Gesichtszüge. »Mit Graf Sygifrid bist du verbunden, bis dass der Tod euch scheidet. Denk an deine Mutter, und erinnere dich immer daran, dass er nicht eine deiner Launen ist ...«
»Bitte, liebe Bertrada ... nicht wieder deine Moralpredigten«, hob Genovefa abwehrend ihre Hände. »Lass mich nur glücklich sein.«
»Ach, Täubchen ... das ist doch alles, was ich in meinem Leben je gewollt habe: Dass du glücklich bist. Ich verspreche dir, ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, dass es auch so bleibt.«
»Weißt du eigentlich, wie er an Aldebaran gekommen ist?«, fragte Genovefa. Bertrada erschien es, als hätte ihr Schützling überhaupt nicht zugehört. »Er ist die Beute aus einem Kriegszug im aquitanischen Reich. Den hat Sygifrid in jungen Jahren an der Seite von König Chilperich mitgemacht. Daher hat er auch seine Narbe. Ich glaube, Golo hat ihm damals das Leben gerettet.«
Bertrada beugte sich zu ihrer Herrin hinüber. »Trotzdem: Golo kann niemandem in die Augen schauen. Verschlagen wirkt er. Ich glaube, ich werde ihm nie über den Weg trauen.«
»Und außerdem magst du keine hageren Männer«, sagte Genovefa abwiegelnd. »Er hat an der Seite von Sygifrid gekämpft und er ist der treueste Ritter des Grafen. Als solchen achte ich ihn. Das solltest du auch lernen. Das sind die Leute, mit denen wir in Zukunft Umgang haben werden. Und dies hier ist das Land, das unsere Heimat sein wird.«
Bertrada zog die Schultern hoch und verdrehte die Augen: »Ich glaube, in Brabant hat es mir trotzdem besser gefallen.«
»Ach, es ist doch alles so neu und aufregend!«, zog Genovefa die Vorhänge des über die Straße rumpelnden Kastenwagens weit zur Seite.
Sie blinzelte in die Morgensonne, sog die von Blütendüften geschwängerte Frühlingsluft ein.
»Gib's doch schon zu, es ist wirklich schön hier!«
Bertrada zuckte mit den Schultern. »Ich weiß ja, dass du es nicht erwarten konntest, deinem Vaterhaus Lebewohl zu sagen. Und glaub' mir, ich kann dich verstehen. Aber für mich ist es etwas anderes.«
»Ich will nur, dass du meine Freude teilst.«
»Ach, freu' dich nur!«, seufzte Bertrada. Die Amme wollte sich aber offenbar keinesfalls von Genovefas Euphorie anstecken lassen. »Bertrada, ich könnte tausend Dankgebete gen Himmel schicken, dass die Muttergottes meine Bitten erhört hat!«
Genovefa konnte sich kaum noch an alle ihre Befürchtungen und Ängste erinnern, die sie mit ihrer Amme in der Nacht vor Sygifrids Ankunft geteilt hatte ...
Genovefa und Bertrada beteten in der besagten Nacht gemeinsam in der dunklen Kapelle der väterlichen Burg. Das Gemäuer wurde vom Schein der beiden Windlichter, die sie mitgebracht hatten, in ein flackerndes Zwielicht getaucht.
»Gnade mir Gott«, sagte Graf Ugoberts Tochter ein übers andere Mal. »Was wird sein, wenn er erst mein Gemahl ist? Ich bin ihm ausgeliefert auf Gedeih und Verderb.«
Die Nacht draußen war die bisher wärmste des Frühlings hier in Brabant, aber in der Burgkapelle hielt sich noch immer die Knochenkälte des Winters. Bertrada nahm ihren Schützling in den Arm, schwieg aber. Sie wusste wie Genovefa, was man sich vom Pfalzgrafen Sygifrid dem Hörensagen nach erzählte: Dass er ein stattlicher Krieger sei, reich an Land und an Hörigen und erprobt in Kämpfen sowohl mit den Sarazenen als auch mit den heidnischen Sachsen; dass er aber zugleich ein unzivilisierter, rauer Kerl sei, der sich nichts aus Süßholzgeraspel machte und für den eine Frau fast wie eine Kriegsbeute war. Genovefa jedoch pflegte ihrerseits gewöhnlich den Umgang mit Söhnen aus Familien, die sich ihrer römischen Abstammung rühmten, und deren Ahnen Senatoren waren oder gar Heermeister römischer Kaiser.
»Ob er wirklich ein solcher Barbar ist, wie man sich erzählt?«, fragte Genovefa ängstlich. »Ich weiß ja, dass ich meine Pflichten habe als Tochter des Grafen Ugobert, und es ist gut, dass mein Haus durch diese Heirat einen starken Verbündeten gewinnt«, tröstete Genovefa sich selbst. »In Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, Verbündete zu haben.«
Bertrada nickte eifrig.
»Aber trotzdem ... ist es zuviel verlangt, wenn ich mich nach einem guten Mann sehne? Beim Leben meiner Mutter! Ist das zuviel verlangt?«
»Beruhige dich doch!«, legte die Amme beschwichtigend den Arm um Genovefas Schultern. »Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Am Ende wird es bestimmt nicht so schlimm, wie du jetzt vielleicht denkst.«
»Das ist ja wirklich beruhigend«, schnaubte Genovefa, so dass es in der kahlen und düsteren Kapelle widerhallte. »Wenn doch der Kelch an mir vorübergehen würde ...«
»Du bist kein Kind mehr«, erwiderte die beleibte Amme streng. »Und trotzdem redest du wie ein trotziges Kind. Du solltest dich lieber daran erinnern, was du in die Waagschale zu werfen hast. Alle Männer starren dir nach, wenn du über den Marktplatz von Gent gehst, und dein Haar leuchtet in der Sonne wie goldener, reifer Weizen. Für viele von ihnen bist du der Inbegriff weiblicher Schönheit. Mein Gott, wäre ich froh gewesen, wenn ich eine solche Figur gehabt hätte, als ich so alt war wie du! Sygifrid wird sich beglückwünschen, wenn er dich zum ersten Mal sieht.«
Genovefa seufzte und legte den Kopf an die Schulter der Dienerin.
»Ich habe so oft zur Muttergottes gebetet. Vielleicht schenkt sie mir ja Gehör.«
»Denk daran, dass es Gottes Wille war, Mann und Frau zu erschaffen.«
»Ich will es versuchen«, flüsterte Genovefa. »Wenn nur die nächsten Tage schon vorüber wären.«
***
Der Tross hielt inne.
Fünf Tage waren seit dem Gespräch in der Burgkapelle vergangen, und alles war ganz anders gekommen, als Genovefa es erwartet hatte. Selbst das, wovor sie sich am meisten gefürchtet hatte, der Akt, der Vollzug der Ehe, war schließlich eine Erfüllung gewesen, hatte ein unsichtbares Band zwischen den Eheleuten gesponnen. Wie sehr sie sich jetzt zu Sygifrid hingezogen fühlte! Trotz all seiner zur Schau gestellten Männlichkeit war er fast genauso nervös wie sie selbst gewesen. Er hatte sie behutsam genommen und war dabei sogar ein bisschen zärtlich, und der Anblick ihres unbekleideten Körpers hatte ihn offenkundig mit Wohlgefallen erfüllt. Die frischgebackene Gräfin lehnte sich weit aus dem Fenster des Wagens und winkte zu Sygifrid hinüber, der an der Spitze des kleinen Trosses ritt. Der Graf sah seine Braut winken und lächelte kurz. Er nickte ihr zu und richtete sich auf dem Rücken seines Pferdes stolz auf.
Genovefa ließ sich zurück auf die Sitzbank sinken. Bertrada sah, dass ihr Schützling Tränen in den Augen hatte.
»Dein Gefühlsüberschwang ist so groß«, sagte die Amme tadelnd, »dass du aufpassen musst, nicht alle Pfeile aus deinem Köcher auf einmal zu verschießen.« Sie schüttelte den Kopf. »Lass noch etwas übrig von deinen Gefühlen. Es kommen noch viele lange Jahre, wo du sie brauchen wirst.«
Aber Genovefa wollte nichts von alledem wissen. »Sieht seine Narbe nicht unheimlich männlich aus? Sie entstellt ihn doch kein bisschen, oder?«
Derweil drehte sich der Graf im Sattel um und winkte hinauf zu Abt Hucbert, der inmitten seiner ärmlich gekleideten Mönche an der Klosterpforte droben auf dem Heiligen Berg Aufstellung genommen hatte und dem gräflichen Tross Segenszeichen hinterherschickte.
»Der Abt ist Sygifrid ziemlich zu Dank verpflichtet«, sagte Genovefa stolz. Sie hatte die Ehre und den guten Ruf ihres frisch Angetrauten schnell auch für sich selbst vereinnahmt. »Vor ein paar Jahren hat mein Mann ihnen das ganze Tal hier geschenkt.« Sie deutete mit einer großzügigen Geste über das Tal hinweg, so als hätte sie selbst die Schenkung verfügt. »Dafür liest Hucbert ihm jeden Freitag einen eigenen Gottesdienst.«
»Dann ist ja für sein Seelenheil bestens gesorgt«, bemerkte Bertrada trocken.
Genovefa beobachtete derweil ihren Gemahl so verzückt, dass Bertrada unwillkürlich das Gesicht verzog, so als hätte sie in eine saure Zitrone gebissen.
»Passt der Reitanzug ihm nicht wie angegossen?«, schwärmte die junge Gräfin weiter.
»Ob wir denn die Kesselinger Brücke erreicht haben?«, wollte Bertrada ihrerseits wissen.
An eben dieser Brücke, so hatte Sygifrid seine Braut und die Amme am Abend zuvor aufgeklärt, begann sein Gau.
Das war im Skriborium des Klosters gewesen, wo sie mit dem Abt Hucbert und ein paar anderen Mönchen am Feuer gesessen und bei kräftigem Ahrrotwein miteinander fabuliert hatten. Sie lauschten Hucberts Geschichten von der geheimnisvollen Welt dort draußen, und folgten ihm auf seiner abenteuerlichen Pilgerreise, die ihn über Konstantinopel nach Jerusalem geführt hatte. Aber auch Sygifrid war in fernen Ländern gewesen und wusste von wundersamen Begebenheiten aus dem sagenumwobenen Reich der Sarazenen zu berichten. Genovefa jedenfalls war unendlich stolz, mit welchem Respekt der ehrwürdige Abt ihrem Gemahl begegnete ...
Nur einmal war ganz kurz die Harmonie des Abends gestört worden, als ein junger, etwas vorwitziger Mönch einen offenkundigen Fehler Sygifrids korrigierte. Wenn so etwas geschah, dann konnte Sygifrid geradezu halsstarrig werden. Er duldete keinen Widerspruch und gab sich über die Maßen selbstsicher. Darin ähnelte er Genovefas Vater.
Aber davon wollte sie jetzt nichts wissen. Sie sah über solche kleinen Fehler liebevoll hinweg.
Sygifrid lenkte jetzt seinen Aldebaran zum Wagen, wo das Tier ungeduldig auf der Stelle tänzelte. Aldebaran, so dachte die Gräfin, ähnelte in vielem seinem Herrn. So ungestüm, so stolz und auch so herrisch wie das Pferd war sein Reiter.
Der Graf beugte sich zum Wagenfenster herab. »Ich wünschte, alles könnte so bleiben wie es jetzt ist«, sagte er mit einem Anflug von Melancholie – so leise, dass es Golo und Audoin, die mit ihren gelb bewimpelten Hellebarden ganz in der Nähe waren, nicht hören konnten.
»Dann sollten wir einander schwören, dass sich niemals etwas ändert zwischen uns«, erwiderte Genovefa zärtlich.
»Manchmal glaube ich, dass du eine Zauberin bist«, lachte der Graf. Er klopfte Aldebaran beruhigend den Hals. »Weißt du warum? Mir kommt es so vor, als ob du jeden Tag noch ein bisschen schöner geworden bist, obwohl ich das eigentlich nicht für möglich gehalten habe.«
»Du willst mir nur schmeicheln, Sygifrid«, erwiderte Genovefa und senkte so verschämt wie kokett den Blick.
»Ich kann nicht schmeicheln«, erwiderte Sygifrid rigoros. »Ich bin ein Krieger. Ich bin geboren für den Kampf und für das Leben im Sattel. Das Schmeicheln überlasse ich den jungen Burschen, die noch nie einen Zweikampf auf Leben und Tod ausgefochten haben.«
»Warum so kriegerisch, mein Gemahl?«, neckte Genovefa den Grafen. Sie wusste genau, wen er mit den jungen Burschen gemeint hatte: die brabantischen Jungadligen, die bei der Hochzeitsfeier auf der Wasserburg Ugoberts zugegen waren. Schon bei dieser Feier war die junge Braut gleichsam in einem Meer von Glück untergegangen. Selbst der alte Graf hatte sich leutselig gegeben. Wenn sie an den weichlichen Berthofrid oder den strohdummen Wulfoald dachte – zwei andere Bewerber um ihre Hand, junge Adelige aus senatorischem Haus –, dann dankte sie Gott und vor allen Dingen der Muttergottes noch einmal inständig, dass ihr Vater sich für den Pfalzgrafen aus dem Moselland entschieden hatte.
Nicht zuletzt natürlich wegen des großen Umfangs seiner Besitztümer, die er als Allod und Eigengut oder zu Lehen besaß und die sich vom Tal der Ahr über den Rücken des Eifelgebirges und den Magus-Gau bis hinüber nach Treveris erstreckte. In Treveris war Sygifrid Herr über die Pfalz des Merowingerkönigs. Das war eine ehrwürdige Pfalz mit der hochberühmten Konstantins-Basilika als Pfalzkirche und Versammlungsort. Zugleich brachte das Amt die Aufsicht über zahlreiche Besitzungen an der Mosel und an der alten Römerstraße entlang bis hinauf zum neuen Kloster Sancti Salvatoris Prumiense. Auch über dieses Kloster hätte Sygifrid wohl gerne die Vogtei ausgeübt, wenn Karl der Majordomus das nur zugelassen hätte. Aber was noch nicht war, konnte ja noch werden.
Der Pfalzgraf sprang von seinem Pferd. Es war noch immer ein ungewöhnlicher Anblick, wie er dabei die modernen Steigbügel benutzte, aber er machte es perfekt, beinahe elegant. Er öffnete den Schlag des Wagens, reichte der Gräfin die Hand, half ihr hinaus und legte den Arm um sie.
»Hier beginnt also mein Reich, das jetzt auch dein Reich ist«, deutete er auf die Kesselinger Brücke. »Die Dörfer bis hinauf nach Magus gehören alle dazu«, lächelte er stolz. »Es ist zwar kein glänzendes Lehen, eher bescheiden ...«
»Du stellst dein Licht doch auch sonst nicht unter den Scheffel«, warf Golo ein, der ein paar Schritte abseits stand. »Von wegen bescheiden ... es gibt mehr als genug Herren in Austrien, die dich beneiden.«
Sygifrid machte eine wegwerfende Handbewegung. »Es sind unruhige Zeiten heutzutage. Karl wird bald wieder gegen die Sarazenen ziehen. Was kommt nach mir, wenn es mich in der nächsten Schlacht erwischt?« Er wandte sich an Genovefa. »Weißt du, seit einiger Zeit beschäftigen mich diese Gedanken.«
Unwillkürlich schaute Golo zu Genovefa herüber, so als erwarte er irgendetwas von ihr. Als er jedoch bemerkte, dass die Gräfin ihn selbst beobachtete, senkte er schnell den Blick. Bertrada hat recht, dachte Genovefa. In seinem Blick ist etwas Lauerndes, etwas Verschlagenes. In diesem Mann steckt etwas, das hinaus will, aber noch keinen Weg gefunden hat.
»Von welcher Schlacht redest du nur?«, fragte Genovefa erschrocken.
Der Pfalzgraf streichelte ihr beruhigend über den Rücken. »Ich glaube nicht, dass wir in diesem und im kommenden Jahr noch einmal Ärger haben werden. Al Tarik ist damit beschäftigt, seinem Schwiegersohn den Garaus zu machen, und man erzählt sich, dass er immer öfter auf den Rat seiner Sterndeuter hört. Bis zur nächsten Wintersonnenwende sollen Abd ar-Rachmans Sterne schlecht stehen.«
»Wer ist Abd ar-Rachman?«, fragte Genovefa, die diesen Namen noch niemals zuvor vernommen hatte.
»Ein gerissener Bursche. Er ist ein Feldherr der Sarazenen, ein Ungläubiger. Aber auch wenn er ein Heide ist, ist er sehr klug und verschlagen. Ein gewiefter Kriegsherr und Taktiker. Ein Gegner, den man nicht unterschätzen darf. Glaub' mir, ich weiß es, denn ich war im Krieg gegen ihn.«
Sygifrid machte plötzlich eine Handbewegung, als wolle er irgendwelche störenden Insekten vertreiben.
»Genug davon! Wir sollten uns diesen schönen Morgen nicht durch trübe Gedanken an den Krieg verderben.«
»Und außerdem ist Krieg Männersache«, meldete sich Golo zu Wort. »Frauen sollten sich da nicht einmischen.«
Genovefa spürte von neuem Widerwillen gegen diesen Mann und die Art, wie er sprach. Aber sie vertrieb die unangenehmen Gedanken.
»Immer war ich im Krieg«, fuhr Sygifrid leise fort. Er schaute versonnen das Tal in Richtung Magus hinauf, durch das sich – kaum sichtbar – der Weg schlängelte, den sie nehmen würden. Rechts und links bedeckten dichte, dunkle Wälder die Hänge. »Ich bin nicht mehr der Allerjüngste«, fuhr der Pfalzgraf so leise fort, dass es nur Genovefa hören konnte. »Ich wünsche mir einen Sohn, der mir in meinem Amt folgt.«
Er schlug mit der Hand gegen den Knauf seines Schwertes, eine Verlegenheitsgeste. »Es ist Zeit, mein Haus zu bestellen.«
»Nichts will ich lieber tun, als dabei an deiner Seite zu sein«, erwiderte die Gräfin zärtlich und aufrichtig. »Nichts würde mich glücklicher machen, als dir deine sehnlichsten Wünsche zu erfüllen.«
II
Am Abend erreichte der Tross die Gegend von Magus. Das Wetter war umgeschlagen. Es hatte heftig zu regnen begonnen. Tief hängende, graue Wolken strichen um die Berggipfel des Eifelgebirges. Die Wälder waren düster und abweisend, wirkten beinahe bedrohlich. Es war viel kälter als noch am Morgen. Der starke Regen machte die Wege fast unpassierbar, und sie waren froh, dass es jetzt nur noch eine Meile bis Magus war.
Im Innern des gräflichen Wagens hüllten sich Genovefa und Bertrada in wollene Decken. Die beiden schwiegen, während der Tross an einem großen, fast kreisrunden See vorbeikam, dessen bleigraue Wasser unergründlich wirkten.
Audoin ritt neben dem Wagen. Er war der angenehmere der beiden Gefolgsleute des Pfalzgrafen, ein untersetzter Mann von kräftiger Gestalt mit großen Körperkräften, nahezu das Gegenteil des hageren Golo, ein einfacher, bescheidener Krieger.
»Das ist der Lagossee«, sagte der Krieger durch das Fenster des Wagens und deutete auf das Gewässer. »Man sagt, er hat keinen Grund, und es sollen Feen in ihm wohnen.«
»Habt Ihr Feen gesagt?«, fragte Bertrada und bemäntelte dabei nur mühsam ihre Neugierde, während der Wagen sich über den schlammigen Weg quälte. Sie hörten den Wagenlenker ein übers andere Mal fluchen. Die beiden Pferde, die vorgespannt waren, schnaubten schwer.
Audoin nickte wichtig: »Ja, Ihr habt richtig gehört«, bestätigte er. »Und wenn ein gottesfürchtiger Mann sein Leben für die Feenkönigin hergibt, dann sind ihre Seelen erlöst.« Audoin lachte, während er versuchte, sich genau neben Bertradas Fenster zu halten. »So erzählt man es sich jedenfalls.«
Genovefa sah, wie ein Schaudern ihre treue Amme durchlief. Bertrada liebte Feengeschichten und konnte stundenlang zuhören, wenn sie am Kamin erzählt wurden. Und wenn sie schaurig waren – um so besser.
»Die Feenkönigin?«, fragte sie mit zitternder Stimme.
Audoin nickte bedeutungsvoll und wischte sich den Regen von den Wangen. Ein Ast schlug ihm ins Gesicht. Er tat so, als merke er es nicht. Ob er selbst an die Geschichten glaubt, die er uns da auftischt?, fragte sich Genovefa.
»Manchmal, in mondhellen Nächten, soll man am See ihr Wehklagen hören«, sagte Audoin geheimnisvoll.
»Ich spüre es ... hier sind geheimnisvolle Mächte am Werk«, schüttelte Bertrada sich in wohligem Schauer. Genovefa dagegen berührte die Geschichte Audoins nicht sonderlich. Sie fühlte sich müde und abgespannt. Das gewaltige Glücksgefühl, das sie seit der Hochzeit in ihrem Herzen wie eine lodernde Fackel mit sich geführt hatte, brannte inzwischen, wenn auch unmerklich, ein bisschen weniger hell und heiß. Aber sie war noch immer zufrieden, sagte sie sich. Nein, es war ganz gewiss kein schlimmes Vorzeichen, dass sich das Wetter bei ihrem Einzug in das neue Zuhause gegen sie verschworen hatte. Und noch immer fühlte sie die unendliche Freude über die Befreiung aus der Umklammerung des Vaters, die nun schon so viele Meilen weit weg war.
»Der Berg dort hinter dem See heißt Hochstein«, fuhr Audoin fort. Der Eindruck, den er bei Bertrada hinterließ, schien ihn zu weiteren Mitteilungen zu beflügeln. »Der Hochstein hat am Gipfel Höhlen, denen man am besten nicht zu nahe kommt.«
Audoin schien es nicht sonderlich zu interessieren, dass der Regen ihn inzwischen vollkommen durchnässt hatte. Offenbar war er solche widrigen Umstände gewöhnt.
Aber ehe Bertrada weiter in ihn dringen und mit neugierigen Fragen zu weiteren Ausführungen veranlassen konnte, wurde der Weg so schmal, dass Audoin sich mit seinem Pferd hinter den Wagen zurückfallen lassen musste. Dort ritten zehn Mann des Geleits, die besten Kämpfer Sygifrids, die er diesmal nicht in die Schlacht, sondern zur Heimführung seiner Braut aufgeboten hatte.
Zwei Stunden später erreichte der Tross aus nördlicher Richtung kommend Magus, den Hauptort des gleichnamigen Gaus, in dem Sygifrids Familie seit der Zeit des zweiten Chlodowech das Grafenamt innehatte. Sygifrids Vater Sigibert hatte dann die Vogtei über die treverische Pfalz hinzugewonnen, und trotz aller Wirrungen im merowingischen Reich, in deren Verlauf die fränkischen Könige mit- und gegeneinander kämpften, hatte Sigibert seine Ämter dem einzigen Sohn übertragen können.
Der Wald lichtete sich. Der Weg war abschüssig.
Der Regen hatte ein wenig nachgelassen, aber noch immer hingen die Wolken tief und bedrückend über dem Talkessel, in dem Magus lag.
Sie kamen an eine Furt, bei der sie das Flüsschen Nyt überquerten. Der Bach führte sehr viel Wasser, dennoch gab es bei der Überquerung keine größeren Probleme.
»Brrr ... ist das kalt hier!«, klagte Bertrada und starrte mit finsterem Blick hinaus. »Wir hatten Mai, als wir losgezogen sind. Aber hier könnte man meinen, dass der Winter noch nicht vorbei ist.«
»Es wird nicht immer so sein«, beruhigte die Gräfin ihre Amme. »Denke nicht zu viel an Brabant«, mahnte sie die Dienerin. »Bedenke, dass wir den Rest unseres Lebens an diesem Ort verbringen werden.«
»So Gott will«, seufzte Bertrada, winkte dann kurz zu Audoin hinüber, der wann immer es möglich war an der Seite des Wagens ritt, offenbar um einen Blick Bertradas zu erhaschen.
»Gib nur acht!«, lachte Genovefa. »Ich glaube, er hat ein Auge auf dich geworfen!«
Bertrada machte eine wegwerfende Handbewegung, aber diese Zurschaustellung von Desinteresse kam Genovefa nicht allzu nachdrücklich vor.
Sie durchquerten ein kleines Kiefernwäldchen, dann weitete sich der Blick auf die Siedlung Magus, die drunten im Tal lag, teils hinter Nebelschwaden.
Genovefa und Bertrada schauten einander an, und beide brauchten nicht in Worte zu fassen, was sie dachten, denn sie sahen im Gesicht der jeweils anderen ein Gran von Enttäuschung, bei der Dienerin wohl mehr als ein Gran.
Genovefa aber wischte das schnell weg, sie schüttelte den Kopf, lächelte. »Was hast du anderes erwartet? Das ist nicht Colonia und nicht Gent. Das ist Magus, und da es der Hauptort meines Gemahls ist, werde ich es lieben.«
Der schlecht befestigte Weg machte eine scharfe Linkskurve und führte dann in weitem Bogen auf die wenig mehr als mannshohe Palisade aus Holzstämmen zu, die den Ort schützte. Es waren kaum mehr als drei Dutzend Gebäude, die diese Befestigung zu schützen hatte. Die meisten lugten mit ihren bemoosten Reetdächern kaum über die Palisade hinaus.
Nur auf der gegenüberliegenden Seite des Ortes war als dunkler Schattenriss ein größeres Gebäude zu erkennen. Aus dem Kamin dieses steinernen Gebäudes quoll schwarzer Qualm und vereinte sich mit den Wolken.
Der Anblick des Ortes war wegen des Regens, der Wolken, der beginnenden Dämmerung noch trostloser. Genovefa wünschte sich, an einem strahlenden Sonnentag in ihrer neuen Heimat angekommen zu sein.
So als ob Sygifrid die Enttäuschung geahnt hätte, ließ er den Tross vor dem Durchlass der Palisade anhalten, wo der Weg in den Ort führte. Der Graf kam von der Spitze der Reisegesellschaft zurück zu Genovefas Wagen. Er sprang aus dem Sattel.
»Ich habe Golo vorausgeschickt. Die Leute sollen aus ihren Häusern kommen. Sie sollen sehen, wer ihre neue Herrin ist.«
Aus irgendeinem Grunde schien Sygifrid verärgert zu sein. In seinem Tonfall war nichts mehr von der Zärtlichkeit, mit der er sie zuvor angesprochen hatte.
Genovefa spürte ein leichtes Unbehagen, denn sie sah plötzlich einen ganz anderen Mann vor sich als den, den sie kennen- und lieben gelernt hatte.
»Was schaust du mich so an?«, fragte Sygifrid unsicher. Er versuchte zu lachen. »Es war ein langer Ritt«, sagte er wie entschuldigend. Er wirkte unkonzentriert und fahrig.
»Golo kommt zurück.« Ohne Genovefa weiter zu beachten, eilte er seinem Gefolgsmann entgegen. Er wechselte ein paar Worte mit ihm.
Golo nickte, schaute dann verstohlen zu Genovefa herüber. Die Gräfin spürte Häme in diesem Blick und vielleicht sogar Verächtlichkeit, aber sie sagte sich, dass dieser Eindruck nur Einbildung war nach den Strapazen der langen Reise.
Sygifrids seltsame Zornesanwandlung jedoch war ganz sicher keine Einbildung gewesen. Auch darin glich er dem Vater Genovefas.
»Ich fühle mich nicht wohl in meiner Haut«, flüsterte Bertrada, als der Tross sich auf das Handzeichen des Pfalzgrafen wieder in Bewegung setzte. »Es ist eine seltsame Stimmung an diesem Ort ... ich kann es nicht beschreiben.«
Sie legte die Hand auf den Unterarm ihres Schützlings. Genovefas Haut war ganz kalt. »Spürst du es nicht auch? Es ist als ob sich irgendetwas zusammenbraut.«
»Nun ist es aber genug mit deinem Gerede«, fuhr Genovefa die Amme heftiger an, als sie es eigentlich gewollt hatte.
Der Wagen rumpelte über einen Stein, so dass die Achse knackte. Bald erreichten sie den Durchlass der Palisade und kamen in den Ort. Die winzige Kapelle lag rechter Hand, dahinter mündete der Weg auf die mit riesigen Pfützen übersäte Hauptstraße, die den Ort von Nordosten nach Südwesten querte.
Ein Schlammloch, in dem streunende Hunde suhlten.
Bei der Kapelle stand eine Handvoll Frauen und Männer. Ohne seine Untertanen eines Blickes zu würdigen, ritt der Pfalzgraf an ihnen vorbei, bog dann nach links ab.
Plötzlich war Audoin wieder neben dem Wagen.
»Die Kirche des Heiligen Clemens«, deutete er auf die unscheinbare Kapelle. »Hinten ist die alte Römerbrücke über den Nyt, und auf der anderen Seite ist der Marktplatz. Danach kommt der Richtplatz und dann der Steinbruch.«
Vor einem großen Fachwerkgebäude in der Mitte des Ortes, gleich neben der Herberge, standen einige Männer, Frauen und Kinder, die selbst nach brabantischen Maßstäben gut gekleidet und wohlgenährt waren. Aus dieser Schar löste sich jetzt plötzlich eine junge Frau mit schwarzem Haar, eine auffällige Schönheit von hoher Gestalt. Sie lief auf den Pfalzgrafen zu, der soeben am Haus der Händler vorüberritt.
Bertrada tippte Genovefa an und machte sie auf die unerwartete Szene aufmerksam.
Audoin zügelte sein Pferd und schüttelte den Kopf.
»Was geht da vor?«, fragte die Amme den alten Kämpen, erhielt aber außer einem Achselzucken keine Antwort.
Genovefa beugte sich zu ihrer Amme hinüber, um besser durch die Fensteröffnung des Reisewagens schauen zu können. Sie machte ein gleichgültiges Gesicht, so als ginge sie das alles nichts an. Währenddessen wurde der Regen unvermittelt wieder stärker. Im Wagen war es klamm und kalt.
Zwischen dem Pfalzgrafen und der Schwarzhaarigen entspann sich ein kurzer Wortwechsel, aber im Wagen konnte man nichts davon verstehen.
Bertrada musterte ihre Herrin, so als erwarte sie einen Kommentar oder einen Ausdruck der Missbilligung.
Aber Genovefa schwieg.
Aus der Gruppe, von der sich die einheimische Schönheit gelöst hatte, kam jetzt ein alter Mann mit schwarzen Kleidern und einem bis auf den Bauch wallenden Bart, näherte sich unter Bücklingen dem Pfalzgrafen, legte den Arm um die Schwarze, versuchte sie fortzuziehen, und als die junge Frau nicht gleich reagierte, redete er heftig auf sie ein. Er hatte dabei einen Gesichtsausdruck, der wohl zornig sein sollte, es aber in Wirklichkeit nicht war.
Schließlich wandte sich der Pfalzgraf ab, trieb Aldebaran zum Weiterreiten an, während es dem Alten mit dem Vollbart endlich gelang, die Frau in den Schutz des Vordaches zurückzubugsieren, das auf gekalkten, dünnen Pfosten ruhte und unter dem Fässer, ein paar geschnürte Ballen und gestapelte Holzscheite lagerten. »Über die Römerbrücke am Weiher vorbei, dann kommt schon der Burgweg«, rief Audoin zu Bertrada herüber. Es kam Genovefa so vor, als ob er die Szene zuvor überspielen wollte, und sie fragte sich, warum die Stimme des alten Kämpen jetzt so erleichtert klang, und warum es ihr mit einem Mal so kalt war in dem Wagen, dass ihre Zähne zu klappern begannen.
»Reiß dich zusammen«, sagte sie zu sich selbst, aber so leise, dass selbst die Amme es nicht hören konnte. Bertrada machte jetzt ein resigniertes Gesicht und starrte teilnahmslos in das regenverhangene Tal von Magus.
Sie ließen die letzten Hütten der Siedlung hinter sich.
Genovefa versuchte, sich die schönen Tage nach der Hochzeit in Erinnerung zu rufen. Sygifrids unbeholfene Zärtlichkeit hatte ihn der Gräfin noch liebenswerter gemacht. Ihre Gedanken glitten zurück zu dem Zeitpunkt, als er sie am Morgen nach der ersten Liebesnacht auf die Arme genommen und freudestrahlend in der sonnendurchfluteten Gästekammer der väterlichen Burg umhergetragen hatte. Leicht wie eine Feder war sie sich vorgekommen und hatte die enorme Kraft Sygifrids bewundert. Alles war so anders als in der kalten Ehe ihrer Eltern.
Es machte sie traurig, dass diese Erinnerungen ihr nach so kurzer Zeit schon so merkwürdig blass und fremd vorkamen, so als sei es etwas, das sie nicht etwa selbst erlebt, sondern aus dem Munde anderer gehört hatte. Sie ärgerte sich über sich selbst, wischte ein paar Tropfen aus ihrem Gesicht, die seitlich zum Fenster hereingeregnet waren.
Sie widerstand der Versuchung, einfach den ledernen Rollvorhang herunterzuziehen und alles dort draußen für einen Augenblick wieder loszuwerden. Sie biss sich auf die Unterlippe, schimpfte sich ein undankbares, launisches Kind. Niemals würde Sygifrid unter solchen albernen Launen leiden müssen, schwor sie, während der Wagen den Burgweg hinaufächzte, wobei der Schlamm unter den wuchtigen Rädern gluckste und schmatzte.
III
Die Küche der Burg war rußgeschwärzt. Es roch nach Zwiebeln und nach Kohl. Der junge Küchengehilfe, ein Milchbart namens Martinus, hantierte an den gusseisernen Kesseln und fluchte ein übers andere Mal.
Genovefa lächelte zu Doraswinth hinüber, ein vergebliches Lächeln, war die alte Küchenmeisterin – die Vorgängerin von Richildis – doch so gut wie blind.
»Zu Ostern will ich etwas Besonderes auf dem Tisch haben«, sagte Genovefa, während Martinus am anderen Ende der Küche die großen Kessel mit Bimsstein zu reinigen versuchte.
»Ja, Ostern«, erwiderte die Alte. »Der Herr ist aufgestiegen in den Himmel, und seine Engel jauchzen und freuen sich über seine Heimkunft.«
Genovefa hatte das Gefühl, als sehe die alte Küchenmeisterin das Himmlische Jerusalem in der dunklen Umnachtung ihrer Blindheit leibhaftig vor sich; jedenfalls hatte ihre Stimme eine Vibration und Ergriffenheit, die schon nicht mehr von dieser Welt zu sein schienen.
»Ich will zu Ostern ein schönes Festmahl zusammenstellen. Wir haben Gäste. Der Graf soll zufrieden sein.«
»Und deswegen wollt Ihr selbst Euch darum kümmern?« Die Alte raffte ihr dunkelblaues Kleid zusammen und strich die dünnen Strähnen ihres schütteren, schlohweißen Haares aus dem Gesicht.
»Die Gastlichkeit des Hauses sind das Lob und die Ehre der Hausfrau«, lachte Genovefa. »Das weißt du genauso gut wie ich, Doraswinth, und deswegen frage ich dich.«
»Warum erkundigt Ihr Euch nicht bei Richildis, mein Kind?«
In Genovefas Gesicht malte sich für einen kurzen Augenblick ein Schatten ab. »Du kennst die Antwort selbst«, sagte sie schließlich leise.
»Ist es nicht besser geworden?« In der Stimme Doraswinths war jetzt echte Besorgnis. »Ich hätte es wissen müssen. Richildis wird sich niemals daran gewöhnen, dass sie nicht mehr die Herrin in der Burg ist.«
Genovefa zuckte mit den Schultern. »Wie dem auch sei«, versetzte sie mit fester Stimme. »In jedem Haus kann es nur eine Herrin geben.«
Grüblerisch zupfte die Alte an ihrem Kinn. »Ihr erweist mir Ehre, wenn Ihr nach meinem Rat fragt. Ich habe ihn Euch oft gegeben, und gerne.«
»Das weiß ich doch«, sagte die Gräfin abwiegelnd. »Mach dir keine Sorgen wegen Richildis. Ich kann ja verstehen, dass sie Angst hat um ihre Pfründe. All die Jahre ist sie so etwas wie die Frau im Haus gewesen, und keiner hat ihr hereingeredet ...«
Doraswinth hüstelte vielsagend. »Solche Frauen sind die schlimmsten. Wenn dann eine kommt, und nimmt ihren Platz ein, und entreißt ihr dann das Festmahl zu Ostern ...«
Die Alte schüttelte den Kopf.
»Ich habe dem Herrn gesagt, ich kümmere mich darum«, erwiderte Genovefa unwillig. »Und so wird es geschehen, ganz gleich, ob es Richildis gefällt oder nicht.«
»Aber gebt Obacht, Herrin«, erwiderte die alte Küchenmeisterin, die lange Jahre unter Sygifrids Vater treu gedient hatte und nun ihr Gnadenbrot auf Burg Magus fristete. »Richildis kann gefährlich sein, wenn sie ihre Intrigen spinnt ... Martinus!«, rief sie zur anderen Küchenseite hin. »Lauschst du schon wieder?«
Der Angesprochene zuckte schuldbewusst zusammen und schüttelte den Kopf.
»Bei dir weiß man nie, ob du das Schoßhündchen deiner Tante bist, oder ob du dein eigenes Süppchen kochst.«
»Genug davon«, wandte Genovefa ein. »Ich will jetzt mit dir über das Osteressen sprechen, und was bei diesem Festmahl auf den Tisch kommt.«
Eine Zeit lang beratschlagten nun die beiden ungleichen Frauen über die Speisefolge beim Festmahl, das zu Ostern im Saal der Burg stattfinden würde, und als diese Küchenangelegenheiten zur Zufriedenheit erledigt waren, wurde Martinus zur Ruhe geschickt. Fast unwillig verließ der Bursche das Gewölbe, in dem für die Bewohner der Burg gekocht wurde.
»Ich habe das Gefühl, Ihr habt noch etwas auf dem Herzen«, wandte sich Doraswinth schließlich an die Gräfin, als Martinus die Burgküche endlich verlassen hatte.
»Ich weiß nicht«, zögerte Genovefa.
Plötzlich lächelte die alte Küchenmeisterin. »Ihr wisst, dass meine Augen kaum noch erkennen, ob es Tag ist oder Nacht«, sagte sie leise. Im Licht der wenigen, blakenden Fackeln sah sie noch älter und runzeliger aus als sonst. »Es ist ein winziger Schimmer, den ich noch erkennen kann, eigentlich kaum mehr als eine Ahnung«, fuhr sie nachdenklich fort. »Alles andere ist Erinnerung an schöne Tage. Aber ich will mich nicht beklagen.«
Genovefa nahm die Hand der greisen Frau in die ihre. Die Hand war kalt.
»Und trotzdem, glaubt mir«, fuhr Doraswinth fort, »ich spüre ganz genau, wenn der Mond aufgeht und wenn er untergeht.« Sie machte ein verklärtes Gesicht. »Bemerkt Ihr sie nicht?«
»Was meinst du?«