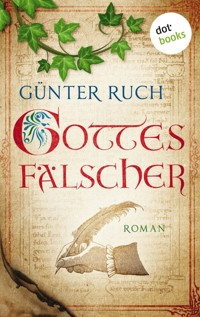Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mitreißend erzählt und perfekt recherchiert: Der fesselnde historische Roman »Das Geheimnis des Wundarztes« von Günter Ruch als eBook bei dotbooks. Wenn Glanz und Elend nah beieinander liegen … Köln im Jahre 1396. Während in den Häusern der Patrizier das pralle Leben tobt, geht im einfachen Volk die Angst vor der Pest um. In dieser aufgeladenen Stimmung müssen zwei Menschen alles daran setzen, die Vergangenheit hinter sich zu lassen, um für ihre Zukunft zu kämpfen: Die schöne Witwe Judith hat von ihrem einstmals reichen Mann neben hohen Schulden auch eine schreckliche Bürde geerbt; zur selben Zeit ist der Apotheker Matthäus gezwungen, im Geheimen einem grausamen Geschäft nachzugehen. Gibt es Hoffnung für die beiden? Doch dann spitzt sich der Streit zwischen den vermögenden Patriziern und den Vertretern der Zünfte immer weiter zu – es droht, zu einem schrecklichen Kampf zu kommen, dem niemand entfliehen kann! »Mit drastischen Schilderungen und Sorgfalt im Detail versteht es Ruch, eine gnadenlose Zeit heraufzubeschwören, in der sich alles um den Kampf ums Überleben dreht.« Deutsche Presseagentur Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der historische Roman »Das Geheimnis des Wundarztes« von Günter Ruch entführt Sie in die Zeit der sogenannten »Unblutigen Kölner Revolution« des Jahres 1396. Wer liest, hat mehr vom Leben! dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 774
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Wenn Glanz und Elend nah beieinander liegen … Köln im Jahre 1396. Während in den Häusern der Patrizier das pralle Leben tobt, geht im einfachen Volk die Angst vor der Pest um. In dieser aufgeladenen Stimmung müssen zwei Menschen alles daran setzen, die Vergangenheit hinter sich zu lassen, um für ihre Zukunft zu kämpfen: Die schöne Witwe Judith hat von ihrem einstmals reichen Mann neben hohen Schulden auch eine schreckliche Bürde geerbt; zur selben Zeit ist der Apotheker Matthäus gezwungen, im Geheimen einem grausamen Geschäft nachzugehen. Gibt es Hoffnung für die beiden? Doch dann spitzt sich der Streit zwischen den vermögenden Patriziern und den Vertretern der Zünfte immer weiter zu – es droht, zu einem schrecklichen Kampf zu kommen, dem niemand entfliehen kann!
»Mit drastischen Schilderungen und Sorgfalt im Detail versteht es Ruch, eine gnadenlose Zeit heraufzubeschwören, in der sich alles um den Kampf ums Überleben dreht.« Deutsche Presseagentur
Über den Autor:
Günter Ruch (1956–2010), wurde in Sinzig am Rhein geboren, studierte in Bonn mittelalterliche Geschichte und arbeitete später als Journalist, Grafiker, Fotograf und Autor.
Bei dotbooks erschienen außerdem Günter Ruchs hervorragend recherchierte und mitreißend erzählte historische Romane »Gottes Fälscher« und »Genovefa – Das Herz einer Gräfin«.
***
eBook-Neuausgabe Dezember 2018
Dieses Buch erschien bereits 2008 unter dem Titel »Der Krüppelmacher« im Verlag Philipp von Zabern.
Copyright © der Originalausgabe © 2008 by Verlag Philipp von Zabern, Mainz am Rhein
Copyright © der Neuausgabe 2018 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung von Bildmotiven von shutterstock/Artyzan, Morphat Creation und Hannah Kh
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-96148-438-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Das Geheimnis des Wundarztes« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Günter Ruch
Das Geheimnis des Wundarztes
Roman
dotbooks.
Faber est suae quisque fortunae.
(»Jeder ist seines Glückes Schmied.« – Sallust, epistula)
Prolog Über die Krüppelbettler
Die Krüppelbettler, die vom Volk auch die Klenker genannt werden, das sind die Bettler, die vor den Kirchen an allen Messtagen oder bei der Kirchweih herumlungern. Der eine hat zerschlagene Beine, der andere keinen Fuß oder kein Bein, der dritte keine Hand oder keinen Arm.
ITEM haben etliche von den Krüppelbettlern eiserne Ketten bei sich liegen und sprechen, sie seien unschuldig eingekerkert gewesen. Dem nächsten haben sie die Hand abgehauen im Krieg, wegen der Weiber oder wegen des Spiels. Manche verbinden ihre Beine und Arme und gehen auf Krücken, aber ihnen gebricht genauso wenig als anderen Menschen.
ITEM ein wahres Exempel: Zu Ostern saß einer vor der Kirche, der hatte einem, der am Galgen hing, das Bein abgehauen und hatte das Bein vor sich gelegt. Sein gesundes Bein hatte er hochgebunden. Derselbe ward mit einem andern Bettler uneins. Die Stadtgardisten kommen. Sobald er sie sieht, springt er auf und lässt das abgehackte Bein liegen. Der enttarnte Klenker läuft so schnell zur Stadt hinaus, dass selbst ein Pferd ihn kaum erlaufen hätte. Er ward hiernach in Aachen an den Galgen gehenkt, sie hatten ihm das Bein abgeschnitten und daneben gehängt, und er hat geheißen Peter von Kreuznach.
ITEM sind es die allergrößten Gotteslästerer, so man sie finden mag, die solches und desgleichen tun. AMEN.
Frei übertragen aus dem Liber Vagatorum (spätes Mittelalter)
I. Salzgasse
Mittwoch, 7. Juni 1395
Ja – jetzt lächelst du noch mit deinem welken dunklen alten Mund, dachte ich, und du versuchst angestrengt, mutig zu sein, und du bist auch ein bisschen trotzig. Du findest, dass du das hier eigentlich nicht verdient hast.
Bedauernswerte Hure!
Du lächelst tatsächlich noch. Tapfer!
Aber wenn ich dir gleich deine dürre rechte Hand abschneide, und wenn dein dünnes, verdorbenes Blut spritzt, wenn du dich vor Schmerzen windest und die Handfesseln dir ins Fleisch schneiden und wenn dann deine wenigen übrigen Zähne auf dem Beißholz knirschen, bevor du ohnmächtig wirst ... dann wird dir das Lächeln längst vergangen sein.
Ich bin nicht brutal und empfinde nicht den mindesten Hass, ich bin vielmehr ein gefühlloser und sozusagen unbeteiligter Beobachter meines eigenen Tuns. Ein Realist. Ich mache meine Arbeit. Ich habe nicht das Gefühl, dass mein Handeln gottlos ist. Wieso auch? Auch ein Metzger arbeitet nicht anders. Oder der Feldscher draußen auf dem Schlachtfeld.
Die allerwenigsten erleben bei vollem Bewusstsein das Ende dieser Arbeit, wenn ich die fachgerecht amputierte Gliedmaße – meistens eine Hand – in heißes Öl tauche, damit die Wunde sich verschließt, sich nicht entzündet und eitrig wird. Ich halte mir zugute, dass mir noch nicht ein einziger meiner Kunden auf dem Behandlungsbett gestorben ist, das in der Mitte meines Salzgassengewölbes steht. Das Bett ist schwarz vom Blut der Leute, die ich zu Krüppeln gemacht habe.
Ich nahm mein Chirurgenmesser, die Knochensäge, die Sehnenschere und die anderen Utensilien aus der großen inneren Tasche meines schweren Mantels und legte alles zurecht. Die Augen der alten Hure weiteten sich, ich sah es trotz des allenfalls fahlen Lichtes. Ich vermied es, in ihr Gesicht zu blicken. Ich kam mir in diesem Augenblick vor wie der Folterknecht, der seinem Opfer die Instrumente seiner Peinigung zeigt, ein Gehilfe des Henkers.
»Jetzt gibt es noch ein Zurück«, sagte ich beiläufig.
Die alte Hure aus der Schwalbengasse war schwer betrunken, zitterte mit ihren vor Angst weit aufgerissenen Augen, atmete schnell und flach, aber sie schüttelte den Kopf. Sie stank. Ihre Kleider standen vor Dreck. Um das Handgelenk trug sie die dünne rote Leinenschleife, mit der sich die Kölner Huren auf Beschluss des Rates seit ein paar Jahren selbst kennzeichnen mussten.
»Du musst mir bei Gott nur eines versprechen, Krüppelmacher«, keuchte sie.
Ich kann es nicht leiden, wenn man mich so nennt. Krüppelmacher. Aber es entspricht nun mal den Tatsachen.
Die Hure trank den nächsten Schluck Schnaps, um sich noch mehr zu betäuben. Je mehr Schnaps sie tranken, desto besser.
»Versprechen?« Ich schaute die Alte fragend an. »Hm? Was soll ich dir versprechen?«
Ich ekelte mich vor der heruntergekommenen Schäbigkeit der verbrauchten Frau, vor ihrer räudigen, grauen Haut, die mit etlichen Flohstichen übersät war, vor ihrer schwarzen Mundhöhle, in der nur noch eine Handvoll gelber, spitzer Zähne übrig war. Ihr Atem stank furchtbar. Das einzige Schmuckstück der Armen war ein billiger Armreif aus Blech am linken Handgelenk. In den schäbigen Kleidern und den dünnen, stumpfen Haaren hausten Heerscharen von Läusen. Ich war ihr letzter Ausweg. Ich sollte ihr helfen, zukünftig als Krüppel betteln zu gehen und damit ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
Ich war froh, dass ich meine Arbeit nur im Geheimen verrichtete, im Auftrag des Capitano, und dass mir niemand dabei zuschauen konnte. Es war für mich überlebenswichtig, dass keiner der ehrsamen Bürger dort draußen eine Ahnung davon hatte, was ich tat und womit ich einen erheblichen Teil meines Lebensunterhaltes verdiente – hinter der Fassade des frommen Winkelapothekers vom Malzbüchel.
»Du versprichst mir bei deinen Eiern, dass du verdammt noch mal kein Mitleid mit mir haben wirst, hast du verstanden, Pinkel? Schwör es bei den Titten von Maria Magdalena!« Sie versuchte ein krächzendes Lachen.
Ihre Derbheit und Heruntergekommenheit stießen mich ab. Sie sprach die schäbigste Sprache der Gosse. Aber so waren die meisten meiner Kunden. Letzte Station Krüppelmacher, und dann der Tod. Ich drehte den Kopf etwas beiseite, damit ich ihrem schlimmen Mundgeruch entkam. Ich fragte mich, was mein Eheweib Esstgen sagen würde, wenn sie wüsste, womit ich mir hier die Hände schmutzig machte. Bei Gott, vermutlich würde sie darüber hinweg sehen, weil es Geld in unseren Säckel brachte, und sie würde mich noch ein Stückchen mehr verachten.
»Glaub mir, das kann ich dir versprechen«, erwiderte ich kalt. »Ich werde kein Mitleid mit dir haben. Mit dir genauso wenig wie mit allen anderen vorher.«
Das Schlimmste daran war, dass es tatsächlich stimmte.
Stille.
Die Hure auf dem Bett in meinem Kellerloch in der Salzgasse, in dem sie früher Salzheringe in große Fässer eingelegt hatten, setzte noch mal die irdene Flasche Branntwein an. Je betrunkener sie war, desto weniger würde sie von den schrecklichen Schmerzen spüren, wenn ich ihr auftragsgemäß die halbe rechte Hand abschnitt, damit sie glaubhafter und somit erfolgreicher betteln konnte. Wenn sie dem biederen, frommen Bürger an der Treppe zum Domportal ihren Handstumpf entgegenstreckte, sah der genau, dass sie ein echter Krüppelbettler war, ein Klenker, und dass es sich um eine echte Amputation handelte und um nichts Vorgetäuschtes. Der normale Kölner Bürger entlarvte jede vorgespielte Verkrüppelung durch bloßes Hinschauen. Dazu gab es zu viele falsche Krüppel. Bei weitem am besten verdienten die echten Krüppel, denen man genau ansah, dass nichts vorgegaukelt war. Ihnen waren eigene Plätze an den Portalen der angeblich dreihundertfünfundsechzig Kirchen und Kapellen zugewiesen, die es im Heiligen Köln gab.
Ich kratzte mich an meinem kurzen Kinnbart, der in den letzten Monaten um so vieles weißer geworden war, ich erinnerte mich vage an das Würfelspiel vom Abend zuvor, zuerst im Kirchen-Bräues – dem Brauhaus Heinrich zur Krähe, in der Salzgasse genau gegenüber meinem Krüppelmachergewölbe – und dann im Gaffelhaus am Himmelreich, und dass ich dabei mehr Geld gelassen hatte, als es für meine augenblickliche geschäftliche Situation in der Apotheke gut war. Anders gesagt, war ich wieder einmal nahezu zahlungsunfähig. Ich haderte Tag für Tag mit Gott, dass meine Lage stets so misslich war. Ich spürte genau, dass es ungerecht war, Gott für meine eigenen Fehler verantwortlich zu machen. Aber es war so einfach. Die Verantwortung irgendwo abzuladen war immer der einfachste Weg.
Ich legte meinen Flintstein zwischen Daumen und Zeigefinger, klemmte den Zunderschwamm dazwischen und schlug mit allem so lange gegen den Feuerstahl, bis der Schwamm glühte. Die Hure setzte die irdene Flasche ab. Sie zitterte und atmete stoßweise, während ich meine Vorbereitungen vorantrieb. In ihren Augen flackerte das Licht des kleinen, aber heißen Kohlenfeuers, auf dem ich das Öl erhitzen würde. Ich fachte die Kohlen mit meinem kleinen Blasebalg an, den ich ständig bewegen musste, damit die Gluthitze groß genug wurde, um das Öl zum Sieden zu bringen. Das konnte, wie ich wusste, einige Zeit dauern. Ich hatte mich inzwischen an den Gestank gewöhnt, den die Hure verströmte.
Die ahnte anscheinend, wofür ich den kleinen eisernen Topf mit dem Öl erhitzte: »Damit brennst du es nachher aus, Pinkel?«, fragte sie mit schwerer Zunge und nahm einen weiteren tiefen Schluck des billigen Fusels, den sie mitgebracht hatte.
»Ja. Es muss sein. Aber red nicht so vorwurfsvoll. Ich mach das ja schließlich bei keinem, der es nicht selbst will. Alle sind damit einverstanden.«
In einer der dunklen Ecken meines verliesartigen Gewölbes in der Salzgasse – es schien immer noch nach den Heringen zu stinken, die hier jahrzehntelang eingesalzen worden waren – raschelte es.
Ratten.
Immer wieder Ratten.
Ich hasste sie, so wie jeder Stadtbewohner. Ich konnte sie zwar nicht sehen, aber ich wusste, sie waren da, besonders hier im Hafenviertel, in der Nähe des Rheins. Die Ratten: Sie waren immer in der Nähe, unsichtbar, heimtückisch, angriffslustig, wie eine ständige Bedrohung.
»Krüppelmacher, du bist doch vorsichtig?«, fragte die Hure mit zitternder Stimme. Auch wenn sie ihre Gefühle nicht zeigen wollte, so spürte ich sie doch ganz intensiv. Ihre Angst lag in der Luft, zusammen mit dem penetranten Geruch ihres Schweißes. »Du tust mir doch nur so weh, wie es sein muss?«
»Der Capitano hat dich nicht zum Vergnügen hierher geschickt«, erwiderte ich abweisend und prüfte im fahlen Tageslicht, das durch das winzige Kellerfenster des Rattenloches hereindrang, noch mal meine Instrumente. Mich erinnerte jede Verkrüppelung, die ich durchführte, an das Schlachtfeld und an Meister Johann Lobesetzer, den alten kölnischen Feldscher. Bei dem hatte ich vor zwanzig Jahren in den Feldschlachten vor den Toren von Köln mein blutiges Handwerk gelernt, bevor ich dann die schon in die Jahre gekommene Esstgen heiratete und Apotheker wurde.
»Wie heißt du, Quacksalber?«
»Wieso willst du das wissen?«
»Würdest du denn nicht auch wissen wollen, wer dir die Hand abschneidet?«
Ich zuckte mit den Schultern, dann zog ich das Beißholz aus meiner Ledertasche und reichte es ihr. »Ich heiße Matthäus.«
»Hm ... Matthäus ...« Sie schloss die Augen, so als dächte sie über meinen Namen nach. Plötzlich erschien mir mein eigener Name unheimlich. Ich schüttelte diesen plötzlichen Anflug seltsamer Gedanken aber schnell wieder ab. »Ich bin die Magdelin«, sagte sie plötzlich, so als würde es alles erträglicher sein, wenn ich als der Schlächter und sie als das Opfer einander mit Namen kannten. »Früher hatte ich rote Haare«, fügte sie wehmütig hinzu. Ich konnte nicht mehr richtig verstehen, was sie sagte, weil sie so viel getrunken hatte, um sich zu betäuben. Dann schloss sie die Augen.
»Ich werde dich jetzt festbinden.«
»Festbinden?« Sie fuhr hoch. »Davon hat Lauritz mir nichts gesagt.«
Ich drückte sie zurück auf die schäbige Pritsche. Ich scheuchte die lästigen Schmeißfliegen weg. »Es geht nicht anders.« Die zahlreichen dunkelbraunen Flecken auf der wollenen Decke erinnerten an ähnliche Amputationen, die ich in den letzten beiden Jahren in meinem Kellerloch vorgenommen hatte – seit der Capitano, der Großmeister der Kölner Unterwelt, mich eingekauft hatte, um meine alten Kenntnisse als Feldscher für seine Zwecke zu nutzen. »Du würdest wild um dich schlagen«, erklärte ich. »Alles würde nur noch viel schlimmer.«
»Ich sehe es an deinen Augen«, stieß die Hure hervor. »Du bist ein gottloser Mensch.«
»Kein Mensch ist ohne Gott«, versetzte ich müde. »Den einen ist Gott nah, und den anderen ist Gott fern. Das ist der Unterschied, verstehst du?«
»Dir ist Gott sehr fern.«
»Kann sein«, erwiderte ich nachdenklich, aber auch gleichgültig. »Ich weiß es nicht.«
»Ist auch egal«, sagte die Hure trotzig. »Mach weiter.«
Ich zurrte die Stricke um ihre Arme und die Fußgelenke ganz fest. Ich erkannte an den Augen der alten Hure aus der Schwalbengasse, dass ihr klar wurde, es wurde jetzt ernst. Man sah immer, wenn meine Opfer begriffen, dass es ernst wurde – diese Erfahrung hatte ich als Krüppelmacher gemacht.
»Ich bin bereit«, sagte Magdelin. Sie schaute mir in die Augen: »Gott ist mir genauso fern wie dir. Aber ich fürchte ihn. Ich habe Angst vor der Hölle.«
Ich nickte und nahm ihr das Beißholz aus der Hand und steckte es in ihren beinahe zahnlosen Mund.
Ich wusste, dass ihr Herzschlag jetzt raste. Sie war schweißgebadet, obwohl es in meinem Krüppelmacher-Gewölbe kalt und klamm war. Ich wusste, wie hilflos und ausgeliefert sie sich fühlen musste, so wie ich sie dort angebunden hatte.
»Ich werde jetzt ganz schnell machen«, sagte ich hastig. Ich nahm das Feldschermesser, das ich von Meister Johann Lobesetzer erhalten hatte, als er mich zu einem fertigen Wundarzt erklärte, in jenen fernen jungen Tagen. Andere hätten es als ein Schlachtermesser bezeichnet.
Dann tat ich, wofür ich bezahlt wurde.
Ich nahm die Hand der alten Hure in meine Hand. Die Alte starrte mich mit weit aufgerissenen Augen an, dann nickte sie und biss auf das Holz. Sie konnte kaum noch geradeaus blicken, so betrunken war sie. Ich spürte plötzlich Mitleid mit Magdelin, aber dieses Gefühl konnte ich mir in meinem Beruf einfach nicht leisten.
Ich setzte an. Der Stahl drang zwischen dem Zeige- und dem Mittelfinger der linken Hand in das Fleisch ein.
Blankes Entsetzen in den Augen der Alten.
Kein Schmerz, den sie jemals gefühlt hatte.
Dann schrie sie.
»Still«, wies ich sie an. »Beiß auf das Holz!«
Ich wusste, wie irrsinnig es war, so etwas von ihr zu verlangen. Ich hatte auf dem Schlachtfeld Männer gesehen, die bei weniger Schmerzhaftem wie am Spieß gebrüllt hatten. Ich traf mit dem Stahl des Feldschermessers auf die Knochen des Mittelfingers, und während das Geschrei Magdelins in sich selbst zu einem erbärmlichen Gewimmer zusammensank, und ich Angst bekam, dass sie ihre eigene Zunge verschluckte, ertastete ich die Lücke des Fingergelenkes, wo ich den Finger ohne Säge abtrennen konnte.
Das war einfacher und ging schneller.
Wie ich es hasste, dass ich von oben bis unten mit Blut bespritzt wurde! Die meiste Zeit ging für das Säubern danach drauf. Es durfte ja niemand sehen, dass ich als Chirurg und Wundarzt gearbeitet hatte. Ich war Apotheker, da war es mir von unserem Rat strikt untersagt, zugleich als Arzt tätig zu sein. So war es in Köln. Überall war alles untersagt, alles war reguliert, keiner konnte einen Furz lassen, ohne dass eine Gaffel oder ein Amt oder eine Zunft oder der Erzbischof ihren Segen dazu gaben.
Sofort sammelten sich die widerlichen Aasfliegen um das Blut, so als hätten sie gewusst, dass es fließen würde. Es schien tausend verschiedene Arten von Schmeißfliegen in Köln zu geben, von ganz kleinen harmlosen bis hin zu den ekelhaften, fetten blauen Brummern, deren Berührung nach dem Glauben des Volkes alles Fleisch verdarb.
Die vor Entsetzen geweiteten Augen von Magdelin suchten meine, aber ich konzentrierte mich auf meine Schnitte. Ich hatte genau vorausgeplant, wie ich Magdelin verstümmeln wollte. Der Zeigefinger sollte übrig bleiben, denn damit konnte sie als Bettlerin auf diejenigen deuten, die ihr nichts oder zu wenig gegeben hatten. Den Mittelfinger schnitt ich am Stumpf ab, aber beim Ringfinger und beim kleinen Finger musste auch die Handwurzel mit daran glauben, damit es beim Betteln dramatisch genug wirkte und sofort als echt erkennbar war.
Magdelin war inzwischen ohnmächtig geworden. Keiner übersteht das bei klarem Bewusstsein. Das Beißholz fiel aus ihrem erschlafften Mund. Sie furzte so laut und so ekelhaft, dass ich mich beinahe übergeben hätte. Immer wieder fachte ich mit dem kleinen Blasebalg das Kohlenfeuer an, über dem das Öl erhitzt wurde.
Draußen hörte man lautes Stimmengewirr, und obwohl am Hafen von Köln immer viel Betrieb war, kam mir die Stadt an diesem schäbigen, feuchtkalten Dienstag in einem weiteren der tristen Jahre unter König Wenzels Herrschaft noch unruhiger vor, als sie es ohnehin schon war. Schon auf dem Weg von meiner Winkelapotheke Zum Schwanenstein hierher in die Salzgasse war mir das aufgefallen.
Die Leute rotteten sich an allen Straßenecken zusammen. Überall wurde lautstark diskutiert, und alle waren unzufrieden: mit dem Rat, mit der Kirche, mit den Zünften, mit den Gaffeln und natürlich mit dem Wetter. Maulende Unzufriedenheit war zwar eines der Wesensmerkmale der Kölner, genauso wie ihre selbstzufriedene Großkotzigkeit, aber ich hatte den Eindruck, dass sich der Ärger und der Missmut immer mehr aufbauschten. Manchmal wurde sogar gegen die Kirche und ihre vielen Besitztümer und Sonderrechte gelästert. Irgendwann – und es würde nicht mehr allzu lange dauern – würde dieser Topf überkochen wie heiße Milch. Der Blick der Menschen war ... aggressiv, gewaltbereit, beleidigt, gereizt. So als läge eine neue Weberschlacht in der Luft. Viele erinnerten sich noch an die Straßenkämpfe und blutigen Scharmützel mit den vielen Toten, die die Stadt vor einem Vierteljahrhundert erschüttert hatten, lange bevor ich durch die Heirat mit Esstgen einer ihrer Bürger geworden war. Die Weberschlacht war die zweite große Erschütterung, die die Stadt Köln nach der Pest durchgerüttelt hatte wie bei einem Fieberanfall.
Das Leben in Köln würde niemals wieder so unschuldig sein wie in den sehnsüchtigen Erzählungen aus der Zeit vor der großen Pest, mit der Gott uns vor einem Menschenalter heimgesucht hatte. Die Pest trennte die Geschichte unserer christlichen Menschheit in ein Vorher und ein Nachher, die beide kaum miteinander in Verbindung zu stehen schienen. Jetzt hatten wir den trunksüchtigen, unfähigen König Wenzel zum Herrscher, dahingegen rühmten sich die Ahnen einst der Herrschaft eines Kaisers Barbarossa oder eines Karl des Großen. Wir Heutigen hatten die Finsternis – die Altvorderen hatten das Licht. Die Welt war in stetem Niedergang begriffen.
Ich war mit den Gedanken ganz woanders. Ich dachte daran, dass Esstgen mir gesagt hatte, ich solle vom nahen Fischmarkt eine Barbe für unsere heimische Küche mitbringen. Ich mochte Fisch nicht besonders, und musste mich jedes Mal überwinden, ihn hinunterzuwürgen. Fisch war aber immer noch besser als zu hungern. Die Hure, die vor mir lag, hatte in letzter Zeit oft gehungert. Man sah es ihrem ausgemergelten Körper an. Sie zuckte trotz der tiefen Schmerzohnmacht heftig zusammen, als ich ihr in die Handwurzel hineinschnitt. Mit dem Messer kam ich jetzt nicht weiter.
Aus der erschlafften rechten Hand der armseligen Magdelin nahm ich die fast leere Branntweinflasche, setzte sie selbst an und stürzte den gesamten Rest in einem Zug hinunter. Wie das in der Kehle brannte! Billigster Fusel! Und trotzdem schluckte ich ihn gierig. Und ich war sogar froh, dass ich in dem dickbauchigen Tonkrug in meiner Ledertasche noch weiteren Nachschub hatte. Immer, wenn ich als Krüppelmacher arbeitete, soff ich viel mehr, als mir gut tat.
Ich nahm die Säge, um die Handwurzel zu durchtrennen, und wischte zwischendurch das Blut ab, das immer dünner aus der tiefen Wunde rann, die ich der Hure zugefügt hatte. Es musste jetzt schnell gehen, damit Magdelin mir nicht verblutete. Ich kannte mich aus. Nachdem ich meinem heimatlichen Dorf den Rücken gekehrt hatte, hatte ich nicht umsonst als Feldscher bei Johann Lobesetzer gelernt, und ich beherrschte dieses blutige Handwerk noch immer wie im Schlaf. Irgendwie hatte der Capitano davon Wind bekommen. Ich hatte das Gefühl, es gab nichts zwischen Bayenturm und Eigelstein, das ihm entging, wer auch immer er im wirklichen Leben war.
Mit tat der Arm weh. Ich hatte keine Lust mehr, den Blasebalg zu betätigen. Das Öl auf dem Kohlefeuer war hoffentlich heiß genug, und ich fand die Wärme, die das kleine, glühende Kohlefeuer in meinem Rattenloch verbreitete, jetzt sehr angenehm nach all der knochenkalten Feuchtigkeit draußen in den Kölner Gassen.
Das Brandmarken und Versiegeln der Wunden mit dem heißen Öl war der Abschluss der Schlächterei, die ich mit Magdelin veranstaltete, nur damit sie nachher umso glaubwürdiger betteln konnte und für ihre alten Tage ihren Lebensunterhalt verdiente.
Ich nickte zufrieden. Ich war selbst schon betrunken.
Ein forderndes Klopfen. Ich zuckte zusammen. Ich konnte es nicht leiden, wenn die Leute das Capitano so laut gegen die Türe pochten.
»Wartet!«
Da waren schon die beiden kräftigen jungen Burschen, die Magdelin im Auftrag des Capitano wegtransportieren würden. Ich fand es immer wieder beeindruckend, wie gut der Capitano alles organisierte, und ich hätte einiges darum gegeben, wenn ich seine wahre Identität hätte erfahren dürfen. Aber dann, so sagten mir alle sieben Sinne, hätte ich vermutlich nicht mehr lange zu leben.
Die Knochensäge und die Sehnenschere taten ihre Arbeit. Schon auf dem Feld, als junger Bursche, als ich – ohne jede Ahnung vom wahren Leben – bei Meister Lobesetzer als Lehrling begann, hatte mich das Geräusch entsetzt, wenn man einen menschlichen Knochen durchschneidet und wenn der Gepeinigte dabei, längst ohne Besinnung, mit den Zähnen knirscht, sofern er sein Beißholz verloren hat. Meister Lobesetzer war als Wundarzt in den zahllosen Fehden der Stadt Köln eine Legende, und weil sein Vater und mein Vater miteinander verwandt waren, nahm er mich aus meinem kleinen Heimatdorf Stotzheim in der Voreifel mit, damit ich seinen Beruf erlernte und ihn – der ohne Sohn geblieben war – dereinst beerben sollte.
So hatte es sich tatsächlich zugetragen, und trotzdem war in den Jahren danach alles anders gekommen, als ich es hätte ahnen können. Jetzt war ich neununddreißig Jahre alt und der Winkelapotheker im Haus Schwanenstein am Malzbüchel, gleich hinter dem Heumarkt, ich war der verhasste Schwiegersohn von Goswin Anraidt und der verachtete jüngere Ehemann von Esstgen Anraidt.
Es klopfte von Neuem. »Ihr habt wieder alle Zeit der Welt gepachtet, Krüppelmacher«, rief eine freche, junge Stimme. Ich kannte den jungen Mann mit dem Glatzkopf, wusste aber nicht seinen Namen. Er hatte ein interessantes Gesicht, doch ich traute ihm nicht. Er hatte eine finstere Ausstrahlung. Ich vermutete, er sei ein übler Kerl. Er war oft dabei, wenn ich etwas für den Capitano erledigte. Wahrscheinlich musste ich auf der Hut sein vor ihm, aber nicht heute.
»Ich schneide noch, verdammt!«, antwortete ich mit betont gereizter Stimme. Keiner war mehr freundlich in Köln, und die alten Leute sagten, dass diese Grobheit Einzug gehalten hatte, als Gott die Menschheit mit der Pest überzogen hatte. Seit es dieses Fegefeuer von Abertausend Toten gegeben hatte, hatten die Lebenden die Lust an Nettigkeiten verloren. Der Totentanz war der Tanz, zu dem jetzt alle die Beine schwangen. Alle Menschen fürchteten Gott und den Tod mehr denn jemals zuvor.
»Schneidet nicht zu lange, Meister«, murrte eine ebenso unwirsche Stimme durch die geschlossene Türe.
»Ich bin fast so weit. Aber glaubt ja nicht, dass ich den Wundsegen weglasse.«
»Dann mach aber schnell mit deinem Wundsegen.«
Natürlich würde ich den nicht weglassen, das verstanden auch die Männer dort draußen. Schon als junger Wundarzt auf den Schlachtfeldern rund um Köln fand die Versorgung der Verwundeten immer auf zweierlei Weise statt: Durch das Schneiden mit dem Messer und durch das Aussprechen des Wundsegens, mit dem man die Hilfe Gottes herbeiflehte. Von einem Feldscher erwartete man das.
»Ich segne dich, böse Wunde, mit dem Kreuzeszeichen.« Ich schlug ein Kreuzzeichen. Das gehörte an dieser Stelle zu dem Wundsegen dazu. »Du sollst nicht schwären und nicht schwellen und du sollst nicht tropfen und nicht fließen und nicht faulen und nicht säuern und nicht stinken, und du sollst nicht quälen und keine Schrecknis aufgeben. Ob Fliegengeschmeiß, Mücken, Würmer, Maden, Spinnen oder andere Plagen: Was dieser Wunde schädlich ist, das möge gebannt sein mit diesen Worten, so wahr mir Gott helfe, im Namen des Vaters, der Sohnes und des Heiligen Geistes.«
Ich seufzte. Ich glaubte nicht recht an diese Segenssprüche, von denen ich ein gutes Dutzend auf Lager hatte. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ein allmächtiger, ewiger Gott sich von solchen menschlichen, tausendfach dahergesagten Sprüchen beeinflussen ließ. Aber ich hätte jede Verkrüppelung als unvollkommen empfunden, bei der ich nicht wenigstens einen Segensspruch zur Heilung der Wunde rezitiert hätte. Und wer sonst würde den Segen Gottes und der Heiligen für die Wunde der Verkrüppelten erbitten, wenn nicht ich, der Krüppelmacher? Es war eine heilige Pflicht, die ich auf den Schlachtfeldern rund um Köln kennengelernt hatte, als ich meinem alten Meister Johann Lobesetzer folgte, und auch später, als ich selbst ein blutjunger Wundarzt war.
Die Blutungen hatten nachgelassen. Die alte Hure würde es schon schaffen. Nun ging wirklich alles ganz schnell. Ich versiegelte die Wunde in meinem Öl, ließ die jungen Männer ein und war froh, als sie die besinnungslose Magdelin hinausschafften und auf einen Eselskarren legten, als wäre sie ein Sack Stroh. Ich legte die irdene Branntweinflasche auf Magdelins Bauch, die eines ihrer wenigen irdischen Besitztümer war.
Aber sie war weg, weg aus meinen Augen, und ich hatte sie fast schon wieder vergessen.
Ich hatte noch eine letzte Aufgabe, dann konnte ich mein Rattenloch verlassen und das große Schloss zusperren: Ich musste das Feuer löschen, alles Blut wegwischen und meine Siebensachen zusammenpacken, und dann würde ich mich zum Hafen begeben und mich dort treiben lassen.
II.Sturzgeburt
Montag, 30. August 1395
Es war stockfinstere Nacht. Draußen ging ein leichter Sommerregen nieder. Die Stadt schwieg still. Judith, die junge adelige Herrin im Hause des welken kölnischen Patriziers Richwinus Hirzelin, war im achten Monat schwanger. Sie lag wie fast in jeder Nacht wach, halb aufgerichtet in dem großen, holländischen Ehebett, das nach Art der Patrizier von einem prächtigen, gewobenen Stoffhimmel überwölbt war. Es glich ein wenig dem Bett, das sie zu Hause vor ein paar Jahren im Namen ihres Vaters nach hartem Feilschen für billiges Geld von einem so gut wie zahlungsunfähigen trierischen Händler erworben hatte, der in Ahrweiler gestrandet war und der seine teuren Waren um vier Fünftel verhökern musste, um an klingende Münzen zu kommen. »Du bist aber ein geschäftstüchtiges, junges Burgfräulein«, hatte der Händler erstaunt gesagt. Nachher hatte man seinen Leichnam schwer aufgedunsen in der Ahr gefunden, und keiner hatte gewusst, ob er sich selbst ertränkt hatte, oder ob ihm doch ein christliches Begräbnis zustand.
Das riesige, ganz aus Stein gebaute Herrenhaus der Familie Hirzelin am Kölner Altermarkt kam Judith von Ahrweiler, die jetzt eine Judith Hirzelin war, manchmal vor wie ein Sarg. Der Mann, der neben ihr in ihrem Ehebett lag, war ihr mehr denn je fremd, und sie spürte, dass er ihr immer unzugänglich bleiben würde. Was wusste sie schon von ihm?
Ein ziehender Schmerz im Unterleib.
Sie hatte vor allem Angst. Richwinus Hirzelin schnarchte. Judith sah im dunkelgrauen Licht der Nacht die vagen Konturen ihres Gemahles neben sich unter der großen Decke. Einen Augenblick lang dachte sie, wie es wäre, wenn er tot wäre. In dieser Nacht hatte er wieder heftig geschwitzt und sich bewegt. Er sah nicht gut aus. In der Finsternis sah sie wenigstens nicht, wie alt und hässlich er war. Er glich einem alten Truthahn, meinten die Leute. Aber Judith hatte den kölnischen Patrizier nicht geheiratet, weil er ein hübscher junger Adonis gewesen wäre, sondern weil ihr verarmter Vater, Burggraf Gerhard von Ahrweiler, glaubte, dass ihm das Geld des Schwiegersohnes aus seiner beständig schlechter werdenden finanziellen Lage heraushelfen könnte. Man dichtete im Rheinland allen kölnischen Patrizierfamilien ein riesiges Vermögen an, und wenigstens das Haus am Altermarkt entsprach allen Erwartungen, die Judith an den irdischen Reichtum ihres Gemahles gehegt hatte. Wenn man so wollte, dann hatte sie Gerhard Hirzelin aus berechnender Habsucht geheiratet, und aus keinem anderen Grund.
Judith spürte, dass ihr schlecht wurde, und der Schmerz nahm schnell zu, wurde beißender, heftiger. Sie hatte Angst und sprach ein Gebet an die Heilige Ursula, die sie von allen Kölner Heiligen am liebsten mochte. Nicht dass sie ängstlich gewesen wäre, aber in ihrem Körper geschah etwas, das sie nicht kannte, das ihr nicht geheuer war. Neues Leben war gewachsen. Bald würde das Kind aus ihr herauskommen.
Durch die drei offen stehenden, zum Innenhof hin liegenden Kemenatenfenster strich ein kühler Luftzug herein. Das tat ihr gut. Sie hatte sehr unter der spätsommerlichen Bruthitze der letzten Tage gelitten und die große Kemenate des Hauses kaum verlassen, die im dritten Stockwerk gleich unterhalb des Geschlechterturms lag.
Sie hatte viel Zeit zum Nachdenken gehabt. Würde sie es länger als ein paar Monate an der Seite des zwiespältigen Richwinus Hirzelin aushalten, der so viele gegensätzliche Charakterzüge hatte? Der finster und harmlos zugleich wirkte? Der manchmal südländisch temperamentvoll und manchmal eiskalt war? Würde sie jemals die Fremdheit überwinden, die sie ihm gegenüber empfand? Würde sie sich irgendwann mit allem abfinden?
Sie kannte wenige Menschen, die sich so schnell, so schwer und so grundlos aufregen konnten wie ihr Gemahl. In dem Jahr seit der prächtigen Hochzeit mit Richwinus in der Stiftskirche Groß Sankt Martin hatte sie sich damit vertraut machen und abfinden müssen, dass Meister Hirzelin – der ehrsame Stadtrat und Kaufmann, der schon etliche Ämter in der Kölner Stadtregierung innegehabt hatte – von überaus cholerischer und aufbrausender Natur war. Ein Mann, der sich nicht zu beherrschen wusste und dessen unsympathische Galligkeit auch leicht in Grausamkeit und leichtfertige Brutalität umschlagen konnte.
Richwinus Hirzelin schob das auf sein angebliches italienisches Temperament, denn seine Familie beanspruchte, von den alten römischen Senatoren abzustammen, die dereinst in der Colonia Agrippina das Sagen gehabt hatten. Judith hatte sich außerdem daran gewöhnen müssen, dass es in Richwinus Wesen keine Zärtlichkeit oder auch nur eine Andeutung zarterer Gefühle gab. Sein prächtiges, weißes Pferd unten im Stall jedenfalls liebte er mehr als jeden Menschen. Das Einzige, das er fürchtete, war Gott.
Judith hasste die tiefen Runzeln um seine Augen und die rauen, geröteten Hautfalten an seinem Hals, wegen denen man ihn »den Truthahn« nannte. Sie hasste seinen vorspringenden Schmerbauch. Sie hasste seine Ignoranz und Großspurigkeit, hasste seine aggressive Frömmigkeit und die Art, wie er mit ihr redete, wie er sie anschaute und dass er beim Reden sabberte. Sie hasste es vor allem, wie er sie anfasste und wie er mit ihr schlief, wenn er denn einmal dazu im Stande war. Sie hasste es sogar, wenn er freundlich zu ihr war. Sie ertappte sich mindestens einmal am Tag bei dem Gedanken, dass sie ihrem Gemahl mit dem »italienischen Geblüt« den Tod wünschte.
Judith merkte, wie die immer stärker werdende Übelkeit ihren ganzen Bauch beherrschen wollte. Was war los mit dem ungeborenen Kind, das sie unter dem Herzen trug? Ihr Herz pochte. Irgendetwas stimmte nicht, sie spürte es. Gott im Himmel, was war das? Die flammenden Schmerzen in ihrem Unterleib wurden von Minute zu Minute stärker ...
***
Zehn Minuten später war der ganze Haushalt aufgescheucht. Richwinus hatte seinen teuren, seidenen Morgenmantel in Türkis-Gold übergezogen. Sein gelichtetes, graues Haar stand in alle Richtungen ab. Seit er wusste, dass seine junge Gemahlin schwanger war, war er sicher, dass sie ihm den ersehnten Sohn und Erben schenken würde. Dementsprechend machte er alle verrückt. Vor der Tür der Kemenate standen ein halbes Dutzend Diener und Mägde mit Fackeln und Lampen. Die Obermagd Clothildis, die im Hause das eigentliche Regiment führte, ließ sich aber durch die Aufgescheuchtheit des Herrn nicht aus der Ruhe bringen. Sie entzündete mit einem Kienspan die Kerzen in der Kemenate. »Setzt Euch erst mal hin auf Euer Bett, Herr«, riet Clothildis im fürsorglichen Tonfall einer Mutter. »Ihr wisst doch, dass Ihr Euer Herz schonen sollt!«
Die herrische Obermagd gehörte seit ewigen Zeiten zum Haus der Hirzelins, sie war schon Richwinus' verstorbenem Vater zu Diensten gewesen, und sie hatte schon immer das hässliche, breite Gesicht mit dem Damenbart gehabt. Eines ihrer Augen triefte. Die Nase war groß und rot, und sie hatte ein fliehendes Kinn. Das stumpfe Haar, das unter der Haube hervorquoll, war grau und strähnig. Clothildis war Judiths böser Geist. Wenn sie nicht wäre, dachte die neunzehnjährige Tochter des Burggrafen von Ahrweiler, dann wäre ihr ganzes Leben in Köln tausendfach erträglicher gewesen. Judiths Gemahl glaubte, dass ohne sie sein Haushalt zusammenbrechen würde. Er hatte nicht einen Gedanken daran verschwendet, dass seine junge Gemahlin vielleicht den Haushalt selbst würde führen können. Es gab keinen Menschen, den Judith mehr hasste. Clothildis war ein rotes Tuch für die junge Herrin. Aber der Herr stand hinter ihr.
»Ich glaube, es geht wirklich jetzt los«, keuchte Judith.
»Hol die Hebamme, Clothildis«, befahl Richwinus.
»Die Hebamme? Seid Ihr sicher, Herr?« Clothildis musterte Judith ungläubig. »Eigentlich ist sie noch nicht so weit.«
Die junge Herrin stöhnte und keuchte. Die Schmerzen wurden von Augenblick zu Augenblick schlimmer, und unbeherrschbarer. »Ja. Die Hebamme, schnell. Verdammt! Mach schon!«
»Worauf wartest du denn noch, Clothildis? Los, hol Gunhila!«
»Wie Ihr meint, Herr. Ich hole sie selbst.«
Das Ziehen im Unterleib wurde immer schmerzhafter. Waren das tatsächlich schon die Wehen? Es war ihr erstes Kind, Judith wusste es nicht. Es war jedenfalls so, als würde jemand mit einer glühenden Zange in ihre Eingeweide hineinfahren. Sie wollte dieses Kind und betete jeden Tag zu Sankt Ursula, dass es lebend und gesund auf die Welt käme. War es ein Sohn, so wäre ihre Stellung als Herrin des Hauses Hirzelin nahezu unangreifbar. Dann hatte Gott sie zur Mutter des Erben einer patrizischen Familie gemacht, die zu den fünfzehn Geschlechtern gehörte, ohne die in Köln gar nichts geschah. Sie hatten in der Stadt das Sagen. Daran hatte Judith von Ahrweiler, die jetzt eine Hirzelin war, durchaus Gefallen gefunden, wenn sie auch in vielen Dingen enttäuscht und ernüchtert war.
Es tat so weh! Judith konnte sich nicht zurückhalten, sie begann zu schluchzen. »Gott, das sind solche Schmerzen«, stöhnte sie.
Richwinus Hirzelin beugte sich sorgenvoll über seine junge Frau. »Was ist los, Kind?«
»Die Schmerzen«, presste Judith hervor. »Es sind diese schlimmen Schmerzen.« Dann stöhnte sie erneut auf.
»Gunhila wird bald da sein«, redete Richwinus beruhigend auf sie ein. »Hast du denn starke Wehen?«
»Ich weiß nicht ... mir ist so heiß ... ich bekomme kaum Luft. Ich muss irgendetwas tun.« Sie machte Anstalten, das Bett zu verlassen. Richwinus versuchte unbeholfen, sie daran zu hindern. »Du darfst jetzt nicht aufstehen. Warte doch, bis Clothildis mit Gunhila zurück ist.«
»Nein, nein, es geht schon«, stieß Judith mit schmerzverzerrter Stimme hervor. »Ich knie mich nur vor das Bett, ich habe das Gefühl, dann wird es besser.« Sie hechelte. Die Übelkeit wollte nicht weichen. Sie betete zu Sankt Ursula um Erlösung.
In diesem Augenblick stürmte die Hebamme Gunhila zusammen mit der Obermagd Clothildis in die Kemenate.
»Wann hat es angefangen?«, fragte Gunhila grußlos, während sie die Ärmel hochkrempelte. Sie kam sich offenbar sehr wichtig vor. Sie schien eine etwas weniger hässliche Zwillingsschwester von Clothildis zu sein.
»Vor nicht mal einer halben Stunde«, antwortete die Obermagd.
Gunhila verschränkte ihre Arme vor der Brust. »Herrje! Und da macht Ihr einen solchen Aufstand, Clothildis?«
»Ich?« Die Obermagd zuckte mit den Schultern und deutete mit ihrem Kinn zu Richwinus.
»Selbst wenn das Kind tatsächlich kommt, kann das noch Stunden dauern. Na ja. Männer«, meinte Gunhila. »Alle sind sie gleich, ob Knecht, Handwerker, Kaufmann oder Patrizier.« Als Hebamme hatte sie Tag für Tag mit dem neuen Leben und oft genug auch mit einem frühen Tod zu tun. Sie brachte die jungen Menschlein auf die Welt, da war sie es gewohnt, sich mehr herausnehmen zu können als eine andere Magd. Sie stemmte die Arme in die Seite. »Also gut. Ich würde sagen, wir regen uns jetzt alle erst einmal ab, und Ihr, junge Frau ...«
Judith verharrte noch immer in ihrer Hockstellung vor dem holländischen Bett, und Richwinus stand aufgeregt neben seiner jungen Gemahlin. Sie hatte den alten Mann, den sie wegen ihres Vaters geheiratet hatte, noch nie so erlebt. Jetzt, da es um sein Kind ging, zeigte er zum ersten Mal Gefühle. Überraschenderweise milderte das Judiths heftige Schmerzen.
»Ihr legt Euch besser wieder flach auf das Bett, Herrin. Ihr, Herr Hirzelin, seid mir hier nur im Wege. Und Ihr, liebste Clothildis, sorgt für warmes Wasser, Seife und einen Haufen Tücher.«
Richwinus schien geradezu aufzuatmen, dass er aus der Verantwortung entlassen war. Er half Judith, zurück ins Bett zu kehren.
»Gut so, Herr! Wir werden Euch rufen, wenn wir Euch wieder brauchen«, erklärte die resolute Hebamme. »Betet für Eure Gemahlin. Und selbst wenn es laut wird, bleibt Ihr trotzdem draußen!«
»Ich warte im Rittersaal«, murmelte Richwinus Hirzelin und verließ die Kemenate in seinem türkis-goldenen Seidenmorgenrock.
Clothildis rief mit ihrer schrillen, durchdringenden Stimme nach einer der Hausmägde. Es war Marie. Die schien draußen vor der Türe gewartet zu haben und nahm nun die Weisungen der Obermagd entgegen.
»Und bring einen kleinen Krug Hefeschnaps mit, Mädchen«, befahl Gunhila.
»Hefeschnaps?«, fragte Clothildis erstaunt.
»Nicht für Eure Herrin, sondern für mich.«
Kaum war Marie draußen, schrie Judith laut auf: »Gott im Himmel! Alles ist nass auf dem Bett! Alles läuft aus mir heraus.« Sie drehte und wand sich vor Schmerzen. Auf der Überdecke des patrizischen Ehebettes breitete sich ein dunkler Fleck aus.
»Nichts Besonderes. Das ist das Fruchtwasser, in dem das Kind schwimmt«, wiegelte die Hebamme ab. Sie war die Ruhe in Person. »Das heißt noch gar nichts. Und außerdem bin ich ja jetzt hier.«
Die junge Hausmagd Marie und eine zweite Magd brachten, was die Hebamme geordert hatte: einen ganzen Berg trockener Tücher, das heiße Wasser, Seife, den Hefeschnaps. Die beiden jungen Dinger verließen die Kemenate nicht, ohne zuvor einen ebenso neugierigen wie besorgten Blick auf ihre Herrin Judith geworfen zu haben, die vor Schmerzen wimmerte. An ihren Blicken sah man, dass die jungen Mägde die neue Herrin des Hauses Hirzelin liebten und bewunderten. Sie schlossen die Kemenatentüre hinter sich.
»Und jetzt schnell runter mit den Kleidern!«, sagte Gunhila. Die beiden alten Frauen packten gemeinsam an, sie lösten die Bänder, öffneten die Knoten, zogen Judith das Nachtgewand aus. Die war viel zu sehr mit ihren Schmerzen beschäftigt, als dass sie sich vor den alten Frauen geschämt oder geekelt hätte. Judith war froh, das nasse Zeug los zu sein. Aber ihr war plötzlich kalt, als sie dort so vollkommen nackt lag.
»Putzt Eure Herrin mit den trockenen Tüchern ab. Schließt dann die Fenster. Wir wollen doch nicht, dass sie sich eine Lungenentzündung holt.«
Clothildis nickte. Die Hebamme schmierte ihre rechte Hand mit einer kupferfarbenen Salbe ein, die sie aus ihrer ledernen Tasche hervorgeholt hatte. Dann drückte sie Judiths Beine weit auseinander, schob ohne weitere Vorwarnung ihre ganze Hand resolut in die weit geöffnete Scheide der Hausherrin und tastete darin herum. Judith bekam das alles kaum noch mit, so stark waren in diesem Augenblick die Wehenschmerzen.
»Heilige Muttergottes!«, erschrak die Hebamme. »Herrje! Der Muttermund ist schon ganz geweitet. Ich spüre den Kopf. Wer glaubt's denn! Es ist gleich so weit.«
»Himmel! Etwa eine Sturzgeburt?«, stieß Judith hervor.
»Sagen wir, fast eine Sturzgeburt, Herrin. Zwei, drei, fünf Wehen noch, höchstens zehn, dann kommt es.« Gunhila machte ein Kreuzzeichen. »So Gott will.« Die Hebamme kramte in der ledernen Tasche, die sie mitgebracht hatte, und zog ein Amulett hervor. »Hier, Clothildis, hängt es der Herrin um den Hals.«
»Stimmt etwas nicht?«, keuchte Judith, während die Obermagd sie mit den trockenen Tüchern abrieb.
»Keine Sorge, Kind. Wir wollen nur sicher gehen. Die meisten Sturzgeburten gehen Gott sei Dank glimpflich aus.«
»Die meisten? Glimpflich?« Judiths Augen waren geweitet vor Angst und Schmerz. Sie fürchtete um das Leben ihres Kindes, und um ihr eigenes.
Die Zeit dehnte sich.
Die Schmerzen, die sie jetzt hatte, schienen ihren Körper zu zerreißen. Heilige Ursula, heilige Jungfrau Maria, helft mir, dachte sie in einem fort. Sie konzentrierte sich auf den Schmerz, sie versuchte, ihn als Teil eines ganz natürlichen, gottgewollten Vorgangs zu verstehen und ihn auf diese Weise zu beherrschen. Das gelang für kurze Zeit, dann aber brach sich der Schmerz wieder in all seiner brutalen Wirklichkeit Bahn. Judith glaubte die ganze Zeit, dass sie eine höhere Stufe des Schmerzes nicht mehr bewältigen konnte, und dennoch musste sie es – wieder und wieder. Sie hätte nicht geglaubt, dass man solche Schmerzen aushalten konnte. Ob es ähnlich schlimm war, wenn man den kriegsverwundeten Männern ein Bein oder einen Arm abnahm? Sie schwor sich, dass sie das niemals wieder erleben wollte, und wenn sie in ein Kloster gehen müsste.
»Richtet Euren Oberkörper etwas auf, setzt Euch hier auf die Kissen. Ihr müsst pressen, hört Ihr? Pressen!«, rief die Hebamme. »Nehmt die Arme nach hinten und haltet Euch am Kopfende des Bettes fest, seht Ihr ... es ist ganz leicht.«
»So?«
»Genau so. Wenn Ihr Euch festhaltet, könnt Ihr besser Druck aufbauen in Eurem Körper.«
»Ich kann nicht«, schrie Judith.
»Keiner außer der Herrgott kann das jetzt noch aufhalten«, erwiderte die Hebamme gleichmütig. »Ob Ihr könnt oder nicht, ist egal. Ihr müsst können. Hört Ihr? Euer Kind ist gleich da.«
»Ich kann nicht mehr.«
»Und ob Ihr noch könnt. Ihr macht das besser als so manche andere Frau.«
»Jetzt spüre ich, wie es rauskommt.«
»Ja. Ich seh schon das Köpfchen«, rief die Hebamme und fasste beherzt zu. »Noch mal pressen, stärker! Clothildis, halte das andere Bein fest!«
»Ich hab es.«
»Also los. Pressen und durchatmen, pressen und durchatmen, pressen und durchatmen. Gut macht Ihr das. Jetzt aber! Ich hab den Kopf.«
»Aber ich kann doch kein Blut sehen«, jammerte die Obermagd plötzlich.
»Macht Euch doch nicht lächerlich! Achtung ... jetzt hab ich es!« Gunhila zog das Kind hinaus aus der Mutter in die Welt und hielt es für einen kurzen Augenblick wie im Triumph hoch. »Seht Ihr es?«
»Alles in Ordnung?«
»Alles in Ordnung. Alles dran. Dem Himmel sei es gedankt! Gut gemacht, Kind. Und seht Ihr das hier? Das ist ein kleiner Pimmel. Ihr habt mit Gottes Hilfe dem Haus Hirzelin einen Erben geboren.«
Judith nickte abwesend. Alles drehte sich. Ein Sohn ...
Die Hebamme nahm eine saubere Schere aus ihrem Lederbeutel und durchtrennte die spiralig gewundene, blutige Nabelschnur am Bauch des Kindes. »Die brauchen wir jetzt nicht mehr«, meinte sie. Gunhila hielt das winzige, blutige Neugeborene an den kleinen Beinen hoch und gab ihm einen Klaps. Dann besprengte die Hebamme das Kind mit Wasser. »Weihwasser«, sagte sie. »Der Teufel soll die Finger von dem Kind lassen.«
Das Kind hatte Lebenswillen. Sofort begann es aus vollem Hals zu schreien. Die Hebamme lachte zufrieden.
»Nehmt Ihr jetzt das Kind, Clothildis. Wascht es gründlich ab.«
»Mein Gott, wirklich, hallelujah, es ist wahrhaftig ein Sohn«, rief Clothildis aus, als sie den neugeborenen Jungen in Empfang nahm, so dass es gewiss auch die Dienerschar hören konnte, die sich auf dem Gang vor der Kemenate versammelt hatte.
Von draußen waren Jubelrufe zu hören.
»Er ist zwar etwas klein geraten, aber alles ist dran«, sagte Gunhila zufrieden. Sie machte Segenszeichen über dem Kind und nahm aus ihrer Tasche geweihte Palmblätter, mit denen sie das Neugeborene am Kopf, am Bauch und an den Füßen berührte, um böse Geister von ihm fernzuhalten.
»Heilige Ursula ... danke. Und danke, heilige Jungfrau Maria«, stammelte Judith. Dann verließen sie für einen Augenblick ihre Sinne.
»Lasst, das macht nichts. Wascht nur weiter den Jungen! Das tut ihr gut, wenn sie mal wegtritt. Sie ist gleich wieder da.« Die Hebamme reinigte ihre Hände und trank dann den Krug Hefeschnaps in einem Zug aus.
Clothildis rief Marie herein. Die strahlte vor Glück, als sie den Sohn sah. »Hol den Herren! Sag ihm, er hat einen Erben!« Dann entdeckte Marie die ohnmächtige Mutter.
»Herrje!« Sie verschloss ihren Mund mit der hohlen Hand. »Was ist mit der Herrin?«
»Es geht ihr gut«, beruhigte die Hebamme die Magd. »Gott hat ihr eine starke Natur gegeben. Sie muss sich nur ein bisschen ... ausruhen.«
Wie zu einer Bestätigung dessen schlug Judith die Augen auf Sie sah ihren Sohn. Clothildis hatte das Blut weggewischt. Für einen Augenblick schien die Obermagd ihre Rivalität vergessen zu haben. Sie legte den Sohn auf den Bauch der jungen Mutter.
Die junge Marie klatschte in die Hände. »Ich laufe und hole den Herrn.«
Gunhila lächelte zufrieden. Gute Arbeit, dachte sie. Eine Sturzgeburt war schnell verdientes Geld. Sie musste noch auf die Nachgeburt, den Mutterkuchen, warten, denn die stand ihr als Hebamme zu. In den Apotheken der Stadt machte man daraus alle möglichen Tränke und Salben. Sie wollte nicht wissen, was, aber es brachte immer ein paar Denare extra ein.
III. Das Brennpulver
Samstag, 9. Oktober 1395
Ich schlug die schwere Holztüre meines Laboratoriums hinter mir zu, so dass die eisernen Beschläge klirrten und das ganze Kellergewölbe davon widerhallte. »Ehrlich, du kannst mir den Buckel herunterrutschen!«, bellte ich zornig hinter meinem Eheweib her. »Verschwinde nur, und am liebsten würde ich dich nie wieder sehen.«
»Ha, den Gefallen werd ich dir gerade tun!«, keifte meine bessere Hälfte durch die geschlossene Türe. Ich schwor, ich würde sie verprügeln, wenn sie die jetzt öffnete und mich nicht endlich in Ruhe ließ. »Ich wünsche dir die Pest an den Hals! In der Hölle sollst du schmoren! Ich geh zu Merg. Ich esse dort zu Mittag.«
»Um Himmels Willen, geh wohin du willst!«
Ich hörte ihre Schritte auf der Treppe, die hinauf in den Garten führte, und dann das Krachen der Türe, durch die man den Laden erreichte, meine Winkelapotheke, in der mein Gehilfe Rohloff die Stellung hielt. Endlich war ich allein. So wie es mir in letzter Zeit normalerweise am liebsten war. Mir ging es nicht gut. Ich wollte niemanden sehen, keinen Menschen. Ich fühlte mich hundeelend und haderte mit Gott, weil er es zuließ, dass mein Leben mit solcher Mühsal verbunden war.
Die alltägliche Ordnung, in die ich eingebunden war, war mir verhasst – auch wenn ich immer genug zu essen und zu trinken hatte, was weiß Gott keine Selbstverständlichkeit war. Mir drehte sich der Magen um, wenn ich nach Hause in die Apotheke kam. Manchmal hatte ich sogar das Gefühl, lebendig begraben zu sein. Die Alpträume, in denen ich in den Schlund der Hölle hinabgezogen wurde, kamen jetzt öfter und wurden intensiver. Ich wusste, dass meine Krüppelmacherei sowohl gottlos war, als auch gegen die Gesetze der Stadt Köln verstieß. Dieses Schuldbewusstsein hing wie eine ständige, düstere Wolke über meinem Leben. Mein Verhältnis zu Gott war seit meiner Jugend schwierig. Ich hasste und ich fürchtete ihn, und wenn ich genug getrunken hatte, dann hielt ich ihm sogar jetzt noch die trotzige Stirn entgegen. Mit genug Wein im Blut wurde ich zum Gotteslästerer, ungeachtet der Tatsache, dass alle glaubten, der Teufel hole den Todsünder, der gegen das erste der zehn Gebote verstieß, auf der Stelle zu sich hinab. Ich lachte über die Höllenangst und schwang mit meinen gleichfalls betrunkenen Saufkumpanen großspurige Reden: »Wir treffen uns in der Hölle zum Würfelspielen mit Beelzebub.« Ich pfiff darauf, dass ich ein Todsünder war. Ich hatte zwei Weißpfennige verspielt? Egal – auch wenn Esstgens neuer Gürtel bei Meister Konrad immer noch darauf wartete, abgeholt zu werden. Wenn schon, prost! Die Bedrohung durch Gottes letztes Gericht – was ging mich das an? Das war eine Sache der Pfaffen und der Kirche, der Frauen und der Kinder.
Das schale Erwachen am nächsten Morgen war immer böse. Von unerklärlicher Angst erfüllt, die mein Rückgrat entlang kroch. Im Laufe der Zeit gab es keinen Morgen mehr, an dem ich nicht mit diesem mulmigen Gefühl erwachte, auch wenn ich am Abend zuvor weder gesündigt noch gar Gott gelästert hatte. Das war wie eine ständige Bedrohung, unter der mein Leben stand. Ich hatte Angst vor Gottes Zorn, und verachtete mich zugleich für meine Feigheit. Hin- und hergezogen verharrte ich schließlich in freudloser Trägheit.
Ich fühlte mich zu Zeiten wie Hiob, der vom Allmächtigen mit immer neuen Plagen heimgesucht wird. Eine dieser Plagen war mein Eheweib. Seit Tagen stritt ich mich mit ihr wegen Geld, Geld und noch mal Geld und wegen meiner angeblichen Unfähigkeit, unseren Laden gedeihlich zu führen. Heute hatte mein Weib besonders schlechte Laune, den ganzen Vormittag.
Gut, dass sie endlich weg war.
Ich war froh, dass ich Rohloff hatte. Mein Gott, was hätte ich ohne ihn gemacht?! Ich hätte nicht gewusst, wie ich meine ungeliebte Arbeit ohne ihn hätte schaffen sollen. Anfangs hatte ich noch geglaubt, der blondgelockte Junge wäre ein bisschen blöde und träge, damals, als seine Mutter, die in der nahen Rheingasse in einer schäbigen Zinswohnung hauste, ihn mir im Alter von ungefähr zwölf Jahren brachte: ein etwas dicklicher, unbeholfener und schwerfälliger und sehr frommer Junge mit einem kleinen Kopf und schlechten Glubschaugen, die er immer zusammenkneifen musste, wenn er etwas erkennen wollte. Dass die Augen eigentlich von einem schönen Blau waren, passte gar nicht zu ihrer Verkniffenheit. Die blonden Engelslocken standen in einem seltsamen Kontrast zu seinem einfältigen Gesicht. Rohloff sprach von Anfang an nicht viel. Aber er war fleißig, und er verstand, worauf es ankam. Und vor allen Dingen war er mir vom ersten Tag an so treu ergeben wie ein Hund, und er versuchte, mir jeden Wunsch von den Lippen abzulesen. Ich vermutete, dass er so anhänglich war, weil sein vorheriges Leben schrecklich und qualvoll gewesen sein musste. Rohloff verlor über seine Eltern und die Vergangenheit niemals ein einziges Wort.
Es war im Jahre des Herrn 1391, als Rohloff zu mir kam, vor vier Jahren. Jetzt war Rohloff fast erwachsen, und wenn er auch immer noch so unscheinbar wirkte wie zuvor, so hatte er doch trotz seiner Einfältigkeit nach und nach immer mehr Verantwortung in meinem Apothekerhaus am Malzbüchel übernommen. Anno Domini 1391, das war das Jahr, als der umtriebige Patrizier Hilger Quattermart in einem Handstreich die Schöffen beim Hochgericht ausgeschaltet und die Richerzeche aufgelöst hatte, diese Vereinigung alter Männer, die sich stets im Hintergrund gehalten hatte und meinte, alles in Köln bestimmen zu können.
Ich schüttelte den Kopf. Meine Gedanken kehrten in mein Laboratoriumsgewölbe zurück. Ich betrachtete die Substanzen, die ich vor mir auf dem schartigen Werktisch ausgebreitet hatte. Ein halbes Dutzend Unschlittlampen verbreiteten genügend Licht in dem Kellergewölbe, das sich unterhalb meines Hauses erstreckte und das man nur durch den Seiteneingang aus dem schmalen Apothekengarten mit dem Brunnen erreichen konnte. Es war ein zweigeteilter Keller: Auf der einen Seite der Laboratoriumsraum oder die Offizin, auf der anderen Seite der Stall, in dem mein Maultier und meine drei Schweine untergebracht waren. Außerdem lebte noch ein halbes Dutzend Stück Geflügel hier und in meinem Hinterhof. Getrennt waren die beiden Kellerhälften durch einen engen Gang, in den die schmale Treppe aus dem Garten mündete.
Eine der Substanzen gab mir Rätsel auf. Man nannte sie Salpeter, und sie wurde in Viehställen und Schlachthäusern gesammelt, wo sie sich aus der Pisse der Tiere bildete. Ich erhitzte mit dem Blasebalg die Holzkohle in der runden, ummauerten Feuerstelle meines Laboratoriums. Ich erinnerte mich daran, dass mein Meister Gerlach behauptet hatte, mit Salpeter und Holzkohle ließe sich ein Pulver mischen, das beim Anzünden gewaltige, wunderschöne Funken versprühte und blendend hell verbrannte. Das hatte meine Phantasie entzündet, und ich hatte mir überlegt, ob man ein solches Brennpulver nicht verkaufen könnte – vielleicht als Fastnachtsspaß.
Ich konzentrierte mich. Wenn ich mit den alchimistischen Stoffen arbeitete, vergaß ich Gott und die Welt ringsum. Der Salpeter stank ähnlich wie die Schweinepisse im Stall gegenüber. Es war ein geheimnisvolles Wunderland, das Gott mit der Welt der unterschiedlichen Stoffe geschaffen hatte. Eine Erkenntnis, die mir in den vielen Jahren gekommen war, in denen ich schon mit meinen Substanzen experimentierte – meistens nach den Methoden, die mir mein Lehrmeister, der Apotheker Niklas Gerlach, beigebracht hatte. Das waren die alchimistischen Arbeiten, bei denen ich etliche der Produkte herstellte, die ich in meiner Winkelapotheke gut verkaufte: Ich destillierte Weine und Liköre, ich stellte Gerlachs Elixier her, »die köstlichste der Arzneien«, die sich immer noch gut verkaufte, weil die Leute an ihre verjüngende Wirkung glaubten. Ich verarbeitete Blut, Eierschalen, Dotter, benutzte die Nachgeburt der Frauen und das Körperfett hingerichteter Mörder, und ich stellte natürlich Theriak her, das angeblich aus fünfzig Substanzen besteht, darunter Opium und das Fleisch frisch getöteter Vipern ... Aber wo bekam ich im Heiligen Köln des Jahres 1395 Opium und frisch getötete Vipern her?
Der Theriak.
Dick und braun war mein Theriak, wie es sich gehörte, und nicht gerade billig, aber es bestand aus kaum mehr als einem knappen Dutzend Stoffen, aus Honig, dunkler Heilerde aus dem Ahrtal, Wasser, Essig, Salz sowie aus Tauben-, Mäuse- oder Hasenkot, die darüber hinaus auch gegen Verstopfungen und Harnverhaltungen, aber auch als Aphrodisiakum und als Haar- und Bartwuchsmittel zu gebrauchen waren.
Ich kochte den Salpeter und das Kohlepulver, ohne recht zu wissen, was ich damit eigentlich anfangen wollte. Dann presste ich die graue Substanz durch ein grobmaschiges Tuch, so dass sie die Feuchtigkeit verlor. Zum endgültigen Trocknen breitete ich den dunkelgrauen, etwas grobkörnigen Brei auf meinem Laboratoriumstisch aus. Ich ließ mir Zeit dabei. Nur nicht nach oben, in den Verkaufsraum! Es gab Tage, da konnte ich keinen Kunden sehen. Am liebsten war es mir dann, wenn ich ganz alleine war, hier in meinem Laboratorium. So ein Tag war heute.
Ich überlegte. Die Brennwirkung des Pulvers, das ich aus Salpeter und Holzkohle hergestellt hatte, begnügte sich mit einem kraftlosen, blaugrauen Aufleuchten. Ich setzte mich auf meinen Schemel und atmete tief durch. Irgendetwas stimmte nicht. Ich musterte die Regale, die zwei Wände des Laboratoriums bedeckten. Zahlreiche Holzbüchsen, große und kleine Krüge, Dispensiergefäße und Destillierkolben, Zinnkannen für Sirup, Büchsen für Salben, Blechflaschen für Säfte, irdene Krüge für Öle und Wasser standen dort aneinander aufgereiht – das ganze Arsenal und Erbe meines Meisters. Ich hatte jedes einzelne der Gefäße mit dem allegorischen Wappen meines Hauses, dem Schwan, versehen, und außerdem hatte ich mit Kreide den Inhalt jedes Gefäßes bezeichnet.
Mein Blick blieb an dem Krug mit dem Schriftzug SULFUR hängen, in dem ich den Schwefel als hellgelbes Pulver aufbewahrte. Mein verhasster Lehrmeister, der alte Apotheker Niklas Gerlach, hatte so geheimnisvoll getan. Er behauptete damals, dass die heidnischen Araber die Funken sprühende Donnersubstanz erfunden hätten und dass sie in Köln vor über hundert Jahren zum ersten Mal von dem Erzalchimisten Albertus Magnus benutzt worden wäre. Aber er hatte herumgedruckst und mich nicht darüber aufgeklärt, was sie außer Salpeter und Holzkohle vom Stinkbaum noch enthielt. Wahrscheinlich hatte er es selbst nicht gewusst.
Schwefel. Warum blieb mein Auge ausgerechnet am Schwefel hängen? Schwefel war ein Brennstoff. Schwefel war eine der grundlegenden Substanzen, mit denen die Apotheker und Alchimisten hantierten. Es war eine Substanz des Lebens und des Todes. Es verbrannte mit blauer Flamme und erzeugte dabei einen stechenden Geruch, der einem die Sinne rauben konnte.
Rohloff pochte lautstark an die Laboratoriumstüre. Ich zuckte zusammen. Hatte ihn gar nicht kommen hören.
»Herr!«, rief mein Gehilfe. »Meister Matthäus, darf ich hineinkommen?«
»Was ist denn los?«
»Ist der Ordenbach, Herr. Er macht Rabatz!«
»Mist!« Ich stöhnte auf. »Komm rein!« Peter von Ordenbach, mein Lieferant für Latwerge und andere wichtige Grundstoffe, die ich mehr schlecht als recht oder gar nicht selbst herstellen konnte. Er war etwas jünger als ich, ich konnte ihn eigentlich gut leiden und sprach gerne mit ihm. Aber jetzt schuldete ich ihm Geld, ziemlich viel Geld, und ich hatte augenblicklich nun wirklich nicht genug in der Schatulle, um diese Schulden auf der Stelle zu begleichen.
Rohloff stand verlegen an der Laboratoriumstüre und drehte eine Locke seines blonden Haares um den Zeigefinger. »Er sagt, er geht nicht wieder aus dem Laden.«
Ich lachte, schüttelte den Kopf, ging zum Regal und nahm das Behältnis mit dem Schwefel, stellte es auf den Tisch.
»Weißt du, was das ist?«
»Er will nicht gehen, bis er nicht jeden Heller gesehen hat, den wir ihm schulden.«
»Das ist Schwefel, Rohloff, Schwefel.«
»Aber Herr! Was ist mit dem Ordenbach?«
»Es ist der Geist, das nicht brennende Feuer, das männliche feurige Prinzip.«
Rohloff machte ein Kreuzzeichen. »Ich gehe hinauf und sage ihm, dass ... dass ...«
»... dass ich kurz davor stehe, Blei in Gold zu verwandeln ...«
Rohloff stöhnte auf. Für ihn waren solche Experimente Teufelswerk, und nur weil er mich als seinen Herren so sehr liebte, ertrug er es, darin verwickelt zu sein. Die seltsamen blauen Glubschaugen in seinem kleinen Kopf traten noch mehr hervor als sonst. »Das könnt Ihr doch nicht wirklich, Herr?«, fragte der Junge ängstlich.
Ich lachte lauthals. »Wenn ich das könnte, meinst du, dann würde Ordenbach dort oben stehen und auf sein Geld warten?«
»Ich weiß nicht, Herr.«
»Oje! Manchmal stellst du dich ganz schön blöd an.«
»Ja, Meister.«
»Sag ihm ... warum sagst du nicht einfach, ich wäre nicht da?«
»Das hab ich ja versucht.«
»Du kannst eben nicht lügen. Versuch es trotzdem noch mal, hörst du? Lauf hinauf, sag ihm, ich wäre in die Stadt gegangen ... Außenstände einzutreiben.«
»Welche Außenstände denn?«
»Sei doch nicht so schwer von Begriff! Geh einfach hinauf und sag es ihm!«
Rohloff machte ein unglückliches Gesicht, weil er eigentlich nicht gerne lügen wollte, nickte dann aber und verschwand. Die Tür meines Laboratoriums ließ er halb offen stehen.
Ich hustete, und hatte wieder dieses Schwindelgefühl, das in letzter Zeit häufiger auftrat, als mir lieb war. Ich vermutete, dass es mit den Spanischen Fliegen zu tun hatte, die sehr beliebt waren als Potenzmittel. Ich hatte vorgestern ein Dutzend von ihnen zerkleinert und pulverisiert, und wie immer hatte der beißend scharfe Gestank meine Augen zum Tränen gebracht und mir das Atmen erschwert. Ich hatte wieder kotzen müssen und Durchfall bekommen, aber ich nahm das in Kauf, weil ich für das Pulver der Fliegen viel Geld verlangen konnte.
Ich versuchte, mich zu konzentrieren, aber es gelang mir nicht, meine finanziellen Nöte zu vergessen. Ich verscheuchte die Schmeißfliegen. Das lästige Ungeziefer kam vom gegenüberliegenden Stall. Auch Ratten und Mäuse waren in meinem Gewölbe keineswegs seltene Gäste.
Wenn es mir geschäftlich so schlecht ging wie jetzt, dann fühlte ich mich besonders einsam und gottverlassen. Niemals zuvor hatte ich so deutlich gespürt, dass ich als ein Kaufmann in Geldnöten in Köln ganz schnell zu einem verachteten Außenseiter wurde. Nichts war schlimmer als blank zu sein – auch wenn ich, im Gegensatz zu vielen anderen, ärmeren Zeitgenossen in der Stadt, wenigstens nie hungern musste und ein gutes Dach über dem Kopf hatte.
Der Capitano hatte mir seit geraumer Zeit meinen Lohn nicht mehr bezahlt. Monate. Er schuldete mir das Geld für elf Verkrüppelungen und etliche andere Behandlungen, bei denen ich in meinem Kellerloch als Wundarzt für seine Leute tätig geworden war. Alles in allem machte das vier Gulden aus, also sage und schreibe einhundertzwanzig Weißpfennige. Klingende Münze. So viel wie ein Handlanger beim Dombau im Jahr verdiente. Viermal der monatliche Pachtzins, den ich meinem Schwiegervater Goswin Anraidt für meine Winkelapotheke am Malzbüchel hinlegen musste. Geld, das ich dringender denn je benötigte. Sollte ich den Capitano vielleicht vor den Gewaltrichter zerren, um das Geld einzuklagen?