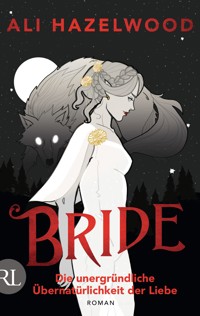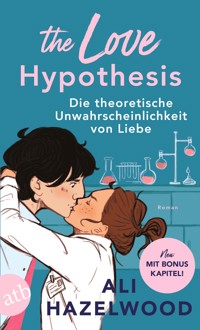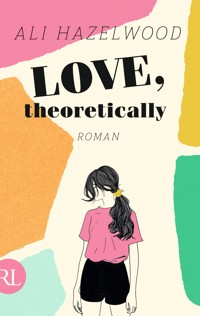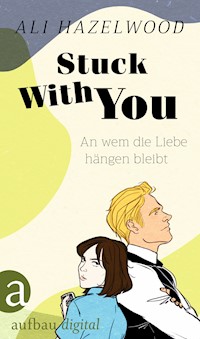12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Hype geht weiter – die neue große Lovestory von Bestsellerautorin Ali Hazelwood.
Für Neurowissenschaftlerin Bee ist die Liebe nur ein neurophysiologischer Zwischenfall, hoffnungslos instabil und der wahre Bösewicht menschlicher Beziehungen, deren neuronale Grundlagen sie erforscht. Als Frau in den Naturwissenschaften ist Bee eine bedrohte Art in einer von Männern beherrschten Welt, in der für sie stets gilt: Was würde Marie Curie tun? Dann wird ihr die Leitung eines neurotechnischen Wunschprojekts angeboten – was Marie Curie sofort annehmen würde. Aber die musste auch nie mit Levi Ward zusammenarbeiten, Bees langjährigem akademischem Erzfeind, der ihren Traum zum Projekt des Grauens macht. Bis Bee sich plötzlich in eine völlig irrational romantische Zwangslage verstrickt findet, in der nur noch zählt: Was wird Bee tun?
“Ali Hazelwood beweist, wie verdammt sexy Wissenschaft ist und dass Liebe an den unwahrscheinlichsten Orten entstehen kann. Meine neueste Must-buy-Autorin.“ Jodie Picoult.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 518
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
Für Neurowissenschaftlerin Bee Königswasser ist die Liebe nur ein schlichter neurophysiologischer Zwischenfall, nicht darauf angelegt, von Dauer zu sein, schon gar nicht ein Leben lang. Und sie muss es wissen, denn sie erforscht die neuronalen Grundlagen menschlichen Verhaltens. Als Frau in den Naturwissenschaften ist Bee eine bedrohte Art in einem von Männern beherrschten Universum. Dann wird ihr die Leitung eines Traumprojekts angeboten – was ihr großes Vorbild Marie Curie gewiss, ohne zu zögern, annehmen würde. Aber die Mutter der modernen Physik hatte auch noch nie mit Levi Ward zu tun, Bees akademischem Erzfeind. Schon bald findet sich Bee in eine völlig irrational emotionale Konstellation verstrickt, die alle Neuronen zum Feuern bringt und unkalkulierbar romantische Ereignisse zur Folge hat …
“Ali Hazelwood beweist, wie verdammt sexy Wissenschaft ist und dass Liebe an den unwahrscheinlichsten Orten entstehen kann. Meine neueste Must-buy-Autorin.“ Jodie Picoult
Über Ali Hazelwood
Ali Hazelwood hat unendlich viel veröffentlicht (falls man all ihre Artikel über Hirnforschung mitzählt, die allerdings niemand außer ein paar Wissenschaftlern kennt und die, leider, oft kein Happy End haben). In Italien geboren, hat Ali in Deutschland und Japan gelebt, bevor sie in die USA ging, um in Neurobiologie zu promovieren. Vor Kurzem wurde sie zur Professorin berufen, was niemanden mehr schockiert als sie selbst. Ihr erster Roman »Die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe« wurde bei TikTok zum Sensationserfolg und ist ein internationaler Bestseller.Mehr unter: www.AliHazelwood.com; Instagram: @AliHazelwood
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Ali Hazelwood
Love on the Brain - Das irrationale Vorkommnis der Liebe
Roman
Aus dem Amerikanischen von Christine Strüh und Anna Julia Strüh
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Kapitel 1: Die Habenula: Hort der Enttäuschung
Kapitel 2: Der Vagusnerv: wo Ohnmacht droht
Kapitel 3: Gyrus angularis: Pass bloß auf!
Kapitel 4: Gyrus parahippocampalis: Quell des Argwohns
Kapitel 5: Die Amygdala: Wut
Kapitel 6: Gyrus temporalis transversus: Hört, hört
Kapitel 7: Orbitofrontalcortex: Hoffnung
Kapitel 8: Gyrus praecentralis: Bewegung
Kapitel 9: Medialer frontaler Cortex: Lag ich etwa falsch?
Kapitel 10: Dorsolateraler präfrontaler Cortex: Wo die Lüge wohnt
Kapitel 11: Nucleus accumbens: Glücksspiel
Kapitel 12: Ventrales Striatum: Sehnsucht
Kapitel 13: Colliculi superiores: Sieh sich das einer an
Kapitel 14: Periaquäduktales Grau & der Hippocampus: schmerzhafte Erinnerungen
Kapitel 15: Fusiformes Areal: vertraute Gesichter
Kapitel 16: Nucleus subthalamicus: Unterbrechungen
Kapitel 17: Pulvinar: greifbar
Kapitel 18: Nuclei Raphes: Glückseligkeit
Kapitel 19: Die basolaterale Amygdala: Arachnophobie
Kapitel 20: Ventrales tegmentales Areal: romantische Liebe
Kapitel 21: Rechter Gyrus frontalis inferior: Aberglaube
Kapitel 22: Anteriorer cingulärer Cortex: Ach du Scheiße
Kapitel 23: Und wieder die Amygdala: Angst
Kapitel 24: Rechter Temporallappen: Aha!
Kapitel 25: Oriens-lacunosum-moleculare Interneuronen: Courage
Epilog
Anmerkung der Autorin
Dank
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
Für meine Gremlins (Anbei: Delphintitten.gif)
Kapitel 1
Die Habenula: Hort der Enttäuschung
Meine absolute Lieblingsbelanglosigkeit: Dr. Marie Skłodowska-Curie erschien zu ihrer eigenen Hochzeit in ihrem Laborkittel.
Eigentlich ist das eine ziemlich coole Geschichte: Ein befreundeter Wissenschaftler machte sie mit Pierre Curie bekannt, die beiden gestanden einander verlegen, dass sie gegenseitig ihre wissenschaftlichen Veröffentlichungen gelesen hatten, flirteten bei ein paar Bechergläsern flüssigem Uranium, und er machte ihr noch im selben Jahr einen Antrag. Doch Marie war nur nach Frankreich gekommen, um ihr Studium zu absolvieren, also lehnte sie schweren Herzens ab und kehrte nach Polen zurück.
Tragisch, oder?
An dieser Stelle hatte die Universität von Krakau, Bösewicht und unbeabsichtigter Amor dieser Geschichte, ihren großen Auftritt, indem sie sich weigerte, Marie eine Stelle zu geben, schlicht und einfach, weil sie eine Frau war (was für eine Glanzleistung, liebe U von K …). Ziemlich arschig, so viel ist klar, aber es hatte den positiven Nebeneffekt, dass Marie zurück in Pierres liebevolle, noch nicht radioaktive Arme trieb. Die beiden wundervollen Nerds heirateten 1895, und Marie, die damals nicht gerade viel verdiente, kaufte sich ein Hochzeitskleid, das bequem genug war, dass sie es jeden Tag im Labor tragen konnte. Bewundernswert pragmatisch, die Frau.
Natürlich wird die Geschichte um einiges weniger cool, wenn man circa zehn Jahre vorspult und erfährt, dass Pierre von einer Kutsche überfahren wurde und Marie und ihre zwei Töchter allein zurückblieben. Man schaue sich das Jahr 1906 genauer an, und da ist schon die Moral von der Geschicht’: Darauf zu vertrauen, dass Leute für immer bei einem bleiben, ist eine ganz schlechte Idee. Auf die eine oder andere Art verlassen sie einen alle. Entweder rutschen sie an einem regnerischen Morgen auf der Rue Dauphine aus und werden von einer Kutsche überrollt. Oder sie werden von Außerirdischen entführt und verschwinden in den unendlichen Weiten des Weltalls. Oder vielleicht haben sie auch sechs Monate vor eurer geplanten Hochzeit Sex mit deiner besten Freundin, so dass du die Hochzeit absagen musst und einen Haufen Geld verlierst.
Der Phantasie sind in diesen Dingen einfach keine Grenzen gesetzt.
Angesichts dessen könnte man wohl sagen, dass die U von K als Bösewicht eine Nebenfigur bleibt. Nur damit ich nicht falsch verstanden werde: Ich liebe die Vorstellung, wie Dr. Curie in ihrem Hochzeitskleid-Schrägstrich-Laborkittel auf Pretty-Woman-Art nach Krakau zurückmarschiert und ihre zwei Nobelpreise in die Höhe reckend schreit: »Großer Fehler. Riesengroßer Fehler.« Doch der wahre Bösewicht, der Marie nächtelang weinend an die Decke starren ließ, ist der Verlust. Die Trauer. Die Vergänglichkeit, die den menschlichen Beziehungen immanent ist. Der wahre Bösewicht ist die Liebe: ein hoffnungslos instabiles Isotop, das sich ständig dem spontanen Kernzerfall hingibt.
Und niemals dafür zur Rechenschaft gezogen wird.
Aber was ist es, auf das man zählen kann? Was Dr. Curie über all die Jahre niemals, aber auch wirklich niemals im Stich gelassen hat? Ihre Neugier. Ihre Entdeckungen. Ihre Leistung.
Die Wissenschaft. Denn auf die Wissenschaft ist Verlass.
Was genau der Grund ist, der mich vor Freude kreischen lässt, als die NASA mich benachrichtigt, dass ich zur Leiterin von BLINK, eines ihrer angesehensten Forschungsprojekte in Sachen Neurotechnik, ausgewählt wurde – ich! Bee Königswasser! Kreischend mache ich Luftsprünge in meinem winzig kleinen, fensterlosen Büro auf dem Campus der National Institutes of Health in Bethesda. Kreischend male ich mir die phantastische Technologie aus, die ich für NASA-Astronauten entwickeln werde. Bis ich mich daran erinnere, wie papierdünn die Wände sind und dass mein linker Nachbar schon mal offiziell Beschwerde gegen mich eingelegt hat, weil ich es gewagt habe, Frauen-Neunziger-Alternative-Rock ohne Kopfhörer zu hören. Also halte ich mir die Hand vor den Mund, beiße hinein und hüpfe so leise wie möglich auf und ab, während mich eine nie gekannte Begeisterung durchflutet.
Ich fühle mich, wie sich Dr. Curie damals gefühlt haben muss, als sie Ende 1891 endlich an der Universität von Paris angenommen wurde: als sei die Welt der (vorzugsweise nicht radioaktiven) wissenschaftlichen Entdeckungen endlich in greifbare Nähe gerückt. Es ist bei Weitem der bedeutendste Tag meines Lebens, der zugleich ein phänomenales Wochenende einleitet. Die Highlights:
Ich erzähl meinen drei Lieblingskolleginnen die große Neuigkeit, wir gehen zur Feier des Tages in unsere übliche Bar, trinken mehrere Runden Lemon Drops und spielen lachend nach, wie uns Trevor, unser hässlicher mittelalter Chef, gebeten hat, uns bloß nicht in ihn zu verlieben. (Männer in der akademischen Welt tendieren dazu, an Größenwahn zu leiden – alle außer Pierre. Pierre hätte so etwas nie getan.)
Ich färbe meine rosa Haare lila. (Zu Hause, denn angehende Akademiker können es sich nicht leisten, zum Friseur zu gehen. Hinterher sieht meine Dusche aus wie eine Mischung aus einer Zuckerwattemaschine und einem Einhorn-Schlachthaus, doch seit dem Waschbär-Vorfall – glaub mir, du willst nicht wissen, was da passiert ist – war ohnehin klar, dass ich die Kaution nicht zurückbekommen werde.
Ich gehe zu Victoria’s Secret und kaufe mir hübsche grüne Unterwäsche, ohne mich wegen der exorbitanten Kosten schlecht zu fühlen (obwohl mich seit Jahren niemand mehr in Unterwäsche gesehen hat und es, wenn es nach mir geht, noch sehr lange dabei bleiben wird).
Ich lade mir den Runter-von-der-Couch-ab-zum-Marathon-Fitnessplan runter, mit dem ich schon ewig anfangen will, und mache meinen ersten Lauf. (Danach humpele ich, meinen Ehrgeiz verfluchend, zurück nach Hause und stufe mich sofort auf ein Runter-von-der-Couch-ab-zu-ganzen-fünf-Kilometern-Programm hinab. Ich kann nicht glauben, dass manche Leute jeden Tag Sport machen.)
Ich backe Leckerlis für Finneas, den betagten Kater meiner betagten Nachbarn, der mich oft besucht, um sich ein zweites Abendessen abzuholen. (Zum Dank zerkratzt er meine Lieblings-Converse. Dr. Curie in ihrer unendlichen Weisheit war wahrscheinlich ein Hundemensch.)
Alles in allem habe ich einen Wahnsinnsspaß. Ich bin nicht einmal traurig, als das Wochenende vorbei ist und ein Montag wie jeder andere folgt – mit Experimenten, Besprechungen, Tiefkühlessen und Dosenlimo an meinem Schreibtisch, während ich endlose Datenberge auswerte –, doch mit der Aussicht auf BLINK fühlt sich selbst Altbekanntes neu und aufregend an.
Ich will ehrlich sein: Vor der Zusage war ich geradezu krank vor Sorge. Nachdem innerhalb von sechs Monaten vier meiner Anträge für Forschungsgelder abgelehnt worden waren, konnte ich mir so gut wie sicher sein, dass meine Karriere stagnierte – womöglich sogar vorbei war. Jedes Mal, wenn mich Trevor in sein Büro rief, bekam ich Herzrasen und Schweißausbrüche aus Angst, er werde mir sagen, dass mein jährlich befristeter Vertrag nicht verlängert würde. Die letzten paar Jahre, seit ich meinen Ph.D. gemacht habe, waren nicht gerade spaßig.
Aber damit ist jetzt Schluss. Bei der NASA zu arbeiten bedeutet einen riesigen Sprung auf der Karriereleiter. Nicht umsonst habe ich mich bei einem erbarmungslosen Auswahlverfahren gegen Goldjungen durchgesetzt wie Josh Martin, Hank Malik und sogar gegen Jan Vanderberg, diesen grässlichen Kerl, der so angestrengt über meine Forschung herzieht, als könne er damit eine olympische Medaille gewinnen. Ich mag Rückschläge erlitten haben, ziemlich viele sogar, aber meine nun schon zwei Jahrzehnte andauernde Besessenheit vom menschlichen Gehirn hat mich endlich an diesen Punkt gebracht: Ich bin Leitende Neurowissenschaftlerin bei BLINK. Ich werde Ausrüstung für Astronauten entwickeln, die ihnen im Weltall von Nutzen sein soll. Das macht es mir möglich, Trevors ebenso klammen wie sexistischen Fängen zu entfliehen. Das ermöglicht mir einen langfristigen Vertrag und mein eigenes Labor mit eigenen Forschungsprojekten. Das bedeutet den Wendepunkt meines Berufslebens – was ehrlich gesagt das einzige Leben ist, das ich mir wünsche.
Die nächsten Tage verbringe ich in einem Zustand purer Ekstase. Ich bin überglücklich. Ich bin überglücklich bis zur Ekstase.
Dann, am Montag um vier Uhr dreiunddreißig nachmittags, bekomme ich eine Mail von der NASA. Ich lese den Namen der Person, die BLINK mit mir zusammen leiten wird, und mit einem Mal bin ich nichts mehr davon.
*
»Erinnerst du dich an Levi Ward?«
»Brennt es irgendwo … hä?« Mareikes Stimme am Telefon ist belegt und schläfrig, vom schlechten Empfang und der großen Entfernung gedämpft. »Bee? Bist du das? Wie spät ist es?«
»Viertel nach acht in Maryland und …« Ich berechne schnell die Zeitdifferenz. Vor ein paar Wochen war Reike in Tadschikistan, aber jetzt ist sie in … war es Portugal? »Zwei Uhr nachts bei dir.«
Reike knurrt, stöhnt und macht eine Menge anderer Geräusche, mit denen ich bestens vertraut bin, weil ich die ersten zwei Jahrzehnte unseres Lebens mit ihr im gleichen Zimmer geschlafen habe. Ich lehne mich auf dem Sofa zurück und warte, bis sie fragt: »Wer ist gestorben?«
»Niemand ist gestorben. Na ja, bestimmt ist irgendjemand gestorben, aber niemand, den wir kennen. Hast du etwa wirklich geschlafen? Bist du krank? Soll ich mich in den nächsten Flieger setzen?« Es macht mir ernsthaft Sorgen, dass meine Schwester nicht durch die Clubs zieht, nackt im Mittelmeer badet oder mit einem Hexenmeisterzirkel in den Wäldern der Iberischen Halbinsel lustwandelt. Nachts zu schlafen ist sehr untypisch für sie.
»Nein. Ich bin nur wieder pleite.« Sie gähnt. »Und muss reichen, verwöhnten portugiesischen Jungs tagsüber Privatunterricht geben, bis ich genug gespart habe, um nach Norwegen zu fliegen.«
Ich mache mir nicht die Mühe zu fragen: »Warum Norwegen?«, weil Reike sowieso nur »Warum nicht?« antworten würde. Stattdessen frage ich: »Soll ich dir was überweisen?« Ich schwimme nicht gerade in Geld, vor allem nicht nach meinen (wie sich leider herausgestellt hat: verfrühten) Feierlichkeiten, aber ich könnte ein paar Dollar entbehren, wenn ich mich etwas zusammenreiße. Und einfach nichts mehr esse. Ein paar Tage lang.
»Nein, danke, die Eltern der Rotzlöffel bezahlen mich gut. Im Ernst, Bee, gestern hat ein Zwölfjähriger versucht, mir an die Brust zu fassen – bäh.«
»Bäh. Was hast du gemacht?«
»Ich hab ihm gesagt, dass ich ihm die Finger abhacke, wenn er nicht sofort damit aufhört – was sonst? Aber egal, wie komme ich zu der Ehre, so grausam aus dem Schlaf gerissen zu werden?«
»Tut mir leid.«
»Nee, tut es nicht.«
Ich lächle. »Nee, tut es nicht.« Wozu teilt man sich hundert Prozent seiner DNA mit einer anderen Person, wenn man sie nicht für ein Notfallgespräch wecken kann? »Erinnerst du dich noch an das Forschungsprojekt, von dem ich dir erzählt habe? BLINK?«
»Das Projekt, das du leiten sollst? Bei der NASA? Wo du deine coole Gehirn-Wissenschaft einsetzt, um diese coolen Helme zu bauen, die coole Astronauten im All benutzen werden?«
»So in etwa. Wie sich herausgestellt hat, soll ich das Projekt nicht allein leiten. Die Gelder kommen von der NASA und den NIH, und sie konnten sich nicht einigen, welche Institution das Sagen haben sollte, weshalb sie beschlossen haben, zwei Leitungspositionen zu besetzen.« Aus dem Augenwinkel sehe ich etwas Orangerotes aufblitzen – Finneas, der auf den Sims meines Küchenfensters springt. Ich lasse ihn herein und kraule ihn am Kopf. Er miaut liebevoll und leckt meine Hand. »Erinnerst du dich an Levi Ward?«
»Ist das irgendein Typ, mit dem ich was hatte und der mich jetzt erreichen will, weil er einen Tripper hat?«
»Hä? Nein. Ich habe ihn während meiner Promotion kennengelernt«, erkläre ich und öffne den Schrank, in dem ich das Katzenfutter aufbewahre. »Er hat seinen Doktor der Ingenieurswissenschaften in demselben Labor wie ich gemacht, war aber schon im fünften Jahr, als ich angefangen habe …«
»Der Ward-Arsch!«
»Genau der!«
»Na klar erinnere ich mich an den! War er nicht … heiß? Groß? Muskulös?«
Ich verkneife mir ein Grinsen und schütte Futter in Finneas’ Schüssel. »Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass du von meinem Erzfeind nur noch die Körpergröße von eins neunzig in Erinnerung behalten hast.« Dr. Marie Curies Schwestern, die hochangesehene Ärztin Bronisława Dłuska und die Bildungsaktivistin Helena Skłodowska, hätten so etwas nie getan. Es sei denn, sie hätten ununterbrochen nach irgendeinem Mann gelechzt wie Reike – in diesem Fall hätten sie es ganz bestimmt doch getan.
»Und muskulös! Du solltest stolz auf mich sein – ich habe ein Gedächtnis wie ein Elefant.«
»Das bin ich. Jedenfalls wurde mir mitgeteilt, wer mein Co-Leiter von der NASA sein wird, und …«
»Echt jetzt?« Anscheinend hat Reike sich aufgesetzt. Auf einmal ist ihre Stimme viel klarer. »Echt jetzt?!«
»Ja, echt jetzt.« Während ich die leere Katzenfutterdose wegwerfe, muss ich mir das irre, schadenfrohe Gelächter meiner Schwester anhören. »Hör mal, du könntest wenigstens so tun, als würde dich das nicht mordsmäßig freuen.«
»O ja, das könnte ich. Aber werde ich das auch?«
»Offenbar nicht.«
»Hast du geheult, als du es herausgefunden hast?«
»Nein.«
»Hast du den Kopf auf deinen Schreibtisch gehauen?«
»Nein.«
»Lüg mich nicht an. Hast du nicht eine Beule auf der Stirn?«
»… vielleicht eine klitzekleine.«
»O Bee. Vielen Dank, dass du mich geweckt hast, um diese köstliche Neuigkeit mit mir zu teilen. Hat der Ward-Arsch dir nicht mal gesagt, du wärst potthässlich?«
Hat er nicht, zumindest nicht mit diesen Worten, aber ich muss so laut lachen, dass Finneas erschrocken zu mir aufsieht. »Ich fasse es nicht, dass du dich daran erinnerst.«
»Hey, dafür habe ich ihn gehasst. Immerhin bist du verdammt heiß.«
»Das sagst du nur, weil ich genauso aussehe wie du.«
»Ach ja? Ist mir noch gar nicht aufgefallen.«
Eigentlich entspricht es auch nicht ganz der Wahrheit. Ja, Reike und ich sind beide klein und schlank. Wir haben dieselben symmetrischen Gesichtszüge und dieselben blauen Augen, dieselben glatten dunklen Haare. Doch wir sind unserer Ein-Zwilling-kommt-selten-allein-Phase längst entwachsen, und mit achtundzwanzig kann uns wirklich jeder problemlos auseinanderhalten. Schließlich färbe ich mir seit Jahren die Haare in verschiedenen Pastelltönen, und ich liebe Piercings – und das eine oder andere Tattoo. Mit ihrer Wanderlust und ihren künstlerischen Neigungen ist Reike zwar der Freigeist der Familie, aber auf den Modestil eines Freigeists hat sie keine Lust. Da komme ich, die angeblich langweilige Wissenschaftlerin, ins Spiel.
»Also, war er es, der mich indirekt beleidigt hat?«
»Jepp. Levi Ward. Der einzig Wahre.«
Ich gieße Wasser für Finneas in eine Schüssel. Eigentlich stimmt das auch nicht ganz. Levi hat mich nie explizit beleidigt. Implizit allerdings …
Im zweiten Semester meines Promotionsstudiums hielt ich meinen ersten großen Vortrag, was ich sehr ernst nahm. Ich lernte den Text komplett auswendig, machte die PowerPoint-Präsentation nicht weniger als sechs Mal neu und zerbrach mir stundenlang den Kopf, was das perfekte Outfit wäre. Letztlich zog ich mich deutlich schicker an als sonst, und Annie, meine beste Freundin im Studium, hatte die gut gemeinte, aber unglückliche Idee, Levi dazu zu bringen, mir ein Kompliment zu machen.
»Sieht Bee heute nicht ganz besonders hübsch aus?«
Wahrscheinlich war es das einzige Gesprächsthema, das ihr in den Sinn kam, denn sie redete ständig darüber, wie unheimlich gut aussehend er sei, mit seinen dunklen Haaren und den breiten Schultern und diesem markanten, ungewöhnlichen Gesicht – und wie sehr sie sich wünschte, er würde aufhören, so verdammt zurückhaltend zu sein, und sie um ein Date bitten. Dummerweise schien Levi nicht an einem Gespräch interessiert zu sein. Er musterte mich mit seinen stechend grünen Augen. Einen langen Moment starrte er mich einfach nur an. Und dann sagte er …
Nichts. Rein gar nichts.
Er machte nur ein, wie Tim, mein Ex-Verlobter, es später nannte, »entgeistertes Gesicht« und verließ das Labor mit einem steifen Nicken – und nicht dem geringsten Kompliment, noch nicht einmal einem aufgesetzten oder erlogenen. Danach nahmen die Dinge an der Uni – der ultimativen Gerüchte-Jauchegrube – ihren Lauf, und die Geschichte entwickelte ein Eigenleben. Bald erzählten die Studenten sich, er hätte mein Kleid vollgekotzt; er hätte mich angefleht, mir eine Papiertüte über den Kopf zu ziehen; er wäre so verstört gewesen, dass er Bleichmittel getrunken hätte, um sein Gehirn zu reinigen, und neurologische Schäden davongetragen. Ich bin niemand, der sich selbst besonders ernst nimmt, und ein Meme zu sein war anfangs sogar ganz amüsant, aber irgendwann wurden die Gerüchte so mies, dass ich mich fragen musste, ob ich wirklich so abstoßend bin.
Und dennoch habe ich Levi deswegen nie Vorwürfe gemacht. Ich war nie wütend auf ihn, weil er sich weigerte, so zu tun, als fände er mich anziehend. Oder … na ja, zumindest nicht abstoßend. Denn er wirkte auf mich schon immer wie ein Bild von einem Mann. Anders als die Jungs in meinem Umfeld. Ernst, diszipliniert, ein bisschen grüblerisch vielleicht. Strebsam und ausgesprochen talentiert. Folglich dürfte ein Mädchen mit einem Septum-Piercing und blauen Haaren nicht unbedingt seiner Vorstellung von einer schönen Frau entsprechen. Was ich voll und ganz akzeptieren kann.
Was ich Levi allerdings sehr wohl übel nehme, ist sein Verhalten in dem Jahr, in dem wir gemeinsame Kurse hatten. Etwa dass er mich nie direkt angesehen hat oder dass er immer irgendeinen Vorwand hatte, nicht zum Journal Club zu erscheinen, wenn ich eines meiner Themen vorstellte. Und so nehme ich mir das Recht heraus, wütend zu sein, weil er sich aus Gruppengesprächen ausklinkte, sobald ich auftauchte, weil er nicht einmal Hallo sagte, wenn ich ins Labor kam, oder weil er mich ständig mit grimmigem, missbilligendem Blick anstarrte, als wäre ich ein Ungeheuer. Und ich nehme mir das Recht heraus, mich gekränkt zu fühlen, weil er Tim nach unserer Verlobung beiseitenahm und ihm sagte, er hätte etwas viel Besseres verdient als mich. Also wirklich, wer macht denn so was?
Vor allem aber nehme ich mir das Recht heraus, ihn dafür zu hassen, dass er so überaus deutlich gemacht hat, wie wenig er von mir als Wissenschaftlerin hält. Alles andere hätte ich ihm vielleicht noch nachsehen können, aber der fehlende Respekt für meine Arbeit – dafür werde ich auf ewig meine Axt schärfen.
Bis ich sie ihm irgendwann zwischen die Beine ramme.
Zu meinem ewigen Erzfeind wurde Levi dann an einem Dienstag im April, im Büro meiner Betreuerin. Samantha Lee war – und ist immer noch – einsame Spitze in allem, was neurologische Bildgebung angeht. Wenn es eine Möglichkeit gibt, ein lebendes menschliches Gehirn in Augenschein zu nehmen, ohne den Schädel aufzubrechen, hat Sam sie entweder entdeckt oder zumindest perfektioniert. Ihre Neuroimaging-Forschung ist brillant, sehr solide finanziert und höchst interdisziplinär ausgerichtet – weshalb sie auch so viele Studenten aus verschiedenen Fachbereichen betreut: kognitive Neurowissenschaftler wie mich, die sich für die neuronalen Grundlagen menschlichen Verhaltens interessieren, ebenso wie Informatiker, Biologen, Psychologen oder Ingenieure.
Selbst im überfüllten Chaos von Sams Labor stach Levi hervor. Er hatte ein Händchen für eben jene Art der Problemlösung, die Neuroimaging zu einer wahren Kunstform erhebt. In seinem ersten Jahr gelang es ihm, ein tragbares Infrarot-Spektroskop zu bauen – was Postdocs seit einem Jahrzehnt Kopfschmerzen bereitet hatte. Bis zum dritten Jahr hatte er die Datenanalyse des Labors revolutioniert. Im vierten wurde seine Arbeit in der weltweit wichtigsten Fachzeitschrift Science veröffentlicht. Und in seinem fünften Jahr, als ich zu dem Laborteam stieß, rief Sam uns beide in ihr Büro.
»Es gibt da dieses großartige Projekt, das ich unbedingt auf den Weg bringen möchte«, sagte sie mit ihrem üblichen Enthusiasmus. »Wenn wir das hinbekommen, wird es das gesamte Spektrum des Studienfelds verändern. Und deswegen brauche ich dafür meine beste Neurowissenschaftlerin und meinen besten Ingenieur in Gemeinschaftsarbeit.«
Es war ein milder, frühlingshafter Nachmittag. Daran erinnere ich mich gut, denn schon der Morgen war unvergesslich gewesen: Tim war mitten im Labor vor mir auf die Knie gegangen und hatte mir einen Antrag gemacht. Ein bisschen theatralisch, was nicht wirklich mein Ding ist, aber ich hatte nicht vor, mich zu beschweren, wenn das hieß, dass jemand sein Leben lang bei mir bleiben wollte. Also sah ich ihm in die Augen, hielt die Tränen zurück und sagte Ja.
Ein paar Stunden später ballte ich die Fäuste so fest, dass sich der Verlobungsring schmerzhaft in meine Hand bohrte. »Ich habe keine Zeit für diese Zusammenarbeit, Sam«, sagte Levi. Er stand so weit von mir weg wie möglich, und dennoch schaffte er es irgendwie, das kleine Büro vollständig einzunehmen und zu seinem Gravitationszentrum zu werden. Mich würdigte er keines Blickes. Das tat er nie.
Sam runzelte die Stirn. »Neulich hast du gesagt, du wärst mit an Bord.«
»Ich habe mich geirrt.« Sein Gesichtsausdruck war undurchschaubar. Kompromisslos. »Tut mir leid, Sam. Ich habe einfach zu viel zu tun.«
Ich räusperte mich und trat ein paar Schritte auf ihn zu. »Ich weiß, ich bin nur eine Studentin im ersten Jahr«, begann ich in beschwichtigendem Ton, »aber ich werde meinen Beitrag leisten, versprochen. Und …«
»Darum geht es nicht«, unterbrach er mich. Flüchtig schaute er mir in die Augen, und einen kurzen Moment schien es, als könne er nicht wegsehen. Mein Herz setzte einen Schlag aus. »Wie ich schon sagte, ich habe im Moment keine Zeit, ein neues Projekt anzufangen.«
Ich weiß nicht mehr, warum ich das Büro allein verließ oder warum ich noch einen Moment davor verharrte. Ich versuchte mir einzureden, alles sei schon in Ordnung und Levi einfach zu beschäftigt. Hier waren alle sehr beschäftigt. Die akademische Welt war nichts als ein Haufen sehr beschäftigter Leute, die sehr beschäftigt herumrannten. Und ich war selbst sehr beschäftigt, denn Sam hatte recht: Was Neurowissenschaft anging, gehörte ich im Labor definitiv zu den Besten. Ich hatte genug eigene Arbeit, um mich davon nicht unterkriegen zu lassen.
Bis ich Sam besorgt fragen hörte: »Warum hast du deine Meinung geändert? Du hast doch selbst gesagt, das Projekt sei einfach der Hammer.«
»Ich weiß. Aber ich kann nicht. Tut mir leid.«
»Was kannst du nicht?«
»Mit Bee zusammenarbeiten.«
Sam fragte, warum, aber ich hörte nicht mehr zu. Jeder einzelne Schritt einer wissenschaftlichen Laufbahn erfordert einen gewissen Masochismus, aber die Grenze des Akzeptablen ist für mich erreicht, wenn mich jemand vor meiner Chefin schlechtmacht. Ich stürmte davon. Als ich dann eine Woche später Annie glücklich darüber plaudern hörte, dass Levi zugestimmt habe, ihr bei ihrem Dissertationsprojekt zu helfen, hatte ich längst aufgehört, mich selbst zu belügen.
Levi Ward, Seine Wardheit, Dr. Ward-Arsch, verachtete mich.
Mich.
Mich persönlich.
Ja, er war ein wortkarger, grimmiger, grüblerischer Berg von einem Mann. Er legte viel Wert auf Privatsphäre, war sehr introvertiert. Zurückhaltend und unnahbar. Ich konnte nicht von ihm verlangen, dass er mich mochte, und hatte das auch keinesfalls vor. Doch wenn er sich allen anderen gegenüber höflich, anständig und sogar freundlich benahm, hätte er das mir gegenüber wenigstens auch versuchen können. Aber nein – Levi Ward verachtete mich ganz eindeutig, und angesichts eines solchen Hasses …
Tja, da hatte ich doch keine andere Wahl, als ihn auch zu hassen.
»Bist du noch da?«, fragt Reike.
»Ja«, murmele ich, »ich hab nur über das Thema Levi nachgegrübelt.«
»Er ist bei der NASA, oder? Darf ich hoffen, dass er auf den Mars geschickt wird, um diesen ollen Rover Curiosity zurückzuholen?«
»Leider nicht, bevor er mein Projekt mit mir geleitet hat.« In den letzten Jahren, während meine Karriere nach Luft schnappte wie ein Nilpferd mit Schlafapnoe, war Levi ausgesprochen erfolgreich – auf wirklich nervtötende Art. Er hat eine Reihe interessanter Studien veröffentlicht, einen riesigen Etat vom Verteidigungsministerium bekommen und es laut einer Mail, die Sam an alle weiterleitete, sogar auf die 10-unter-40-Liste der Wissenschaftsedition von Forbes geschafft. Der einzige Grund, warum ich seine Erfolge bislang ertragen konnte, ohne mich in mein Schwert zu stürzen, ist, dass sich seine Forschung immer weiter vom Neuroimaging entfernt hat. Dadurch sind wir keine direkten Konkurrenten, und ich konnte einfach … nie an ihn denken. Ein exzellenter Lifehack, der ausgezeichnet funktioniert hat – bis heute.
Ganz ehrlich, scheiß auf heute.
»Ich genieße dieses Schauspiel wirklich ungemein, aber ich werde mir Mühe geben, aufrichtiges Mitgefühl zu zeigen. Wie sehr beunruhigt es dich, mit ihm zusammenzuarbeiten, auf einer Skala von eins bis heftig in eine Papiertüte keuchen?«
Ich schütte den Rest von Finneas’ Wasser in einen Blumentopf »Ich denke, mit jemandem zusammenarbeiten zu müssen, der mich für eine beschissene Wissenschaftlerin hält, rechtfertigt mindestens zwei Inhalatoren.«
»Du bist großartig. Du bist die beste Wissenschaftlerin überhaupt.«
»Aw, danke.« Dass für Reike auch Astrologie und Kristalltherapie unter den Begriff »Wissenschaft« fallen, schmälert das Kompliment nur geringfügig. »Die Zusammenarbeit mit ihm wird grauenhaft werden. Schlimmer geht’s nicht. Wenn er auch nur annähernd so ist wie früher, werde ich … Reike, pinkelst du?«
Eine Pause, erfüllt vom Geräusch fließenden Wassers. »… vielleicht. Hey, du bist diejenige, die mich und meine Blase geweckt hat. Bitte, erzähl weiter.«
Ich schüttle lächelnd den Kopf. »Wenn er noch so ist wie früher, wird es ein Alptraum werden. Außerdem werden wir in seinem Revier sein.«
»Ach ja, weil du nach Houston ziehst.«
»Für drei Monate. Meine wissenschaftliche Mitarbeiterin und ich fahren nächste Woche.«
»Ich bin so neidisch. Ich sitze wer weiß wie lange in Portugal fest und werde von kleinen Möchtegern-Narzissten à la Joffrey Baratheon begrapscht, die sich weigern zu lernen, was ein Konjunktiv ist. Ich gehe ein, Bee.«
Es erstaunt mich immer wieder, wie unterschiedlich Reike und ich damit umgehen, dass wir als Kinder durch die Welt geschleudert wurden wie Gummibälle, sowohl vor als auch nach dem Tod unserer Eltern, von einem entfernten Verwandten zum nächsten. Wir haben in einem Dutzend verschiedener Länder gelebt, und alles, was Reike will, ist … in noch mehr Ländern leben. Reisen, neue Orte kennenlernen, neue Erfahrungen machen. Die Sehnsucht nach Veränderung ist in ihr Gehirn einprogrammiert. Sie hat ihre Sachen gepackt, sobald wir unseren Highschool-Abschluss hatten, bahnt sich seit zehn Jahren ihren Weg über die Kontinente und langweilt sich nach einer Handvoll Wochen am selben Ort.
Ich bin das genaue Gegenteil. Ich will Wurzeln schlagen. Sicherheit. Stabilität. Und ich dachte, mit Tim würde ich genau das bekommen, aber wie ich schon sagte: sich auf andere zu verlassen ist riskant. Beständigkeit und Liebe sind eindeutig inkompatibel, also konzentriere ich mich jetzt auf meine Karriere. Ich will eine unbefristete Stelle als NIH-Wissenschaftlerin, und BLINK ist das perfekte Sprungbrett.
»Weißt du, was mir gerade klar geworden ist?«
»Du hast vergessen zu spülen?«
»Nachts kann ich nicht spülen – diese europäischen Rohre sind zu laut. Wenn ich jetzt spüle, hinterlässt mir mein Nachbar morgen einen Haufen passiv-aggressive Nachrichten. Aber hör zu: Vor drei Jahren, als ich den Sommer über in Australien Wassermelonen ernten war, habe ich einen Typen aus Houston getroffen. Er war total witzig. Und ziemlich süß. Bestimmt hab ich seine Mailadresse irgendwo und könnte ihn fragen, ob er noch Single …«
»Nein.«
»Er hatte echt hübsche Augen. Und er konnte seine Nasenspitze mit der Zunge berühren – das können nur etwa zehn Prozent der gesamten Menschheit.«
Ich mache mir eine mentale Notiz, bei nächster Gelegenheit nachzuschauen, ob das stimmt. »Ich bin dort, um zu arbeiten, nicht, um deinen Zungenakrobaten zu daten.«
»Du könntest beides tun.«
»Ich date nicht.«
»Warum?«
»Du weißt, warum.«
»Nein, nicht wirklich.« Reikes Stimme nimmt ihren üblichen sturen Ton an. »Hör mal, ich weiß, dass dein letztes Date …«
»Ich war verlobt.«
»Läuft doch aufs Gleiche hinaus. Mag sein, dass es damals nicht gut lief« – ich ziehe eine Augenbraue hoch bei dem euphemistischsten Euphemismus, den ich je gehört habe –, »deshalb willst du dich jetzt sicher fühlen und deine emotionalen Grenzen hüten, aber das darf dich nicht davon abhalten, irgendwann wieder zu daten. Du solltest nicht all deine Eier in den Wissenschaftskorb legen. Schließlich gibt es noch andere, bessere Körbe, zum Beispiel den Sex-Korb und den Rummach-Korb und den Einen-Mann-für-dein-teures-veganes-Essen-bezahlen-lassen-Korb und …« Finneas wählt genau diesen Moment, um sehr laut zu miauen. Gesegnet sei sein perfektes Timing. »Bee! Hast du dir endlich das Kätzchen besorgt, von dem du schon so lange redest?«
»Nein, das ist der Nachbarskater.« Ich beuge mich vor, um ihn zu knuddeln – ein stilles Dankeschön dafür, dass er meine Schwester mitten in ihrer Predigt unterbrochen hat.
»Wenn du nicht mit dem Zungenakrobaten ausgehen willst, hol dir wenigstens eine verdammte Katze. Du hättest doch sogar schon diesen dämlichen Namen.«
»Miaurie Curie ist ein großartiger Name – und nein.«
»Das ist dein Kindheitstraum! Weißt du noch, als wir in Österreich waren? Wie wir Harry Potter gespielt haben und dein Patronus immer eine kleine Katze war?«
»Und deiner war ein Blobfisch.« Die Erinnerung bringt mich zum Grinsen. Wir haben die Bücher zusammen auf Deutsch gelesen, kurz bevor wir nach Großbritannien zu unserer Cousine mütterlicherseits gezogen sind, die nicht gerade begeistert war, dass wir in ihrem winzigen Gästezimmer wohnten. Bäh, ich hasse Umziehen. Es macht mich traurig, mein objektiv beschissenes, aber dennoch innig geliebtes Apartment in Bethesda verlassen zu müssen. »Egal, Harry Potter ist für immer verdorben, und ich hole mir keine Katze.«
»Warum?«
»Weil Katzen jüngsten Studien zufolge nach dreizehn bis siebzehn Jahren sterben, worauf mein Herz in dreizehn bis siebzehn Stücke zerbrechen würde.«
»Um Himmels willen.«
»Ich bleibe lieber dabei, anderer Leute Katzen zu lieben und nie zu wissen, wann sie sterben.«
Ein Poltern am anderen Ende der Leitung – wahrscheinlich hat sich Reike auf ihr Bett geschmissen. »Weißt du, wie man deine Störung nennt?«
»Ich habe keine Störung, das haben wir doch schon …«
»… Bindungsverweigerung. Du bist krankhaft unabhängig und lässt niemanden an dich heran aus Angst, er könnte dich irgendwann verlassen. Du hast eine Mauer um dich errichtet und fürchtest dich vor allem, was mit emotionaler …« Reikes Worte gehen in ein herzhaftes Gähnen über, und mich durchströmt eine tiefe Zuneigung. Auch wenn es zu ihren Lieblingsbeschäftigungen gehört, meine Persönlichkeitsmerkmale bei Netdoktor einzugeben und mich mit imaginären Störungen zu diagnostizieren.
»Geh ins Bett, Reike. Ich melde mich bald wieder.«
»Okay.« Noch ein kleines Gähnen. »Aber ich habe recht, Bee. Und du hast unrecht.«
»Natürlich. Gute Nacht, Süße.«
Ich lege auf und streichle Finneas noch ein paar Minuten. Als er in die frische Abendbrise davonhuscht, fange ich an zu packen. Beim Zusammenlegen meiner Jeans und farbenfrohen Tops stoße ich auf etwas, das mir schon lange nicht mehr untergekommen ist: ein Kleid mit gelben Punkten in demselben Blau wie Dr. Curies Hochzeitskleid. Target, Frühlingskollektion, vor circa fünf Millionen Jahren. Nur zwölf Dollar. Es war dieses Kleid, das ich getragen habe, als Levi entschieden hat, dass ich nur ein empfindungsfähiger Hallux valgus bin, die widerwärtigste Schöpfung der Natur.
Ich zucke die Achseln und stopfe es in meinen Koffer.
Kapitel 2
Der Vagusnerv: wo Ohnmacht droht
»Übrigens kann man von Gürteltieren Lepra kriegen.«
Ich reiße mich vom Flugzeugfenster los und werfe Rocío, meiner wissenschaftlichen Mitarbeiterin, einen skeptischen Blick zu. »Wirklich?«
»Jepp. Sie haben es vor Tausenden Jahren von Menschen bekommen, und jetzt geben sie es uns zurück«, erklärt sie achselzuckend. »Rache ist süß.«
Ich suche in ihrem schönen Gesicht nach Hinweisen, dass sie lügt. Ihre großen, dunklen, kräftig mit Eyeliner umrandeten Augen sind unergründlich. Ihr Haar ist so schwarz, dass es 99 Prozent des sichtbaren Lichts absorbiert. Ihre vollen Lippen sind wie üblich zu einem launigen Schmollen verzogen.
Nein. Nichts zu entdecken. »Ist das wirklich wahr?«
»Würde ich dich je anlügen?«
»Letzte Woche hast du mir erzählt, Stephen King würde ein Spin-off von Pu der Bär schreiben.« Und ich habe ihr geglaubt. Ebenso wie ich ihr auch geglaubt habe, dass Lady Gaga eine bekannte Satanistin ist oder dass Badmintonschläger aus menschlichen Knochen und Gedärmen hergestellt werden. Düstere Gothic-Misanthropie und grusliger, todernster Sarkasmus sind ihre Markenzeichen, und ich sollte inzwischen gelernt haben, ihre Behauptungen nicht ernst zu nehmen. Das Problem ist nur, dass sie hin und wieder eine völlig verrückt klingende Geschichte einwirft, die sich bei genauerer Untersuchung (d. h. Google-Suche) als wahr herausstellt. Wer hätte etwa geahnt, dass The Texas Chain Saw Massacre auf einer wahren Geschichte basiert? Vor Rocío hatte ich davon keine Ahnung. Und ich habe um einiges besser geschlafen.
»Dann glaub mir eben nicht«, sagt sie gleichgültig und widmet sich wieder dem Buch, mit dem sie sich auf die Aufnahmeprüfung zum Promotionsstudium vorbereitet. »Streichle ruhig die leprakranken Gürteltiere und stirb.«
Sie hat so einen Knall. Ich liebe sie.
»Hey, bist du sicher, dass es okay für dich ist, Alex für ein paar Monate zu verlassen?« Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich sie von ihrem Freund fernhalte. Wenn jemand von mir verlangt hätte, mich monatelang von Tim zu trennen, als ich zweiundzwanzig war, wäre ich ins Wasser gegangen. Allerdings hat sich rückblickend ohne jeden Zweifel gezeigt, dass ich eine Vollidiotin war, und Rocío scheint sich über die Gelegenheit zur Distanz eher zu freuen. Sie will sich im Herbst für das Neurowissenschaften-Programm an der Johns Hopkins University bewerben, und die NASA in ihrem Lebenslauf zu haben wird dabei garantiert nicht schaden. Sie hat mich sogar umarmt, als ich ihr angeboten habe mitzukommen – ein Moment der Schwäche, den sie gewiss längst bereut hat.
»Echt jetzt? Machst du Witze?« Sie sieht mich an, als hätte ich den Verstand verloren. »Drei Monate in Texas – hast du eine Ahnung, wie oft ich La Llorona sehen werde?«
»La… was?«
Sie verdreht die Augen und steckt sich ihre Kopfhörer in die Ohren. »Du hast wirklich nicht die geringste Ahnung von berühmten feministischen Geistern.«
Ich verkneife mir ein Lächeln und wende mich wieder zum Fenster. 1905 beschloss Dr. Curie, mithilfe ihres Nobelpreisgelds ihre erste wissenschaftliche Mitarbeiterin einzustellen. Ob sie wohl auch mit einem leicht furchterregenden, Cthulhu anbetenden Emo-Mädchen zusammengearbeitet hat? Ich starre die Wolken an, bis mir langweilig wird, dann hole ich mein Handy aus der Tasche und verbinde mich mit dem Bord-WLAN. Mit einem raschen Blick vergewissere ich mich, dass Rocío mich nicht beachtet, und drehe das Display von ihr weg.
Eigentlich bin ich kein sonderlich geheimnisvoller Mensch, hauptsächlich aus Faulheit: Es schiene mir Verschwendung kognitiver Energien, den Überblick über all die Lügen und Halbwahrheiten zu behalten. Doch es gibt ein einziges großes Geheimnis, das ich hüte. Eine Information, die ich nie mit jemandem geteilt habe – nicht einmal mit meiner Schwester. Nur damit ich nicht falsch verstanden werde, ich würde Reike mein Leben anvertrauen, doch zugleich kenne ich sie gut genug, um mir die Szene genau vorstellen zu können: Sie trägt ein leichtes Sommerkleid und flirtet mit einem schottischen Schafhirten, den sie in einer Trattoria an der Amalfiküste kennengelernt hat. Die beiden beschließen, eben jene halluzinogenen Pilze zu nehmen, die sie bei einem belarussischen Bauern gekauft haben, und im Drogenrausch plaudert meine Schwester aus, was ich ihr streng verboten habe, jemals jemandem zu erzählen: Ihre Zwillingsschwester Bee hat einen der bekanntesten, kontroversesten akademischen Twitter-Accounts. Dummerweise ist der Cousin des schottischen Hirten ein verkappter Aktivist für Männerrechte, der mir ein totes Opossum schickt, mich bei seinen durchgeknallten Freunden verpetzt, worauf ich gefeuert werde.
Nein, danke. Dafür liebe ich meinen Job (und Opossums) zu sehr.
Die Idee zu @WhatWouldMarieDo, »Was würde Marie tun«, entstand in meinem ersten Semester als Doktorandin. Zu der Zeit unterrichtete ich einen Neuroanatomiekurs und beschloss, meine Studenten in einer anonymen Umfrage um ehrliches Feedback zu bitten, wie ich den Kurs verbessern könnte. Was ich bekam, war … etwas ganz anderes. Mir wurde geraten, dass meine Vorlesungen deutlich besser wären, wenn ich sie nackt halten würde. Dass ich zunehmen, mir die Brüste vergrößern, meine Haare nicht so »unnatürlich« färben und die Piercings rausmachen solle. Ich erhielt sogar eine Telefonnummer, die ich anrufen sollte, wenn ich je »Lust auf einen riesigen Schwanz« hätte (na klar …).
Die Nachrichten selbst waren grässlich genug, aber um mich so weit zu bringen, dass ich mir in einer Klokabine die Augen ausheulte, bedurfte es erst noch der Reaktion meiner Kollegen – einschließlich Tims. Sie taten die Kommentare als harmlose Späße ab und rieten mir davon ab, sie der Fakultätsleitung zu melden, weil ich angeblich zu viel Lärm um nichts machen würde.
Natürlich waren sie alle Männer.
(Im Erst: Warum sind Männer so?)
In jener Nacht weinte ich mich in den Schlaf. Am Tag darauf stand ich auf, überlegte, wie viele andere Frauen in MINT-Fächern sich genauso allein fühlen mussten wie ich, meldete mich spontan bei Twitter an und rief @WhatWouldMarieDo ins Leben. Zu guter Letzt stellte ich noch ein schlecht gephotoshopptes Bild von Dr. Curie mit Sonnenbrille als Avatar ein und schrieb eine einzeilige Bio: Mache das Periodensystem seit 1889 mädchenhafter (she/her). Ich musste einfach alles in die digitale Leere hinausschreien. Ehrlich, ich hätte nie gedacht, dass überhaupt jemand meinen ersten Tweet sieht. Aber da irrte ich.
@WhatWouldMarieDo Was würde Dr. Curie, die erste Professorin an der Sorbonne, tun, wenn sie einer ihrer Studenten auffordern würde, nackt zu unterrichten?
@198 888 Sie würde sein armseliges Leben beenden.
@annahhhh IHN BEI PIERRE VERPFEIFEN!!!
@emily89 Polonium auf seine Hose schütten und zusehen, wie sein Penis verkümmert
@bioworm55 ihn atomisieren IHN ATOMISIEREN
@lucyinthesea Ist dir das passiert? O Gott, das tut mir so leid. Mir hat einmal ein Student etwas sehr Widerliches über meinen Hintern gesagt, aber niemand hat mir geglaubt.
Über fünf Jahre später, nach einer Handvoll positiver Erwähnungen in der Chronicle of Higher Education, einem Artikel in der New York Times und etwa einer Million Follower ist WWMD mein Wohlfühlort. Und das Beste daran ist, dass ich glaube, vielen anderen geht es genauso. Der Account hat sich zu einer Art therapeutischer Community entwickelt, in der Frauen in MINT-Fächern ihre Geschichten erzählen, Ratschläge austauschen und … sich auskotzen.
Oh, und wie wir uns auskotzen. Wir kotzen uns ständig aus, und das ist herrlich.
@BiologySarah Hey, @WhatWouldMarieDo Was würde Marie tun, wenn sie nicht als Urheberin des Projekts genannt werden würde, das ihre Idee war und an dem sie über ein Jahr gearbeitet hat? Alle anderen Autoren sind – NATÜRLICH – Männer.
»Ach du Scheiße.« Ich verziehe das Gesicht und schreibe Sarah zurück.
Marie würde ihnen eine Portion Radium in den Kaffee geben. Außerdem würde sie erwägen, es der Fachstelle für Forschungsintegrität ihres Instituts zu melden, wobei sie dafür Sorge tragen würde, jeden Schritt des Verfahrens genauestens zu dokumentieren
Ich drücke auf Senden, trommle mit den Fingern auf die Armlehne und warte. Meine Antworten sind alles andere als die Hauptattraktion des Accounts. Der echte Grund, warum Leute sich an WWMD wenden, ist …
Jepp. Genau das. Ein Grinsen breitet sich auf meinem Gesicht aus, als immer mehr Antworten eintrudeln.
@DrAllixx Das ist mir auch passiert. Ich war die einzige Frau und die einzige POC im Autoren-Line-up, und während der Korrektur ist auf einmal mein Name verschwunden. Schreib mich gern an, wenn du reden willst, Sarah.
@AmyBernard Ich bin Mitglied der Women in Science Association, und wir haben auf unserer Website Ratschläge für solche Fälle (leider ist so etwas gang und gäbe).
@TheGeologician Mache gerade das Gleiche durch @BiologySarah Ich habe es der zuständigen Stelle gemeldet, und die Untersuchung läuft, aber wir können gern reden, wenn du Dampf ablassen musst.
@SteveHarrison Newsflash: Du machst dir was vor, Mädel. Deine Beiträge sind nicht QUALIFIZIERT genug, deshalb wirst du nicht als Autor genannt. Dein Team hat dir den Gefallen getan, dich eine Weile mitmachen zu lassen, aber wenn du nicht schlau genug bist, bist du RAUS. Nicht alles dreht sich darum, dass du eine Frau bist, manchmal bist du einfach ein LOSER
Es ist eine allgemein anerkannte Wahrheit, dass eine Gruppe von Frauen, die sich um nichts anderes als ihre Angelegenheiten kümmern wollen, dringend der Meinung irgendeines dahergelaufenen Mannes bedarf.
Ich habe schon längst gelernt, dass es nie eine gute Idee ist, sich auf eine Diskussion mit einem im Keller seiner Eltern hausenden Troll einzulassen – das Letzte, was ich will, ist, ihrem fragilen Ego einen kostenlosen Zeitvertreib zu bieten. Wenn sie sich abreagieren wollen, können sie sich im Fitnesscenter anmelden oder einen ultraharten Shooter zocken. Was normale Menschen eben so tun.
Ich will @SteveHarrisons Beitrag gerade ausblenden, als ich sehe, dass ihm jemand geantwortet hat.
@Shmacademics Ja, Marie, manchmal bist du einfach ein Loser. Damit kennt sich Steve aus.
Ich kichere leise.
@WhatWouldMarieDo Aw, Steve. Sei nicht so hart zu dir.
@Shmacademics Er ist nur ein Junge, dem angesichts einer Frau nichts anderes einfällt, als zu verlangen, dass sie doppelt so viel arbeitet wie er, um es wert zu sein, in der Wissenschaft mitzumischen.
@WhatWouldMarieDo Steve, du alter Romantiker.
@SteveHarrison Fickt euch. Dieser lächerliche Trend, mehr Frauen zuzulassen, ruiniert die Wissenschaft. Man sollte einen Job kriegen, weil man gut darin ist, nicht WEIL MAN EINE VAGINA HAT. Aber jetzt haben alle das Gefühl, dass sie Frauen einstellen müssen, und die kriegen Jobs, für die Männer einfach BESSER GEEIGNET wären. Das ist das Ende der Wissenschaft, UND DAS IST FALSCH.
@WhatWouldMarieDo Ich kann sehen, dass dir das zu schaffen macht, Steve.
@Shmacademics Eine Runde Mitleid.
Steve blockt uns beide, und ich muss lachen, womit ich mir einen neugierigen Blick von Rocío zuziehe. @Shmacademics ist ein anderer sehr bekannter akademischer Twitter-Account und mit Abstand mein Favorit. Er postet hauptsächlich darüber, dass er eigentlich schreiben statt forschen sollte, macht sich über elitäre und weltfremde Akademiker im Elfenbeinturm lustig und weist immer wieder auf schlechte oder von Vorurteilen geprägte Forschung hin. Anfangs war ich ihm gegenüber ein bisschen misstrauisch – in seiner Bio steht »he/him«, und wir wissen alle, wie die meisten Cis-Männer im Internet drauf sind. Aber mit der Zeit sind wir eine Art Allianz eingegangen. Wenn die Trolle sich allein bei der Vorstellung von Frauen in der Wissenschaft angegriffen fühlen und bei meinen Tweets und Antworten die Mistgabeln schwingen, hilft er mir, sie ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. Ich bin mir nicht sicher, wann wir angefangen haben, uns zu schreiben; wann ich keine Angst mehr hatte, er könne ein ehemaliger Gamergater auf Doxxing-Entzug sein, nur darauf aus, meine persönlichen Daten rauszufinden und sie online zu veröffentlichen, oder wann ich angefangen habe, ihn als echten Freund zu sehen. Aber hier sind wir nun ein paar Jahre später und plaudern etwa ein halbes Dutzend Mal die Woche über Gott und die Welt, ohne auch nur unsere richtigen Namen zu kennen. Ist es seltsam zu wissen, dass Shmac in der zweiten Klasse dreimal Läuse hatte, aber keine Ahnung zu haben, in welcher Zeitzone er lebt? Ein bisschen. Aber es ist auch befreiend. Außerdem birgt es durchaus Risiken, online eine Meinung zu vertreten. Das Internet ist ein Meer voller creepy cyberkrimineller Fische, und wenn Mark Zuckerberg seine Webcam mit Tape zukleben kann, behalte ich mir das Recht vor, bis zum bitteren Ende anonym zu bleiben.
Der Flugbegleiter bietet mir ein Glas Wasser an. Ich schüttele lächelnd den Kopf und sende Shmac eine Direktnachricht.
Marie: Ich glaube, Steve will nicht mehr mit uns spielen.
Shmac: Ich glaube, Steve wurde als Kaulquappe nicht oft genug umarmt.
Marie: Lol!
Shmac: Wie läuft’s bei dir?
Marie: Gut! Fange nächste Woche ein cooles neues Projekt an. Mein Ticket, endlich von meinem schuftigen Chef wegzukommen.
Shmac: Ich fasse es nicht, dass der Typ immer noch da ist.
Marie: Die Macht der Beziehungen. Und der Trägheit. Wie läuft’s bei dir?
Shmac: Die Arbeit ist interessant.
Marie: Gut interessant?
Shmac: Politisch interessant. Also: nein.
Marie: Ich hab Angst zu fragen. Wie ist alles andere?
Shmac: Eigenartig.
Marie: Hat deine Katze wieder in deinen Schuh gekackt?
Shmac: Nein, aber ich hab neulich eine Tomate in meinem Schuh gefunden.
Marie: Schick mir nächstes Mal ein Bild! Sonst gibt’s nichts Neues?
Shmac: Eigentlich nicht.
Marie: Ach komm, hau’s raus!
Shmac: Woher willst du überhaupt wissen, dass es was Neues gibt?
Marie: Die fehlenden Ausrufezeichen!
Shmac:!!!!!!11!!!1!!!!
Marie: Shmac.
Shmac: Nur zur Info: Ich seufze tief.
Marie: Dachte ich mir. Jetzt erzähl schon!
Shmac: Es geht um eine Frau.
Marie: Ooooh! Erzähl mir ALLES!!!!!!11!!!1!!!!
Shmac: Da gibt es nicht viel zu erzählen.
Marie: Hast du sie gerade erst kennengelernt?
Shmac: Nein, ich kenne sie schon lange, aber jetzt ist sie wieder zurück.
Shmac: Und sie ist verheiratet.
Marie: Mit dir?
Shmac: Leider nicht.
Shmac: Sorry, wir räumen das Labor um. Muss los, bevor jmd ein 5 Mil teures Gerät zerstört. Bis später!
Marie: Okay, aber dann will ich alles über deine Affäre mit einer verheirateten Frau hören.
Shmac: Schön wär’s.
Es tut gut zu wissen, dass Shmac immer nur einen Klick entfernt ist, besonders jetzt, da ich in Ward-Arschs eisiges, feindliches Revier fliege.
Ich wechsle zu meiner Mail-App, um zu sehen, ob Levi endlich auf die Nachricht geantwortet hat, die ich ihm vor drei Tagen geschickt habe. Es waren nur ein paar Zeilen – Hey, lange nicht gesehen, ich freue mich darauf, wieder mit Dir zusammenzuarbeiten, wollen wir uns am Wochenende treffen und über BLINK reden? –, aber anscheinend war er zu beschäftigt, um zu antworten. Oder er hält mich einer Antwort nicht für würdig. Oder beides.
Ich lehne mich zurück, schließe die Augen und überlege, wie Dr. Curie wohl mit Levi Ward umgehen würde. Wahrscheinlich würde sie radioaktive Isotope in seinen Taschen verstecken, sich Popcorn besorgen und zusehen, wie der Kernzerfall seine Magie entfaltet.
Jepp, das klingt ganz nach ihr.
Wenig später schlafe ich ein und träume, dass Levi zum Teil ein Gürteltier ist: Seine Haut leuchtet blassgrün, und er gräbt mit einem schweineteuren Gerät eine Tomate aus seinem Stiefel. Bei alldem ist das Seltsamste an ihm, dass er endlich nett zu mir ist.
*
Wir wohnen in einem kleinen, möblierten Apartment in einem Gebäude direkt neben dem Johnson Space Center, nur ein paar Minuten vom Sullivan Discovery Building entfernt, wo wir arbeiten werden. Kaum zu glauben, wie kurz mein Weg zur Arbeit ist.
»Und trotzdem wirst du es schaffen, ständig zu spät zu kommen«, sagt Rocío, und ich werfe ihr einen bösen Blick zu, während ich die Tür aufschließe. Es ist nicht meine Schuld, dass ich einen Großteil meiner prägenden Jahre in Italien verbracht habe, wo der Begriff der Zeit nichts anderes ist als ein höflicher Vorschlag.
Das Apartment ist um einiges schöner als meine Mietwohnung – vielleicht wegen des Waschbär-Vorfalls, aber wahrscheinlich eher, weil ich die meisten meiner Möbel in der Schnäppchen-Abteilung von IKEA gekauft habe. Hier gibt es einen Balkon, eine Spülmaschine und – was meine Lebensqualität auf ein ganz neues Level hebt – eine Toilette, die zuverlässig spült, wenn ich den Knopf drücke. Wirklich bahnbrechend. Aufgeregt öffne und schließe ich jeden Schrank (sie sind alle leer; ich weiß nicht, was ich erwartet habe), mache Bilder, um sie Reike und meinen Kollegen zu schicken, klebe meinen Lieblings-Marie-Curie-Magneten an den Kühlschrank (ein Bild von ihr mit einem Becherglas, auf dem steht: I’m pretty rad. Wobei »rad« nicht nur »toll« meint, sondern natürlich auch die Kurzform von »radioaktiv«), hänge meinen Futterspender für Kolibris auf den Balkon, und dann …
Es ist erst halb drei. Mist.
Nicht, dass ich einer dieser Menschen wäre, die nichts mit freier Zeit anzufangen wüssten. Ich könnte mühelos fünf Stunden am Tag Nickerchen machen, eine ganze Staffel The Office gucken und erdbeerige Twizzlers lutschen oder zu Stufe 2 meines Von-der-Couch-hoch-Plans übergehen, an den ich mich immer noch strikt – okay, relativ strikt – halte. Aber ich bin hier! In Houston! In der Nähe des Space Center! Und ich werde ganz bald mit dem coolsten Projekt meines Lebens anfangen!
Es ist Freitag, und ich muss eigentlich erst am Montag vor Ort sein, aber ich sprudle vor nervöser Energie geradezu über. Also schreibe ich Rocío und frage, ob sie das Space Center mit mir auschecken will (Nein) oder mit mir essen gehen will (Ich esse nur Tierkadaver.).
Sie ist so gemein. Ich liebe sie.
Mein erster Eindruck von Houston ist: groß. Dicht gefolgt von: schwül. In Maryland liegen immer noch Überreste von Schnee, aber das Space Center ist schon von üppigem Grün umgeben, ein Mix aus Freiflächen, gigantischen Gebäuden und alten NASA-Fluggeräten zum Bestaunen. Es kommen viele Familien zu Besuch, wodurch es ein bisschen wie ein Vergnügungspark wirkt. Ich kann nicht glauben, dass ich die nächsten drei Monate auf dem Weg zur Arbeit Raketen sehen werde. Viel besser als der perverse Wärter auf dem Campus der NIH.
Das Discovery Building befindet sich im Außenbereich des Zentrums. Es ist weitläufig, drei Stockwerke hoch und sehr futuristisch, mit Glaswänden und einem komplizierten Treppensystem, das ich nicht ganz durchschaue. Als ich das Marmorfoyer betrete, frage ich mich unwillkürlich, ob mein neues Büro wohl Fenster haben wird. Ich bin kein natürliches Licht gewohnt, die plötzliche Zufuhr von Vitamin D könnte mich womöglich töten.
»Ich bin Bee Königswasser«, sage ich lächelnd zum Rezeptionisten. »Ich fange am Montag hier an, und ich habe mich gefragt, ob ich mich schon mal umsehen könnte?«
Er lächelt mich entschuldigend an. »Ich darf Sie nicht reinlassen, wenn Sie noch keinen Mitarbeiterausweis haben. Die Techniklabore oben sind Hochsicherheitsbereiche.«
Ach ja. Natürlich. Die Techniklabore. Levis Labore. Wahrscheinlich ist er dort oben und arbeitet fleißig. Macht seinen Technikkram. Seinen Laborkram. Und antwortet nicht auf meine Mails.
»Kein Problem, das ist verständlich. Ich werde einfach …«
»Dr. Königswasser? Bee?«
Als ich mich umdrehe, sehe ich einen blonden jungen Mann vor mir. Er ist auf eine nicht bedrohliche Art attraktiv, mittelgroß, und er lächelt mich an, als wären wir alte Freunde, obwohl er mir nicht bekannt vorkommt. »… hi?«
»Ich wollte nicht lauschen, aber ich habe deinen Namen aufgeschnappt und … Ich bin Guy. Guy Kowalsky.«
Bei dem Namen macht es sofort klick. Ein Grinsen breitet sich auf meinem Gesicht aus. »Guy! Wie schön, dich zu treffen.« Als ich die Zusage für BLINK bekam, war Guy mein Ansprechpartner für logistische Fragen, und wir haben einige Mails ausgetauscht. Er ist Astronaut – ein echter Astronaut! – und arbeitet an BLINK, solange er auf der Erde ist. Er war so vertraut mit dem Projekt, dass ich anfangs dachte, er wäre derjenige, der es mit mir leiten würde.
Jetzt begrüßt er mich mit einem warmen Händedruck. »Ich liebe deine Arbeit! Ich habe alle deine Artikel gelesen – du bist ein großer Gewinn für das Projekt.«
»Das kann ich nur zurückgeben. Ich freue mich schon sehr auf unsere Zusammenarbeit.«
Wenn ich vom Flug nicht so dehydriert wäre, würden mir wahrscheinlich die Tränen kommen. Ich fasse es nicht, dass dieser Mann, dieser nette, sympathische Mann, mit dem ich in einer Minute mehr positive Interaktionen hatte als mit Dr. Ward-Arsch in einem Jahr, mein Co-Leiter hätte sein können. Ich muss irgendeinen Gott verärgert haben. Zeus? Eros? Vermutlich Poseidon. Ich hätte in meiner wilden Jugend nicht in die Ostsee pinkeln sollen …
»Wie wär’s, wenn ich dich herumführe? Als mein Gast darfst du rein.« Er nickt dem Rezeptionisten zu und bedeutet mir, ihm zu folgen.
»Ich will dich nicht von … von der Astronautenarbeit abhalten.«
»Ich hab gerade Pause zwischen zwei Missionen. Dir eine Tour zu geben ist viel besser als den ganzen Tag Fehlersuchprogramme laufen zu lassen«, erklärt er mit einem Schulterzucken, und ich kann nicht übersehen, wie jungenhaft charmant er ist. Wir werden uns wunderbar verstehen, das weiß ich schon jetzt.
»Wohnst du schon lange in Houston?«, frage ich, als wir den Aufzug betreten.
»Etwa acht Jahre. Ich bin direkt nach der Promotion zur NASA gekommen. Hab mich für das Astronaut Corps beworben, das Training absolviert und hatte gleich meine erste Mission.« Ich stelle im Kopf ein paar Berechnungen an. Dann müsste er Mitte dreißig sein, älter, als ich auf den ersten Blick gedacht hätte. »Die letzten zwei Jahre habe ich am Vorgänger von BLINK gearbeitet. Die Struktur des Helms entwickelt, das drahtlose System ausgetüftelt. Aber wir sind an einen Punkt gelangt, an dem wir einen Experten für Neurostimulation brauchten.« Er schenkt mir ein warmes Lächeln.
»Ich kann es kaum erwarten herauszufinden, was wir uns zusammen ausdenken werden.« Und ich kann es auch kaum erwarten herauszufinden, warum die Leitung des Projekts Levi überlassen wurde und nicht jemandem mit jahrelanger Erfahrung. Das erscheint mir unfair. Sowohl Guy als auch mir gegenüber.
Die Aufzugtür öffnet sich, und er deutet auf ein gemütlich aussehendes Café in der Ecke. »Siehst du das Café dort drüben – tolle Sandwiches, der schlechteste Kaffee der Welt. Hunger?«
»Nein, danke.«
»Bist du sicher? Ich lade dich ein. Die Eier-Sandwiches sind fast so gut, wie der Kaffee schlecht ist.«
»Ich esse keine Eier.«
»Lass mich raten: Veganerin?«
Ich nicke. Weil ich die Klischees, mit denen man meine Leute gern quält, nicht bedienen möchte, vermeide ich nach Möglichkeit in den ersten drei Minuten eines Treffens das Wort »vegan«, aber wenn mein Gegenüber davon anfängt, gibt es kein Halten mehr.
»Ich sollte dich meiner Tochter vorstellen. Sie hat neulich verkündet, dass sie keine tierischen Produkte mehr essen will.« Er seufzt. »Letztes Wochenende habe ich ihr normale Milch ins Müsli gegossen, weil ich dachte, sie würde den Unterschied nicht merken, daraufhin hat sie mich informiert, ihr Anwalt werde mit mir Kontakt aufnehmen.«
»Wie alt ist sie?«
»Gerade sechs geworden.«
Ich lache. »Viel Glück!«
Ich habe mit sieben aufgehört, Fleisch zu essen, als mir klar wurde, dass zwischen den köstlichen Pollo-Nuggets, die es fast jeden Tag bei meiner sizilianischen Großmutter gab, und den süßen Galline, die auf der Farm herumliefen, eine erheblich engere … Beziehung bestand, als von mir zunächst angenommen. Ein schockierender Plot-Twist, ich weiß. Reike war nicht annähernd so entsetzt wie ich: Als ich fieberhaft erklärte, dass »Schweine auch Familien haben – eine Mutter und einen Vater und Geschwister, die sie vermissen – «, nickte sie nur nachdenklich und sagte: »Du meinst, wir sollten lieber die ganze Familie essen?« Ein paar Jahre später lebte ich vollständig vegan. Derweil hat meine Schwester es sich zum Lebensziel gemacht, genügend Tierprodukte für zwei zu essen. Zusammen hinterlassen wir den CO2-Fußabdruck einer normalen Person.
»Die Techniklabore sind den Flur runter«, sagt Guy. Das Gebäude ist ein interessanter Mix aus Glas und Holz, und man kann in manche der Räume hineinsehen. »Ein bisschen chaotisch, und die meisten Leute haben heute frei – wir räumen um. Wir haben viele laufende Projekte, aber BLINK ist jedermanns Liebling. Die anderen Astronauten schauen hin und wieder vorbei, um zu fragen, wie lange es noch dauern wird, bis ihre schicke Ausrüstung fertig ist.«
Ich grinse. »Wirklich?«
»Ja.«
Schicke Ausrüstung für Astronauten herzustellen ist quasi meine Jobbeschreibung. Ich könnte es in mein LinkedIn-Profil aufnehmen. Nicht, dass irgendjemand LinkedIn benutzt.
»Die neurowissenschaftlichen Labore – deine Labore – werden hier rechts sein. Dort hinten sind …« Sein Handy klingelt. »Sorry – da muss ich rangehen. Ich hoffe, es stört dich nicht?«
»Nein, überhaupt nicht.« Mit einem Lächeln nehme ich seine Biber-Handyhülle zur Kenntnis (ein Ingenieur der Natur) und wende mich ab.
Wird Guy mich wohl für bescheuert halten, wenn ich für meine Freunde ein paar Fotos im Gebäude mache? Ich beschließe, dass ich damit leben kann, doch als ich mein Handy heraushole, höre ich ein Geräusch vom anderen Ende des Flurs. Es klingt sanft und munter wie eine …
»Miau.«
Ich sehe zu Guy. Er erklärt gerade einer sehr jungen Person, wie man Vaiana im Fernseher zum Laufen bringt, also beschließe ich, dem Geräusch nachzugehen. Die meisten Räume sind verlassen, Labore voller großer Geräte undurchschaubarer Funktion, die aussehen, als gehören sie … na ja, zur NASA. Von irgendwoher sind Männerstimmen zu hören, doch keine Spur von der …
»Miau.«
Ich drehe mich um. Ein paar Meter entfernt sitzt eine wunderschöne, junge dreifarbige Kalikokatze und starrt mich mit neugierigem Blick an.
»Und wer bist du denn?« Ich strecke langsam die Hand aus. Das Kätzchen kommt näher, schnüffelt an meinen Fingern und gibt meiner Hand zur Begrüßung einen Kopfstoß.
Ich lache. »Was bist du für ein süßes Mädchen«, sage ich lächelnd und gehe in die Hocke, um sie unter dem Kinn zu kraulen. Sie knabbert ganz sanft an meinem Finger – eine spielerische Zuneigungsbekundung. »Bist du nicht ein perfekter kleiner Schnurr-ke? Was hab ich doch für ein Glück, eine Glückskatze wie dich zu treffen.«
Sie wirft mir einen verächtlichen Blick zu und wendet sich ab. Ich glaube, sie versteht schlechte Wortspiele.
»Komm schon, sei nicht böse, ich erkenne meinen Feller!« Noch ein böser Blick. Dann springt sie auf einen riesigen Rollwagen in der Nähe, auf dem sich Kisten und schwere, gefährlich aussehende Gerätschaften türmen. »Wo willst du hin?«
Ich kneife die Augen zusammen und versuche herauszufinden, wohin sie verschwunden ist, und da dämmert es mir. Die gefährlich aussehenden Gerätschaften? Sie sind tatsächlich gefährlich, weil nämlich die Katze sie gerade fest genug angestupst hat, um sie aus dem Gleichgewicht zu bringen. Und das Zeug gerade dabei ist, mir auf den Kopf zu fallen.
Genau …
Jetzt.
Ich habe nur einen Sekundenbruchteil, um mich in Sicherheit zu bringen. Was zu schade ist, denn mein Körper ist plötzlich wie versteinert und reagiert nicht auf die Befehle meines Gehirns. Starr vor Angst stehe ich da und schließe die Augen, während mir ein wildes Durcheinander von Gedanken durch den Kopf schießt. Geht es der Katze gut? Werde ich sterben? O Gott, ich werde sterben. Von einem Amboss erschlagen wie Wile E. Coyote, der ewige Antagonist des Roadrunners. Ich bin der Pierre Curie des 21. Jahrhunderts, dessen Schädel von einer anderen Art der Kutsche zertrümmert wird. Nur habe ich leider keine leitende Position in der Physikalischen Fakultät der Universität von Paris, die ich meiner geliebten Ehefrau Marie überlassen könnte. Und ich habe nicht einmal ein Zehntel der wissenschaftlichen Entdeckungen gemacht, die ich machen wollte. Ich wollte doch noch so viel erleben und habe nie, o Gott gleich werde ich …
Etwas prallt mit voller Wucht gegen mich und schubst mich gegen die Wand.
Alles ist Schmerz.
Ein paar Sekunden lang. Dann ist der Schmerz vorbei, und alles ist Lärm: ein lautes Krachen, entsetztes Geschrei, ein schrilles »Miau« irgendwo in der Ferne, und näher an meinem Ohr … keucht jemand. Wenige Zentimeter von mir entfernt.
Nach Atem ringend öffne ich die Augen und …
Grün.
Alles, was ich sehe, ist Grün. Nicht dunkel, wie das Gras draußen; nicht matt wie die Pistazien, die ich auf dem Flug gegessen habe. Dieses Grün ist hell, stechend, intensiv. Vertraut, aber schwer zuzuordnen wie …
Augen.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: